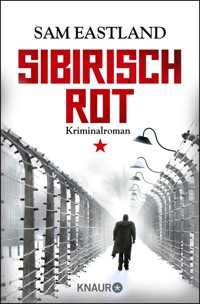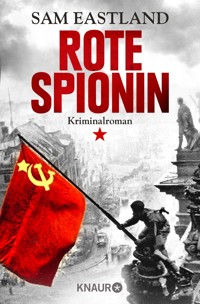6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Inspektor-Pekkala-Serie
- Sprache: Deutsch
Moskau 1939: Oberst Nagorski ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Der Ingenieur war für Stalins wichtigstes Projekt verantwortlich – den neuen, hochgeheimen Panzer T-34, von Spöttern auch »der rote Sarg« genannt. Der Diktator glaubt an Sabotage und vermutet, dass die »Weiße Gilde« Nagorski ermordet hat. Sonderermittler Pekkala erhält den Auftrag, die Verschwörer aufzuspüren – eine lebensgefährliche Mission. Denn niemand weiß, ob es die Gruppe überhaupt gibt. Der Krimi "Der rote Sarg" ist Band 2 der Inspektor-Pekkala-Serie von Sam Eastland!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Sam Eastland
Der rote Sarg
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Karl-Heinz Ebnet
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Moskau 1939: Oberst Nagorski ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Der Ingenieur war für Stalins wichtigstes Projekt verantwortlich – den neuen, hoch geheimen Panzer F 34, von Spöttern auch »der rote Sarg« genannt. Der Diktator glaubt an Sabotage und vermutet, dass die »Weiße Gilde« Nagorski ermordet hat. Sonderermittler Pekkala erhält den Auftrag, die Verschwörer aufzuspüren – eine lebensgefährliche Mission. Denn niemand weiß, ob es die Gruppe überhaupt gibt …
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Auf der Motorradbrille blitzte das Sonnenlicht, als der Fahrer den Hügelkamm erreichte. Er trug zum Schutz gegen die ersten kühlen Frühlingstage einen zweireihigen Ledermantel und eine unter dem Kinn geschnürte Lederhaube.
Seit drei Tagen war er unterwegs. Er hatte nur zum Tanken angehalten, die Satteltaschen waren voll mit Konservendosen, die er als Proviant mitgenommen hatte.
Er übernachtete nicht in den Städten, sondern schob das Motorrad zwischen die Bäume. Es war eine neue Maschine, eine Zündapp K500 mit Pressstahlrahmen und doppelt gefederter Pressstahlvordergabel. Normalerweise hätte er sich so ein Motorrad nie leisten können, aber allein diese Reise würde mehr als genug einbringen. Daran dachte er, als er allein im Wald saß und kalte Suppe aus der Dose löffelte.
Bevor er das Motorrad mit ein paar abgebrochenen Ästen tarnte, wischte er den Staub vom gefederten Ledersitz und dem großen, tropfenförmigen Tank. Er spuckte auf jeden Kratzer, den er entdeckte, und polierte ihn mit dem Ärmel blank.
Er schlief auf dem nackten Boden, eingewickelt in eine Wachstuchdecke, und gönnte sich kein Feuer, noch nicht einmal eine Zigarette. Der Rauch hätte ihn verraten können; ein Risiko, das er nicht eingehen durfte.
Manchmal wurde er vom Dröhnen polnischer Armeelaster geweckt, die auf der Straße vorbeifuhren. Keiner hielt an. Einmal hörte er ein Knacken zwischen den Bäumen. Er zog seinen Revolver aus dem Mantel und setzte sich auf. Ein Hirsch zog nur wenige Meter an ihm vorüber, kaum sichtbar, als wäre ein Schatten zum Leben erwacht. Die restliche Nacht schreckte er immer wieder hoch. Kindheitsalpträume mit geweihtragenden Menschengestalten plagten ihn. Er wollte nur noch raus aus diesem Land. Seit dem Überschreiten der deutsch-polnischen Grenze hatte er Angst – auch wenn das keinem, der ihn gesehen hätte, aufgefallen wäre. Er war nicht zum ersten Mal auf einer solchen Reise; er wusste aus Erfahrung, dass die Angst ihn nicht mehr verlassen würde, bis er wieder zu Hause war.
Am dritten Tag überquerte er die Grenze zur Sowjetunion. Er hatte sich einen abgelegenen Kontrollpunkt gesucht, bewacht von einem polnischen und einem russischen Soldaten, von denen keiner die Sprache des anderen verstand. Beide bewunderten sein Motorrad. »Zündapp«, hauchten beide, als würden sie den Namen ihrer Geliebten aussprechen. Er musste schwer an sich halten, als sie mit den Händen über den chromverkleideten Tank strichen.
Wenige Minuten nach dem Grenzposten fuhr er an den Straßenrand und schob die Brille auf die Stirn; dort, wo sich der Staub der Straße nicht festgesetzt hatte, wurden zwei blasse Hautmonde sichtbar. Er beschattete die Augen und ließ den Blick über die hügelige Landschaft schweifen. Die Felder waren gepflügt und geeggt, Roggen- und Gerstensamen schlummerten in der Erde. Dünne Rauchfäden stiegen aus den Kaminen einsamer Bauernkaten, auf deren schiefergedeckten Dächern leuchtend grünes Moos wuchs.
Kurz fragte er sich, was die Bewohner tun würden, falls sie wüssten, dass es mit ihrem gewohnten Leben bald vorbei sein würde. Aber selbst wenn sie es wüssten, sagte er sich, würden sie wahrscheinlich weitermachen wie bisher und weiterhin an Wunder glauben. Deshalb, dachte er, hatten sie nichts anderes verdient, als ausgelöscht zu werden. Die vor ihm liegende Aufgabe markierte einen weiteren Schritt hin zu diesem Ziel. Nach dem heutigen Tag würde es nicht mehr aufzuhalten sein. Er wischte die Fingerabdrücke der Grenzposten von den Handgriffen und fuhr weiter.
Es war nicht mehr weit bis zum Treffpunkt. Er fuhr auf einsamen Straßen, durch Nebelschwaden, die sich in die Senken kauerten wie Tintenschlieren in Wasser. Er sang Texte von nur halb erinnerten Liedern vor sich hin. Ansonsten blieb er stumm, als wäre er ganz allein auf der Welt. Unterwegs in einem unbewohnten Land – genauso fühlte er sich.
Endlich erreichte er den gesuchten Ort. Ein verlassenes Bauernhaus, dessen Dach durchhing wie der Rücken eines alten Gauls. Er bog von der Straße ab und fuhr durch einen Durchlass in der Steinmauer, die den Hof umgab. Überwachsene Bäume standen um das Haus, an den dicken Stämmen rankte sich Efeu. Ein Krähenschwarm stob von den Ästen auf, geisterhafte Silhouetten, die sich in den Pfützen auf dem Hof spiegelten.
Stille legte sich über ihn, als er den Motor abstellte. Er zog die Handschuhe aus und kratzte sich die getrockneten Schlammspritzer vom Kinn, darunter kamen eine Woche alte Bartstoppel zum Vorschein.
Vermoderte Fensterläden hingen schief an den Rahmen, die Tür war eingetreten und lag auf dem Boden. Löwenzahn wuchs aus den Ritzen der Holzdielen.
Er stellte die Zündapp auf den Ständer, zog die Waffe und trat vorsichtig ins Haus. Den Revolver zu Boden gerichtet, ging er über die knarrenden Bretter. Graues Licht fiel durch die Spalten der Fensterläden. Zwei drachenköpfige Feuerböcke starrten ihn aus dem offenen Kamin an.
»Da sind Sie ja«, erklang eine Stimme.
Der Zündapp-Fahrer zuckte zusammen, ließ aber die Waffe gesenkt. Reglos starrte er in die Schatten. Dann entdeckte er einen Mann, der an einem Tisch im Raum nebenan saß, der ehemaligen Küche. Der Fremde lächelte und winkte ihm langsam, bedächtig zu. »Schönes Motorrad«, sagte er.
Der Fahrer steckte seinen Revolver weg und trat in die Küche.
»Sehr pünktlich«, sagte der andere. Vor ihm auf dem Tisch lag eine Tokarew-Automatikpistole, dazu zwei kleine Metallbecher, nicht größer als Eierschalen. Daneben stand eine ungeöffnete Flasche mit georgischem Tschatscha-Wodka. Ein zweiter Stuhl war an die gegenüberliegende Tischseite gestellt, damit der Fahrer Platz nehmen konnte. »Wie war die Fahrt?«, fragte der andere.
»Haben Sie alles?«, wollte der Fahrer wissen.
»Natürlich.« Der andere griff in seinen Mantel und zog ein zusammengerolltes Dokumentenbündel heraus. Klatschend ließ er es auf den Tisch fallen. Von der verdreckten Oberfläche stieg Staub auf.
»Das ist alles?«, fragte der Fahrer.
Beruhigend patschte der andere auf das Bündel. »Vollständige schematische Darstellung des gesamten Konstantin-Projekts.«
Der Zündapp-Fahrer stellte einen Fuß auf den Stuhl und rollte das Hosenbein hoch. An der Wade war mit Klebeband ein Lederumschlag befestigt. Er löste das Klebeband und fluchte leise, als die Haare am Bein mit abgezogen wurden. Dann holte er einen Stoß Geldscheine aus dem Umschlag und legte ihn auf den Tisch. »Zählen Sie es«, sagte er.
Der andere gehorchte; seine Fingerspitzen flogen über die Scheine.
Irgendwo über ihnen auf den Dachsparren trillerten Stare und klackten mit den Schnäbeln.
Nachdem der andere zu Ende gezählt hatte, füllte er die kleinen Becher mit Wodka und prostete dem Fahrer zu. »Im Namen der Weißen Gilde möchte ich Ihnen danken. Auf die Gilde und den Untergang des Kommunismus!«
Der Fahrer rührte den Becher nicht an. »Das war’s?«, fragte er.
»Ja!« Der Mann kippte seinen Wodka, nahm den zweiten Becher, prostete dem Fahrer nochmals zu und leerte auch diesen Becher. »Ich würde sagen, das war’s!«
Der Fahrer nahm die Dokumente, schob sich das Bündel in die Innentasche des Mantels und sah sich um. Er betrachtete die Baldachine aus Spinnweben, die runzeligen Tapeten, die Risse, die wie Wachstumslinien eines Schädels die Decke überzogen. Bald bist du wieder daheim, dachte er. Dann kannst du das alles vergessen.
»Zigarette gefällig?«, fragte der andere. Er legte ein Zigarettenetui auf den Tisch und darauf ein Metallfeuerzeug.
»Das nächste Mal vielleicht.« Der andere lächelte.
Der Fahrer drehte sich um und wollte zu seinem Motorrad zurück.
Weiter als drei Schritte kam er nicht. Der andere griff sich die Tokarew, visierte, ohne sich zu erheben, mit ausgestrecktem Arm den Fahrer an und schoss ihm in den Hinterkopf. Das Geschoss durchschlug den Schädel und riss einen Teil der Stirn heraus. Der Fahrer sackte wie eine Marionette, deren Fäden man gekappt hatte, zu Boden.
Der andere stand nun auf, ging um den Tisch herum und drehte mit dem Stiefel den Toten um. Dann beugte er sich nach unten und zog die Dokumente aus der Innentasche des Mantels.
»Dann trinkst du eben jetzt, Faschistenschwein«, sagte er. Er holte die Wodkaflasche und schüttete den Inhalt über Kopf, Schultern und Beine des Fahrers. Als sie leer war, schleuderte er sie gegen die Wand. Das schwere Glas zerbrach nicht.
Der Mann verstaute das Geld und die Dokumente in seiner Tasche, nahm die Pistole, die kleinen Becher und die Zigarettenschachtel. Auf dem Weg nach draußen fuhr er mit dem Daumen über das kleine Metallrädchen des Feuerzeugs, die Flamme sprang aus dem Docht, und er ließ das Feuerzeug auf den Toten fallen. Mit dem Geräusch eines im Wind schlagenden Vorhangs fing der Alkohol Feuer.
Der Mann ging hinaus in den Hof, trat an das Motorrad und strich mit den Fingerspitzen über den Zündapp-Namenszug auf dem Tank. Dann saß er auf, löste Haube und Brille vom Lenker, stülpte sich die Haube über und legte die Brille an. An der Lederpolsterung der Brille war noch die Körperwärme des Toten zu spüren. Er startete die Maschine, fuhr zur Straße hinaus, und die Zündapp surrte, während er durch die Gänge schaltete.
Schon kurz darauf erhob sich hinter ihm aus den lodernden Trümmern des Bauernhofs eine dichte Rauchwolke.
Offiziell hatte das in einer stillen Seitenstraße des Bolotnia-Platzes in Moskau gelegene Borodino-Restaurant geöffnet. Inoffiziell wurde jeder, der durch die mit Efeumuster verzierte Milchglastür kam, vom Besitzer und Oberkellner, einem hageren Mann namens Tschitscherin, streng beäugt und dann entweder zu einem Tisch oder durch einen schmalen, unbeleuchteten Gang geleitet, der, wie der betreffende Gast mutmaßen musste, zu einem zweiten Speiseraum führte. Die Tür aber ging direkt hinaus in eine kleine Gasse neben dem Restaurant. Bis der Gast merkte, wie ihm geschah, war die Tür hinter ihm schon wieder sicher verriegelt. Und falls der Gast etwas schwer von Begriff war und meinte, es ein zweites Mal probieren zu müssen, bekam er es mit dem Barmann zu tun, einem ehemaligen griechischen Ringer namens Niarchos, der ihn dann auf etwas direktere Art des Lokals verwies.
An einem trüben Märznachmittag, an dem sich noch die schwarzen Schneereste an die sonnenlosen Ecken der Stadt klammerten, betrat ein junger Mann in Uniform das Restaurant. Er war groß, hatte ein schmales Gesicht, rosige Wangen und einen Blick, der stete Neugier ausstrahlte. Seine maßgeschneiderte Gymnastiorka schmiegte sich an die Schultern und die Taille. Dazu trug er blaue Uniformhosen mit roten Lampassen sowie kniehohe, frisch gewienerte schwarze Stiefel.
Tschitscherin suchte die Uniform nach Rangabzeichen ab. Alles unterhalb eines Hauptmanns würde durch den Gang zur Zaubergrotte geführt werden, wie Tschitscherin es nannte. Dieser junge Mann hatte nicht nur keinen Dienstgrad, er trug noch nicht einmal ein Abzeichen, das Auskunft über seine Truppengattung gegeben hätte.
Trotz seines Widerwillens begrüßte Tschitscherin ihn mit einem Lächeln und einem »Guten Tag« und senkte leicht den Kopf, ohne den jungen Mann aus den Augen zu lassen.
»Guten Tag auch«, kam die Erwiderung. Der Mann sah sich zwischen den vollbesetzten Tischen um und bewunderte augenscheinlich das Essen auf den Tellern. »Ah«, seufzte er. »Schaschlik.« Er deutete auf einen Teller, auf dem bereits lockerer weißer Reis zu sehen war und auf den nun ein Kellner gegrilltes Lammfleisch, Zwiebeln und grüne Paprika gab, nachdem er alles vorsichtig vom Spieß gelöst hatte. »War das Lamm in Rotwein eingelegt?«, fragte er und schnupperte dem Essensdunst hinterher. »Oder ist das Granatapfelsaft?«
Tschitscherin musterte ihn durch schmale Augen. »Sie wollen einen Tisch?«
Der junge Mann schien ihn gar nicht zu hören. »Und dort …« Er zeigte auf einen weiteren Tisch. »Lachs mit Dill und Meerrettichsauce.«
»Ja, stimmt.« Tschitscherin nahm ihn sanft am Arm und lotste ihn zum Gang. »Hier entlang, bitte.«
»Hier?« Der junge Mann blinzelte in den dunklen Korridor.
»Jaja«, beruhigte ihn Tschitscherin. »Zur Zaubergrotte.«
Gehorsam verschwand der junge Mann in der Gasse.
Kurz darauf fiel die Metalltür klackend ins Schloss. Dann ertönte das hilflose Geruckel am Türknauf, als der junge Mann versuchte, wieder hereinzukommen.
Gewöhnlich verstanden die Gäste den Wink, und Tschitscherin sah sie nie wieder. Diesmal aber dauerte es keine Minute, bis der junge Mann erneut in der Tür stand, auf seinem Gesicht nach wie vor ein unschuldiges Lächeln. Tschitscherin nickte Niarchos zu.
Niarchos trocknete mit einem Schmuddellappen eines der frisch gespülten Teegläser. Als er Tschitscherins Nicken bemerkte, ruckte er kurz und abrupt den Kopf wie ein Pferd, das sich aus seinem Zaumzeug zu befreien versuchte. Behutsam stellte er das Glas ab und kam hinter der Theke hervor.
»Es scheint ein Missverständnis vorzuliegen«, sagte der junge Mann. »Mein Name lautet Kirow, und …«
»Sie sollten gehen«, unterbrach Niarchos ihn. Er hasste es, wenn er die Theke verlassen und seine endlosen Tagträume unterbrechen musste, denen er sich beim Gläserpolieren hingeben konnte.
»Ich denke …«, setzte Kirow zu einer neuen Erklärung an.
»Jaja«, zischte Tschitscherin nur, der plötzlich neben ihm auftauchte. Aus seinem Gesicht war jede Freundlichkeit verschwunden. »Ein Missverständnis, wie Sie sagen. Das einzige Missverständnis, das vorliegt, besteht darin, dass Sie hier reingekommen sind. Sehen Sie nicht, dass das kein Lokal für Sie ist?« Er ließ den Blick über die Tische schweifen, an denen vorwiegend rotgesichtige Männer mit Hängebacken und angegrautem Haar speisten. Manche trugen olivbraune Gabardine-Uniformen mit den Abzeichen hochrangiger Kommissare, andere Zivilkleidung europäischen Zuschnitts aus hochwertigen Stoffen, die so fein gewebt waren, dass sie im Licht der orchideenförmigen Lampen zu schimmern schienen. Zwischen den Offizieren und Politikern saßen schöne, aber gelangweilt wirkende Frauen, die Filterzigaretten rauchten.
»Hören Sie«, sagte Tschitscherin, »selbst wenn Sie hier einen Tisch bekommen würden, bezweifle ich, dass Sie sich das Essen überhaupt leisten könnten.«
»Aber ich bin doch gar nicht zum Essen hier«, protestierte Kirow. »Außerdem koche ich selbst, und mir scheint, Ihr Küchenchef verlässt sich zu sehr auf seine Saucen.«
Verwirrt runzelte Tschitscherin die Stirn. »Sie suchen Arbeit?«
»Nein«, erwiderte der junge Mann. »Ich suche Oberst Nagorski.«
Tschitscherin riss die Augen auf. Er sah zu einem Tisch in der Ecke, wo zwei Männer beim Essen saßen. Beide trugen Anzug. Einer war kahlrasiert, so dass sein breiter Schädel aussah wie rosafarbener Granit, der auf dem weißen Sockel des gestärkten Hemdkragens ruhte. Der andere hatte dichtes, schwarzes, gerade nach hinten gekämmtes Haar. Seine scharfen Wangenknochen wurden durch einen spitz zulaufenden, am Kinn kurzgeschnittenen Bart noch betont, so dass er aussah, als wäre seine Gesichtshaut über ein Holzdreieck gespannt, und das so straff, dass man befürchten musste, die geringste Gefühlsregung könnte die Haut platzen lassen.
»Sie suchen Oberst Nagorski?«, fragte Tschitscherin. Mit einem Nicken wies er auf den Mann mit den dichten schwarzen Haaren. »Nun, da ist er, aber …«
»Danke.« Kirow tat einen Schritt in Richtung Tisch.
Tschitscherin packte ihn am Arm. »Hören Sie, junger Freund, tun Sie sich einen Gefallen und gehen Sie nach Hause. Wer immer Sie hierhergeschickt hat, er versucht nur, Sie umzubringen. Ist Ihnen überhaupt klar, was Sie hier tun? Oder mit wem Sie es zu tun haben?«
Geduldig griff Kirow in seine Jacke und holte ein Telegramm heraus. Die rote Linie oben auf dem dünnen gelben Papier verwies darauf, dass es in einer Regierungsbehörde aufgegeben worden war. »Vielleicht sollten Sie mal einen Blick darauf werfen.«
Tschitscherin riss ihm das Telegramm aus der Hand.
Der Barmann Niarchos, der sich mit zusammengekniffenen Augen drohend vor ihm aufgebaut hatte, wurde beim Anblick des Telegramms nervös. Das Papier sah so dünn, so durchscheinend aus, als könnte es sich jeden Moment in Rauch auflösen.
Tschitscherin stierte auf das Papier, auch nachdem er das Telegramm längst gelesen hatte, so als erwartete er, dass noch mehr Wörter auftauchten.
Kirow nahm ihm das Telegramm aus der Hand und setzte sich in Bewegung.
Diesmal hielt Tschitscherin ihn nicht zurück.
Niarchos trat zur Seite.
Auf dem Weg zum Tisch von Oberst Nagorski zögerte Kirow kurz und betrachtete die diversen Speisen, sog die Gerüche ein, seufzte zufrieden oder grummelte leise beim Anblick der schweren Sahnesaucen und des übermäßigen Gebrauchs von Petersilie. Als der junge Mann endlich vor Nagorskis Tisch stand, räusperte er sich.
Nagorski sah auf. Der über die Wangenknochen gespannten Haut haftete etwas Wächsernes an. »Mehr Blinis für den Kaviar!« Er schlug mit der Hand auf den Tisch.
»Genosse Nagorski«, sprach Kirow ihn an.
Nagorski hatte sich schon wieder seinem Essen zugewandt, bei der Erwähnung seines Namens aber erstarrte er. »Woher kennen Sie meinen Namen?«, fragte er leise.
»Ihre Anwesenheit ist erforderlich, Genosse Nagorski.«
Nagorski sah zur Theke und hoffte, Blickkontakt mit Niarchos aufnehmen zu können. Der Barmann aber war ganz in das Polieren der Teegläser vertieft. Dann suchte er nach Tschitscherin, aber der Lokalbesitzer war spurlos verschwunden. Schließlich wandte er sich dem jungen Mann zu. »Wo genau ist meine Anwesenheit erforderlich?«, fragte er.
»Darüber wird man Sie unterwegs in Kenntnis setzen«, antwortete Kirow.
Nagorskis Tischgefährte hatte sich mit verschränkten Armen zurückgelehnt und starrte mit ausdrucksloser Miene vor sich hin.
Während sich vor Nagorski die Speisen türmten, hatte sich der glatzköpfige Riese nur einen kleinen Salat aus eingelegtem Kohl und Roter Bete bestellt.
»Warum glauben Sie«, begann Nagorski, »dass ich jetzt einfach aufstehe und mit Ihnen mitgehe?«
»Wenn Sie nicht freiwillig mitkommen, Genosse Nagorski, lautet mein Befehl, Sie zu verhaften.« Kirow hielt ihm das Telegramm hin.
Nagorski wischte das Papier zur Seite. »Mich verhaften?«, brüllte er.
Im Restaurant wurde es totenstill.
Nagorski betupfte sich mit der Serviette die dünnen Lippen, warf das Tuch auf das Essen und erhob sich.
Alle Augen waren nun auf den Tisch in der Ecke gerichtet.
Nagorski setzte ein breites Lächeln auf, sein Blick aber war so kalt und feindselig wie zuvor. Er fasste in die Tasche seiner Jacke und zog eine kleine Automatikpistole heraus.
Den Gästen an den umliegenden Tischen stockte der Atem. Klappernd wurden Messer und Gabel auf die Teller gelegt.
Blinzelnd sah Kirow zur Waffe.
»Sie scheinen mir ein wenig nervös zu werden«, lächelte Nagorski. Dann drehte er die Waffe um, so dass der Lauf zu ihm zeigte, und reichte sie dem anderen Mann an seinem Tisch.
Sein Begleiter nahm sie entgegen.
»Pass gut auf sie auf«, sagte Nagorski. »Ich möchte sie bald wiederhaben.«
»Ja, Oberst«, erwiderte der andere. Er legte die Waffe neben seinen Teller, als gehörte sie zum Besteck.
Nagorski verpasste dem jungen Mann einen Schlag auf den Rücken. »So, dann wollen wir doch mal sehen, was das Ganze soll!«
Kirow verlor fast das Gleichgewicht. »Ein Wagen wartet.«
»Gut!«, verkündete Nagorski dröhnend. »Warum zu Fuß gehen, wenn man fahren kann?« Lachend sah er sich um.
Ein schwaches Lächeln zeichnete sich auf den Gesichtern der übrigen Gäste ab.
Die beiden Männer gingen hinaus.
Als sie an der Küche vorbeikamen, sahen sie in einem der kleinen runden Fenster in den beiden Schwingtüren Tschitscherins Gesicht.
Draußen vor dem Borodino lag Schneematsch auf dem Gehweg.
Kaum war die Tür hinter ihnen zugefallen, packte Nagorski den jungen Mann am Kragen und stieß ihn gegen die Mauer des Restaurants.
Der junge Mann leistete keinerlei Widerstand. Fast schien er es sogar erwartet zu haben.
»Keiner stört mich beim Essen!«, knurrte Nagorski und hob den jungen Mann an, so dass dieser nur noch mit den Zehenspitzen den Boden berührte. »Keiner wird sich ungestraft eine solche Dummheit erlauben!«
Mit einem Nicken wies Kirow zum schwarzen Wagen, der mit laufendem Motor am Straßenrand stand. »Er wartet, Genosse Nagorski.«
Nagorski blickte über die Schulter und erkannte die Umrisse einer Person auf dem Rücksitz. Das Gesicht war nicht zu sehen. Dann wandte er sich wieder an den jungen Mann. »Wer sind Sie?«, fragte er.
»Ich heiße Kirow. Major Kirow.«
»Major?« Unvermittelt ließ Nagorski ihn los. »Warum haben Sie das nicht gleich gesagt?« Er trat einen Schritt zurück und versuchte, Kirows zerknittertes Revers glatt zu streichen. »Dann hätten wir uns diese Unannehmlichkeit ersparen können.« Er schlenderte zum Wagen und öffnete die Fondtür.
Major Kirow setzte sich ans Steuer.
Nagorski ließ sich auf der Rückbank nieder, und erst dann sah er zur Person neben sich. »Sie!«, rief er.
»Guten Tag«, sagte Pekkala.
»O Scheiße«, erwiderte Oberst Nagorski.
Inspektor Pekkala war ein großer, kräftiger Mann mit breiten Schultern und leicht zusammengekniffenen, mahagonifarbenen Augen. Er war in Lappeenranta, Finnland, geboren, als das Land noch zum Russischen Reich gehört hatte. Seine Mutter stammte aus dem lappländischen Rovaniemi im Norden.
Im Alter von achtzehn Jahren war Pekkala auf Wunsch seines Vaters nach Petrograd aufgebrochen, um sich zum Finnischen Garderegiment des Zaren zu melden. Dort war er zu Beginn der Ausbildung vom Zaren persönlich ausgewählt und zu dessen Sonderermittler bestimmt worden. Mit dieser Position, die es davor nicht gegeben hatte, erlangte Pekkala eine bis dahin unvorstellbare Machtfülle.
Im Lauf seiner Ausbildung war er zunächst der Polizei unterstellt, dann der Staatspolizei – der Gendarmerie – und schließlich der zaristischen Geheimpolizei, der Ochrana. In dieser Zeit öffneten sich ihm Türen, von denen nur die wenigsten wussten, dass es sie überhaupt gab. Nach Abschluss der Ausbildung überreichte der Zar ihm ein Abzeichen, das einzige Dienstemblem, das er jemals trug – eine schwere Goldscheibe, deren Durchmesser der Länge seines kleinen Fingers entsprach. Sie war mit einer weißen, ovalen Emailleintarsie versehen, die sich durch die gesamte Goldscheibe zog und in der Mitte, an ihrer dicksten Stelle, den halben Durchmesser ausfüllte. Und in der Mitte dieses weißen Emailleovals steckte ein großer, runder Smaragd. Zusammen bildeten diese Elemente die unverkennbare Gestalt eines Auges. Pekkala würde nie vergessen, wie er die Scheibe zum ersten Mal in der Hand gehalten, mit der Fingerspitze über das Auge gestrichen und die glatte Erhebung des Edelsteins ertastet hatte – wie ein Blinder, der Brailleschrift las.
Aufgrund dieses Abzeichens wurde Pekkala als »das Smaragdauge« bekannt. Sehr viel mehr wusste man über ihn nicht. Es gab keinerlei Fotos von ihm. In Ermangelung von Fakten rankten sich um Pekkala bald Legenden sowie Gerüchte, denen zufolge er kein Mensch sei, sondern eine Art Dämon, der durch die schwarzen Künste eines arktischen Schamanen zum Leben erweckt worden war.
Dienstlich war Pekkala einzig und allein dem Zaren unterstellt. In dieser Zeit lernte er die Geheimnisse des Russischen Reichs kennen, und als dieses Reich unterging und jene, die seine Geheimnisse bewahrt hatten, diese mit ins Grab nahmen, war Pekkala zu seinem großen Erstaunen immer noch am Leben.
Während der Revolution wurde er verhaftet und ins sibirische Arbeitslager Borodok verbannt, wo er die Welt, die er zurückgelassen hatte, zu vergessen suchte.
Aber die Welt hatte ihn nicht vergessen.
Nach sieben einsamen Jahren in den Wäldern von Krasnagoljana, in denen er mehr wie ein wildes Tier denn als Mensch lebte, wurde Pekkala auf Befehl Stalins nach Moskau zurückgebracht.
Und seit dieser Zeit, in der er einen brüchigen Frieden mit seinen früheren Feinden geschlossen hatte, übte Pekkala wieder seine Rolle als Sonderermittler aus.
Tief unterhalb der Moskauer Straßen saß Oberst Rolan Nagorski auf einem Metallstuhl in einer engen Zelle des Lubjanka-Gefängnisses. Die Wände waren weiß gestrichen, eine einzelne Glühbirne, geschützt unter einem verstaubten Eisengitter, erhellte den Raum.
Nagorski hatte sein Jackett ausgezogen und es über die Stuhllehne gehängt. Die Hosenträger spannten sich über seinen Schultern. Als er zu reden begann, krempelte er die Ärmel hoch, als wollte er sich auf eine Schlägerei vorbereiten. »Bevor Sie mich mit Fragen überschütten, Inspektor Pekkala, würde ich Ihnen gern eine stellen.«
»Nur zu«, sagte Pekkala. Er saß dem Oberst auf einem gleichen Metallstuhl gegenüber. Der Raum war so klein, dass sich ihre Knie fast berührten.
Trotz der stickigen Luft hatte Pekkala seinen Mantel anbehalten. Er wies einen altmodischen Schnitt auf: schwarz, knielang, kurzer Kragen, verdeckte Knopfleiste, linksgeknöpft. Er saß unnatürlich gerade wie jemand mit Rückenschmerzen. Grund dafür war die Waffe, die er über die Brust geschnallt hatte.
Es handelte sich um einen .455er Webley-Revolver mit Messinggriff und einem nadeldünnen Loch im Lauf unmittelbar hinter dem Korn, das den Rückschlag der Waffe verringerte. Eine Modifikation, die nicht für Pekkala, sondern für den Zaren vorgenommen worden war, der den Revolver als Geschenk von seinem Vetter König George V. erhalten hatte. Der Zar hatte ihn dann Pekkala geschenkt. »Ich habe keine Verwendung dafür«, hatte der Zar ihm gesagt. »Wenn meine Feinde mir so nahe kommen, dass ich eine Waffe wie diese einsetzen müsste, dann würde sie mir auch nicht mehr nützen.«
»Ich möchte Sie Folgendes fragen«, sagte Nagorski. »Warum glauben Sie, ich würde ausgerechnet an jene Leute das Geheimnis meiner Erfindung verraten, gegen die wir diese Erfindung möglicherweise einsetzen müssen?«
Bevor Pekkala darauf etwas erwidern konnte, fuhr Nagorski bereits fort.
»Sie sehen also, ich weiß, warum ich hier bin. Sie glauben, ich wäre für die Sicherheitslücke beim Konstantin-Projekt verantwortlich. Ich bin weder so naiv noch so uninformiert, dass ich nicht weiß, was um mich herum vorgeht. Deshalb findet sämtliche Entwicklungsarbeit in einer abgeschotteten Anlage statt. Der gesamte Stützpunkt ist vollkommen abgeriegelt, alles wird von mir persönlich kontrolliert. Jeder, der dort arbeitet, wurde von mir genauestens überprüft. Nichts geschieht, ohne dass ich davon erfahren würde.«
»Was uns zu dem Grund zurückbringt, warum Sie hier sind.«
Nagorski beugte sich vor. »Ja, Inspektor Pekkala. Genau, und Ihnen wäre einiges an Zeit erspart geblieben, und ich hätte mein sündhaft teures Essen nicht abbrechen müssen, wenn ich Ihrem Laufburschen einfach hätte erzählen können …«
»Dieser ›Laufbursche‹, wie Sie ihn nennen, ist Major der Inneren Sicherheit.«
»Selbst NKWD-Offiziere können Laufburschen sein, Inspektor, wenn deren Vorgesetzte das Land leiten. Ich hätte Ihrem Major sagen können, was ich jetzt Ihnen sage – dass es nämlich keine Sicherheitslücke gibt.«
»Die Waffe, die Sie T-34 nennen, ist unseren Feinden bekannt«, sagte Pekkala. »Diese Tatsache können Sie nicht bestreiten.«
»Natürlich ist sie bekannt. Man kann keine dreißig Tonnen schwere Maschine entwickeln, sie bauen, im Feld testen und dann erwarten, dass sie unsichtbar bleibt. Aber davon rede ich nicht. Das Geheimnis liegt darin, wozu sie fähig ist. Ich gebe zu, einige Mitarbeiter meiner Entwicklungsmannschaft könnten Ihnen Teile dieses Puzzles verraten, aber es gibt nur eine Person, der das gesamte Potenzial bekannt ist.« Nagorski lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. Schweiß lief ihm über das glänzende Gesicht. »Und das bin ich, Inspektor Pekkala.«
»Etwas verstehe ich nicht«, sagte Pekkala. »Was ist so besonders an Ihrer Entwicklung? Haben wir nicht schon Panzer?«
Nagorski stieß ein Lachen aus. »Gewiss! Da gibt es den T-26.« Er öffnete eine Hand, als würde ein Miniaturpanzer auf seiner Handfläche sitzen. »Aber er ist zu langsam.« Die Hand schloss sich zur Faust. »Dann gibt es die BT-Serie.« Die andere Hand öffnete sich. »Aber die ist zu schwach gepanzert. Genauso gut könnten Sie mich fragen, warum wir überhaupt noch Waffen bauen, wenn doch überall genügend Steine herumliegen, mit denen wir auf unsere Gegner werfen könnten.«
»Sie klingen sehr von sich eingenommen, Genosse Nagorski.«
»Ich bin sehr von mir eingenommen. Mehr als das!«, bellte Nagorski ihm ins Gesicht. »Ich bin von mir absolut überzeugt, und nicht nur, weil ich den T-34 erfunden habe. Sondern weil ich Panzern in der Schlacht gegenübergestanden habe. Erst wenn man erfahren hat, wie sie auf einen zukommen, und man weiß, dass man ihnen hilflos ausgeliefert ist und sie nicht aufhalten kann, dann versteht man, warum Panzer nicht nur eine Schlacht, sondern den ganzen Krieg gewinnen können.«
»Wann haben Sie Panzern gegenübergestanden?«, fragte Pekkala.
»Im Krieg, den wir gegen Deutschland geführt haben, und möge uns der Himmel beistehen, wenn wir einen weiteren führen müssen. Bei Ausbruch des Krieges im Sommer 1914 war ich in Lyon, dort habe ich am französischen Grand Prix teilgenommen. Rennwagen waren damals meine große Leidenschaft, mein Leben. Ich habe das Rennen gewonnen, müssen Sie wissen, das einzige Autorennen, aus dem unser Land jemals als Sieger hervorgegangen ist. Es war der glücklichste Tag in meinem Leben, und er hätte vollkommen sein können, wäre nicht mein Chefmechaniker von einem anderen Wagen, der von der Strecke abgekommen ist, erfasst worden.«
»Er wurde getötet?«, fragte Pekkala.
»Nein«, erwiderte Nagorski, »aber schwer verletzt. Sie sehen, der Automobilrennsport ist eine gefährliche Angelegenheit, Inspektor, auch wenn Sie nicht hinter dem Steuer sitzen.«
»Wann haben die angefangen, sich für solche Maschinen zu interessieren?«
Nagorski begann sich sichtlich zu entspannen. »Mein erstes Automobil bekam ich 1907 zu Gesicht. Einen Rolls-Royce Silver Ghost, den der Großherzog Michail nach Russland gebracht hat. Mein Vater und er gingen jedes Jahr zusammen auf die Jagd, nach Gänsesäger in den Pripjet-Sümpfen. Als der Großherzog einmal mit seinem Wagen vor unserem Haus anhielt, fragte ihn mein Vater, ob er nicht einen Blick auf den inneren Mechanismus werfen könnte.« Nagorski lachte. »So hat er das genannt: den inneren Mechanismus. Als wäre es so was wie eine Standuhr. Als der Großherzog die Motorhaube öffnete, veränderte sich mein Leben von einer Sekunde auf die andere. Mein Vater starrte darauf. Für ihn war das alles nur eine verwirrende Ansammlung von Metallröhren und Schrauben. Für mich aber ergab alles einen Sinn. Es war, als hätte ich alles schon mal gesehen. Besser kann ich es nicht erklären. Aber ich wusste, dass solche Motoren meine Zukunft waren. Es dauerte nicht lange, bis ich selbst einen baute. Im Lauf der nächsten zehn Jahre gewann ich mehr als zwanzig Rennen. Wäre der Krieg nicht dazwischengekommen, würde ich das immer noch machen. Aber das kann ja jeder von sich behaupten, nicht wahr, Inspektor? Wäre der Krieg nicht dazwischengekommen …«
»Wie ist es Ihnen im Krieg ergangen?«, unterbrach ihn Pekkala.
»Ich konnte nicht zurück nach Russland, also habe ich mich zur französischen Fremdenlegion gemeldet. Männer aus der ganzen Welt, die sich bei Kriegsausbruch im falschen Land befunden hatten und nun nicht mehr nach Hause konnten, trafen dort zusammen. Ich war schon fast zwei Jahre bei der Legion, als wir in der Nähe vom Dorf Flers auf Panzer stießen. Wir hatten von diesen Maschinen gehört. Die Briten hatten sie 1917 in der Schlacht bei Cambrai zum ersten Mal gegen die Deutschen eingesetzt. Im folgenden Jahr hatten die Deutschen dann eigene Panzer. Ich hatte sie bis dahin noch nie gesehen, und dann mussten wir gegen sie antreten. Mein erster Gedanke war: Wie langsam sie sich bewegen! Sechs Kilometer in der Stunde. Fußgängertempo! Sie hatten nichts Elegantes an sich, es war, als würde man von riesigen Kakerlaken aus Eisen angegriffen. Drei der fünf Maschinen fielen aus, bevor sie uns überhaupt erreichten, einer wurde von der Artillerie zerstört, dem letzten gelang es schließlich zu entkommen. Zwei Tage später fanden wir ihn ausgebrannt am Straßenrand liegen, wahrscheinlich ein Motorschaden.«
»Das klingt nicht sehr beeindruckend.«
»Nein. Ich sah, wie diese Eisenungetüme vernichtet wurden oder stotternd von allein zum Halt kamen, und trotzdem wusste ich, dass die Zukunft diesen Maschinen gehört. Das war keine vorübergehende Mode wie die Armbrust oder die Blide. Mir war sofort klar, wie man die Konstruktion verbessern könnte. Mir schwebten Dinge vor, die noch gar nicht erfunden waren, die ich mir aber in den kommenden Monaten ausdachte und auf allen Zetteln, die ich nur auftreiben konnte, skizzierte. Diese Zettel brachte ich nach Kriegsende mit nach Russland.«
Pekkala kannte den Rest der Geschichte. Eines Tages war Nagorski in das neugegründete sowjetische Patentamt in Moskau marschiert und hatte über zwanzig unterschiedliche Konstruktionspläne dabei, die ihm schließlich die Leitung des T-34-Projekts eintrugen. Bis dahin hatte er sein Dasein auf den Moskauer Straßen gefristet und den Männern, über die er später den Befehl hatte, die Schuhe geputzt.
»Kennen Sie die Grenze meines Entwicklungsbudgets?«, fragte Nagorski.
»Nein«, antwortete Pekkala.
»Können Sie auch nicht, denn es gibt nämlich keine«, sagte Nagorski. »Genosse Stalin weiß ganz genau, wie wichtig dieses Fahrzeug für die Sicherheit unseres Landes ist. Daher kann ich so viel Geld ausgeben, wie ich will, ich kann mir nehmen, was ich brauche, und jedem nach Belieben alles auftragen, was mir nützlich erscheint. Sie beschuldigen mich, die Sicherheit des Landes aufs Spiel gesetzt zu haben? Wenn das jemandem vorzuwerfen ist, dann eher dem Mann, der Sie hierhergeschickt hat. Sagen Sie dem Genossen Stalin, wenn er weiterhin in diesem Tempo Angehörige der sowjetischen Streitkräfte verhaftet, wird bald keiner mehr da sein, der meine Panzer steuern kann, selbst wenn er mich meine Arbeit machen lässt!«
Nagorskis wahre Macht lag nicht in dem Geld, über das er verfügte, sondern in der Tatsache, dass er Aussagen wie diese äußern konnte, ohne fürchten zu müssen, mit einer Kugel im Kopf zu enden. Pekkala erwiderte nichts darauf – nicht aus Angst vor Nagorski, sondern weil er wusste, dass er recht hatte.
Aus Furcht, die Macht zu verlieren, hatte Stalin Massenverhaftungen angeordnet. In den zurückliegenden eineinhalb Jahren waren über eine Million Menschen verhaftet worden, darunter der Großteil des sowjetischen Oberkommandos. Die Offiziere waren entweder erschossen oder in den Gulag geschickt worden.
»Na«, schlug Pekkala vor, »vielleicht hat sich Ihre Gesinnung ja geändert. Wäre doch möglich, dass Sie unter dem Eindruck dieser Ereignisse versucht sein könnten, alles wieder rückgängig zu machen.«
»Indem ich meine Geheimnisse dem Gegner überlasse, meinen Sie?«
Pekkala nickte. »Das wäre eine Möglichkeit.«
»Wissen Sie, warum es das Konstantin-Projekt heißt?«
»Nein, Genosse Nagorski.«
»Konstantin ist der Name meines Sohnes, meines einzigen Kindes. Sie verstehen, Inspektor, dieses Projekt ist mir so heilig wie meine Familie. Ich würde nie zulassen, dass ihm Schaden zugefügt wird. Manche wollen das nicht verstehen. Sie halten mich für eine Art Dr. Frankenstein, der davon besessen ist, ein Ungeheuer zum Leben zu erwecken. Sie sehen nicht den Preis, den ich dafür zu zahlen habe. Wenn man einfach nur sein Leben leben will, kann Erfolg ebenso großen Schaden anrichten wie Misserfolg. Meine Frau und mein Sohn haben sehr darunter zu leiden.«
»Das verstehe ich«, sagte Pekkala.
»Tun Sie das?«, fragte Nagorski fast flehentlich. »Wirklich?«
»Wir haben beide schwierige Entscheidungen getroffen«, sagte Pekkala.
Nagorski nickte und starrte gedankenverloren in eine Ecke der Zelle. Plötzlich wandte er sich wieder Pekkala zu. »Dann sollten Sie wissen, dass alles, was ich Ihnen erzählt habe, der Wahrheit entspricht.«
»Entschuldigen Sie mich, Oberst Nagorski«, sagte Pekkala. Er verließ die Zelle und ging durch den mit Metalltüren gesäumten Korridor. Seine Schritte erzeugten auf dem grauen Industrieteppich kaum ein Geräusch. Alles war gedämmt und gedämpft, als wäre dem gesamten Gebäude die Luft entzogen worden. Am Ende des Korridors war eine Tür nur angelehnt. Pekkala klopfte an und trat ein. Drinnen stand so dick der Rauch, dass Pekkala meinte, er atme Asche ein.
»Und, Pekkala?«, erklang eine Stimme. Auf einem Stuhl in der Ecke des ansonsten leeren Zimmers saß ein stämmiger Mann mittlerer Größe mit pockennarbigem Gesicht und einer verkümmerten linken Hand. Das dichte, schwarze Haar war glatt nach hinten gekämmt, ein buschiger, von grauen Strähnen durchzogener Schnauzer wölbte sich über die Oberlippe. Er rauchte eine Zigarette, von der nur noch so viel übrig war, dass sich die Glut nach einem weiteren Zug in die Haut gefressen hätte.
»Nun ja, Genosse Stalin«, sagte Pekkala.
Stalin drückte die Zigarette an der Schuhsohle aus und stieß grauen Rauch durch die Nasenlöcher aus. »Was halten Sie von unserem Oberst Nagorski?«
»Ich denke, er sagt die Wahrheit«, antwortete Pekkala.
»Ich bin da anderer Meinung«, sagte Stalin. »Vielleicht sollte Ihr Assistent ihn befragen.«
»Major Kirow?«, sagte Pekkala.
»Ich weiß, wie er heißt!«, brauste er auf.
Pekkala verstand, warum. Die Erwähnung von Kirows Namen sorgte jedes Mal dafür, dass Stalin die Nerven verlor. So hatte auch der fünf Jahre zuvor ermordete Leningrader Parteichef geheißen. Kirows Tod lastete schwer auf Stalin, nicht weil er eine besondere Zuneigung zu ihm gefasst hatte, sondern weil dessen Tod ihm eines deutlich machte: Wenn schon jemand wie Kirow umgebracht werden konnte, dann war Stalin vielleicht als Nächster an der Reihe. Seit Kirows Tod hatte Stalin die Öffentlichkeit gemieden und sich nicht mehr unter die Menschen gewagt, über die er zwar noch herrschte, denen er aber nicht mehr vertraute.
Stalin knetete die Hände und ließ nacheinander die Knöchel knacken. »Das Konstantin-Projekt ist verraten worden, und dahinter steckt meiner Ansicht nach Nagorski.«
»Dafür gibt es keinerlei Beweise«, sagte Pekkala. »Wissen Sie von Dingen, von denen Sie mir nichts gesagt haben, Genosse Stalin? Haben Sie Beweise, die Sie mir vorlegen können? Oder handelt es sich nur um eine der unzähligen Verhaftungen, so dass Sie in diesem Fall auch einen x-beliebigen Ermittler darauf ansetzen könnten?«
Stalin rollte den Zigarettenstummel zwischen den Fingern. »Wissen Sie, wie viele so mit mir reden dürfen?«
»Nicht viele, denke ich mir«, antwortete Pekkala. Jedes Treffen mit Stalin offenbarte nur die emotionale Leere dieses Mannes. Das lag an seinen Augen. Seine Miene mochte sich ändern, der Ausdruck seiner Augen änderte sich nie. Wenn Stalin lachte, wenn er jemandem schöntat oder, falls dies nichts nützte, wenn er jemandem drohte, dann war es, als würde man dem Maskenwechsel in einer japanischen Kabuki-Aufführung beiwohnen. Manchmal, wenn auf die eine Maske die nächste folgte, glaubte Pekkala kurz zu erkennen, was dahinterlag. Und was er dort sah, erfüllte ihn mit Angst. Dagegen konnte er sich nur schützen, wenn er so tat, als hätte er es nicht gesehen.
Stalin lächelte, und plötzlich hatte sich die Maske erneut verändert. »Nicht viele, das stimmt. Keiner, damit wäre es noch treffender beschrieben. Sie haben recht, ich habe andere Ermittler, aber dieser Fall ist zu wichtig.« Dann steckte er den Zigarettenstummel in die Tasche.
Pekkala sah es nicht zum ersten Mal. Eine seltsame Angewohnheit, hier in einer Stadt, wo selbst die Ärmsten ihre Kippen auf den Boden warfen. Seltsam für jemanden, der es auf vierzig Zigaretten am Tag brachte und niemals Angst haben musste, dass sie ihm ausgingen. Es musste etwas dahinterstecken, vielleicht eine Geschichte, die möglicherweise auf seine Zeit als Bankräuber in Tiflis zurückging. Vielleicht, ging Pekkala durch den Kopf, krümelte Stalin wie die Bettler auf der Straße den letzten Tabak aus den Kippen und rollte damit neue Zigaretten. Was immer der Grund sein mochte, Stalin behielt ihn für sich.
»Ich bewundere Ihre Kühnheit, Pekkala. Mir gefallen Leute, die sich nicht scheuen, ihre Meinung zu sagen. Das ist einer der Gründe, warum ich Ihnen traue.«
»Ich bitte Sie nur, dass Sie mich meine Arbeit machen lassen«, sagte Pekkala. »Das ist unsere Vereinbarung.«
Ungeduldig ließ Stalin die Hände auf die Knie fallen. »Pekkala, ist Ihnen klar, dass mein Stift schon das Papier berührt hat, auf dem Ihr Todesurteil stand? So nahe war ich davor gewesen.« Er legte die Finger zusammen, als würde er tatsächlich einen Stift in der Hand halten, und krakelte seine imaginäre Unterschrift in die Luft. »Ich habe meine Entscheidung nie bereut. Wie viele Jahre arbeiten wir jetzt schon zusammen?«
»Sechs. Fast sieben.«
»Und habe ich mich in der Zeit auch nur einmal in Ihre Arbeit eingemischt?«
»Nein«, musste Pekkala zugeben.
»Und habe ich Sie jemals bedroht, nur weil Sie anderer Meinung waren?«
»Nein, Genosse Stalin.«
»Und das«, sagte Stalin und zielte mit dem Zeigefinger auf Pekkala, als zielte er mit einer Waffe auf ihn, »ist mehr, als Sie über Ihren früheren Vorgesetzten oder seine sich immer in alles einmischende Gattin Alexandra sagen können.«
In diesem Augenblick wurde Pekkala in die Zeit zurückgeworfen.
Wie jemand, der aus einer Trance aufwacht, fand er sich im Alexanderpalast wieder und hatte die Hand erhoben, um an die Tür zum Arbeitszimmer des Zaren zu klopfen.
Es war der Tag, an dem er endlich den Mörder Grodek aufgespürt hatte.
Grodek und seine Verlobte Maria Balka hatten sich in einer Wohnung in der Nähe des Moika-Kanals versteckt. Als Agenten der Ochrana das Gebäude stürmten, ließ Grodek einen Sprengsatz explodieren. Das Haus wurde vollständig zerstört, alle darin befindlichen Personen, auch die Agenten, wurden getötet. Grodek und Balka waren unterdessen über den Hintereingang geflohen, wo Pekkala allerdings bereits auf sie gewartet hatte. Er verfolgte sie auf den vereisten Pflastersteinen, bis Grodek die Potsulejew-Brücke überqueren wollte. Auf der anderen Seite hatten sich jedoch Ochrana-Männer postiert, so dass die beiden Flüchtenden in der Falle saßen. Daraufhin erschoss Grodek seine Verlobte, damit sie nicht der Polizei in die Hände fiel. Balkas Leichnam stürzte in den Kanal und verschwand unter den Eisschollen, die wie diamantbesetzte Flöße in die Ostsee hinaustrieben. Grodek, der sich nicht zu springen traute, wollte sich erschießen, aber ihm war die Munition ausgegangen. Er wurde augenblicklich in Gewahrsam genommen.
Der Zar hatte Pekkala an jenem Tag befohlen, nicht später als bis 16 Uhr im Alexanderpalast zu erscheinen, um seinen Bericht abzuliefern. Der Monarch schätzte es nicht, wenn er warten musste. Pekkala hatte sich daher beeilt und war wenige Minuten vor vier eingetroffen. Er stürmte die Stufen zum Palast hinauf und eilte zum Arbeitszimmer des Zaren.
Niemand antwortete, also klopfte Pekkala erneut. Noch immer keine Antwort. Vorsichtig öffnete er die Tür. Der Raum war leer.
Pekkala seufzte.
Dem Zaren gefiel es zwar nicht, wenn er warten musste, er hatte aber keine Probleme damit, andere warten zu lassen.
In diesem Augenblick vernahm Pekkala die Stimme des Zaren. Sie kam aus dem Zimmer an der gegenüberliegenden Gangseite, das der Zarin Alexandra gehörte und als das Malvenboudoir bekannt war. Von den hundert Räumen im Alexanderpalast gehörte es zu den berühmtesten – hauptsächlich deshalb, weil es von nahezu allen als ausgesprochen hässlich empfunden wurde. Pekkala musste zustimmen. Seiner Meinung nach war alles in diesem Raum in eine Farbe getaucht, die der von gekochter Leber ähnelte.
Pekkala blieb davor stehen und versuchte nach seinen eiligen Schritten, zu Atem zu kommen. Dann hörte er die Stimme der Zarin und die wütende Erwiderung des Zaren. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass sie über ihn sprachen.
»Ich werde Pekkala nicht entlassen!«, sagte der Zar.
Pekkala hörte das leise Knarren der Reitstiefel, mit denen der Zar auf und ab schritt. Er wusste genau, um welches Paar es sich handelte – sie waren speziell in England geordert worden und in der Woche zuvor eingetroffen. Der Zar versuchte, sie einzulaufen, was mit ziemlichen Schmerzen einherging. Er hatte Pekkala anvertraut, dass er, um das Leder weich zu machen, sogar den alten Bauerntrick angewandt und hineinuriniert und sie über Nacht hatte stehenlassen.
Die sanfte Stimme der Zarin war wieder zu hören. Sie hob so gut wie nie die Stimme, in ihrem leisen Ton aber schien immer eine unterschwellige Drohung mitzuschwingen. »Unser Freund drängt uns dazu«, sagte sie.
Bei der Erwähnung von »unserem Freund« spannte sich Pekkalas Kiefer. So nannten Zar und Zarin, wenn sie unter sich waren, den selbsternannten Heiligen Rasputin.
Rasputins Einfluss auf die Zarenfamilie hatte seit seiner Ankunft am Hof so zugenommen, dass er mittlerweile in allen Fragen konsultiert wurde, egal, ob es um den Krieg ging, der nun in seinem zweiten Jahr war und von einer Katastrophe zur nächsten führte, um Berufungen an den Zarenhof oder die Krankheit ihres jüngsten Kindes Alexej. Offiziell wurde es zwar dementiert, bei dem Jungen aber war Hämophilie diagnostiziert worden. Verletzungen, über die jeder gesunde Junge nur gelacht hätte, fesselten Alexej tagelang ans Bett. Oftmals musste er bei Ausflügen von seinem Leibdiener, einem Matrosen namens Derewenko, getragen werden.
Die Zarin war bald davon überzeugt, dass Rasputin Alexej von seiner Krankheit heilen könnte.
Ministerpräsident Pjotr Stolypin, beunruhigt wegen Rasputins gesellschaftlichem Aufstieg, ordnete eine Untersuchung an. Der Bericht, den er daraufhin dem Zaren vorlegte, enthüllte ausschweifende Gelage in Rasputins Petrograder Wohnung und geheime Treffen zwischen der Zarin und Rasputin im Haus ihrer besten Freundin Anna Wyrubowa.
Die Zarin, beim russischen Volk nicht besonders beliebt, wurde landläufig nur als Nemka, die Deutsche, bezeichnet. Als das Land im Krieg gegen das Deutsche Reich stand, fragte man sich natürlich, welcher Seite ihre Loyalität wirklich gehörte.
Nach der Lektüre des Berichts befahl der Zar Stolypin, Rasputin ihm gegenüber nie wieder zu erwähnen. Als 1911 auf Stolypin bei einem Opernbesuch in Kiew ein Anschlag verübt wurde, an dessen Folgen der Ministerpräsident fünf Tage später starb, sorgte das Desinteresse seitens des Zaren und der Zarin für einen Skandal am russischen Hof.
Nach der Verhaftung des Attentäters Dimitri Bogrow stellte sich heraus, dass dieser ein bezahlter Informant der Ochrana gewesen war. Beim Prozess gegen Bogrow war es den Anwälten nicht erlaubt, zu fragen, ob es irgendeine Verbindung zwischen Bogrow und der Familie Romanow gegeben habe. Keine Woche nach Stolypins Tod wurde Bogrow hingerichtet.
Rasputins Zusammenkünften mit der Zarin stand nun nichts mehr im Weg. Bald kamen Gerüchte über ihre Untreue auf. Pekkala schenkte ihnen zwar keinen Glauben, aber er kannte viele, die dies taten.
Allerdings war er davon überzeugt, dass die Angst um ihren kranken Sohn die Zarin fast um den Verstand gebracht hatte. Aller Reichtümer der Romanows zum Trotz gab es kein Heilmittel, das sie für Geld hätte kaufen können. Daher hatte sich die Zarin dem Aberglauben zugewandt, der mittlerweile so viel Macht über sie hatte, dass sie in einer völlig von Angst beherrschten Welt lebte. Und in dieser Welt war Rasputin zu einer Art Gott geworden.
Der Zar ließ sich nicht so leicht davon überzeugen. Rasputins Einfluss hätte vielleicht wieder nachgelassen, wäre nicht ein Ereignis eingetreten, das ihm nicht nur die Ergebenheit der gesamten Familie gesichert, sondern letztlich auch sein Schicksal besiegelt hatte.
In der tristen Jagdunterkunft der Romanows in Spala war der Zarewitsch, als er aus der Badewanne stieg, ausgeglitten und hatte sich dabei eine so schlimme Blutung zugezogen, dass die Ärzte den Eltern nahelegten, sich bereits auf sein Ableben einzustellen.
Dann traf ein Telegramm von Rasputin ein, in dem er der Zarin versicherte, dass ihr Sohn nicht sterben werde.
Was als Nächstes geschah, konnten noch nicht einmal Rasputins schärfste Kritiker abstreiten.
Nach der Ankunft des Telegramms begann sich Alexejs Zustand überraschend schnell zu bessern.
Von diesem Zeitpunkt an war Rasputin, egal was er tat, über nahezu jede Kritik erhaben.
Nahezu.
Denn Rasputin frönte auch weiterhin seinen Ausschweifungen, und Pekkala fürchtete den Tag, an dem er vom Zaren möglicherweise damit betraut wurde, gegen den sibirischen Prediger zu ermitteln. So oder so wäre dies das Ende seiner Karriere gewesen oder – wie bei Stolypin – gar seines Lebens. Möglicherweise aus diesem Grund oder weil er die Wahrheit nicht erfahren wollte, verschonte der Zar ihn mit einem solchen Auftrag.
»Unser Freund«, gab der Zar zurück, »würde gut daran tun, nicht zu vergessen, dass ich persönlich Pekkala ernannt habe.«
»Nun, mein Lieber«, sagte die Zarin, worauf das Rascheln ihres Kleides zu hören war, während sie durchs Zimmer ging, »keiner behauptet, dass es falsch war, ihn zu ernennen. Deine Loyalität gegenüber Pekkala steht außer Zweifel. Es ist nur Pekkalas Loyalität dir gegenüber, die in Frage gestellt wird.«
Die Worte versetzten Pekkala einen Stich. Er hatte sich nie auch nur im Geringsten illoyal verhalten. Er wusste es, und der Zar musste es ebenfalls wissen. Aber in diesem Augenblick packte ihn der Zorn, denn er wusste, wie leicht der Monarch umgestimmt werden konnte. Der Zar sah sich gern als entscheidungsfreudigen Mann, was er in gewisser Weise auch war, dennoch konnte er von so ziemlich allem überzeugt werden, wenn es sich seine Frau nur in den Kopf gesetzt hatte.
»Sunny, verstehst du nicht?«, protestierte der Zar. »Pekkala hat nicht mir gegenüber loyal zu sein.«
»Na, ich will doch annehmen, dass er das sein sollte, oder?«
»Pekkala ist ausschließlich der Aufgabe verpflichtet, die ich ihm stelle«, erwiderte der Zar, »nur ihr gehört seine Loyalität.«
»Seine Pflicht …«, begann die Zarin.
Der Zar schnitt ihr das Wort ab. »… ist es, die Wahrheit in der Sache herauszufinden, mit der ich ihn betraue, mag sie noch so unerfreulich sein. Ein solcher Mensch entfacht Angst in den Herzen jener, die Lügen in sich tragen. Und ich frage mich, Sunny, ob unser Freund nicht mehr um sich selbst besorgt ist als um das Wohlergehen des Hofes.«
»Das kannst du nicht behaupten, mein Lieber! Unser Freund wünscht unserer Familie und unserem Land nur das Beste. Er hat dir sogar ein Geschenk geschickt.« Raschelndes Papier war zu hören.
»Was um alles in der Welt ist das?«
»Ein Kamm«, erwiderte sie. »Einer, der einmal ihm gehört hat. Es wird dir Glück bringen, wenn du dir damit durch die Haare fährst, bevor du an den Tagessitzungen mit den Generälen teilnimmst.«
Pekkala schauderte beim Gedanken an Rasputins fettige Haare.
Der Zar schien den gleichen Gedanken zu hegen. »Ich werde mich keinesfalls auf Rasputins abscheuliche Rituale einlassen!«, schrie er. Und damit verließ er das Zimmer und trat hinaus in den Gang.
Pekkala konnte sich nicht mehr verstecken. Ihm blieb nur eine Möglichkeit: da zu bleiben, wo er war.
Der Zar stutzte.
Eine Weile starrten sich die beiden Männer nur an.
Pekkala brach schließlich das Schweigen, indem er das sagte, was ihm als Erstes durch den Kopf ging. »Wie sind die Stiefel, Majestät?«
Überrascht blinzelte der Zar ihn an, dann lächelte er. »Die Engländer machen wunderbare Stiefel«, sagte er, »nur nicht für uns Menschen.«
Nun erschien die Zarin in der Tür. Sie trug ein einfaches weißes, bodenlanges Kleid mit hohem Kragen und halblangen Ärmeln. Um die Taille hatte sie einen schwarzen, mit Quasten besetzten Stoffgürtel geschlungen, am Hals trug sie an einer Goldkette ein von Rasputin persönlich geschnitztes Kreuz aus Knochen. Sie war eine ernste Frau mit schmalem Mund, tiefliegenden Augen und einer glatten, breiten Stirn. Pekkala hatte Bilder von ihr kurz nach ihrer Hochzeit mit dem Zaren gesehen. Damals hatte sie glücklicher gewirkt. Wenn sie sich jetzt entspannte, war ihr Gesicht von Sorgenfalten überzogen. »Was wollen Sie?«, fragte sie Pekkala.
»Seine Exzellenz haben mich gebeten, mich um Punkt vier Uhr zu melden.«
»Dann kommen Sie zu spät«, blaffte sie.
»Nein, Exzellenz«, erwiderte Pekkala. »Ich war pünktlich.«
Der Zarin dämmerte, dass er jedes Wort, das sie gesprochen hatten, mit angehört haben musste.
»Was gibt es Neues von Grodek?«, fragte der Zar, bemüht, das Thema zu wechseln.
»Wir haben ihn, Exzellenz«, antwortete Pekkala.
Die Miene des Zaren hellte sich schlagartig auf. »Gut gemacht!« Der Zar klopfte ihm leicht auf die Schulter, drehte sich um und ging den Korridor hinunter. Als er an seiner Frau vorbeikam, blieb er stehen und flüsterte ihr ins Ohr: »Erzähl das deinem Freund.«