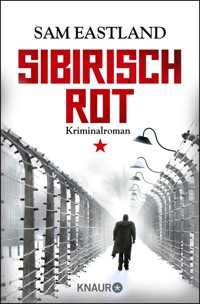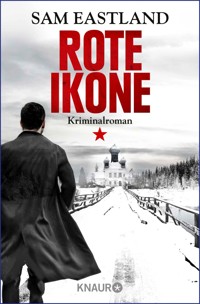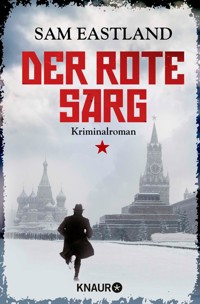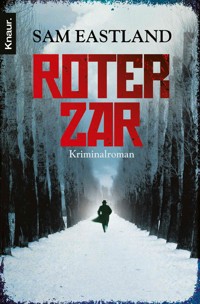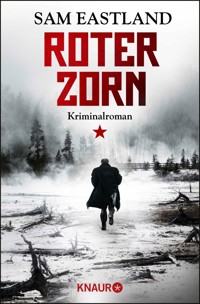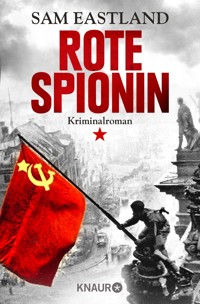
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Inspektor-Pekkala-Serie
- Sprache: Deutsch
1945 geht es in Berlin um alles oder nichts für Inspektor Pekkala – im siebten Band der historischen Krimi-Reihe wird es persönlich für den »James Bond in Diensten Stalins« (Die Welt) Berlin im April 1945: Ein britischer Spion ist an Pläne für die neue Steuerung der gefürchteten V2-Rakete gelangt, die dem Krieg eine entscheidende Wende geben könnte. Da die Rote Armee bereits vor den Toren der Stadt steht, bittet man den Kreml um Hilfe, um den Spion sicher aus dem umkämpften Gebiet zu bringen. Die Mission ist ein Himmelfahrtskommando – und die Briten wollen genau einen Mann dafür: den legendären Inspektor Pekkala. Stalin willigt ein, seinen besten Mann buchstäblich in die Hölle zu schicken, denn er spekuliert selbst auf die Pläne der V2-Rakete. Als Pekkala jedoch herausfindet, wen er da aus Berlin retten soll, ist er bereit, alles aufs Spiel zu setzen: Denn der Spion ist eine Frau – und noch einmal will er sie nicht verlieren! »Rote Spionin« ist der siebte und abschließende Band von Sam Eastlands historischer Krimi-Reihe aus dem stalinistischen Russland. Die Inspektor-Pekkala-Krimis bieten hochspannende Unterhaltung für alle historisch interessierten Krimi-Fans und sind in folgender Reihenfolge erschienen: - »Roter Zar« (1929) - »Der rote Sarg« (1939) - »Sibirisch Rot« (1939) - »Roter Schmetterling« (1941) - »Roter Zorn« (1944) - »Rote Ikone« (1944) - »Rote Spionin« (1945)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sam Eastland
Rote Spionin
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Karl-Heinz Ebnet
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Berlin im April 1945: Ein britischer Spion ist an Pläne für die neue Steuerung der gefürchteten V2-Rakete gelangt. Um den Spion sicher aus der umkämpften Stadt zu bringen, bittet London den Kreml um Hilfe. Die Mission ist ein Himmelfahrtskommando – und die Briten wollen genau einen Mann dafür: den legendären Inspektor Pekkala. Als Pekkala den wahren Grund erfährt, warum gerade er in die Hölle geschickt werden soll, ist er bereit, alles zu riskieren. Denn der Spion, den er retten soll, ist niemand anderer als die Frau, die er heiraten wollte, bevor die Revolution sie vor über zwanzig Jahren auseinandergerissen hat.
Inhaltsübersicht
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Für John und Johanna
Moskau, 9. April 1945. Seine Schritte hallten in der verlassenen Straße.
Über ihm, gerahmt von den schartigen Silhouetten der Kamine, erstreckte sich die sternenfunkelnde Dunkelheit.
Pekkala, die Hände tief in den Taschen seines Mantels vergraben, war auf dem Weg ins Café Tilsit, das einzige Lokal, das zu dieser Nachtzeit noch offen hatte.
Die beschlagenen Scheiben des Cafés glühten im Schein der Kerzen, die hinter den Fenstern aufgestellt waren.
Mit der Schulter stieß Pekkala die schwere Holztür auf, und als er den Raum betrat, ertönte eine an der Klinke befestigte kleine Glocke. Er hielt kurz inne, sog den Geruch von Suppe und Zigaretten ein und steuerte einen ruhigen Tisch im hinteren Bereich an.
Pekkala kam seit Jahren hierher.
Vor dem Krieg hatten sich hier nach Mitternacht, am Ende ihrer Schicht, vor allem Arbeiter eingefunden – Taxifahrer, Huren, Museumswärter. Dazu die, die sonst nirgendwohin konnten, und manche wie Pekkala, die in ihren leeren, stillen Wohnungen den Einflüsterungen des Wahnsinns zu entfliehen suchten.
Denn im Café Tilsit, wo sie allein, aber nicht einsam waren, konnten sie ihre Dämonen verjagen.
Nach neun Jahren Arbeitslager wusste Pekkala um den Wert dieser seltsamen, schweigsamen Gemeinschaft.
Von den schwarzen sibirischen Wintern in der Kunst der Einsamkeit geschult, hatte er eine Stille erfahren, die so absolut war, dass sie ihren ganz eigenen Ton zu haben schien – ein hastendes Zischen wie das eines durch den Weltraum sirrenden Planeten.
Kurz nach seiner Ankunft in Borodok hatte der Lagerkommandant ihn in die Wälder geschickt, damit die anderen Insassen nicht erfuhren, wer er wirklich war.
Pekkala war im Wald von Krasnagoljana mit der Aufgabe betraut gewesen, die Bäume zu markieren, die von anderen Lagerinsassen gefällt werden sollten. Nicht nur fehlten Pekkala in der weiten Wildnis die Annehmlichkeiten eines zivilisierten Lebens, sondern auch ein Name – in Borodok war er nur als Gefangener 4745 bekannt.
Gestützt auf einen kräftigen Knüppel, einem knorrigen Wurzelstock, aus dem Hufnägel mit Vierkantköpfen ragten, strich er durch die Wälder, tauchte seine Hände in rote Farbe und hinterließ seine Abdrücke auf den von ihm ausgewählten Bäumen. Diese Abdrücke waren oftmals die einzigen Spuren, die andere Lagerinsassen von ihm zu sehen bekamen.
Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Baummarkierers im Wald von Krasnagoljana betrug ein halbes Jahr. Diese Männer arbeiteten allein, fernab von anderen Menschen, ohne die geringste Fluchtmöglichkeit. Sie erfroren oder verhungerten oder starben an Einsamkeit. Wer sich verirrte, wer stürzte und sich ein Bein brach, fiel meistens den Wölfen zum Opfer. Bäume markieren war die einzige Tätigkeit in Borodok, die noch gefürchteter war als die Todesstrafe.
Jeder ging davon aus, dass Pekkala tot sein würde, bevor im Frühjahr das Eis aufbrach. Neun Jahre später war er aber immer noch in den Wäldern und hatte damit länger durchgehalten als jeder andere Baummarkierer im Gulag.
Dreimal im Jahr wurden ihm am Ende eines Waldwegs Nahrungsmittel und andere Güter abgestellt. Petroleum, Dosenfleisch, Nägel. Um alles andere musste er sich selbst kümmern. Nur selten wurde er von den Holzfällern in den Wäldern gesichtet. Was sie erhaschten, war ein Wesen, das mit einem Menschen kaum mehr etwas gemein hatte. In seiner mit roter Farbe verkrusteten Gefängniskleidung, mit seinen langen Zottelhaaren glich er eher einem wilden Tier, dem das Fell abgezogen worden war und das man zum Sterben hatte liegen lassen – und das es trotzdem irgendwie geschafft hatte, zu überleben. Wilde Gerüchte rankten sich um ihn: Er esse Menschenfleisch, er trage einen Brustpanzer aus den Knochen derer, die in den Wäldern verschwunden waren, er habe eine Mütze aus zusammengenähten Skalpen.
Sie nannten ihn den Mann mit den blutigen Händen. Keiner außer dem Kommandanten von Borodok wusste, woher dieser Sträfling gekommen oder wer er früher gewesen war.
Die gleichen Männer, die eine Heidenangst davor hatten, ihm über den Weg zu laufen, hatten nicht die geringste Ahnung, dass er Pekkala war – dessen Namen sie einst angerufen hatten wie ihre Vorfahren die Götter.
Nach der langen Zeit in den Wäldern hatten sich einige Gewohnheiten erhalten. Natürlich hatte Pekkala in seiner Wohnung ein Bett, nur schlief er nie darin, sondern zog die harten Bodendielen und seinen zu einem Kissen zusammengerollten Mantel vor. Er trug immer die gleiche Kleidung – einen halblangen, zweireihigen Mantel, schwere braune Cordhosen und eine graue Weste –, unabhängig von Jahreszeit oder Anlass. Und dank des Cafés Tilsit nahm er sein Abendessen gern mitten in der Nacht zu sich, so wie er es auch in Sibirien getan hatte.
Im sechsten Kriegsjahr saßen fast nur noch Armeeangehörige im Café. Sie waren eine braun uniformierte, nach Stiefelwichse, Machorka und der erdigen Muffigkeit sowjetischer Uniformwolle riechende Horde. Auch die Frauen trugen Uniformen. Soldatinnen schwarze Barette und dunkelblaue Röcke unter ihren Uniformblusen. Andere die kakifarbenen Overalls der Fabrikarbeiterinnen, dazu blaue Kopftücher, unter denen das Haar derer, die in den Munitionsfabriken beschäftigt waren, einen ranzig gelben Farbton angenommen hatte.
Die meisten saßen Ellbogen an Ellbogen an einem der beiden langen Holztische und schlürften ihre Suppen aus flachen Holzschalen.
Nur wenige blickten von ihrem Essen auf, als Pekkala an ihnen vorbeiging, und sahen in der rauchgeschwängerten Luft blinzelnd zu dem großen, breitschultrigen Mann mit seinen grünlich braunen Augen und seinem leichten Silberblick, der allerdings nur auffiel, wenn man ihm direkt in die Augen schaute. Seine dunklen Haare waren stellenweise vorzeitig ergraut, auf seinen wettergegerbten Wangen wucherten Bartstoppel, da er sich seit einer Woche nicht mehr rasiert hatte.
Pekkala nahm nicht an einem der langen Tische Platz, sondern ging zu seinem üblichen Tisch an der Rückwand, wo er die Eingangstür im Blick hatte.
Während er darauf wartete, bedient zu werden, zog er eine abgegriffene Fotografie aus der Manteltasche. Weiße Knitterfalten liefen im Zickzack über die Glanzschicht des Bildes, die einst scharfkantigen Ecken waren längst abgeknickt und eingerissen wie die Ohren eines alten Kampfhundes. Eindringlich betrachtete er das Bild, als würde er es zum ersten Mal sehen. Tatsächlich hatte er das Bild im Lauf der Zeit so oft betrachtet, dass sich ihm die Erinnerung an den Zeitpunkt seiner Aufnahme sehr viel deutlicher ins Gedächtnis geprägt hatte als das Foto selbst. Und dennoch konnte er nicht von ihm lassen. Erst als die Wirtin in ihren ausgetretenen Filzstiefeln auf ihn zuschlurfte, steckte er das Bild wieder weg.
Die Wirtin war eine schlanke, schmalschultrige Frau mit dicken, blonden, glatt nach hinten gekämmten und mit blauem Garn zusammengebundenen Haaren. Ihr Name lautete Valentina.
Sie stellte ihm einen Krug mit Kwass hin: ein halb fermentiertes Getränk, das aussah wie schmutziges Abwaschwasser und nach verbranntem Toast schmeckte.
»Mein lieber Finne«, sagte sie und legte ihm die Hand an die Stirn, als wollte sie prüfen, ob er Fieber habe. »Welche Träume haben dich heute Nacht zu mir geführt?«
»Wollte man Träume haben, müsste man dazu erst mal schlafen«, erwiderte er, »aber das tue ich kaum. Außerdem ist es nach Mitternacht. Dann kann ich gleich ganz aufbleiben.«
»Dann bringe ich dir also die erste Mahlzeit des Tages.«
Er musste nicht nach der Auswahl der Speisen fragen, denn es gab keine. Im Café Tilsit wurde aufgetragen, was gerade gekocht wurde, bislang hatte er aber nie Grund zur Beschwerde gehabt.
Während Valentina in die Küche zurückschlenderte, holte Pekkala erneut das Foto heraus und betrachtete es, als hätte in der Zwischenzeit ein neues Detail auftauchen können.
Das Bild zeigte Pekkala. Er lehnte an einer hüfthohen Steinmauer, hatte die Augen zusammengekniffen und blinzelte ins Sonnenlicht. Er lächelte verlegen und hatte die Arme vor der Brust verschränkt. Sein Gesicht war schmaler als jetzt, die Augen lagen tiefer.
Hinter ihm stand ein Ziegelgebäude mit einem steilen Schieferdach und hohen Bogenfenstern. Über die Mauer spähte eine Gruppe kleiner Kinder, deren Augen groß und rund vor Neugier waren.
Und neben Pekkala stand eine junge Frau mit Stupsnase und sommersprossigen Wangen. Ihre langen Haare waren mit einem Band zusammengebunden, ein Windstoß aber hatte einige Strähnen gelöst. Sie wehten ihr vor dem Gesicht und verbargen fast die Augen, ihre Hand, nur leicht verschwommen wiedergegeben, hatte sie gerade erhoben, um sie zur Seite zu streichen.
Sie hieß Lilja Simonowa. Sie war Lehrerin an der gleich außerhalb des zaristischen Anwesens gelegenen Grundschule von Zarskoje Selo.
Jedes Mal, wenn er das Foto betrachtete, empfand er wieder die unbeschwerte Leichtigkeit jenes Tages, als er diese Frau bei der Feier zum Beginn des neuen Schuljahrs zum ersten Mal gesehen hatte.
Er war nach einem Treffen mit dem Zaren im Alexanderpalast auf dem Weg zu seinem Haus in der Nähe der Alten Stallungen gewesen, als die Schulrektorin Rada Obolenskaja ihm von der Mauer aus zugewinkt hatte. Sie war eine große, würdevolle Frau mit einem grauen Haarknoten und einer versierten Strenge im Blick, dem unerlässlichen Handwerkszeug ihrer Zunft.
»Inspektor!«, rief sie und näherte sich auch schon der Mauer, die zwischen ihnen stand. Eine Kindermeute folgte ihr. »Einige Schüler würden Sie gern etwas näher kennenlernen.«
Insgeheim stöhnte Pekkala auf. Er war müde und sehnte sich nach der Ruhe seines Zuhauses, wollte die Stiefel ausziehen und im Schatten des Apfelbaums hinter seinem Haus ein kaltes Glas Weißwein genießen. Aber er wusste, dass er keine andere Wahl hatte, also blieb er stehen und setzte ein breites Lächeln auf.
In diesem Augenblick fiel ihm eine Frau auf, die er nie zuvor gesehen hatte. Sie stand vor einem zu diesem Anlass auf dem Schulhof errichteten weißen Zelt und trug ein blassgrünes Kleid. Ihre Augen waren leuchtend blau.
Zunächst glaubte er, er müsse sie von irgendwoher kennen, obwohl er überzeugt war, dass sie hier fremd war. Jedenfalls konnte er sich diese plötzliche und unerklärliche Vertrautheit nicht erklären, die sich sofort bei ihm eingestellt hatte.
»Sind Sie wirklich der Inspektor?«, war eine aufgeregte Piepsstimme zu hören.
Wie benommen sah Pekkala hinab zu dem fünfjährigen Mädchen, das hinter Madame Obolenskajas Rock hervorlugte. »Aber ja«, erwiderte er. »Der bin ich.«
Und nun erschien ein weiteres Gesicht unter einem wuscheligen roten Haarschopf. »Haben Sie schon mal den Zaren getroffen?«
»Ja. Tatsächlich war ich erst heute bei ihm.«
Daraufhin war ein kollektiver Seufzer zu vernehmen, und ein halbes Dutzend Kinder verließ die Deckung hinter Madame Obolenskaja und drängte sich dichter an die Mauer.
»Können Sie zaubern? Das sagen nämlich alle«, fragte ein Junge.
»Meine Mutter hat gesagt, dort, wo Sie herkommen, da reitet man auf Eisbären.«
»Na, davon weiß ich nichts«, nuschelte Pekkala. Dann bemerkte er ein äußerst verhaltenes Lächeln in Madame Obolenskajas sonst so ungerührter Miene. »Ach, ein Eisbär, hast du gesagt?«
Der Junge nickte. So neugierig der Junge auch war, so sehr fürchtete er sich auch vor der Antwort auf seine Frage.
»Ja, natürlich!«, rief Pekkala aus. »Wollt ihr etwa sagen, dass man hier nicht auf Eisbären reitet?«
»Nein«, antwortete das rothaarige Mädchen. »Und ich hab auch noch nie einen gesehen.«
»Ich hab es doch gesagt«, verkündete der Junge zu niemand Bestimmtem. »Ich hab es doch gesagt, dass er das macht.«
Während sich weiter die Kinder um ihn scharten, sah Pekkala immer wieder über Madame Obolenskajas Schulter zu der Frau im blassgrünen Kleid.
Was der Rektorin natürlich keineswegs entging. Schließlich drehte sie sich um, um dem Grund seiner Ablenkung auf die Spur zu kommen. »Ah«, sagte sie daraufhin, »Sie kennen unsere neue Lehrerin noch nicht, Lilja Simonowa.«
»Nein«, antwortete Pekkala heiser, als wäre seine Kehle plötzlich voller Staub.
Madame Obolenskaja hob die Hand, schüttelte kurz das Handgelenk und winkte der neuen Lehrerin zu, als wollte sie eine Droschke in der Straße herbeirufen.
Gehorsam, aber nicht ohne einen leisen Anflug von Trotz in ihren Schritten überquerte Lilja Simonowa den Pausenhof.
Was Pekkala ihr in den wenigen Minuten ihrer ersten Begegnung sagte, waren völlig belanglose Nichtigkeiten, dennoch kamen ihm die Worte so mühselig über die Lippen, als hätte er den Mund voller Kirschkerne.
Lilja war höflich, aber reserviert. Sie sagte sehr wenig, worauf er umso mehr redete.
Irgendwann hörte Pekkala ein Klicken, und als er aufblickte, stellte er fest, dass Madame Obolenskaja ein Foto von ihnen beiden gemacht hatte. Sie besaß eine Kodak-Brownie-Kamera, die sie im fotografischen Studio von DeLisle in den Arkaden des Gostiny Dwor in Sankt Petersburg erworben hatte. Seitdem bekannt war, dass die Zarin selbst eine solche Kamera hatte, mit der sie den Alltag ihrer Familie festhielt, waren sie der letzte Schrei in der Stadt.
Madame Obolenskaja hatte kürzlich damit begonnen, von jeder Schulklasse eine Aufnahme zu machen. Jeder Schüler bekam daraufhin einen Abzug, und einer davon hing an der Wand in ihrem Büro.
Unter normalen Umständen hätte Pekkala Madame Obolenskaja zur Seite genommen und ihr höflich erklärt, dass der Film, auf dem dieses Bild festgehalten worden war, zu zerstören sei. Denn auf ausdrücklichen Befehl des Zaren durfte vom Smaragdauge kein Foto gemacht werden.
Bei dieser Gelegenheit aber fragte er sie nur, ob er vielleicht einen Abzug haben könne.
Ein Jahr später lieh sich Pekkala vom Zaren ein Ruderboot, und im Pavillon auf der kleinen Insel mitten im Lamskie-Teich hielt er um Liljas Hand an.
Ein Datum wurde festgelegt, aber zur Trauung kam es nicht mehr. Am Vorabend der Revolution bestieg Lilja einen Zug nach Finnland, der sie auf seiner langen und umständlichen Reise schließlich nach Paris bringen sollte, wohin, wie Pekkala ihr versprach, er so schnell wie möglich nachkommen wolle – sobald der Zar ihm die Abreise gestattete. Aber Pekkala schaffte es nicht mehr, das Land zu verlassen. Einige Monate später wurde er von bolschewistischen Milizionären verhaftet. Und damit begann seine ganz eigene Reise, die ihn letztlich nach Sibirien führen sollte.
Neben den unscharfen Bildern in seinem Kopf war dieses Foto alles, was er besaß, um sich selbst davon zu überzeugen, dass diese seine kostbarste Erinnerung mehr war als nur ein Traumgespinst.
Das Klingeln der kleinen Glocke riss ihn aus diesen Gedanken. Ein weiterer Fremder trat aus der Nacht in den Gastraum des Cafés.
Zur selben Zeit, am Ende eines unbefestigten Wegs auf der windumtosten Insel Usedom an der Ostseeküste, blickte ein hagerer deutscher Offizier hinaus auf die Wellen, die im Nebel über den hellgrauen Sand hereinschlugen.
Zwischen die Zähne hatte er eine kurzstielige Bruyèrepfeife geklemmt, mit der er seinen letzten Tabak rauchte.
Ein weiterer Soldat in der Uniform eines Luftwaffen-Unteroffiziers näherte sich und blieb vor dem Offizier stehen. »General Hagemann«, sagte er leise, als fürchtete er, die Gedanken seines Vorgesetzten zu stören.
Der Offizier nahm die Pfeife aus dem Mund und umschloss den Pfeifenkopf mit seiner lederbehandschuhten Hand. »Ich hoffe, Sie haben zur Abwechslung mal angenehme Neuigkeiten, Feldwebel Behr.«
»Der Nebel wird sich bald auflösen«, antwortete der Unteroffizier. »Und laut Meldung des Beobachtungsschiffes sind die Sichtverhältnisse im Zielgebiet gut.«
Ein Lächeln erschien auf General Hagemanns müdem Gesicht. Trotz seines militärischen Rangs war das Soldatentum ihm eigentlich fremd. Er war Wissenschaftler von Beruf, und seine Arbeit als Leiter der Triebwerksentwicklung in der hochgeheimen V2-Produktionsstätte im nahe gelegenen Peenemünde hatte sein Leben bestimmt – es hatte ihn erst seine Ehe, dann seine Gesundheit und schließlich auch seinen Verstand gekostet, wie er seit Kurzem mutmaßte.
Seit dem ersten erfolgreichen Start einer V2-Rakete im Oktober 1942 arbeitete Hagemann an einer Radarfrequenz-Fernsteuerung namens Diamantstrahl. Das System, wenn es perfektioniert würde, könnte die Zielgenauigkeit der vierzehn Meter hohen Rakete mit ihrem tausend Kilogramm schweren Sprengkopf in höchstem Maße verbessern. Die Entwicklung des Krieges hatte sie gezwungen, die Städte London und Antwerpen anzugreifen, wobei nach Hagemanns Schätzungen nur eine von siebzehn der bislang über tausend abgeschossenen Raketen ihr beabsichtigtes Ziel auch getroffen hatte. Die beträchtlichen Schäden, die den fraglichen Städten zugefügt wurden, waren dem General allerdings nur ein kleiner Trost. Obwohl das Deutsche Reich zwischen den Engländern und Amerikanern im Westen und der Roten Armee im Osten in die Zange genommen wurde, war der General überzeugt, dass diese schreckenerregenden Waffen, sofern die erforderliche Zielgenauigkeit erreicht würde, den Ausgang des Krieges zu ihren Gunsten entscheiden könnten. Und selbst wenn die Niederlage nicht mehr abzuwenden wäre, könnte eine perfektionierte V2 bei separaten Friedensverhandlungen mit den westlichen Alliierten dazu benutzt werden, um die bedingungslose Kapitulation vielleicht doch noch abzuwenden.
Hagemann zweifelte nicht daran, dass nicht nur die Zukunft seines Landes, sondern jede zukünftige Kriegsführung in höchstem Maße vom Projekt Diamantstrahl beeinflusst würde und abhängig war. Der Name des Projekts leitete sich von den glitzernden Partikeln im Abgasstrahl der unter kontrollierten Versuchsbedingungen gestarteten Rakete ab, der einem funkelnden Schweif aus Diamanten glich.
Während im Westen mit Sprengköpfen bestückte V2 auf ihre Ziele abgefeuert wurden, stiegen andere, nur mit Sandsäcken beladene Aggregate in den Nachthimmel auf, um irgendwo in den Gewässern der Ostsee niederzugehen. Sie waren die Opferlämmer des Projekts. Durch Regulierung der aus Flüssigsauerstoff, Alkohol und Wasserstoffperoxid bestehenden Treibstoffmischung – die vorgenommenen Änderungen der Zusammensetzung lagen im Milliliterbereich – versuchte Hagemann, die Zielgenauigkeit zu vervollkommnen.
Die für den heutigen Abend vorgesehene Rakete war mit einem Gerät versehen, das ursprünglich für die Steuerung von Luftabwehrraketen entwickelt worden war. Das für den Einsatz in einer V2 ursprünglich viel zu primitive System hatte eine so große Anzahl von Nachbesserungen erforderlich gemacht, dass Hagemann bei diesem Test fest mit einem weiteren Fehlschlag rechnete.
Feldwebel Behr reichte ihm ein Klemmbrett. »Hier die Details für heute Abend«, sagte er. Er gab ihm eine kleine Stabtaschenlampe, damit der General die Seite beleuchten konnte, wenn er die Zahlenreihen durchging. »Keine einzige liegt innerhalb der üblichen Parameter.« Er schnalzte mit der Zunge und seufzte. Nach so vielen Jahren der Forschung, dachte er, nach Abertausend Experimenten haben wir zwar einiges erreicht, dennoch kommt irgendwann immer der Punkt, an dem wir blind durch die Dunkelheit stolpern. Und wie so oft musste Hagemann sich selbst daran gemahnen, dass es keinen Grund gebe, den Glauben zu verlieren.
»Das mit den Parametern, das stimmt schon«, erwiderte Behr. »Manche Werte liegen darüber, andere darunter. Aber vielleicht gleicht sich ja alles wieder aus.«
Hagemann stieß ein Lachen aus. Er patschte dem Feldwebel auf den Rücken. »Wenn es nur immer so einfach wäre, mein Freund.«
»Soll ich weitergeben, dass sich der Start verzögert?«, fragte Behr. »Wenn Sie noch Zeit brauchen, um die Zahlen neu zu ordnen?«
»Nein.« Hagemann drückte dem Feldwebel das Klemmbrett gegen die Brust. »Sagen Sie ihnen, sie können loslegen.«
»Sie kommen mit zum Prüfstand?«
»Ich bleibe und beobachte den Start von hier aus«, antwortete Hagemann. Er fürchtete, sein Untergebener würde bemerken, wie sehr es ihm an Vertrauen mangelte. An manchen Tagen konnte er es besser verbergen als an anderen.
»Zu Befehl.« Feldwebel Behr schlug die Hacken zusammen und entfernte sich wieder. Kurz bevor ihn die Dunkelheit verschluckte, drehte er sich noch einmal um. »Viel Glück, Herr General.«
»Was?«, fragte Hagemann. »Was haben Sie gesagt?«
»Ich wünsche Ihnen viel Glück«, kam die Antwort aus der Nacht.
»Ja«, erwiderte Hagemann schroff. »Das können wir alle gebrauchen.«
Mit einem Mal hatte er ein schlechtes Gewissen, weil er so wenig für die Moral des technischen Stabs tat. Noch nicht einmal eine Flasche Schnaps gegen die Kälte hatte er den Männern spendiert, wenn sie in ihre hastig errichteten Notunterkünfte in Karlshagen an der Südspitze der Insel zurückkehrten. Die ursprünglichen Quartiere, die nicht nur fließend warmes Wasser, sondern auch eine erstklassige Messe und sogar ein Kino besessen hatten, waren im August 1943 durch einen britischen Bombenangriff zerstört worden. Obwohl man manche Anlagen der weitverzweigten Versuchsanstalt wiederaufgebaut hatte, war vieles doch Ruine geblieben. Zudem hatte der sowjetische Vormarsch es erforderlich gemacht, den Großteil der Belegschaft in den Harz zu evakuieren.
In diesem Moment hörte er das vertraute Zischen des Raketenmotors der V2. Er spürte regelrecht, wie das Aggregat von der Betonplatte des Prüfstands abhob, als wäre das gewaltige Gerät ein Teil seines eigenen Körpers. Und eine Sekunde später, als die Rakete in den Nachthimmel aufstieg, sah er ihre mohnrote Abgasflamme.
Fast augenblicklich wurde sie vom feuchten Nebel verschluckt.
Hagemann machte kehrt und trat den Rückweg zum Meillerwagen an, einem eigens entwickelten Anhänger zum Transport und Aufrichten der Rakete.
Es gab jetzt nichts mehr zu tun, außer auf den Bericht des Beobachtungsschiffes zu warten, um zu erfahren, wo die Rakete niedergegangen war.
Er sah die winzigen Glühpunkte der Zigaretten, als sich die Mannschaft daranmachte, die Abschussplattform abzubauen, damit die Aufklärungsmaschinen der Alliierten bei Tag nichts mehr zu fotografieren hatten. Sogar der verräterische Kreis aus verbrannter Erde, der nach der Zündung am Boden zurückblieb, wurde von Männern mit Holzrechen sorgfältig entfernt – sie gingen dabei so ernst und feierlich ihrer Arbeit nach wie Sand rechende buddhistische Mönche in einem Zen-Garten.
Als sich Hagemann ihnen näherte, drückte er den Rücken durch und setzte eine zuversichtliche Miene auf. Er wusste, sie würden bei ihm Bestätigung dafür suchen, dass sich ihre Mühen und Opfer auch lohnten.
Weit draußen in den kalten Gewässern der Ostsee rollte der Trawler Gullmaren in der aufkommenden Brise. Der Frühling war erst spät gekommen, gelegentlich schlugen nach wie vor Eisschollen gegen den Holzrumpf, was laute Flüche des Rudergängers zur Folge hatte.
Unter Deck im Eisraum, wo sonst der Fang verstaut wurde, hatte sich die restliche aus drei Mann bestehende Crew um ein großes Funkgerät versammelt.
Der Apparat war an einen Tisch geschraubt, damit er bei schwerem Seegang nicht wegrutschte. Vor dem Funkgerät war eine Enigma-Verschlüsselungsmaschine angebracht. Sie glich entfernt einer Schreibmaschine, nur hatte sie dort, wo man Typenhebel und Wagen erwartete, vier Metallwalzen. Die Kerben an diesen Walzen korrespondierten mit den Buchstaben des Alphabets und konnten je nach Belieben angeordnet werden, sodass Sender und Empfänger die Konfiguration nach Belieben anpassen konnten. Betätigte man die Tasten der Maschine, wurde jeder einzelne Buchstabe durch die jeweilige Verdrahtung der Walzen separat verschlüsselt. Dieses System ermöglichte für jede übermittelte Nachricht Hunderttausende von Permutationen.
Der Funker war über das Gerät gebeugt und drückte sich die Kopfhörer an die Ohren. Gegen die feuchte Kälte hatte er eine schwarze, halblange und kragenlose Lederjacke übergezogen, wie sie sonst deutsche U-Boot-Maschinisten trugen.
Neben ihm stand Oskar Hildebrand, der Kapitän der Gullmaren. Er schwankte in der Dünung leicht hin und her.
Hildebrand war kein Fischer, auch wenn er in seinem verdreckten weißen Rollkragenpullover und mit der schwarzen Wollmütze so aussah.
Tatsächlich bekleidete er den Dienstrang eines Kapitänleutnants der deutschen Kriegsmarine und war seit über einem Jahr als Verbindungsoffizier zur Heeresversuchsanstalt in Peenemünde abgestellt.
»Und?«, fragte Hildebrand den Funker.
»Noch nichts, Kaleu.« Kaum hatte der Funker das ausgesprochen, zuckte er zusammen, als hätte er einen Stromstoß abbekommen. Im gleichen Augenblick blitzten Lichter im Lampenfeld der Enigma auf. »Start ist erfolgt«, sagte er.
Hildebrand wusste somit, dass ihnen noch etwa sechs Minuten blieben, bis die V2 das Zielgebiet erreichte. Seine Aufgabe war es, so genau wie möglich den Einschlagspunkt zu bestimmen und die Informationen an General Hagemann zu übermitteln.
Seit fast einem Jahr diente Hildebrand schon als Beobachter und durfte mit ansehen, wie sich die Raketen durch den Aufprall auf den Wellen selbst vernichteten. Ursprünglich war er als Kommandant eines Schnellboots an der französischen Atlantikküste stationiert gewesen. Sein neues Kommando in der Ostsee hatte er anfangs als so sehr unter seiner Würde angesehen, dass er – selbst wenn er darüber hätte reden dürfen – schon aus Scham geschwiegen hätte. Es war ihm nur ein kleiner Trost, dass er seinen alten Funker, den Steuermannsmaat Grimm, und seinen Rudergänger, den Matrosenobergefreiten Barth, hatte behalten dürfen. Barth, in den Jahren zuvor gewohnt, die drei Daimler-Benz-Motoren des Schnellboots mit insgesamt 2500PS Leistung zu steuern, grämte sich, dass er sich hier mit dem schwerfälligen und eigenwilligen Diesel herumschlagen musste.
In den folgenden Monaten aber, als fast alle ihre Kameraden aus der Kriegsmarine von ihren alten Kommandos abgezogen und der Infanterie zugewiesen wurden, um in den Fleischwolf der russischen Front geworfen zu werden, wussten Hildebrand und seine zweiköpfige Besatzung ihren scheinbar belanglosen Einsatz sehr zu schätzen.
Sah man davon ab, dass sie den Befehl hatten, unter der Flagge des neutralen Schweden zu fahren, wofür sie sofort erschossen worden wären, falls sie von einem der in diesem Gebiet operierenden russischen Schiffe kontrolliert würden, befanden sie sich in relativer Sicherheit.
Hildebrand fürchtete lediglich, von einer Rakete getroffen zu werden. Dass diese Waffen keinen Sprengkopf mit sich führten, beruhigte ihn kaum – allein das Eigengewicht der sogenannten Aggregate sowie ihre Endgeschwindigkeit reichten aus, um ihn, sein Boot und seine Mannschaft zu pulverisieren.
Hildebrand war beileibe kein Ingenieur, hatte sich aber zumindest so viel zusammenreimen können, um zu wissen, dass die ständige Bombardierung der Ostsee der Verbesserung des Steuerungssystems diente. Und nach allem, was er hier draußen auf dem Meer mit eigenen Augen gesehen hatte, vermutete er, dass die zuständigen Techniker noch einen weiten Weg vor sich hatten.
»Ich geh mal lieber rauf«, verkündete Hildebrand. Aus einem Staufach am Niedergang nahm er sich ein schweres Zeiss-Fernglas mit schwarzer Gummierung und Schutzklappen. Das Dienstglas war ihm als S-Boot-Kommandant ausgegeben worden, und hätten die Gläser alles, was Hildebrand mit ihnen anvisiert hatte, in sich aufbewahrt, dann hätte man die Kreidefelsen von Dover sehen können, brennende amerikanische Tanker vor dem Hafen von Portsmouth wären sichtbar geworden sowie die Marinebasis La Pallice an der bretonischen Küste, die, wie er nach der Rückkehr von einem seiner Einsätze feststellen musste, durch einen alliierten Luftangriff völlig zerstört worden war.
Sie mochten ihm sein Schnellboot genommen haben, aber er würde sich niemals von diesem Fernglas trennen. Er schlang sich den Ledergurt um den Hals und stieg den Niedergang hinauf, öffnete die Luke und trat aufs Deck.
Der erste Atemzug in der kalten Luft fühlte sich an, als hätte er Pfeffer in die Lunge bekommen.
Eis hatte sich auf das Schleppnetz gelegt, das achtern auf einer großen horizontal angebrachten Metalltrommel aufgewickelt war. Sogar jetzt noch fiel die Temperatur oftmals unter den Gefrierpunkt. Er ging sofort zum Netz und schlug gegen das Eis, das sich in großen Brocken löste. Jedes passierende russische Fahrzeug hätte anhand des vereisten Netzes sofort erkannt, dass sie mit der Fischerei nicht viel am Hut hatten.
Die Tür zum Ruderhaus ging auf, und Barth steckte den Kopf heraus. »Bist du das, Kaleu?«, fragte er.
»Mach nur das Netz frei«, erwiderte Hildebrand und sah, dass ihre kleine, an einem Besenstiel am Bug befestigte schwedische Flagge ebenfalls vereist war. Hildebrand trat an die Flagge und schüttelte das Tuch, bis die gelben und blauen Farben wieder zu erkennen waren.
»Der Führer dankt es dir, wenn du so pingelig bist«, bemerkte der Rudergänger.
»Und er weiß bestimmt auch deinen Sarkasmus zu schätzen«, antwortete Hildebrand.
Barth richtete den Blick auf den Himmel. »Wann soll sie kommen?«
»Jederzeit.«
Der Rudergänger nickte. »Kalt heute Nacht.«
»Halt nach Eisschollen Ausschau.«
»Wir haben schon ein paar gerammt auf dieser Fahrt. Wenn das so weitergeht, knallt uns noch mal eine durch den Rumpf.« Er spuckte aufs Deck und schloss die Tür hinter sich.
Hildebrand, der wieder allein war, suchte zwischen den Sternen nach der Flamme der V2. Er nahm das Fernglas vor die Augen und richtete es auf den Dreiviertelmond. Der Ptolemaeus-Krater – eine Landschaft, die ihn an die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs erinnerten – geriet in sein Blickfeld.
»Kaleu!«, rief Barth.
Hildebrand ließ das Fernglas sinken.
Der Rudergänger deutete nach backbord achtern.
Hildebrand sah es jetzt – die weiße Bugwelle eines schmalen, durch die Gewässer pflügenden Schiffes. Kurz darauf erkannte Hildebrand den gepanzerten Ruderstand eines sowjetischen Patrouillenboots, die primär zur U-Boot-Jagd eingesetzt wurden. Hildebrand hatte bereits einige von ihnen gesichtet, seitdem er in der Ostsee unterwegs war. Außerdem hatte er von regelrechten Duellen zwischen den sowjetischen Booten und finnischen U-Booten gehört, die aufgetaucht gestellt worden waren. Da die Finnen nicht abtauchen konnten, weil sie sonst chancenlos gegen die russischen Wasserbomben gewesen wären, blieben sie an der Oberfläche und lieferten sich mit den russischen Seeleuten Maschinengewehrgefechte, bis die Boote so von Einschüssen durchlöchert waren, dass oftmals beide sanken. Es gab auch andere Geschichten; Geschichten von überladenen Frachtschiffen, die mit deutschen Zivilisten und verwundeten Soldaten an Bord vor dem sowjetischen Vormarsch flohen und das noch von deutschen Truppen besetzte Dänemark anzusteuern versuchten. Diese Schiffe wurden zu einer leichten Beute für die russischen Boote. Tausende von Frauen, Kindern und Soldaten verloren dabei ihr Leben. Vielleicht auch Zehntausende. Die genaue Zahl würde wohl nie bekannt werden.
Direkt vor Hildebrand lag eine Holzkiste, in der normalerweise aufgeschossene Taue aufbewahrt wurden. Sie enthielt zwei Panzerfäuste, ein Dutzend Stielhandgranaten und drei Schmeißer-MPi – genug, damit sich die Besatzung der Gullmaren zumindest notdürftig verteidigen konnte, falls die Russen ihnen zu sehr auf die Pelle rückten. Denn der Trawler war natürlich nicht gepanzert. Der Rumpf war bereits angefault und von Schiffsbohrwürmern angegriffen. Die alte Dieselmaschine hatte absolut keine Chance, selbst dem langsamsten russischen Patrouillenboot zu entkommen. Hildebrand hatte immer darauf gebaut, dass ihr größter Schutz ihre absolute Schutzlosigkeit war. Und die blau-gelbe schwedische Fahne, die dank seiner Pingeligkeit jetzt auf ihrem Besenstiel vor sich hin flatterte.
Mit der Stiefelspitze öffnete Hildebrand den Deckel der Holzkiste und betrachtete die Waffen vor sich. Und während sich der Nebel auf den schwarzen Lauf der MPi und die matte Röhre der Panzerfaust legte, versuchte Hildebrand zu kalkulieren, wie lange er brauchen würde, um eine der Handgranaten zu ergreifen, die Sicherungskappe unten am Stiel wegzuschrauben, die Abreißschnur innerhalb des hohlen Stiels abzureißen und sie nicht auf die Russen zu schleudern, sondern nach unten in den Eisraum, um die Enigma-Maschine zu zerstören, bevor sie den Russen in die Hände fiel.
Grimm würde durch die Explosion natürlich getötet werden, aber die Russen würden ihn sowieso erschießen, wenn sie herausfanden, wer er war. Keiner von ihnen würde überleben, davon war Hildebrand überzeugt.
Das Patrouillenboot kam näher, Hildebrand hörte, wie der russische Rudergänger die Maschine drosselte. Dann ertönte ein scharfer Befehl, ein metallisches Klacken, und plötzlich war der Trawler in das Magnesiumlicht eines Suchscheinwerfers getaucht.
Mit zusammengekniffenen Augen hob Hildebrand die Hand und rief: »Hur mår du?« – die einzigen Worte Schwedisch, die er kannte.
Während der Suchscheinwerfer des Patrouillenboots über den Rumpf des Trawlers strich, sah Hildebrand den Maschinengewehrstand auf dem Vordeck. Ein russischer Seemann stand hinter dem schweren MG und lehnte sich gegen die halbmondförmigen Schulterpolster, um ihn jederzeit mit seinen 37-mm-Patronen in Stücke zu schießen.
Trotz der Kälte lief Hildebrand jetzt der Schweiß über den Rücken.
Das Patrouillenboot war mit ihnen mittlerweile auf gleicher Höhe und machte kaum noch Fahrt.
Er erblickte den Kommandanten, der vom offenen Ruderhaus heruntersah. Er trug eine eng anliegende Pelzmütze und hatte mit seinen dicken Pranken die Schutzhaube des Turms umfasst. Er lächelte nicht.
Das galt auch für die übrigen Besatzungsmitglieder, die alle schwere Tuchmäntel mit dicken Pelzkragen trugen und mit PPSch-Maschinenpistolen mit fünfzig Schuss fassendem Trommelmagazin bewaffnet waren.
»Hur mår du?«, rief Hildebrand erneut und winkte überschwänglich, während er wie ein Betrunkener hin und her schwankte, um die Bewegung des Decks unter seinen Füßen auszugleichen.
Der Kommandant wandte sich an einen der Männer neben ihm.
Der andere lächelte.
Der Kommandant lachte. Er hob eine Hand und winkte zum Gruß.
»Das war’s«, murmelte Hildebrand, während er mit zusammengebissenen Zähnen lächelte. »Hau schon ab, Bolschewik.«
Die Maschine des Patrouillenboots heulte auf, und das Boot entfernte sich und verschwand im salzigen Nebel.
Hildebrand versuchte zu schlucken, aber seine Kehle war so zugeschnürt, dass er sich an einem Tau festhalten und über die Bordwand beugen musste, um auszuspucken. Und dabei schwang das Fernglas an seinem Lederriemen hin und her.
Sein Herz setzte einen Schlag aus. Er hatte es ganz vergessen.
Wie konnte den Sowjets entgangen sein, dass ein schwedischer Fischer ein deutsches Fernglas um den Hals hängen hatte? Die Antwort konnte nur lauten: Es war ihnen nicht entgangen. Er zog eine Panzerfaust aus der Holzkiste, und da er nie eine abgefeuert hatte, fragte er sich, wie zielgenau sie war.
Hildebrand starrte in die Schwärze und wartete darauf, dass das Patrouillenboot zurückkehrte und die nächtliche Luft von den Strahlen der Leuchtspurmunition zerrissen würde, wenn die russischen Waffen sein Schiff vernichteten.
Aber das Patrouillenboot tauchte nicht mehr auf.
Er stellte sich vor, wie der russische Kommandant Wochen oder sogar Jahre später aus einem Traum hochschreckte und plötzlich seinen Irrtum bemerkte.
Wieder lächelte Hildebrand, diesmal aber nicht aus Angst.
In diesem Moment flackerte etwas vor der zerfurchten weißen Mondscheibe auf.
Hastig griff er zum Fernglas und entdeckte gleich darauf den feurigen Abgasstrahl der V2, die einen weißen Kondensstreifen in das Firmament zeichnete. Und noch etwas, etwas noch nie Dagewesenes. Zwischen der kreidigen Dunstspur und dem Gasbrenner der Rakete sah er ein glitzerndes Licht, als hätte sich das Universum umgekehrt und als blicke er nicht mehr hinauf, sondern hinab in die Tiefe des Meeres, und als wäre die V2 nicht mehr ein zusammengeschweißtes Stück Hochtechnologie, sondern ein riesiges und elegantes Meereslebewesen, dem ein Schwarm winziger Fische folgte, die seinen Weg mit ihren silbrigen Leibern illuminierten.
»Diamanten«, flüsterte Hildebrand. So verzaubert war er von der einzigartigen Schönheit dieses Augenblicks, dass er erst, als die Rakete in einer Höhe von etwa einem Kilometer über ihn hinwegflog, bemerkte, dass sie nicht im Sinkflug begriffen war, wie es bei allen anderen Raketen der Fall gewesen war. »Sind wir auch wirklich im Zielgebiet?«, schrie er dem Rudergänger zu.
Die Tür zum Ruderhaus ging auf, und Hildebrand war gezwungen, sich zu wiederholen.
»Ja«, antwortete Barth. »Warum?« Bevor Hildebrand etwas erwidern konnte, bemerkte der Rudergänger ebenfalls, dass die V2 über sie hinwegflog.
»Sollte die nicht langsam runterkommen?«, fragte Barth.
»Ja, sollte sie«, sagte Hildebrand. »Vorausgesetzt, wir sind an der richtigen Stelle.«
»Sind wir, Kaleu. Ich hab’s nachgeprüft.«
»In welche Richtung ist sie unterwegs?«, fragte Hildebrand.
»Nach Norden. Direkt nach Norden.«
Hildebrand stieg den Niedergang in den Eisraum hinunter.
»Alles in Ordnung?«, fragte Grimm und nahm die Kopfhörer ab.
»Eine Karte!«, rief Hildebrand. »Ich brauch eine Karte der Gegend hier.«
Grimm legte ihm eine Seekarte auf den Tisch, nachdem er mehrere Stifte, Winkelmesser und entschlüsselte Enigma-Transkripte zur Seite geräumt hatte.
Hildebrand studierte die Karte und fuhr mit dem Finger die Nord-Süd-Achse entlang, bis er auf die fünfzig Kilometer voraus liegende Insel Bornholm stieß. »Scheiße«, schrie Hildebrand. »Ich glaube, wir erklären Schweden gerade den Krieg.«
»Bornholm gehört zu Dänemark«, bemerkte Grimm nur tonlos.
»Völlig egal, zu wem sie gehört. Schick eine Meldung an den General und frag ihn, was zum Teufel hier vor sich geht.«
Pekkala arbeitete sich durch die Schale mit der Sauerampfer-Pilz-Suppe, die ihm Valentina serviert hatte, und blickte plötzlich auf. Er fühlte sich beobachtet.
Sein Blick fiel auf einen uralten Mann mit dichtem Vollbart, der ihn anstarrte.
Verlegen lächelte der Alte, als er bemerkte, dass er entdeckt worden war, und wandte sich wieder seinem Essen zu.
Es war nicht das erste Mal, dass Pekkala dieses Kribbeln spürte, wenn er beobachtet wurde.
Manche wie der Alte, der einst der Wache des zaristischen Winterpalasts angehört hatte, erkannten sein Gesicht von früher. Andere hatten nur Gerüchte über den stillen mitternächtlichen Gast gehört, der im gesamten Sowjetreich als das Smaragdauge bekannt war.
Pekkala war in Lappeenranta in Finnland geboren, zu einer Zeit, als das Land noch Teil des russischen Reichs gewesen war. Seine Mutter, eine Lappin, stammte aus Rovaniemi im Norden.
Im Alter von achtzehn Jahren war Pekkala auf Wunsch seines Vaters nach Sankt Petersburg gegangen, um sich beim Finnischen Garderegiment des Zaren Nikolaus II. zu melden. Bei der Ausbildung war er vom Zaren selbst als sein persönlicher Sonderermittler auserwählt worden. Eine Stellung, die es bis dahin nicht gegeben hatte und die Pekkala mit einer Machtfülle ausstattete, die bis zu diesem Zeitpunkt undenkbar gewesen war.
Zur Vorbereitung durchlief er verschiedene Ausbildungen, erst bei der Polizei, dann bei der Staatspolizei – der Gendarmerie – und schließlich bei der zaristischen Geheimpolizei, der Ochrana. In dieser Zeit wurden ihm Türen geöffnet, von denen die wenigsten wussten, dass es sie überhaupt gab. Zum Abschluss überreichte der Zar ihm das einzige Dienstabzeichen, das er jemals tragen sollte – eine schwere Goldscheibe mit dem Durchmesser von der Länge eines kleinen Fingers. In der Mitte befand sich eine ovale weiße Emailleeinlage, in der wiederum ein großer runder Smaragd saß. Zusammen ergaben sie die unverkennbare Gestalt eines Auges. Pekkala würde nie vergessen, wie er dieses Abzeichen zum ersten Mal in der Hand gehalten, wie er mit der Fingerspitze über das Auge gestrichen und die sanfte Erhebung des Edelsteins gespürt hatte – wie ein Blinder, der Brailleschrift ertastete.
Aufgrund dieses Abzeichens wurde Pekkala als das Smaragdauge bekannt. Sonst wusste die Öffentlichkeit wenig über ihn. Da es an nachweisbaren Fakten mangelte, rankten sich bald Legenden um ihn, unter anderem, dass er kein Mensch sei, sondern ein von den schwarzen Künsten eines arktischen Schamanen heraufbeschworener Dämon.
In seinem Dienst war Pekkala einzig und allein dem Zaren unterstellt. In dieser Zeit lernte er die Geheimnisse des Reichs kennen, und als dieses Reich unterging und jene, die diese Geheimnisse geteilt hatten, sie mit in ihr Grab nahmen, musste Pekkala nicht wenig überrascht feststellen, dass er immer noch am Leben war.
Während der Revolutionswirren wurde er festgenommen und nach monatelangen Verhören in den Gefängnissen der Lubjanka und Lefortowo von den Bolschewiken wegen Straftaten gegen den Staat verurteilt und ins Arbeitslager Borodok verbannt. Dort hatte er eine Strafe von nicht weniger als fünfundzwanzig Jahren zu verbüßen.
Neun Jahre davon hatte Pekkala hinter sich, als ein junger Offizier aus dem Büro für Besondere Operationen im Wald von Krasnagoljana erschien und verkündete, dass ihm die restliche Strafe erlassen würde, falls er sich bereit erklärte, für Stalin zu arbeiten, so wie er es einst für den Zaren getan hatte.
Als Zeichen von Stalins gutem Willen brachte der Offizier einen Beutel mit, der die beiden Trophäen enthielt, die Pekkala bei seiner Verhaftung abgenommen worden waren und die er nun berechtigt war zurückzugeben.
Zum einen handelte es sich um einen Webley-Revolver Kaliber .455 mit Messinggriff, ein Geschenk des englischen Königs George V. an seinen Cousin, den Zaren Nikolaus II., den dieser als Ausdruck seiner Wertschätzung an Pekkala weitergereicht hatte. Zum anderen um das Smaragdauge, das Stalin in einem purpurroten Samtbeutel in seiner Schreibtischschublade aufbewahrt hatte. Stalin hatte das Abzeichen, eines seiner kostbarsten Besitztümer, oft herausgenommen, wenn er sich in seinem Kremlbüro allein wähnte, hatte es in der Hand gewogen und versunken zugesehen, wie der dunkelgrüne Edelstein das Sonnenlicht aufsog, als wäre er lebendig.
Seitdem war Pekkala als Sonderermittler tätig, der sich einzig und allein gegenüber dem Herrscher über das Sowjetvolk zu verantworten hatte, und seitdem herrschte zwischen den beiden ein brüchiger Waffenstillstand.
Da sind Sie ja!«, rief der Major der Roten Armee aus, als er in die miefige Luft des Cafés Tilsit trat. Er war groß und drahtig, hatte rosige Wangen und hoch geschwungene Augenbrauen, was ihm einen Gesichtsausdruck unablässigen Erstaunens verlieh.
An jedem Ärmel seiner eng anliegenden Gymnastiorka trug er einen roten Stern mit einer Bordüre aus Goldfäden, die seinen Rang als Kommissar anzeigten. Die Reithose von der matten Farbe verfaulter Äpfel steckte in auf Hochglanz gewienerten, kniehohen Stiefeln. Er durchquerte den Raum und setzte sich zu Pekkala an den Tisch.
Hatten die Café-Gäste Pekkala noch mit offener Neugier bestaunt, wandten sie jetzt, nachdem sie die roten Sterne an den Ärmeln bemerkt hatten, den Blick ab. Jetzt kratzten sie den Dreck unter ihren Fingernägeln hervor, vertieften sich in ihre Zeitungsfetzen oder widmeten sich mit plötzlichem Eifer ihrer Suppe.
Der Mann an Pekkalas Tisch war derselbe Offizier, der durch die sibirische Wildnis gestapft war und ihm die Neuigkeit unterbreitet hatte, dass Stalin seine Dienste benötige.
Seit vielen Jahren arbeiteten sie nun schon zusammen und hatten gelernt, die Eigenheiten des jeweils anderen zu tolerieren.
Kirow fasste über den Tisch, griff sich den halb geleerten Kwass-Becher, nahm einen Schluck und zuckte zusammen. »Zum Frühstück?«, fragte er.
Pekkala antwortete mit einer Gegenfrage. »Was führt Sie zu dieser unchristlichen Stunde hierher?«
»Ich hab eine Meldung zu übermitteln.«
»Dann übermitteln Sie, Major Kirow.«
»Sie werden im Kreml erwünscht.«
»Warum?«
»Es duldet keinen Aufschub, was immer es sein mag«, antwortete Kirow und erhob sich.
In der Heeresversuchsanstalt in Peenemünde hatte General Hagemanns technisches Personal den »Starttisch«, die mobile Abschussrampe, schon wieder zerlegt. Die schweren, von zahlreichen Zündvorgängen versengten Träger waren auf den Meillerwagen verladen, dessen Hinterachse jeweils mit Doppelrädern versehen war, damit er das Gewicht einer voll beladenen Rakete tragen konnte.
Die Leute hockten auf ihren Helmen, rauchten Zigaretten, deren »Tabak« mittlerweile zum größten Teil aus Eicheln und Maisbart bestand, und warteten auf den Abrückbefehl. Der Auf- und Abbau des Starttisches und der Rampe war ihnen längst in Fleisch und Blut übergegangen – gezwungenermaßen, da ihr Leben davon abhing, wie schnell sie die Arbeiten verrichteten. Tagsüber, wenn der Feind das verräterische Feuer eines V2-Starts entdeckte, war es bloß eine Frage von Minuten, bis die feindliche Artillerie das neue Ziel anvisiert hatte oder Jagdflugzeuge mit panzerbrechender Bewaffnung in Baumwipfelhöhe auftauchten. Bis dahin mussten die mobilen Raketeneinheiten wieder verschwunden sein, was man den Männern kaum ein zweites Mal sagen musste.
Bei nächtlichen Raketenstarts war es anders, vor allem in relativ großer Entfernung zur Front wie hier. Man musste weder feindliche Artilleriebeobachter fürchten noch Jagdbomber, die so lange nicht in den Himmel aufstiegen, bis sie sahen, welches Ziel sie anzugreifen hatten.
Für die Männer des V2-Programms war die Dunkelheit das Einzige, auf das sie noch vertrauen konnten. Das und ihre Fähigkeit, zu verschwinden, bevor die Metallstreben der Abschussrampe wieder erkaltet waren.
General Hagemann wartete im Funklaster. Die dort untergebrachte Enigma-Maschine, die auf die gleiche Walzenkonfiguration eingestellt war wie die auf dem Trawler, sollte Kommandant Hildebrands Meldung über die Koordinaten der Einschlagstelle empfangen.
Es war der letzte Testlauf für mindestens eine Woche. Grund dafür war der Abzug der noch verfügbaren, auf London und den Hafen von Antwerpen gerichteten V2-Raketen aus ihren Stellungen in Holland, damit sie gegen Ziele im Osten eingesetzt werden konnten. Hagemann würde vollauf damit beschäftigt sein, den Transport zu beaufsichtigen sowie die neuen Startplätze festzulegen.
Damit endeten seine Sorgen aber nicht.
Denn der Druck, den das Oberkommando der Wehrmacht auf ihn ausübte, damit er das von Anfang an vorhandene Steuerungsproblem der V2 endlich in den Griff bekam, würde damit noch zunehmen. Aufgrund der ausgesprochen optimistischen Vorhersagen von Propagandaminister Goebbels war der deutschen Bevölkerung weisgemacht worden, dass sich durch die neuen Wunderwaffen das Blatt in diesem Krieg noch wenden würde. Sogar Angehörige des Oberkommandos glaubten daran. Aber die Zeit lief ihnen davon. Nicht mehr lange, und selbst Wunder würden das Deutsche Reich nicht mehr retten können.
Im fahlen roten Licht des Funkgeräts sah Hagemann, wie der Funker die von der Enigma-Maschine ausgespuckte Meldung des Trawlers auf ein Blatt kritzelte. Sie war länger als sonst. Sofort mutmaßte Hagemann, dass etwas schiefgelaufen sein musste.
Der Funker war mit der Transkription fertig, riss das Blatt ab und reichte es dem General.
Als Erstes bemerkte Hagemann, dass keine Zahlen notiert waren. Diese verwiesen sonst auf die Koordinaten, wo die Rakete oder »Nadel«, wie sie in diesen Meldungen bezeichnet wurde, niedergegangen war. Diese Zahlen würden dann mit den für den Flug getroffenen Einstellungen verglichen, worauf man feststellen konnte, ob die Zielgenauigkeit wirklich verbessert worden war.
Stattdessen musste er lesen: »Nadel über Ziel Richtung Nordnordost hinausgeschossen. Ungewöhnliches Abgasmuster zu beobachten.«
Als Hagemann den letzten Satz las, wurde er kreidebleich. »Eine Antwort«, krächzte er.
Der Funker legte die beiden Zeigefinger auf die Tastatur der Enigma-Maschine. »Bereit«, sagte er leise.
»Beschreiben Sie ungewöhnliches Abgasmuster.«
Der Funker gab die vier Wörter ein.
Sie warteten.
»Warum brauchen die so lange?«, blaffte Hagemann unwirsch.
Bevor der Funker etwas erwidern konnte, zeigte das aufblitzende Lampenfeld den Eingang einer neuen Nachricht an.
Eilig entschlüsselte der Funker den Inhalt. »Er schreibt: ›Lichthof eine silberne Wolke.‹«
Dem General schlug das Herz in der Brust. »Silberne Wolke?«
»Richtig, Herr General. Soll ich um Klarstellung bitten?«
»Nein«, antwortete Hagemann. »Eine neue Meldung, diesmal ans Führerhauptquartier.«
Der Funker blickte auf. Er stutzte und war sich nicht ganz sicher, ob er seinen Vorgesetzten richtig verstanden hatte.
»Gibt es ein Problem?«, fragte Hagemann.
»Nein, Herr General!« Der Funker, die Hände über der Tastatur, wartete.
»Schreiben Sie: ›Nadel über Zielgebiet hinausgeschossen.‹«
»Das ist alles?«
»Nein.« Aber dann zögerte Hagemann.
»Herr General?«
»›Diamantstrahl beobachtet.‹ Fügen Sie das noch an. Und schicken Sie es ab.«
Seit fast zwei Jahren hatte Hitler auf diese Meldung gewartet. Hagemann hoffte inständig, dass sich die Leute draußen auf der Ostsee bei ihrer Beobachtung nicht geirrt hatten.
Das technische Personal hatte mittlerweile bemerkt, dass etwas Ungewöhnliches vor sich ging. Die Männer erhoben sich von ihren Helmen, die nun wie große, plötzlich mitten aus der Straße gesprossene Pilze aussahen, und trotteten langsam zum Funklaster.
Unter ihnen war auch Feldwebel Behr. »Was ist, Herr General?«, fragte er.
Hagemann reichte ihm die soeben eingetroffene Meldung.
»Diamantstrahl«, flüsterte Behr.
Das Wort machte unter der kleinen Gruppe schnell die Runde.
Hagemann sah auf die Liste mit den Berechnungen, die er auf seinem Klemmbrett vor sich hatte. So lange hatte er darauf gewartet, dass der Diamantstrahl Wirklichkeit würde, so oft hatte er sich vorgestellt, welche Gefühle diese Worte bei ihm auslösen würden. Aber jetzt, als dieser Augenblick endlich gekommen war, hatte er nur ein flaues Gefühl im Magen.
Feldwebel Behr hatte mittlerweile die gesamte Nachricht des Trawlers gelesen. »Aber warum ist das Aggregat über das Ziel hinausgeschossen?«
»Das weiß ich noch nicht«, antwortete Hagemann. »Der Diamantstrahl muss eine unbeabsichtigte Wirkung auf das Antriebssystem haben. Ich muss die Flugdaten noch mal durchrechnen. Es kann eine Weile dauern, bis ich mit Sicherheit sagen kann, was genau geschehen ist.«
»Haben wir irgendeinen Anhaltspunkt, wo sie runtergekommen ist, Herr General?«
Hagemann schüttelte den Kopf. »Höchstwahrscheinlich in der Ostsee.«
»Und selbst wenn sie an Land aufgetroffen wäre, wäre von ihr nichts mehr übrig.«
Hagemann erwiderte nichts darauf. Er wusste, dass ganze Baugruppen des V2-Rumpfes den überschallschnellen Aufprall überstehen konnten, selbst dann, wenn ein Sprengkopf mit an Bord war. Verwirrt setzte sich der General auf dem sandigen Weg in Richtung Meer in Bewegung, fast so, als hätte er vor, in den eiskalten Gewässern der Ostsee hinauszuschwimmen und die vermisste Rakete höchstpersönlich zu bergen.
»Herzlichen Glückwunsch!«, rief ihm Behr hinterher.
Hagemann hob zum Dank nur die Hand, bevor die Dunkelheit ihn verschluckte.
Weit im Westen, in einem Horchposten der britischen Special Operations Executive, der sogenannten Station 53A, die in einem ländlichen Herrenhaus in Buckinghamshire untergebracht war, hatte man die Funksprüche zwischen General Hagemanns Abschussstelle und dem Beobachtungsschiff abgefangen.
Kaum eine Stunde später waren die Nachrichten von Peter Garlinski, dem operativen Leiter der Station und ehemaligem Mitglied des polnischen Geheimdienstes, entschlüsselt worden.
Garlinski, ein hagerer Mann mit runder Schildpattbrille und dünnem Haarkranz auf dem sonst vollständig kahlen Schädel, war es im September 1939 gelungen, nach England zu flüchten, nachdem er während des Überfalls der Deutschen auf sein Land zwei Enigma-Walzen gestohlen hatte. Da die Rückkehr nach Polen ausgeschlossen war, bot er dem britischen Geheimdienst seine Dienste an. Seitdem war er in der Station 53A untergebracht und hatte sich dort zum operativen Leiter hochgearbeitet. Sein Aufstieg war vor allem seiner Fähigkeit geschuldet, sechsunddreißig Stunden am Stück durcharbeiten zu können – er brauchte kaum mehr als starken Tee und Zigaretten –, um den Funkverkehr auf feindliche Übertragungen zu überwachen.
Als dem britischen Geheimdienst eine vollständige Enigma-Maschine in die Hände fiel, die aus einem vor der britischen Küste gesunkenen deutschen U-Boot stammte, konnte der Geheimdienst endlich mit der Entschlüsselung des Nachrichtenverkehrs beginnen.
Garlinski studierte General Hagemanns Text und fragte sich, ob er die Nachricht möglicherweise falsch verstanden hatte. Er entschlüsselte sie ein zweites Mal, um sicherzugehen, dass ihm kein Fehler unterlaufen war. Dann schickte er die Nachricht an die kryptografischen Analysten im Bletchley Park, um von ihnen die Bestätigung zu erhalten.
Etwa zu der Zeit, als Feldwebel Behr General Hagemann seine Glückwünsche aussprach, trug sich auf der dänischen Insel Bornholm ein Brüderpaar mit Mordgedanken.
Die Zwillingsbrüder Per und Ole Ottesen wohnten in einem niedrigen Haus nicht weit von der Ansiedlung Saxebro. Sie hatten ihr ganzes Leben auf Bornholm verbracht und betrieben dort einen kleinen Bauernhof mit Milchwirtschaft. Keiner der beiden hatte geheiratet, und mittlerweile befanden sie sich in weit vorgerücktem Alter.