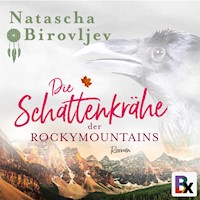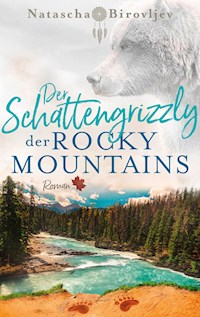
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dunkle Berge - Mutige Herzen Jetzt oder nie - der Rancher Lee erhält endlich die Erlaubnis, Reittouren in die Wildnis Kanadas durchzuführen. Ein Erfolg wäre die Basis für seine ersehnte Familiengründung. Scheitert er, wird er alles verlieren. In dieser turbulenten Zeit kehrt seine Schwester Lyla aus dem Yukon zurück und übernimmt die Leitung der Wildtierstation. Sie wächst an ihren Aufgaben und verliebt sich in den Indianer Lonefeather Jones. Doch er kämpft gegen Dämonen aus seiner Vergangenheit und weist sie ab. Als Lees Beziehung zu zerbrechen droht, Lyla dem Tod ins Auge sieht und Jones seinen Kampf zu verlieren scheint, müssen alle drei ihre Kräfte bündeln. Kann der Mut zur Liebe die Dunkelheit besiegen, bevor das letzte Licht am Horizont erlischt? Im dritten Buch der Willow Ranch Reihe fordern neue Aufgaben Mut und Zusammenhalt von den Bewohnern und Freunden der Ranch. Und die Liebe sorgt für einigen Wirbel inmitten der wilden Schönheit der Rocky Mountains.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Danksagung
Die Autorin
Werbung
Dunkle Berge – mutige Herzen
Jetzt oder nie – der Rancher Lee erhält endlich die Erlaubnis, Reittouren in der Wildnis Kanadas durchzuführen. Ist er erfolgreich, steht seiner ersehnten Familiengründung nichts mehr im Weg. Wenn er scheitert, wird er alles verlieren. In dieser turbulenten Zeit kehrt seine Schwester Lyla aus dem Yukon zurück und übernimmt die Leitung der Wildtierstation. Sie wächst an ihren Aufgaben und verliebt sich in den Indianer Lonefeather Jones. Doch der kämpft gegen Dämonen aus seiner Vergangenheit und weist sie ab.
Als Lees Beziehung zu zerbrechen droht, Lyla dem Tod ins Auge sieht und Lonefeather Jones seinen Kampf zu verlieren scheint, müssen alle drei ihre Kräfte bündeln. Wird der Mut zur Liebe die Dunkelheit besiegen, bevor das letzte Licht am Horizont erlischt?
Im dritten Buch der Willow Ranch Reihe fordern neue Aufgaben Mut und Zusammenhalt von den Bewohnern und Freunden der Ranch. Und die Liebe sorgt für einigen Wirbel inmitten der wilden Schönheit der Rocky Mountains.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2020 Birovljev, Natascha · www.natascha-birovljev.com
Herstellung und Verlag: BoD – Books on Demand, Norderstedt
ISBN: 9783750412170
Tolino: 9783739492087
2. Auflage (Juli 2020)
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com
Lektorat: Dr. Hanne Landbeck, www.schreibwerk-berlin.com
Layout und Satz: Gabi Schmid, www.buechermacherei.de
Bilder: #260089724 | AdobeStock und Motive von shutterstock.com
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte liegen bei der Autorin. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Der Große Bär
Der junge Indianer ließ seinen Blick über die zahlreichen Menschen schweifen, die sich an diesem Abend um das Lagerfeuer versammelt hatten. Die ersten Sterne leuchteten am Himmel. Einige der Zuhörer konnten auf doppelt so viele Lebensjahre wie der Indianer zurückschauen, aber sie wussten, dass der junge Mann eine kraftvolle Magie besaß. Das Gemurmel verstummte, der Indianer setzte sich, sah in die Flammen und dann in den Himmel. Mit zwei Fingern rieb er über die Kralle eines Bären und erzählte mit eindringlicher Stimme seine Geschichte:
„In den frühen Zeiten dieser Erde erreichte vier Jäger der Bericht über einen gigantischen Bären, der sich in der Nähe eines Dorfes herumtrieb. Diese vier Jäger waren Brüder und ihre Jagderfolge legendär. Der Bär war ein Monster, das Nyah-gwaheh genannt wurde. Er terrorisierte das Dorf und das umliegende Gebiet. Die Dorfbewohner waren so verängstigt, dass sie ihre Kinder nicht mehr im nahen Wald spielen ließen.
Den Bären zu besiegen, war eine große Herausforderung. Wenn das Monster die Jäger zuerst sah, würde es die Brüder bis in ihren Tod verfolgen, denn dieser gigantische Bär, so glaubte man, hatte seinen eigenen, kraftvollen Zauber. Wann immer die Dorfbewohner versucht hatten, seinen Spuren zu folgen, waren diese sofort verschwunden. Die vier Jäger besaßen ihre eigene Magie in Form eines Hundes, der zwei dunkle Kreise um seine Augen hatte. Dieser kleine Hund wurde Four Eyes genannt und konnte Spuren folgen, die viele Tage alt waren.
Die Jäger und der Bär versuchten fieberhaft, gegenseitig ihre Spuren zu finden, bis der kleine Hund plötzlich bellte und zeigte, dass er die Spur des Bären erschnüffelt hatte. Die Brüder jubelten. Als der Bär durchs Buschwerk brach, sahen die vier Jäger das Monstrum. Sein Fell war so weiß, dass er beinahe nackt wirkte. Die Jagd begann.
Der Bär rannte und rannte den ganzen Tag, um den Jägern zu entkommen, aber diese gaben die Verfolgung nie auf. Der gigantische Nyah-gwaheh war so groß, dass es leicht war, ihm zu folgen, denn er hinterließ einen breiten Streifen der Zerstörung auf Wald und Feld. Der Bär kletterte höher und höher einen Berg hinauf, die Jäger dicht auf seinen Fersen. Der mutige kleine Hund hetzte dem Bären hinterher und zwickte das Biest in den Schwanz.
Es wurde dunkel, als Jäger und Monster die Spitze des Berges erreichten und alle erschöpft waren. Als der Bär zu müde zum Rennen war, drehte er sich um, um sich des lästigen kleinen Hundes zu entledigen. Plötzlich tauchte einer der Brüder auf und rammte seinen Speer durch das Herz des Biests und tötete es. Im Glauben, dass sie die magische Kraft des Bären besiegt hatten, zerteilten die Jäger sein Fleisch und rösteten es über dem Feuer. Sie begannen, die erjagte Beute auf der Spitze des Berges zu essen, während Bärenfett ins Feuer tropfte und Funken sprühte.
Als sie sich gemütlich zurücklehnten, vollgestopft mit geröstetem Bärenfleisch, sah ein Bruder an sich hinab und beobachtete kleine leuchtende Lichter in der Dunkelheit weit unterhalb seiner Beine. Zu ihrem Erstaunen bemerkten die Brüder, dass sie nicht mehr auf dem Berg waren, sondern die kraftvolle Magie des Bären sie einen merkwürdigen Weg hoch hinauf in die Welt des Himmels geführt hatte.
Zu diesem Zeitpunkt begann der kleine Hund an den Bärenknochen zu nagen und sie wurden lebendig. Die Jäger ergriffen schnell ihre Speere und verfolgten den Großen Bären über den Himmel.
Die Legende erzählt weiter, dass in jedem Herbst die Jäger dem Bären erneut über das Firmament nachjagen und ihn wieder töten. Wenn sie das Fleisch des Bären für ihr Essen schneiden, färbt das Blut, das vom Himmel tropft, die Blätter der Ahornbäume blutrot, während das in die Flammen tropfende Fett das Gras weiß färbt.
Unsere Vorfahren sagen, dass die Geschichte für uns im Himmel lesbar ist. Im Herbst erscheinen die Sterne, die den Großen Bären bilden, tief am Horizont. Sie stehen bildhaft für den toten Nyah-gwaheh, der auf dem Rücken liegt. Die Sterne, von manchen auch die Deichsel des Großen Wagens genannt, symbolisieren die Jäger und den kleinen Hund, die das Monster verfolgen.
Wenn der Frühling naht, sieht man den Großen Bären stehen, was die Wiedergeburt Nyah-gwaheh repräsentiert und er wird zu einem der höchststehenden Sternenbilder. Im Herbst wird er erneut von den Jägern verfolgt und über den Himmel gejagt, dicht auf den Fersen der kleine, besondere Suchhund.
(Nach einer Legende der Iroquois First Nations)
Der junge Indianer hob den Blick und deutete mit dem ausgestreckten Arm in den Himmel. „Das Sternbild des Großen Bären ist ganzjährig zu sehen und verschwindet nie hinter dem Horizont. Für viele mag es nur eine Sternkonstellation sein. In dieser Legende zeigt sich unser Glaube, dass das Leben aus mehr besteht als aus dem Begreifbaren. Mythen und Legenden haben sich über Jahrhunderte in den Herzen der Menschen gehalten, wurden überliefert und machen uns zu den Personen, die wir heute sind.“
Er fuhr sich durch die kurzen, schwarzen Haare und beobachtete, wie seine Zuhörer ihre Aufmerksamkeit wieder ihm zu wandten. „Es ist unsere Aufgabe, uns an die Vergangenheit zu erinnern.“
Der junge Indianer vernahm zustimmendes Gemurmel und erhob sich schwerfällig, wie ein Grizzly, der aus dem Winterschlaf erwacht. „Vergesst nie unsere Vergangenheit, schaut nicht in die ferne Zukunft, sondern erlebt das Hier und Jetzt“, sagte er mit einem Brummen in der Stimme und sein Blick wanderte ein letztes Mal über die Menschen, die rund um das Feuer saßen.
Diejenigen, die genau hinsahen, bemerkten die Sterne in seinen Augen.
„Autsch, Shit, verdammt nochmal“, fluchte Lee und steckte sich den pochenden Daumen in den Mund. Wütend warf er den Hammer mit der anderen Hand gegen die Scheunenwand. Laut scheppernd traf das Werkzeug eines der antiken Werbeschilder aus Metall, die sein Vater einst gesammelt hatte.
„Was ist das denn für ein Lärm?“, rief jemand hinter ihm. Er wandte sich um.
Rosie, die neue Ranchhelferin, kam zum Scheunentor herein, sah sich um und blieb stehen. Einen Augenblick später grinste sie.
Hastig zog Lee den Daumen aus dem Mund und wischte ihn vorsichtig an seiner Jeans ab. Mit zusammengepressten Lippen betrachtete er den Finger. Es blutete heftig und unter dem Nagel bildete sich bereits ein Bluterguss.
„Zeig mal her“, sagte Rosie, zog ihre Handschuhe aus und trat an ihn heran.
Er streckte ihr den Finger hin. „Bin mit dem scheiß Hammer ausgerutscht“, grummelte er.
„Da habe ich schon Schlimmeres gesehen“, sagte sie achselzuckend. „Reinigen, Pflaster drauf und ich denke, du wirst es überleben, Boss. Ich mach dann mal mit dem Ausmisten weiter.“ Mit wippendem Pferdeschwanz ging sie davon.
Lee grinste. Die junge Frau hatte vor zwei Monaten auf der Willow Ranch als Pferdepflegerin angefangen und von Anfang an kein Blatt vor den Mund genommen. Rosie kümmerte sich um die Stuten ebenso hingebungsvoll, wie es seine Stiefschwester Lyla getan hatte, bevor sie letzten November in den Norden des Landes gereist war. Lee mochte Rosies direkte Art und war froh, dass ihr Onkel Eric Laforge sie für die Arbeit mit den Zuchtstuten auf der Ranch vorgeschlagen hatte. Der Pelzjäger Eric war ein guter Freund seines Vaters gewesen und auch nach dessen Tod und Lees Übernahme der Ranch, blieb Eric ein treuer Freund der Familie.
Lee befolgte Rosies Rat und wusch den Daumen im kleinen Waschbecken in der Scheune. Im Erste-Hilfe-Kasten, der an einem Nagel an der Wand hing, fand er Desinfektionsmittel und Pflaster. Fertig verarztet machte er sich auf den Weg zu den Pferden, um zu sehen, wie voll die Heuraufe noch war. Auf dem Hof kam ihm Nick, der Mitinhaber der Willow Ranch, entgegen. Der Cowboy hatte die Hände tief in die Taschen seiner Jacke vergraben und den Lammfellkragen hochgeschlagen. Er war zurück von dem täglichen Kontrollbesuch auf der Nachbarranch, wo seit letztem Jahr die Deckhengste der Willow Ranch untergebracht waren. Rob Tanner, der Besitzer, hatte keine Stuten, was den Umgang mit den Hengsten wesentlich erleichterte.
„Ist alles in Ordnung?“, fragte Lee.
„Ich glaube, Burt hat einen Hufabszess.“
Lees Miene verfinsterte sich. „Mist, das wäre schon der zweite Abszess in einem Monat. Der Hengst ist echt empfindlich. Wir lassen besser Dr. Langley einen Blick drauf werfen.“
„Denke ich auch. Ich wollte gerade ins Haus und ihn anrufen.“
„Was ist mit deinem Handy passiert?“
„Hab’s vergessen aufzuladen und bei dem scheißkalten Wetter telefoniere ich eh lieber in der warmen Küche.“
„Du hättest doch auch von Rob aus anrufen können, oder?“
„Der war nicht zuhause.“ Nick schüttelte sich und rieb seine Hände aneinander. „Brr, ist das kalt. Diese letzten Februartage haben es echt in sich“, sagte er. „Ich geh jetzt ins Haus. Vielleicht kann ich Jeanne einen Keks abschwatzen, sie wollte heute Nachmittag backen.“
Die Aussicht auf frischgebackene Kekse seiner Tante hellte Lees Stimmung ein wenig auf und er nickte. „Ich könnte auch eine kurze Pause gebrauchen.“
Gemeinsam stiegen die Männer die Stufen der Holzveranda hoch, die sich rund um das Ranchhaus zog. Lees Vater hatte das mächtige Haus aus Zedernholz selbst gebaut und Lee liebte die knarzenden Geräusche, die das Holz an kalten Tagen von sich gab. In der Diele zogen sie ihre Boots aus und hängten die Winterjacken an die Haken. In der Küche trafen sie auf Jeanne, die ein Blech aus dem Ofen holte und auf den Herd stellte. Die Küche wurde erfüllt vom Geruch der warmen Kekse.
„Das nenne ich perfektes Timing“, sagte Lee und streckte seine Hand nach einem der Kekse aus.
„An denen verbrennst du dir nur die Finger“, sagte Jeanne und schob ihn zum Ecktisch. „Setzt euch, ihr zwei.“
Die zierliche, grauhaarige Frau stellte schmunzelnd einen Teller mit abgekühlten Keksen auf den Tisch. „Ich mache frischen Kaffee“, sagte sie. „Wird Naira rechtzeitig zum Abendessen zurück sein?“
Lee nahm sich einen der handtellergroßen Schokoladen-Karamellkekse. „Ich denke schon“, antwortete er, obwohl er nicht sicher war, wann Naira von Calgary aus losfahren würde.
Die Cree-Indianerin, mit der er seit vier Jahre zusammen war, gab in diesem Wintersemester ein Seminar über indianische Bräuche an der dortigen Universität und wurde von den Studenten manchmal so ausgiebig mit Fragen überschüttet, dass sie erst am späten Abend zur Ranch zurückkam. Während der letzten Monate hatte sie unter der Woche mehrmals in Calgary übernachtet. Die Universität hatte ihr ein Zimmer zur Verfügung gestellt, denn bei ihren langen Arbeitszeiten machte es keinen Sinn, die zwei Stunden zurück zur Ranch zu fahren, wenn sie früh am Morgen wieder unterrichten musste.
So sehr sich Lee über Nairas Erfolg freute, so sehr fehlte ihm ihre Nähe. Auch wenn er es vor ihr nie zugeben würde, dachte er manchmal, dass er sie mehr vermisste als sie ihn. Aber er wollte keinesfalls ihr Streben, die indianische Kultur lebendig zu halten, behindern. Er griff nach einem weiteren Keks. Heute Abend würde sie wieder ganz ihm gehören. Er konnte es kaum erwarten, mit ihr im Arm einzuschlafen.
„Esst nicht zu viel Süßkram, in zwei Stunden gibt es Abendessen“, unterbrach Jeanne seine Träumerei.
Aus den Augenwinkeln sah er, wie Nick sich schnell einen weiteren Keks nahm. Lee tat es ihm gleich und grinste Nick an. Der Cowboy erwiderte das Lächeln und Lee wünschte, diese Komplizenschaft würde sich auch in ihrer Zusammenarbeit auf der Willow Ranch zeigen. Aber seit Nicks Beziehung mit Lyla in die Brüche gegangen war, war der Cowboy launisch und unzufrieden. Lee trank einen Schluck Kaffee und spülte die Reste des Kekses hinunter. Dann wandte er sich an Nick. „Wie viele der Zweijährigen werden wir dieses Jahr auf die Auktion bringen?“
„Nachdem wir letztes Jahr keine Hengste verkauft haben, würde ich auf die diesjährigen Preise der ersten Auktionen warten. So hat es dein Dad auch immer gehandhabt und ich wüsste nicht, wieso wir dieses Verfahren ändern sollten“, erwiderte Nick und strich sich durch die sandblonden Haare.
Lee presste die Lippen zusammen. Dabei stimmte er im Grunde Nick zu. Die Hengstpreise sollten die Anzahl der Pferde bestimmen, die sie zum Verkauf anboten. Aber Lee merkte, dass er es leid war, bei allen Belangen der Pferdezucht auf der Willow Ranch das Erbe seines Vater Darcy vor Augen zu haben. Seit vier Jahren gehörte ihm – und Nick zu einem geringeren Anteil – die Ranch, und doch nannten viele Pferdezüchter im Umkreis die Willow Ranch immer noch Darcys Ranch. Und bei Fragen zur Zucht oder den Deckhengsten wandten sie sich lieber an Nick als an Lee, da der Cowboy viele Jahre Darcys rechte Hand gewesen war.
„Was ist jetzt?“, fragte Nick ungeduldig und riss Lee aus seinen Grübeleien.
„Okay, dann warten wir die ersten beiden Auktionen ab und entscheiden dann, wen wir nach Lethbridge bringen, einverstanden?“
„Ja. Ist sonst noch was?“ Ohne eine Antwort abzuwarten, stand Nick auf, stellte seine Tasse neben Jeanne in die Spüle und drückte ihr einen Kuss auf die Wange.
Lee erhob sich ebenfalls und sah auf die Uhr. „Ach, könntest du die Heuraufen der Dreijährigen checken? Ich will für Nairas Rückkehr noch etwas vorbereiten.“
Der Cowboy schnaubte und rollte die Augen. „Man kann es mit der Romantik auch übertreiben“, sagte er. „Ich ziehe die Pferde eh den Frauen vor.“ Damit verließ Nick die Küche.
„Armer Kerl. Er ist immer noch verbittert über die Trennung“, sagte Jeanne.
„Das hat er sich selbst zuzuschreiben.“ Lee empfand kein Mitgefühl mit Nick. So viel er mitbekommen hatte, hatte er sich seiner Schwester gegenüber wie ein kompletter Idiot verhalten.
„Das weiß ich doch. Aber es schmerzt mich trotzdem, ihn so zu sehen.“
Lee umarmte sie kurz und drückte ihr einen Kuss auf die grauen Haare. „Ach, Tantchen, du und dein weiches Herz.“
Er verließ die Küche und fuhr in die Stadt. Er wollte Nairas Lieblingspralinen und eine Flasche Wein kaufen. Seine Gedanken gingen zurück zu dem Gespräch mit Nick. Lee musste zugeben, dass es vor allem Nicks Händchen mit den Hengsten und der Auswahl der passenden Stuten zu verdanken war, dass es die Willow Ranch nach dem Tod von Lees Vater so schnell aus den roten Zahlen geschafft hatte.
Bevor Lee nach Spruce View abbog, schaute er aus dem Beifahrerfenster nach Westen. Am Horizont, vor dem klaren Winterhimmel, leuchteten die schneebedeckten Gipfel der Rocky Mountains. Lee lächelte, wie er es immer tat, wenn er die Berge sah und an die Wildnis dachte, die sie umgab. Die unberührte Natur gab ihm ein unwiderstehliches Gefühl von Freiheit.
In diesem Moment war er voller Zuversicht, dass sein Vorhaben, ab nächstes Jahr Touristen auf Reittouren in die Berglandschaft zu führen, gelingen würde. Lee war kein Freund von übereilten Entscheidungen und wollte die nächsten Monate nutzen, diesen Traum genau zu planen. Aber er wusste auch, dass er sich die Gelegenheit durch nichts nehmen lassen würde, denn das wäre ganz allein sein Verdienst, seine Zukunft auf der Willow Ranch.
Lonefeather Jones holte den Seesack und stellte ihn neben das Bett. Es war an der Zeit, seine Sachen zu packen und mit dem Wind weiterzuziehen. Vom Frühling konnte man jetzt, Ende Februar, zwar nur träumen, aber er hatte bereits länger in diesem Blockhaus verweilt als an irgendeinem anderen Ort in den letzten Jahren.
Mit wenigen Handgriffen steckte er seine Kleidung in die Tasche, nahm den Seesack und ging damit ins Wohnzimmer. Durch das Panoramafenster sah er zwei Rehe, die sich an den Sonnenblumenkernen im Vogelhaus bedienten, das er gestern gefüllt hatte. Aufgehängt hatte er das Häuschen Ende Oktober. Damals hatte er fest vorgehabt, vor dem Wintereinbruch weiterzuziehen, aber dann war er doch geblieben.
In diesem einsam gelegenen Blockhaus pulsierte seine Knüpfmagie stärker als je zuvor. Jones hatte viele Wünsche erfüllt und mit den Traumfängern Ängste und Sorgen der Menschen gemildert. Jetzt fiel es ihm immer schwerer, die Einladungen zum Abendessen oder zu anderen Zusammenkünften von den Bewohnern der Gegend abzulehnen. Doch wollte, ja musste, er frei bleiben. Er durfte sich nicht allzu heimisch fühlen, denn dann bangte er um seine Magie beim Knüpfen.
Seufzend wandte er den Blick ab und packte die Knüpfutensilien in die dafür vorgesehenen Lederbeutel. Nachdem fast alles im Seesack verstaut war, schlüpfte er in seine Fellstiefel, zog die gefütterte Jacke an und ging hinaus. Den Rest würde er am nächsten Tag packen. Der kalte Wind biss in seine Wangen und er schlug den Kragen der Jacke hoch. Er hatte Chinook, dem Schamanen des Cree-Volks im Reservat, versprochen, Birkenrinde zu bringen und auf einen Tee zu bleiben.
Nach einer halben Stunde kehrte er, zufrieden mit der Ausbeute, zum Blockhaus zurück und fuhr mit dem Motorrad zu dem alten Schamanen ins Reservat. Seine Finger waren klamm, als er in die warme Wohnstube trat. Chinook saß in einem Schaukelstuhl beim Holzofen.
„Tanisi, weiser Mann“, sagte Jones und legte den Beutel mit Birkenrinde neben Chinook auf einen kleinen Tisch.
„Sei gegrüßt, Knüpfer. Danke für die Rinde. Daraus werde ich mir später eine Salbe machen“, sagte der Schamane. „Setz dich zu mir.“
Jones nahm auf einem Hocker Platz und streckte seine Hände der Wärme des Ofens entgegen. Er merkte, dass Chinook ihn beobachtete. „Die Kälte lässt meine Finger steif werden“, murmelte Jones.
„Und das viele Knüpfen trägt seinen Teil dazu bei. Wenn du so weitermachst, hast du bald so verknotete Hände wie ich.“ Chinook hob seine von Arthrose angeschwollenen Finger, deren Gelenke sich immer weniger bewegen ließen.
Eine junge Indianerin erschien. In den Händen hielt sie zwei Tassen, aus denen es dampfte. Sie lächelte Jones zu und stellte die Getränke auf den Tisch neben Chinook.
„Kräutertee mit Honig“, sagte sie leise. „Ich muss zum Eishockey-Training, bin schon spät dran.“
„Dann ab mit dir“, erwiderte Chinook. „Go, Huskies, go.“
Das Mädchen schmunzelte, warf Jones ein weiteres Lächeln zu und verschwand wieder.
„Gib es eigentlich Frauen, die dir keine schönen Augen machen?“ Der Schamane kicherte, es klang wie das Klackern von Kieselsteinen, die aneinander gerieben wurden.
Jones zuckte mit den Schultern. „Das Knüpfen ist meine Berufung.“ Er nahm eine der Tassen und nippte an dem Tee. „Deshalb werde ich in den nächsten Tagen weiterziehen.“
Aus den Augenwinkeln sah er, wie der Schamane seinen Kopf langsam hin und her wiegte. Die langen grauen Haare tanzten wie Spinnweben im Wind. „Berufung oder Bürde?“
Jones sah auf und wusste nicht, was er erwidern sollte. Chinooks graue Augen schienen direkt in seine Seele zu schauen. „Du könntest hierbleiben, Teil unserer Gemeinschaft werden. Der Rat im Reservat braucht junges Blut.“
Jones schüttelte langsam den Kopf. „Dein Angebot ehrt mich, aber der Wind ruft mich, ihm zu folgen. Es ist mir nicht bestimmt, Wurzeln zu schlagen.“
„Bestimmungen können sich ändern. Verschließe deinen Geist nicht davor.“
Jones hob eine Augenbraue. Wusste der Schamane etwas, das ihm selbst verborgen war? Sollte er Chinook danach fragen? Besser nicht. Er wollte nicht zum Bleiben überredet werden. Für ein paar Minuten tranken die Männer schweigend ihren Tee.
„Wir könnten dich hier wirklich gut gebrauchen“, begann Chinook aufs Neue. „Das Reservat braucht eine weise Führung, einen Rat, der über die Belange der Menschen hier entscheidet.“
„Er wird nicht ohne Grund Rat der Ältesten genannt. Da würde ich doch nicht reinpassen mit meinen sechsundzwanzig Jahren.“
„Die Welt verändert sich und wir können nicht aus Sturheit an alten Formen festhalten. Gerade die jungen Menschen hier müssen sehen, dass auch ihre Ansichten im Rat vertreten sind“, gab Chinook zu bedenken.
„Lass es gut sein, weiser Mann, ich werde nicht bleiben.“ Jones lächelte den Schamanen entschuldigend an, stellte seine Tasse zurück auf das Tischchen und stand auf. „Ich muss noch einiges für die Abreise vorbereiten. Wer weiß, vielleicht führt mich mein Weg irgendwann wieder hierher.“
Als Jones an Chinook vorbeiging, hielt dieser ihn am Arm fest. Der Griff des Alten war überraschend kräftig.
„Ich habe noch etwas für dich.“ Chinook erhob sich und zog einen kleinen ledernen Medizinbeutel hervor, der an einer Lederschnur um seinen Hals hing. Daraus holte er eine Grizzlybärkralle, die er ihm in die Hand drückte.
„Ein Talisman?“, fragte Jones und betrachtete die Kralle, die so lang war wie sein Daumen.
„Etwas in der Art. Eine Erinnerung an die Bedeutung von Familie“, murmelte Chinook. „Bis bald, Knüpfer.“ Mit diesen Worten wandte der Schamane seinen Blick ab, summte eine Melodie und begann, langsam vor und zurück zu schaukeln.
Lees Wecker klingelte und er streckte den Arm aus, um ihn abzustellen. Naira neben ihm grummelte, rollte sich auf die Seite und zog die Decke mit sich.
„He, so leicht wirst du mich nicht los.“ Lee rutschte an sie heran und schlang seinen Arm um ihre Hüfte.
„Hmmmm“, murmelte Naira und drückte ihren Po gegen ihn. Lee stöhnte auf. Wie sehr hatte er sie in den letzten zwei Wochen vermisst. Mit den Lippen liebkoste er ihren Nacken, während seine Hände ihr Nachthemd nach oben schoben.
„Musst du nicht aufstehen?“, murmelte sie und drehte sich zu ihm um.
„Später“, erwiderte Lee und erstickte ihre weiteren Worte mit einem Kuss.
Ein lautes Klopfen ließ Lee hochschrecken. Der Wecker zeigte halb neun Uhr morgens. Shit, er musste nochmal eingeschlafen sein. Erst jetzt bemerkte er, dass Naira nicht mehr neben ihm lag und hörte die Dusche in dem angrenzenden Badezimmer. Wieder klopfte es an der Tür.
„He, Loverboy, hast du den Termin im Forstamt vergessen?“ Nicks Stimme klang halb genervt, halb belustigt.
„Ich bin gleich unten“, rief Lee und sprang aus dem Bett.
In diesem Moment kam Naira in ein Handtuch gewickelt aus dem Badezimmer.
„Wieso hast du mich nicht geweckt? Jetzt muss ich mich verdammt beeilen, um noch pünktlich in die Stadt zu kommen.“
„Sorry, ich dachte, ein wenig mehr Schlaf würde dir guttun. Um was geht es denn bei dem Termin?“
„Weiß ich nicht genau. Der Forstbeamte meinte nur, sie wollen etwas mit mir besprechen.“
„Vielleicht haben sie schon über deinen Antrag entschieden, Reiter in die Berge zu führen“, sagte Naira.
Lee zuckte mit den Schultern. „Das würde mich wundern. Ich habe ja angegeben, dass ich die Gästeranch erst nächstes Jahr eröffnen will.“
„Ich finde es toll, dass du dir diesen Traum erfüllen willst. Die Pferdezucht war der Weg deines Vaters und auch Nicks, das Gästebusiness wird ganz deins sein. Und du hältst damit dein Versprechen, das du Lyla gegeben hast.“
„Wie meinst du das?“
„Du hast ihr gesagt, du wirst gemeinsam mit Chuck den Lebensraum der Wildpferde schützen, und wenn die Willow Ranch als einziger Betrieb Touristen in diese Gegend bringen darf, dann ist das der beste Schutz für die Wildnis.“ Naira ließ das Handtuch auf den Boden gleiten und Lee seufzte bei dem Anblick, der sich ihm bot. „Du bist grausam.“
„Mag sein, aber ich bin sehr stolz auf dich.“ Sie lächelte, tänzelte zu ihm und ihr Geruch nach Mandeln und Zitronen hüllte ihn ein. Kurz drückte sie ihren nackten Körper an ihn und er hatte Mühe, seine erneut auflodernde Leidenschaft zu kontrollieren. Mit einer Hand zerzauste sie seine braunen, lockigen Haare und drückte ihm einen Kuss auf die Lippen. „Ab unter die Dusche, Rancher. Ich besorg uns Kaffee und fahre mit dir in die Stadt.“
Nach seinem Termin im Forstbüro war Lee mit Naira in Mary’s Diner zum Mittagessen verabredet. Wie an den meisten Tagen war das kleine Restaurant gut gefüllt mit Ranchern, Müttern mit Kleinkindern und Cowboys. Die Einrichtung war genauso bunt, wie die Gäste, die es sich auf Sesseln, Lehnstühlen und Hockern gemütlich gemacht hatten. Lee sah Naira an der Theke sitzen. Sie war in ein Gespräch mit Mary, der Besitzerin des Diners, vertieft. Er atmete tief durch, doch nicht einmal der Duft nach Kaffee und Frischgebackenem konnte seine Laune heben.
„Was machst du denn für ein Gesicht?“, fragte Naira, als er sich neben sie auf einen der hohen Stühle setzte.
Mary füllte eine Tasse mit Kaffee und stellte ihn vor Lee hin. „Kann ich dir auch etwas zu essen bringen?“
„Im Moment nicht“, erwiderte Lee. „Mein Magen ist ein einziger Knoten.“
Naira legte eine Hand auf seinen Arm. „Jetzt erzähl schon.“
„Das Forstamt hat mir ein Ultimatum gestellt. Wenn ich in diesem Sommer keine Gästeranch anmelde und Touristen in die Berge führe, dann schreiben sie die Führungen offiziell aus und andere Gästeranches können sich bewerben.“
„Was?“ Naira wandte sich mit dem Wasserglas so ruckartig zu ihm um, dass der Inhalt über Lees Shirt schwappte. „Huch, entschuldige.“
„Macht nichts, ich fühle mich eh, als hätte jemand einen Eimer kaltes Wasser über mir ausgeschüttet.“
Mary brachte ein Tuch und hielt es Lee grinsend hin. Er nahm es dankend und wischte über den nassen Fleck auf seinem Hemd.
„Ich verstehe nicht, warum sie dir auf einmal die Pistole auf die Brust setzen. Du hattest doch im November offiziell nachgefragt, ob die Behörde die Genehmigung der Reiturlaube mit den Touristen erst für nächstes Jahr erteilen könne.“ Nairas dunkelbraune Augen blitzen wütend. „Und jetzt will die Forstbehörde sie sofort umgesetzt sehen? Normalerweise mahlen die Amtsmühlen doch langsam. Unglaublich.“
„Na ja, die Behörden haben festgelegt, dass die Gästeranch für jeden Gast eine Gebühr an das Forstamt zahlen muss.“
„Das verstehe ich nicht. Die Reittouren liegen doch hauptsächlich in dem Gebiet, das sowieso Chuck gehört. Wieso soll die Willow Ranch dann einen Abschlag zahlen?“
„Um zu Chucks Land zu kommen, reitet man durch Gebiete, die der Provinz gehören. Die Abgaben sind an die Anzahl der Besucher gebunden, die eine Tour in die Wildnis buchen. Und diese Gebühren werden in Zukunft auch Chucks Gehalt abdecken.“
„Sprecht ihr über mich?“, fragte eine Stimme hinter ihnen und Lee wandte sich um. Sein Kumpel Chuck kam heran, tippte zur Begrüßung an die Krempe seines Cowboyhuts und öffnete den Reißverschluss der Jacke.
„Oh, hi, was machst du denn hier?“, fragte Lee.
„Nette Begrüßung, Kumpel. Passt zu deiner grimmigen Miene“, erwiderte Chuck.
„Gegen deine Frohnatur komme ich eh nie an“, grummelte Lee und wies auf den Stuhl neben sich. „Hast du Zeit für einen Kaffee? Ich will deine Meinung zu etwas hören.“
Chuck setzte sich. „Sarahs Schicht in der Küche geht noch zwanzig Minuten. So lange habe ich Zeit“, sagte er. „Schieß los.“
Lee berichtete von dem Gespräch im Forstamt und sein Kumpel hörte aufmerksam zu. Sarah, Chucks Lebensgefährtin, kam aus der Küche, begrüßte die drei Freunde und küsste Chuck auf die Wange, bevor sie sich um die Gäste des Diners kümmerte und neue Bestellungen annahm. Lee entging nicht das Leuchten in Chucks Augen und der verliebte Blick, mit dem er Sarah hinterher sah.
„He, Romeo, was sagst du dazu?“, fragte Lee und stieß Chuck, der immer noch in Sarahs Richtung starrte, mit dem Ellenbogen an.
Chuck grinste und zuckte mit den Schultern. „Jaja, schon gut. Du willst es vielleicht nicht hören, aber das Forstamt sitzt am längeren Hebel. Bei unserem Antrag, das Gebiet einschließlich meines Geländes für eine begrenzte Anzahl an Touristen nutzen zu dürfen, hat das Forstamt wohl unser Startdatum übersehen oder ist erst auf die Idee gekommen, dass es schon früher als nächstes Jahr Geld bekommen könnte. Und obendrauf kam die Bewilligung des Antrags mit der Bedingung zurück, den Tourismusbetrieb so bald wie möglich einzubinden. Hast du das vergessen?“
Mary stellte eine Kaffeetasse vor Chuck und füllte Lees Tasse auf. Lee nickte dankend und fuhr sich mit einer Hand durch seine lockigen, braunen Haare. „Na ja, ich dachte, das können wir gestalten, wie wir wollen. Aber bevor ich die Willow Ranch in eine Gästeranch umwandele, muss ich einen Betriebsplan erstellen, alles genau durchrechnen, mehr Reitpferde kaufen, weitere Rancharbeiter einstellen und, und, und …“
Chuck zuckte mit den Schultern. „Das Forstamt sieht eine neue Einnahmequelle durch die Touristen und will diese Chance schnellstmöglich nutzen. Wir hätten den Antrag vielleicht zurückhalten sollen, damit sie keine ungelegten Eier ausbrüten, aber jetzt ist es zu spät, sich darüber Gedanken zu machen.“
„Ich glaube, die Willow Ranch ist perfekt für Besucher aus der ganzen Welt“, sagte Mary.
Naira nickte und legte ihre Hand auf seinen Arm. „Sich einen Traum zu erfüllen, braucht Mut. Manchmal muss man einfach ins kalte Wasser springen.“ Sie nahm ihr frisch gefülltes Wasserglas und kippte es langsam zur Seite.
Lee hob abwehrend die Hände. „Untersteh dich!“
Naira lachte und stand auf. „Ich geh in die Küche und spreche kurz mit Sarah.“
Als die Indianerin hinter der Küchentür verschwunden war, wandte sich Lee nochmal an Chuck. „Glaubst du tatsächlich, das Forstamt meint es ernst? Wer würde sich denn für die Reitwege rund um dein Gebiet interessieren, wenn sie nicht bis zum Fuß der Drei Geschwister führen? Die Berge und der See gehören zum schönsten Teil des Clearwater Tales.“
„Das geht jetzt nicht gegen dich, Lee. Aber da das Forstamt meine Stelle als Wildhüter bezahlt, werde ich auch einem möglichen anderen Betrieb, der sich für die Genehmigung bewirbt, Ritte in mein Gebiet erlauben. Natürlich nur in begrenzter Anzahl, aber das würde für dich ja auch gelten.“
Lee seufzte. „Das versteh ich schon, Kumpel. Aber es ist ein großer Schritt für mich. Und ohne einen Bankkredit, werde ich es dieses Jahr nicht schaffen. Das beunruhigt mich.“
„Ich will nicht in deiner Haut stecken“, sagte Chuck und legte eine Hand auf Lees Schulter. „Aber ich weiß, wie sehr du dir ein Gästebusiness wünschst. Wenn du das Angebot des Forstamtes jetzt ablehnst, wirst du keine zweite Chance bekommen.“
In diesem Moment schwang die Küchentür auf und Naira kam zusammen mit Sarah heraus. Sarah öffnete ihren Zopf und schüttelte ihre langen, kastanienroten Haare aus, bis sie in einer wilden Mähne über ihre Schultern fielen.
Chuck stand auf, trat zu ihr und zog sie eng an sich. „Na, meine Schöne, gehörst du mir für den Rest des Tages?“
„Das wäre dir genug?“, neckte sie ihn.
„Nein, die Nacht hätte ich natürlich auch gern“, gab er mit einem schelmischen Grinsen zurück. „Und den Rest der Ewigkeit auch.“ Er drückte seine Lippen auf die ihren, bevor sie etwas erwidern konnte.
„Meine Güte, langsam, langsam, ihr beiden, ihr seid hier nicht in der Bar.“ Mary fuchtelte mit einem Geschirrtuch und vertrieb das Paar aus dem Thekenbereich.
„Ach, apropos Bar“, sagte Chuck zu Lee. „Wollen wir uns demnächst zu einer Runde Billard im Coyote Moon treffen?“
„Super Idee“, sagte Naira und Lee nickte.
„Ich melde mich bei dir“, erwiderte er und die Freunde verabschiedeten sich.
Der folgende Tag begann für Lonefeather Jones vor Sonnenaufgang. Nach einer halben Stunde Yoga packte er den Rest seiner Sachen, um am Vormittag die Blockhütte zu verlassen. Den Schlüssel wollte er Naira bringen und sich dabei gleich von ihr verabschieden. Er hatte gestern Abend kurz überlegt, alle Bekannten vor seiner Abreise zu einem Lagerfeuer und ein paar Bier einzuladen, die Idee dann jedoch verworfen. Er hasste Abschiede und Naira könnte die Grüße von ihm ausrichten, ohne dass er persönlich Hände schütteln und Fragen, wohin er jetzt gehen würde, beantworten müsste. Denn wenn er ehrlich war, hatte er keine Ahnung, wohin ihn die Reise führen würde.
Er griff nach dem Beutel für seine Trommel und sah, dass sich ein gelber Faden am Reißverschluss verheddert hatte. Bevor er es verhindern konnte, flogen seine Gedanken zu Lyla. Im selben Moment krächzte eine Krähe lauthals vor dem Fenster.
Lyla hat oft mit gelbem Zwirn geknüpft, dachte Jones. Automatisch fragte er sich, ob sie zurückkehren und enttäuscht sein würde, wenn er nicht mehr hier wäre. Er rieb den Faden zwischen seinen Fingern und beobachtete gedankenverloren die Krähe, die auf dem Rand der Holzveranda saß und ihr Gefieder putzte. Sie spreizte ihre Flügel, die in der morgendlichen Sonne in allen Regenbogenfarben schimmerten. Jones’ Herz wurde einen Augenblick leicht, doch dann verschloss er es mit grimmiger Entschlossenheit. Lyla war auf ihrem eigenen Weg, so wie er es ihr geraten hatte, und auch er musste seiner Bestimmung folgen.
Er riss den Blick von dem schwarzen Vogel los, steckte die Trommel in die Tasche und wollte den Faden wegwerfen. Dann jedoch band er ihn an den Reißverschluss des Trommelbeutels, den er neben seinen Rucksack stellte. In diesem Moment klopfte es an der Haustür. Jones sah auf. Wer mochte das sein? Er erwartete niemanden und hatte auch kein Auto gehört. Er lief zur Tür und öffnete sie. Vor ihm stand ein Indianer, einige Jahre älter als er, mit langen schwarzen Haaren, einem karierten Hemd unter einer Felljacke und einer zerschlissene Jeans, die in alte Winterstiefel gestopft war. In der Hand trug er eine fleckige Sporttasche.
„Woodwind?“, fragte Jones erstaunt.
„Ja, ich bin’s. In Fleisch und Blut, kleiner Bruder“, erwiderte der Mann, ließ die Tasche fallen und zog ihn in eine Umarmung.
Jones nahm den Schweißgeruch wahr, den sein Bruder verströmte und war erleichtert, als dieser sich von ihm löste. Seit acht Jahren, seit jener unheilvollen Nacht, hatten sie sich nicht mehr gesehen. Hatte sein Bruder erfahren, dass …? Nein, Jones vertrieb diesen Gedanken. Aber was zur Hölle wollte Woodwind hier?
„Kann ich reinkommen? Verdammt kalt hier draußen.“
Jones trat beiseite und ließ seinen Bruder eintreten. „Ich war gerade im Aufbruch“, erklärte er, als er sah, dass Woodwind die Unordnung im Wohnzimmer begutachtete.
„Ich kann doch kurz duschen, oder?“
„Ähm“, Jones stockte, betrachtete Woodwind einen Augenblick lang und zuckte dann mit den Schultern. „Klar, da hinten links. Ein Handtuch müsste noch im Bad hängen.“
„Cool. Kannst du Tee machen? Wir haben einiges zu bereden.“ Woodwind streifte seine Jacke und die Boots ab und verschwand im Badezimmer.
Jones Gedanken wirbelten durcheinander und er versuchte, sich einen Reim auf das plötzliche Erscheinen seines Bruders zu machen. Er füllte den Wasserkocher, den Naira ihm mit der restlichen Küchenausstattung geliehen hatte, und schaltete ihn an. In seinem Rucksack kramte er nach dem Beutel mit getrockneten Teekräutern.
Was mache ich denn jetzt?, fragte er sich, als er in zwei Tassen Teebeutel hängte und mit kochendem Wasser füllte. Die Situation wurde noch seltsamer, als Woodwind nur mit einem Handtuch um die Hüften aus dem Badezimmer kam. Seine schwarzen Haare reichten in nassen Strähnen bis auf den Rücken. Jones musterte den mageren Körper seines Bruders, der früher muskulös und durchtrainiert gewesen war.
„Hast du vielleicht ein paar saubere Klamotten für mich?“ Woodwind deutete auf seine Tasche. „Alles da drin muffelt nach Gefängnis.“
Jones horchte auf. „Bist du etwa ausgebrochen?“
Woodwind stieß ein kratziges Lachen aus. „Nö, ich habe die Zeit abgesessen. Glaub mir, das waren die längsten acht Jahre meines Lebens.“
Jones schluckte. „Wow. Ich wusste nicht, dass die Gefängnisstrafe so lange war.“
„Hätte ich mich nicht ständig provozieren lassen, wäre die Zeit hinter Gittern merklich kürzer ausgefallen. Aber hier draußen schien auch nichts auf mich zu warten“, erwiderte Woodwind. „Nicht mal mein kleiner Bruder scherte sich mehr um mich.“
Es tut mir leid, dass ich dich nie im Gefängnis besucht habe, wollte Jones sagen, aber stimmte das überhaupt? Er wusste es nicht und wich dem eindringlichen Blick aus, mit dem Woodwind ihn taxierte. Stattdessen beugte er sich erneut zu seinem Rucksack, zog eine Jeans, ein Shirt und Boxershorts heraus. „Hier, wahrscheinlich sind die Sachen ein wenig eng.“
Kurze Zeit später kam Woodwind zurück. Jeans und Shirt waren zu kurz, passten ansonsten aber erstaunlich gut. Aus dem einst eher kräftigen älteren Bruder war ein hagerer Mann geworden. Woodwind hatte die Haare zu einem Zopf geflochten und setzte sich an den Tisch. Jones reichte ihm eine Tasse und sein Bruder atmete den würzigen Dampf des Tees ein. Der Indianer schloss kurz die Augen und für einen Moment entspannten sich seine Züge. Für den Bruchteil einer Sekunde sah Jones den Mann, der so lange sein Vorbild gewesen war. Obwohl Woodwind acht Jahre älter war, hatten die Brüder die meiste Zeit zusammen verbracht. Sobald Jones alt genug gewesen war, hatte er ihm nachgeeifert. Woodwind hatte den kleinen Bruder nur allzu gern unter seine Fittiche genommen. Im Reservat, in dem sie aufgewachsen waren, nannte sie jeder die unzertrennlichen Bärenbrüder. Das war vor dem Unfall gewesen, der ihr Leben auf einen Schlag aus der Bahn geworfen hatte.
Woodwind schlug die Augen auf, der ernste Ausdruck in seinem Gesicht kehrte zurück. „Wie ich sehe, hat es das Leben gut mit dir gemeint. Das Motorrad da draußen muss eine Stange Geld gekostet haben.“
Jones setzte sich ebenfalls an den Tisch. „Hab lange darauf gespart.“
Woodwind schaute sich um. „Gehört das Blockhaus dir?“
„Nein. Ich habe es gemietet. Naira, eine befreundete Cree, kennt den Besitzer und hat mir den Kontakt vermittelt.“
„Und wieso willst du weg? Ist doch nett hier oder haben sie dich rausgeschmissen?“
Jones schüttelte den Kopf. „Ich bleibe nicht lange an einem Ort. Meine Arbeit als Knüpfer von Traumfängern mache ich dort, wo ich gebraucht werde. Hier habe ich schon genug getan.“
Woodwind zog eine Augenbraue hoch, nippte an seinem Tee und musterte Jones. „Hier warst du aber eine ganze Weile, sonst hätte ich dich nicht gefunden.“
„Hat sich so ergeben. Aber jetzt wird’s Zeit, weiterzuziehen. Wie hast du mich eigentlich aufgespürt?“
„Nach meiner Entlassung habe ich in unserem Reservat vorbeigeschaut und nach dir gefragt. Einige der Ältesten sind gut mit Chinook befreundet und dieser hat deine Anwesenheit hier nicht geheim gehalten.“
„Wieso bist du nicht dort geblieben?“, rutschte es Jones heraus.
Woodwind schnaubte. „Das hört sich nicht nach Wiedersehensfreude an, kleiner Bruder.“
„Tut mir leid, ich bin einfach überrascht, dich zu sehen.“
„Schon gut, ich könnte ja jetzt behaupten, ich hätte dich vermisst und wäre deshalb hergekommen, aber wenn ich ehrlich bin, haben mir die Ältesten gesagt, meine Anwesenheit würde zu viele schmerzliche Erinnerungen aufwirbeln und ich solle nicht bleiben.“
„Es ist so viele Jahre her“, murmelte Jones, wusste jedoch, dass dies keinen Unterschied machte.
Woodwind zuckte mit den Schultern, holte eine Dose mit Ingwerbonbons hervor und steckte sich eines in den Mund. „Willst du auch? Die sind scharf, aber ich liebe die Dinger.“
Jones lehnte ab und sein Bruder steckte die Dose wieder in die Hosentasche. Dann deutete er auf die Trommel. „Spielst du noch regelmäßig?“
„Nicht so oft wie früher. Und du? Hast du deine Flöten-Musik noch?“, fragte Jones und schalt sich selbst für diese Frage. Sein Bruder hatte im Gefängnis gesessen, kaum ein Ort für Musik. Doch zu seiner Überraschung nickte Woodwind, erhob sich und holte etwas aus der Jackentasche. Er legte den Gegenstand auf den Tisch.
Jones nahm die fein geschnitzte Flöte in die Hand. Sie war nur zwanzig Zentimeter lang und mit indianischen Symbolen verziert. „Hast du die im Gefängnis geschnitzt?“ Jones wunderte sich, dass Häftlinge Zugang zu scharfem Schnitzwerkzeug hatten.
„Ja, das letzte Jahr war ich in einer First Nations Healing Lodge, die speziell für indianische Häftlinge eingerichtet ist. Wir waren zwar immer noch eingesperrt, aber wir durften uns bestimmten Projekten widmen.“
Jones legte die Flöte behutsam zurück auf den Tisch und sah seinen Bruder an. „Wieso bist du hier?“
„Ich würde gerne ne Weile bleiben, aber, nun ja, nach acht Jahren Gefängnis bin ich mehr oder weniger mittellos“, sagte Woodwind.
Jones presste die Lippen zusammen. Ein Teil von ihm sträubte sich dagegen, seinem Bruder Hilfe anzubieten. Doch ein anderer Teil, tief in ihm drin, wusste, dass er Woodwind nicht abweisen konnte. Er erinnerte sich an das Versprechen, das er seinem Bruder nach dem Unfall im Krankenhaus gegeben hatte. Woodwind hatte damals vollgepumpt mit Schmerzmitteln im Krankenhausbett gelegen. Jones hatte sich spät nachts in das Zimmer geschlichen, da er niemandem begegnen hatte wollen. „Ich bin für dich da, wenn du Hilfe brauchst“, hatte er gemurmelt und war dann vor dem Anblick des schwerverletzten Bruders und vor seiner eigenen Hilflosigkeit geflüchtet. Doch dann hatte er jeden Kontakt zu Woodwind abgebrochen und die zwei, drei Anrufe seines Bruders aus dem Gefängnis nicht angenommen. Damals war es ihm als die einzige Möglichkeit erschienen, weiterleben zu können. Dafür schämte er sich, aber eine Entschuldigung wäre nur eine leere Floskel. Er konnte sein vergangenes Verhalten nicht rückgängig machen. Jetzt war Woodwind hier und Jones fühlte sich an sein Versprechen gebunden.
„Ich kann hier im Reservat ein gutes Wort für dich einlegen, damit du dort erstmal unterkommst. Jobs gibt’s hier in der Gegend, man darf nur nicht wählerisch sein.“
„Okay, in der Zwischenzeit kann ich doch hier bei dir wohnen, oder? Musst eben ein paar Tage länger bleiben, kleiner Bruder.“
Jones stand auf. „Gut, ich werde mich gleich auf den Weg ins Reservat machen. Willst du mitkommen?“
Woodwind gähnte und streckte sich. „Lass mal, ich bin hundemüde und leg mich ein wenig aufs Ohr. Du kannst mir ja dann berichten, was sie gesagt haben.“ Woodwind erhob sich ebenfalls und schlurfte zum Kühlschrank. Er zog die Tür auf. „Leer“, stellte er fest. „Du warst echt kurz davor, zu verschwinden“, murmelte er, wandte sich dann zu Jones. „Bring ein paar Lebensmittel mit und ich koche uns was heute Abend.“
Jones nahm den Motorradhelm hoch. „Ach, wie bist du eigentlich hierhergekommen? Hast du ein Auto?“
„Schön wär’s. Ich bin mit dem Bus nach Spruce View gekommen und habe im Diner nach dem Weg zu dir gefragt. Ich dachte erst, ich müsste die ganzen zwanzig Kilometer laufen, aber dann hatte ich Glück und einer der Gäste hat mich ein Stück mitgenommen. Die letzten drei Kilometer bin ich gelaufen. Das Blockhaus liegt ja recht abgelegen.“
Lyla hörte Geschirrklappern aus der Küche. Tante Ayita deckte wohl den Tisch für das Abendessen. Aus dem kleinen Fenster sah sie vier Nachbarskinder, die in ihren zu großen Winterparkas im Schnee spielten. Ihre Wangen waren vom kalten Wind feuerrot, kein Wunder bei minus fünfundzwanzig Grad. Wieder einmal fragte sich Lyla, ob die Mütter sich je um ihre Kinder sorgten, die die meiste Zeit draußen herumtollten.
Lyla saß auf der Bettkante, dann stand sie auf. Mr. Mud, ihr schwarzer Labrador, hob schläfrig den Kopf, gähnte und wedelte mit dem Schwanz. Sie beugte sich zu ihm und strich über seinen Bauch. „Bist dicker geworden, du Faultier“, sagte sie.
Mud warf ihr einen Blick zu, als wollte er sagen: „Das ist ja wohl nicht meine Schuld.“
Und Lyla gab ihm recht. Hier im Norden Kanadas war es seit ihrer Ankunft Ende November fast jeden Tag zu kalt, um länger als eine halbe Stunde draußen zu sein. Am Anfang war Lyla fasziniert gewesen von den grün leuchtenden Nordlichtern und der Goldgräber-Vergangenheit dieser Gegend. Die wilde Unberührtheit des Yukon war eindringlich und ungestüm. Gerne hätte sie mehr von der Provinz gesehen, aber sie hatte unterschätzt, wie harsch die Wintermonate im Norden waren. Ihr alter Kombi war kaum das geeignete Fahrzeug, um bei Temperaturen, die täglich um die minus zwanzig Grad lagen, längere Fahrten zu unternehmen. Hinzu kam, dass viele Gebiete im Winter nur mit einem Schneemobil erreichbar waren. Ayita hatte sie herzlich bei sich aufgenommen, doch im Laufe der Zeit fühlte sich Lyla eher wie eine Betreuerin von Ayita und deren zweijährigem Sohn. Zwar bezeichnete ihre Tante den Sohn Wynono als ihr Segenskind, sie schien aber mit dem Kind überfordert zu sein. Lyla fragte sich, ob es wirklich ein Segen für Ayita gewesen war, mit fünfundvierzig zum ersten Mal Mutter zu werden.
Lylas Hoffnung, von ihrer Tante mehr über ihren Vater Kangee zu erfahren, hatte sich nur zum Teil erfüllt. Ayita hatte ihr von der gemeinsamen Kindheit erzählt, und dass Kangee immer eine besondere Verbindung zu Tieren gehabt hatte. Aber über den Mann, der ihr Vater gewesen war, konnte sie ihr nicht viel berichten. „Ich hatte zu ihm und zu unserer kleinen Schwester Donoma den Kontakt verloren“, hatte Ayita nur gesagt und es dabei belassen.
Doch Lyla wollte, nein sie musste, mehr über ihren Vater erfahren, um sich selbst darüber klar zu werden, wer sie war. Der Besuch bei ihrer Tante war ihr als der einzige Weg erschienen, die Bruchstücke ihres Lebens wieder zusammenzusetzen.
Anders als in Alberta lebten die Indianer im Yukon nicht in Reservaten, sondern besaßen eigenes Land. In den wenigen Städten und Siedlungen hier im Norden bildeten sie Gemeinschaften und hatten Lyla freundlich in ihrer Mitte aufgenommen. Lyla hatte sogar zwei Traumfänger für Neugeborene geknüpft.
Doch jetzt, nach drei Monaten, fiel ihr langsam die Decke auf den Kopf. Ihr kam es so vor, als wäre die Kälte nach und nach tief in sie gekrochen. Sie fühlte eine graue Mutlosigkeit.
Auf der kleinen Kommode lag ihre Zeichenmappe. Lyla nahm sie und sah sich die Bleistiftzeichnungen an. Die Stille des Nordens hatte ihren Drang zu zeichnen wieder geweckt und darüber freute sie sich. Bilder von Huskies, dem kleinen Wynono und Skizzen verschiedener Indianer lagen auf einem Stapel in der Mappe. Ganz unten gab es eine Zeichnung, die Lyla von ihrer Tante angefertigt hatte. Sie betrachtete die müden Augen und den Mund, der sich zu Ayitas typischem zaghaften Lächeln verzogen hatte. Manchmal kam es Lyla vor, als hätte ihre Tante schlichtweg vergessen, wie man lachte.
Vor zwei Tagen hatte Lyla mit ihrem Bruder Lee telefoniert. Lyla verstand sein Zögern, die Willow Ranch schon in diesem Jahr in eine Gästeranch umzuwandeln. Vor allem der Kredit bei der Bank, den er brauchen würde, machte ihrem Bruder zu schaffen. Sollte die Idee, Touristen in die Berge zu führen, scheitern, stünde die Zukunft der Ranch auf dem Spiel. Trotzdem hoffte Lyla, ihr Bruder werde den Mut zu diesem Schritt finden. Wenn Lee als Einziger in der Gegend die Erlaubnis bekam, Touristen in den Lebensraum der Wildpferde zu führen, würde dies die Natur und die Tiere vor einer unbegrenzten Anzahl an Reitern schützen. Lee kannte die Wildpferde und konnte dafür sorgen, dass sie in ihrer Freiheit nie eingeschränkt oder gestört werden würden.
Lyla fragte sich, was Nick zu dem Gästebusiness sagte. Lee hatte ihren Exfreund mit keinem Wort erwähnt, nur erzählt, dass die neue Ranchhilfe, die Lee für die Betreuung der Stuten eingestellt hatte, ausgezeichnete Arbeit leistete. Lyla musste zugeben, dass diese Worte sie ein wenig schmerzten. Lee zwar zufrieden ohne sie, hatte schnell offenbar fähigen Ersatz gefunden und sie nicht gefragt, wann sie zurückkommen würde. Die eigentliche Frage war, ob sie die Willow Ranch wieder zu ihrem Zuhause machen wollte. Da war sie sich nicht so ganz sicher. Jetzt, wo sie dort nicht mehr gebraucht wurde, fühlte sie sich merkwürdig heimatlos.
Du willst deinen eigenen Weg finden, ermahnte sie sich und dachte gleichzeitig daran, dass ihr langsam die Ersparnisse ausgingen. Sollte sie sich hier im Norden einen Job suchen?
„Das Abendessen ist fertig“, rief Ayita und riss Lyla aus dem Grübeln. Sie packte die Zeichnungen wieder in die Mappe. Zusammen mit Mud verließ sie das Zimmer und ging in die Küche. Der Hund wurde von Ayitas zweijährigem Sohn mit einem freudigen Jauchzen begrüßt. Der Kleine tapste auf Mud zu und schlang die speckigen Arme um seinen Hals. Lyla entging nicht, wie Ayita mit den Augen rollte und den Kopf schüttelte. Lyla war froh, dass Wynono so vernarrt in ihren Hund war. Denn ansonsten hätte der Labrador mit den zwei Husky-Mischlingen ihrer Tante draußen bleiben müssen. So genoss Mud Sofahund-Status. Wynono ließ sich vor dem Labrador auf den Hintern plumpsen.
„Siitz“, quiekte er den Hund an.
Mud legte den Kopf schief.
„Siiiitz“, wiederholte der Kleine und Mud setzte sich brav hin.
Lyla lächelte. Ayita stellte eine Schüssel auf den Tisch, beugte sich dann zu ihrem Sohn, hob ihn hoch und setzte ihn in den Hochstuhl. Lyla nahm zwei Gläser aus dem Schrank, trat an die Spüle und füllte die Gläser mit Wasser. Ihre Tante holte eine Dose Bier aus dem Kühlschrank und Lyla sah, dass es die letzte Dose aus dem Sixpack war, den ihre Tante gestern gekauft hatte. Erneut hielt sich Ayita nicht an ihr Versprechen, weniger zu trinken. Lyla stellte eines der Gläser so ruckartig neben den Teller ihrer Tante, dass ein wenig Wasser überschwappte.
„Shit“, murmelte sie, griff nach einem Lappen und sah zu Ayita.
Ihre Tante zuckte nur mit den Schultern, öffnete die Bierdose und setzte sich. Sie streckte ihre Hand aus und kitzelte die nackten Füße von Wynono. Der Kleine jauchzte vor Freude, wackelte mit den speckigen Beinchen und strahlte seine Mutter an.
Lyla seufzte, schluckte den Ärger hinunter und nahm am Tisch Platz.
„Hast du darüber nachgedacht, wie lange du noch hierbleiben willst?“, fragte Ayita und gab ihr von dem Eintopf.
Lyla erkannte, dass das Essen wieder aus einer Dose stammte, wie meistens, wenn ihre Tante kochte. Sie aß einen Löffel davon, verzog den Mund und sah Ayita an. „Wieso fragst du?“
„Du bist hier immer willkommen, aber, also, ich würde das Zimmer, in dem du wohnst, gerne ab nächsten Monat vermieten. Könnte das zusätzliche Geld gut gebrauchen.“
Um dir mehr Bier zu kaufen, schoss es Lyla durch den Kopf und schämte sich gleich für diesen Gedanken. Ihre Tante war gefangen in einem Kummer, über den sie nicht sprechen wollte. Nicht einmal die Liebe zu ihrem Sohn konnte die Traurigkeit vertreiben. Die Trinkerei war ihr Weg, um durch den Tag zu kommen und den Schmerz zu betäuben.
Lyla erinnerte sich an Nicks Mutter, die ebenfalls Alkoholikerin gewesen war und mit dieser Sucht beinahe ihr und Nicks Leben zerstört hätte.
Das war nur wenige Monate her, doch Lyla kam es wie eine Ewigkeit vor. Lylas Versuche, der Traurigkeit ihrer Tante auf den Grund zu gehen, waren nicht erfolgreich gewesen, Ayita sprach einfach nicht darüber. Zunächst hatte Lyla vermutet, ihre Tante würde Wynonos Vater vermissen, der Schlittenhunde gezüchtet hatte. Seine Hunde hatte er an zahlreiche Hundeführer, die an der Yukon Quest, dem alljährlichen Hundeschlittenrennen teilnahmen, verkauft. Aber von anderen Indianern hatte sie gehört, dass er zu Wutausbrüchen geneigt und Ayita ihm nicht nachgeweint hatte, als er vor einem Jahr, kurz nach Wynonos Geburt, sturzbetrunken draußen erfroren war.
In den wenigen Gesprächen hatte ihre Tante einmal ihre Kindheit erwähnt und die Jahre, die sie in einer Residential-Schule, einem Internat für Natives, verbringen musste. Lyla wusste kaum etwas über dieses separate Schulsystem, nur, dass der Sinn der Internatsschulen für indianische Kinder der war, die Kinder dem Einflussbereich ihrer Eltern und ihren Traditionen zu entziehen. Was Lyla im Internet darüber gefunden hatte, hatte ihr Alpträume beschert. Missbrauch, Drogen und jede Menge Alkohol verbunden mit gewissenlosen Aufsichtspersonen, die die Kinder für ihre zweifelhaften Zwecke nutzten. Zum Glück gab es solche Schulen jetzt nicht mehr.
Jede Unterhaltung über Ayitas Vergangenheit und warum sie damals das Reservat, ihre Familie und Freunde verlassen hatte, um in den Yukon zu ziehen, blockte die Tante ab. Daher hatte Lyla es nach den ersten Wochen aufgeben, sich in ihr Leben einzumischen, und begonnen, sich um vieles im Haushalt und um Wynono zu kümmern. Doch in den letzten Wochen hatte sie immer mehr das Gefühl, dass Ayitas depressive Stimmung auf sie abfärbte, und das wollte sie nicht zulassen. Wenn sie ehrlich war, war es nur Wynono, der die trüben Gedanken aus ihrem Kopf vertrieb. Sobald sie daran dachte, ihn mit seiner trinkenden Mutter alleine zu lassen, bekam sie ein schlechtes Gewissen.
In der Nachbarschaft gab es eine Art Hort, in dem Kinder aufgenommen wurden, deren Eltern nicht in der Lage waren, die Betreuung zu übernehmen. Lyla hatte dort vorbeigeschaut und unter einem Vorwand mit der Leiterin gesprochen, ohne ihr ihre Sorge um Wynono mitzuteilen. Vielleicht sollte sie die Frau nochmals kontaktieren. Lyla spürte, dass es Zeit für sie war, den Absprung zu finden. Sie sah ihre Tante an. „Ich verstehe, dass du das Zimmer gerne vermieten würdest. Ich kann Ende März ausziehen.“
Ayita hob eine Augenbraue. „Wohin wirst du gehen? Ich will dich nicht rauswerfen. Sicher finden wir eine andere Lösung, wenn du bleiben willst. Du könntest dir hier einen Job suchen und mir eine kleine Miete zahlen.“
Lyla sah, dass es ihrer Tante nicht leichtfiel, sie darum zu bitten. „Ich lasse es mir durch den Kopf gehen“, sagte sie. „Und natürlich werde ich Miete zahlen, wenn ich mich entschließe zu bleiben.“
Ayita legte eine Hand auf Lylas Arm und lächelte. „Danke, dass du es verstehst. Ich habe dich gerne hier bei mir. Und ich bin mir sicher, dass du bei Joe im Supermarkt als Kassiererin arbeiten kannst.“
Lyla stand auf und räumte den Tisch ab. Während sie sich um das Geschirr kümmerte, beschäftigte sich Ayita mit ihrem Sohn.
„Ich werde den Kleinen baden, dann schläft er besser“, sagte sie nach ein paar Minuten. Sie legte einen Zehndollarschein auf den Tisch. „Könntest du zum Liquor Store gehen und mir ein neues Sixpack kaufen?“
Lyla trocknete sich die Hände ab und seufzte innerlich. „Du weißt, dass ich dir keinen Alkohol kaufe. Aber ich werde Milch und Brei für Wynono mitbringen. Mud und ich wollten eh noch einen Spaziergang machen.“ Sie nahm das Geld, steckte es ein und sah ihre Tante an. Bitte, lass uns nicht schon wieder streiten, dachte Lyla. Zu ihrer Erleichterung zuckte ihre Tante nur mit den Schultern.
„Jaja, schon gut. Wenn du eh in den Supermarkt gehst, frag Joe doch gleich nach einem Job“, schlug Ayita vor und verschwand mit dem fröhlich glucksenden Wynono auf dem Arm im Badezimmer.
Dick eingepackt in ihren Schneeanzug, lief Lyla einen schmalen Pfad entlang, der sich durch den nahegelegenen Park schlängelte. Mud schnüffelte Hasenspuren nach und genoss das Herumtollen in der Kälte für eine kurze Zeit. Sie dachte über Ayitas Vorschlag nach. Wollte sie wirklich im Supermarkt arbeiten? Sie war sich sicher, dass Joe ihr den Job geben würde. Er hatte ebenfalls ihren Vater Kangee gekannt und er war damals zusammen mit Ayita in den Norden gegangen. Joe war beinahe das Herz stehen geblieben, als sie mit Ayita Anfang Dezember den Supermarkt zum ersten Mal betreten hatte. Lyla erinnerte sich genau an seine Reaktion.
„He, Joe“, hatte Ayita gerufen, „ich habe hier jemanden, den du unbedingt kennenlernen solltest.“
Der Mann, der damit beschäftigt war, ein Regal mit Dosen zu bestücken, wandte sich zu ihnen um. Als er Lyla sah, riss er die Augen auf, ließ eine Dose fallen und fasste sich mit der Hand an die Brust.
Ayita ging lachend zu ihm. „Beruhig dich, Joe. Ich weiß, sie ist meiner kleinen Schwester Donoma wie aus dem Gesicht geschnitten.“
Lyla fuhr sich durch die langen, dunkelbraunen Haare und lächelte den Unbekannten an. „Hallo, ich bin Lyla Meyers“, stellte sie sich vor.
„Joe Stone“, murmelte der Indianer, immer noch um Fassung ringend. Er sah ihr so intensiv in die Augen, dass Lyla den Blick senkte.
„Tut mir leid“, sagte Joe. „Diese goldfarbenen Sprengsel in deinen Augen, sie strahlen wie die von Donoma. Aber dein Gesicht trägt auch die stolzen Züge deines Vaters Kangee.“
„Dankeschön“, murmelte Lyla verlegen. „Hast du meinen Vater gut gekannt?“, fragte sie.
Joes Blick flog zu Ayita, dann wieder zu Lyla. „Nein, leider nicht. Aber Donoma und ich haben als Teenager viel Zeit miteinander verbracht“, sagte er und warf Lyla ein schiefes Grinsen zu.
Lyla schob die Erinnerung beiseite. Ihre äußerliche Ähnlichkeit mit ihren Verwandten halfen ihr nicht, sich innerlich ihren indianischen Wurzeln näher zu fühlen. Und deshalb war sie doch in den Norden gereist, oder? Lyla seufzte und ging weiter den Pfad entlang, unfähig, eine Entscheidung zu treffen. Sie kam sich vor wie in einer Warteschleife, dabei hatte sie sich beim Verlassen der Willow Ranch doch selbstbewusst und voller Tatendrang gefühlt. Jetzt schienen ihr Mut und die Motivation, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, im langen Winter des kanadischen Nordens eingefrorenen zu sein. Mud kam mit einem Stock im Maul zu ihr gerannt und schaute sie erwartungsvoll an. Sie nahm den kurzen Ast und warf ihn, soweit sie konnte. Begeistert schoss Mud hinterher. Wie einfach es für den Hund war, jeden Tag zu genießen, ohne sich Gedanken über ein Gestern oder Morgen zu machen.
Sie überquerte eine Gasse und entdeckte ein hölzernen Schild, das im Schnee nur wenige Schritte vor ihr lag. Es zeigte eine bunte Feder, aus der Tinte auf ein Blatt Papier tropfte. Darunter stand in geschwungener Schrift ‚Kunst und Tattoos‘. Lyla beugte sich hinab und hob das fein gearbeitete Schild auf. Während sie die gezeichnete Feder bewunderte, öffnete sich neben ihr eine Wohnungstür.
„Oh, ist das dumme Ding wieder abgefallen“, sagte eine Stimme und als Lyla den Kopf wandte, sah sie eine alte Indianerin im Türrahmen stehen. Sie trug ein traditionelles Gewand aus Wildleder.
„Ist das Ihr Schild?“, fragte Lyla lächelnd. „Es lag hier auf dem Gehweg. Sind Sie die Besitzerin des Kunstgeschäfts?“
„Ja, das bin ich. Es ist eigentlich meine Wohnung und die, die mich finden wollen, tun es auch ohne das Schild. Aber manchmal hänge ich es eben doch raus.“ Die Indianerin kicherte heiser. „Komm herein, ich habe gerade Tee gemacht“, sagte sie.
Lyla zögerte, überrascht über die spontane Einladung. „Ich möchte Ihnen keine Umstände machen.“
„Unsinn, für Tee ist immer Zeit.“
„Darf mein Hund mit hinein?“
„Sicher“, sagte die Frau und lächelte.
Lyla betrat mit Mud den kleinen Laden, der nach Salbei roch. An den Wänden hingen unzählige Zeichnungen und erst da sah Lyla im hinteren Teil des Raumes die Tattoomaschine. „Sind das deine eigenen Zeichnungen?“, fragte Lyla.
„Ja, und die meisten habe ich auf der Haut von jemandem verewigt.“
„Die sind unglaublich schön.“ Lyla besah sich die Kunstwerke und staunte über die vielen Details. „Mit Tusche habe ich noch nie gearbeitet. Die Schattierungen sind toll.“
„Ach, du zeichnest selbst?“
„Am liebsten mit Bleistift“, erwiderte Lyla. „Aber so ein Tattoo würde mir auch gefallen.“
„Du bist Ayitas Nichte, oder?“, fragte die Frau, goss Tee in zwei Tassen und reichte Lyla eine davon. „Die Menschen hier nennen mich Old Deer.“
„Ja, das bin ich. Mein Name ist Lyla.“
„Du hast für zwei Babys wunderbare Traumfänger geknüpft. Ich bin mit den Müttern befreundet und sie haben sie mir gezeigt. Wo hast du diese Kunst erlernt?“
Lyla dachte an Lonefeather Jones, der die Gabe in ihr gesehen hatte. Viele Stunden hatte sie mit ihm an ihrer Fingerfertigkeit gearbeitet und gelernt, Magie in die Kunstwerke zu weben. Diese war aber längst nicht so durchdringend wie in ihm selbst. „Ein Freund hat es mir beigebracht“, sagte sie.
Old Deer wiegte ihren Kopf leicht hin und her. „Es ist schön zu sehen, dass diese Kunst weitergegeben wird. Glaubst du, das Knüpfen könnte dich vollends erfüllen?“
Lyla überlegte einen Moment, dann schüttelte sie den Kopf. „Ich denke, das Zeichnen liegt mir mehr. Seit ich hier im Norden bei Ayita bin, kann ich gar nicht mehr aufhören.“
„Kommt ihr beide gut miteinander aus?“
Lyla wunderte sich über die direkte Frage und zögerte einen Augenblick. Dann spürte sie den Drang, dieser Fremden ihr Herz auszuschütten. „Na ja, wir streiten uns immer öfter in letzter Zeit.“
„Um was geht es denn bei euren Auseinandersetzungen?“
„Meistens dreht es sich um ihren Sohn Wynono. Sie vergisst, Windeln zu wechseln oder Brei zu kaufen, solche Dinge. Immer wenn sie zu viel Bier trinkt und diese blöden Online-Casino-Spiele spielt, vergisst sie ihren eigenen Sohn. Das macht mich wütend und traurig.“
Old Deer seufzte. „Es tut Ayita gut, dass du hier bist, aber ich fürchte, für dich bewirkt es das Gegenteil.“
„Wie meinst du das?“
„Du bist eine Suchende, aber ich glaube nicht, dass du hier findest, was dein Herz begehrt.“
Lyla sah die Indianerin verwundert an. „Was suche ich denn?“
„Dich selbst“, sagte Old Deer knapp.
„Ja, irgendwie schon“, stimmte Lyla zu. „Und ich werde mich bald wieder auf die Suche nach meinem Weg machen. Ich weiß nur nicht, wohin ich mich wenden soll. Nach Hause zurückzukehren, erscheint mir wie ein Rückschritt.“
„Aber wieso? Dort sind deine Wurzeln und du kannst deine Heimat immer wieder neu als Zuhause zurückerobern.“