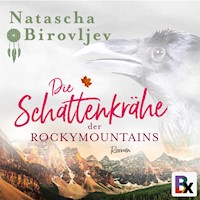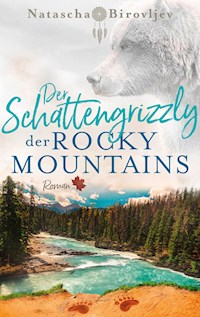4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lied der Wildnis - Ruf des Herzens Drei Menschen und eine Wölfin bringen turbulente Zeiten zurück auf die Willow Ranch. In der wilden Natur der Rocky Mountains treffen sich die Schicksale und Abenteuer. Die Pferdepflegerin Rosie, der Cowboy Cody und der Cree-Indianer Woodwind streben neuen berufliche Zielen und Träumen entgegen. Wäre da nur nicht die Liebe, die ihre Herzen durcheinanderwirbelt. Muss Cody sich nach dem Selbstmord seiner Bruders entscheiden, sein Leben im Sattel aufzugeben, um die Familienfarm zu retten? Wird Rosie dem Falschen vertrauen und nicht nur ihre Pferde, sondern auch ihr Zuhause verlieren? Und wie kann sich Woodwind von seinen Selbstzweifeln lösen, um die Wölfin und die Frau seines Herzens zu retten? Leichtsinnige Entscheidungen bringen die Zukunft der Menschen rund um die Willow Ranch in Gefahr. Werden alle rechtzeitig erkennen, dass sie nur in der Gemeinschaft die Ranch und ihr eigenes Glück retten können? Im vierten Band der Willow Ranch-Reihe wird die Liebe zu einer Mutprobe, und der Schutz der wilden Schönheit der Rocky Mountains eine Herausforderung. Freunde und Mitarbeitern der Ranch müssen an einem Strang ziehen und an die Magie der Gemeinschaft glauben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Januar
Februar
März
April
Mai
Danksagung
Die Autorin
Werbung
Über das Buch
Lied der Wildnis – Ruf des Herzens
Drei Menschen und eine Wölfin bringen turbulente Zeiten zurück auf die Willow Ranch. In der wilden Natur der Rocky Mountains treffen sich Schicksal und Abenteuer.
Die Pferdepflegerin Rosie, der Cowboy Cody und der Cree-Indianer Woodwind streben neuen beruflichen Zielen und Träumen entgegen. Wäre da nur nicht die Liebe, die ihre Herzen durcheinanderwirbelt. Muss Cody sich nach dem Selbstmord seines Bruders entscheiden, sein Leben im Sattel aufzugeben, um die Familienfarm zu retten? Wird Rosie dem Falschen vertrauen und nicht nur ihre Pferde, sondern auch ihr Zuhause verlieren? Und wie kann sich Woodwind von seinen Selbstzweifeln lösen, um die Wölfin und die Frau seines Herzens zu retten?
Bibliographische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2021 Natascha Birovljev · Caroline, Alberta, Kanada · www.natascha-birovljev.com
Bestellung und Vertrieb: Nova MD GmbH, Vachendorf
Druck: Custom Printing, Warschau, Polen
ISBN 978-3-96966-545-9
Tolino ISBN: 978-3-949489-00-6
1. Auflage (Version 1.0)
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com
Lektorat: Dr. Hanne Landbeck, www.schreibwerk-berlin.com
Korrektorat: Ursula Hahnenberg · www.buechermacherei.de
Layout und Satz: Gabi Schmid, www.buechermacherei.de
Bilder: #306737217 | AdobeStock und Motive von shutterstock.com
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte liegen bei der Autorin. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Zwei Wölfe
Schweigend nahm die Indianerin die verrußte Blechkanne vom Grill über den Flammen. Sie füllte den Kaffee in Tassen und verteilte diese unter den Zuhörern, die ihrer Einladung zu diesem Lagerfeuerabend gefolgt waren. Bevor sie sich wieder am Lagerfeuer auf der Decke niederließ, strich sie ihrem Sohn zärtlich über den schwarzen Haarschopf.
Die Bäume um sie herum warfen schaurige Schatten, das Feuer knackte und die orangenen Flammen loderten in den Himmel. Sie sah den Indianer in der Wildlederkluft am Waldrand stehen. Er nickte ihr zu und sie erwiderte den Gruß. Geduldig wartete sie, bis es sich alle bequem gemacht hatten und die Blicke der zur Mehrheit weißen Zuhörer auf ihr ruhten.
„Flammenlicht und Dunkelheit“, begann sie, „wie die zwei Wölfe, die in unseren Herzen wohnen.“
„Was bedeutet das?“, fragte ihr Sohn mit leuchtenden Augen.
Die Indianerin warf ihm einen ernsten Blick zu; er sollte doch wissen, dass Ungeduld einer Geschichte schadete. Es ärgerte die Geister, die lauschten. Aber ihr Sohn hatte sie schon mehrmals gebeten, diese Legende zu erzählen, und seine stürmische Vorfreude ließ sie schmunzeln. Sie holte unter ihrer Jacke einen Beutel hervor, der um ihren Hals hing, und nahm mit zwei Fingerspitzen ein wenig getrockneten Salbei und Bisongras heraus. Mit einem Schwung aus dem Handgelenk warf sie die Kräuter ins Feuer, um die Geister wieder zu besänftigen. Tief atmete sie den würzigen Rauch ein, blickte in die Runde und erzählte die uralte Stammesgeschichte von den zwei Wölfen:
„In jedem von uns lebt ein Wolf mit hellem und einer mit dunklem Fell. Der Lichtwolf verkörpert alles, was uns gut erscheint. Er ist Freude, Friede, Liebe, Hoffnung, Freundlichkeit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Wahrheit und all das Lichte in uns. Im Schattenwolf leben Zorn, Neid, Trauer, Arroganz, Selbstmitleid und andere negative Gefühle. Der Kampf zwischen den zwei Wölfen findet in jeder Person statt, denn wir haben alle diese beiden Tiere in uns.“
„Und welcher Wolf gewinnt?“, fragte ihr Sohn und diesmal nickte die Indianerin ihm zu. Das war eine wichtige Frage.
„Der, den du fütterst“, antwortete sie.
„Dann gebe ich nur dem hellen Wolf Futter.“
Einige Zuhörer nickten und wechselten ein paar Worte. Bedächtig hob die Erzählerin die Hand und das Gemurmel verstummte. Sie wusste, dass viele sich vor dem dunklen Wolf ängstigten. Er schlummerte außerhalb des Blickfelds, mied jedes Licht. Wenige wagten es, zu ihm in den Schatten zu blicken. Die anderen fürchteten, dass sie etwas Unheimliches finden würden, wenn sie dem schlafenden Wolf nahekamen.
„Bedenke, mein Sohn, nährst du nur den Lichtwolf, wird der Dunkle hinter jeder Ecke lauern und auf dich warten. Denn er wird auch ohne Nahrung ein Teil von dir bleiben.“
Ein junger Mann legte mehr Holz auf das glimmende Feuer, stocherte in der Glut, bis das Licht der Flammen wieder hell leuchtete. Die Indianerin wusste, dass niemand gerne an seine Schatten dachte. „Der dunkle Wolf wird versuchen, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die er braucht“, fuhr sie fort.
„Aber was kann ich dagegen tun?“, fragte ein Mädchen, das neben ihrem Sohn saß.
„Wir müssen anerkennen, dass wir mit unseren hellen Seiten auch dunkle Facetten in uns tragen. Es bringt nichts, diese zu verdrängen oder sie nicht wahrhaben zu wollen. Erst, wenn wir diese Schattenseiten annehmen, entdecken wir unsere Mitte. Aber das innere Gleichgewicht zu finden, ist eine große Herausforderung.“
Die Indianerin nahm einen Schluck aus ihrer Tasse, schmeckte die bittere Süße des Kaffees, in den sie Ahornsirup gerührt hatte, und sah in nachdenkliche Gesichter. Gut, ihre Zuhörer aus dem nahen Dorf und manche auch aus der weiter entfernten Stadt, lauschten nicht nur ihren Worten, sondern begannen, sich eigene Gedanken zu machen. Ein Mann räusperte sich. Mit einem Nicken lud sie ihn zum Sprechen ein.
„Aber wenn der Schattenwolf nur Negatives verkörpert, wieso soll ich ihm dann Aufmerksamkeit schenken?“
„Das dunkle Tier hat auch wertvolle Qualitäten. Dazu gehören Beharrlichkeit, Willensstärke und Furchtlosigkeit. Er ist entschlossen und hartnäckig. In ihm verbergen sich Tugenden, die der Lichtwolf nicht hat. All dies brauchen wir in Zeiten, in denen der helle Wolf nicht weiter weiß, denn auch er hat seine Schwächen. Wenn du beide nährst und auf sie achtest, werden sie in dir ein Teil von etwas Größerem, das in Harmonie wachsen kann. Du wirst dich nicht mehr zerrissen fühlen und kannst deiner inneren Stimme lauschen, die dir in jeder Situation den richtigen Weg deutet.“
„Das klingt friedlich“, sagte eine junge Frau.
„Das ist es“, stimmte die Erzählerin zu. „Ein Mensch, der den dunklen und hellen Wolf in Frieden in sich hat, der hat alles. Einer, der in seinen inneren Krieg gezogen wird, der hat gar nichts. Das Leben kann fröhlich oder traurig, schön oder brutal sein – wir erschaffen unsere eigene Geschichte. Wir erfahren Hass und Liebe, Gelassenheit und Verlust. Das ist das Leben.“
Wieder erhob sich ein Gemurmel unter den Zuhörern. Die Indianerin ließ sie für ein paar Minuten gewähren. Dann räusperte sie sich, ihre Stimme klang eindringlich. „Behaltet diese Legende in den Herzen, lebt mit dem Wissen eurer Schatten, die ebenso zu euch gehören wie das Licht. Unterschätzt nie dieses Tier mit dem durchdringenden Blick und seinem zerzausten Fell. Es ist dunkel wie die Nacht. Begrüßt es in eurer Mitte.“
In der Ferne erklang das Heulen eines Wolfes. Die Indianerin erhob sich und lauschte. Aus einer anderen Richtung antwortete ein weiterer Wolf. Lächelnd streckte die Erzählerin den Arm aus. Ihr Sohn stand auf, schmiegte seine Hand in ihre und gemeinsam verschwanden sie in der Dunkelheit der Bäume.
(Frei nach einer Legende der Cherokee)
Kaffeegeruch drang in Woodwinds Nase. Verdammt, er hatte doch weg sein wollen, bevor Una aufstand. Gähnend rieb er sich über die Augen, schlug die Decke zurück und setzte sich auf die Bettkante. Er löste das Lederband vom Handgelenk und band damit seine schwarzen Haare zusammen. Dann stand er auf, nahm seine Klamotten, die verstreut auf dem Holzboden lagen, und zog sich an. Leise trat er aus dem Schlafzimmer und beobachtete Una in der kleinen Küche. Die junge Frau stand nur mit einem T-Shirt bekleidet am Fenster, nippte an einer Tasse und sah hinaus in den trüben Maimorgen. Woodwind wandte seinen Blick zur Haustür, dann seufzte er und ging über den Flur in die Küche.
„Ich muss los“, sagte er.
Una drehte sich um. „Bleib doch zum Frühstück. Kaffee ist schon fertig.“ Sie lächelte zwar, aber ihre Augen blieben davon unberührt. Sie kannte seine Antwort.
„Das ist lieb, aber ich mache mich besser auf den Weg.“
Ihre Schultern versteiften sich und sie presste kurz die Lippen aufeinander. „Sehen wir uns heute Abend?“
„Besser nicht.“ Er trat näher und legte eine Hand auf ihre Wange. Sie schmiegte ihren Kopf kurz dagegen, dann jedoch schüttelte sie sie ab.
„Tut mir leid. Du hast einen besseren Mann verdient, als ich einer sein kann“, murmelte er. Er wusste nicht, wie er mit ihrer plötzlichen Traurigkeit umgehen sollte.
Ein schmales Lächeln umspielte ihre Lippen. „Du musst dich für nichts entschuldigen. Wir wollen beide keine feste Beziehung. Ich bin nur traurig, dass unsere gemeinsame Zeit vorbei ist.“ Ihre hellbraunen Augen blickten jetzt sanft. Sie beugte sich zu ihm und küsste ihn. Es war mehr ein Hauch als ein Kuss und die Berührung fühlte sich an wie Hoffnung und Abschied zugleich. Fragend sah er sie an.
„Nächste Woche kommt meine Bekannte, der das Haus hier gehört, von ihrer Weltreise zurück und ich werde zu meinem Vater ins Reservat ziehen. Mein kleiner Bruder Nuka ist wieder hier. Er braucht mich.“
Woodwind nickte. Unter diesen Umständen war ein Wiedersehen tatsächlich erstmal nicht möglich. Seit er vor einem Jahr ins Reservat gezogen war, hatte der Mann ihn auf dem Kieker. Bull würde ihm und Una die Hölle heißmachen, wenn er von ihrer Verbindung erfahren würde. „Pass auf dich auf, Una. Ich habe dich wirklich gern.“
„Das weiß ich doch. Mach’s gut, Flötenschnitzer“, sagte sie. „Bis irgendwann mal wieder.“
Vor dem kleinen Haus, das ein paar Kilometer außerhalb des Reservats lag, stieg er in sein klappriges Auto und fuhr los. Er würde die innigen Momente mit Una vermissen. Bevor er sie getroffen hatte, hatte er sich mit einigen Frauen eingelassen, die ihn aber nicht so verzaubert hatten wie Una. Doch er war für eine feste Beziehung nicht geschaffen und so war Unas Wunsch nach einer lockeren Verbindung ohne Verpflichtungen für ihn kein Problem gewesen. Woodwind wusste, dass sie nicht hier im Sunchild Reservat bleiben wollte, aber warum sie ihr Studium abgebrochen und überhaupt zurückgekommen war, hatte sie ihm nicht verraten.
Nach zwanzig Minuten hatte er sein Haus im Sunchild Reservat erreicht. Er wollte duschen und sich dann auf den Weg in die Wildtierstation machen, die er seit ein paar Monaten leitete. Sein Nachbar war wieder einmal mit dem Truck in der Einfahrt beschäftigt. Dieser Typ tat den lieben langen Tag nichts anderes, als an dem Fahrzeug rumzuschrauben. Woodwind parkte, stieg aus und nickte dem Mann zu.
„Na, hast du wieder eine Frau unglücklich gemacht?“
„Was geht’s dich an?“
„Treue ist wohl nicht so deins, oder? Wenn du so weitermachst, jagen sie dich aus dem Reservat.“
„Was juckt es mich, wenn die Kerle hier zu doof sind, eine Frau glücklich zu machen?“, gab Woodwind zurück, riss ein Flugblatt aus dem Briefkasten neben der Tür und beeilte sich, ins Haus zu kommen. Er wusste, dass sein Nachbar recht hatte und einige der Männer hier nicht gut auf ihn zu sprechen waren. Sie neideten ihm sein Glück bei Frauen und viele misstrauten ihm schon allein deshalb, weil er im Gefängnis gesessen hatte. Er warf einen Blick auf das Flugblatt. Es kündigte die nächste Gemeinschaftsversammlung an. Die Teilnahme war zwar freiwillig, aber im Grunde wurde von Reservatsbewohnern erwartet, dass sie bei wenigstens einer solchen Sitzung pro Monat anwesend waren. Bis jetzt hatte er es vermieden, dort aufzutauchen, was ihn immer noch zu dem Neuen machte, den keiner hier wirklich kannte.
Außer Chinook, dem Schamanen des Sunchild Reservats, der sich für Woodwinds Aufnahme eingesetzt und ihm das Haus hier verschafft hatte. Die Miete, die er an die Reservatsverwaltung zahlte, war niedrig und Woodwind versuchte, wenigstens eine Art Freundschaft mit Chinook zu pflegen. Seufzend knüllte er das Flugblatt zusammen und warf es in den Papierkorb. Er konnte sich nur allzu gut vorstellen, wie sich die Reservatsbewohner über ihn das Maul zerreißen würden, wenn er auf einer Versammlung auftauchen würde. Nein, danke.
Er stellte sich unter die Dusche und die Worte seines Nachbarn kamen ihm wieder in den Sinn. Woodwind hatte sich in keine der Frauen, mit denen er kurz zusammen war, verliebt, auch nicht in Una, aber das war schließlich nicht seine Schuld. Die Liebe hatte ihn vor zehn Jahren verlassen, als seine Verlobte und sein ungeborenes Kind bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren. Betrunken hatte er das Auto gegen einen Baum gefahren. Er rubbelte sich mit einem Handtuch trocken, bis seine Haut schmerzte. Das lag, verdammt nochmal, alles hinter ihm. Er hatte seine Schuld gebüßt und war dabei, sich hier ein neues Zuhause, eine Zukunft aufzubauen. Ohne jemandem Rechenschaft ablegen zu müssen. Soll sich doch jeder um seineneigenen Mist kümmern, dachte er, schlüpfte in frische Klamotten und fuhr zur Wildtierstation.
„Nein, das Brett kommt da hinten hin“, rief Rosie ihrem Bruder Jim zu, der auf der windschiefen Veranda vor der Blockhütte stand.
Jim nickte und befestigte das Regal mit ein paar Schrauben an der Holzwand. Rosie stellte sich in einigem Abstand davor und beäugte es kritisch. Dann winkte sie ihn heran. „Findest du, das hängt zu niedrig? Ich will Blumentöpfe drauf stellen.“
Jim zuckte mit den Schultern. „Sieht gut aus. Ich habe einen Bärenhunger. Fütterst du mich noch, bevor ich dich verlasse?“
„Ich füttere Hazel und mache uns was zu essen“, erwiderte sie grinsend. Kaum hatte die Hündin ihren Namen gehört, kam sie angelaufen. Rosie strich dem Bloodhound liebevoll über die langen Schlappohren und ging mit ihr ins Haus. Nachdem sie Hazel den Rest Dosenfutter in den Napf gelöffelt hatte, stellte sie einen Topf Wasser auf den Gasherd. Ihr Bruder kam herein und zog Jacke und Boots aus.
„Sind Spagetti mit Fleischbällchen okay für den besten Bruder der Welt?“
Jim machte es sich auf der speckigen Ledercouch gemütlich. „Klingt lecker. Ich bin also dein Lieblingsbruder, eh? Lass das mal nicht Darryl und Bob hören.“
Sie schmunzelte und nahm eine Dose Root Beer aus dem Kühlschrank, die sie Jim zuwarf. Mit ihren vierundzwanzig Jahren war Rosie nur drei Jahre jünger als Jim, während ihre beiden anderen Brüder acht und zehn Jahre älter waren als sie. Darryl und Bob waren verheiratet, hatten Kinder und gutbezahlte Jobs im Energiesektor. Jim hatte zwei Collegeabschlüsse und arbeitete als Umweltschutzberater für ein Sägewerk, das in ganz Kanada Betriebe hatte. Ihre Eltern waren stolz auf ihre Söhne. „Ehrgeiz und harte Arbeit führen ans Ziel. Mach einen Plan und verwirkliche ihn“, sagte ihre Mutter immer und Rosies Brüder hatten es geschafft. Wenn sie ihre mit deren Laufbahnen verglich, kam sie sich wie ein Blatt im Wind vor.
„Ist wirklich nett von Onkel Eric, dass du die Blockhütte von ihm übernehmen konntest“, sagte Jim. „Und mit den kleinen Renovierungen wird das hier ein gemütliches Plätzchen.“
Rosie lächelte und bereitete die Sauce zu. Ihr Onkel war Mitte sechzig, Pelzjäger und seit letztem Sommer verheiratet mit Jeanne, der Liebe seines Lebens. Zunächst hatten die beiden nicht zusammenziehen wollen. „Wir lieben uns“, hatte ihr Onkel gesagt. „Aber das bedeutet nicht, dass wir uns jeden Tag ertragen könnten.“ Doch dann hatten sie vor ein paar Wochen alle Bedenken über Bord geworfen und Eric war in Jeannes kleines Häuschen gezogen, das auf dem Gelände der Willow Ranch stand. Und er hatte Rosie, die bereits bei ihm gewohnt hatte, seine Blockhütte zur Miete angeboten. Zum ersten Mal in ihrem Leben wohnte sie allein. Es fühlte sich noch etwas ungewohnt an, aber eigentlich gut. Sie holte eine Tüte mit Fleischbällchen aus dem Gefrierschrank und gab einige in die Tomatensauce.
„Reicht denn das Gehalt für Miete, Essen und dergleichen?“, fragte Jim und riss sie aus ihren Gedanken.
„Das kriege ich schon hin.“ Sie stellte zwei Teller und Gläser auf den kleinen Esstisch und legte das Besteck dazu.
Jim stand auf und deckte den Tisch. „Bist du dir sicher, du wirst dich hier nicht einsam fühlen? Die Hütte liegt ziemlich abgelegen.“
„Ich habe doch Hazel, die mir Gesellschaft leistet.“
Wenig später saßen die Geschwister zusammen. Rosie freute sich, dass Jim mit großem Appetit aß. Nach dem Essen sah er auf die Uhr. „Ich mache mich besser mal auf den Heimweg. Nächste Woche stehen einige wichtige Geschäftstermine mit Japan an. Telefonkonferenzen zu unmöglichen Uhrzeiten.“
Sie standen auf und stellten das Geschirr in die Spüle.
Rosie und Hazel begleiteten Jim zu seinem Truck. „Danke nochmals für deine Hilfe und das Holz.“
„Passt schon, Schwesterherz. Ich kann dir kommendes Wochenende bei den Arbeiten an der Hütte auch noch mal zur Hand gehen.“
„Aber nur, wenn es keine Umstände macht. Das meiste bekomme ich selbst hin“, sagte sie.
„Weiß ich doch. Aber die schweren Holzbalken wirst du kaum allein heben und anschrauben können.“ Er grinste sie an.
Sie lächelte zurück. „Hast ja recht. Dann bis nächste Woche.“ Sie umarmte ihren Bruder und schaute dem Truck nach, bis die Rücklichter hinter einer Kurve verschwanden. Ein flüchtiges Gefühl von Einsamkeit überkam sie und sie schlang die Arme um ihren Oberkörper. Hazel war in den Paddock gelaufen und schnüffelte an der Heuraufe. Rosie schlenderte zu ihr. „Wäre schön, Pferde hier zu haben, oder?“ Sie strich mit einer Hand über den Koppelzaun. Zwar war sie bei ihrer Arbeit auf der Willow Ranch den ganzen Tag von Pferden umgeben, aber das war nicht dasselbe. Als sie noch mit Calvin zusammen gewesen war, hatte sie im Reitstall seines Vaters gearbeitet und die Ausbildung von Ranchpferden beobachtet.
Es wurde immer wieder unterschätzt, was ein Pferd alles können musste, um dem Rancher eine wirkliche Hilfe zu sein. In Alberta gab es nur einen Pferdetrainer, der jedes Jahr eine Handvoll junger Menschen speziell dafür ausbildete. Soweit Rosie wusste, hatten bisher nur zwei Frauen bei Gordsteen abgeschlossen. Calvin hatte diese Ausbildung als Geldmacherei belächelt. Er, selbst bei Rodeo-Events aktiv, hatte sie stets angespornt, sich einen Namen in den Barrel Racing Wettkämpfen zu machen. „Wenn du in deinem Rodeo-Outfit um die drei Tonnen fegst, kann ich mich an dir gar nicht sattsehen“, hatte er oft geschwärmt. Leider war sie nicht das einzige Cowgirl, zu dem er das gesagt hatte.
Mit dem Ende der Beziehung hatte sie auch das Rodeoreiten aufgegeben, was sie nicht bedauerte. Ihr lagen die Ranchpferde mehr am Herzen. Und wie gerne hätte sie sich von Gordsteen ausbilden lassen.
Erste Sterne erschienen am Himmel und Rosie ging mit Hazel zurück ins Haus. Sie wollte ihre Ausgaben und Einnahmen auflisten, um etwas klarer zu sehen. Wenn sie sparsam lebte, könnte sie sich irgendwann doch ihren Traum erfüllen und bei Gordsteen lernen. Und, wenn alles glatt lief, auch noch Pferde hierher holen. Mit einem Lächeln auf den Lippen machte sie sich an die Zahlen, aber die gute Laune verging ihr bald. Ohne weitere Einnahmequellen würde aus den Träumen so schnell nichts werden.
Cody drehte das Radio leiser und bog vom Highway auf die Schotterstraße ab. In einer Viertelstunde würde er die Farm seiner Eltern erreichen. Das letzte Mal war er vor einem Monat zur Beerdigung seines älteren Bruders Scott hier gewesen. Cody seufzte und fuhr sich durch die Haare. Scott. Nie hätte er gedacht, dass der sich das Leben nehmen würde. Der Abschiedsbrief hatte nur aus ein paar Worten bestanden. Es tut mir leid. Cody wusste nicht, ob er Antworten auf das Warum finden wollte, obwohl diese Frage ihn wie ein Dorn unter der Haut quälte. Im Grunde hatte er das Gefühl, dass er diese Tat nie verstehen würde. Genauso wie er seinen Vater nicht verstand, der ihn nicht mal bei der Beerdigung hatte umarmen können. Lediglich Codys Hand hatte er geschüttelt, seine Augen voller Gram und Düsternis.
Cody schluckte, unerträglich waren die Gedanken an die Trauerfeier und an die Nachbarn, die meinten, er würde jetzt einfach Scotts Position als Verwalter der Farm und später als Erbe einnehmen. Das würde bedeuten zu bleiben, den Eltern helfen und die Milchfarm mit den hundertfünfzig Kühen bewirtschaften. Cody meinte jetzt noch, die unzähligen Hände zu spüren, die auf seinen Rücken klopften. Wie Hammerschläge, die ihn festnageln sollten. Er hatte es nicht abwarten können, die Farm wieder zu verlassen. Mit der Ausrede, er würde auf der Willow Ranch gebraucht, war er zusammen mit den letzten Trauergästen gegangen.
Und jetzt kehrte er zurück, denn sein Vater hatte sich das Bein gebrochen und seine Mutter hatte Cody angefleht, zu kommen.
Zum Glück hatte Lee, der Besitzer der Willow Ranch, ihm zwei Tage frei gegeben. Mehr bräuchte er nicht, hatte Cody ihm gesagt. Denn er wollte auf keinen Fall hierbleiben. Er würde Nachbarn bitten, auszuhelfen, bis sein Vater wieder einsatzfähig war. Als die Einfahrt der Farm in Sicht kam, strich er seine Haare zurück und setzte den Cowboyhut auf, der auf dem Beifahrersitz lag. Tippet-Dairyfarm est. 1906, stand auf dem großen Holzschild neben der Auffahrt. Die Farm war seit mehr als hundert Jahren im Familienbesitz und für Scott war immer klar gewesen, dass er den Betrieb einmal übernehmen würde. Doch jetzt war er tot. Was war geschehen? Was hatte ihn so aus der Bahn geworfen? Cody stoppte die Gedanken, als er sah, dass seine Mutter aus dem Haus kam. Sie musste seinen Dieseltruck gehört haben. Wahrscheinlich hatte sie vom Küchenfenster aus die Einfahrt beobachtet, seit er ihr vor einer Stunde mitgeteilt hatte, er würde jetzt von der Willow Ranch losfahren. Er parkte und stieg aus.
„Hi, Mom.“
„Hallo, mein Schatz.“ Sie schlang ihre Arme um ihn, was mehr ein Festklammern als eine Umarmung war. Ihr Geruch nach gebackenem Brot und Rosmarin umfing ihn. „Gott sei Dank, dass du hier bist.“
Seine Mutter war eine füllige, stets gutgelaunte Frau gewesen. Doch in ihren Augen und in ihrem schmal gewordenen Gesicht lag nun eine müde Traurigkeit, die er nur schwer ertrug.
„Wie geht es Dad?“ Mit seiner Tasche über der Schulter folgte er ihr ins Haus.
„Es war ein komplizierter Schienbeinbruch, aber er wird morgen entlassen. Strikte Ruhe, haben die Ärzte gesagt. Er hat für drei Wochen einen Liegegips und dann bekommt er einen Gehgips.“
Cody streifte in der Diele die Cowboyboots ab. „Ich kann zwei Tage bleiben“, sagte er und folgte seiner Mutter in die Küche. Er goss sich eine Tasse Kaffee aus der Thermoskanne ein, die auf dem Tisch stand.
„Aber dein Dad braucht dich jetzt hier. Du kannst doch sicher Urlaub nehmen. Dieser Lee Meyers scheint ein netter Boss zu sein und unter diesen Umständen wird er es sicher verstehen.“
„Das ist nicht möglich“, unterbrach er sie und rührte Kaffeesahne in seine Tasse. „Ich werde mit den Nachbarn sprechen. Vielleicht können die euch in der Zwischenzeit unter die Arme greifen. Ansonsten müsst ihr halt eine Hilfe einstellen.“
Seine Mutter stellte einen Teller mit Keksen auf den Tisch und setzte sich ihm gegenüber. „Wir können es uns nicht leisten, jemanden Vollzeit einzustellen.“
Cody hob eine Augenbraue. Er war immer davon ausgegangen, dass es der Farm finanziell gut ging. Zumindest hatte Scott in den sporadischen Telefongesprächen ihm gegenüber nie von Geldproblemen gesprochen, und mit seinem Vater hatte er schon viele Jahre lang kein Wort mehr über die Farmgeschäfte gewechselt. „Da wird sich sicher eine Lösung finden“, erwiderte er ausweichend.
Seine Mutter legte eine Hand auf die seine. „Schatz. Ich weiß, dass dein Vater und du nicht immer gleicher Meinung seid. Aber jetzt, wo Scott, ich meine, wo er nicht mehr …“ Ein Schluchzen verschluckte ihre Worte und sie wischte sich rasch einige Tränen aus den Augen.
„Ach, Mom. Du weißt, dass ich der Letzte bin, den Dad hier haben will. Außerdem verstehe ich nichts von Milchwirtschaft. Ich bin ein Cowboy, Pferde sind meine Welt.“
„Du bist hier aufgewachsen. Das hast du im Blut.“
Dad glaubt das nicht, dachte er, schwieg aber. Es hatte keinen Sinn zu versuchen, ihr zu erklären, dass ihn und seinen Vater mehr trennte als bloße Missverständnisse. Er musste jemanden finden, der seinen Eltern in der nächsten Zeit unter die Arme greifen konnte. Denn seinen Job auf der Willow Ranch würde er auf keinen Fall aufgeben.
Woodwind hatte seinen Kontrollgang beendet und schlenderte den schmalen Pfad zwischen den Tiergehegen entlang. Alle Schützlinge in der Wildtierstation waren versorgt. Mit Maja und den ehrenamtlichen Helfern hatte er ein tolles Team beisammen, das sich um die Tiere kümmerte. Er hörte ein Auto und sah auf. Brachte jemand ein neues Sorgenkind?
Der Indianer betrat das Hauptgebäude der Station durch die Hintertür, durchquerte die Fütterungsstation, die kleine Küche zum Stationseingang. Ein schwarzer Labrador rannte ihm von der Eingangstür her hechelnd und mit wild wedelndem Schwanz entgegen.
„Hi, Mister Mud, alter Racker. Wo hast du denn deine Besitzerin gelassen?“ Er streichelte den Hund und sah, wie sein Bruder Lonefeather Jones mit seiner Lebensgefährtin Lyla und einer ihm unbekannten Frau durch die Tür kam. Sie trug ein Kind auf dem Arm. Woodwind schätze sie auf Mitte vierzig.
„Hallo, großer Bruder. Stören wir?“, fragte Jones.
„Ach, überhaupt nicht. Ich wollte eh Pause machen. Habt ihr Zeit für einen Kaffee?“
„Ja, gern. Das sind übrigens meine Tante Ayita und ihr Sohn Wynono“, stellte Lyla ihre Begleitung vor.
„Hallo, schön, dich kennenzulernen“, sagte Ayita mit einer tiefen, samtigen Stimme und streckte ihm die Hand hin. Sie war warm, ein wenig rau, ihr Händedruck fest. Der Blick ihrer dunklen Augen strich über sein Gesicht, ähnlich den Fingern eines Blinden.
„Woodwind Jones“, brachte er hervor, blinzelte und wandte seine Aufmerksamkeit dem kleinen Jungen zu. Der spielte mit dem langen Zopf seiner Mutter und beäugte ihn misstrauisch.
„Hallo, Wynono, wie alt bist du denn?“, fragte er lächelnd.
„Er ist drei“, sagte Ayita schnell und ließ den quengelnden Jungen runter.
Wynono ergriff wie selbstverständlich das Halsband des Hundes, nachdem dieser auf ihn zugelaufen war. Zusammen machten sich die beiden an die Erkundung des Gebäudes. Mud, der die Station in- und auswendig kannte, schien dem Kleinen seine Lieblingsecken zeigen zu wollen. Woodwind schmunzelte. „Die zwei sind ja ein eingespieltes Team.“
„Wynono und Mud waren schon unzertrennlich, als ich letztes Jahr im Yukon war“, erklärte Lyla.
„Mein Kleiner hat seinen vierbeinigen Babysitter sehr vermisst. Die beiden verstehen sich ohne Worte.“
Ayita klang traurig und in Woodwind flackerte der Verdacht auf, Wynono könne stumm sein. Er kam ihm auch klein für sein Alter vor, aber was wusste er schon von Kindern – und außerdem ging es ihn nichts an. Jones trat neben Woodwind. „Lass uns mal Kaffee kochen.“ Er boxte ihn in die Seite.
„Und wir sammeln Wynono und Mud ein und setzen uns auf die Veranda. Der Mai hat eines seiner schönsten Kleider angezogen.“ Lyla lächelte und ging mit ihrer Tante davon.
In der kleinen Küche gab Woodwind einige Löffel Kaffee in den Filter, während Jones Tassen aus einem Hängeschrank holte.
„Wie geht es dir?“, fragte Jones.
„Blendend. Machst du dir Sorgen um mich, kleiner Bruder?“
Jones Blick hielt ihn fest, forderte eine Ehrlichkeit, die Woodwind nicht zu geben bereit war. „Du wirkst unzufrieden. Wann hast du das letzte Mal was Schönes unternommen? Oder deine Flöte gespielt?“
Er zuckte nur mit den Schultern und erinnerte sich an sein letztes Flötenspiel. Una hatte ihn um ein Lied gebeten, aber als er spielte, war ihm die Melodie leer und nichtssagend vorgekommen. Er verdrängte die Gedanken. „Die Wildtierstation hält mich auf Trab.“
„Und wie kommst du im Reservat zurecht?“, fragte Jones.
Er hob eine Augenbraue. „Wieso?“
„Ach, Chinook und ich haben den Eindruck, du fühlst dich dort nicht wohl.“
Woodwind goss Wasser in die Kaffeemaschine und schaltete sie ein. Dann lehnte er sich mit dem Rücken an die Anrichte und verschränkte die Arme vor der Brust. „Und wieso spricht der allwissende Schamane mit dir und nicht mit mir darüber?“
Jones zuckte mit den Schultern. „Chinook meinte, er bekomme dich kaum zu Gesicht, obwohl er dich mehrmals zu sich eingeladen hat. Und du nimmst nicht an den Zusammenkünften im Gemeinschaftshaus teil, oder?“
„Was soll ich da? Die meisten im Reservat sind eh nicht gut auf mich zu sprechen.“
Jones nahm die volle Kaffeekanne und füllte die vier Tassen. „Du hast ihnen aber auch in den letzten Monaten keine Gelegenheit gegeben, dich kennenzulernen.“
Woodwind holte ein Tablett, stellte Milch, Zucker und die vier Tassen darauf. Doch bevor er es anheben konnte, legte Jones eine Hand auf seinen Oberarm.
„Bruder, ich schreibe dir nicht vor, wie du dich zu verhalten hast. Aber wenn du weiterhin im Reservat bleiben willst, solltest du dich ein wenig mehr in die Gemeinschaft einbringen.“
„Vielleicht ist das Leben dort nichts für mich.“ Er sah Jones Miene an, dass er ihm diese Worte nicht abnahm. Zu Recht, denn Woodwind glaubte sie ja selbst nicht. Er nahm das Tablett. „Hab viel um die Ohren. Aber mal sehen, vielleicht habe ich diesen Sonntag Zeit, um zum Treffen zu gehen.“
Jones lächelte und nickte. „Mach das. Auch ein Grizzly braucht eine Gemeinschaft.“
„Ach, Bärenbruder, was du nicht alles zu wissen glaubst.“ Woodwind wandte sich um und ging nach draußen auf die Veranda. Jones folgte ihm mit dem Kaffee. Er reichte Ayita und Lyla, die auf Plastikstühlen saßen und plauderten, ihre Tassen. Wynono und Mud hatten es sich unter einem nahen Apfelbaum bequem gemacht. Der Junge rupfte immer wieder Gras aus und ließ es über den Hund rieseln. Der Labrador zuckte nur manchmal schläfrig mit einem Ohr.
„Lyla hat mir erzählt, dass du die Wildtierstation von ihr übernommen hast“, sagte Ayita. „Es muss schön sein, so eine wunderbare Aufgabe zu haben.“
„Ja, und ich bin sehr dankbar für ihr Vertrauen. Ich liebe die Arbeit mit den Tieren.“
„Und er macht das verdammt gut“, warf Lyla ein. „Außerdem bin ich froh, dass du das Kommando hier übernommen hast, Woodwind. Das gibt mir und Jones Zeit, unsere Pläne für den Laden zu verwirklichen.“ Sie schenkte ihrem Partner ein Lächeln.
„Ihr beide seid ein tolles Team.“ Woodwind nippte an seinem Kaffee. „Der Laden wird sicher ein Erfolg. Wirst du deine Kunstwerke auch verkaufen, Jones?“
„Nein, meine Traumfänger werde ich weiterhin nur auf Wunsch für Menschen herstellen, die Ängste und Sorgen nicht loswerden.“
„Eine gute Entscheidung, Bruder. Deine Magie ist heilig und kann nicht mit Dollars aufgewogen werden.“
„Wir werden neben meinen Zeichnungen auch indianische Kunst im Laden anbieten und dafür eine kleine Kommission nehmen. Das gibt unbekannten Künstlern unseres Volks die Gelegenheit, ihre Werke auszustellen.“
Woodwind sah die Vorfreude über diesen neuen Lebensabschnitt in Lylas Augen funkeln und er freute sich mit den beiden. Er wandte sich Ayita zu, die versonnen ihren Sohn beobachtete. Wynono hatte sich an den dösenden Hund gekuschelt und schien kurz davor zu sein, selbst einzuschlafen.
„Einen ruhigen Jungen hast du da. Ist er immer so zufrieden?“, fragte er und dachte an die krakeelenden Kleinkinder im Reservat, deren Mütter oder ältere Geschwister ihnen ständig hinterherlaufen mussten.
Ayita sah ihn einen Moment lang an. Dann seufzte sie. „Er hat die letzten Nächte im Blockhaus bei Lyla und Jones kaum geschlafen.“
„Wann seid ihr denn angekommen?“
„Vor einer Woche.“ Sie stellte ihre Tasse ab und stand auf. „Dürfte ich die Toilette benutzen?“
„Klar, die Tür gleich neben der Küche.“
Die Indianerin nickte und verschwand im Gebäude.
„Wie lange wird sie denn hierbleiben?“, fragte Woodwind.
Lyla zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, warum sie nach fünfundzwanzig Jahren auf einmal beschlossen hat, wieder hierher zu kommen.“
„Sie ist auf der Suche“, sagte Jones.
„Sind wir das nicht alle?“ Woodwind wich dem fragenden Blick seines Bruders aus und wandte sich wieder an Lyla. „Weißt du denn, warum sie damals in den Norden gezogen ist? Das Sunchild Reservat war doch ihr Zuhause.“
„Nein, sie will nicht darüber sprechen.“ Lyla sah kurz zu Wynono, der aufgestanden war. „Ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen um den Kleinen. Als ich ihn letztes Jahr kennengelernt habe, war er ein aufgewecktes Bürschchen. Seit er hier ist, hat er noch kein einziges Wort gesprochen.“
„Vielleicht liegt es wirklich nur an der langen Reise und der neuen Umgebung“, mutmaßte Woodwind.
„Schon möglich“, lenkte sie ein und räusperte sich. „Sag mal, könntest du dich ein wenig um Ayita und ihren Sohn kümmern? Ich will sie nicht abschieben. Aber Jones und ich haben alle Hände voll zu tun. Und das Blockhaus fühlt sich ein wenig klaustrophobisch an, wenn wir den ganzen Tag zu viert sind.“
„Aber sie wird doch sicher im Reservat wieder Kontakte knüpfen wollen, oder?“ Der Gedanke, Ayita und ihren Sohn öfter um sich zu haben, verunsicherte ihn auf unerklärliche Weise.
„Meine Tante glaubt nicht, dass sie im Reservat willkommen ist. Nur Chinook weiß, dass sie wieder hier ist.“
Woodwind wunderte sich nicht, dass der alte Schamane Bescheid wusste. Wahrscheinlich hatte er Ayitas Ankunft geahnt, bevor die Frau selbst die Entscheidung zu dieser Reise getroffen hatte. „Ich bin die meiste Zeit hier in der Station“, sagte er, „und ich weiß nicht, ob das hier ein guter Platz für ein Kleinkind ist.“
„Aber du wohnst im Reservat und kannst Ayita dabei unterstützen, sich dort wieder zuhause zu fühlen. Nimm sie doch am Sonntag mit zu dem Treffen.“
Woodwind warf seinem Bruder einen genervten Blick zu. „Ach, daher kam das Gelaber in der Küche?“
Jones hob die Hände. „Nein, Chinook und ich haben wirklich über dich geredet.“
Woodwind schnaubte. „Ich kann mich um mich selbst kümmern.“
In diesem Moment kam Ayita aus dem Gebäude und ging zu Wynono, der um den schlafenden Mud herum tapste. Sie streckte die Hand nach ihrem Sohn aus, aber der Junge schenkte ihr keine Beachtung. Die Indianerin drehte sich um. „Können wir uns ein wenig bei den Gehegen umschauen?“, fragte sie.
„Wir sollten los“, antwortete Lyla. „Aber vielleicht hat Woodwind in den nächsten Tagen Zeit, mit euch eine Tour zu machen.“ Sie zwinkerte ihm zu und er verzog seine Lippen zu einem schiefen Grinsen. Er hatte nicht vor, etwas zu versprechen.
„Mal sehen“, erwiderte er ausweichend und begleitete seinen Besuch zu Lylas Auto.
Rosie verabschiedete sich von den Stuten auf der Willow Ranch. In wenigen Tagen sollte das erste der sechs Pferde sein Fohlen auf die Welt bringen. Der andere Nachwuchs würde innerhalb der nächsten vier Wochen geboren werden. Sie hatte die Pflege der Stuten im letzten Frühjahr übernommen. Vorher hatte Lees Schwester Lyla die Pferde betreut. Rosie liebte ihren Job, auch wenn sie wusste, dass sie ihn nicht ewig machen wollte. Der Wortwechsel mit ihrer Mutter bei ihrem letzten Telefonat hatte sich in ihren Gedanken festgesetzt.
„Kind, du musst einen Plan haben. Ins Blaue hinein zu leben, macht doch nicht glücklich. Schau deine Brüder an, sie haben ihre Träume verwirklicht, Karriere gemacht und Familien gegründet.“
„Mom, ich will aber keine Karriere machen. Und mit der Familiengründung kann ich mir auch noch Zeit lassen. Außerdem hat Jim …“
„… Jim hat seit vielen Jahren einen Partner“, unterbrach sie ihre Mutter. „Ich weiß, du trauerst diesem Hallodri Calvin nach, aber der ist Schnee von gestern. Mach einen neuen Plan, halt daran fest und verwirkliche ihn. Und dann such dir einen Mann.“
Rosie hatte gar nicht erst versucht, ihrer Mutter zu sagen, dass sie Calvin Dunn keineswegs nachweinte. Aber sie kam sich ohne einen festen Zukunftsplan tatsächlich verloren vor. Hatte sie denn keinen Ehrgeiz mehr? Was wollte sie in ihrem Leben erreichen? Nachdenklich riegelte sie das Tor des Offenstalls ab. Auf dem Hof kamen ihr Lee und Naira, die Besitzer der Willow Ranch, händchenhaltend entgegen.
„Macht ihr einen Spaziergang?“, fragte Rosie.
„Ja, es ist so ein schöner Abend. Vielleicht haben wir Glück und der Winter liegt hinter uns“, erwiderte Naira.
Lee nickte. „So einen warmen Mai hatten wir schon lange nicht mehr. Wie geht es den werdenden Müttern?“
„Alle fit und rund.“ Rosie lächelte. „Sie sind versorgt und ich wollte gerade nach Hause fahren.“
„Mach das, wir sehen uns morgen früh.“ Lee nickte ihr zu.
„Genieß den Feierabend“, ergänzte Naira und die beiden spazierten in Richtung der Weiden davon.
Rosie sah ihnen nach. Ein glückliches Paar! Dabei wusste sie, dass es im letzten Jahr in der Beziehung reichlich gepoltert hatte. Aber Lee und Nairas Verbundenheit und Liebe waren stark genug gewesen, um sie wieder zusammen zu bringen. Zwar wohnte Naira noch in ihrem Bungalow, aber Rosie war überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie auf die Willow Ranch zog. Mit dem Programm für die indianischen Jugendlichen und dem kleinen Bed & Breakfast-Betrieb, den sie erhalten wollten, hatten Lee und Naira jetzt gemeinsame Ziele auf der Ranch, und Rosie beneidete die beiden um ihren Zusammenhalt. Wie es sich wohl anfühlte, einen Partner zu haben, der einen unterstützte? Hazel kam zu ihr und stupste sie mit der Schnauze an. Rosie lächelte und streichelte ihr über den Kopf. „Hast ja recht, Hazel Mae, wir halten zusammen. Auf dich kann ich mich immer verlassen.“
Als sie zwanzig Minuten später in ihre Einfahrt einbog, wunderte sie sich über den Truck, der vor ihrer Hütte parkte. Auch Hazel hatte sich aufgesetzt und knurrte leise. „Na, Mädchen, wer besucht uns denn da?“
Die Fahrertür öffnete sich und ein Mann stieg aus. Doug? Sie stellte ihr Auto vor der kleinen Veranda ab. Das letzte Mal hatte sie ihn vor über einem Jahr gesehen. Er hatte ihr geholfen, Weihnachtsbeleuchtung rund um Erics Hütte anzubringen, und war dann zu einem Feuerwehreinsatz, als sogenannter Smoke-Jumper, nach Australien verschwunden. Sie stieg aus und erwiderte sein breites Lächeln.
„Hey, Girl, wie geht’s?“
„Hallo, Doug. Das ist ja eine Überraschung. Warst du so lange in Australien?“
Er fuhr sich durch seine zerzausten sandfarbenen Haare. „Nein, da war meine Truppe nur vier Wochen. Danach ging es nach Kalifornien und auf weitere Einsätze. Einfach dahin, wo immer wir als fallschirmspringende Feuerwehrtruppe in unzugänglichen Zonen eben gebraucht werden. Jetzt bin ich aber erstmal wieder eine Weile Zuhause, und da wir keine Handynummern ausgetauscht haben, dachte ich, ich schau einfach mal vorbei. Ist doch okay, oder?“
Sein schelmisches Grinsen ließ Rosie schmunzeln und sie nickte. „Klar, kein Problem. Willst du auf ein Bier reinkommen?“
„Gern.“ Er folgte ihr in die Hütte und sah sich um. „Wohnst du jetzt allein hier?“
Sie holte zwei Bierflaschen aus dem Kühlschrank und reichte ihm eine. „Ja, wie hast du das so schnell erraten?“
„So wie du mir damals von deinem Onkel erzählt hast, wäre er kaum mit dem bunten Flickenteppich, den Duftkerzen und diesem, ähm, Lampenschirm einverstanden gewesen.“ Er trat zu der riesigen Deckenlampe mit dem Papierschirm, die über dem Couchtisch hing. Das Papier war mit Pferden bedruckt und Rosie sah in seinem Gesicht, dass er diese Dekoration kitschig fand.
„Mir gefällt’s“, sagte sie leichthin und setzte sich auf einen kleinen Sessel.
Doug nahm auf der Couch Platz.
Rosie trank einen großen Schluck Bier. „Wie lange bleibst du diesmal zuhause?“
„Momentan stehen keine neuen Einsätze an. Arbeitest du noch auf der Willow Ranch?“
Sie nickte und Doug erzählte von seinen gefährlichen Einsätzen und der Faszination, Feuer zu bekämpfen. Manches klang wie aus einem Hollywoodfilm und Rosie ahnte, dass er ein paar Mal mit seinen Beschreibungen übertrieb. Aber er hatte eine angenehme, warme Stimme und sie staunte, wie viele Länder er durch seine Arbeit als Smoke-Jumper bereist hatte. Auf einmal knurrte ihr Magen so laut, dass er in seinen Ausführungen innehielt.
„Entschuldige.“ Sie lächelte verlegen und legte eine Hand auf ihren Bauch.
„Schon okay, ich habe dich ja direkt nach deiner Arbeit überfallen. Muss jetzt eh los. Hast du am Wochenende etwas vor?“
„Ich will die Veranda streichen, wenn das Wetter mitmacht.“
Doug stellte seine Bierflasche auf den Couchtisch und stand auf. „Okay, wenn es dir recht ist, schaue ich dann wieder vorbei.“
Rosie erhob sich ebenfalls und ging mit ihm zur Haustür. „Klar. Ich habe auch einen zweiten Pinsel.“
„Na, dann sehen wir uns bald wieder.“ Er grinste, trat einen Schritt näher und zog sie in eine Umarmung.
Sie reichte ihm gerade mal an die Brust, aber ihr gefiel das Gefühl der Sicherheit, das sie in seinen Armen empfand und sie schmiegte sich kurz an ihn. Er drückte ihr einen Kuss auf die Wange. „Gute Nacht, Rosie.“
„Danke für deinen Besuch“, erwiderte sie und schloss die Tür hinter ihm.
Die nächsten Tage vergingen wie im Flug. Das erste Fohlen kam auf der Willow Ranch zur Welt und Rosie verbrachte zwei Nächte bei den Stuten. Während der Zeit rund um die Geburten der Fohlen war sie öfter an ihrem Arbeitsplatz als zuhause. Da die nächste Geburt noch einige Tage auf sich warten lassen würde, hatte Lee ihr das Wochenende freigegeben. „Wenn es Probleme gibt, rufe ich dich an. Jetzt mach dir zwei schöne Tage. Ich weiß doch, dass du mitten in Renovierungen steckst“, hatte er gesagt und sie aus den Stallungen gescheucht.
Da es die Außentemperatur erlaubte, hatte Rosie an diesem Samstag mit den Malerarbeiten auf der Veranda begonnen. Immer wieder ertappte sie sich dabei, auf Motorgeräusche zu lauschen und zu hoffen, Dougs Truck zu erspähen. „Du bist doof“, schalt sie sich und war doch enttäuscht, als er am späten Nachmittag noch nicht aufgetaucht war.
Seufzend packte sie den Pinsel in Klarsichtfolie, wusch sich die Hände und fuhr ins Dorf. Jim würde morgen vorbeikommen und sie hatte versprochen, zum Abendessen zu grillen. An der Fleischtheke entschloss sie sich, drei Steaks zu kaufen. Vielleicht würde Doug ja am Sonntag kommen und dann wollte sie genug zu essen im Haus haben.
Jim kam am späten Sonntagvormittag mit einer weiteren Ladung Holz. Und er überraschte Rosie mit einer Hundehütte für Hazel.
„Im Sommer kann dein Couchhund ruhig auch mal draußen schlafen“, sagte er und strich dem Bloodhound über den Kopf. „Wenn sie schon nicht wie alle anderen Exemplare ihrer Rasse angebunden sein muss, kann sie wenigstens die Coyoten und Bären von der Hütte fernhalten.“
Rosie lachte und bedankte sich. Sie hatte Hazel vor einigen Jahren aus einer Tierfalle gerettet. Die Arme war halb verhungert gewesen und wich seither nicht von Rosies Seite. Bloodhounds waren dafür bekannt, dass sie ohne Leine oder eingezäuntes Areal ihrem stark ausgeprägten Geruchssinn nicht widerstehen konnten und davonliefen. Nicht so Hazel Mae.
„Na, dann lass uns mal loslegen.“ Rosie zog Arbeitshandschuhe an und sie luden das Holz vom Truck. Danach tauschten sie einige morsche Bretter am Geräteschuppen aus. Später hämmerte Jim am Holzsockel für die Hundehütte und Rosie strich die Veranda.
Nach zwei Stunden zog sie die Handschuhe aus und wischte den Schweiß von der Stirn. Die Sonne bescherte ihnen einen dieser noch seltenen warmen Tage. „Ich hole uns mal was zu trinken. Bier oder Wasser?“, fragte Rosie.
„Wasser wäre super.“ Jim streckte den Rücken.
Kaum hatte sie zwei Wasserflaschen gefüllt, klingelte ihr Smartphone. Auf dem Display sah sie, dass es ihr Ex-Freund Calvin Dunn war. Was wollte der denn von ihr?
„Hallo“, meldete sie sich.
„Hey, Rose, wie geht’s dir?“
Sie ärgerte sich, dass er sie bei dem Kosenamen nannte, den er immer für sie verwendet hatte, als sie noch zusammen gewesen waren.
„Alles bestens. Warum rufst du an?“
„Vielleicht will ich ja nur wissen, ob es dir gut geht.“
Sie rollte mit den Augen, irritiert über das warme Gefühl, das seine vertraute Stimme in ihr auslöste. Sie waren vier Jahre zusammen gewesen. Rosie hatte geglaubt, er sei ihre große Liebe, bis vor anderthalb Jahren alles wie ein Kartenhaus zusammengefallen war und sie ohne Freund, Job und ein Zuhause dagestanden war. Rasch schob sie diese Gedanken beiseite. „Ich bin dabei, meine Veranda zu streichen. Was willst du?“
„Ich brauche eine Unterkunft für Lori. Du erinnerst dich doch an die Paintstute?“
Rosie lächelte. „Ja, natürlich.“ Lori war ihre Lieblingsstute gewesen, als sie zusammen mit Calvin im Reitstall seines Vaters gelebt und gearbeitet hatte.
Bevor sie nachfragen konnte, fuhr er fort. „Ich habe sie von Dragon besamen lassen. Also, den Hengst kennst du sicher nicht.“ Calvin lachte kurz. „Spielt keine Rolle. Ich …“
„Du hast Lori noch einmal decken lassen? Sie ist doch schon sechzehn“, unterbrach sie ihn.
„Sie ist voll fit und es wird ihr letztes Fohlen sein.“
„Wieso kann sie nicht im Reitstall bleiben? Dort ist doch genug Platz.“
„Ähm, ach, Dad will alle Boxen an Kunden vermieten, die ihre Pferde einstellen wollen. Reitschüler und Ausbildungspferde bringen mehr Geld als die Zucht, sagt er. Außerdem ist im Reitstall ein ständiges Kommen und Gehen, jetzt, wo er vergrößert hat. Lori braucht aber ein ruhiges Plätzchen zum Abfohlen.“
Und da kommst du auf mich, fragte sich Rosie, die sich keinen Reim auf Calvins Anruf machen konnte. „Ich kann mich ja mal umhören“, sagte sie ausweichend.
„Wohnst du denn nicht mehr bei deinem Onkel? Der hat doch einen kleinen Stall und eine Weide, wenn ich mich recht erinnere.“
„Schon, aber …“ Sie hatte ganz vergessen, dass sie und Calvin Onkel Eric in seiner Blockhütte ein paar Mal besucht hatten.
„Nachdem das Fohlen abgesetzt werden kann, würde ich dir Lori überlassen. Ich weiß doch, wie gern du die Stute hast.“
Die Tür der Hütte ging auf und Jim kam herein. „Ich bin echt am Verdursten“, sagte er. „Was machst du denn so lange?“
Sie zeigte auf ihr Smartphone am Ohr und wandte sich wieder dem Gespräch zu. „Ähm, okay. Ich werde es mir überlegen.“
„Ich müsste innerhalb der nächsten Woche Bescheid wissen“, sagte Calvin und sie verabschiedeten sich.
Jim stand an der Spüle und trank aus der Wasserflasche. „Wer war das denn?“, fragte er.
Rosie druckste herum. Jim war nicht gut auf ihren Ex zu sprechen. Das hatte zum einen damit zu tun, dass Calvin sie schlecht behandelt und betrogen hatte. Zum anderen hatte ihr Ex sich kurz vor dem Ende der Beziehung abfällig über Homosexuelle geäußert.
„Ach, nur ein alter Freund, der mich um einen Gefallen gebeten hat“, sagte sie hastig.
Jim sah sie misstrauisch an. „Ein alter Freund, eh?“
„Ja“, murmelte sie, nahm die andere Wasserflasche und ging wieder nach draußen auf die Veranda. Jim stellte sich neben sie.
„Meinst du, am Stall müsste viel repariert werden?“, fragte sie.
„Wieso? Willst du dir ein Pferd zulegen?“
„Vielleicht.“
Ein Motorengeräusch erklang und ein grüner Truck näherte sich der Hütte.
„Erwartest du Besuch?“
„Ähm, das ist Doug Fry. Wir kennen uns von, äh, also …“ Sie ärgerte sich über das Gefühl, sich vor ihrem Bruder rechtfertigen zu müssen. „Ich habe ihn letztes Jahr kennengelernt“, sagte sie und ging auf Doug zu, der aus seinem Truck ausstieg.
Er umarmte sie kurz und sah zu Jim. „Wie ich sehe, hast du dir anderweitig Hilfe besorgt.“
Sie stutzte über den beleidigten Ton in seiner Stimme. „Das ist mein Bruder Jim. Er hilft mir bei der Renovierung.“
Doug lächelte, legte einen Arm um ihre Schultern und zog sie an sich. „Ach so. Kein Problem. Sorry, dass ich gestern nicht gekommen bin. Musste einem Kumpel helfen.“
„Schon okay“, erwiderte sie und schluckte die Enttäuschung darüber, dass er jetzt erst hier auftauchte, hinunter. Doug hatte ihr seine Hilfe ja nicht versprochen. „Willst du zum Abendessen bleiben?“
„Klar, gern“, erwiderte er grinsend.
Sie stellte ihn Jim vor und machte sich an die Vorbereitungen zum Grillen. Aus dem Küchenfenster beobachtete sie, wie sich die beiden unterhielten. An Jims Gesicht konnte sie ablesen, dass er nicht wusste, wie er diesen Kerl einschätzen sollte, der da mit modisch zerrissenen Jeans, Sneakers und einer Basecap vor ihm stand. Typisch Jim. Kein Mann war gut genug für seine kleine Schwester. Jim hatte immer ein Auge auf sie gehabt. Aber auch ihre anderen Brüder hatten sie beschützt und gleichzeitig dafür gesorgt, dass sie vom Reifenwechsel, dem Reparieren verschiedenster Dinge im Haus und Maschinen etwas verstand.
„Auch wenn du ein Mädchen bist, solltest du trotzdem vieles selbst machen können“, hatte Jim gesagt und dann sofort hinzugefügt: „Werde aber bloß keine alte Jungfer. So ein hübsches Girl wie du braucht einen Mann an seiner Seite, um es vor all den Dreckskerlen zu beschützen.“
Als Rosie sechzehn geworden war, hatten ihre Brüder versucht, sie mit Kerlen zu verkuppeln, die sie für okay hielten. Das war meistens schrecklich in die Hose gegangen. Und dann hatte Rosie ein Jahr später Calvin kennengelernt. Er hatte ihr am Anfang die Welt zu Füßen gelegt. Und sie hatte für ihn, zum Ärger ihrer Eltern, den Plan, Grundschullehrerin zu werden, verworfen und war zu ihm gezogen. Das Ende war bitter gewesen und sie hatte einige Zeit gebraucht, um sich aus der Trauer zu kämpfen. Geblieben war ihre Liebe zu Pferden und sie war überglücklich, als Onkel Eric ihr den Job auf der Willow Ranch vorgeschlagen hatte.
„Der Barbecue-Grill wäre bereit für die Steaks“, rief Jim und unterbrach ihre Gedanken.
„Ich bringe das Fleisch gleich raus“, antwortete Rosie.
Eine halbe Stunde später saßen sie am Tisch und aßen. Doug warf ihr immer wieder Blicke zu, die sie mit einem Lächeln erwiderte.
„Ich werde jetzt eine Weile nicht mehr helfen können“, sagte Jim. „Die Sägemühle hat einen riesen Auftrag bekommen und ich muss die Wochenenden durcharbeiten.“
„Schon gut. Alles weitere kriege ich allein hin.“
„Wieso allein?“, warf Doug ein. „Jetzt bin ich doch da. Ich bin zwar kein Farmboy, aber die Muskeln für die Arbeit habe ich ja.“ Er zwinkerte ihr zu.
Rosie sah, wie Jim ihm einen kritischen Blick zuwarf. „Schau nicht so, Bruderherz. Du kennst mich doch, ich weiß mir gut selbst zu helfen.“
Jim verdrehte die Augen. Bevor er mehr sagen konnte, stand sie auf und räumte das Geschirr ab. „Es sind ja nur noch Kleinigkeiten zu erledigen“, sagte sie. „Für anderes habe ich im Moment kein Geld.“
„Dann willst du den Stall also nicht renovieren?“, fragte Jim.
Rosie stellte die Teller in die Spüle. „Ich habe mich noch nicht entschieden“, gab sie zu. „So viel ist hoffentlich nicht daran zu tun.“ Ihr Smartphone piepste, doch bevor sie es ergreifen konnte, hatte es Doug schon in der Hand.
„Eine Textnachricht von Calvin. Wer ist das denn?“, fragte er und starrte auf das Display.
„Rosies idiotischer Ex“, antwortet Jim. „Mit dem sie hoffentlich nichts mehr zu tun hat. War er der alte Freund von vorhin?“
„Das ist meine Sache.“ Sie nahm ihr Smartphone an sich und verschränkte die Arme vor der Brust.
„Wieso hat er angerufen?“, drängte Jim.
„Er sucht einen Platz für Lori. Sie ist trächtig.“
„Will Calvin sie verkaufen?“
„Nein, ich, also“, druckste Rosie herum, „ich muss selbst erst darüber nachdenken. Reg dich ab.“
Jim stand nun ebenfalls auf. „Ich hoffe, du lässt die Finger davon. Ich muss los. Danke fürs Abendessen.“
Er umarmte sie und schüttelte Doug die Hand. „Nett, dich kennengelernt zu haben. Vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder.“
„Aber sicher doch. Und mach dir keinen Kopf, ich passe ja jetzt auf deine Schwester auf.“
„Wenn du dir da mal nicht die Finger verbrennst“, erwiderte Jim und verließ das Haus.
Doug trat zu Rosie und versuchte, sie in den Arm nehmen.
Sie wehrte ihn ab. „Ich brauche keinen Mann, der auf mich aufpasst“, zischte sie.
Er hob beschwichtigend die Hände. „Boa, ganz ruhig. Ich habe es nicht so gemeint. Wollte doch nur deinen überfürsorglichen Bruder beruhigen.“
„Schon gut“, lenkte sie ein. „Jim will nur, dass ich glücklich bin.“
„Siehst du, genau das möchte ich auch.“ Doug streckte eine Hand aus. Rosie ergriff sie und ließ sich in eine Umarmung ziehen.
Cody sattelte Jazz, seinen Palomino-Wallach, den er vor einem Jahr mit auf die Willow Ranch gebracht hatte. Lee hatte ihn gebeten, die Zäune der westlichen Weiden zu kontrollieren. Im letzten Sommer war Cody für die Packpferde zuständig gewesen, die das Gepäck der Ranchgäste in die Berge getragen hatten. In diesem Jahr hatten Lee und Naira das Konzept der Ranch geändert. Sie würden zwar immer noch Übernachtungsgäste beherbergen, die die ländliche Umgebung genießen wollten. Aber ihr Schwerpunkt lag auf indianischen Jugendgruppen, die auf der Willow Ranch untergebracht und ihrer Tradition näher gebracht werden würden. Ihm war es einerlei. Er würde weiter für die Pferde zuständig sein und den geplanten Trip in die Berge im Sommer mit den Packpferden begleiten.
Er stieg auf und ritt auf Jazz zu einem Gatter. Ohne Mühe öffnete er es vom Pferderücken aus und schlug die Richtung zur Westweide ein. Er liebte es, im Sattel zu sitzen. Mit Menschen hatte er oftmals Probleme und wusste nicht, worüber er reden sollte. Aber in der Gesellschaft der Pferde fühlte er sich wohl, sie verstand er ohne Worte.
Jazz fiel in einen Galopp und Cody ließ ihn gewähren, bis sie den Zaun erreichten. Er parierte in den Schritt und ritt am Stacheldraht entlang, um nach schadhaften Stellen zu suchen. Ein Klingeln ließ ihn zusammenzucken. „Scheißding“, fluchte er und zog das Smartphone aus der Innentasche seiner Jacke. „Hallo, Cody Tippet hier.“
„Hi, hier ist Mom. Störe ich?“
„Schon gut. Ist was passiert?“
„Mr. McKnight meinte, er hätte ab nächster Woche genug in seinem eigenen Betrieb zu tun. Er kann uns nicht mehr beim Melken und den anderen Stallarbeiten zur Hand gehen.“
„Hast du bei den Vandermeers nachgefragt? Sie meinten, sie könnten eventuell einen ihrer Helfer ausleihen? Kurt kennt den Betrieb doch schon, er würde sicher gerne aushelfen.“
„Habe ich. Aber sie wollen, dass wir seinen vollen Lohn übernehmen.“
„Ja, und?“
„Das können wir uns nicht leisten.“
Cody zog kurz am Zügel und brachte Jazz zum Stehen.
„Schatz, bist du noch dran?“
„Ja. Hör zu, Mom. Ich versuche, mir nochmal frei zu nehmen und eine Lösung zu finden, okay?“
„Kommst du dann am Sonntag?“
„Ich muss erst mit Lee sprechen und melde mich wieder.“ Er legte auf, atmete tief durch. Verdammter Mist. Er hasste es, schon wieder um ein paar freie Tage zu bitten.
Um auf andere Gedanken zu kommen, stürzte er sich nach dem Ausritt in die Arbeit auf der Ranch. Am späten Nachmittag taten ihm die Arme vom Ausmisten und Kehren des gesamten Stalls weh und er war am Verhungern. Im Kühlschrank seines Wohntrailers standen ein Joghurt, Essiggurken und zwei Dosen Cola. Na, toll. Zum Kochen hatte er keine Lust, daher beschloss er, nach dem Duschen ins Dorf zu Mary’s Diner zu fahren.
Die Glocken über der Eingangstür bimmelten, als er eine Stunde später das kleine Restaurant betrat. Es waren nur zwei Tische besetzt. Das Diner machte am meisten Umsatz während der Mittagszeit und hatte daher abends nur bis halb sieben geöffnet. An der Theke sah er eine bekannte Gestalt auf einem der Barhocker sitzen. Er ging auf den jungen Indianer zu und legte ihm eine Hand auf den Rücken.
„Hey, Rabbit, wie geht’s?“
Der Mann zuckte zusammen und wandte den Kopf. „Musst du mich so erschrecken?“
„Sorry, ich wusste nicht, dass du so in Gedanken versunken warst. Gibt’s Probleme?“
Mary kam zu den beiden und sah Cody an. „Was kann ich dir bringen?“
„Das Tagesgericht und ein Glas Wasser.“
Sie nickte. „Willst du noch etwas bestellen, Ray?“
„Nur einen weiteren Kaffee.“
„Kommt sofort.“ Die Dinerbesitzerin hob die Karaffe in ihrer Hand, füllte eines der Gläser auf dem Tisch mit Wasser, wandte sich ab und verschwand durch die Schwingtür in die Küche.
„Wirst du eigentlich lieber Ray oder Rabbit genannt?“, fragte Cody.
„Das kommt darauf an, wer mich anspricht. Meinen indianischen Namen kennen viele Leute nicht, und das ist okay so. Offiziell heiße ich nun mal Ray Bull.“
Cody nippte an seinem Wasser. Er erinnerte sich an die erste Begegnung mit dem Indianer, der nur ein paar Jahre jünger war als er. Als er letzten Sommer eine Reittour mit einer Gruppe von der Willow Ranch in die Berge begleitet hatte, war er Rabbit begegnet. Der junge Mann war zusammen mit einem Freund auf einer Wanderung gewesen.
Mary brachte sein Essen und Cody biss in das gegrillte Käse-Schinken Sandwich. Aus den Augenwinkeln beobachtete er, wie Rabbit mit verschlossener Miene am schwarzen Kaffee nippte. Anfangs hatte es Cody unpassend gefunden, dass sein Kumpel „Hase“ genannt wurde. Mit seiner drahtigen, fast hageren Statur erinnerte der Indianer ihn eher an ein junges Wildpferd nach einem harten Winter. Aber als aus der ersten Begegnung eine lockere Freundschaft wurde, verstand Cody, warum Rabbit diesen Namen trug. Seine Stimme war sanft, das Auftreten zunächst zurückhaltend. Und die großen dunkelbraunen Augen, umrahmt von tiefschwarzen Wimpern, strahlten immer eine gewisse Wachsamkeit aus. Nachdem Cody den letzten Bissen in den Mund geschoben hatte, wandte er sich seinem schweigenden Freund zu. „Jetzt spuck schon aus, was dir auf Seele liegt.“
„Mein Bruder Nuka ist zurück.“
„Ist er von der Pflegefamilie abgehauen?“
„Nein. Nachdem er mit ein paar Kumpels kleinere Diebstähle begangen hat und beim Sprayen erwischt worden ist, haben sie ihn quasi auf die Straße gesetzt.“
Cody nahm einen Schluck Wasser. „Dürfen die das denn? Nuka ist doch erst vierzehn.“
Rabbit zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung. Soviel ich weiß, wäre er in einem Heim gelandet, wenn ihn mein Vater nicht aufgenommen hätte.“
Jeremy Bull hatte vor fünf Jahren nach dem Tod seiner Frau den neunjährigen Nuka in eine Pflegefamilie gegeben. Rabbit, damals sechzehn, war im Reservat bei einem Vater geblieben, der Liebe mit Strenge gleichsetzte.
„Wie kommen Nuka und dein Dad klar?“
Rabbit stöhnte und schüttelte den Kopf. „Ein Streit nach dem anderen. Ich wollte schon wieder bei meinem Vater einziehen, um ein Auge auf Nuka zu haben. Aber der will nichts mit mir zu tun haben. Nimmt es mir übel, dass er damals abgeschoben wurde und ich bleiben durfte.“
„Scheiß Situation“, murmelte Cody.
„Das kannst du laut sagen. Zumindest wird unsere ältere Schwester wieder zu Hause einziehen. Ich glaube, Una kann an Nuka rankommen. Sie ist elf Jahre älter als er und hat die Geduld von Mom geerbt.“ Er nahm den letzten Schluck Kaffee und schob die Tasse von sich. „Ich fürchte, wenn keiner sich um meinen kleinen Bruder kümmert, wird er früher oder später etwas Dummes anstellen.“
Mary räumte das Geschirr ab. Cody bezahlte sein Essen und Rabbits Kaffee. „Rede doch mal mit meinem Boss Lee“, schlug er vor. „Vielleicht hat er eine Idee, wie er Nuka und dir helfen kann. Auf der Willow Ranch finden diesen Sommer die Camps für indianische Jugendliche statt.“
„Mein Dad würde ausrasten, wenn ich mit unseren Familienproblemen hausieren ginge.“
„Aber darum geht es doch nicht“, sagte Cody, sah jedoch an Rabbits zusammengekniffenen Lippen, dass er so nicht weiter kam. „Dann sprich wenigstens mit Woodwind. Er weiß vielleicht Rat.“
„Ich habe schon überlegt, mit einem der Elder zu sprechen, aber die meisten würden sofort zu meinem Vater rennen.“
„Sind die Elder eigentlich immer die ältesten Mitglieder des Rats?“, fragte Cody, der nicht allzu viel von den gesellschaftlichen Regeln im Reservat wusste.
„Nicht unbedingt. Niemand wird allein aufgrund seines Alters als Elder bezeichnet. Hier spielen seine reichen Erfahrungen, sein Wissen, seine Weisheit und seine bisherigen Taten zum Wohl der Gemeinschaft die entscheidende Rolle. Ein Elder hat sich den Respekt und die Wertschätzung der Gemeinde verdient.“
„Und wie ist das mit Schamanen? Gehören die automatisch zu den Elder?“
„Im Grunde schon. Wusstest du, dass der Begriff Schamane seine Wurzeln im Sanskrit und chinesischem Buddhismus hat? Heutzutage wird es mit der indianischen Spiritualität gleichgesetzt, dabei ist es nicht dasselbe.“
„Das war mir wirklich nicht bewusst.“ Cody staunte über das Wissen des jungen Indianers.
„In eurer Sprache gibt es keine eindeutige Bezeichnung für unsere Wicasa Wakan. Aber ehrlich gesagt, verwenden wir auch das Wort Schamanen oder Medizinmänner beziehungsweise Medizinfrauen.“ Er hob eine Hand und winkte ab. „Entschuldige, ich schweife ab. Also sagen wir mal so: Ein Elder ist nicht gleichzusetzen mit einem spirituellen Führer. Diese Rolle obliegt den Schamanen, unseren heiligen Männern oder Frauen. Elder, jung oder alt, teilen ihr Wissen als Lehrer, Berater oder Zeremonienmeister.“
„Wieder was gelernt“, sagte Cody und war seinem Kumpel dankbar, dass er sich nie über seine Unwissenheit lustig machte, sondern immer bereitwillig erklärte.
„Tja, mein Dad wird wohl nie den Titel Elder bekommen, auch wenn er hundert Jahre alt wird.“ Rabbit verzog seinen Mund zu einem schiefen Lächeln. „Ich habe keine Ahnung, wie er es erreichen will, zum Chief gewählt zu werden.“
„Schließt das eine das andere denn aus?“
Rabbit stand auf. „Nicht unbedingt. Mein Vater hat immer schon seine eigenen Mittel gehabt, seinen Willen durchzusetzen.“
„Der Chief ist so etwas wie der Bürgermeister eines Reservats, richtig?“
Rabbit nickte. „Der Chief ist der weltliche, also der politische Leiter eines Reservats. Er vertritt, zusammen mit dem Rat, der ihn wählt, die Belange unseres Volkes. Meinetwegen kann mein Dad machen, was er will. Mir ist Nuka wichtiger.“ Er zog seine Jacke an, hielt dann jedoch inne. „Sorry, jetzt habe ich gar nicht gefragt, wie es dir geht. Wir haben uns ja seit der Beerdigung deines Bruders nicht mehr gesehen.“
„Der Alltag hat mich wieder“, sagte Cody. Sein Kumpel hatte genug am Hals, da wollte er ihn nicht mit dem Ärger mit seinem eigenen Vater belasten.
„Also, alles heile in deiner Cowboy-Welt?“
„Yup, bestens.“
Zusammen verließen sie das Diner. Auf dem Gehweg verabschiedeten sie sich mit einem Handschlag und einer kurzen Umarmung.
„Mach’s gut, Cowboy. Wir sehen uns.“
„Nächstes Mal vielleicht auf ein Bier und eine Runde Billard“, erwiderte Cody. „Und sprich mit Woodwind.“
Rabbit warf mit einer fließenden Bewegung seine zum Zopf geflochtenen Haare auf den Rücken, nickte ihm zu und trabte über die Straße zu einem verrosteten Auto. Cody ging zu seinem Truck und machte sich auf den Rückweg zur Willow Ranch.