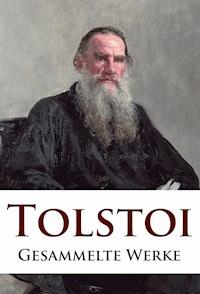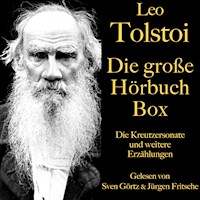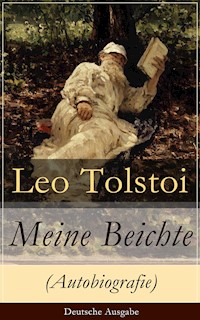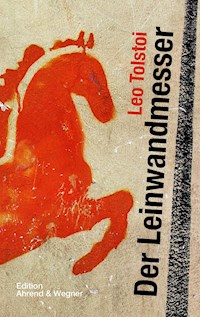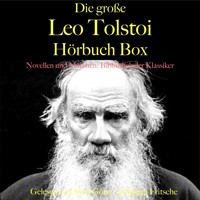Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ich hatte keine Lust, umzukehren; doch auch die Aussicht, die ganze Nacht bei Frost und Schneesturm in diesem Teil des Donkosakenlandes, einer völlig nackten Steppe, umherzuirren, schien mir wenig verlockend. Außerdem gefiel mir mein Kutscher nicht recht, obwohl ich ihn im Finstern nicht genau sehen konnte, und ich hatte zu ihm kein Vertrauen ... Diese Sammlung umfasst Meistererzählungen des großen russischen Dichters.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Schneesturm
und andere Erzählungen
idb
Wieviel Erde braucht der Mensch?
Übertragen von Alexander Eliasberg
1
Die ältere Schwester aus der Stadt besuchte ihre jüngere Schwester auf dem Dorfe. Die ältere war mit einem Kaufmann in der Stadt verheiratet und die jüngere mit einem Bauern im Dorfe. Die Schwestern tranken Tee und unterhielten sich. Die ältere Schwester begann zu prahlen und ihr Leben in der Stadt zu rühmen: wie geräumig und wie reinlich sie in der Stadt wohne, wie schön sie sich kleide und ihre Kinder putze, wie gut sie esse und trinke, und wie sie Spazierfahrten und Vergnügungen mitmache und Theatervorstellungen besuche.
Die jüngere Schwester fühlte sich dadurch verletzt, und sie begann das Kaufmannsleben herabzusetzen und ihr eigenes Bauernleben zu rühmen.
»Ich würde um nichts in der Welt«, so sagte sie, »mein Leben mit dem deinigen vertauschen. Es ist wahr, daß wir nicht besonders schön wohnen, dafür kennen wir auch keine Sorgen. Ihr lebt allerdings schöner und sauberer, dafür könnt ihr heute viel Geld verdienen, morgen aber alles verlieren. Es gibt auch ein Sprichwort: Der Verlust ist der ältere Bruder des Gewinns. Es kommt ja wirklich vor, daß jemand heute reich ist und morgen betteln geht. Unser Bauernleben ist viel sicherer: das Leben des Bauern ist karg, doch lang. Reich werden wir nie, dafür aber haben wir immer satt zu essen!«
Darauf entgegnete die ältere Schwester:
»Das ist mir ein schönes Essen: aus einem Trog mit den Schweinen und Kälbern! Ihr lebt im Schmutz und ohne Manieren. Wie sehr sich dein Bauer auch abmüht, ihr werdet doch nicht anders als auf dem Misthaufen leben und auch auf dem Misthaufen sterben. Und euren Kindern wird es nicht anders gehen.«
»Was macht denn das?« erwiderte die Jüngere. »Unser Leben ist einmal so. Dafür leben wir sicher, brauchen uns vor niemand zu bücken und fürchten niemand. Ihr lebt aber in der Stadt in ständiger Anfechtung; heute lebt ihr gut, und morgen kommt der Böse und verführt deinen Mann zum Kartenspiel oder zum Trunk oder gar zu einer Liebschaft. Und dann ist alles hin. Kommt das etwa nicht vor?«
Der Bauer Pachom lag auf dem Ofen und hörte dem Gespräch der beiden Frauen zu.
›Es ist ja alles wahr‹, sagte er sich. ›Unsereiner hat von Kind auf mit der Erde zu schaffen, und daher kommen ihm solche Narrheiten nie in den Sinn. Eines ist nur traurig: wir haben zu wenig Land! Wenn ich genug Land hätte, so fürchtete ich niemand, nicht einmal den Teufel!‹
Die Weiber tranken ihren Tee aus, schwatzten noch von Putz und Kleidern, räumten das Geschirr weg und legten sich schlafen.
Der Teufel hatte aber hinter dem Ofen gesessen und alles gehört. Er freute sich, daß die Bäuerin ihren Mann zum Prahlen verleitet hatte: er prahlte ja, wenn er genug Land hätte, so würde ihn auch der Teufel nicht holen können. ›Es ist gut,‹ sagte sich der Teufel, ›wir wollen sehen: ich will dir viel Land geben und dich gerade damit fangen.‹
2
In der Nachbarschaft wohnte eine Gutsbesitzerin. Sie war nicht sehr reich und besaß etwa hundertundzwanzig Dessjatinen Land. Anfangs vertrug sie sich mit den Bauern sehr gut und tat ihnen nie etwas zuleide. Nun stellte sie sich aber einen verabschiedeten Soldaten als Verwalter an, und dieser begann die Bauern mit Geldstrafen zu plagen. Wie sehr sich auch Pachom in acht nahm, kam es doch jeden Tag vor, daß entweder sein Pferd in den fremden Hafer ging oder seine Kuh sich in den Garten verirrte oder die Kälber auf der fremden Wiese weideten; jedesmal gab es Geldstrafen. Pachom zahlte die Strafen und ließ seinen Ärger an seinen Hausgenossen aus. Gar oft hatte sich Pachom im Laufe des Sommers um dieses Verwalters willen an den Seinen versündigt. Als das Vieh im Herbst in den Stall kam, war er froh: das Futter kostete zwar Geld, dafür aber hörte die ewige Angst auf.
Im Winter hieß es plötzlich, daß die Gutsbesitzerin ihr Land verkaufen wolle und daß der Besitzer der Herberge an der Landstraße mit ihr darüber unterhandle. Als die Bauern davon hörten, begannen sie zu jammern und sagten: »Wenn der Wirt das Gut bekommt, wird er uns noch viel ärger zusetzen als die Gutsherrin. Wir können ohne dieses Land nicht auskommen, denn unser Besitz ist darin von allen Seiten eingeschlossen.« Die Bauern gingen nun alle zur Gutsherrin und baten, sie möchte das Land nicht dem Wirt, sondern ihnen verkaufen; sie versprachen auch einen höheren Preis zu zahlen. Die Gutsherrin ging darauf ein. Die Bauern wollten das Land als Gemeindegut erwerben; sie versammelten sich einige Male, um die Sache zu besprechen, konnten aber nicht einig werden. Jedesmal kam es zu Streitigkeiten, denn der Böse hatte seine Hand im Spiele. Darauf beschlossen die Bauern, daß ein jeder auf eigene Rechnung je nach seinem Vermögen kaufen solle. Auch darauf ging die Gutsherrin ein. Pachom hörte, daß sein Nachbar der Gutsherrin zwanzig Dessjatinen abgekauft habe, wobei er die Hälfte des Kaufpreises in jährlichen Raten bezahlen dürfe. Pachom wurde neidisch. ›Sie kaufen das ganze Land auf und lassen mir nichts übrig‹, dachte er. Und er beriet sich mit seiner Frau.
»Da alle Leute kaufen,« sagte er zu ihr, »müssen auch wir an die zehn Dessjatinen kaufen. Sonst ist es ja wirklich kein Leben: der Verwalter hat uns mit seinen Geldstrafen beinahe zugrunde gerichtet.«
Und sie überlegten sich, wie sie es anstellen sollten. Sie hatten hundert Rubel erspart; nun verkauften sie ein Füllen und die Hälfte der Bienenstöcke, verdingten den Sohn als Arbeiter, borgten sich noch etwas beim Schwager und brachten auf diese Weise die Hälfte der Kaufsumme auf.
Als Pachom das Geld beisammen hatte, suchte er sich ein Stück Land nach seinem Geschmack aus – es waren fünfzehn Dessjatinen mit einem kleinen Wald – und begab sich zur Gutsherrin, um über den Kauf zu verhandeln. Sie wurden handelseinig, und er gab ihr eine Anzahlung auf die fünfzehn Dessjatinen. Dann fuhren sie in die Stadt und schlossen den Kaufvertrag ab; Pachom zahlte die Hälfte des Preises und verpflichtete sich, den Rest innerhalb zweier Jahre abzuzahlen.
Nun hatte Pachom ein ordentliches Stück Land. Er verschaffte sich Saat auf Borg und besäte den gekauften Grund. Schon die erste Ernte war so gut, daß er gleich im ersten Jahre sowohl der Gutsherrin wie auch dem Schwager die Schuld bezahlen konnte. So wurde Pachom Gutsbesitzer: der Boden, den er bebaute, auf dem er mähte, sein Holz fällte und sein Vieh weidete, gehörte nun ihm. Sooft Pachom auf sein eigenes Land hinausfuhr, um zu pflügen oder um die Saat und das Gras anzusehen, war er stolz und glücklich. Es schien ihm, daß auf seinem Grund und Boden ganz anderes Gras wachse und andere Blumen blühten als sonst überall. Wenn er früher an diesem Stück Land vorbeigefahren war, schien ihm das Land ganz gewöhnlich; jetzt war es aber ein gesegnetes Land.
3
So lebte Pachom in Freuden. Er wäre wohl ganz zufrieden gewesen, wenn ihm die Bauern nicht ständig mit den vielen Flurschäden zugesetzt hätten. Er stellte sie freundlich zur Rede, aber es half alles nichts: bald ließen die Hirten die Kühe auf seinen Wiesen grasen, bald verirrten sich nachts die Pferde in sein Korn. Pachom trieb das fremde Vieh weg, verzieh den Bauern und beschwerte sich nicht; auf die Dauer wurde es ihm aber doch zu dumm, und er zeigte die Schuldigen bei der Dorfpolizei an. Er wußte zwar, daß die Bauern es nicht mit böser Absicht taten und daß es nur daher kam, weil sie so dicht beieinander wohnten; und doch mußte er sich sagen: ›Ich kann es ihnen doch nicht immer nachsehen! Sie ruinieren mir schließlich mein ganzes Land. Ich muß ihnen doch einmal eine Lehre geben!‹
Er zeigte einen Bauern an, dann einen andern, und beiden wurden Geldstrafen zudiktiert. Das ärgerte die Nachbarn, und von nun an kam es vor, daß sie ihn mit Absicht schädigten.
Jemand kam nachts in sein Wäldchen und fällte zehn junge Linden, um sich aus ihrer Rinde Bast zu machen. Als Pachom am nächsten Tage an dieser Stelle vorbeifuhr, sah er etwas weiß schimmern. Wie er näher kam, sah er die abgeschälten Stämme auf der Erde liegen, nur die Stümpfe ragten noch aus dem Boden. Wenn der Dieb wenigstens die äußersten Stämme vom Gebüsch gefällt und die mittleren stehen gelassen hätte! Aber nein: er hatte alle der Reihe nach abgehauen. Pachom wurde wütend.
›Wenn ich nur wüßte, wer es war! Dem möchte ich einen ordentlichen Denkzettel geben!‹ Er überlegte lange hin und her und sagte sich schließlich: ›Es kann niemand anders als Semjon gewesen sein.‹
Er ging zu Semjon, durchsuchte seinen Hof, fand aber nichts; es kam nur zu einem Streit. Pachom war nun erst recht davon überzeugt, daß Semjon der Täter war. Er reichte eine Klage ein. Es kam zur Verhandlung, und die Richter mußten Semjon freisprechen, da jeglicher Beweis für seine Schuld fehlte. Darob geriet Pachom noch mehr in Zorn, und er fing einen Streit mit dem Schulzen und den Richtern an. Er sagte zu ihnen: »Ihr steckt unter einer Decke mit den Dieben. Wenn ihr anständig wäret, würdet ihr den Dieb nicht freisprechen!«
Nun war Pachom mit den Richtern und den Nachbarn verzankt. Die Bauern drohten ihm mit dem roten Hahn. So hatte Pachom zwar auf seinem Grund und Boden genügend Raum, doch in der Gemeinde wurde es ihm zu eng.
Um jene Zeit kam das Gerücht auf, daß viele Bauern weiter nach Osten auswanderten. Und Pachom sagte sich: ›Ich selbst brauche ja nicht auszuwandern, denn ich habe auch hier genügend Land; wenn aber jemand von den Nachbarn auswandern wollte, würde es hier geräumiger werden. Ich würde das Land der Auswandernden aufkaufen und damit meinen Besitz abrunden; ich würde es dann viel bequemer haben, denn jetzt ist es wirklich zu eng!‹
Als Pachom einmal zu Hause saß, klopfte bei ihm ein durchreisender Bauer an. Pachom gewährte ihm Nachtquartier, gab ihm zu essen und zu trinken und fragte ihn, woher er des Weges komme. Der Bauer sagte, daß er aus dem unteren Wolgagebiet komme, wo er auf Arbeit gewesen sei. Ein Wort gab das andere, und der Bauer erzählte von den Verhältnissen der Einwanderer in jener Gegend. Viele Leute aus seinem Dorf seien hingezogen; man habe sie ohne Schwierigkeiten in die Gemeinde aufgenommen und einem jeden zehn Dessjatinen Land zugeteilt. Der Boden sei dort sehr fruchtbar: zwischen den Kornähren könne sich ein Pferd verbergen, und fünf Handvoll Ähren gäben eine Garbe ab. Ein Bauer, der gänzlich verarmt und mit leeren Händen hingekommen sei, besitze jetzt sechs Pferde und zwei Kühe.
Pachoms Herz entbrannte. Er sagte sich: ›Was soll ich mich hier in der Enge plagen, wenn ich anderswo viel besser leben kann? Ich will meinen hiesigen Besitz verkaufen und mich mit dem Erlös drüben einrichten. Denn hier in der Enge hat man nichts als Ärger. Nur muß ich zuerst selbst hin und mir die Sache näher anschauen.‹
Als die Sommerarbeiten zu Ende waren, machte sich Pachom auf den Weg. Er fuhr bis Samara die Wolga hinab und ging von dort etwa vierhundert Werst zu Fuß. Er kam in die Gegend. Alles stimmte. Die Bauern hatten dort viel Land. Einem jeden waren zehn Dessjatinen zugeteilt, und Fremde wurden ohne Schwierigkeiten in die Gemeinde aufgenommen. Wer aber auch noch Geld mitbrachte, durfte außer den angewiesenen zehn Dessjatinen noch so viel Land kaufen, wie er wollte; eine Dessjatine bester Erde kostete nur drei Rubel.
Als Pachom alles an Ort und Stelle kennen gelernt hatte, kehrte er zum Herbst nach Hause zurück und begann seinen Besitz zu verkaufen. Er verkaufte sein Land mit Gewinn, verkaufte sein Gehöft, sein Vieh, trat aus der Gemeinde aus und zog im nächsten Frühjahr mit Weib und Kind in die neue Heimat.
4
Pachom kam mit seiner Familie ins neue Land und ließ sich in einem großen Dorfe in die Gemeinde aufnehmen. Er bewirtete die Gemeindeältesten mit Schnaps, und sie verschafften ihm alle notwendigen Papiere. Sie nahmen Pachom in die Gemeinde auf und teilten ihm, da seine Familie aus fünf Köpfen bestand, fünfzig Dessjatinen Land auf verschiedenen Feldern zu; außerdem bekam er einen Anteil am Weideland. Pachom baute sich an und kaufte Vieh. Nun besaß er allein an zugeteiltem Land dreimal mehr als früher; es war guter, fruchtbarer Boden. Er konnte daher zehnmal so gut leben wie früher. Er besaß genügend Ackergrund und Weideland und konnte sich so viel Vieh halten, wie er wollte.
Anfangs, während er sich einrichtete, erschien ihm alles vortrefflich; nachdem er aber eine Zeitlang gewirtschaftet hatte, fand er es auch hier zu eng. Im ersten Jahre säte Pachom Weizen auf dem ihm zugeteilten Lande, und er gedieh sehr gut. Nun bekam er Lust, noch mehr Weizen zu bauen, doch das zugeteilte Land reichte nicht mehr aus. Auch war es nicht von der nötigen Beschaffenheit. In jener Gegend sät man den Weizen auf neuen Steppenboden oder Brachfeld. Man sät ihn nur ein oder zwei Jahre und läßt dann die Erde brach liegen, bis sie wieder mit Steppengras bewachsen ist. Solches Land fand viele Liebhaber, aber für alle konnte es nicht reichen. Das gab immer Grund zu Streitigkeiten; die reicheren Bauern bebauten ihr Land selbst, und die ärmeren verpachteten das ihrige an Kaufleute, um mit dem Pachtzins ihre Steuern zu bezahlen. Auch Pachom wollte mehr von diesem Lande haben. Er ging im nächsten Jahr in die Stadt und pachtete von einem Kaufmann Land auf ein Jahr. Er besäte es, der Weizen gedieh gut, doch das Feld lag zu weit vom Dorf entfernt: er mußte ganze fünfzehn Werst weit fahren. Er sah, daß die reicheren Bauern in der Umgegend wie Gutsbesitzer auf Einzelhöfen lebten und von Jahr zu Jahr reicher wurden. ›Wenn ich mir noch etwas Land zu Erb und Eigen kaufen könnte,‹ dachte er sich, ›würde ich mir auch so ein Gut bauen! Dann hätte ich alles beisammen.‹ Und Pachom sann nun darüber nach, wie er sich Erbland zulegen könnte.
So vergingen drei Jahre. Pachom nahm Land in Pacht und baute Weizen. Die Jahre waren gut, der Weizen gedieh vortrefflich, und Pachom konnte sich etwas Geld zurücklegen. Eigentlich hätte er so sehr gut leben können, aber es ärgerte ihn, daß er jedes Jahr neue Pachtverträge abschließen mußte. Jedesmal gab es große Scherereien: wenn irgendwo besonders guter Boden zu verpachten war, stürzten sich die Bauern von der ganzen Gegend darauf und schnappten ihm alles vor der Nase weg, so daß er nichts säen konnte. Im dritten Jahre pachtete er zusammen mit einem Kaufmann von den Bauern Weideland; sie hatten es schon aufgepflügt, als die Bauern plötzlich einen Prozeß anfingen, und so war alle Mühe verloren. ›Wenn ich eigenes Land hätte,‹ dachte er, ›brauchte ich mich vor niemand zu bücken und hätte diesen Ärger nicht.‹
Nun begann Pachom Erkundigungen einzuziehen, wo er sich Land zu Erb und Eigen kaufen könnte. Er stieß auf einen Bauern, der erst vor kurzem fünfhundert Dessjatinen gekauft hatte, aber in Not geraten war und das Land billig verkaufen mußte. Pachom unterhandelte mit dem Bauern. Sie handelten lange hin und her und einigten sich schließlich auf die Summe von tausend Rubel, wobei die Hälfte des Betrages in Raten zu zahlen war. Das Geschäft war beinahe abgeschlossen, als bei Pachom eines Tages ein durchreisender Kaufmann einkehrte, um seinen Pferden Futter zu geben. Sie tranken Tee und kamen ins Gespräch. Der Kaufmann erzählte, daß er aus dem fernen Baschkirenland komme. Er hätte dort von den Baschkiren fünftausend Dessjatinen Land gekauft, das Ganze hätte nur tausend Rubel gekostet. Pachom begann ihn auszufragen. Der Kaufmann erzählte: »Ich habe das Land so billig bekommen, weil ich zuvor die Gemeindeältesten beschenkt habe: sie bekamen von mir Teppiche und Kaftane für etwa hundert Rubel, eine Kiste Tee, und solche, die Branntwein trinken, bewirtete ich mit Branntwein. Auf diese Weise bekam ich die Dessjatine zu zwanzig Kopeken.«
Er zeigte ihm den Kaufvertrag und sagte noch: »Das Land liegt an einem Fluß und ist gutes Steppenland.«
Pachom fragte ihn weiter aus, und der Kaufmann sagte: »Es gibt dort so viel Land, daß man es auch in einem Jahre nicht umgehen kann. Alles gehört den Baschkiren. Die Leute sind stumpfsinnig wie die Hammel. Man kann das Land von ihnen beinahe umsonst haben.«
›Nun,‹ denkt sich Pachom, ›warum soll ich für meine tausend Rubel fünfhundert Dessjatinen kaufen und mir dabei noch eine Schuld auf den Hals laden, wenn ich dort für das gleiche Geld viel mehr bekommen kann?‹
5
Pachom erkundigte sich, wie man zu den Baschkiren käme; kaum war der Kaufmann fort, als er sich zur Reise zu rüsten begann. Er vertraute die ganze Wirtschaft seiner Frau an und nahm einen seiner Knechte auf die Reise mit. Sie fuhren zuerst in die Stadt und kauften eine Kiste Tee, Geschenke und Branntwein – alles, wie der Kaufmann gesagt hatte. Sie fuhren und fuhren und legten an die fünfhundert Werst zurück. Am siebenten Tage kamen sie in das Zeltlager der Baschkiren. Alles war wirklich so, wie der Kaufmann erzählt hatte. Die Baschkiren wohnen in der Steppe, am Flusse, in Zelten aus Filz. Sie treiben keinen Ackerbau und essen kein Brot. In der Steppe weiden ihre Vieh- und Pferdeherden. Hinter den Zelten sind die Füllen angebunden, und zweimal am Tage treibt man die Stuten zu ihnen hin. Die Stuten werden gemolken, und aus der Milch wird Kumys bereitet. Die Weiber rühren den Kumys und machen daraus Käse; die Männer tun aber nichts als Kumys und Tee trinken, Hammelfleisch essen und Flöte blasen. Es sind lauter gesunde, lustige Leute, die den ganzen Sommer lang feiern. Das Volk ist ganz ungebildet, versteht kein Russisch, ist aber sehr freundlich.
Kaum hatten die Baschkiren Pachom erblickt, als sie alle aus ihren Zelten herauskamen und den Gast umringten. Unter ihnen fand sich auch ein Dolmetsch. Pachom ließ ihn den Leuten sagen, daß er des Landes wegen gekommen sei. Darob freuten sich die Baschkiren sehr; sie nahmen ihn bei den Händen, führten ihn in ein schönes Zelt, setzten ihn auf Teppiche und Daunenkissen, ließen sich dann alle um ihn im Kreise nieder und bewirteten ihn mit Kumys und Tee. Sie schlachteten auch einen Hammel und gaben ihm das Fleisch zu essen. Pachom holte aus seinem Wagen die mitgebrachten Geschenke hervor und verteilte sie unter die Baschkiren. Ein jeder bekam ein Geschenk und etwas Tee. Da freuten sich die Baschkiren. Sie sprachen lange miteinander in ihrem Kauderwelsch und ließen dann den Dolmetsch sprechen.
»Sie lassen dir sagen,« sagte der Dolmetsch, »daß sie dich liebgewonnen haben und daß es bei uns Sitte ist, jedem Gast jeden Gefallen zu erweisen und ihm für seine Geschenke Gegengeschenke zu machen. Du hast uns beschenkt; sage uns nun, was dir von unserem Besitz am besten gefällt, damit wir es dir geben.«
»Am besten gefällt mir euer Land,« entgegnete Pachom. »Bei uns zu Hause ist es eng, und der Boden ist erschöpft; bei euch gibt es aber viel Land, und der Boden ist so gut, wie ich noch keinen gesehen habe.«
Der Dolmetsch übersetzte es. Die Baschkiren sprachen wieder lange miteinander. Pachom verstand davon kein Wort, sah aber, daß sie sehr lustig waren: sie schrien und lachten. Dann wurden sie wieder still, blickten alle auf Pachom, und der Dolmetsch sagte:
»Sie lassen dir sagen, daß sie bereit sind, dir für deine Freundlichkeit so viel Land zu geben, wie du magst. Zeige nur mit der Hand, welches Land dir am besten gefällt, und es ist dein.«
Sie sprachen noch eine Weile und schienen in Streit geraten zu sein. Pachom fragte, worüber sie stritten. Und der Dolmetsch sagte:
»Die einen sagen, daß man erst den Ältesten fragen müsse und ohne seine Erlaubnis nichts hergeben dürfe; die andern meinen aber, man könne es auch ohne ihn entscheiden.«
6
Während die Baschkiren so stritten, kam plötzlich ein Mann in einer Fuchsfellmütze ins Zelt. Alle verstummten und erhoben sich. Und der Dolmetsch sagte:
»Es ist der Älteste selbst!«
Pachom holte gleich den schönsten Kaftan hervor und überreichte ihn dem Ältesten; auch fünf Pfund Tee gab er ihm. Der Älteste nahm die Geschenke an und setzte sich auf den Ehrenplatz. Die Baschkiren begannen ihm sofort etwas zu erzählen. Der Älteste hörte sie an, nickte mit dem Kopfe, daß sie schweigen sollten, und sagte zu Pachom russisch:
»Nun, ich habe nichts dagegen. Nimm dir Land, wo es dir beliebt; wir haben genügend da.«
Pachom dachte: ›Was heißt das, daß ich mir so viel nehmen darf, wie ich mag? Man muß es doch irgendwie schriftlich abmachen. Sonst können sie heute sagen, daß es mir gehört, und es mir morgen wieder abnehmen.‹
»Ich danke euch für die freundlichen Worte,« sagte er. »Ihr habt ja viel Land, und ich brauche nur wenig. Ich muß aber genau wissen, welches Stück mir gehört. Man muß es irgendwie abgrenzen und auf meinen Namen einschreiben. Gott ist ja Herr über Leben und Tod. Ihr seid gute Leute und gebt mir das Land; vielleicht kommen aber einmal eure Kinder und nehmen es mir wieder weg.«
»Du hast recht,« entgegnete der Älteste, »man kann es ja auch schriftlich abmachen.«
Pachom sagte weiter:
»Ich habe gehört, daß euch neulich ein Kaufmann besucht hat. Ihr habt ihm gleichfalls etwas Land geschenkt und einen Vertrag darüber abgeschlossen; ich möchte es gern auch so machen.«
Der Älteste begriff alles.
»Das kann man wohl machen,« sagte er, »wir haben auch einen Schreiber; wir wollen in die Stadt fahren und alles besiegeln.«
»Und welchen Preis verlangt ihr dafür?« fragte Pachom.
»Wir haben nur einen Preis: tausend Rubel für den Tag.« Pachom verstand es nicht.
»Was ist denn der Tag für ein Maß? Wieviel Dessjatinen sind es?«
»Wir verstehen so nicht zu rechnen,« erwiderte der Älteste.
»Wir verkaufen so: Wieviel Land du an einem Tage umgehen kannst, soviel gehört dir. Und ein Tag kostet tausend Rubel.«
Pachom wunderte sich.
»In einem Tage,« sagte er, »kann man ja ein sehr großes Stück Land umgehen.«
Der Älteste lachte:
»Ja, und alles soll dir gehören! Wir machen aber noch eine Bedingung aus: Wenn du am gleichen Tage nicht auf die Stelle zurückkommst, von der du ausgegangen bist, so ist dein Geld verfallen.«
»Wie wollt ihr euch den Weg merken, den ich gegangen bin?« sagte Pachom.
»Sehr einfach: Wir werden uns auf dem Fleck,den du wählst, aufstellen und warten, bis du ein Stück Land umgangen hast. Du nimmst eine Hacke mit und bringst, wo es nötig ist, Grenzmarken an: an den Ecken gräbst du den Rasen auf, und wir werden hinterdrein mit dem Pfluge von Marke zu Marke Furchen ziehen. Du kannst einen beliebig großen Kreis machen, doch mußt du vor Sonnenuntergang an den gleichen Ort zurückkommen, von dem du ausgegangen bist. Alles, was du umgangen hast, ist dein!«
Pachom freute sich. Sie beschlossen, früh am Morgen hinauszugehen. Sie sprachen noch eine Zeitlang miteinander, tranken Kumys, aßen Hammelfleisch und tranken Tee. So wurde es Nacht. Die Baschkiren bereiteten Pachom ein Lager auf einem Daunenpfühl und gingen auseinander. Man verabredete, am nächsten Morgen zeitig aufzubrechen, um den Ort noch vor Sonnenaufgang zu erreichen.
7
Pachom legte sich auf sein Lager, konnte aber keinen Schlaf finden. Er mußte immer an sein Land denken: ›Ich werde mir ein gehöriges Stück Land einheimsen. An einem Tage kann ich ja leicht fünfzig Werst machen. Die Tage sind jetzt so lang wie Jahre; und in einem Kreise von fünfzig Werst ist viel Land enthalten! Das schlechtere Land will ich verkaufen ober an Bauern verpachten, das bessere behalte ich für mich. Ich schaffe mir zwei Gespann Ochsen an und halte mir noch zwei Knechte; an die fünfzig Dessjatinen will ich bebauen und auf dem übrigen Lande mein Vieh weiden lassen.‹ Erst kurz vor Tag schlummerte Pachom ein. Und er hatte einen Traum. Er lag, so träumte ihm, in diesem selben Zelt und hörte draußen jemand laut lachen. Er wollte sehen, wer es sei, stand auf, ging hinaus und sah den Ältesten der Baschkiren vor dem Zelt sitzen. Er hielt sich mit beiden Händen den Bauch und schüttelte sich vor Lachen. Pachom ging auf ihn zu und fragte: »Worüber lachst du denn?« Es war aber gar nicht der Älteste, sondern jener Kaufmann, der ihn kürzlich besucht und ihm vom Baschkirenland erzählt hatte. Er fragte den Kaufmann: »Bist du lange hier?« Nun war es gar nicht der Kaufmann, sondern jener Bauer aus dem Wolgagebiet, der noch in der alten Heimat zu ihm gekommen war. Und plötzlich sah Pachom, daß es auch gar nicht der Bauer war, sondern der Teufel selbst, mit Hörnern und Hufen. Der Teufel lachte, und vor ihm lag ein Mann, barfuß, nur mit Hemd und Hose bekleidet. Pachom sah genauer hin: Was mochte es für ein Mensch sein? Und er sah – der Mann war tot und war niemand anders als er selbst. Pachom erschrak und erwachte. Als er ganz wach war, sagte er sich: ›Was es doch nicht alles für Träume gibt!‹ Er blickte sich um und sah durch die offene Tür, daß es schon tage. ›Ich muß die Leute wecken,‹ dachte er, ›denn es ist Zeit, aufzubrechen.‹ Pachom stand auf, weckte seinen Knecht, der im Wagen schlief, befahl ihm einzuspannen, und ging, die Baschkiren zu wecken.
»Es ist Zeit,« sagte er, »in die Steppe hinauszufahren, um mein Land abzumessen.«
Die Baschkiren standen auf und versammelten sich vor dem Zelt; auch der Älteste kam herbei. Sie begannen wieder Kumys zu trinken und boten Pachom Tee an; er wollte aber keine Zeit verlieren.
»Wenn wir hinausfahren wollen, müssen wir es gleich tun,« sagte er, »denn es ist höchste Zeit!«
8
Die Baschkiren machten sich fertig, brachen auf und fuhren teils im Wagen, teils ritten sie nebenher. Pachom fuhr mit dem Knecht in seinem Wagen; sie nahmen auch Hacken mit. Wie sie in die Steppe kamen, rötete sich eben der Osten. Sie fuhren einen Hügel, einen ›Schichan‹, wie es in der Baschkirensprache heißt, hinauf, stiegen von den Pferden und Wagen und kamen an einem Platze zusammen. Der Älteste ging auf Pachom zu, zeigte mit der Hand und sagte:
»Dieses ganze Land, so weit dein Blick reicht, gehört uns. Wähle dir nun ein Stück nach deinem Geschmack.«
Pachoms Augen brannten vor Verlangen; es war lauter gutes Steppenland, glatt wie eine Handfläche, schwarz wie Mohnkörner; in den Vertiefungen wuchsen Gräser verschiedener Art, die einem bis an die Brust reichten.
Der Älteste nahm seine Fuchsfellmütze ab und legte sie auf den Boden.
»Das soll unser Merkzeichen sein,« sagte er. »Von hier sollst du ausgehen und hierher wieder zurückkommen. Was du umgehst, gehört dir.«
Pachom holte sein Geld aus der Tasche, legte es auf die Mütze, zog den Kaftan aus und behielt nur sein Unterkleid an. Er schnallte den Gürtel fester um den Leib, steckte sich ein Säckchen mit Brot in den Busen, band sich eine Kürbisflasche mit Wasser an den Gürtel, zog die Stiefelschäfte höher hinauf, reckte sich, nahm aus den Händen des Knechtes die Hacke und stand so marschbereit da. Er überlegte sich noch, welche Richtung er einschlagen sollte – denn das Land war überall von gleicher Güte. Er sagte sich schließlich: ›Es ist ja wirklich einerlei; ich gehe dem Sonnenaufgang zu.‹ Er stellte sich mit dem Gesicht nach Osten, reckte sich und wartete, daß ein Rand der Sonnenscheibe zum Vorschein käme. ›Ich will keine Zeit verlieren‹, sagte er sich; ›solange es noch kühl ist, geht es sich viel leichter.‹ Kaum schossen die ersten Sonnenstrahlen am Himmelsrande hervor, als Pachom die Hacke auf die Schulter nahm und in die Steppe ging.
Pachom ging nicht zu schnell und nicht zu langsam. Als er eine Werst weit gegangen war, grub er ein Loch und schichtete einige Rasenstücke übereinander auf, damit das Zeichen von weitem sichtbar sei. Dann ging er weiter. Seine Glieder waren durch die Bewegung gelenkiger geworden. Er war allmählich in Schwung gekommen und beschleunigte seine Schritte. Er ging noch eine Strecke weiter und grub dann das zweite Loch.
Pachom blickte sich um. Er konnte im Sonnenlichte gut den Hügel sehen, auch die Leute und selbst das Funkeln der eisenbeschlagenen Räder. Pachom schätzte die Strecke, die er zurückgelegt, auf fünf Werst. Es war ihm wärmer geworden; er zog daher auch das Unterkleid aus, warf es über die Schulter und ging weiter. Nun wurde es heiß. Er blickte auf die Sonne – es war gerade die Stunde, Brotzeit zu machen. ›Nun ist gerade ein Viertel des Arbeitstages verstrichen‹, dachte Pachom. ›Es ist noch zu früh, einzubiegen. Ich will mir nur die Stiefel ausziehen.‹ Er setzte sich, zog sich die Stiefel aus, befestigte sie am Gürtel und ging weiter. ›Ich will noch an die fünf Werst gehen und dann links einbiegen. Hier ist der Boden gar zu gut; es wäre schade, wenn ich schon hier einbiegen wollte. Je weiter ich gehe, um so besser scheint das Land.‹ Er ging noch eine Strecke geradeaus und blickte sich um: der Hügel war kaum noch zu sehen; die Leute darauf erschienen wie Ameisen, und die Wagenräder glänzten kaum merklich in der Sonne.
›In dieser Richtung‹, sagte sich Pachom, ›habe ich genug; jetzt heißt es einbiegen! Ich bin ganz in Schweiß gebadet. Ich will etwas Wasser trinken.‹ Er blieb stehen, grub ein etwas größeres Loch, schichtete die Rasenstücke übereinander, band die Kürbisflasche vom Gürtel, trank und bog dann scharf nach links ein. Er ging und ging, geriet in hohes Gras; es wurde aber immer heißer.
Pachom begann Müdigkeit zu spüren; er blickte auf die Sonne und sah, daß es just die Mittagstunde war. ›Nun, jetzt darf ich wirklich etwas ausruhen!‹ Pachom blieb stehen und setzte sich. Er aß Brot, trank Wasser, legte sich aber nicht hin, denn er sagte sich: ›Wenn ich mich hinlege, kann ich unversehens einschlafen.‹ Er saß eine Weile und ging dann weiter. Anfangs fiel ihm das Gehen leicht, denn das Mittagbrot hatte ihn gestärkt. Es war ihm aber sehr heiß, auch wurde er nach und nach schläfrig. Er ging aber rüstig vorwärts und dachte: ›Die Mühe ist kurz, doch das Leben lang.‹
Nachdem er auch in dieser Richtung eine weite Strecke zurückgelegt hatte, wollte er wieder nach links einbiegen; da stieß er aber auf eine feuchte Talsenke; es war schade, sie aufzugeben. Er dachte sich: ›Hier muß Flachs gut gedeihen.‹ Und er ging noch weiter in der gleichen Richtung. Er nahm also auch noch die feuchte Stelle in seinen Kreis auf, grub wieder ein Loch und machte den zweiten Winkel. Pachom blickte zu dem Hügel zurück: es war dunstig geworden, die Luft schien in der Sonnenglut zu zittern, und durch den Dunst hindurch konnte man die Leute auf dem Hügel kaum sehen.
›Ich habe die ersten beiden Seiten zu lang gemacht,‹ sagte sich Pachom, ›die dritte Seite muß kürzer werden.‹
Er ging nun schneller, um noch die dritte Seite des Vierecks abzuschreiten. Er sah auf die Sonne: sie neigte sich der Vesperzeit zu. Auf der dritten Seite hatte er aber erst kaum zwei Werst zurückgelegt, und bis zum Ausgangspunkt blieben noch immer fünfzehn Werst.
›Nein,‹ sagte er sich, ›so geht es nicht: wenn es auch ein schiefes Stück wird, ich muß jetzt geradeaus aufs Ziel zugehen. Daß es nur nicht zuviel wird! Ich habe ja auch schon jetzt genug.‹ Pachom grub schnell ein Loch und ging geradeswegs auf den Hügel zu.
9
Pachom geht also auf den Hügel zu, und das Gehen fällt ihm immer schwerer: er schwitzt, die bloßen Füße sind zerschunden und wollen ihm nicht mehr gehorchen. Er will gern ein wenig ausruhen, darf es aber nicht mehr, sonst kann er vor Sonnenuntergang nicht zurück sein. Die Sonne wartet nicht und sinkt immer tiefer.
›Habe ich nicht doch einen Fehler gemacht und mir zuviel Land genommen? Wenn ich nur nicht zu spät komme!‹
Er blickt bald auf den Hügel, bald auf die Sonne: bis zum Ziel ist es noch weit, die Sonne steht aber schon dicht über dem Steppenrand. Pachom geht mit großer Mühe und beschleunigt dennoch immer seine Schritte. Er geht und geht, die Entfernung bleibt aber immer die gleiche; nun fängt er an zu laufen. Er wirft das Unterkleid, die Stiefel, die Kürbisflasche und die Mütze weg und behält nur die Hacke, um sich auf sie zu stützen.
›O weh,‹ sagt er sich, ›ich war zu gierig, habe die ganze Sache verdorben, werde vor Sonnenuntergang nicht hinkommen.‹ Die Angst benimmt ihm den Atem. Er rennt, was er rennen kann; Hemd und Hose kleben ihm am Leibe, sein Mund ist wie ausgetrocknet, die Brust arbeitet wie ein Schmiedebalg, das Herz hämmert, und die Beine wollen ihn nicht tragen und knicken ein. ›Daß ich nur vor Anstrengung nicht noch sterbe!‹ denkt er voller Angst. Er fürchtet zu sterben, kann aber nicht mehr stehen bleiben.
›Ich bin schon so weit gelaufen,‹ denkt er, ›und wenn ich jetzt stehen bleibe, werden mich die Leute einen Narren nennen!‹
Er läuft und läuft, erreicht beinahe den Hügel und hört, wie ihn die Baschkiren mit Kreischen und Schreien antreiben. Von diesem Geschrei brennt sein Herz noch mehr. Pachom läuft mit den letzten Kräften, die Sonne erreicht aber schon den Steppenrand, sieht durch den Dunst ganz groß und blutrot aus. Jeden Augenblick kann sie untergehen. Er hat aber nicht mehr weit zu laufen. Pachom sieht die Leute auf dem Hügel stehen; sie winken ihm und treiben ihn an. Er sieht auch die Fuchsfellmütze auf der Erde, sieht sein Geld auf ihr liegen, sieht den Ältesten auf der Erde sitzen und sich mit beiden Händen den Bauch halten. Pachom muß an seinen Traum denken. Er sagt sich:
›Nun habe ich viel Land; ob es mir aber von Gott beschieden ist, darauf zu leben? Wehe! Ich habe mich zugrunde gerichtet, erreiche den Hügel nicht mehr...‹
Pachom blickt wieder auf die Sonne: sie berührt schon die Erde, und ein Stück an ihrem Rande ist bereits abgeschnitten. Pachom nimmt seine letzten Kräfte zusammen, beugt sich mit dem ganzen Körper vor, so daß seine Beine kaum mitkommen können. Wie Pachom den Hügel erreicht, wird es plötzlich dunkel. Er blickt zurück – die Sonne ist schon untergegangen. Pachom stöhnt auf: »Umsonst war meine ganze Mühe!« Er will stehen bleiben, hört aber die Baschkiren noch immer schreien. Es fällt ihm ein, daß es ihm nur unten so scheint, als sei die Sonne schon untergegangen; vom Hügel kann man sie noch sehen. Pachom holt Atem und läuft den Hügel hinauf. Oben ist es noch hell. Er erreicht den Gipfel und sieht die Mütze. Vor der Mütze sitzt der Älteste, schüttelt sich vor Lachen und hält sich mit den Händen den Bauch. Wieber muß Pachom an seinen Traum denken. Er stöhnt auf, die Beine knicken ihm ein, und er fällt hin, berührt aber mit den beiden Händen gerade noch die Mütze.
»Gut gemacht!« schreit der Älteste. »Viel Land hast du gewonnen.«
Pachoms Knecht kam gelaufen, wollte ihn aufheben, aber Pachom lag tot da, und aus seinem Munde rann Blut. Die Baschkiren schnalzten mit den Zungen und sprachen ihr Bedauern aus.
Der Knecht nahm die Hacke, grub Pachom ein Grab, genau so lang wie das Stück Erde, das er mit seinem Körper, von den Füßen bis zum Kopf, bedeckte – sechs Ellen –, und scharrte ihn ein.
Die drei Tode
Übertragen von Alexander Eliasberg
1
Es war Herbst. Auf der Landstraße fuhren in schnellem Trab zwei Equipagen. In der vorderen Kutsche saßen zwei Frauen: die eine, die Dame, war hager und bleich, die andere, das Dienstmädchen, hatte glänzende rote Wangen und eine volle Figur. Ihre kurzen trockenen Haare drängten sich unter dem verschossenen Hute hervor, und die rote Hand im zerrissenen Handschuh brachte sie immer wieder hastig in Ordnung. Die hohe, mit einem bunten Tuch bedeckte Brust atmete Gesundheit; die flinken schwarzen Augen verfolgten bald durch das Wagenfenster die dahinschwindenden Felder, bald blickten sie scheu auf die Herrin, bald schweiften sie unruhig über die Ecken der Kutsche. Vor der Nase des Dienstmädchens schaukelte der ans Gepäcknetz gebundene Hut der Herrin, auf ihren Knien lag ein Hündchen, ihre Füße standen auf einem Berg von Schachteln und trommelten kaum hörbar im gleichen Takte mit dem Rütteln der Federn und dem Klirren der Fensterscheiben.
Die Dame hielt die Hände im Schoß gefaltet, hatte die Augen geschlossen und wiegte sich schwach in den Kissen, die man ihr hinter den Rücken geschoben hatte; sie hüstelte hohl mit geschlossenem Mund, wobei sie jedesmal das Gesicht verzog. Auf dem Kopfe trug sie ein weißes Nachthäubchen und darüber ein leichtes hellblaues Tuch, dessen Enden um ihren zarten blassen Hals geschlungen waren. Ein gerader Scheitel, der unter dem Häubchen verschwand, teilte das blonde, ungewöhnlich dünne, pomadisierte Haar; die weiße Haut dieses breiten Scheitels schien eigentümlich trocken und leblos. Die gelbliche Haut lag schlaff auf den feinen und schönen Umrissen des Gesichts und hatte an den Wangen und Backenknochen rote Flecken. Die Lippen waren trocken und unruhig, die dünnen Wimpern waren seltsam gerade, und der Reisemantel fiel auf der eingefallenen Brust in geraden Falten herab. Obwohl die Augen geschlossen waren, drückte das Gesicht der Dame Müdigkeit, Gereiztheit und gewohntes Leid aus.
Der Lakai saß zurückgelehnt auf dem Bock und schlummerte; der Postillion trieb mit kurzen Schreien das stattliche, schweißtriefende Viergespann an und blickte sich ab und zu nach dem andern Kutscher um, der auf dem Bocke des zweiten Wagens saß und seine Pferde mit den gleichen Schreien antrieb. Auf dem kalkigen Straßenschmutz liefen gleichmäßig und schnell die parallelen breiten Spuren der Wagenräder. Der Himmel war grau und kalt, feuchter Nebel lagerte auf den Feldern und Wegen. Im Innern der Kutsche war es dumpf und roch nach Kölnischem Wasser und Staub. Die Kranke warf ihren Kopf in den Nacken und öffnete langsam die Augen. Die großen Augen waren glänzend und von einer schönen, dunklen Farbe.
»Schon wieder!« sagte sie, indem sie nervös mit ihrer schönen hageren Hand einen Mantelzipfel des Dienstmädchens wegschob, der kaum ihren Fuß berührt hatte; ihr Mund zuckte dabei schmerzvoll zusammen. Matrjoscha raffte mit beiden Händen die Schöße ihres Mantels auf, erhob sich auf ihren kräftigen Beinen und rückte etwas weiter. Ihr frisches Gesicht errötete. Die schönen dunklen Augen der Kranken verfolgten gespannt alle Bewegungen des Mädchens. Die Dame stemmte sich mit beiden Händen gegen den Sitz und wollte gleichfalls etwas hinaufrücken, doch ihre Kräfte versagten. Ihr Mund krümmte sich, und ihr ganzes Gesicht wurde durch den Ausdruck ohnmächtiger, gehässiger Ironie verzerrt. »Wenn du mir wenigstens helfen wolltest!... Ach, jetzt ist es nicht mehr nötig! Ich kann schon selbst; leg mir aber um Gottes willen nicht immer deine Päckchen hinter den Rücken!... Laß es sein, wenn du es nicht verstehst!« Die Dame schloß die Augen, hob dann wieder die Lider und warf dem Dienstmädchen einen schnellen Blick zu. Matrjoscha starrte sie an und biß sich in die rote Unterlippe. Ein schwerer Seufzer drang aus der Brust der Kranken und ging in einen Hustenanfall über. Sie wandte sich ab, verzog das Gesicht und griff mit beiden Händen an die Brust. Als der Anfall vorüber war, schloß sie wieder die Augen und saß unbeweglich da. Beide Equipagen fuhren durch ein Dorf. Matrjoscha steckte ihre volle Hand unter dem Tuche hervor und bekreuzigte sich.
»Was gibts?« fragte die Herrin.
»Eine Station, gnädige Frau.«
»Ich frage dich, warum du dich bekreuzigst!«
»Es ist eine Kirche, gnädige Frau.«
Die Kranke wandte sich zum Fenster und begann sich langsam zu bekreuzigen, mit weit geöffneten Augen auf die große hölzerne Kirche starrend, um die die Kutsche herumfuhr. Die Kutsche und die Kalesche hielten gleichzeitig vor der Station. Aus der Kalesche stieg der Gatte der kranken Dame und der Arzt. Sie traten an die Kutsche heran.
»Wie fühlen Sie sich?« fragte derArzt,ihren Puls befühlend.
»Nun, meine Liebe, bist du nicht müde?« fragte der Gatte französisch. »Willst du nicht aussteigen?«
Matrjoscha nahm alle Päckchen zusammen und drückte sich in eine Ecke,um die Herrschaften in ihrem Gespräch nicht zu stören.
»Immer dasselbe,« antwortete die Kranke. »Ich möchte nicht aussteigen.« Der Gatte stand noch eine Weile da und ging dann in das Stationsgebäude. Matrjoscha sprang aus der Kutsche und lief auf den Fußspitzen durch den Schmutz zum Tor.
»Daß es mir schlecht geht, ist noch kein Grund für Sie, nicht zu frühstücken,« sagte die Kranke mit einem schwachen Lächeln zum Arzt, der vor dem Wagenfenster stand.
›Niemand kümmert sich um mich‹, fügte sie in Gedanken hinzu, als der Arzt sich mit leisen Schritten vom Wagen entfernte und dann in großer Hast die Stufen des Stationshauses hinauslief. ›Ihnen geht es gut, und um alles übrige kümmern sie sich nicht. O mein Gott!‹
»Nun, Eduard Iwanowitsch,« sagte der Gatte oben im Stationsgebäude zu dem Arzt, sich mit vergnügtem Lächeln die Hände reibend, »ich habe den Eßkorb heraufbringen lassen. Was halten Sie davon?«
»Ich bin dabei,« antwortete der Arzt.
»Wie geht es ihr eigentlich?« fragte der Gatte seufzend, indem er die Stimme senkte und die Augenbrauen hochzog.
»Ich habe Ihnen ja schon gesagt: sie wird unmöglich bis nach Italien kommen; ich zweifle sogar, daß sie Moskau noch erreicht. Besonders bei diesem Wetter.«
»Was soll ich tun? Ach mein Gott! Mein Gott!« Der Gatte bedeckte die Augen mit der Hand. »Gib her!« wandte er sich zum Diener, der mit dem Eßkorb hereinkam.
»Sie hätten eben zu Hause bleiben müssen,« entgegnete der Arzt und zuckte die Achseln.
»Sagen Sie mir doch, was konnte ich tun?« entgegnete der Gatte. »Ich habe doch alles versucht, um sie von der Reise abzuhalten; ich habe ihr die Kosten vorgehalten, ich habe von den Kindern, die wir allein zurücklassen mußten, und von meinen Geschäften gesprochen – sie will nichts hören. Sie malt sich das Leben im Ausland aus, als ob sie gesund wäre. Und ihr die Wahrheit über ihren Zustand sagen hieße sie töten.«
»Sie ist ja schon so gut wie tot, das müssen Sie selbst wissen, Wassili Dmitritsch. Der Mensch kann nicht ohne Lungen leben, und neue Lungen wachsen nicht nach. Es ist ja wirklich sehr traurig und schwer, was kann man aber tun? Unsere Aufgabe kann nur darin bestehen, daß wir ihr das Ende möglichst leicht gestalten. Hier ist viel eher ein Seelsorger am Platze.«
»Ach mein Gott! Versetzen Sie sich doch in meine Lage; Wie kann ich mit ihr von ihrer letzten Stunde sprechen? Mag kommen, was will, ich kann es ihr nicht sagen. Sie wissen ja selbst, wie gut sie ist ...«
»Versuchen Sie doch, sie zu überreden, noch bis zum Winter, bis wir Schlittenbahn haben, zu warten,« sagte der Arzt und schüttelte bedeutungsvoll den Kopf. »Unterwegs kann ja leicht eine Verschlimmerung eintreten ...«
»Aksjuscha, he, Aksjuscha!« schrie auf der schmutzigen Hintertreppe die Tochter des Stationsaufsehers, indem sie sich eine Jacke über den Kopf warf. »Wir wollen uns die Gutsherrin von Schirkino ansehen; man sagt, sie werde wegen ihrer Brustkrankheit ins Ausland geführt. Ich habe noch nie eine Schwindsüchtige gesehen.«
Aksjuscha sprang herbei, und beide Mädchen liefen Hand in Hand vor das Tor. Als sie an der Kutsche vorbeigingen, verlangsamten sie die Schritte und blickten durch das herabgelassene Fenster hinein. Die Kranke wandte den Kopf nach ihnen um; als sie aber ihre Neugier bemerkte, runzelte sie die Stirn und wandte sich wieder ab.
»Gott der Gerechte!« sagte die Tochter des Stationsaufsehers, hastig den Kopf wegwendend. »Was war sie doch für eine Schönheit, und was ist aus ihr geworden! Es ist sogar entsetzlich! Hast du sie gesehen, Aksjuscha, hast du sie gesehen?«
»Ja, so mager ist sie!« bestätigte Aksjuscha. »Wir wollen noch einmal vorübergehen, als ob wir zum Brunnen gingen. Siehst du, sie hat sich weggewandt, aber ich konnte sie noch sehen. Sie tut mir so leid, Mascha!«
»Und wie schmutzig es ist!« entgegnete Mascha, und beide liefen zum Tore zurück.
Die Kranke dachte: ›Ich muß wohl wirklich grauenhaft aussehen! Wenn ich nur so schnell wie möglich ins Ausland kommen könnte! Dort werde ich mich bald erholen.‹
»Nun, wie geht es dir, meine Liebe?« fragte der Gatte, der wieder zur Kutsche kam. Er hatte noch einen Bissen im Munde.
›Immer dieselbe Frage!‹ dachte die Kranke; ›und er selbst ißt!‹
»Es geht,« murmelte sie durch die Zähne.
»Weißt du, meine Liebe, ich fürchte, die Reise wird dir bei diesem Wetter nicht gut tun; auch Eduard Iwanowitsch ist derselben Ansicht. Wollen wir nicht lieber umkehren?«
Sie schwieg ärgerlich.
»Das Wetter wird ja einmal besser werden, wir werden Schlittenbahn bekommen; inzwischen kannst du dich ja auch erholen, dann könnten wir alle zusammen fahren.«
»Verzeih! Hätte ich auf dich schon früher nicht gehört, so wäre ich jetzt längst in Berlin und ganz gesund.«
»Was soll man tun, mein Engel? Du weißt ja selbst, daß es unmöglich war. Wenn du jetzt noch einen Monat warten wolltest, könntest du dich bedeutend erholen, ich würde auch mit meinen Geschäften fertig werden, und wir könnten auch die Kinder mitnehmen ...«
»Die Kinder sind gesund, und ich nicht.«
»Begreife doch, meine Liebe, bei diesem Wetter! Wenn unterwegs eine Verschlimmerung eintritt ... so ist man wenigstens zu Hause ...«
»Warum ists zu Hause besser? ... Meinst du, ich soll lieber zu Hause sterben?« antwortete die Kranke gereizt. Doch das Wort ›sterben‹ hatte sie offenbar erschreckt, und sie warf dem Gatten einen stehenden und fragenden Blick zu. Er schlug die Augen nieder und schwieg. Der Mund der Kranken verzerrte sich plötzlich wie bei einem Kinde, und Tränen stürzten ihr aus den Augen. Der Gatte bedeckte sein Gesicht mit dem Taschentuch und trat schweigend beiseite.
»Nein, ich will doch fahren!« sagte die Kranke, die Augen gen Himmel richtend. Sie faltete die Hände und begann unzusammenhängende Worte zu flüstern. »Mein Gott! Wofür?« murmelte sie, und die Tränen flossen noch unaufhaltsamer. Sie betete lange und inbrünstig, doch der Schmerz und das Gefühl von Beklemmung in ihrer Brust blieben unverändert, der Himmel, die Felder und die Straße blieben ebenso grau und trüb, und der herbstliche Nebel senkte sich immerzu gleichmäßig, ohne dichter oder durchsichtiger zu werden, auf den Straßenschmutz, auf die Dächer, die Kutsche und die Schafpelze der Kutscher, die unter lautem, vergnügtem Geplauder die Räder schmierten und die Pferde vorspannten...
2
Die Kutsche war angespannt, aber der Postillion ließ noch auf sich warten. Er war in die Kutscherstube gegangen. In der Stube war es heiß, dumpf, finster und schwül, es roch nach Ausdünstungen vieler Menschen, frisch gebackenem Brot, Kohl und Schafpelzen. Einige Fuhrknechte standen in der Stube herum, am Ofen machte sich die Köchin zu schaffen, und auf dem Ofen lag auf mehreren Schaffellen ein Kranker.
»Onkel Fjodor! He, Onkel Fjodor!« sagte der junge Postillion, der im Schafpelz, mit der Peitsche im Gürtel in die Stube trat und sich dem Kranken zuwendete.
»Was willst du vom Fjodor, du Taugenichts?« rief einer der Fuhrknechte. »Du weißt ja, daß man auf dich dort bei der Kutsche wartet.«
»Ich will ihn um seine Stiefel bitten; meine sind zerrissen«, erwiderte der Bursche, indem er das Haar zurückwarf und an den Handschuhen, die im Gürtel steckten, nestelte. »Schläft er gar? He, Onkel Fjodor!« wiederholte er, zum Ofen tretend.
»Was gibts? « fragte eine schwache Stimme, und ein ausgemergeltes, rotbärtiges Gesicht beugte sich über den Ofenrand. Eine große, hagere, bleiche, behaarte Hand bemühte sich, den Pelz über die eckige Schulter zu ziehen, die von einem schmutzigen Hemd bedeckt war. »Gib mir zu trinken, Bruder ... Was willst du?«
Der Bursche reichte ihm den Wasserkrug.
»Weißt du, Fedja,« sagte er verlegen, »weißt du, du brauchst wohl deine neuen Stiefel nicht mehr; gib sie mir, du wirst sie doch wohl nie tragen.«
Der Kranke senkte den müden Kopf zum glasierten Tonkruge, tauchte den dünnen herabhängenden Schnurrbart in das dunkle Wasser und trank in schwachen, doch gierigen Zügen. Sein wirrer Bart war unsauber, und die eingefallenen trüben Augen blickten mit Mühe auf den Burschen. Nachdem er getrunken hatte, wollte er die Hand heben, um die feuchten Lippen abzuwischen, doch er hatte nicht die Kraft dazu und wischte sich den Mund am Ärmel seines Filzmantels ab. Er blickte schweigend und schwer durch die Nase atmend dem Burschen in die Augen und schien alle seine Kräfte zu sammeln.
»Hast du sie vielleicht schon jemand versprochen?« fuhr der Postillion fort. »Das wäre schade. Denn siehst du: draußen ist es naß, und ich muß fahren. Da dachte ich mir: ich will halt den Fedja um seine Stiefel bitten, er braucht sie wohl nicht mehr. Vielleicht brauchst du sie doch, sag es nur...«
In der Brust des Kranken begann es zu kollern und zu röcheln; er beugte sich vor, ein dumpfer Hustenanfall, der nicht recht zum Ausbruch kommen wollte, würgte ihn.
»Wozu soll er denn noch die Stiefel brauchen?« begann plötzlich die Köchin mit keifender Stimme durch das ganze Zimmer zu schnattern. »Schon den zweiten Monat kommt er nicht vom Ofen herunter. Du hörst doch, wie er hustet! Es tut mir auch selbst in der Lunge weh, wenn ich es nur mit anhöre. Was soll er noch mit den Stiefeln anfangen? In neuen Stiefeln wird man ihn doch nicht begraben! Es wäre aber schon längst Zeit, Gott verzeihe mir die Sünde! Du hörst doch, wie er sich quält! Man sollte ihn in eine andere Stube bringen oder sonstwohin! In der Stadt soll es Krankenhäuser für solche Leute geben. Hier hat er aber eine ganze Ecke eingenommen und rührt sich nicht vom Fleck; darf denn das sein? Er nimmt nur den andern den ganzen Raum weg. Und da verlangt man von mir auch noch Sauberkeit!«
»He, Serjoga! Geh auf deinen Posten, die Herrschaften warten!« rief der Oberpostillion durch die Tür herein.
Serjoga wollte schon gehen, ohne die Antwort abzuwarten, doch der Kranke gab ihm während des Hustenanfalls mit den Augen zu verstehen, daß er antworten wolle.
»Nimm dir die Stiefel, Serjoga«, sagte er, als er den Husten unterdrückt und ein wenig ausgeruht hatte. »Doch hör, einen Stein sollst du mir kaufen, wenn ich einmal tot bin,« fügte er heiser hinzu.
»Danke, Onkel, ich nehme also die Stiefel, und den Stein werde ich dir, so wahr Gott lebt, kaufen.«
»Ihr habt es gehört, Kinder,« konnte der Kranke noch sagen. Dann beugte er sich wieder zurück und bekam einen neuen Hustenanfall.
»Ist schon recht, wir haben es gehört,« bestätigte einer von den Kutschern. »Geh doch hin, Serjoga, auf deinen Bock, da kommt schon wieder der Ober gelaufen. Du hast doch die kranke Gutsfrau von Schirkino zu fahren.«
Serjoga warf schnell seine zerrissenen, ihm viel zu großen Stiefel ab und schleuderte sie unter die Bank. Die neuen Stiefel Fjodors paßten ihm ausgezeichnet. Während er zur Kutsche ging, bewunderte er sie an seinen Beinen.
»Das nenn ich Stiefel! Komm, ich will sie dir schmieren,« sagte ein Kutscher, der mit dem Teerpinsel in derHand vor der Kutsche stand, während Serjoga auf den Bock kletterte und die Zügel in die Hand nahm. »Hat er sie dir umsonst gegeben? «
»Bist du vielleicht neidisch?« entgegnete Serjoga,indem er sich erhob und die Schöße des Mantels an den Beinen zurücklegte.
»Laß mich in Ruhe! Los, meine Lieben!« rief er den Pferden zu, holte mit der Peitsche aus, und beide Wagen mit ihren Insassen, Koffern und Reisetaschen rollten schnell über die nasse Landstraße dahin und verschwanden im grauen Herbstnebel.
Der kranke Kutscher war in der dumpfen Stube auf dem Ofen liegen geblieben. Es gelang ihm nicht, sich ordentlich auszuhusten; schließlich drehte er sich mit großer Mühe auf die andere Seite und wurde still.
In der Kutscherstube war bis zum Abend ein Kommen und Gehen, man aß zu Mittag – den Kranken hörte man nicht. Vor Nacht kroch die Köchin auf den Ofen, beugte sich über seine Füße hinüber und holte sich einen Schafpelz.
»Sei mir nicht böse, Nastassja!« sagte der Kranke. »Ich werde dir bald deinen Ofen räumen.«
»Es ist schon gut, ich hab ja nichts gesagt,« murmelte Nastassja. »Was tut dir weh, Onkel? Sags doch!«
»Das ganze Innere tut mir weh. Gott weiß, was das ist!«
»Dir tut wohl auch die Kehle weh, wenn du hustest?«
»Alles tut mir weh. Mein Tod ist gekommen, das ist es. Ach, ach, ach!« stöhnte der Kranke.
»Du mußt dir die Beine so zudecken,« sagte Nastassja, indem sie vom Ofen kletterte und dabei dem Kranken den Mantel über die Beine zog.
Nachts brannte in der Stube ein schwaches Nachtlicht. Nastassja und etwa zehn Fuhrknechte schnarchten auf dem Fußboden und auf den Bänken. Der Kranke allein schlief nicht: er röchelte schwach, hustete und wälzte sich hin und her. Gegen Morgen wurde er ganz still.