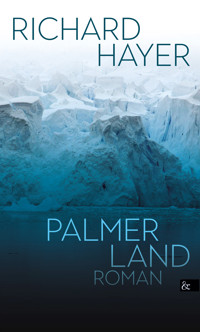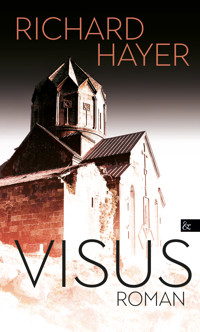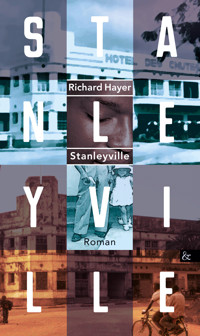Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Buch&media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
In einer maroden Villa aus dem 19. Jahrhundert baut eine Produktionsgesellschaft am Ufer des Berliner Müggelsees das Set für einen Spielfilm auf. »Obedience and Amnesia « wird eine im Hollywoodformat erzählte Geschichte über das Berlin am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Die Besitzerin der Villa, Ellen Koffka (36), ist 1991 aus dem sowjetischen Usbekistan geflüchtet und zwei Jahre später mit ihrer deutschen Mutter aus Moskau übergesiedelt. Seit dem traumatischen Ende ihrer Kindheit beim Zusammenbruch der Sowjetunion ist sie von dem Gefühl besessen, dass ihr Schicksal von undurchschaubaren Mächten der Weltpolitik bestimmt wird. Inzwischen forscht sie als Astrophysikerin in Potsdam. Von einer Vortragsreise zurückgekehrt, findet sie sich in einem Cinemascope-Traum wieder: eine strahlend weiße Villa, getrimmter Rollrasen, ein zum Leben erweckter Springbrunnen. Kameras werden umhergerollt, schwere Lkws parken auf der Straße davor, Menschen in Kostümen der Dreißigerjahre und Techniker mit Klemmbrettern in der Hand laufen geschäftig umher. Doch etwas stimmt nicht mit dem vermeintlichen Filmset. Als sie in der Umgebung betäubte Vögel herumliegen sieht, steigt Ellen nachts in die für sie verschlossene Villa ein – und traut ihren Augen nicht. Sie ist umgeben von dem perfekten Replikat des Hauses aus dem Jahr 1933. Soll hier wirklich ein Film gedreht werden? Sie ahnt, dass sich eine tödliche Katastrophe unfassbaren Ausmaßes ankündigt. Aus dem Fundus der Filmproduktion kleidet sie sich in ein türkisfarbenes Abendkleid und mischt sich unter die Akteure im Haus ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 705
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
OriginalausgabeNovember 2023© 2022 Buch&media GmbH, München© am Text liegen beim AutorLayout und Satz: Mona KönigbauerUmschlaggestaltung: Maja BechertGesetzt aus der Sabon LT ProPrinted in EuropeISBN print 978-3-95780-266-8ISBN epub 978-3-95780-268-2ISBN PDF 978-3-95780-269-9
Buch&media GmbHMerianstraße 24 · 80637 MünchenFon 089 13 92 90 46 · Fax 089 13 92 90 65
Weitere Publikationen aus unserem Programm finden Sie aufwww.buchmedia-publishing.deKontakt und Bestellungen unter [email protected]
Weitere Informationen zum Autor finden Sie auf:www.richard-hayer.de
Fern, fern geht die Weltgeschichte vor sich, dieWeltgeschichte deiner Seele.
Franz Kafka
Prolog
Muynak, Usbekistan; 25. September 1991
»Lenotschka«, flüsterte ihr Vater. »Wir müssen los.«
Erst als er das Zimmer bereits verlassen hatte, schaffte sie es, sich Schritt für Schritt in Richtung der Tür zu bewegen. In der Luft schwebte der Duft ihres warmen Bettes, durch das Fenster fiel das kalte Licht eines halbierten Mondes. Von einem Stuhl zog sie die am gestrigen Abend von ihrem Vater bereitgelegten Kleidungsstücke, ihr flauschiges weißes Lieblingshemd für die kalte Jahreszeit, einen grauen Pullover und dunkelblaue Hosen. Vom Haken an der Zimmerseite der Tür hob sie eine hellblaue gefütterte Jacke, die sie offen stehen ließ. Das Nachthemd warf sie auf das aufgeschlagene Bett.
Ihr Zimmer unter dem Dach des zweistöckigen Hauses, das ganze Haus, die ganze Stadt würde für immer aus ihrem Leben verschwinden, ahnte sie. In einem spontanen Impuls griff sie kurz vor der Tür zur Treppe den alten Spielzeugfisch aus kariertem Stoff, in dessen zugeknöpftem Bauch etwas Schweres steckte, und stopfte ihn zu den zwei Büchern und dem anderen Krimskrams in die Tasche, die ihre Großmutter aus gelbem Stoff für sie genäht hatte.
Sie bewegte sich, wie von etwas gesteuert, das nicht sie selbst war, ausgehöhlt von dem Gefühl, sich von allem, was sie im Leben kannte, trennen zu müssen. Außer von ihrem Vater, ihm würde sie überallhin folgen und sich dafür von allem trennen, genau, wie es jetzt von ihr gefordert wurde.
Sie hob die Tasche an. Was da schwer im Bauch des alten Fisches lag, würde sie allerdings niemals aus der Hand geben. Jetzt, wo alles auseinanderbrach, erst recht nicht.
Durch die Fenster erkannte sie den hellgrünen Wolga, in dem ihr Vater geduldig auf der Straße vor dem Haus wartete. Er war immer geduldig, egal, wie spät sie kam, egal, wie versunken sie in sich selbst die Anforderungen ihrer Umwelt ignorierte, Mikhail, ihr Vater, blieb geduldig wie ein Fels.
Jetzt stieg er aus dem Auto in den Wind der späten Septembernacht und winkte, sie solle sich beeilen. Auf dem Weg nach unten lief Jelena durch sein Zimmer, das nach Büchern und Zigarettenrauch roch. Im Zimmer der Großmutter im Erdgeschoss hing der ewige Geruch von gekochtem Gemüse und kalter Asche im Ofen.
Für einen Moment blieb sie in der Türöffnung stehen. Das Haus stand da wie immer, unter der Platane, die in dem sandigen Wind ihre letzten Blätter von sich schüttelte. Es war warm in dem Haus, es roch genauso wie immer und doch war alles so endgültig anders, dass sie für einen Moment in der Eingangstür in die Knie ging. Sie wusste, dass ihr Vater sie aus dem Auto beobachtete, sie war müde, ihre Augen brannten. Sie hockte im Eingang und tat so, als müsse sie sich die Schnürsenkel zubinden. Sie atmete tief ein. Der Sand, den der Wind aus nordwestlicher Richtung in die Stadt wehte, knirschte zwischen ihren Zähnen.
Was sie ihr ganzes Leben lang für untrennbar voneinander gehalten hatte, trennte sich nun. Ihr Zimmer, das Haus, die Großmutter, ihr Vater, sie selbst, traf sie die Erkenntnis wie ein Blitz, alle und alles trennten sich jetzt voneinander, wurden zu einem Schwarm verschiedener Dinge, die von diesem Moment an in verschiedene Richtungen taumelten.
Ihr Vater langte über die Lehne des Fahrersitzes zurück, um die hintere Tür zu öffnen. Jelena stieg ein. Sie kuschelte sich in die bereitliegende Decke, ihre Tasche fest umklammert.
Als der Wolga die Ulitsa Chalkabad hinunterfuhr, warf sie einen Blick auf das Haus. Sie war sicher, dass sich alles, der Aufbruch, der Abschied von der Schule, von der Stadt, von dem eingeübten Zusammenspiel aller Menschen, die ihr wichtig waren, letztlich als ein vorübergehender Irrtum herausstellen würde. Mit dem Gedanken, dass dann immer noch Zeit genug sein würde, ihr Bett zu machen und ihr Zimmer aufzuräumen, schlief sie ein, kurz nachdem sich das Auto in Bewegung gesetzt hatte.
Es donnerte, sie saß allein in dem Wolga. Das Auto klapperte, aber es bewegte sich nicht. Wolken tobten über den Himmel, um den halbierten Mond und um etwas Anderes, Dunkles, das unförmig groß war wie ein Haus, das sich aber im Himmel dazwischen schob. Vier grelle Scheinwerfer stachen von der riesigen Maschine mit nicht endenden Tragflächen in das Dunkel, aus dem die Wolken anrollten. Ein betäubender Donner krachte über ihr hin, als wäre die Hölle aus der Erde gekrochen, um sich in den Himmel zu stürzen. Sie kam sich vor, als wäre sie es, die alles mit ihrem Blick in Lärm und schwerfällige Bewegung verwandelte. Zuerst war die Maschine direkt über ihr, dann war sie in den Wolken verschwunden, in denen ihre Scheinwerfer wie die Glut erlöschender Zigaretten noch eine Weile glommen, bis auch die verschwunden waren.
Mit einem Zipfel ihrer Decke wischte Jelena ihren kondensierten Atem von der Scheibe, um genauer sehen zu können. Es war kalt in dem Auto, es musste schon eine ganze Weile her sein, dass sie angekommen waren. Einige Regentropfen setzten sich von außen an die Scheiben.
Es regnete sehr selten im September in der Wüste, aber was war in diesen Wochen schon normal, in denen die Leute in der Schule und sogar auf der Straße sich gegenseitig spontan fragten, ob alle verrückt geworden waren. Etwas Großes war zerbrochen, neue Leute tauchten plötzlich in der Schule auf und waren wichtig. Der Direktor und ihre Klassenlehrerin waren von einem Tag auf den anderen verschwunden, Pionierfeiern wurden abgesagt, Kindergeburtstage feierte jeder für sich allein, dumme und dreiste Mitschüler gerieten außer Rand und Band, weil niemand sie mehr zur Ordnung rief.
Gestern hatten sie Großmutter Olga zum Bahnhof gebracht, weil Mikhail darauf bestanden hatte, dass seine Mutter den letzten Zug nach Moskau erwischt.
»Alle haben den Verstand verloren«, hatte die Fahrkartenverkäuferin im Bahnhof erklärt. »Ab morgen fährt der Zug plötzlich alle naslang durch ein anderes Ausland.« Das hatte sie immer wieder gehört. Alle sind verrückt geworden!
Ihr Vater hatte ihr erklärt, dass heute Nacht von Muynak, einem Kaff am Rand der Wüste, die vor ein paar Jahren noch von einem Meer bedeckt gewesen war, ein Flugzeug sie und seine Arbeitskollegen nach Moskau bringen würde. Dann wollten sie zu ihrer Oma fahren, die dort zwei kleine Zimmer bewohnte.
»Dann werden wir alle wieder beisammen sein«, hatte ihr Vater erklärt.
Jetzt war sie allein.
Es roch nach Benzin, die Türen des Autos waren verschlossen, sie musste die Fenster geschlossen halten, wenn sie nicht nass werden wollte. Sie musste sie abwischen, wenn sie sehen wollte, was draußen vor sich ging.
Mit einem Zipfel der Decke hielt sie eine handtellergroße Fläche der Scheibe einigermaßen frei, sodass sie wie durch einen Tunnel in eine Richtung hinausblicken konnte. Sie blickte in die finstere Ruinenlandschaft der alten Konservenfabrik, was offenbar die falsche Richtung war. Sie musste sich hinüber auf die andere Seite bewegen und wischte dort einen Teil der Scheibe frei. Auf dieser Seite erstreckte sich vor ihr ein Flugfeld, auf dem häuserblockgroße Flugzeuge standen, die ihre hinteren Laderampen aufgesperrt hielten wie die Mäuler urzeitlicher Meeresungeheuer. Riesige Zugmaschinen bugsierten ihre unter flatternden Planen verborgenen Anhänger hinein und rauschten in Staub und Regen davon, sobald sie aus den Bäuchen der Flugzeuge wieder auftauchten. Jelena legte die Stirn an die Scheibe und ihre Augen nah an das Glas, um mehr zu erkennen. Wie ein kleiner Schwarm verlorener Vögel wanderte ein Häuflein von Menschen zwischen den haushohen Fliegern umher.
Der halbierte Mond erkämpfte sich einen freien Platz zwischen den Wolken, der Regen ließ nach, der Wind frischte auf. Rollende Sträucher tobten aus der Wüste heran. Sie kamen ihr vor wie die letzten verspäteten Passagiere, die übereinander stürzten, um noch einen Platz an Bord zu ergattern. Männer, die aus den Flugzeugen stiegen, schickten die Gruppe, in der sie auch ihren Vater vermutete, immer wieder in eine andere Richtung.
War ihr Vater der Mann links vorn, der mit einem Uniformierten mit Klemmbrett voller Papiere in der Hand redete? War er der Mann ohne Mütze? Es musste kalt dort draußen sein, mindestens so kalt wie hier in der Blechkiste, in der sie wartete.
»Du bleibst im Auto«, hatte er ihr am Abend vorher eingeschärft, »du öffnest die Fenster nicht, auf gar keinen Fall! Du wartest, bis ich dich hole und an Bord des Fliegers bringe. Hab keine Angst, es kann dauern, aber ich werde kommen. Was immer geschieht, ich werde kommen!«
Ihr Vertrauen in ihren Vater war größer als ihr Zuhause, größer als alle diese Flieger zusammen, vielleicht war es größer als ihr ganzes Leben. Es gab keinen Zweifel, bevor es losging, würde er sie holen und sie würden in Moskau ihre Großmutter treffen.
Eine zweite Maschine klappte ihr Lademaul zu, während sie sich in Bewegung setzte. Als sie die Rollbahn erreichte, schaltete sie die Scheinwerfer ein: Mit ohrenbetäubendem Lärm in der Luft und mit begleitendem Geklapper und Gerassel des Wolga erhob sich die Maschine in die Luft. Das Häuflein der Wartenden war nicht kleiner geworden, weil niemand an Bord gestiegen war. Sie bewegten sich weiter in ihre Richtung.
Am Rand der Gruppe fiel ihr ein Junge auf, der sich inmitten der spürbar zunehmenden Unruhe auf den nassen Beton des Flugfeldes kniete und sich in aller Seelenruhe die Schnürsenkel seiner festen Schuhe löste. Auf der Suche nach ihrem Vater verlor sie ihn für einen Moment aus den Augen. Dann entdeckte sie ihn wieder. Er kniete noch immer, zog seine Schuhe vollkommen aus und auch seine Strümpfe. Niemand der Umstehenden nahm davon Notiz. Schließlich stand er mit nackten Füßen auf dem eiskalten Betonboden. Als wollte wenigstens die Natur Einspruch erheben, rollten Gebüschfetzen heran, die er aber seelenruhig ignorierte. Er zog seine Jacke aus, warf seine Mütze von sich und seinen Schal.
Jelena glaubte ihn zu kennen, Bojan, ein stiller großer Junge aus der zehnten Klasse, den einige kannten, weil er gelegentlich Kostproben seines Klavierspiels gegeben hatte. Sie versuchte, die Türen des Autos zu öffnen, vergeblich, aber sie konnte aus dem Fenster klettern. Jemand muss ihn aufhalten, dachte sie mit zunehmender Panik.
Die Kurbeln sämtlicher Fenster waren abmontiert. Es war unfassbar grausam, was sie mitansehen musste. Sie schlug die Hände vor die Augen, aber immer wieder linste sie durch die Finger. Was geschah dort draußen, wo war ihr Vater?
Als der Junge seine gesamte Kleidung von sich geworfen hatte, lief er vollkommen nackt gegen den Sturm ans Ende der Rollbahn und darüber hinaus. Seine weiße Gestalt verlor sich im scharfkantigen Geröll und dem Gestrüpp der Wüste, das ihn nach wenigen Metern zerfetzen musste. Gnadenlos beleuchtete der halbe Mond die Szenerie, als würde er direkt ins Innere der Hölle leuchten.
Weitere Männer und Frauen und einige Kinder zogen sich aus und liefen als weiche weiße Gespenster wie von Furien gejagt in die fleischfressende Dunkelheit.
Ein dick vermummtes Mädchen hielt plötzlich ein Messer in der Hand. Einer nach dem anderen aus dem Haufen der Wartenden fiel zu Boden. Jelena konnte nicht erkennen, was genau mit jedem von ihnen geschah, nur eins war sicher, jeder stand für sich allein und brachte sich selbst den Tod.
Längst hatte sie es aufgegeben, nach draußen rennen zu wollen. Sie hatte schreiende Angst, sie biss sich auf die Hände, bis sie das Blut schmeckte. Sie wickelte ihren Kopf in die Decke, um keinen einzigen Regentropfen mehr zu sehen, die dort draußen im immer stärker gewordenen Sturm durch die Luft flogen. Sie bekam kaum noch genug Luft zum Atmen, geschweige denn zum Weinen und Schreien, als wäre sie selbst auf dem Weg in die Steinsplitter der Wüste. Jetzt, nach langer Qual, nach dem Gefühl, in die Hölle geraten zu sein, zweifelte sie zum ersten Mal an ihrem Vater. Noch befestigte sein felsenfestes Versprechen ihr Herz, noch wollte sie glauben, dass alles, was dort draußen ablief, von ihm berücksichtigt worden war, als er sein Versprechen gab. Aber wo war er dort draußen? Sie musste es über sich bringen, wieder hinauszusehen, es musste sein, so schrecklich es war. Egal, was es war, er hatte sie niemals vergessen.
Die dritte Maschine hob sich in die Luft gegen den tobenden Sturm. Als ihre Scheinwerfer im Sturm und Regen und Staub und Unwetter verglüht waren, rollte die letzte Maschine an die Startbahn. Bald gab es keinen Menschen mehr, der auf dem Flugfeld stand. Viele waren in der Dunkelheit verschwunden, viele lagen unbeweglich unter den Strauchfetzen.
Eine Gestalt im wehenden Mantel lief in Richtung des Autos, in dem sie saß. Jelena bemühte sich, die Scheibe so blank zu wischen, wie es nur irgend ging. Sämtliche Scheiben waren von Tränen und Atem und Angst beschlagen, die Feuchtigkeit tropfte herab. Sie wischte eine winzige Fläche klar und legte ihre Augen daran wie an ein Schlüsselloch. Die Gestalt lief, taumelte, fing sich wieder, kam näher.
Vater!
Sie drückte das ganze Gesicht an die Scheibe. Er musste sie doch sehen. Er lief an dem Wolga vorbei.
Die Heckscheibe!
Ehe sie etwas freigewischt hatte, durch das sie sehen konnte, war das Blickfeld leer. Die Scheibe auf der anderen Seite, die den Blick in das Gebüsch am Rand des kleinen Flughafengebäudes und in die Ruinen der alten Fischkonserven-Fabrik freigab! Nichts, auch die war leer!
So fest es ging, wickelte sie sich in die Decke auf der Rückbank. Noch jetzt sah sie sein angsterfülltes, weißes Gesicht vor sich. Niemals in ihrem ganzen Leben hatte sie ihn so gesehen, so voller Angst, so gehetzt, als hätte ihn die Hölle ausgespuckt.
Die Hölle hat ihn ausgespuckt, dachte sie. Sie verkroch sich in sich selbst. Was soll nun geschehen? Wohin war er gelaufen? Wollte er Hilfe holen, wovor war er auf der Flucht?
Die Maschinen waren durch die Luft auf und davon. Sie war allein in der Wüste, in einem abgeschlossenen Auto, zu dem nur ihr Vater den Schlüssel besaß, und der war verschwunden. Was sollte in den nächsten Minuten geschehen, und was in den nächsten Stunden? Sie wagte nicht, an die nächsten Tage und Wochen zu denken, während sie sich auf die Lippen und die Zunge biss, um keine einzige Sekunde von dem zu verpassen, was geschah. Sie hatte das Gefühl, mit dem Schließen ihrer Augen würde sie in die dunkelsten Abgründe der Hölle gezogen.
Irgendwann musste sie doch eingeschlafen sein. Im Mund spürte sie den Geschmack von Blut, als die Wagentür auf der Fahrerseite geöffnet wurde. Etwas in ihrem Bauch riet ihr, sich weiter schlafend zu stellen. Geruch nach Blut und nassem Fell füllte das Innere des Wagens. Sie linste durch die Falten der Decke, die sie um ihren Kopf gewickelt hatte.
Wer ist das, schoss es ihr durch den Kopf. Nicht ihr Vater hatte den Wagen geöffnet, aber nur ihr Vater hatte den Schlüssel gehabt.
Was geschieht hier?
Im weiten Bogen warf der Mann ein blutiges Taschenmesser in Richtung der Ruinen der alten Fischkonservenfabrik und ließ sich dann in den Fahrersitz fallen. Blut hämmerte in jedem Teil ihres Körpers. Noch stellte sie sich schlafend, dabei wusste sie nicht einmal, ob der Mann sie überhaupt bemerkt hatte.
Vor ihr sah sie einen Rücken, der in einen nassen Fellmantel gehüllt war. Noch hatte er sich nicht in die richtige Position gebracht, um sie im Rückspiegel betrachten zu können, der Schlüssel steckte bereits im Zündschloss. Jetzt war das Auto entriegelt, das war der große Unterschied: Egal, was dort draußen geschah, ihre Bewegungsfreiheit war zurück. Für einen Moment jedenfalls. Wenn das Auto losfuhr, würden auch die Türen wieder verschlossen sein. Das hieß, sie musste sofort handeln.
Sie wickelte sich aus der Decke. Ihre suchende Hand bewegte sich durch die gelbe Stofftasche und tastete im Innern des karierten Kinderfisches herum, bis sie in einem dichten Filzstoff hängen blieb. Langsam zog sie ihre alte schwarze Kappe hervor und setzte sie auf. Draußen war es stürmisch und kalt und sie konnte nicht ausschließen, dass die feinen Regentropfen bald wieder durch die Gegend flogen. Sie wusste nicht, wohin sie ohne das Auto eigentlich sollte und wie lange der Weg ins Nichts dann dauern würde. Von dem, was da draußen geschehen war und was noch geschehen sollte, wusste sie ebenso überhaupt nichts.
Wie von einer Feder getrieben schnellte sie nach vorn.
Den Zündschlüssel in der Hand, ließ sie sich aus der hinteren Tür fallen, rappelte sich auf und lief weit weg durch den Sturm, in dem sich Sand und Gestrüpp miteinander verflochten. Weit vor dem Auto stellte sie sich unter das Dach einer verfallenen Laderampe, den Schlüssel in der rechten Hand hochgestreckt.
»Wo ist mein Vater?«, rief sie so laut sie konnte. Es war nicht laut, im Sturm war es kaum zu hören. Der Mann im Fellmantel stieg aus dem Auto und kam näher. Jeden Schritt, den er auf sie zuging, beantwortete sie mit einem Schritt, mit dem sie sich weiter entfernte. Nach einiger Zeit hatte er das Spiel durchschaut und blieb stehen.
Seit die Flugzeuge auf und davon waren, seit Totenstille auf dem Flugfeld herrschte, hatte sich der Mond endgültig hinter die Wolken verzogen, als wäre er nur ein Köder gewesen, den jemand an den Himmel gehängt hatte, um die Wartenden anzulocken. Jetzt herrschte Finsternis. In dem kleinen Flughafengebäude gab es eine einzige taumelnde Glühbirne, die durch alles Chaos hindurch weiter geleuchtet hatte und nun einen nebligen, schwankenden Schein auf ihre Umgebung warf. Der Mann im Fellmantel wartete. Jelena bemühte sich, sein Gesicht zu erkennen, aber zwischen Fellmütze und dem Kragen des Fellmantels war nicht viel zu sehen. Er stand dort auf der Hälfte des Weges zwischen ihr und dem Wolga. Wenn er darauf gesetzt hatte, mit dem herrenlosen Wagen davonzukommen, hatte er jetzt ein Problem.
Dasselbe Problem wie ich, dachte sie.
»Wo ist mein Vater?«, rief sie immer und immer wieder. »Nicht ohne ihn!«
Ihre Stimme war heiser vor Angst und Erschöpfung. Als die feinen Regentropfen wieder waagerecht durch die Luft flogen, kehrte er um und setzte sich zurück ins Auto. Die regenabgewandte rückwärtige Tür ließ er offen stehen.
Jelena zog sich unter das Vordach der alten Rampe zurück, wo sie vor Regen und Sturm einigermaßen geschützt war. Sie hatte einen Plan, sie zog sich die alte schwarze Kinderkappe fest über den Kopf und hüpfte mit den Armen schlagend auf und ab. Sie musste warten, bis es heller wurde.
Zwei Stunden später würde die Morgendämmerung anbrechen. Jelena war außer Atem, sie legte nur wenige Pausen ein. Sobald der Regen aufhörte, drehte sie Runden um das kleine Flughafengebäude, wenn es wieder regnete, hüpfte sie flügelschlagend weiter unter dem Verladedach für Fischkonserven.
Als der Regen nachgelassen hatte, verließ der Mann für einen kurzen Ausflug auf das Flugfeld das Auto, genauestens von ihr beobachtet. Unschlüssig nahm er verschiedene verstreute Gegenstände auf dem Flugfeld in die Hand und warf sie wieder weg, schließlich hob er einen aufgeplatzten Aktenkoffer auf. Zurück im Wolga legte er sich den Koffer auf den Schoß, öffnete ihn und entnahm ein Blatt Papier nach dem anderen. Es war eine seltsame, beunruhigende, entrückte Szene, die sich ihr bot. Wie im Sekundentakt einer Uhr warf der Mann jedes einzelne Blatt in den Wind, der es in den frühen Morgen über der Wüste wirbelte. So ging es weiter in einem sinnlosen Takt des Wartens, als würde er mit den Fingern auf das Lenkrad des Wagens trommeln.
Jelena musste etwas erledigen, bevor sie zurück ins Auto steigen durfte. Für alle Fälle hatte sie einen handgroßen, messerscharfen Metallsplitter aus einem Schutthaufen in den Ruinen geborgen, den sie nun, in eine dicke Plastikfolie gewickelt, in ihrer Jacke trug. Für den anderen Teil ihres Planes musste sie allen Mut zusammennehmen, den sie noch in sich fand, und sie war erstaunt, wie viel Mut und Kraft noch in ihr steckte. Es war, als hätte sie die Fähigkeit, auf dem ansteigenden Berg des Schreckens immer höher und höher zu klettern. Je größer der Schrecken, desto höher der Berg, desto weiter der Abstand, aus dem sie alles sah. Sie hatte das Gefühl, sich inzwischen fast so hoch wie der unsichtbare Mond zu befinden. Das, was da unten an Schrecken herrschte, war nicht ihr Leben, es war etwas anderes, eine fremde furchtbare Welt, in der sie jetzt gerade gelandet war. Aber sie musste hinunter. Es gab etwas Wichtiges dort unten zu tun.
Sie sprang von der Rampe und lief hinaus auf die Rollbahn.
Im ersten Licht des Morgens, aber noch lange vor dem Sonnenaufgang, breitete sich vor ihr ein Schlachtfeld aus. Mit jedem Schritt, den sie voranging, entdeckte sie weitere reglos auf dem Betonfeld umherliegende Menschen. Einige bedeckt von den rollenden Gebüschen, an denen sich Papiere aus aufgeplatzten Koffern festgesetzt hatten, einige in dunklen Lachen, die sich um sie ausgebreitet hatten wie verlorene Kleidung, einige auf dem Bauch, andere auf dem Rücken. Einige hatten es wenige Meter tief in die Wüste geschafft, von anderen war nur noch in Gebüschen verhakte Kleidung übrig geblieben. Es half nichts, sie musste sich jedes einzelne Gesicht ansehen und jedes herrenlose Kleidungsstück. Jetzt war die Zeit, nach ihrem Vater zu suchen.
Auf ihrem Weg zwischen den Toten kam sie sich so klein und zugleich so versteinert vor wie noch nie in ihrem Leben. Alles, was gewärmt hatte, war von ihr abgefallen, alles, was ganz gewesen war, war auseinandergerissen, einige der Toten kannte sie von gemeinsamen Feiern mit der Schule oder dem Institut ihres Vaters. Noch nie hatte sie einen Toten gesehen, jetzt war sie von Leichen umgeben. Einige musste sie auf den Rücken drehen, weil sie sich unsicher war, bevor sie nicht das Gesicht gesehen hatte. Bei den meisten reichte ein Blick. Um die Leichen mit zerschmetterten Köpfen machte sie einen großen Bogen. Über ihr segelten noch immer die einzelnen Papiere im Wind, die der Mann im Auto weiter in maschinenhaftem Takt in die Luft warf. Wie bei einer Ernte zog sie ihre Bahnen, um keinen zu übersehen, hin, wenden, zurück, wenden, wieder hin. Sie schritt das ganze Betonfeld ab. Zuletzt verfolgte sie den Weg, den ihr Vater in Richtung des Wolga gelaufen war. Der Weg verlor sich ohne eine Spur von ihm in den Tiefen des verfallenen Areals der Fischkonservenfabrik.
Einen letzten Blick musste sie noch auf eine besondere Stelle werfen, wozu sie sich dem Auto weiter näherte. Wie eingeschlafen saß der Mann im Fellmantel hinter dem Lenkrad, er bewegte sich nicht, er sah ihr nicht nach, er saß einfach dort.
Unter einem Gestrüpp in den Ruinen fand sie das Messer, das der Mann im Fellmantel von sich geworfen hatte. An der Kogge über gekreuzten Ankern, dem eingepressten Wappen der Stadt Leningrad, erkannte sie das Taschenmesser ihres Vaters. Sie warf den aufbewahrten scharfen Metallsplitter von sich und steckte das abgewischte Messer zusammengeklappt ein.
Der Mann im Auto hatte ihren Vater auf dem Gewissen. Vielleicht hatte der sich geweigert, ihm das Auto zu übergeben.
Jetzt hat er es, und ich habe den Schlüssel, dachte sie. Um hier wegzukommen, brauchten beide einander.
Jelena zögerte.
Plötzlich fühlte sie sich schwächer als jemals zuvor in ihrem Leben. Dieser Mann in dem nach Tier und Nässe stinkenden Fellmantel hatte ihren Vater mit dessen eigenem Messer umgebracht, um an den Autoschlüssel zu gelangen und mit dem Auto zu verschwinden.
Wohin auch immer. Sicher nicht dorthin, wohin sie musste.
Aber wohin muss ich, fragte sie sich.
Obwohl es sinnlos war, reckte sie noch immer den Schlüssel in die Luft. Hier war der Schlüssel bei ihr. Sie fühlte sich plötzlich auf der Höhe ihrer Stärke. Dort war die einladend geöffnete Tür des Wolga. Auf der Rückbank erkannte sie die Decke, ihre Tasche und ihren alten Kinderfisch, ein winziges restliches Bruchstück ihrer Heimat. Vor allem aber war es eine Versuchung, umso mehr, als der Wind heftige Wellen von Regen herantrieb.
Hatte der Mann erst einmal den Schlüssel, könnte er tun, was er wollte. Mit der linken Hand drehte sie in der Tasche das zugeklappte, noch vom Blut ihres Vaters klebende Messer.
Ich werde hinter ihm mit einem Messer sitzen, dachte sie, und er weiß es nicht.
Der Mann sagte nichts, als sie einstieg. Er warf den leeren Aktenkoffer in Richtung des Flughafengebäudes und umrundete das Auto, um die hintere Tür von außen zuzuschlagen, während sie den Schlüssel zurück in das Zündschloss steckte.
Jetzt habe ich mich ausgeliefert.
Aber einen anderen Weg konnte sie nicht erkennen.
Ihre Tasche an sich gedrückt, wickelte sie sich auf der Rückbank in die Decke. Für einen Moment drehte er sich zu ihr um und zum ersten Mal erblickte sie sein Gesicht. Sie kannte ihn nicht, aber niemals in ihrem ganzen Leben würde sie dieses Gesicht vergessen. Unter dem rechten Auge lag ein großer Leberfleck, der ihr vorkam wie ein drittes Auge. Die nächste Zeit sah sie niemand anderen als ihn.
I
Bei der Rückkehr von längeren Reisen befürchtete Ellen stets, zu Hause nichts mehr so vorzufinden, wie sie es verlassen hatte. Diesmal wusste sie genau, dass es so war.
Sie reichte der Stewardess, die den Müll einsammelte, ihren leeren Kaffeebecher, als der Airbus A-320 aus London im Anflug auf Berlin-Schönefeld seine Reiseflughöhe verließ. In zwanzig Minuten würden sie pünktlich landen. Sie warf einen letzten Blick auf einen Ausschnitt ihres Vortrages in Boston, in dem sie über ihr Projekt am Astrophysikalischen Institut in Potsdam berichtet hatte. Mit jedem Kilometer, mit dem sich die Maschine Berlin weiter näherte, versank das Universum, aus dem sie von roten Zwergsternen berichtet hatte, immer weiter hinter der diesigen Atmosphäre des heißen Augusttages über der Stadt.
Ellen kannte Menschen, die bei der Abreise von Bügeleisen- oder Gasherdängsten gepeinigt wurden, bei ihr betraf die Angst die Ankunft und umfasste das ganze Haus. Es gelang ihr einfach nicht, der Beständigkeit eines festen Zuhauses über den Weg zu trauen. Auf ihrem aufgeklappten Mac sah sie sich Fotos an, die sie unmittelbar vor ihrer Abreise im Eiltempo vom Inneren und Äußeren ihrer Villa aufgenommen hatte.
Der Flugkapitän bat, die Tische hochzuklappen und die Sitzgurte wieder anzulegen. Die Stewardess weckte Ellens Sitznachbarn, von dem sie seit London im Wesentlichen zwei riesige rote Kopfhörermuscheln gesehen hatte und dessen langen, kompliziert zusammengefalteten Beinen sie immer wieder in die Quere gekommen war. Jetzt, als er die Kopfhörer abnahm, entpuppte er sich als ein Mitdreißiger mit dunklem Zweitagebart in einem wettergegerbten Gesicht.
Ellen vertiefte sich in die Betrachtung der Fotos ihrer neoklassizistischen Villa unter den hoch aufragenden Fichten. Wenn man genau hinsah, schimmerten die üppigen Rundungen der nackten Steinfiguren an der Fassade der östlichen Seite, die das erste Bild zeigte, grün vom Moosbewuchs. Sie blätterte zur Ansicht von der Westseite, auf der es von einer Terrasse und einem Erker im Erdgeschoss über eine ungepflegte Wiese zum Ufer des Müggelsees hinunterging. Während sie sich ihr Haus ansah, wunderte sie sich noch immer, wie sie es geschafft hatte, den Kasten in all den Jahren am Laufen zu halten.
Die Stewardess mahnte sie, den Laptop zu schließen, aber sie wollte unbedingt noch die Bilder aus dem Innern sehen. Seit der Zeit, als sie begonnen hatte, sich ernsthaft Gedanken um das Haus zu machen, wusste Ellen, dass es seit 1959 im Grundbuch auf ihre Mutter Kathryn Koffka eingetragen war. Und dass ihr Eigentumsanspruch an einem seidenen Faden hing.
Sie blätterte sich weiter durch die Aufnahmen: die Lateinamerika-Bibliothek im Erdgeschoss, dunkle Bücherrücken, denen man ihren Geruch nach Klebstoff und Staub ansehen konnte, der Lesesaal mit einem großen Tisch und acht mit grünem Kunstleder bezogenen Sesseln sowie einem Ohrensessel mit Blick aus dem Erker auf den See, ihr eigenes Zimmer im Obergeschoss, dem Terrassensalon, der in weißer Pracht glänzte und im Wesentlichen ihr gelb abgedecktes Bett enthielt.
Im Grunde verdankte das Haus seinen jetzigen heruntergekommenen Zustand der Grundstückverkehrsordnung, nach der im ehemaligen Ostberlin jeder Eigentümerwechsel zwischen Januar 1933 und Oktober 1990 amtlicherseits genau überprüft wurde, sobald das Haus zum ersten Mal verkauft oder beliehen werden sollte. Um eine entsprechende Prüfung zu vermeiden, hatte es nie Geld gegeben. Jetzt blieb ihr nichts als gespanntes Erwarten. Nichts, davon war sie überzeugt, würde noch so aussehen wie auf diesen Fotos.
»Ein schönes Haus«, meinte der Sitznachbar.
»Finden Sie?«, antwortete Ellen. »Was schön ist, ist auch anstrengend!«
Ihr traumhaftes Wohn- und Schlafzimmer im Obergeschoss mit Zugang zur Terrasse und Ausblick auf den See hatte den Nachteil, dass sie es nur in den Sommermonaten bewohnen konnte, weil die Heizung vor zwei Jahren pünktlich an ihrem vierunddreißigsten Geburtstag in einer kalten Augustnacht den Geist aufgegeben hatte und das lange für Heizungszwecke missbrauchte Stromnetz eine Nacht später zusammengebrochen war.
»Sind Sie denn anstrengend?« Er grinste sie breit an.
»Danke für das Kompliment!« Sie schloss die Augen und lehnte sich so weit zurück, wie es ging, was nicht besonders weit war.
»Einmal um die Welt. Ich bin froh, wieder nach Hause zu kommen.« Er gähnte.
»Was treibt einen um die Welt?«, fragte Ellen geistesabwesend.
»Umweltkatastrophen.« Er versuchte, die Beine so weit auseinanderzufalten, wie es ging. »Ich bin Fotograf.«
Ellen wandte den Kopf, um ihn sich genauer anzusehen. Sie hatte vor vielen Jahren einen Science-Fiction-Roman gelesen, in dem sich Besucher aus der Zukunft im Vorfeld von Katastrophen und welterschütternden Konflikten versammelten, um ihre Neugier zu befriedigen. Katastrophenfotograf, dachte sie, muss etwas Ähnliches sein.
»Bei einer so langen Reise müsste ich eine Webcam auf einem der Bäume installieren, um alle paar Tage zu überprüfen, ob mein Haus noch steht.«
»So schlimm?«
»Ziemlich.« Ellen musste grinsen, es war eine ihrer Marotten, an die sie sich im Laufe ihres Lebens hatte gewöhnen müssen.
»Es ist ein tolles Haus«, meinte er. »Es könnte in einem Film die Hauptrolle spielen.«
Ellen lehnte sich vor. »Darauf sind schon andere gekommen.« Hollywood, dachte sie. Ich habe die komplette Villa den Händen einer Filmproduktion ausgeliefert.
Als auf dem Bildschirm ein Foto erschien, das einer ihrer Kollegen auf der Konferenz von ihr bei ihrem Vortrag aufgenommen hatte, unterbrach ihr Sitznachbar ihre Bewegung, den Laptop zu schließen.
»Lässt sich sehen«, sagte er lächelnd.
»Keine Katastrophe?«, fragte sie müde.
»Ganz und gar nicht«, antwortete er. Er sah sich ihr Foto mit provozierender Ruhe an.
Ellen nahm sich Zeit, sich selbst in der Großaufnahme zu betrachten, frei stehend auf dem Podium, mit der rechten Hand in einen Sternenhimmel hinter ihr an der Bildwand deutend. Skeptisch begutachtete sie diese Frau mit streichholzkurzen blonden Haaren, einem Meter sechsundsiebzig und annehmbar vollem Schwung der Kurve ihrer Brüste unter weißer Bluse mit offenem grauem Jackett. Ihre Augen leuchteten in ähnlichem Farbton wie ihre hellblauen Jeans, Feuer und Flamme für das, was sie gerade zu berichten hatte.
Leuchten meine Augen wirklich so unnatürlich hell, fragte sie sich, oder ist es ein Fehler in der Einstellung der Farbsättigung? Sie wusste, dass es nicht so war.
Nach wiederholter Aufforderung der Stewardess schob sie den Mac zusammengeklappt in die Rücklehnentasche vor ihr.
Die Männer, hatte sie in ihrem Leben erfahren müssen, hielten diese klaren hell strahlenden Augen für den wichtigsten Schmuck in ihrem schmalen, wie sie fand, zu harten Gesicht. Dabei waren sie in Wahrheit etwas gänzlich anderes.
Meine Augen, hatte sie von Kindheit an gefühlt, und was sich in meinem Kopf dahinter verbirgt, leben im wolkenlosen Land der Mathematik. Sie sind die Beobachtungs- und Beurteilungsinstrumente, die nur von fern Verbindungen zu Emotionen aufnehmen. Manchmal kam sie sich vor wie ein lebendiges Teleskop, das sich überall im Universum auskannte, nur nichts über die Erde wusste, auf der es gebaut worden war.
Ich darf mich nicht beschweren, dachte sie und wandte den Blick von dem Sitznachbarn ab, die Diskrepanz zwischen meinem Körper, der offenbar dafür konstruiert wurde, nah zu sein, und den Augen, die alles aus kosmischer Entfernung betrachten, hat meine wissenschaftliche Karriere ungemein befördert. Und mir unter den Studenten an der TU Berlin den Titel eines »Systems unbelebter blauer Planeten« eingebracht. Und mit meinen verkorksten Beziehungen zu Männern ein lebenslanges Problem beschert.
Die Maschine setzte auf, ab jetzt waren die Ablagefächer wichtig und jeder Fluggast sich selbst der Nächste.
Alles in allem war Ellen zwei Wochen abwesend gewesen. Auf der Konferenz in Boston war ihr Vortrag über rote Zwergsterne auf große Resonanz gestoßen, danach hatte sie ehemalige Kommilitonen aus ihrem Semester in Harvard besucht und noch einige Urlaubstage in Neuengland angehängt. Jetzt also endlich wieder zu Hause – aber in was für einem Haus?
Während sie sich langsam mit ihrem Handgepäck im Gang zum Ausgang der Maschine schob, blickte Ellen aus den Fenstern. Es sah nach einem wunderbaren Berliner Sommertag aus, weiße Wolken wurden über den blauen Himmel getrieben, ohne die Sonne wirklich je zu verdecken.
Als sie ins Freie trat, stellte sie fest, dass es schwüler war, als sie erwartet hatte. Es ging ein heftiger Wind, der Vorbote eines Gewitters zu sein schien, das man hier am Flughafen noch nicht am Himmel erkennen konnte. Im Bus zum Terminal zog sie ihre beige Jacke aus und hängte sie in den Schultergurt ihrer großen Reisetasche aus weichem hellbraunen Leder. Sie wartete am Gepäckband auf ihren Rollkoffer. Das konnte dauern. Sie redete sich ein, dass sie keinen Grund zur Eile hatte, den morgigen Tag hatte sie sich institutsfrei organisiert. Sie freute sich auf eine große Schwimmtour im See, das war der richtige Weg, um anzukommen.
Schließlich kroch ihr hellblauer Rollkoffer durch die flatternden Gummistreifen auf das Gepäckband. Sie wuchtete ihn herunter und zog ihn wie ein fettes, ungelenkes Tier hinter sich her zum Ausgang.
Im Taxi fiel etwas von der Anspannung von ihr ab. Sie lehnte sich mit geschlossenen Augen zurück, den Weg vom Flughafen Schönefeld zum Müggelseedamm in Berlin-Köpenick brauchte sie sich nicht anzusehen. Der warme Fahrtwind aus dem geöffneten Beifahrerfenster fächelte über ihr Gesicht. Anzukommen war eine Freude!
Ein Filmscout aus Babelsberg hatte keine Ruhe gegeben, bis sie eingewilligt hatte, das Haus für einen fantastischen Preis an die Produktionsgesellschaft »Studio 21« zu vermieten. Inklusive einer Pauschale für den Rückbau der Szenenbildeinbauten und einer üppigen Versicherung lag der Gesamtpreis deutlich über dem branchenüblichen Betrag von einer Monatskaltmiete pro Tag. Nach Beratung mit einem vage bekannten Immobilienentwickler, den sie sonst nicht ausstehen konnte, hatte Ellen sich ausgerechnet, dass ihre Einnahmen für die Sanierung von Heizung, Sanitär und Elektro ausreichen mussten. Der Preis, den sie dafür zu zahlen hatte, war allerdings ebenso erheblich. Deshalb klopfte ihr Herz umso stärker, je näher sie dem Müggelseedamm kamen. Laut Plan der Produktionsgesellschaft mussten in diesen Tagen die ersten Dreharbeiten beginnen.
In den letzten Stunden vor ihrer Abreise hatte eine hemdsärmelige Truppe unter Kontrolle des studioeigenen Baubüros damit begonnen, das gesamte Haus auszuräumen. Besenrein war das Ziel, keine Aufputzleitung von Elektro oder Wasser sollte bestehen bleiben, keine Installationen in Küche oder Bad, keine Regale in der Bibliothek, kein einziges Möbelstück. Nichts, nichts, nichts, hatte der Szenenbildner ihr erklärt. Anschließend sollte das Haus mit dem Szenenbild ausgestattet werden, das sie für den Dreh ihres Films brauchten. Insgesamt hatten die Filmleute für Ausräumen, Einrichten, Drehen einer Vordoku, Filmdreh und Rückbau fünfunddreißig Tage eingeplant.
Ein neues Haus erwartet mich, dachte sie, aber was bedeutete das? Vielleicht werde ich gleich davor einen Schreikrampf erleiden.
Eine eingehende Nachricht ihres Kollegen Leo Sommer vom Institut in Potsdam machte sich mit einem Signalton bemerkbar.
»Willkommen zurück«, schrieb er, »alle melden, dein Konferenzvortrag war ein voller Erfolg. Gratuliere.« Im Weiteren teilte er mit, dass er sich morgen vor seinem Abflug zu einer Tagung in Tokio mit einem neu für ihr gemeinsames Forschungsprojekt gewonnenen Spezialisten treffen wollte. »Wenn du dann den Jetlag überlebt hast, bist du dabei herzlich willkommen.«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Ellen nach kurzer Überlegung. Sie hatte keine Ahnung, was sie zu Hause erwartete, und nicht die Absicht, sich schon jetzt von neuen Verabredungen einschränken zu lassen.
In Friedrichshagen steckten sie in einem Stau fest. Ellen ließ den Fahrer in die Einfahrt einer Schule abzweigen, neben der sich ein Supermarkt befand. Sie sprang aus dem Taxi.
Wenig später kam sie mit zwei vollen Tüten zurück. Neben dem nötigen Grundbestand an Lebensmitteln nach langer Abwesenheit hatte sie einiges eingepackt, auf das sie sich für den heutigen Abend freuen konnte, einen Guy Saget, den einzigen guten Chardonnay mit Schraubverschluss, und einen von ihr bereits im Laden probierten, fertig angerichteten leckeren Vitello Tonnato, ein frisches Baguette und alles, was sie für einen Salat aus Fetakäse, Tomaten und Gurken benötigte.
Nach einem kurzen Blick in die Autoschlange, in die sich das Taxi wieder eingereiht hatte, schloss sie erneut die Augen. Der Fahrer hatte die Scheiben komplett heruntergefahren, die Luft draußen war heiß und fühlte sich immer mehr nach einem nahenden Gewitter an. Vor fünfundzwanzig Jahren war ihr das graue düstere Haus, das da irgendwo am Ende des Staus auf sie wartete, wie eine rettende Festung in einem gefährlichen Universum erschienen.
2
Fünfundzwanzig Jahre zuvor
Ellen war gefangen. Sie rüttelte an der Tür, aber die rührte sich nicht. Sie fror und dennoch brannte ihre Haut am ganzen Körper, unsichtbare Käfer liefen darauf herum. Wie damals.
In diesem Zimmer fühlte sie sich ihrer Kindheit am nächsten und jetzt musste sie feststellen, dass sie es nicht mehr verlassen konnte. Dabei hatte es mit seinem übergroßen schwarzen Ledersofa, in das sie sich in diesem Augenblick kuschelte, mit den Doppelfenstern unter der hohen Zimmerdecke und den verstaubten Kunstfreesien in der großen türkisfarbenen Bodenvase äußerlich keine Ähnlichkeit mit dem unendlichen Raum voller glitzernder Sterne über der Wüste Kyzilkum, den sie an diesem Ort nie vergessen konnte.
Sie sah es noch genau vor sich, wie sie mit ihrem Vater an ihrem neunten Geburtstag auf einer Felldecke auf dem warmen Sand der Wüste lag, der mit Einbruch der Nacht schnell kalt wurde. Das war im August 1990, vor nunmehr achtundzwanzig Jahren.
»Behalte das Sternbild des Orion im Blick«, hatte er sie damals aufgefordert. »Er ist ein Jäger, den zwei Hunde begleiten. Südwestlich von dem linken Stern im Gürtel des Orion liegt der große Hund. Der helle Stern darin heißt Sirius, er ist doppelt so groß und fünfundzwanzigmal heller als unsere Sonne. Er wird von einer Zwergsonne umkreist, die so groß ist wie unsere Erde. Dieser Stern hat heute etwas mit dir zu tun.«
Ellen hatte sich damals alle Mühe gegeben, den hellen Stern im Sternbild des großen Hundes nicht aus den Augen zu verlieren.
»Das Licht von hier muss neun Jahre lang reisen, bis es dort ankommt. Stell dir vor, es gibt dort einen Planeten, an dessen Himmel am Tag eine kleine und eine riesengroße Sonne stehen. Wenn die Menschen dort Fernrohre haben, sehen sie genau jetzt in diesem Moment, wie du geboren wirst. Von jetzt an bist du dort bekannt, und sie beobachten genau, wie es dir geht. Wir geben diesem Planeten mit der kleinen und der großen Sonne am Himmel deinen Namen, Lena.« Mit diesen Worten legte er in ihre Hand eine glatt polierte, blau-weiß marmorierte tennisballgroße Steinkugel, die seit seinem Tod für immer verloren war.
Das Gefühl unbegreiflicher Weite, das sie damals gespürt hatte, spürte sie auch in diesem seltsamen Raum von Kane, einem Jugendfreund ihrer Mutter. Er und seine Schwester Julie hatten Ellen nach dem frühzeitigen Tod ihrer Mutter in Berlin aufgenommen. Seit nun zwei Jahren wohnte sie in dieser zum Verirren großen Wohnung in einem Zuckerbäckerschloss von Mietshaus in der Fasanenstraße direkt neben der S-Bahn zwischen den Bahnhöfen Zoo und SavignyPlatz. Den Raum, in dem sie jetzt schon wieder eine halbe Ewigkeit saß, nannte sie den Äther.
Die gegenüberliegende Wand war von einem Regal bedeckt, in dem mehr als zehn restaurierte Rundfunkempfänger aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren brummten und leuchteten.
Onkel Kane, natürlich nicht wirklich ihr Onkel, war eher riesig als groß, er ging gemächlich wie ein Nashorn und lachte sehr gern. Er war Moderator einer Musiksendung beim Soldatensender AFN, bis der seinen Betrieb eingestellt hatte. In endlosen nächtlichen Bastelarbeiten hatte er die Rundfunkapparate restauriert, er hatte das Ahornfurnier der Musiktruhen ausgebessert, das Holz mit Olivenöl poliert und die Bakelitteile zum Schimmern gebracht. Aber er hatte auch die Technik restauriert, die Röhren und Kondensatoren durch Originalteile ersetzt und die magischen Augen der Apparate zu ihrem grünen Glimmen gebracht. Er hatte auf Märkten nach Ersatzteilen gesucht, manchmal in ihrer Begleitung, wobei das eine oder andere Kuscheltier für sie abfiel, solange sie dafür noch empfänglich gewesen war. Er hatte gelötet und Spulen gewickelt, stets roch es in seinem Werkstattraum am Ende des langen Flures nach angesengtem Plastik und der stechende Geruch des Kolophoniums zog durch alle Zimmer.
Jedes der Radios war fest auf einen von ihm gebauten Sender eingestellt, hatte er ihr einmal erklärt. Sein Sender, der aus einer Kiste im Nachbarzimmer funkte, wiederholte endlos die Jahre 1949 bis 1961 mit ihren Reden, mit dem atmosphärischen Pfeifen und mit der Musik. Aus den Apparaten strömten die Sendungen aller Sender, ob Ost oder West, mit ihren Nachrichten, ihren Diskjockeys, ihren Orchestern, politischen Berichten, mit allem, was damals den Äther gefüllt hatte. Es war ein summender Bienenstock, und vor allem war es eine Übung, den Verstand immer wieder auf andere Quellen zu konzentrieren.
Sooft Ellen hier die Augen schloss, hatte sie das Gefühl, im Weltraum zu schweben, in einer Sphäre aus alten Radiosignalen, die die Erde in sechzig Lichtjahren Entfernung weit draußen im All umgeben.
Dort treibe ich in meinem Ledercouchraumschiff nahe dem bläulich leuchtenden Doppelstern Diadem im Sternbild Haar der Berenike und höre diese Rundfunkwellen der fernen Erde.
Oft schlief sie dort draußen ein, ließ sich auf der Couch durch das All treiben, hielt Ausschau nach interessanten Planeten, aber nie verlor sie die konfusen Stimmen aus der Vergangenheit der Erde aus dem Ohr.
Heute war alles anders.
Jedenfalls seit sie festgestellt hatte, dass sie den Äther nicht mehr verlassen konnte. Sie war auf ihrer Traumreise durch den Kosmos unter der weichen, schwarzen Decke aufgewacht, weil die Stimmen verstummt waren.
Alles ist verstummt, nichts glimmt mehr, nichts flackert.
Sie erhob sich verwirrt. Zuerst betätigte sie den großen Schalter direkt neben der Tür, die Kommunikationszentrale ihres Ledercouchraumschiffes, die die Verbindung zur Erde herstellte. Es funktionierte. Jemand hatte es abgestellt, als sie schlief. Kanes Schwester, die sich gern Julie nannte, weil sie Südfrankreich liebte, war schon seit Wochen nicht mehr hier gewesen. Also Kane.
Die Tür zum Flur war verschlossen.
Ellen linste durch das Schlüsselloch und erkannte einen umgedrehten Schlüssel darin. Abgeschlossen. Wenn Kane Fuller sich auf eine Reise begab, schloss er oft seine beiden Heiligtümer ab, die Werkstatt und den Äther. Nicht, weil Ellen in seiner Abwesenheit die Räume meiden sollte, die Schlüssel blieben ja immer stecken. Das Umdrehen des Schlüssels sollte sie nur noch mal daran erinnern, dass sie in den Räumen möglichst auf Zehenspitzen gehen und keinen Unsinn anstellen sollte.
Sie klopfte an die Tür. Vielleicht war Kane noch in der Wohnung. Sie horchte. Sie legte das Ohr auf den quietschenden Parkettboden. Nichts – kein Ruf, kein Nashornschritt, Stille.
In irgendwelchen Krimis hatte sie gelesen, wie man mit einer Situation wie dieser umgehen sollte. Man stocherte so lange im Schlüsselloch der Tür, bis der Schlüssel auf ein durchgeschobenes Zeitungsblatt fiel, das man dann unter dem breiten Spalt unter der Tür zurückzog.
Bingo.
Im Künstlerhaus St. Lukas gab es keine breiten Ritzen unter der Tür, es gab Schwellen.
Ellen setzte sich zurück in das Ledersofa und dachte nach. Dazu war dieser Raum draußen im Sternbild Haar der Berenike schließlich gemacht.
Habe ich Hunger? Im Moment nicht zu spüren.
Durst? Könnte sein, aber draußen rauscht seit dem Morgen ein Wolkenbruch herunter, so lässt sich sicher Abhilfe schaffen.
Klo? Bloß nicht genauer darüber nachdenken.
Sie öffnete das große zweiflügelige Doppelfenster und lehnte sich so weit hinaus, wie es ging. Dann drehte sie das Gesicht nach oben und öffnete den Mund, um den warmen Augustregen zu trinken.
Sie blickte nach unten. Vier hohe Etagen, mindestens zwanzig Meter. Eine rot geklinkerte Wand mit Vorsprüngen und Figuren und Erkern und Efeu, zwischen denen das Wasser in die Tiefe rauschte. Eine Leiter, breite Simse oder sonst etwas, an dem man sich festhalten könnte, war nicht in Sicht.
Ellen schloss das Fenster. Onkel Kane hatte eine einwöchige Reise geplant. Aber war er wirklich gefahren, ohne sich zu verabschieden? Ohne in ihrem Lieblingsraum nach ihr zu suchen? Hatte er sie unter der schwarzen Decke auf der schwarzen Couch im dunklen Zimmer übersehen?
Ein Hilfeschrei müsste schon sehr, sehr laut sein, um hinter dem Regen irgendwo gehört zu werden. Es gab auch kein Telefon in diesem Raum. Grübeln wird nicht viel helfen, dachte sie, und schlief ein.
Am nächsten Morgen erwachte sie unter ihrer warmen Decke auf der schwarzen Ledercouch. Morgens, hatte sie die Erfahrung gemacht, war ein Weltuntergang immer besser auszuhalten, weil die Dunkelheit sich zurückgezogen hatte und nichts mehr schlimmer machen konnte. Ansonsten aber hatte sich nicht viel geändert. Es regnete noch immer, als würden ganze Meere über dem Haus in der Fasanenstraße ausgekippt. Hunger machte sich noch nicht wirklich bemerkbar. Nur eins ließ sich nicht eine Minute länger ignorieren: Sie musste pinkeln, daran führte kein Weg mehr vorbei.
Sie nahm noch einmal einen Anlauf, die Tür aufzubekommen, vielleicht waren die Bolzen in Fußboden und Türrahmen nicht richtig eingerastet, und ein verzweifeltes Hin- und Herwackeln konnte sie lockern.
Negativ.
Dann übernahm die pure Not die Regie. Die Kunstblumen flogen aus der Vase, Ellen hielt das Gefäß kurz gegen das Licht, um zu sehen, ob die Vase auch wirklich dicht war.
Nachdem sie sich erleichtert hatte, war sie sicher, es noch lange in ihrem Raumschiff aushalten zu können, das singend und pfeifend und schwätzend durch die Atmosphäre eines fernen Wasserplaneten glitt. Zum ersten Mal hatte sie wirklich das Gefühl, einsam zwischen den Stimmen weit draußen im All zu schweben.
Es wurden endlose Zahlenkolonnen vorgelesen, die von Störungen auf ihrem sechzigjährigen Weg in die Gegenwart verzerrte Pausenmelodie von Radio Moskau erklang, ein Diskjockey, in dem sie die Stimme von Onkel Kane erkannte, kündigte den immer wieder gewünschten Top-Hit der Four Lads an, » Skokiaan«. Wenn Ellen sich konzentrierte, hörte sie es aus all den Störungen, Reden, Berichten und Zahlen heraus: »Hohoho, far away in Africa.«
Sie schnappte sich die große Vase, die bewiesen hatte, dass sie dicht war.
Unangenehm, wie warm das Glas geworden ist.
Aus dem geöffneten Fenster konnte sie in dem grauen Tag und der Wasserflut den Boden des Hofes erkennen. Niemand hielt sich dort auf. Der Inhalt der Vase vermischte sich mit dem Regen, sie spülte die Vase aus, entleerte sie erneut, bis sie wieder kalt geworden war. Dann arrangierte sie die Blumen darin neu und stellte alles an seinen alten Platz.
Als sie einige Stunden später auf ihrer Couch erwachte, hatte sie schließlich doch Hunger. Der Zeitpunkt, an dem der Spaß aufhörte, war bald gekommen, das spürte sie deutlich. Sie öffnete wieder das Fenster und drehte die Lautstärke ihrer Kommunikationszentrale zur Bodenstation auf der Erde so laut auf, wie es nur irgend ging. Zwölf hervorragend restaurierte Rundfunkgeräte posaunten die Wichtigkeiten der Fünfzigerjahre als ein unverständliches Durcheinander in den Regen. Dann stellte sich Ellen an das offene Fenster und rief.
Irgendwann hatte sie einmal gehört, dass, wer in Not ist, überfallen wird oder ertrinkt, nicht »Hilfe«, sondern »Feuer« rufen muss, damit jemand herbeieilt. Dafür war die Situation aber überhaupt nicht geeignet. In der Atmosphäre des Wasserplaneten im Sternbild des Haar der Berenike, wo sie sich jetzt im Sound der alten Klänge sechzig Lichtjahre weit draußen im All befand, kam niemand auf die Idee, auf einen Ruf »Feuer« zu reagieren.
Also rief sie laut: »Hilfe!« Dann noch einmal lauter. Und noch lauter! Auch das reichte nicht. Niemand kam herbei. Sie versuchte zu brüllen wie am Spieß, aber es gelang ihr nicht. Sie vermochte es einfach nicht, ohne jede Hemmung so laut zu schreien, wie es physisch möglich war.
Was sitzt da zwischen meinem Willen und meiner Stimme und klemmt mich ein? Wenn ich je lebend hier herauskomme, werde ich mich damit beschäftigen müssen, selbst wenn daraus eine Lebensaufgabe wird.
Sie gab sich einen Ruck. Vor zwei Wochen hatte sie ihren vierzehnten Geburtstag gefeiert. Sie war alt genug, eine Lösung zu finden. Ich werde herauskommen!
Es war so offensichtlich, sie hatte es nur nicht sehen wollen. Weil sie Angst hatte. Aber sie musste aus ihrem Raumschiff steigen, sie musste hinab in den Hof. Es gab keinen anderen Weg. Sie würde aus dem Fenster klettern, sich am Efeu und an den Vorsprüngen und Figuren des verrückten Kitschschlosses festhalten und über vier Stockwerke in die Tiefe steigen.
Nein, das ist verrückt. Das ist Selbstmord!
Sie setzte sich in einen der schwarzen Ledersessel, die rauschende, flüsternde, singende Wand, den Äther im Rücken, und dachte nach, dachte gegen ihre Angst an. Sie musste eine Hauswand zwanzig Meter hinunterklettern.
Sie zählte sich die Schwierigkeiten auf: Es war glitschig, dem Efeu war nicht wirklich zu trauen und zwanzig Meter waren verdammt hoch.
Sie sah sich in ihrem Zimmer um. Da gab es nicht viel, was zum Erfolg dieser Unternehmung beitragen könnte. Es gab kein Messer und keine Schere, mit denen sie die Decke in Streifen zerschneiden konnte. Es gab nur Kunstblumen in einer Vase und jede Menge Apparate.
Ellen ging wieder zum Fenster, öffnete die Flügel weit und betrachtete die Wand unter ihr so eingehend wie nie zuvor. Von Efeu bedeckt und deshalb auf den ersten Blick nicht zu erkennen, führte direkt neben ihrem Fenster ein Regenabflussrohr in die Tiefe. Aber dessen Durchmesser war mindestens zwanzig Zentimeter. Es gab keine Chance, es zu umfassen.
Ellen wandte sich ab und machte einen letzten Versuch, die Tür mit Gewalt aufzubrechen. Sie drückte dagegen, sie stemmte sich dagegen, sie warf sich dagegen. Wieder und wieder. Erneut spürte sie, dass zwischen ihrem Willen und ihrer Aktion etwas saß, das sie bremste, obwohl es um alles ging. Bedeutete das, dass sie in Wahrheit gar nicht hinauswollte?
Jetzt ist der Zeitpunkt, das herauszufinden.
Die Blumen, dachte sie. Sie zog die Blumen, fünf verstaubte künstliche Freesien von anderthalb Metern Länge, aus der Vase. Sie bestanden aus wächsernen Blättern und seidenen Blüten, die an einem stabilen Draht befestigt waren. Auf dem Sofa hockend, die Beine untergeschlagen, schälte Ellen die Blätter und Blüten von den Drähten. Jeder Draht für sich war nicht stark genug, sie zu halten, alle zusammen könnten fest genug sein.
Sie flocht zunächst einen Dreierzopf und verflocht den dann mit den beiden übrigen Drähten, so dass sie am Ende einen Draht von mehr als einem Meter Länge hatte. Den legte sie um die Mittelstütze des Fensterrahmens und lehnte sich schräg ins Zimmer zurück, weiter – noch weiter. Der Zopf schien zu halten.
Ihr Hunger ließ sich nicht mehr einen Atemzug lang vergessen. Sie stand am geöffneten Fenster und blickte in die Tiefe. An der Hauswand, das wusste sie von ihren wilden Klettereien an Felsnadeln in der Wüste, übernahmen die Hände und die Füße das Denken. Denen musste sie vertrauen, wenn schon nicht ihrem blockierten Kopf.
Dann stand sie auf dem Fensterbrett. Sie zog sich die Turnschuhe aus, knotete sie an ihren Schnürsenkeln zusammen, stopfte die Socken hinein und warf sie in den Hof. Vom Fensterbrett aus stocherte sie mit dem steifen Zopf aus Draht in Richtung der Regenrinne.
Der nächste Moment wird alles entscheiden!
Würde sie es schaffen, den Drahtzopf hinter der Regenrinne durchzufädeln?
Dann war sie durch damit. Jetzt kam der schlimmste Teil.
Sie stemmte sich von außen fest in die Höhle des Fensters. In einem großen Ausfallschritt stützte sie sich mit dem linken Fuß auf eine kleine Eulenfigur an einem vorspringenden Klinkerstein, die kaum aus dem Efeu hervorragte. So weit sie konnte, griff sie auf die andere Seite des Regenrohres, um den Draht zu packen. In dem Moment, als sie ihn gegriffen, zu sich gebogen und mit dem anderen Ende zusammen um ihre rechte Hand geschlungen hatte, brach die Eule unter ihr aus der Wand.
Ihr Fuß rutschte nach unten, aber nur etwa einen Meter, dann hielt der Efeu ihn fest. Sie zog das rechte Bein, das nun fast über ihre Kopfhöhe nach oben ragte, vom Fenstersims ab, schob damit ebenfalls den Efeu zusammen, bis er zu halten schien, und dann ging es fast so elegant nach unten wie bei den Männern, die sie früher mit ihren gebogenen Eisenstangen an den Schuhen die Telegrafenmasten hinauf- und herunterklettern gesehen hatte.
Ruckweise arbeitete sie sich mit dem Draht am Regenrohr herunter, das den größten Teil ihres Gewichtes hielt, der Efeu funktionierte gut als Bremse für ihre gegen die Klinkerwand gestemmten Füße. Ruck um Ruck fädelte sie bei jeder Halteklammer am Regenrohr den Draht aus und wieder ein. Dabei vergaß sie die Zeit und den Regen und alles, was sie nicht brauchte, um es lebend nach unten zu schaffen.
Und dann schließlich stand sie im Hof, außer Atem, durchnässt bis auf die Knochen und erstaunt über das, was sie geschafft hatte. Nachdem sie ihre Strümpfe und Schuhe auf die blutigen, zerkratzten und abgeschürften Füße gezogen hatte, reckte sie den Kopf in den Nacken, trank von dem erquickenden Sommerregen und blickte hinauf zu dem Äther, in dem das Flackern der magischen Augen zu ahnen war. Sie meinte, noch ein verklingendes »Hohoho far away in Africa« zu hören, als sie hinaus auf die Fasanenstraße trat.
Der Hunger brannte in ihr wie ein Feuer, das nicht wärmte. Jeder Muskel zitterte. Ellen fror, sie war klatschnass, der Regen fiel weiter. Sie versuchte, sich abzulenken, indem sie in einem leichten Trab die Kantstraße hinunter in Richtung Bahnhof Zoo lief. Dort musste es möglich sein, ohne einen Cent irgendetwas zu essen zu finden.
Als sie dort ankam, hatte kein einziger Imbissstand mehr geöffnet. Die Abfallkörbe waren abgefahren, weit und breit war nichts zu entdecken, was essbar gewesen wäre. Sie lief die Treppe zur S 3 hinauf. Der letzte Zug zum Ostkreuz sollte in achtzehn Minuten fahren, dort musste sie in den letzten Zug in Richtung Erkner umsteigen.
Wenig später saß sie eng in eine Ecke gekuschelt, zitternd, frierend, hungrig. Ihre Gedanken kreisten darum, warum sie nicht so laut hatte schreien können, dass die Nachbarn die Polizei alarmieren mussten, warum sie nicht mit Fußtritten der Verzweiflung die Tür hatte aufbrechen können.
Irgendwann schlief sie frierend und zitternd ein, wachte aber alle paar Augenblicke wieder kurz auf. Sie spürte einen Wasserfaden aus ihren kurzen Haaren ihre Nase entlangrinnen. Immer wieder schreckte sie hoch, sie musste sich immer wieder neu vergewissern, wo sie gerade war.
Am Ostkreuz stürmte sie aus dem Zug, die Treppe hinauf, dann wieder hinunter, der nächste Zug fuhr nach Erkner. Der Fahrtwind blies die letzten Regentropfen von den Scheiben der S-Bahn. Während der Zug hielt, sah sie vereinzelte Fahrgäste sich gegen den Sturm stemmen. Kurz vor drei Uhr am Morgen fuhr der Zug in Hirschgarten ein. Hier draußen regnete es nicht mehr. Ein frischer Sturm, der direkt über das große Wasser des Müggelsees angefegt kam, schüttelte die Bäume, die ersten Blätter stoben davon, der Himmel wurde klarer. Morgen würde ein schöner Tag werden.
Nach kurzem Zögern schlug sie den kürzeren Weg durch den Wald ein. Zu dieser Zeit und bei diesem Wetter würde keiner, der etwas im Schilde führte, hier draußen lauern. Unterwegs blieb sie plötzlich stehen, weil in ihrem Kopf ein Gedanke einschlug wie ein Blitz und weil dieser Gedanke von einer so großen Entschlossenheit begleitet wurde, dass Ellen den Moment ganz und gar spüren wollte. Der Gedanke stand so deutlich vor ihren Augen, als wäre er ihr in jeden Handrücken tätowiert: Ich werde ein Haus haben und die Kontrolle über alle seine Schlüssel. Niemals wieder im Weltall verloren.
Vereinzelt standen Lampen zwischen den Bäumen am Weg. Ellen merkte, dass sich irgendwo in ihrem tiefen Innern der Hunger in ein aufsteigendes Fieber verwandelte. Sie lief, sie hüpfte, sie schlug mit den Armen, bis sie schließlich vor dem großen dunklen schmiedeeisernen Torgitter der Villa angekommen war, die sie seit fast drei Jahren nicht mehr betreten hatte. Sie drückte eine Minute lang auf die Klingel.
Das Haus blieb dunkel.
Sie versuchte, sich zu erinnern, warum sie das Haus nach dem Tod der Mutter fluchtartig verlassen hatte, als sich die Gelegenheit ergab, zu Onkel Kane und Tante Julie zu ziehen. Um nichts in der Welt wollte ich allein sein in einem leeren Haus, das jeden meiner Gedanken bis in die Angst vergrößerte, erinnerte sie sich.
Nichts rührte sich im Haus.
Ellen kannte den Zaun rechts von dem Tor. Mit einem Ziehen und einem Schwung wälzte sie sich auf die andere Seite und ging an dem totgelegten Springbrunnen vorüber zum Eingangsportal an der südlichen Seite des dunklen Hauses. Es war Viertel nach drei in der Nacht. Niemand war um diese Zeit wach. Es konnte aber auch sein, es kam ihr in diesem Moment sogar wahrscheinlich vor, dass sich niemand in dem Haus aufhielt.
Sie drückte auf die Klingel neben dem großen Aluminiumschild »Lateinamerika-Fachbibliothek«.
Tagsüber saß dort der Bibliothekar Tomas, mit dem sie einige Wochen Deutsch geübt hatte, oder besser, er wanderte umher, saß in einem Liegestuhl mit Kissen nahe am Seeufer und staubte gelegentlich Bücher ab. Immer wieder erhielt er Besuch von Schülern, denen er Deutsch, Spanisch oder Russisch beibrachte. Aber er hatte nur selten eine Nacht hier zugebracht, damals, als ihre Mutter und ihre Großmutter noch lebten. Jetzt hatte er das Haus für sich allein. Warum sollte er im Sommer hier nicht gelegentlich übernachten?
Es blieb dunkel.
Ellen klingelte noch einmal und bereitete sich innerlich auf die schlimmsten, hoffnungslosesten, kältesten, hungrigsten Stunden ihres Lebens vor. Sie war nicht einmal sicher, ob sie es noch einmal zurück über den Zaun schaffen würde. Sie wollte sich gerade abwenden, als im Erdgeschoss ein Licht aufflammte.
Der Mann, der die Tür einen Spalt öffnete, hatte offensichtlich keine Ahnung, wer da nass wie aus dem Wasser gezogen vor ihm stand, ein Teenager, der damals noch ein schüchternes Mädchen war. Ellen sagte ihm ihren Namen.
Nach diesem Kraftakt wurde alles gut.
Nach einer langen warmen Dusche und Bratkartoffeln mit drei Spiegeleiern saß sie ganz früh morgens dem freundlichen Bibliothekar aus den ersten vier Monaten ihrer späten Kindheit in Berlin gegenüber. Sie trug ein weiches großes Nachthemd, das nach altem Waschmittel roch, darüber eine dicke graue Strickjacke, die von einigen Mottenlöchern verziert war. Ihr war warm. Von innen heraus war ihr warm. Alles fühlte sich warm an.
Den letzten Bissen spülte sie mit einem großen Glas Milch herunter, die der Bibliothekar noch in seinem Kühlschrank aufgetrieben hatte. Dann erzählte sie ihm die Geschichte ihrer letzten Nacht.
»In drei oder vier Jahren komme ich zurück in mein Haus«, sagte sie dann. »Bist du dann noch hier?«
Tomas zögerte eine Weile. Wer weiß, sagte sein Gesicht, was in drei oder vier Jahren sein wird?
»Sicher«, antwortete er.
3
Ellen näherte sich ihrem Haus, das da vorn im Morgendunst lag. Es gab nie ein Zuhause, das ich nicht immer genau dann verloren habe, wenn es am schönsten war. Diesmal bin ich so verrückt, es selbst aus der Hand zu geben, wenn auch nur für ein paar Wochen. In ihrem tiefsten Inneren bewegte sich eine lächerliche Angst, die sie einfach nicht loswurde. Sie lachte auf. Was soll schon sein? Ich habe es vermietet, das ist das Normalste von der Welt.
Als der Ort Hirschgarten im späten neunzehnten Jahrhundert vor den Toren Berlins von einigen Bankiers als Villenkolonie entwickelt wurde, begannen die beteiligten Finanziers damit, Traumvillen an das Ufer des Müggelsees zu setzen, um die Preise künftiger Parzellenverkäufe festzusetzen. Diese Logik des Luxus hatte Ellen beim Anblick ihrer heruntergekommenen Villa bisher nie nachvollziehen können, jetzt, als das Taxi sie an ihrem Ziel aussteigen ließ, sprang sie ihr ins Auge. Vor dem strahlend weißen, übermannshohen Torpfeiler befand sie sich, die Hand noch immer auf den ausgefahrenen Griff ihres Rollkoffers gestützt, in einer vollkommen anderen Welt, in die Villa und umgebender Park direkt aus Hollywood verpflanzt zu sein schienen.
Es herrschte reges Getümmel von hemdsärmeligen Typen in T-Shirts mit verdrehten Baseballmützen auf dem Kopf, die schwere Kabel hinter sich herzogen, und von Frauen mit Sprechfunkgeräten und Klemmbrettern.
Jeder Einzelne hatte vermutlich einen klaren Auftrag, für Ellen sah es allerdings aus wie ein Ameisengewimmel, wie es ihre Villa noch nie gesehen hatte. Etwas verloren stand sie als Hindernis im Weg und wurde von den Filmleuten mit professioneller Geschmeidigkeit ignoriert. Der Rasen bis zu ihrer Villa war zentimeterkurz geschnitten und sattgrün, wie es die letzten heißen Wochen in Berlin ohne permanente Berieselung niemals erlaubt hätten. Der runde Springbrunnen, den sie zeitlebens nur als versumpftes Becken kannte, war perfekt gereinigt und sprudelte einen zarten Fächer von Wasser in den heißen Himmel, an dem die Anzahl der Wolken zunahm.