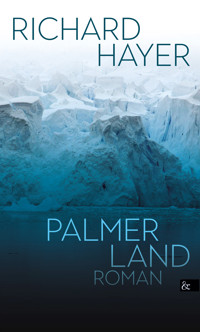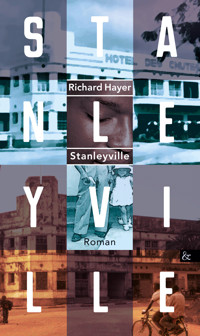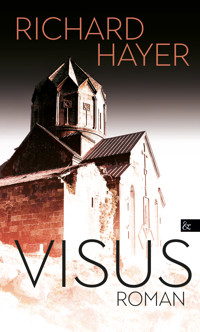
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Buch&media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Londoner Maler Robert Casty entdeckt in Bildern des italienischen Renaissancemalers Piero della Francesca Hinweise auf ein seltsames Objekt, das uralten Legenden zufolge in einem Kloster in Armenien existieren soll. Zur gleichen Zeit birgt ein internationales Forscherteam um die junge armenische Historikerin Anahit aus dem Wrack eines Schiffes, das seit dem vierzehnten Jahrhundert auf dem Grund des Schwarzen Meeres liegt, ein rätselhaftes, spiegelähnliches Objekt, das man im Mittelalter das »Auge Gottes« nannte. Als der Spiegel bei einem Überfall auf das Forschungsschiff gestohlen wird, bricht zum Entsetzen der Weltöffentlichkeit die Pest aus und bedroht die Menschheit. Es gibt geheimnisvolle Hinweise, dass beim Zusammentreffen der beiden Spiegel eine Katastrophe von unvorstellbarem Ausmaß droht. Im Kampf um das Schicksal der Welt bleiben Robert und Anahit weniger als fünf Tage, um zu verhindern, dass dies geschieht. Ein atemberaubender Thriller von knallhartem Realismus auf der Grundlage irritierender Fakten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 738
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Der Londoner Maler Robert Casty entdeckt in Bildern des italienischen Renaissancemalers Piero della Francesca Hinweise auf ein seltsames Objekt, das uralten Legenden zufolge in einem Kloster in Armenien existieren soll.
Zur gleichen Zeit birgt ein internationales Forscherteam um die junge armenische Historikerin Anahit aus dem Wrack eines Schiffes, das seit dem vierzehnten Jahrhundert auf dem Grund des Schwarzen Meeres liegt, ein rätselhaftes, spiegelähnliches Objekt, das man im Mittelalter das »Auge Gottes« nannte. Als der Spiegel bei einem Überfall auf das Forschungsschiff gestohlen wird, bricht zum Entsetzen der Weltöffentlichkeit die Pest aus und bedroht die Menschheit.
Es gibt geheimnisvolle Hinweise, dass beim Zusammentreffen der beiden Spiegel eine Katastrophe von unvorstellbarem Ausmaß droht. Im Kampf um das Schicksal der Welt bleiben Robert und Anahit weniger als fünf Tage, um zu verhindern, dass dies geschieht.
Ein atemberaubender Thriller von knallhartem Realismus auf der Grundlage irritierender Fakten.
Der Autor
Richard Hayer ist Wissenschaftler und Top-Manager eines internationalen Konzerns. Er lebt in Berlin.
In unserem Hause ist von Richard Hayer bereits erschienen:
Der schwarze Garten
© Buch&media GmbH, 2024Umschlaggestaltung: Maja BechertTitelabbildung: © Friedrich HagemeyerSatz: Pinkuin Satz und Datentechnik, BerlinGesetzt aus der SabonPrinted in GermanyISBN 978-3-95780-307-8
Zur Erinnerung an Piero della FrancescaMaler und Mathematiker (1417–1492)
Wenn man Euch fragt, woher seid Ihr gekommen?, antwortet: Wir sind aus dem Licht gekommen, von dort, wo das Licht durch sich selbst entstanden ist.
Thomas-Evangelium, 50
PROLOG
2. Oktober 1369
Keine Stunde bevor Pierre I de Lusignan das Leben verlor, versuchten mehrere Dutzend Männer des Königs, eine gigantische Steinplatte auf sein Schiff zu verladen. Man munkelte, die runde, in schwarzes Tuch gehüllte steinerne Scheibe, die an dicken Seilen neben der voll betakelten CATHERINE im Schein von Fackeln und Feuern über der Mole schwebte, sei das »Auge Gottes«.
Eine stürmische Nacht lag über der Nordküste Zyperns, Wolkenfetzen trieben dicht über den Felsen dahin. Sie vermischten sich mit der Gischt der Brandung, die an den ersten Felsen der Ausläufer des Pentadaktylos-Gebirges im Meer aufschäumte. Kein Stern leuchtete am Himmel. Es erschien unvorstellbar, dass es jemals wieder Tag werden könnte.
Vor den sieben Meter hohen Mauern der Hafenfestung von Kyrinea hatten sich Hunderte von Angreifern zusammengerottet. Sie führten ein Gerüst mit, unter dem ein schwerer Rammbock aufgehängt war, um damit das Tor der Festung aufzubrechen. Die Nacht hallte wider von dem regelmäßigen wumm, wumm, wumm, wumm, das sich bis in den Herzschlag jedes Bewohners der Burg fortsetzte.
Ein schlanker Mann mittlerer Größe, einen Ledersack auf dem Rücken, den er mit der linken Hand an der Schulter hielt, stand in einem Raum tief in den Felsen über der Mole, an der das Schiff des Königs beladen wurde. Er war in einen langen dunkelgrauen Wollumhang gekleidet, der von einem schwarzen geflochtenen Gürtel zusammengehalten wurde. Auf seinem Kopf trug er eine schwarz eingefärbte Kappe, von deren Ohrenklappen die Fäden lose in dem Wind flatterten, der durch die Gänge in den Felsen zog. Er hatte nicht viel Zeit. In wenigen Minuten würde die CATHERINE ablegen, und er hatte dem König geschworen, ihn zu begleiten. Vorher jedoch musste er, koste es, was es wolle, die Felsenkammer in Augenschein nehmen, in der bis vor kurzem die riesige Scheibe aufbewahrt worden war, die soeben verladen wurde. Vom Meer wehte ein satter Tanggeruch heran.
Wumm, wumm, wumm, wumm. Noch hielt das Tor der Festung den Angreifern stand.
Leon Kartian, der Mann mit dem Ledersack auf dem Rücken, war vor einundvierzig Jahren im Herzland der ehemaligen römischen Provinz Armenien als sechstes Kind einfacher Weinbauern geboren worden. Ehe es ihn in die Paläste der Lusignans auf Zypern verschlug, hatte er Jahre mit Studien in Paris, Prag und Salamanca verbracht und mehrere Sommer einen mit Steinstaub bedeckten Mantel in der Werkstatt eines Bildhauers an der dalmatinischen Küste getragen. Nachdem er eine kleine Sommerresidenz für Pierre I in den Bergen an der Nordküste Zyperns entworfen und deren Bau überwacht hatte, betrachtete er sich als Baumeister, Astrologe und Logiker. Am Hof sicherte er seinen Lebensunterhalt, indem er die Kinder der Königsfamilie unterrichtete.
Das Kreischen aufgeregter Vögel, das Stürzen und Brechen der Wellen, die Stimmen vieler Männer, die eine gemeinsame Anstrengung zusammenführte, drangen von der Mole zu ihm herüber. Ho, ho, ho, hoy. Ho, ho, ho, hoy.
Die Gänge im Felsen waren verlassen. Gegenüber dem breiten Tunnel hinunter zur Mole befand sich ein Eichenportal im Stein, groß wie das Tor einer Kirche. Kartian betrat den Raum dahinter.
Der Geruch nach verfaultem Tang wurde intensiver. An den Wänden glänzte fauliger Schlick, aus dem winzige Fliegen aufstoben. Insgesamt machte der Raum den Eindruck, als stünde täglich viele Stunden brackiges Meerwasser darin. Zentimeterdick klebte Schlamm an der Wand, der an seiner Oberfläche eingetrocknet, tiefer jedoch feucht geblieben war.
Das wumm, wumm, wumm, wumm war verstummt. Die Angreifer hatten die Burganlage des Hafens eingenommen. Kartian konnte die Schreie der Verfolger in den Gängen im Felsen hören. Sie kamen näher.
Sein Schuh stieß an ein fußgroßes Stück eines Asphaltbrockens, in dem sich ein seltsamer Abdruck erhalten hatte. Er hob ihn auf und verstaute ihn in seinem Ledersack. Der Abdruck musste in einer Verbindung mit der steinernen Platte stehen, die jetzt auf die CATHERINE verladen wurde. Eines Tages würde es ihm vielleicht gelingen, mit Hilfe des Abdruckes das Ding zu identifizieren, das ihn hinterlassen hatte. Eilig lief er hinunter zur Mole.
Als er aus dem Gang in die Felsen oberhalb der Mole trat, griff eine grobe Hand von hinten um seinen Hals. Mit gewaltiger Kraft wurde seine Kehle zugedrückt. In einer Schraubenbewegung ging er in die Knie.
Der Angreifer verbreitete eine Wein-Fahne, und seine Kleidung stank penetrant nach Urin. Er zog ein Kurzschwert aus seinen Gewändern. Verzweifelt zerrte Kartian den steinharten Asphaltbrocken aus seinem Ledersack.
Für einen kurzen Moment, im Ausholen, lockerte der Angreifer den Griff, mit dem er Kartians Kehle gepackt hielt. Kartian nutzte die Sekunde und schmetterte dem Mann mit aller Kraft den Brocken auf den Schädel. Ein kurzes dumpfes Geräusch. Blutüberströmt brach der Angreifer zusammen. Kartian beugte sich über den Toten, um das Stück Asphalt wieder aus dem Schädel zu ziehen, doch so entschlossen er es auch versuchte, es gelang ihm nicht.
In der aufgewühlten See an der Mole unterhalb der Felsen lag eine an Fock- und Großmast mit Rahsegeln betakelte dreimastige Karacke. An ihrem Bug prangte in goldenen Zeichen der Schriftzug CATHERINE. Sie war Pierre I vor einigen Jahren von König Edward III bei einem Besuch in London geschenkt worden und hatte ihm als eines der großen Fracht- und Begleitschiffe der königlichen Flotte bei seinem letzten Kreuzfahrtunternehmen in Alexandria hervorragende Dienste geleistet.
Die CATHERINE war an die dreißig Meter lang und elf Meter breit, über dem Achtersteven erhob sich ein mehrstöckiger Heckaufbau mit offener Galerie, in dem sich das Quartier der Königsfamilie befand.
Der Laderaum der CATHERINE öffnete sich zur Seite mit einem Schott in der Bordwand, das dicht über der Wasserlinie lag. Kartian konnte ein Gerüst aus starken Balken im Laderaum erkennen, eine Vorrichtung, um die ungeheure Last des Steines gegen das Verrutschen bei hohem Wellengang zu sichern. Alles würde bei der vorausliegenden Reise von der Zuverlässigkeit dieser Konstruktion abhängen.
Eng vertäut lag das Schiff an der Mole. Ein breiter Steg führte hinab durch den geöffneten Schott in den Laderaum. Der Stein senkte sich weiter an den Seilen herab. Rufe ertönten. Fackelträger beleuchteten die Szene. Ein falscher Griff, ein gerissenes Seil würde die tonnenschwere Last unwiederbringlich im Meer versinken lassen.
Kartian wusste, welches Ziel der König verfolgte. Vor sieben Tagen hatte er Kartian zu sich in die Bibliothek in seiner Residenz St. Hilarion rufen lassen. Die Angst vor dem, was er dort von dem König über das Ziel der anstehenden Reise erfahren hatte, würde Kartian auch an Bord der CATHERINE nicht verlassen.
Die klare Luft trug den Blick aus der königlichen Residenz bis weit über das Meer. Es war ein strahlender Spätherbsttag, die von den sonnendurchglühten Bergen aufsteigende Wärme strömte durch die offenen Fensterbögen in den großen, mit grünen, golddurchwirkten Seidentapeten bespannten Raum.
»Wir werden eine Reise antreten«, sagte der König, »die uns in deine alte Heimat führt. Du kannst uns dabei von großem Nutzen sein.«
Pierre I war kein besonders großer Mann. Obwohl er erst knapp dreißig Jahre zählte, war sein langes blondes Haupthaar bereits schütter und ließ die gebräunte Haut des Schädels hindurchscheinen. Trotz der Bräune, die er vom Kreuzzug nach Alexandria aus Afrika mitgebracht hatte, war sein Gesicht fahl. In den blassen blauen Augen jedoch brannte ein Feuer, das von einer Kartian unverständlichen Hoffnung gespeist sein musste.
Kartian legte seine Hand auf die vor ihm liegende Bibel und sprach zum Schwur die Worte des Königs nach.
»Ich werde Pierre I de Lusignan, König von Zypern, Jerusalem und Armenien, auf seiner Reise in den Kaukasus begleiten und alle Geheimnisse seines Planes zur Rettung der Christenheit, die mir offenbart werden, bewahren. Ich werde das Leben seines Sohnes Guy de Lusignan mehr schützen als mein eigenes. Solange Leben in mir ist und so wahr mir Gott helfe. Amen.«
Anschließend nahm der König ein auf dem Tisch liegendes Dokument zur Hand und entrollte das dünne Pergament überaus vorsichtig. »Vier Jahre lang habe ich in Alexandria nach dieser Karte gesucht, die die armenische Abschrift einer Karte aus dem Besitz der Jünger des Philosophen Pythagoras ist. Ich habe etwas in meinem Besitz, was ›das Auge Gottes‹ genannt wird. Meine Männer werden es auf die CATHERINE verladen.« Das Gesicht des Königs war grau, seine Augen brannten übermüdet.
»Diese Karte führt uns zu dem zweiten ›Auge Gottes‹. Es wird in den Bergen deiner Heimat Armenien in einem Kloster aufbewahrt, das den Namen Lusavank trägt. Wem es gelingt, Gott seine Augen zurückzubringen, der wird …« Der König blickte Kartian versteinert an, erschrocken vor der Ungeheuerlichkeit des Satzes, den er jetzt sagen würde. Seine Stimme war heiser, »… über Gottes Macht verfügen, sodass sich die Welt vor ihm beugen wird.«
Er ging in dem stillen Raum umher. Abendkühle wehte von den Bergen in feuchten Schwaden herein.
»Mit dieser Macht ausgestattet, werden wir Asien und Afrika unter das Schwert Christi bringen. Du wirst alles tun, um mich in deiner Heimat zu dem Ort zu führen, der in diesem Dokument verzeichnet ist.«
Kartian standen Schweißperlen auf der Stirn. »Das Auge Gottes«. Ein Licht, das nach der Legende Krankheit und Tod verbreiten oder Heilung, Kraft und ewige Jugend bedeuten konnte.
Pierre I war ein Kriegsherr, den Kartian in Alexandria als einen skrupellosen Schlächter erlebt hatte. Wenn ihm wirklich gelingen sollte, was er plante, würde die Welt ein schrecklicher Ort werden.
»Majestät«, begann Kartian. »Ich habe geschworen, Euren Sohn zu schützen. Wegen dieses Schwures spreche ich zu Euch, danach werde ich schweigen und alles tun, was ich kann, ihn zu schützen, was immer Euer Weg von hier an sein wird.« Der König hielt in seiner ruhelosen Bewegung inne.
»Nur Ihr kennt das ›Auge Gottes‹ und die Macht, die es Euch schon heute verleiht. Wenn wir Gott seine Augen geben, wird er die Welt, die er geschaffen hat, bis in den fernsten Winkel des letzten Herzens erkennen. Er wird sein Werk begutachten und darüber richten. Es wird der Tag des Jüngsten Gerichtes werden, Majestät. Die Reiter des Schwarzen Todes und der anderen Plagen der Apokalypse werden unerbittlich über die Menschheit kommen. Kann es Teil meines Gelübdes zum Schutz Eures Sohnes sein, diesen Tag herbeizuführen?« Nach diesen Worten fiel Kartian auf die Knie und senkte demütig seinen Kopf vor dem König.
Es gab niemanden in der Umgebung des Königs, der den armenischen Kaukasus kannte. Das war seine Lebensversicherung.
»Und du glaubst, Magister, dass die Welt nur deshalb noch existiert, weil Gott seine Augen verloren hat und erblindet ist?«, vernahm Kartian die heisere Stimme des Königs.
Genau das war Kartians Überzeugung. Es konnte nicht anders sein. Dieses schreckliche Jahrhundert stellte den Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte dar, und der Tiefpunkt dieses Jahrhunderts schien noch immer nicht erreicht.
»Lass es niemanden hören. Steh jetzt auf und tue deine Pflicht. Wir werden bald in See stechen.« Rückwärts gehend verließ Kartian den Raum. Dabei fiel sein Blick auf den Kamin an der Ostseite der Bibliothek und das darüber prangende Mischwesen im Familienwappen der Lusignans – eine Frau, deren Beine in Schlangen ausliefen und aus deren Rücken riesige Fledermausflügel wuchsen. Die Melusine. Die legendäre Urmutter der Königsfamilie de Lusignan, um die sich die lateinische Inschrift »in prescientiae dei« rankte.
Kurz vor Verlassen der königlichen Bibliothek bemerkte Kartian, wie der König die Karte zusammenrollte und in einer goldenen Röhre verschloss, die er an einer um seinen Hals liegenden Kette befestigte.
Die Kämpfe zwischen den Männern des Königs und den Verfolgern schreckten Kartian aus seiner Erinnerung auf.
Die CATHERINE schwankte auf dem Kamm einer heranrollenden Welle. Die Männer am Kranausleger waren für einen Moment unaufmerksam, der Stein sackte durch, schlug auf die Planken, die von der Mole in das große Ladeschott führten, und zerschmetterte sie.
Einen atemlosen Augenblick lang breitete sich Entsetzen aus wie Wasser in einem sinkenden Schiff. Die Angreifer rückten vor. Ein Schwarm von Meteoriten stürzte glühend vom Himmel.
Wie flüssiges Metall fuhr jetzt der König selbst in den Haufen der Angreifer. Seine Arme kämpften, als seien sie zwei eigenständige Krieger. Mit einem Hieb seines Langschwertes in der Rechten trennte er zwei Angreifern die Köpfe vom Hals, während das Kurzschwert in der Linken unaufhörlich in die Leiber seiner Gegner stieß. Der Kampf war so schnell, dass Kartian der Kopf schwirrte. Im Flackerlicht der Fackeln, im Heulen des Sturms, im Geschrei und Waffengeklirr schien der König in jeder Sekunde an einem anderen Ort zu stehen, so blitzartig bewegte er sich. Einen nach dem anderen entledigte er sich der Angreiferschar, als wäre er der Tod persönlich. Der eiserne Geruch des umherspritzenden Blutes drang bis zu Kartian hinunter. Keiner der Angreifer hatte eine Chance, tiefer am Felsen in den Rücken des Königs zu gelangen. Niemand, der in seine Reichweite gelangte, überlebte. Einem legte er die bloße Hand auf den Schädel und zerquetschte ihn wie eine Frucht. Noch niemals hatte Kartian etwas derartig Schreckliches gesehen.
Den Männern unten am Schiff gelang es, neue Planken in die Ladeöffnung zu legen. Die Steinplatte lag nun auf hölzernen Rollen zwischen Bordwand und Schiff. Nur noch einen Wimpernschlag und das Entscheidende war geschafft.
Oben am Hang versuchte ein rothaariger Riese, sich an dem König vorbei in dessen Rücken zu schleichen.
Eine heranrollende Welle hob die CATHERINE an. Für den Bruchteil eines Atemzuges stand das Ladeschott höher als die Mole. Dadurch kehrte sich das Gefälle der Planke um und die steinerne Platte rollte begleitet von einem vielstimmigen Aufschrei auf ihrem Balkenlager zurück an Land.
Als der König dorthin blickte, trennte ihm der beidhändig geführte Schlag des rothaarigen Riesen den Kopf von den Schultern. Meterweit spritzte der Blutstrahl, den sein Herz aus dem Rumpf pumpte. Der Rumpf trudelte, fiel und rollte den Felsen hinab. Vom Stumpf seines Halses löste sich eine Kette, an der ein verschlossenes goldenes Rohr hing, und blieb kurz vor der Klippe im Gras hängen, während der Rumpf des Königs weiterrollte und vor dem Bug der CATHERINE im kochenden Meer verschwand. Kartian ergriff die Kette und legte sie sich unter seiner Kleidung um den Hals.
Als sich sein Blick nach oben wandte, sah er den Kopf des Königs ihm entgegenrollen. Für einen Moment war er unfähig, sich in Bewegung zu setzen.
Während die CATHERINE in ein Wellental tanzte, rollte die große Platte sanft in den Laderaum. Sie wurde vertäut und verkeilt, der große Schott schloss sich. Männer mit kochendem Pech standen bereit, die Bordwand neu zu kalfatern.
Der Rothaarige erreichte den Kopf des Königs. Er packte ihn an den Haaren und streckte ihn seinen jubelnden Leuten entgegen.
Die CATHERINE legte ab. Seile wurden eingeholt und die Segel wurden gesetzt. In großen Sätzen lief Kartian die Felsen hinab an die Mole. Mit einem verzweifelten Sprung klammerte er sich an die Bordwand des Schiffes. Über ihm hinter der Reling stand Guy, der zehnjährige Sohn des Königs. Blassblaue Augen sahen ihn kalt an, und eine Kinder-hand, auf deren Rücken ein Muttermal in Gestalt eines umgekehrten Y prangte, gab ein Zeichen, auf das hin er an Bord gezogen wurde.
Ausgestattet mit einer rätselhaften Macht, verließ die CATHERINE in den frühen Morgenstunden des zweiten Oktober dreizehnhundertneunundsechzig unter dem Zeichen der Melusine auf ihrem großen Rahsegel im Widerschein der brennenden Festung den Hafen von Kyrenia.
CATHERINE
16. Juli
Präzise gesteuert von geostationären Satelliten, die in sechsunddreißigtausend Kilometer Höhe über der Erdoberfläche standen, zog die SEA WASP stetig ihre vorgegebene Bahn in Richtung Nordost. Als sie eine Position bei 42 Grad 29 Minuten nördlicher Breite, 40 Grad 48 Minuten östlicher Länge erreichte, war es kurz vor zwei Uhr am Nachmittag. Nicht mehr lange bis zum festgelegten Umkehrpunkt bei 42 Grad 30 Minuten. Dann würde sie im parallelen Sektor vor den Küsten Georgiens und der Türkei auf dem Rückweg nach Süden weitersuchen.
Kein Hauch rührte sich an Bord. Bei ihrer Fahrt von zwölf Knoten hoben sich der Fahrtwind und ein leichter Südwest zu glutheißer Stille auf. Die blaue Fahne am Heck mit einem goldenen griechischen Buchstaben PHI hing schlaff von ihrem Mast herunter. Soeben hatte der Wetterbericht für die nächste Woche die Fortsetzung der Hochdrucklage über dem östlichen Teil des Schwarzen Meeres angekündigt.
Anahit Sarian verließ den Beobachtungsraum, um sich für ein paar Minuten an Deck zu strecken. Sie saß bereits vier Stunden ununterbrochen vor dem Monitor des Side-Scan-Sonars. Vor ihr wühlten die beiden Heckrotoren der SEA WASP in dem wie bleiern daliegenden Meer.
Ihr größtes Vergnügen bestand darin, barfuß über die Planken des Decks zu gehen. Dabei hatte sie das Gefühl, durch ihre Fußsohlen die bewegte Geschichte des Schiffes zu spüren – über die Bordwand rollende Brecher der Nordsee bei Versorgungsfahrten zu den Bohrinseln vor der schottischen Küste oder den langen trägen Seegang in der Karibik. Anahit trug weiße Shorts und eine ausgewaschene, weit offene rote Bluse, an deren Revers ein kleiner silberner Leuchtturm steckte. Mehr als zwei Kleidungsstücke waren ihr bei dieser Hitze unerträglich.
Ein weißer Schmetterling hatte es geschafft, an Bord zu gelangen. Ohne von einem Lufthauch gestört zu werden, ließ er sich auf dem Ankerspill links von ihr nieder. Sie hatte noch zwei Stunden Beobachtungszeit bei Tage vor sich und danach weitere vier Stunden in der Nacht. Was ihr anfangs so leicht erschienen war, hatte sich zu einer Tortur entwickelt. Seit Wochen jeden Tag zwischen acht und zwölf Stunden – und immer vergeblich.
»Das ist das Prinzip einer Schatzsuche«, hatte Rock, der Leiter des Projektes PHIDIAS, erklärt, »die meiste Zeit findet man nichts. Wäre es anders, wäre uns längst jemand zuvorgekommen.« Roger Penfield, ein dunkelhaariger schlanker Amerikaner von Mitte fünfzig aus North Carolina, der es liebte, Rock genannt zu werden, musste es wissen. Er war bereits mit zwei eigenen Schatzsucherunternehmen in der Karibik bankrottgegangen, weil andere schneller gewesen waren.
Seit fünfzehn Jahren war Rock für Mareology Inc., Amsterdam, auf dem zum Forschungsschiff umgerüsteten ehemaligen Bohrinselversorger SEA WASP im Schwarzen Meer auf der Jagd nach einer am Ende des vierzehnten Jahrhunderts versunkenen zyprischen Karacke – allerdings mit langen Unterbrechungen, in denen die Spuren des Projektes PHIDIAS nicht auf dem Meer, sondern in Schiffskatastern, Archiven oder staatlichen Registern in Sevilla, Paris oder bei Lloyds of London verfolgt wurden.
Anahit blickte auf das Meer hinaus. Die letzten zwei Monate hatte sie ununterbrochen mit ihren Sinnen unter seiner Oberfläche verbracht. Gemeinsam mit der Crew der SEA WASP beobachtete sie auf den Monitoren des Sonars den Schlick am Grund des Schwarzen Meeres. Vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Zu ihrer Erlösung brauchten sie weiter nichts als den richtigen Schatten, die richtige Struktur, die sich unter dem Sand abzeichnete.
Jon Wengren stand an Deck im schützenden Schatten und beobachtete Anahit, die auf einem Poller saß und in die Wasserstrudel am Heck blickte. Ohne dass sie es bemerkte, setzte sich ein weißer Schmetterling auf ihre schwarzen Haare. Sie muss ein besonderes Bündnis geschlossen haben, dachte er.
Noch immer begriff Jon nicht recht, wieso eine Achtundzwanzigjährige sich in der Geschichte des vierzehnten Jahrhunderts bewegte, sich mit Schiffen, Uniformen, Münzen, antiken Handelsrouten des Mittelmeers und des Schwarzen Meeres auskannte, als hätte sie diese selbst befahren.
Er konnte die Augen nicht von Anahits zierlichem, aber ganz und gar nicht kurvenlosem Körper und ihrem Gesicht mit dem klassischen Profil und den schwarzen Augen abwenden. Am unteren Rand der Iris blitzte ein feiner weißer Streifen auf, der ihrem Blick etwas Starkes, ja Abweisendes verlieh. Wen diese Augen einmal voller Hoffnung und Erwartung ansahen, würde die Last einer Verpflichtung mit Haut und Haaren tragen müssen.
Sie schien es zu genießen, allein zu sein, vielleicht weil sie befürchtete, mit dem Verlust der Distanz an Unabhängigkeit einzubüßen. Während sie jetzt unbeweglich auf dem Poller saß, fielen ihr die Haare in langen schwarzen Locken auf die Schultern. Unter ihrer offenen roten Bluse konnte Jon ihre kleinen festen Brüste erkennen.
Seine ersten Taucherfahrungen hatte Jon Wengren bei der Demontage der norwegischen Bohrplattform CRYSTAL IV in der nördlichen Nordsee gewonnen. Seither waren schwere Präzisionsarbeiten in großen Wassertiefen mit dem Jim Suit, einer roboterähnlichen Tiefseetaucherrüstung, seine Spezialität.
Als der schützende Schatten schmaler wurde, lehnte sich Jon mit dem Rücken an die Wand. Sein schmerzender Sonnenbrand brachte ihn auf andere Gedanken. Das Projekt PHIDIAS besaß eine Dimension, die ihm den Schlaf raubte, wenn er nachts daran dachte.
19. Juli
Die Lampe in ihrer Kabine verbreitete mildes Licht, dennoch konnte Anahit nicht einschlafen. Wann immer sie die Augen schloss, befand sie sich in der Dunkelheit, in der sie niemals wieder sein wollte. Das schwarze Wasser lag vor ihr wie ein wartendes Tier, sie zitterte am ganzen Körper. Wenn sie doch nur mit offenen Augen schlafen könnte. Ihr war kalt. Alles um sie her war nass. Ihre Hände fühlten sich an wie blutige Klumpen.
Sie erhob sich und ging an Deck. Aus Penfields Kabine erklang leise Perry Como. Too many miles, too many days, too many nights to be alone …
Es war zwei Uhr früh. Jon stand mit André Vossgut, dem belgischen Meeresbiologen aus ihrer Crew, an der Reling. Sie sahen in die warme, sternenhelle Nacht und waren in eine leise Unterhaltung vertieft. Anahit stellte sich zu ihnen und blickte auf das ruhige Meer. Hoch über ihnen zog ein Keil von Wildgänsen in Richtung der türkischen Küste.
»Man glaubt es nicht«, sagte der Biologe, »aber dieses schöne Meer ist das toteste Meer des Planeten – übersalzen, verdreckt, überfischt, artenarm.« Anahit achtete nicht besonders auf seine Worte, es war eine schöne laue Sommernacht in der Gesellschaft angenehmer Menschen, was wollte sie mehr? Sie wusste schon jetzt, dass sie sich später wehmütig an Nächte wie diese erinnern würde.
»Hast du ein Problem mit dieser schönen Nacht, André?«, fragte sie. Sie wusste inzwischen, dass er umso mehr Probleme in einer Sache entdecken musste, je zufriedener die anderen damit waren.
»Jeder, der um diese Zeit an der Reling steht, hat ein Problem mit der Nacht«, war die Antwort. Sie lachten. André wurde ernst.
»Wir verdanken die Schönheit, die wir jetzt genießen, nur einer dünnen Schicht Wasser. Eigentlich müsste es stinken wie von einer Million faulen Eiern, weil das Meer in den unteren zweitausend Metern tot, verfault und giftig wie Schwefelsäure ist.«
»Jon wird begeistert sein, da hineinzutauchen.«
»Das wird er tatsächlich, weil alles so schön tot und übersichtlich ist. Für einen Taucher gibt es nichts Besseres.«
Jon legte seine Hand auf Anahits Arm, als wollte er ihr signalisieren, sie solle sich nicht aufregen, der Biologe sei nun mal eine Nervensäge, die gern anderen die Stimmung vermieste. Aber diese Geschichte beunruhigte Anahit keineswegs, und André ließ sich nicht bremsen.
»Ich will nicht leugnen, dass es Lebensformen gibt, die mit allem zurechtkommen, auch wenn ich sie nicht als Kuscheltiere haben wollte. Vor zwanzig Jahren haben wir vor der türkischen Küste eine Invasion von Rippenquallen aus dem Atlantik untersucht«, setzte Vossgut seine Rede fort, die Anahit schon deshalb zu genießen begann, weil er trotz seiner schlechten Botschaften eine leise ruhige Stimme hatte, die ein sanfter Bestandteil dieser wunderbaren Nacht war. Der Ton seiner Stimme half ihr, diese Ruhe in sich aufzunehmen. Vielleicht würde sie später doch noch einschlafen können. »Nichts im Biosystem des Schwarzen Meeres wurde mit den Quallen fertig, sie fraßen die Larven aller Fische und dezimierten Fischbestände um neunzig Prozent, sie verdoppelten alle vierundzwanzig Stunden ihr Gewicht. Schließlich gab es eine Milliarde Tonnen von ihnen, mehr als der Weltfischfang eines Jahres.«
»Was geschah danach?«, fragte Anahit. Irgendwo schrie eine Möwe, die einen Platz auf der SEA WASP gefunden haben musste.
»Zehn Jahre später tauchte die Melonenqualle auf, die mit Vorliebe Rippenquallen verschlang.« Vossgut wandte seinen Rücken dem Meer zu und blickte in den im Osten heraufdämmernden Tag. »Ich gehe ins Bett. Irgendwann werden wir etwas finden, dann werden wir nicht mehr zum Schlafen kommen.« Zögerlich machte er einige Schritte in Richtung der Kabinen. »Das menschengemachte Biosystem scheint mir ähnlich fragil wie das Schwarze Meer, verdreckt, genetisch verarmt, in seinen Tiefen bereits tot. Ich habe das Gefühl, der Blick ins Schwarze Meer ist ein Blick in die Zukunft.« Mit einem stummen Winken verabschiedete er sich.
Anahit mochte den Biologen, auch wenn er an der Angst vor der Zukunft zu verzweifeln schien. Vielleicht wusste er einfach zu viel, um sich wohl zu fühlen.
»Wie einfach ist das Leben eines Historikers«, sagte sie zu Jon, »der sich nur um die Vergangenheit Sorgen machen muss.« Sie hatte noch nicht die Absicht, zurück in ihre Kabine zu gehen, dazu fühlte sie sich an Deck zu sicher vor den Alpträumen, die sich in ihrem Kopf melden würden, sobald sie allein war. Und die ihr immer wieder bewiesen, welche Schrecken die Vergangenheit barg.
»Du müsstest als Historikerin doch wissen, wonach genau wir in dem Wrack der CATHERINE eigentlich suchen«, begann Jon eine Rede, die sich anhörte, als trage er sie schon lange mit sich herum. Anahit war nicht im Geringsten danach zumute, einen vorgezogenen Arbeitstag einzulegen, aber sie ahnte, dass Jon es nicht bei einer Frage belassen würde. Jon war ein schweigsamer Kerl. Was immer er sich zurechtgelegt hatte, um es mit ihr zu besprechen, er hatte es sich bestimmt lange genug überlegt.
»Die CATHERINE soll Kunstgegenstände mit sich geführt haben«, antwortete Anahit. »Statuen, Mosaike für den georgischen König Bagrat V, zu dem Pierre I als König Armeniens gute Beziehungen gepflegt hatte. Vielleicht wollte er sich mit Schätzen, die er auf seinem letzten Raubzug nach Alexandria erbeutet hatte, einen ruhigen Lebensabend in Georgien erkaufen.«
»Hast du dir mal überlegt, was die Expedition der SEA WASP für Geld verschlingt? Sieh dir das Schiff an. Es ist fünfzig Meter lang, Suchschiff und Bergungsplattform in einem, ausgestattet mit dem Besten, was die Untermeeresforschung heute zu bieten hat. Es hat Unterwasserroboter an Bord, einsetzbar bis zu dreitausend Meter Tiefe, entsprechende automatische Kamerasysteme, Side-Scan-Sonar und Dutzende verschiedener anderer Systeme, Nuklearresonanz-Magnetometer, um tief im Schlick des Meeresgrundes Metallen auf die Spur zu kommen, Radar und Funksysteme, automatische Positionsfixierung mit vier Schubdüsen und zwei steuerbaren Heckschrauben. Ein komplett umgebautes Schiff, tausend Tonnen Tragfähigkeit, Dieselantrieb von siebentausendzweihundert PS. Selbst das Zodiac dort drüben ist mit Satellitennavigation, Tank und Motor ausgestattet, dass man es damit die einhundertfünfzig Kilometer bis zur Küste Georgiens schaffen könnte. Die SEA WASP dürfte das aufwendigste Schiff sein, mit dem man zurzeit in der Branche nach Schätzen sucht. Und sie tut es seit fünfzehn Jahren.«
Anahit spürte, wie ihr unwohl wurde. Allmählich bekam sie einen nebelhaften Eindruck davon, worauf sie sich bei dieser Exkursion eingelassen hatte. Sie fragte sich, worauf er hinauswollte. Den immensen Aufwendungen bei dieser Expedition musste ein unglaublicher Wert entgegenstehen. War es das? Hatte Jon einen Hinweis, wonach sie in dem Wrack suchten, das sie zu finden hofften?
»Ich habe eine Zahl gesehen, die mir plausibel erscheint, fünfzig Millionen Dollar für PHIDIAS über all die Jahre.« Plötzlich waren Schritte zu hören und Jon machte eine Pause.
Toros, der Koch der Crew, war an Deck gekommen. Er blieb in seinem weißen Leinenanzug vorn an der Reling stehen, beide Hände, die groß wie Schraubstockbacken waren, auf seinen Leib gepresst, das Gesicht schmerzverzerrt. Er war ein unheimlicher Bursche, fand Anahit. Irgendwas stimmte nicht an ihm. Seine Augen und seine schwarz gefärbten Haare passten nicht zu dem Alter seines verwitterten Gesichtes. Sie schätzte ihn auf über siebzig. Zudem hatte sie mitbekommen, wie er sich mit jedem aus der Mannschaft in dessen Muttersprache unterhalten hatte. Norwegisch, Englisch, Armenisch, Französisch, Afrikaans. Er blickte kurz zu ihnen herüber und verschwand, als sie keine Anstalten machten, das Feld zu räumen.
Jon sah Anahit in die Augen, um sich zu vergewissern, dass sie ihm aufmerksam zuhörte, und fuhr dann fort: »Die Schatzsuche ist ein Hochrisikogeschäft. Die Einnahmen müssen das Zehnfache der Kosten erwarten lassen. Bei der Bergung der CATHERINE muss es für Mareology um eine halbe Milliarde Dollar gehen. PHIDIAS bewegt sich in der obersten Liga der Schatzsucher. In einer Klasse mit Tommy Thompson und seiner Columbus-America-Discovery-Group, die 1988 aus der Central America zwanzig Tonnen Gold im Wert von einer Milliarde Dollar holten.«
Anahit blieb die Spucke weg.
»Woher soll so viel Geld kommen?«, fragte sie entgeistert. In dieser Weise hatte sie noch nie über die stupide Beschäftigung nachgedacht, den Meeresgrund zu beobachten. »Wir suchen keinen Goldtransporter. Die CATHERINE hatte Kunstgegenstände an Bord. Was sollen die bringen?«
»Das ist das große Rätsel. Niemand spricht darüber, aber mit Sicherheit stellen sich alle dieselbe Frage: Was ist es, das diesen ungeheuren Aufwand in Wahrheit rechtfertigt?«
Anahit überlegte laut. »Phidias, der legendäre Bildhauer der Antike? Er lebte zweitausend Jahre bevor das Schiff in See stach. Er hat sagenhafte Kunstwerke geschaffen, von denen keines erhalten ist. Was soll da unten liegen? Der Inhalt eines ganzen Museums?«
Eine Weile schwiegen beide nachdenklich. Anahit war inzwischen angesteckt von Jons offensichtlicher Beunruhigung. Die ganze Zeit an Bord hatte sie nichts von alldem gemerkt, weil sie mit sich selbst beschäftigt war. Mit Ängsten, die sie seit einer Ewigkeit mit sich herumschleppte. Mit Schuldgefühlen. Ihre Gegenwart hatte sie vollkommen ausgeblendet.
»Es gibt ein legendäres Kunstwerk des Phidias«, sagte sie schließlich, »eines der sieben Weltwunder. Es war das Nationalheiligtum der Griechen der Antike – die Zeusstatue von Olympia. Sie war zwölf Meter hoch, mit Gold, Elfenbein und Ebenholz verkleidet und mit Edelsteinen verziert. Sie wurde vierhundertdreißig vor Christus von Phidias fertiggestellt und achthundert Jahre später nach Konstantinopel gebracht. Wenn sie intakt im Wasser läge, würde ihr Fund den der Titanic in den Schatten stellen. Bedauerlicherweise ist sie fünfzig Jahre nach ihrer Aufstellung in Konstantinopel verbrannt.« Nach dem Ende ihrer Rede war das Rätsel umso größer geworden.
»Ich habe kein gutes Gefühl.« Jon schob sich etwas näher an Anahit heran, im Osten ging gerade die Sonne auf. »Etwas läuft hinter den Kulissen ab, das mir unheimlich ist. Als Taucher hänge ich ebenfalls an einem sehr fragilen Biosystem.« Er legte leicht den Arm auf ihre Schulter. Anahit ließ es geschehen, an diesem frühen Morgen wollte sie alle Wärme aufsaugen, die ihr geschenkt wurde. Sie würde sie brauchen, um wenigstens noch ein paar Stunden schlafen zu können.
»Ich werde Hunderte Meter unter der Wasseroberfläche sein. Mit jedem Atemzug aus den Versorgungsschläuchen werde ich davon abhängen, dass hier oben alles geordnet zugeht.« Jon zögerte erneut und holte dann tief Luft. Seine Hand berührte ihre. »Ich möchte dich bitten, meine Versorgung zu überwachen.«
21. Juli
Ein Gewitter lag in der Luft. Schon die ganze Nacht über war es drückend schwül, ohne jeden Hauch einer Brise. Um fünf Uhr früh fand Anahit sich damit ab, dass es wieder einmal eine der Nächte war, in denen ihre Grübeleien sie am Einschlafen hinderten.
Sie legte eine CD mit Liedern des klassischen armenischen Komponisten Komitas ein, »Mondlicht«, zarte, einfache Melodien, gesungen in einem klaren Sopran von Lusine Azaryan. Vielleicht konnte sie dabei ein wenig vor sich hin träumen und schließlich doch noch Schlaf finden.
Aber sie blieb wach, die quälende Erinnerung an das schwarze Wasser war stärker als die Wirkung der Musik. Also stand sie auf, schaltete den CD-Player aus und ging an Deck.
Sie horchte in die Dunkelheit. Irgendwo war ein Stöhnen zu hören, der gedehnte Schrei eines unterdrückten Schmerzes, wie von einem verletzten Tier. Es machte ihr Angst. Es strahlte eine zerstörerische Kraft aus, eine Mischung aus Gewalttätigkeit und hingebungsvoller Todeserwartung. Ein Stöhnen wie ein Gebet.
Das Geräusch kam aus der Küche, in der kein Licht brannte. Im hereindringenden Dämmerschein der Deckbeleuchtung erkannte sie einen über den Herd gebeugten Schatten. Zwei Platten glühten in sanftem Rot, ausgespart jeweils die Form einer riesigen Pranke. Toros, der Koch, presste seine Hände absichtlich auf die eingeschalteten Herdplatten! Versuchte er, den Schmerz in seinem Bauch zu überdecken? Nach dem, was sie an Deck beobachtet hatte, schien es ihn von innen förmlich zu zerreißen.
Offenbar spürte er, dass ihn jemand beobachtete, denn im nächsten Moment klackten Schalter, das Rot verglomm, und die Schatten der Hände verschmolzen mit der Dunkelheit. Kein Geräusch war mehr zu hören.
Anahit lief zurück an Deck. In dem Beobachtungsraum hingen André, der belgische Biologe, und Piet, der Bergungsspezialist, in ihren Sesseln. Piet trug seinen riesigen afrikanischen Hut auf dem Kopf, von dem Jon behauptete, er wäre eine Pizza, deren Haltbarkeit bei Piets Geburt abgelaufen war.
»Hat jemand Interesse an einem Kaffee?«, fragte sie in den Raum hinein. Beide hoben müde die Hand, ohne den Blick vom Monitor zu wenden. Anahit holte drei Becher Kaffee aus der Maschine und setzte sich dazu. Im Hintergrund sang Norah Jones: »If I were a painter …«
Anahit nahm einen Bleistift mit Radiergummi vom Tisch und tippte nervös auf den Flachbildmonitor, während die anderen ihre Nasen in den Duft ihres frischen Kaffees versenkten. Noch immer war sie in Gedanken bei dem erschreckenden Ritual, bei dem sie den Koch überrascht hatte.
Minutenlang gab es nur Schweigen, Musik und den in Zeitlupe vorbeikriechenden Meeresgrund. Alle drei sanken immer tiefer in ihre Sessel. Plötzlich richtete Anahit sich auf.
»Dort!«, sagte sie lauter als beabsichtigt. Die beiden schraken hoch.
»Wo?«
»Es ist vorbei, lasst die Aufzeichnung ein Stück zurücklaufen. Es sah aus wie ein Haufen Bretter. Kein Schiff.« Piet spulte zurück. Tatsächlich, da lagen Bretter oder Hölzer. Farblich hoben sie sich kaum von ihrer Umgebung ab, deshalb waren sie leicht zu übersehen. Doch bei genauerer Betrachtung war es ein ganzer Haufen Bretter. Verstreut über einen Abschnitt von fast dreihundert Metern. Kein Zweifel. Da war etwas. In 266 Meter Tiefe. 41 Grad 57 Minuten nördlicher Breite und 39 Grad 59 Minuten östlicher Länge.
»Es könnte etwas sein, was ein Schiff verloren hat«, sagte Anahit. Ihre Hand schwebte über dem Signalknopf, während sie sich ansahen. Alle nickten. Kaum hatte sie den Knopf gedrückt, dröhnte ein infernalisches Signal durchs ganze Schiff. André gab die Koordinaten in die satellitengesteuerte Positionsautomatik, die daraufhin die Steuerung des Schiffes übernahm. Langsam tastete sich die SEA WASP zurück zur Sichtungskoordinate.
Die Aktionen, auf die alle wochenlang gewartet hatten, konnten endlich beginnen. Zuallererst mussten sie mit der Kamera runter, um genau nachzusehen, auf was sie gestoßen waren. Jon machte den Kameraschlitten Polyphem und den daranhängenden Tiefseeroboter Creeper fertig. Die Kabel wurden in die Ablauftrommeln geklinkt, und die Technik der Videokameras sowie der Kommunikations- und Steckverbindungen wurde getestet.
Penfield ordnete mürrisch an, das ganze Programm anlaufen zu lassen.
»Wir sehen uns an, was wir haben. Aber macht euch noch nicht in die Hosen. Was wir suchen, sieht anders aus.« Dann zog er sich zu einer längeren Telefonkonferenz mit seinen Auftraggebern in seine Kabine zurück, in der er seinen Klotz von Iridium-Handy mit doppelt dicker Batterie aufbewahrte. Es kommunizierte über ein spezielles weltweites Netz von sechsundsechzig Satelliten, war vollgepackt mit Technik und besaß den Vorzug, von jedem Punkt der Welt aus zu funktionieren.
Kapitän Brink Cousman, ein noch nicht ganz fünfzigjähriger ruhiger Holländer aus Delft, seit zwei Jahren Kapitän der SEA WASP und davor achtzehn Jahre lang als Erster Offizier auf dem britischen Rohöltanker POLLUX, half Anahit, den großen Tagungsraum in Betrieb zu nehmen, vier nicht benötigte Mannschaftskabinen, die zu einem Lagezentrum zusammengelegt worden waren. Sie mussten die Rechner hochfahren, die drei Projektoren anschließen und alle notwendigen Verbindungen schalten.
Anahit heftete die große Karte der Meeresströmungen und Windrichtungen, wie sie im Herbst 1369 geherrscht haben könnten, an eine Wand. Darauf waren die Meerestiefenlinien eingezeichnet – unter ihnen auch die rote Linie, die den Beginn der anaeroben Schicht des Tiefenwassers markierte. Auf einen der Beamer legte sie die Simulation der CATHERINE, eine dreidimensional im Raum schwebende dreimastige Karacke, auf Vorder- und Achterschiff kastellartige Aufbauten.
»Was zum Henker suchen wir in dem Schiff?«, fragte Piet flüsternd. »Es können doch nicht nur Standbilder und Mosaike sein?«
Gegen Mittag waren alle Systeme erfolgreich getestet, Penfield hatte seine Gespräche mit den Geldgebern beendet und sah wieder freundlicher aus. Jon nahm an seinem Steuergerät Platz. Sie gingen in die Tiefe.
Der automatische Kameraschlitten Polyphem verfügte über starke Halogenscheinwerfer, zweimal 500 und einmal 1500 Watt. Seine Position wurde automatisch mit dem Sonarsignal abgeglichen und entsprechend gesteuert. Nach einer halben Stunde hatten sie den Meeresboden auf dem Projektor. Kein lebendes Wesen war zu sehen, nur die sanften Täler und Senken der Ablagerungen organischer Reste, die seit Tausenden von Jahren auf den Grund des Meeres rieselten.
Polyphem, ein offener Stahlrahmen voll Elektronik und Optik, bewegte sich mit seinem eigenen Elektroantrieb voran und zeigte ihnen Bilder einer Unterwasserwüste. Plötzlich unterdrückte Schreie. Die ersten Gegenstände, dann mehr, ganze Haufen. Jon zoomte näher heran.
»Es sind Knochen«, stellte André Vossgut nüchtern fest. Tatsächlich waren es Unmengen von Knochen auf erstaunlich eng begrenztem Gebiet.
»Knochen von Menschen und von Pferden«, sagte André, »es müssen Hunderte sein.« Er wandte sich an Anahit. »Wie viele Menschen gab es an Bord?«
Anahit war noch ganz überwältigt davon, dass endlich bei allen das Jagdfieber nach Überbleibseln aus dem Mittelalter ausgebrochen war. Es ging nicht mehr nur um Karten und Register, jetzt lag das Schicksal der Seefahrer direkt vor ihnen. Vor ihren Augen war etwas aufgetaucht, was seit sechshundertvierzig Jahren kein Mensch gesehen hatte. Sie räusperte sich, bevor sie antwortete: »Es gibt nur Schätzungen. Sie liegen bei einhundert Menschen und fünfzig Pferden.« Alle starrten gebannt auf die Knochenlandschaft. Alle fragten sich, was damals geschehen sein mochte, aber keiner von ihnen sagte einen Ton.
»Alles spricht dafür«, erklärte Anahit schließlich, »dass die Mannschaft unter dem Kinderkönig Guy de Lusignan unterwegs nach Georgien war, mit Geschenken, die vermutlich Beutestücke der letzten Kreuzzüge waren.«
»Wir suchen das Schiff«, sagte Penfield. »Die Gebeine lassen wir lieber in Frieden und verschwenden nicht unsere Zeit damit. Wer weiß, woher die kommen? Vielleicht waren es Armenier, die ein türkisches Schiff im Ersten Weltkrieg über Bord gehen ließ.«
»Wir können nachsehen«, schlug Jon vor. »Wo Knochen sind, ist noch mehr.« Er holte den Creeper näher heran, gehüllt in das gleißende Licht des Kameraschlittens. Er suchte lange, bis er ein nahezu vollständiges Skelett sah. Mit haarfeinen Düsen spülte der Creeper den Sand beiseite. Nichts. Formen von Schwertern, deren Metall sich in schwarzen Schlamm verwandelt hatte.
»Was ist das?«, fragte Jon. Unter hochgespültem Schlick lag ein Haufen auseinandergefallener kleiner Scheiben.
»Goldmünzen«, vermutete Penfield. »Das einzige Metall, das sechshundert Jahre in der Hölle dort unten bestehen konnte.«
Ohne eine entsprechende Anweisung zu erhalten, ließ Jon die Manipulatoren die Metallstücke in einen Behälter füllen, der an der Seite des Creeper angeschraubt war.
Eine Stunde später lagen die von zähem, nach faulen Eiern stinkendem Schlamm verklumpten Münzen im Laborraum auf einem großen Tisch. Anahit gab einige der Münzen in ein Ultraschallbad, um den Schmutz zu entfernen und sie voneinander zu trennen. Während Vossgut eine Münze nach der Entnahme vorsichtig mit einem Tuch abrieb, machte sie eine kleine Videokamera an einem Stativ bereit. In schräg einstrahlendem grellem Licht, das die Einprägungen als Schatten gut sichtbar machte, nahm sie Vorder- und Rückseite des gereinigten Exemplars auf. Die Münze war erstaunlich gut erhalten.
Sie gingen zurück in das Lagezentrum, in dem die anderen ungeduldig warteten. Anahit erklärte ihnen, was sie sahen.
»Auf der Vorderseite der Münze prangt das Bild eines Königs, der ein Schwert und einen Schild hält. Er steht in einem Schiff, das auf einer Welle schwebt. Die Rückseite zeigt in den acht Bögen eines Achtpass das Blumenkreuz, in dessen Winkeln man Leoparden mit Kronen erkennen kann.«
»Das sehen wir selbst«, sagte Penfield ungeduldig, »aber was bedeutet es?«
»Was dort unten herumliegt, sind Schiffsnobel«, antwortete Anahit. »Eine englische Handelsmünze, die nach 1344 für einhundertzwanzig Jahre geschlagen wurde. Sie wurde erstmals von König Edward III in Umlauf gebracht. Leider können wir die Umschrift nicht mehr lesen, um sie genauer zu datieren.
Allerdings liegt das Gewicht unseres Fundstücks bei 7,3 Gramm. Erst ab 1351 wurden diese Münzen mit 7,8 Gramm geprägt, dem einzigen Gewicht, das zu unserem Fund passen kann. Vorher waren sie erheblich schwerer, und alle Prägungen nach dem Jahr 1377 waren deutlich leichter als das von uns gemessene Gewicht.« Sie sah sich um. Noch traute sich niemand, etwas zu sagen. Vielleicht weil sie abergläubisch waren und fürchteten, dass eine Tatsache, die nicht von dem zuständigen Experten bestätigt wurde, sich nach einer leichtfertigen Äußerung wieder in Luft auflösen könnte. Sie wollten ihr den Vortritt lassen, also sprach Anahit es aus.
»Die Münze ist zwischen 1351 und 1377 in England unter König Edward III geschlagen worden. Auf einer seiner Reisen, bei denen er um Unterstützung für die Kreuzzüge warb, besuchte ihn Pierre I de Lusignan im Jahr 1363 und erhielt die CATHERINE zum Geschenk. Offenbar hat er noch mehr erhalten. Wir haben die Geldbörse eines seiner Höflinge gefunden. Wir haben Passagiere und Besatzung der CATHERINE gefunden. Schiff und Ladung müssen in der Nähe sein.«
Diese eindeutige Botschaft brachte endlich den Knoten zum Platzen. Jon stieß einen Indianerschrei aus, den niemand ihm zugetraut hatte, die anderen fielen ein. André Vossgut lief in seine Kabine und kam mit einer Flasche Champagner wieder.
Was hatte Jon gesagt?, versuchte Anahit sich zu erinnern. Sie müssen sich eine halbe Milliarde Dollar von der Bergung versprechen. Davon schienen sie noch so weit entfernt wie zuvor.
Die Freudenfeier, für die alle auf dem Schiff eine Pause eingelegt hatten, war zu Ende. Vossguts Flasche hatte für jeden nur ein winziges Glas ergeben, was der allgemeinen Ausgelassenheit aber keinen Abbruch tat. Inzwischen nahm die Neugier überhand, weshalb einer nach dem anderen seine Arbeit wieder aufnahm.
An die Wand über dem großen Tisch im Lageraum war erneut die dreidimensionale Simulation einer Karacke projiziert, die nach allen Beschreibungen der CATHERINE ähnlich gewesen sein dürfte. Anahit stand vorn.
»Am erstaunlichsten ist es, dass Menschen und Pferde auf dem Meeresgrund so eng beieinanderliegen. Pferde wurden üblicherweise unter Deck zusammengepfercht, Besatzung und Passagiere hielten sich Tag und Nacht an Deck auf. Was also ist an diesem Tag im November 1369 geschehen?« Anahit setzte sich an den PC, und nach einigen Manipulationen legte sich die CATHERINE auf die Seite. Anahit berichtete weiter.
»Es ist Sturm. Der November ist eine Zeit der schweren Nordweststürme auf dem Schwarzen Meer, sie hätten sich eine bessere Zeit aussuchen können, Zypern zu verlassen. Wahrscheinlich haben sie keine Wahl, weil ihnen die Revolte gegen König Pierre I im Genick sitzt.
Vielleicht bricht ein Mast oder es schlägt zu viel Wasser in das Schiff. Die CATHERINE kentert. Viele stürzen ins Meer. Die meisten halten sich an Takelagen fest, weil sie in der Nähe des Schiffes bleiben wollen. Dort findet sich am ehesten etwas, an dem man sich über Wasser halten kann. Schwimmen konnte man damals nicht, schon gar nicht die Seeleute.« Sie erhob sich wieder und deutete mit der Hand auf das im Raum liegende Schiff.
»Die Pferde waren hier eingeschlossen. Keine Möglichkeit für sie, schon auf den Meeresboden zu sinken. Eigentlich hätte sich das klassische Bild ergeben müssen: das zerfallene Schiff am Grund, in seinem Umriss die Knochen der Pferde und überall verstreut die der untergegangenen Menschen. Was wir hier aber sehen, ist sehr ungewöhnlich.« Anahit spürte, dass hinter dem, was sie hier vorgefunden hatten, ein Geheimnis stand, das den Kern ihrer Suche betraf.
Inzwischen heftete Piet Konberg ein gelbes Fähnchen an der Position 41 Grad 57 Minuten nördlicher Breite und 39 Grad 59 Minuten östlicher Länge auf die Karte. Rote Fähnchen bezeichneten Funde, die nichts mit ihrer Suche zu tun hatten. Davon gab es bisher siebzehn. Jetzt hatten sie das erste gelbe Fähnchen. Gelb stand für einen Fund, der zum Projekt gehörte, aber noch nicht der Treffer war. Er schrieb »1 C« neben das Fähnchen. »1 für die erste heiße Spur. C für Cemetery, Friedhof«, verkündete er. Alle waren zuversichtlich, dass bald Grün vergeben werden könnte. Konberg tippte auf die Karte.
»Bei 1 C sind die Toten. Strömungen und Wind haben das Schiff mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter in Richtung dreizehn Uhr, also nach Nordost getrieben.« Anahit war zu einer Schlussfolgerung gelangt.
»Alle, die wir bei 1 C auf einem Haufen sehen, müssen bereits tot gewesen sein, als sie aus dem Schiff durch ein Riesenleck ins Meer stürzten. Eine andere Erklärung fällt mir nicht ein.«
Mit einem Mal herrschte wieder atemlose Stille. Man hätte hören können, wenn sich der weiße Schmetterling niedergesetzt hätte, den Anahit an Bord der SEA WASP schon so oft gesehen hatte.
Alle blickten auf Penfield, doch der zuckte ratlos mit den Schultern.
»Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gab es einen Kampf, eine Meuterei, um sich die Schätze an Bord zu sichern. Ich glaube, wir sollten die Knochen noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht liefern sie uns einen Hinweis, was da passiert sein könnte.«
»In einer Stunde ist es sechzehn Uhr«, sagte Rock Penfield. »Dann gehen wir runter.«
André Vossgut beugte sich ganz nah zu Anahit. »Möglicherweise liegst du mit deiner Vermutung richtig«, murmelte er. »Aber die Pferde werden wohl kaum getötet worden sein, weil sie an einer Meuterei beteiligt waren.«
Jon saß an den Steuerkonsolen, die anderen starrten gebannt auf die Projektion. Konberg heftete durchscheinende grüne Folie auf die Karte, um das Gebiet zu markieren, das als Nächstes untersucht werden sollte.
Mit einer hochauflösenden Digitalkamera des Polyphem fotografierten sie den gesamten Fundort 1 C, für den Anahit später anhand der Daten genau vermessene Lagepläne erstellen lassen würde. Der von ihnen gefundene goldene Schiffsnobel belegte, dass sich unter den zahlreichen Toten auch Bewohner des für den Adel reservierten mehrstöckigen Kastellaufbaus im Heck befunden hatten. Das war bei der ganzen Merkwürdigkeit, die 1 C umgab, ein weiterer ungewöhnlicher Fakt. Darüber hinausgehende Erkenntnisse lieferte auch die eingehendere Untersuchung der Knochen nicht.
»Letzter Run«, meldete sich plötzlich Kapitän Cousman zu Wort, der die Bilder des Polyphem auf der Kommandobrücke verfolgen konnte. »Für den kommenden Abend ist ein schlimmer Nordoststurm angekündigt. In zwei Stunden will ich alles dicht haben.«
Jon lehnte sich weit in seinem Sessel zurück, die Hände hinter dem Kopf verschränkt.
»Also noch ein Ausflug in die Umgebung«, verkündete er. Die Exkursion begann im Zentrum von 1 C und führte sie in rasch größer werdenden Spiralen nach außen.
»Wir suchen Objekte, die so schwer waren, dass sie vor all den Toten auf den Meeresgrund gesunken sind«, erklärte er, »wie zum Beispiel eine Statue. Oder welche, die weitertrieben und erst später sanken. Wie das Schiff.« Doch nichts dergleichen tauchte auf. Nur weitere vereinzelte Knochen, zwei Holzteile.
Jon steuerte Polyphem und Creeper auf den Rückweg und zog sie an einer Stelle hoch, die die CATHERINE vor genau sechshundertvierzig Jahren einen Kilometer vor 1 C passiert hatte. Während die Maschinen sich nach oben bewegten, hielt er die Kamera senkrecht nach unten gerichtet. Stück für Stück erweiterte sich die Perspektive.
»Halt«, kam Cousmans Stimme aus den Lautsprechern. Wie ferngesteuert betätigte Jon einen Knopf und hielt damit die Kameras an. Das Bild fror ein. Als nichts Ungewöhnliches zu entdecken war, ließ er die digitale Bildaufzeichnung zurücklaufen.
»Da!«
Alle konnten es sehen. Im Schlick zeichnete sich ein perfekter Kreis ab, wie mit dem Zirkel gezogen. Jon brachte Polyphem genau darüber in Stellung und zoomte so weit heran, dass der Kreis das Bild genau ausfüllte.
»Jetzt haben wir wirklich etwas«, seufzte Konberg erleichtert auf. Begleitet von lautem Applaus der Crew positionierte er eine grüne Fahne auf die Karte, um die neue Stelle als 2-O zu markieren. »Zweiter Fund, Objekt«, kommentierte er. Jetzt endlich war klar, dass es auch für ihn etwas zu tun geben würde.
»Ihr habt genau drei Minuten, das Ding zu untersuchen«, dröhnte Cousman über die Lautsprecheranlage. Sofort sprang Penfield auf.
Wir sind der halben Milliarde Dollar näher gekommen, dachte Anahit, ich kann es riechen.
Der Creeper fuhr ganz nah heran und spülte mit seinen Düsen an einer Stelle am Rand den Schlick von dem runden Ding.
»Vielleicht ist es die Abdeckung eines Raketenschachtes, die ein amerikanisches U-Boot 1962 verloren hat«, vermutete Vossgut. Niemand nahm die Vermutung ernst. Während Creeper unermüdlich weiterputzte, markierte Anahit auf einem Digitalfoto zwei Punkte am Rand der Scheibe.
»Durchmesser vier Meter vierzig«, sagte sie.
»Macht euch fertig«, ließ Cousman sich vernehmen, »wir haben die Position und können es uns jederzeit wieder vornehmen.«
Inzwischen war es Creeper gelungen, an einer winzigen Stelle den Schlick vollständig abzuspülen.
»Es ist Stein«, ließ sich Konberg vernehmen, »ich schätze das Gewicht auf zehn bis dreißig Tonnen. Je nach Dicke.«
An der freigelegten Stelle hob sich ein umlaufendes Mäanderband aus dunklerem Stein vom Rest der Scheibe ab.
»Seht euch das an!« Anahit sprang nach vorn und deutete auf das Bild. Klar und deutlich ließen sich in dem Zoom der Kamera die lateinischen Buchstaben AD erkennen.
Das Schiff bewegte sich heftiger.
»Schluss jetzt«, rief Cousman. »Ich bringe uns in eine andere Position.« Die Kabeltrommeln liefen an. Während Jon Creeper und Polyphem an Bord hievte, wurde das gespeicherte Bild weiter an die Wand projiziert.
»Anno Domini«, vermutete Anahit, »›Das Jahr des Herrn‹. Ich schätze, wir werden bald eine Jahreszahl zu sehen bekommen.«
Fast pünktlich um neunzehn Uhr fegte plötzlich über die östliche Küste des Schwarzen Meeres ein Nordweststurm der Stärke elf. Alles in der SEA WASP war vertäut und abgedichtet. Sonarschlitten, Kameraautomat und Unterwasserroboter waren in ihren Haltebuchten in dem großen Lagerraum gesichert.
Das Schiff benötigte die ganze Kraft seiner vier Dieselmotoren von zusammen siebentausendzweihundert Pferdestärken, um sich im Wind zu halten und die heranrollenden Wellen mit dem Bug zu nehmen. Brecher donnerten über dem Schiff zusammen, wütender Schaum stürzte von allen Enden des Schiffes heran. Gleichzeitig brach langsam die Dämmerung herein, schon bald betrug die Sichtweite nicht mehr als zwei Kilometer.
Anahit hatte das Gefühl, sich vor dem Untergang der Welt in das Innere einer Maschine geflüchtet zu haben. Um einigermaßen den Überblick zu behalten, versammelten sich alle auf der Brücke.
Jeder fand einen Punkt, an dem er sich festhalten konnte, und bemühte sich, jede Welle in den Knien abzufedern.
»Das Ding ist ein Bodenmosaik«, behauptete Konberg, »da bin ich mir sicher. Es ist der Stein, den die Leute des Königs nach Kolchis bringen wollten – dabei ist er so unglaublich schwer, dass ein Transport ins Landesinnere selbst mit heutiger Technik extrem aufwendig wäre. Wie wollten sie das im vierzehnten Jahrhundert schaffen? Selbst mit all den Pferden an Bord.
Dieser Stein hat die CATHERINE in den Grund gebohrt. Er ist durch die Bordwand gebrochen und direkt nach unten gesackt. Bei einem Wellengang wie diesem hat er das Schiff versenkt.«
»Das macht es nur schlimmer«, sagte Anahit in finsterem Ton. »Dann hat es keine Meuterei gegeben. Dann waren die Pferde und die Menschen ohne Kampf bereits tot und alle unter Deck gelagert, als der Sturm kam.« Sie sahen sich betreten an. »Noch merkwürdiger ist, dass überhaupt noch so viele an Bord waren. Auf den vollgepackten Schiffen des Mittelalters war man über jeden Platz froh, den man gewann, wenn man einen toten Reisegefährten mit einem Seemannsbegräbnis dem Meer übergeben konnte. Deshalb wurden Tote sofort über Bord geworfen. Hier waren sie alle noch da. Selbst die Pferde. Warum? Lebte vielleicht keiner mehr, der die vielen Toten über Bord werfen konnte? War alles viel zu schnell gegangen?« Anahit sprach nicht weiter. Allmählich wurde ihr die Sache unheimlich. Hatte die CATHERINE ihr Ende als Geisterschiff gefunden?
Der Sturm ließ nicht nach. Rock Penfield zog sich zu einer Telefonkonferenz mit Mareology zurück. Als er verschwunden war, sah Anahit zu ihrer großen Überraschung Toros, den unheimlichen Koch, im Schatten des Vorschiffes ein Telefon bedienen, das zwar ebenso groß war wie Penfields Satellitentelefon, es aber nicht sein konnte, da Penfield seins gerade selbst benutzte. Weshalb verfügte der Koch über eine so teure Kommunikationsausstattung? Und wem ließ er damit eine Nachricht zukommen? Heimlich, wie es aussah.
Bevor Anahit weiter darüber nachgrübeln konnte, rief Kapitän Cousman alle auf der Brücke zusammen.
»Der Wetterbericht sagt sehr wechselhaftes Wetter für die nächsten Tage voraus«, verkündete er. »Wir werden jede sturmfreie Phase nutzen müssen, um das Ding zu bergen. Am besten legt ihr euch aufs Ohr, sobald hier im Schiff alles startklar ist. Ich werde euch wecken, sobald wir mit der Bergung beginnen können. Piet?« Konberg meldete sich. Es ging ihm nicht sonderlich gut. Er hatte sein Berufsleben als Unternehmer für Schwerlasttransporte auf Straßen und Schienen begonnen. Dabei hatte sich zumindest der Untergrund immer als eine verlässliche Größe erwiesen.
»Wie viel Zeit brauchen wir, um das Ding zu bergen?«
»Wenn wir trotz des Wetters sofort mit allen Vorbereitungen beginnen und ich sicherheitshalber von einem Gewicht von dreißig Tonnen ausgehe, brauchen wir eine Menge Technik«, antwortete Piet, wobei er sehr langsam sprach. Er schien darauf konzentriert, sich nicht mitten im Satz zu übergeben. »Ich denke, wir setzen die Auftriebskissen ein. Wir werden dabei mindestens zwanzig Kubikmeter Luft nach unten pumpen. Die Wasserbehälter zum Ausgleich der Gewichte am Deckskran können wir gleichzeitig betanken. Zehn Kubikmeter Wasser. Genügend Flexitanks dafür werden wir haben. Die Hebeplattform, das Freispülen. Es muss jemand runter, um die Kissen zu befestigen, danach das Kevlarnetz. Sagen wir zwei Aufenthalte unten, weil Komplikationen auftreten können, plus die Vorbereitungszeiten für den Jim Suit. Dann die Bodenplatte langsam aus dem Wasser heben, an Bord schwenken, in den Lagerraum absenken, wo parallel alle Haltevorrichtungen vorbereitet und arretiert sind, damit garantiert nichts verrutschen kann. Wir wollen nicht, dass uns das Gleiche passiert wie der CATHERINE. Alles in allem müssten wir mit fünf bis sieben Stunden auskommen.« Kaum war das letzte Wort aus seinem Mund, stürzte er hektisch in die nächste Bordtoilette.
»Dann wecke ich euch, wenn ein Schönwetterfenster von mehr als acht Stunden absehbar ist«, entschied Cousman. »Egal wann es so weit ist.« Er sah sich um. »Ich weiß zwar nicht, wo Rock ist, aber ich nehme an, dass er nichts dagegen hat, wenn ihr jetzt alle mit den Vorbereitungen der Bergung beginnt. Dabei hat Piet das Kommando.«
Nordzypern
Die Wege dufteten nach heißem Sand und dem Harz der Pinien, die den Palast umgaben. Von der nahen Küste wehte ein leichter Nordwestwind herüber. Nicht mehr lange und der blaue Himmel würde sich mit dem Dunst bedecken, der jetzt schon durch die Wipfel der Bäume zog.
Die schmale Straße von Yaila hinauf zum Palast war mit großformatigen Granitplatten belegt. Sie waren 1523 von den venezianischen Herren der Insel verlegt worden, als der Bau des Palastes an der Küste abgeschlossen wurde. Fünfzig Jahre später hatte ihn die Familie de Lusignan gekauft, inzwischen gehörte er zum Besitz der wohltätigen Bruderschaft Fraternitas Misericordia, die von Florenz aus geleitet wurde.
Ein weinroter Nissan Kombi aus dem Jahr 1989 fuhr vor, aus dem zwei schlanke mittelalterliche Frauen stiegen, für die der Taxifahrer schnaufend zwei große Koffer aus dem Laderaum zog. Trinkgeld bekam er für diese Leistung nicht, und für das warmherzige Lächeln der beiden konnte er sich nichts kaufen. Er warf einen abschätzigen Blick auf die billigen Koffer, an denen Gepäckanhänger von Ethiopian Airlines klebten. Selbst- und geschlechtslose Helferinnen, dachte er, die dafür sorgten, dass genug Afrikaner am Leben blieben, um sich auf den Weg zu Zyperns Küsten zu machen – glücklicherweise bisher beschränkt auf den griechischen Teil der Insel, der ihnen Zugang zur EU verschaffte.
Er schob den Gang rein und sah zu, dass er beim Anfahren möglichst viel Staub aufwirbelte, damit die beiden drögen Damen in den hochgeschlossenen Sommerkleidern noch eine Weile an ihn dachten.
Nacheinander trafen weitere Gäste ein. Ein grauer Volvo-Mietwagen brachte vier Frauen, ebenfalls um die vierzig bis fünfzig Jahre alt, gekleidet in dünne, hellgraue Reisemäntel, die für die Jahreszeit viel zu warm waren, einige von ihnen schon grauhaarig. Ihre Gesichter waren von der Hitze des Nachmittages gerötet. Ihre Kofferetiketten zeigten, dass sie eine lange Reise aus der philippinischen Hauptstadt Manila hinter sich hatten. Allen sah man die entbehrungsreiche Arbeit vieler Jahre an.
Sie folgten den zuerst angekommenen Frauen in den Palast, als eine jüngere Frau mit breitflächigem Gesicht aus einem dunkelbraunen Corsa stieg, eine Jacke und einen Mantel über dem Arm. Sie musste von einem Ort der südlichen Hemisphäre her angereist sein, an dem Winter herrschte.
Nachdem noch einige weitere Frauen eingetroffen waren, kehrte vor dem Palast Ruhe ein.
Die Decke des großen Raumes in der ersten Etage war mit reichem Schnitzwerk getäfelt, seine Wände mit stattlichen Porträts der zyprischen Könige der Familie de Lusignan und der venezianischen Regenten bedeckt. Aus den kleinteilig verglasten, jetzt aber weit geöffneten Fenstern bot sich ein großartiger Blick auf das unter der schwindenden Hitze des Tages träge wie Quecksilber liegende Mittelmeer.
Die Hand des Ratsvorsitzenden lag auf der Stirnseite der schweren Platte eines Tisches, der den Raum dominierte. Daneben waren ein Handy, ein großes Glas Wasser und eine schmale schwarze Ledermappe angeordnet. Der Ratsvorsitzende war ein schlanker Mann, nicht übermäßig groß, von etwa fünfundfünfzig Jahren. Sein sonnengebräuntes Gesicht lag unter dünnen blonden Haaren, unter denen der glatte, sonnengebräunte Schädel glänzte. Er sah ruhig mit blassblauen Augen in die Runde, auf seiner Stirn bildeten sich kleine Schweißperlen. Seinen Handrücken zierte ein Muttermal in Form eines umgekehrten Y.
Die zwanzig Frauen trugen hochgeschlossene schwarze Schwesterntracht und eng anliegende, zurückgebürstete Haare, die mit vielen Klammern zusammengesteckt waren und je nach Länge der grauen, schwarzen, blonden oder brünetten Haare einen kleineren oder größeren Haarknoten im Nacken ergaben. Sie unterhielten sich miteinander leise in armenischer Sprache, die sie alle schon seit langer Zeit nicht mehr gesprochen hatten. Schließlich verstummten die Gespräche. Nichts weiter geschah.
Eine seltsame Spannung lag über der Runde. Man hätte versucht sein können, nach dem Geräusch der langsam über die Möbel des Raumes wandernden Sonnenstrahlen zu horchen. Der Gedanke an die letzten Minuten eines Wartens drängte sich auf, das so lange schon anhielt, wie der Palast an diesem Ort existierte.
Die Erwartungen waren auf ein Handy gerichtet, das neben der Hand des Vorsitzenden des Konföderationsrates der Bruderschaften der Misericordia auf der polierten Tischplatte lag. Vereinzelt streiften es die Blicke der Frauen.
Das Handy gab ein kurzes melodisches Geräusch von sich. Wortlos las er die übermittelte Botschaft ab. Das Warten war beendet.
»Als Ratsvorsitzender der internationalen Konföderation der wohltätigen Bruderschaften der Misericordia habe ich euch eingeladen, weil mit der soeben eingetroffenen Nachricht der Zeitpunkt gekommen ist, nach Lusavank zurückzukehren«, begann er seine Rede in armenischer Sprache.
Er blickte in die Runde. Irgendwo fern auf dem Meer war die Sirene eines Schiffes zu hören, was die träge Stille nur verstärkte.
»Bevor ihr von hier aufbrecht, um die über Istanbul nach Tiflis gebuchte Maschine auf dem Flughafen Ercan Havaalani bei Nikosia zu erreichen, werde ich euch erklären, welche Aufgabe in den nächsten Wochen vor uns steht.« Er drückte auf einen verborgenen Knopf. Eine junge Frau in langem blauem Kleid betrat den Raum und servierte Tee in weißem Porzellan und Gebäck. Als sie wieder unter sich waren, fuhr er fort:
»Mehr als vierhundert Jahre lang haben christliche Ritter versucht, das Heilige Land zu befreien, und dafür immer wieder Truppen für Kreuzzüge aus den Ländern Europas zusammengestellt. Das Ziel verkam im Lauf der Zeit, es wurden Raubzüge daraus, die zu nichts anderem gut waren als den reichen italienischen Handelsstädten die Kassen zu füllen.
Bis zuletzt gab es jedoch einige, die niemals das Ziel aus dem Auge verloren, Kleinasien und Nordafrika für die Christen zurückzuerobern. Einer, der bis zum letzten Atemzug versuchte, das alte Ideal einer christlichen Welt zu erkämpfen, war …«, er legte eine bedeutungsschwere Pause ein und blickte in die Runde. Die Frauen hörten gespannt zu. »… mein Vorfahre, Pierre I de Lusignan, König von Zypern, Jerusalem und Armenien. Er wurde im Herbst des Jahres 1369 umgebracht, bevor er sein Vorhaben in die Tat umsetzen konnte.« Es begann, kühl durch die Fenster hereinzuwehen. Auf ein Signal des Alten kam die junge Frau und schloss die großen Fensterflügel.
»Eure Arbeit als Schwestern in acht Ländern der Welt zeigt den richtigen Weg, eine christliche Welt zu schaffen. Die Kreuzritter waren in der falschen Richtung unterwegs. Nicht die Gewalt, sondern die Hilfe für die Opfer der Gewalt ist der christliche Weg, die Welt zu erobern. Es gibt keinen anderen Weg zur Beherrschung der Welt als durch die offenen Herzen der Hilfebedürftigen.
In diesem Moment sind wir an einer Wegscheide angelangt, an der wir das Schicksal der Welt ändern werden.« Er griff nach dem Glas Wasser, in das er zwei Tabletten warf. Während er weiterredete, lösten sie sich zu einer milchigen Flüssigkeit auf.