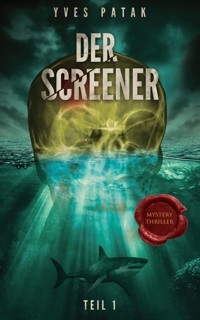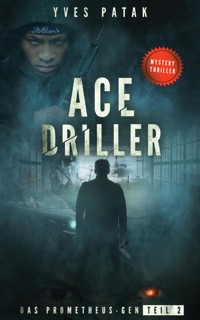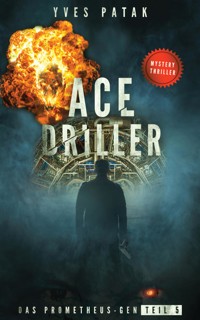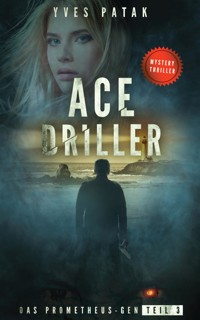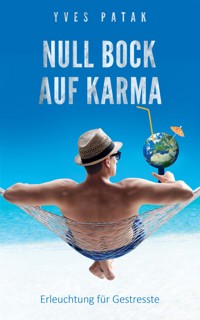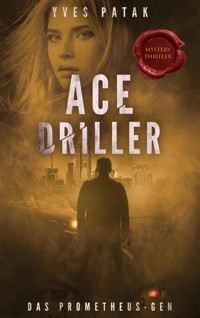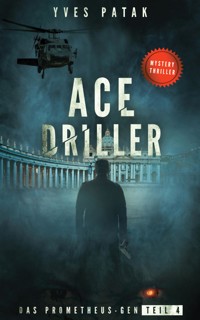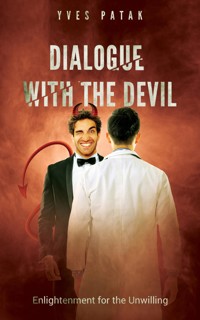3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nur knapp überlebt Desmond den dramatischen Zweikampf auf der Yacht und schafft es ans Ufer – doch der Sturm nimmt ihm alles.
Zurück in New York verändert sich seine unheimliche Gabe: Statt des nahendes Todes erkennt er nun die dunkelsten Seelen in seinen Mitmenschen – und wird zum Instrument einer Macht, die er nicht kontrollieren kann.
Nach einem tödlichen Zwischenfall wird er verurteilt und weggesperrt in eine Anstalt für geisteskranke Straftäter.
Dann erhält er Fotos. Hinweise, dass Jean noch leben könnte – genauso wie Michael ‚Die Flamme‘ Coppola.
Desmond bricht aus der Klinik aus. Doch während er Jeans Spur verfolgt, rüsten sich dunkle Mächte zur entscheidenden Kraftprobe – zum Endkampf der Zeitenwende …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Yves Patak
Der Screener
Teil 2
2019©Yves Patak Alle Rechte beim Autor. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm, elektronische oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer oder sonstiger Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Umschlaggestaltung: Miladinka Milic - www.milagraphicartist.com Lektorat: Thomas Hoffmann & Nicole Lau e-book formatting by bookow.com
Weitere Bücher von Yves Patak
Der Screener - Teil 1Ace Driller - Teil 1Tödlicher SchattenHimmel und Hölle: Karma gefällig?Null Bock auf Karma - Erleuchtung für GestressteGespräche mit LuziInhaltsverzeichnis
Kapitel 7
„Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.“
Friedrich Nietzsche
JETZT
Eingesperrt
Blue Oak Forensic Clinic, Clifton, New Jersey – Donnerstag, 13:22 Uhr
Desmond betritt das Kinderzimmer, und der Horror beginnt. Die Echtheit des Erlebens ist mörderisch. Unerträglich. Das Mobile mit dem Planetensystem an der Decke bewegt sich leicht im Luftzug, den das Öffnen der Tür verursacht hat. Auf dem blauen Teppichboden liegt eine Handpuppe von Kermit, dem Frosch – ein Spielzeug, mit dem Desmonds Vater in seiner Kindheit gern gespielt und das er für seine Kinder aufbewahrt hat.
Ich will das nicht sehen.
Wie von einem unsichtbaren, frostigen Wind vorwärtsgetrieben geht Desmond weiter und bleibt in der Mitte des Raums stehen. Die beiden Wiegen – solides Eichenholz, vom Vater selbst gezimmert – stehen in den Ecken des Raumes, neben dem Fenster, schaukeln langsam hin und her.
Ich will nicht …
Desmond atmet schneller, sein Herz pocht ihm bis zum Hals. Alles in ihm schreit danach, auf dem Absatz kehrtzumachen und aus dem Zimmer zu fliehen, bevor das Unsägliche geschieht, das Zwangsläufige, doch er kann nicht. Seine Füße kleben auf dem Teppich.
Mit leicht geöffnetem Mund starrt er auf die hauchdünnen Gaze-Vorhang über den Wiegen. Schleier, die den Eltern den Anblick der beiden toten Babys ersparen sollen. Jason kam ein Jahr nach Desmond zur Welt. Winston ein weiteres Jahr später. Beide starben wenige Tage nach ihrer Geburt am plötzlichen Kindstod.
Bitte … Desmonds Haut kribbelt, als strichen unsichtbare Spinnweben über sie. Lasst mich!
Wie in einem makabren Puppenspiel gleiten die Totenschleier von den Wiegen, und Desmond sieht seine beiden Brüder, sieht ihre blau angelaufenen Gesichter.
Starre Augen richten sich auf ihn.
Desmond. Jasons winziger Babymund verzieht sich zu einem seelenlosen Lächeln. Du solltest tot sein, nicht wir …
Wir werden dich holen, Desmond, bestätigt Winston. Schon bald.
Winzige Hände greifen nach dem Rand der Wiegen, und im Zeitlupentempo der Unvermeidlichkeit klettern die Säuglinge heraus. Desmond versucht zu schreien, aber seine Stimmbänder sind gelähmt. Er konzentriert sich auf seinen Körper, auf die Starre, die er durchbrechen muss, wenn er überleben will. Mit aller Willenskraft kämpft er dagegen an, gewinnt die Kontrolle über seine Muskeln zurück. Er dreht sich um, bereit, aus dem Zimmer zu rennen – und bleibt stehen, als wäre er gegen eine Wand gerannt.
Im Türrahmen stehen seine Eltern, einen Ausdruck von ultimativem Schock auf den Gesichtern. Dann fühlt Desmond, wie von hinten winzige Hände nach seinen Beinen greifen, und er schreit, schreit, schreit …
***
Keuchend setzt sich Desmond im Bett auf, schaut verwirrt um sich. Ein winziger Raum. Ein Tisch, ein Stuhl, ein WC, ein Waschbecken. Sonst nichts.
Meine Zelle.
Wie immer ist er nach dem Mittagessen – einer Mahlzeit, die einem koreanischen Kriegsgefangenenlager würdig gewesen wäre – eingeschlafen. Und wie jedes Mal realisiert er, wie viel klarer und echter seine Albträume sind als sein Leben im Wachzustand.
Wach mit Psycho-Drogen … ein schlechter Witz.
Der Traum, eben noch da, beginnt sich zu verflüchtigen, weicht der wattigen Leere, die Desmonds Kopf erfüllt, seit er in der Klinik ist. Er schaut zum vergitterten Fenster, sieht das trübe Licht eines frischgeborenen Frühlings, der immer noch nach Winter riecht.
Auf gummiartigen Beinen erhebt er sich und geht zur Tür, den Oberkörper vornübergebeugt wie ein Parkinson-Patient. Trotz der Benommenheit beherrscht ihn Tag und Nacht eine innere Unruhe, die ihn dazu zwingt, ständig umherzugehen, oder an Ort und Stelle zu treten, in den Knien zu wippen. Er kennt die Akathisie, eine der typischen Nebenwirkungen der Neuroleptika, von seiner Ausbildung, und von seinen eigenen Patienten. Die Tatsache, dass er auf einmal die Rolle wechseln musste, dass er der Patient ist, erscheint ihm wie göttliche Ironie.
Du bist kein Patient, korrigiert er sich. Du bist ein Insasse. Ein Gefangener. Ein Mörder.
Als er nach dem Türknauf greift, fällt ihm auf, dass das leichte Zittern seiner Finger stärker geworden ist. Als wäre ich in wenigen Monaten um vierzig Jahre gealtert.
Er zieht die Tür auf. Die Sicherheitstüren sind tagsüber geöffnet, so dass sich die zwölf Insassen der Station D3 im Korridor oder im Aufenthaltsraum frei bewegen können. Doch von sieben Uhr abends bis sieben Uhr morgens verwandelt sich der Raum in eine Gefängniszelle. Schreien, Betteln und mit dem Kopf gegen die Tür hämmern verleitet die Nachtwärter höchstens zu einem gelangweilten Blick durch den Spion. Solange niemand im eigenen Blut liegt oder einen epileptischen Anfall hat, bleiben die Türen nachts verschlossen.
Desmond schlurft den Korridor entlang. Wie jeden Morgen beginnt er seine quälend langsame Tour, dreißig Längen zwischen Stationszimmer und Aufenthaltsraum, dreißig mal zwanzig Meter, um seine Muskeln nicht völlig verkümmern zu lassen. Neben ihm ziehen weiße Wände vorbei, unter ihm grauer Linoleumboden. Der Geruch von Desinfektionsmittel gibt ihm das Gefühl, eine tückische Nachahmung von Luft zu atmen.
„Hey, Parker!“
Desmond bleibt stehen, zwingt sich, den Kopf zu heben. Wenige Schritte vor ihm streckt Stanimir seinen Kopf aus dem Stationszimmer.
„Na?“ Der massige Bulgare winkt ihm mit dem Schlagstock zu, einer Kombination von Knüppel und elektrischem Viehtreiber. „Wie geht’s meinem Lieblings-Menschenöffner denn so?“
Desmond meidet die hellgrauen Augen des Wärters. Du kannst mich nicht provozieren. Zu häufig hat es der Bulgare geschafft, Desmond aus der Reserve zu locken, ihn zu reizen, bis er die Kontrolle verlor. Stanimir hatte nur auf die Gelegenheit gewartet, Desmond mit dem Viehtreiber zu züchtigen, ihm Strom durch den Körper zu jagen, bis er nichts mehr war als ein zuckendes, bewusstloses Stück Fleisch.
Nicht heute.
Wortlos macht Desmond kehrt und schlurft in die andere Richtung. Versucht, nicht daran zu denken, dass er seit zwei Monaten und zehn Tagen Insasse eines menschenverachtenden Höllenlochs ist, das sich Klinik nennt – keine zwanzig Meilen von der Stadt entfernt, in der er in einem früheren Leben, vor Monaten, wohnte und als Psychologe praktizierte. Ein Steinwurf vom Big Apple, und doch in einer fremden Galaxis.
Er schaut auf seine Füße. Links. Rechts. Links. Rechts.
Sein Lebensgefühl ist ein Schrei, der sich tief in der Brust aufbaut, ohne es jemals zu schaffen, sich nach außen zu entladen. Während sein Gemüt in dichte Watte gepackt ist, wimmeln Kolonien von Geisterameisen durch seine Adern, seine Eingeweide, seine Seele.
Die Medikamente, die man ihm die ersten paar Wochen aufzwingen musste, nimmt er inzwischen freiwillig ein, gefügig wie ein Lamm. So sehr sie seinen Geist lähmen, so gründlich betäuben sie auch den Schmerz; die nagenden Schuldgefühle, versagt zu haben; die Selbstzerfleischung, dass er Jean nicht retten konnte. Nicht zuletzt unterdrücken die Pillen Desmonds ‚Talent‘ – den Fluch, den nahenden Tod in anderen Menschen zu sehen. Keine verschwimmenden Farben mehr. Kein unerträglicher Druck in der Stirn. Keine Übelkeit. Keine Wirbel, die um sein Gegenüber rotieren wie bösartige Tornados.
Das Einzige, was selbst die hochdosierten Neuroleptika und Benzodiazepine nicht dämpfen können, ist die tödliche Wut auf den Kalabrier.
Michael ‚Die Flamme‘ Coppola ist tot, mit Jean im Sturm untergegangen, und so sehr Desmond alles tun würde, Jean wieder lebend in seinen Armen zu halten, so unbändig ist das Verlangen, den Mafioso wieder lebendig zu sehen, bloß, um ihn ein zweites Mal zu töten. Und noch einmal. Und immer wieder.
Unerreichbar, für immer … genau wie Jean.
Seit er die Medikamente schluckt, ist er sich selbst fremd, kann manchmal beinahe daran glauben, dass all das Grauen der letzten Monate jemand anderem zugestoßen ist – einem Fremden, den er nur geträumt hat.
Er schaut auf seine Füße, bewegt sie mit der trägen Regelmäßigkeit eines Standuhrpendels. Links. Rechts. Links. Rechts. Sein zu langes Haar hängt vor seinen Augen, schwingt zum schleppenden Rhythmus seiner Schritte hin und her. Hinter dem buschigen Vollbart schürzen sich die Lippen tickartig.
Vor ihm öffnet sich eine Tür, und aus Zelle 11 stapft Tyrone Briggs heraus, ein schwarzer Hüne, der sich für Luke Cage hält. Die Ähnlichkeit mit dem Comic-Helden hält sich in Grenzen, aber die Körpermasse kommt dem Marvel-Vorbild ziemlich nahe. Desmond bewegt sich zur Seite, um Tyrone nicht im Weg zu stehen. Wer dem Muskelpaket in die Quere kommt, riskiert einen Urlaub auf der Krankenstation. Tyrone scheint gegen Beruhigungsmittel ebenso immun zu sein wie gegen Regeln und Anstand.
Desmond erreicht das Ende des Korridors und geht in den offenen Aufenthaltsraum. Acht am Boden festgeschraubte Tische, die Ecken abgerundet, um die Verletzungsgefahr zu verringern. Oben in der Ecke ein Fernseher mit Flachbildschirm und Gitterschutz, auf stumm geschaltet. Zwei Footballmannschaften – Desmond glaubt, die New England Patriots und die New York Giants zu erkennen – gehen wie die Wikinger aufeinander los. Hinten beim Fenster eine Lounge mit verschlissenen Kunstledermöbeln. Ein welliges Poster mit karibischen Inseln an der Wand.
Einer der Wärter – Bill ‚The Moustache‘ Könkerling – hört mit halbem Ohr Charles Lepotte zu, einem kleingewachsenen Mann mit Goldbrille, während er das Footballspiel im Auge behält.
Desmond schleppt sich zur Lounge, lässt sich in einen der Sessel fallen und schaut sich um. Abgesehen vom Wärter befinden sich drei Männer im Aufenthaltsraum: Lepotte, der schmächtige Goldschmied, der sich und seine Familie vergiftet und dummerweise als Einziger überlebt hat, sitzt auf einem der Sessel in Fensternähe, während er Bill die Ungerechtigkeit des Lebens erklärt; Scott Burnette, ein unheimlicher alter Kauz, der seiner Ehefrau die Kehle aufgeschlitzt hat, weil sie die falschen Götter anbetete. Und schließlich Jorge Pacota, der junge Mexikaner mit dem Überbiss, der seine Mutter aus dem vierzehnten Stock geworfen hat. Rastlos tigert er um die Tische herum.
Ein lähmendes Déjà-vu überkommt Desmond. Das erdrückende Gefühl von Stunden, Tagen und Wochen, die zähflüssig ineinander verlaufen wie Melasse, ewig gleiche Szenen des ewig gleichen, sinnlosen Alltags.
Er drückt sich die Handballen auf die Augen, versucht, der unerträglichen Realität seiner Gefangenschaft und den inneren Bildern zu entkommen.
Keine Chance.
Das Geräusch von Schritten lässt ihn aufblicken. Stanimir Balkanski stampft in den Aufenthaltsraum, die grauen Augen hin und her gleitend, eine Hyäne auf der Suche nach einem Opfer.
Er nickt seinem Kollegen zu. „Hey, Bill, kannst du mal eben das Stationszimmer übernehmen? Hab mit unserem Mr. Tortilla hier ein Hühnchen zu rupfen.“
„Geht klar.“ Der hochgewachsene Wärter mit dem gewachsten Schnauzer stelzt aus dem Aufenthaltsraum.
Stanimirs Blick richtet sich auf Jorge.
„Ey amigo!“ Gemütlich spaziert der Bulgare auf den jungen Mexikaner zu. „Dr. Cole hat soeben deine Blutresultate durchgegeben. Gemäß Labor nimmst du deine Medis seit mindestens zwei Wochen nicht mehr ein. Ist das deine Vorstellung von Kooperation?“
„No señor!“ Jorge ist abrupt stehengeblieben, die Augen panisch geweitet. „Ich … ich immer schlucke Medikament, jeden Tag! Ich –“
„Tsk, tsk.“ Stanimir schüttelt den Kopf. „Ungehorsam und Lügen? Eine ungesunde Einstellung.“
Der Bulgare hakt den Schlagstock vom Gürtel.
„Señor Stanimir, por favor …“
Stanimir hebt einen tadelnden Zeigefinger. „Schnauze, Jorge. Du kommst jetzt mit mir zum Stationszimmer, wo du deine Medis vor meinen Augen schlucken wirst. Wenn du mir Probleme machst, jage ich dir ein paar Millionen Volt durch deine haarigen Eier.“
„Señor –“
„Cállate, coño.“ Stanimir hält die Elektroden des Schlagstocks direkt vor Jorges Nase, und der Mexikaner verstummt, die Lippen bebend.
Stanimir lächelt dünn. „Und denk dran, dieser Gringo hier lässt sich nicht verarschen. Ich werde dir ins Maul schauen wie bei einem störrischen Esel. Und danach bleibst du zwei Stunden lang schön brav hier im Aufenthaltsraum, damit du die Pillen nicht wieder auskotzt. Nos entendemos?“
Jorge nickt, macht einen großen Bogen um den Elektrostab und rennt aus dem Aufenthaltsraum.
Desmond starrt zum Bulgaren, sieht die kühlen grauen Augen, und für einen Moment sieht er nicht Stanimir dort stehen, sondern Michael Coppola.
Coppola, der Drogenbaron der Upper West Side.
Coppola, der psychopathische Pyromane.
Coppola, das Monster, das für Jeans Tod verantwortlich ist.
Stanimir fängt den Blick auf und spaziert auf Desmond zu, den Stock in der Hand.
„Hey, Seelenbohrer! Du guckst mich an, als wäre ich deiner Mutter an die Wäsche gegangen! Findest du, dass ich zu unserem Mexikanischen Freund zu streng war?“
Desmond zwingt sich, wegzuschauen. Schweigt.
Stanimir hält ihm die Stockspitze unter das Kinn. „Aber natürlich findest du das! Du warst ja schließlich Psychologe, bevor dir selbst ein paar Latten vom Zaun gefallen sind. Und ein guter Psychologe ist ein Gutmensch, ein Moralapostel, der die Welt verbessern will. Also sag mir“ – er hebt Desmonds Kinn, bis sich ihre Augen begegnen – „war ich zu streng?“
„Nein, Sir.“
Stanimir zieht den Stock zurück. „Was für ’ne Affenschande … offenbar machen dich die Neuroleptika nicht nur zu einem Gemüse, sondern lassen dir auch die Eier schrumpfen.“
Er klickt den Stock an den Gürtel und verlässt den Aufenthaltsraum. Desmond denkt an den völlig verstörten Mexikaner, stellt sich vor, wie dieser im Stationszimmer gezwungen wird, gegen seinen Willen Medikamente zu schlucken, die sein Denken, sein Fühlen, sein ganzes Sein betäuben.
Medikamente, die ich freiwillig schlucke.
Unter dem Mantel von Benommenheit fühlt Desmond, wie sich tief in ihm etwas regt. Wut? Selbstekel? Er weiß es nicht.
„Aufwachen“, leiert jemand.
Desmond schaut sich um und sieht, wie der alte Burnette direkt neben ihm steht und ihn mit seinen stechenden Augen beobachtet – ein Wissenschaftler, der ein exotisches Insekt unter dem Mikroskop studiert. Die nussbraunen Augen zucken hin und her.
Ein Nystagmus, denkt Desmond. Von Geburt an oder von den Medikamenten?
Desmond hält dem Blick Stand, sogleich auf der Hut. Seit seiner Einlieferung in die Blue Oak Forensic Clinic hat ihn der merkwürdige Greis noch nie angesprochen. Desmond vermutet, dass Burnette an einer ausgeprägten Wahnstörung leidet, vermutlich an einer Schizophrenie. Die meiste Zeit schleicht der ehemalige Optiker wie ein Geist durch die Gänge, lächelt sein gruseliges Dauerlächeln und flüstert unverständliches Zeug, als spräche er mit unsichtbaren Verbündeten.
„Auuuuf-wachen!“ wiederholt Scott Burnette in einem unheimlichen Singsang.
Mühselig stemmt sich Desmond auf die Beine. „Lass mich in Ruhe.“
Erstaunlich leichtfüßig folgt Burnette Desmond zum Korridor. Desmond bleibt stehen und fixiert den dürren Alten. Neben der fast vollständigen Glatze ragen seitlich zwei wirre, weiße Haarbüschel hervor. Obwohl er größer als Desmond ist, schafft er es irgendwie, ihn von unten anzuschauen, was ihm etwas Arglistiges verleiht.
„Du bist es!“ Burnette macht mit den Händen kreisende Bewegungen, ein Lehrer, der einen Schüler beim Lösen eines schwierigen Rätsels ermutigt. „Hab dich beobachtet, Kumpel, und ich weiß, du bist es!“
„Was bin ich?“ Desmond verschränkt die Arme. Tief in seinen Knochen fühlt er die bleierne Müdigkeit, die über die letzten zwei Monate zu seiner treusten Begleiterin geworden ist, und er sehnt sich nach seinem Bett, wissend, dass er es wegen der Akathisie dort keine zehn Minuten aushalten wird.
Burnettes Augen sind zwei zuckende Kiesel.
„Du bist der Todesengel!“
„Was?“
Der Alte lächelt listig. „Der Todesengel! Der Doppelnull-Agent der Göttin!“
„Ach ja? Danke für die Info. Und jetzt lass mich in Ruhe.“ Desmond wendet sich ab und schlurft weiter. Burnette weicht ihm nicht von der Seite.
„Du kannst den Willen der Göttin nicht ignorieren, Kumpel! Sie ist stärker, so viel stärker als wir … aber sie braucht uns. Braucht dich!“
„Und du brauchst stärkere Medikamente, mein Freund.“ Desmond hat seine Zelle erreicht, blickt zur Sicherheit auf die Nummer. Sein Verstand ist derart benebelt, dass er schon zweimal den falschen Raum betreten hat. Ein Fehler, der gefährlich sein kann, wenn man zum Beispiel die Zelle von Tyrone alias Luke Cage betritt.
Nr. 5 – alles in Ordnung.
Er öffnet die Tür. Als Burnette Anstalten macht, ihm zu folgen, schiebt ihn Desmond sanft, aber bestimmt aus der Zelle.
„Oh ja!“ gluckst Burnette. „Der Todesengel braucht seine Privatsphäre … um den nächsten Schritt zu planen.“
„Was auch immer.“
Desmond schließt die Tür, wartet, bis er sicher ist, dass der alte Kauz ihm nicht doch noch ins Zimmer folgt. Dann schlurft er zum Bett und lässt sich auf die Matratze sinken. Doch während sein Körper sogleich auf die horizontale Lage reagiert, sich nach dem Schlaf des Vergessens sehnt, durchfährt ein rastloser Strom sein Gehirn.
Passiert das alles wirklich? Hier und jetzt?
Desmond ist, als wäre er durch eine unsichtbare Falltür in eine parallele Dimension gestürzt, eine Dimension der Boshaftigkeit und des Wahnsinns. Die Vorstellung, dass er vor knapp einem halben Jahr ein völlig normales Leben in Manhattan führte, kommt ihm unwirklich vor. Unfassbar.
Vielleicht bin ich wirklich verrückt. Gaga. Durchgedreht.
Eine plötzliche Nervosität erfasst ihn, macht es ihm unmöglich, liegenzubleiben. Neben seinen Neuroleptika, die er jeden Morgen und Abend schluckt, hat er Ativan in Reserve, ein Beruhigungsmittel, das er bei übermäßiger Anspannung verlangen darf – eine Option, die er seit seiner Zwangseinweisung erst zweimal in Anspruch genommen hat.
Er steht auf und geht zum Stationszimmer hinüber. Wie nebenbei bemerkt er, dass er wesentlich schneller geht als zuvor, angetrieben durch das Verlangen nach dem Tranquilizer. Eine Welle von Selbstekel erfasst ihn. Echt jetzt? Bin ich ein verdammter Junkie geworden?
Beim Stationszimmer angelangt hebt er die Hand, um an die Scheibe zu klopfen – und lässt sie wieder sinken. Durch das Fenster sieht er, wie Stanimir und Bill den jungen Mexikaner unsanft auf die Füße reißen. Jorge hat den glasigen Blick eines Boxers, der gerade K.o. gegangen ist.
Oder eines Mannes, der mit einem Elektroschocker traktiert wurde.
Desmond fühlt, wie seine Kiefermuskeln hart werden. Bis vor zwei Monaten hätte er nie geglaubt, dass das Klischee des sadistischen Wärters tatsächlich der Realität entsprechen könnte. Doch während die meisten Wärter zwar nicht besonders freundlich, aber auch nicht unverhohlen feindselig sind, lässt Stanimir klar erkennen, dass er einen Kick davon bekommt, Menschen zu terrorisieren. Ihnen weh zu tun.
Verwirrt schaut sich der Mexikaner um. Bill fasst ihn grob unter dem Arm und führt ihn aus dem Raum.
Stanimir dreht sich zu Desmond, sein Ausdruck derjenige eines Mannes, der gerade guten Sex hatte.
„Hey, der Klapsdoktor! Hast mich wohl vermisst?“
„Ativan.“ Desmonds Miene ist ausdruckslos. „Darf ich eine haben?“
Der Bulgare hebt eine Augenbraue. „Und ich dachte schon, du wärst wegen mir gekommen. Du brichst mir das Herz.“
Er dreht sich um und zieht eine Mappe aus einem Aktenschrank.
„Parker, Desmond … hmm! Tut mir leid, aber du hast dein Ativan heute schon gekriegt. So wie fast jeden Tag. Schau!“
Verständnislos starrt Desmond in die Akte, die ihm Stanimir vor das Gesicht hält. Auf einer Zeile im unteren Drittel, in der Rubrik ‚Reservemedikation‘, sieht er den Namen ATIVAN und daneben, säuberlich aufgelistet, gut zwanzig rote Kreuzchen. Eines für fast jeden Tag des Monats.
„Das … das stimmt nicht.“ Desmond zwingt sich, seine Fäuste zu lockern. „Ich habe das Ativan erst zweimal genommen!“
Stanimir schlägt die Akte zu. „Sorry, Dr. Freud, aber da muss dir deine Erinnerung einen Streich spielen. Du fährst ziemlich ab auf die kleinen gelben Dinger, so wie die meisten Benzo-Junkies.“
„Mistkerl“, knurrt Desmond durch die Zähne.
In Stanimirs Augen funkelt es. „Wie war das?“
„Du weißt genau, dass ich das Ativan weder heute noch in den letzten drei Wochen genommen habe!“
Der Bulgare öffnet die Tür und baut sich dicht vor Desmond auf, die Hand am Schlagstock.
„Nein, das weiß ich nicht, du kleiner Kacker. Weil in deiner Akte klar geschrieben steht, dass du eine miese kleine Benzo-Hure bist. Für eine Handvoll Ativan würdest du gleich hier und jetzt auf die Knie fallen und mir einen blasen – oder?“
Desmond hört das Klicken, als der Bulgare den Schlagstock vom Gürtel hakt.
„Verstehe.“ Desmonds Stimme ist heiser vor Wut. Er dreht sich um, stapft zu seinem Zimmer zurück. Als er an der Nr. 3 vorbeigeht, öffnet sich schlagartig die Tür und eine dürre Hand packt ihn am Arm, zieht ihn in die Zelle hinein.
Desmond schlägt die Hand weg und starrt in die rastlos zuckenden Augen von Scott Burnette.
„Gut!“ gurrt der Alte. „Sehr gut! Die Lebensgeister erwachen!“
„Fass mich noch einmal an, und ich –“
„Ah, ah, ah!“ Burnette tänzelt rückwärts um Desmond herum, ein grotesker Balletttänzer, und stößt die Tür zu.
Desmond ballt die Fäuste, unsicher, ob er einen alten Mann schlagen würde, um sich aus dessen Gegenwart zu befreien.
„Was zum Teufel willst du von mir?“
Burnette lächelt sein gruseliges Lächeln. „Ich bin der Augenöffner! Der Götterbote, der den Unwilligen das Licht der Erkenntnis bringt.“
„Okay.“ Desmond atmet tief durch. „Hör zu. Ich bin hundemüde, und ich will dir nicht weh tun ... aber ich werde jetzt in mein Zimmer gehen, und wenn du dich mir in den Weg stellst – “
„Lausche der Botschaft!“ Unvermittelt breitet der Alte die Arme aus, wirft den Kopf in den Nacken und ruft in schrillem Falsett: „Entsaget dem Gift des Puppenspielers, und die Blinden werden sehen, die Lahmen gehen, und die Toten auferstehen! Matthäus Kapitel 11, Vers 5!“
Desmonds Kiefer sinkt nach unten. Diese Stimme! Ein Déjà-vu, nein, ein Déjà-entendu, das es nicht ganz in sein Bewusstsein schafft. Er richtet einen zitternden Finger auf Burnette.
„Wer zum Teufel bist du?“
Der Alte schürzt die faltigen Lippen und legt den Kopf schief, ein hagerer Kobold.
„Du bist gestolpert.“ Der Tonfall einer Mutter, die mit ihrem leicht zurückgebliebenen Kind spricht. „Aber du musst wieder aufstehen. Auf die Füße kommen. Den Puppenspieler finden und ihn aus dem Weg räumen!“
Desmond macht einen Schritt rückwärts. „Du bist komplett verrückt.“
„Natürlich!“ kichert Burnette, während die stechenden Augen hin und her zucken. „Hier sind nämlich alle verrückt.“
Desmond stößt ihn zur Seite und verlässt fluchtartig die Zelle, betritt schwer atmend seine eigene.
Diese Stimme …
Erschöpft lässt er sich auf das Bett sinken, und sofort gleiten seine Augen zu.
Woher …?
Unvermittelt reißt er die Augen auf. Ich kenne diese Stimme! Ein Schauer geht durch seinen Körper, während er die unheimliche Szene in der WC-Kabine nochmals erlebt, auf dem Flug nach Kingston.
‚Hey, Kumpel! Du musst stark sein … nur der Mutige findet Gnade vor der Göttin.‘
Desmond kann die Stimme in seinem Kopf hören, als hätte jemand ein Tonband in seinen Schädel eingepflanzt.
‚Große Veränderungen stehen bevor … und ihre Vorboten kommen mit Feuer und Wasser.‘
Stocksteif liegt Desmond auf dem Bett, die Augen starr zur Decke gerichtet, während sein Herz in seiner Brust viel zu schnell schlägt, ein unheilvoller Trommelklang.
SECHS MONATE ZUVOR
Überleben
Ocho Rios, Jamaika – Samstag, 1:46 Uhr
Desmond krault durch das aufgewühlte Meer, die Augen starr auf die Hafenlichter von Ocho Rios gerichtet. Seine Arme und Beine sind flüssiger Schmerz, fremdartige Körperteile, die wie von alleine weiterkämpfen, während Desmonds Überlebenswille mit jeder Sekunde schwindet. Hohe Wellen klatschen ihm ins Gesicht, drücken ihn unter Wasser, während die Strömung ihn nach außen ziehen will, ins offene Meer. Der Schmerz der gebrochenen Rippe ist unerträglich, raubt ihm den Atem. Um ihn herum tobt der Sturm unvermindert weiter, als versuchten alle Naturgewalten, ihn aufzuhalten, ihn zu vernichten.
Schon in den ersten Sekunden hat sich Desmond nackt ausgezogen, bevor die nasse Kleidung ihn hinunterziehen konnte. Splitternackt kämpft er sich durch die kochende See, konzentriert sich auf die Lichter, die ihn leiten, auf den Schmerz, der ihn fühlen lässt, dass er noch lebt.
Noch.
Er denkt an Jean. Wenn er schon sterben muss, so soll Jean sein letzter Gedanke sein. Doch der Gedanke bringt keinen Frieden. Er stellt sich vor, wie sich Jean mit jeder Sekunde weiter von ihm entfernt, auf der Caribbean Mermaid im Sturm verschwindet, die Geisel eines sadistischen Psychopathen und Mörders.
Coppola.
Wie nebenbei wird Desmond bewusst, dass etwas mit ihm geschehen ist. Dass er auf den Kalabrier einen Hass empfindet, den er sich nie hätte vorstellen können. Ihm ist, als wäre Coppola ein Dämon, der ausgesandt wurde, ihn zu quälen, ihm alles zu nehmen – und ihn mit zerrissener Seele untergehen zu lassen.
Und ich habe ihn verschont …
Wie ein dunkler Tumor pulsiert die Erinnerung in Desmonds Kopf. Er sieht sich, wie er im Dschungel die Magnum auf den Kalabrier richtet, auf ihn zielt, den Finger am Abzug.
Coppolas unerträglich süffisantes Lächeln.
‚Ich habe mich gerade gefragt, ob Sie die Eier haben, einen unbewaffneten Menschen einfach abzuknallen. Offenbar nicht.‘
Desmond schwimmt weiter, sein Geist im Urwald, jede Zelle in seinem Körper erfüllt vom glühenden Drang, den Kalabrier zu erschießen wie einen tollwütigen Hund. Er fühlt den Widerstand des Abzugs am Finger, fühlt den unsinnigen Widerstand tief in seiner Seele. Er denkt an den Vietnam-Veteranen mit dem weißen Bürstenhaarschnitt, den er von seiner PTBS befreit hatte; denkt an die Worte des Mannes während der ersten Sitzung, als sie über die unmenschlichen Massaker des Krieges sprachen.
‚Das Gehirn gewöhnt sich ans Töten, Mr. Parker … aber nicht die Seele. Wenn man zum ersten Mal einen Menschen tötet, öffnet man eine Tür, die sich nie mehr schließt. Eine Tür, die in eine unheimliche, fremdartige Dimension führt. Eine Dimension, die erschreckend ähnlich aussieht wie unsere normale Welt … aber es ist ein Trugbild, hinter dem sich Monster verstecken.
Mechanisch schwimmt Desmond weiter, sein ganzer Körper ein glühendes Stück Schmerz. Halb bewusstlos schließt er beim Schwimmen immer wieder die Augen, ein Mann kurz vor dem Ende. Jedes Zeitgefühl ist ihm verloren gegangen. Da sind nur Wellen, der schwarze Himmel, und die Lichter des Hafens, unendlich weit entfernt.
Coppola.
Desmond beobachtet sich beim Schwimmen, bemerkt mit losgelöster Verwunderung, wie seine Gedanken immer wieder zum Kalabrier zurückkehren.
Hör auf, ermahnt er sich selbst. Du bist Psychologe. Du weißt, dass diese Gedanken nirgendwo hinführen.
Tief in der Seele grinst etwas mit blitzenden Zähnen. Und wen genau versuchst du zum Narren zu halten? Etwa dich selbst?
Ohne große Gegenwehr akzeptiert er das Offensichtliche. Der neue Lebenszweck ist so simpel, dass ein einziges Wort genügt, diesen zu definieren.
Rache.
Desmond ist vertraut mit den Mechanismen, die hinter Wut und Rachegelüsten stehen, und das Wissen ändert rein gar nichts an der erhabenen Reinheit, an der Macht des Gefühls. Natürlich ist da eine Basis von Angst und Liebe, die ihn antreibt, Jean zu suchen, zu retten, ein neues Leben mit ihr zu beginnen. Doch gleichzeitig fühlt er, dass die wahre Kraft aus dem urwüchsigen Trieb stammt, das Böse in seinem Leben zu bekämpfen, zu vernichten.
Das bist nicht du, versucht es sein Verstand ein letztes Mal. Du wurdest traumatisiert. Du bist kein Killer!
Doch, das bist du, flüstert die andere Stimme, kalt und selbstsicher. Dein neues Ich. Dein wahres Ich.
Etwas berührt Desmond am Bein, und er zuckt zusammen, findet sich in der tobenden Gegenwart des Sturms wieder. Einen Moment lang ist er überzeugt, dass es der Hai ist, der gigantische Hammerhai, der zurückgekommen ist, um ihn zu verschlingen. Doch dann berühren seine Arme weitere Gegenstände.
Treibgut …?
Er hebt den Kopf und sieht, dass sich etwas verändert hat. Er erkennt Masten, die im Wind schaukeln. Sieht die Umrisse der im Hafen vertäuten Schiffskutter und Segelboote. Doch es kommt keine Hoffnung auf. Der Hafen, kaum noch dreihundert Meter entfernt, könnte ebensogut auf dem Mond liegen. Unter dem Schmerz fühlt Desmond seine Arme und Beine nicht mehr, und er nimmt eher kognitiv wahr, dass sie sich überhaupt noch bewegen.
Erst jetzt realisiert er, dass er tatsächlich aufgegeben hat – und mit der Kapitulation kommt eine seltsame, beinahe heitere Gleichmut.
Gleich ist alles vorbei.
Mit nüchterner Distanziertheit überlegt er, wie nahe er dem Hafen kommen wird, bevor er untergeht. Zweihundert Meter? Hundert?
Er schließt die Augen, fühlt, wie seine Arme immer langsamer werden, Windmühlenflügel, die in einer Flaute auslaufen.
Etwas schlägt gegen seinen Kopf, staucht seinen Hals. Erschrocken strampelt Desmond, um sich über Wasser zu halten – und sieht einen blauweißen Fender vor sich, dahinter den hölzernen Rumpf eines Kutters.
Der Hafen … ich hab ihn erreicht!
Kaum noch fähig, seinen Körper zu kontrollieren, kämpft sich Desmond um den Kutter, zum Steg. Oh nein. Der Steg liegt einen halben Meter über dem Meeresspiegel. Unter normalen Umständen wäre es für Desmond ein Leichtes, sich mit einem Klimmzug hochzustemmen, doch jetzt fühlt er, wie seine Kraftreserven aufgebraucht sind. Eine hohe Welle klatscht über seinen Kopf hinweg, und er sinkt, sinkt.
Loslassen … einfach loslassen …
Auf einmal sieht er Coppola vor sich. Der Kalabrier trägt ein buntes Hawaii-Hemd und den selbstgefälligen Ausdruck von ultimativem Triumph.
Ich gewinne, Desmond, grinst er. Immer. Und diesmal gehört der Schatz mir …
Neben Coppola steht plötzlich Jean, hohläugig, resigniert, ihr nasses Haar an der Stirn klebend. Ihr gelbes Kleid ist zerfetzt wie bei einer Schiffbrüchigen. Der Kalabrier legt einen Arm um ihre Schulter, berührt wie beiläufig den Ansatz ihrer Brust.
Desmonds Körper beginnt zu zucken. Seine Arme holen aus, bewegen sich in weiten Bögen seitwärts nach hinten. Unter Wasser schwimmt er los, aufs Geratewohl, zum Strand oder ins offene Meer. Seine Ellenbogen berühren etwas Hartes.
Felsen …?
Mit unkoordinierten Bewegungen schleppt er sich den Steinstrand hoch, fühlt kaum, wie das scharfe Geröll in seine nackte Haut schneidet. Aus dem Augenwinkel sieht er seine Arme zittern, als stünden sie unter Strom – dann bricht er zusammen, schlägt mit dem Kopf auf einen Stein. Wellen strömen über seine Beine, während aus seiner Schläfe Blut sickert.
Ahnung
Der Dschungel vor Ewarton, Jamaika – Samstag, 2:07 Uhr
Dunkelheit auf der Lichtung mitten im Urwald. Ein Regenschwall prasselt auf das Palmwedeldach der einfachen Holzhütte, und lässt dann nach, wird zu einem feinen Nieselregen. Der Sturm, eben noch wutentbrannt, lässt langsam nach.
Auf ihrer harten Pritsche wälzt sich die ehemalige Mambo-Priesterin unruhig hin und her. Ihr linkes Auge – blind seit dem Anschlag des Bokors vor über einem halben Jahrhundert – schmerzt wie seit vielen Jahren nicht mehr, als stecke eine glühende Nadel drin.
Seit sie ein kleines Mädchen war – Bondye, was für Ewigkeiten das her ist! – hatte Rosalie Loloune, die man ab ihrem siebzigsten Altersjahr nur noch als Gramma Rose kannte, Ahnungen. Manchmal waren es Bagatellen. Zuweilen Erfreuliches, das sich ankündigte. Manchmal aber schreckliche Dinge.
Und sie hat sich nie geirrt.
Nicht ein einziges Mal.
Sie weiß noch nicht, was ihre Intuition ihr diesmal zu verstehen geben will, aber was auch immer es ist, es erfüllt sie mit der Kälte des nahenden Todes. Ihr alter Körper scheint zu schrumpfen wie eine Schildkröte, die sich tief in ihren Panzer zurückzieht. Gleichzeitig weiß sie, dass es kein Weglaufen und kein Verstecken gibt.
Etwas ist im Anmarsch.
Das gesunde Auge weit offen starrt Gramma Rose zur Decke, horcht in die Nacht, lauscht dem abebbenden Heulen des Sturms, während ihr Geist den Dschungel um ihre Hütte durchforstet.
Nichts …
Was auch immer sich heranpirscht, es versteht, sich unsichtbar zu machen. Sie kann es nicht wahrnehmen — was bereits alles sagt, denn Gramma Roses sechster Sinn ist derart ausgeprägt, dass sie ohne hinzuschauen sagen könnte, was für Tiere um ihre Hütte herumschleichen, und was deren Absichten sind.
Unwillkürlich denkt sie an den Weißen aus der Stadt der Türme, der sie gestern besucht hat. Obwohl sie sich nichts anmerken ließ, war der Ayahuasca-Trip, den sie mit ihm machte, für sie selbst überwältigend gewesen. Nie zuvor hatte sie mit jemandem eine derart starke Verbindung gespürt. Als wäre er eine mächtige Radiostation, die mit allem Kontakt aufnehmen kann – selbst mit dem Universum.
Sie weiß, dass er den Bokor aufgesucht hat, und sie kann es kaum glauben, dass er die Begegnung überlebt hat. Wenn sie sich auf ihn konzentriert, kann sie ihn fühlen. Aber etwas hat sich verändert. Da ist eine Leere, als hätte man ihm etwas Essentielles direkt aus der Seele gerissen. Eine Leere, die sich zu füllen beginnt.
Die Zeitenwende, denkt sie. Sie hat begonnen. Ein Kampf der Mächte.
Mühsam rappelt sie sich hoch, stellt sich vor das Fenster und schaut in die immer noch stürmische Nacht hinaus. Der Schmerz in ihrem linken Auge wird heftiger … und nun beginnt auch ihre linke Wange zu glühen, die Stelle mit dem spinnenförmigen Mal, das sie ebenfalls dem Bokor zu verdanken hat.
Rosalie Loloune, genannt Gramma Rose, versteht.
Sie zündet die Öllampe an und dreht sich langsam im Kreis, betrachtet jeden Winkel der Hütte, die ihr während unzähligen Jahren als Heim diente.
Zeit, Abschied zu nehmen …
Letzte Chance
Ocho Rios – Samstag, 2:21 Uhr
Desmonds Lider zucken, während die Augen dahinter rastlos hin und her rollen.
Jean …
Er hat von ihr geträumt – aber was? Desmond hält die Augen geschlossen, versucht, die Bilder zurückzuholen, doch der Traum löst sich bereits auf.
Blinzelnd öffnet er die Augen und schaut sich verwirrt um. Ein kleiner Raum, erleuchtet von einer Nachttischlampe. Neben ihm ein Monitor, auf dem eine Zackenlinie stumm vorbeizieht. Auf seiner Brust Klebeelektroden. Neben ihm ein Chromständer mit einem Infusionsbeutel, dessen Schlauch über eine Kanüle in seine Armvene führt.
Ein Krankenhaus. Warum …?
Er versucht, sich aufzusetzen, und der Schmerz explodiert in seinen Armen, seinen Beinen, seinem Brustkorb – die Mutter aller Muskelkater. Stöhnend lässt er sich zurücksinken. Während der Schmerz nachlässt, versucht sich etwas in sein Bewusstsein zu zwängen. Die Erinnerung kommt in Fragmenten.
Der Dschungel. Gramma Rose. Der Bokor. Die Yacht. Der Sturm.
Jean!
Er sieht den Triangelgriff des Bettgalgens über sich, das Kabel mit dem Notknopf. Ohne zu zögern drückt er den Knopf, wieder und wieder.
Kurz darauf eilt eine ältere Krankenschwester ins Zimmer.
„Bitte!“ Desmond fuchtelt mit der freien Hand. „Ein Telefon! Ich muss die Polizei anrufen!“
„Immer mit der Ruhe, Mister.“ Die Schwester wirft einen Blick auf den Monitor, dann auf den Infusionsbeutel. „Momentan brauchen Sie Ruhe und ärztliche Versorgung, nicht die Polizei. Dr. Thompson wird Sie gleich morgen – “
„Morgen ist es zu spät!“ Desmond setzt sich auf und reißt sich die Elektroden von der Brust.
„Whoa, whoa, immer mit der Ruhe!“ Die Krankenschwester greift nun selbst nach dem Notknopf und drückt ihn zweimal.
„Meine Frau ist in Lebensgefahr!“ fährt Desmond sie an. „Meine … Ex-Frau. Sie wurde entführt! Wenn wir nicht gleich die Polizei verständigen, verliere ich ihre Spur!“
„Mister, bitte legen Sie sich wieder hin. Der diensthabende Arzt ist gleich bei Ihnen, und dann – “
„Ich brauche keinen verdammten Arzt, ich brauche ein Telefon!“ brüllt Desmond. Mit einem Ruck reißt er sich die Infusionsnadel aus dem Arm. Blut spritzt auf das Laken.
Die Krankenschwester dreht sich zur offenen Tür.
„Akuter Erregungszustand Zimmer 19! Alle hierher!“
Als hätten sie bloß auf das Kommando gewartet, stürmen zwei Pfleger und ein Arzt in die Zelle. Der Arzt, ein Schwarzer mit Stirnglatze, hebt beschwichtigend die Hände, während sich die Pfleger von beiden Seiten an Desmond heranschleichen.
„Sir – wo liegt das Problem?“
Desmond weicht zum Fenster zurück, von wo er die Pfleger im Auge behalten kann.
„Das Problem?“ Er lacht hart. „Das verdammte Problem ist, dass man mich nicht ernst nimmt! Meine Ex-Frau wird gerade von einem Mafioso entführt! Vom gleichen Mistkerl, der Dr. Branday erschossen hat!“
„Ich verstehe.“ Der Arzt nickt. „Agnes, Diazepam 10mg. Burt, Dave: haltet ihn fest.“
„Nein!“ Desmond springt auf das Bett und hebt die Fäuste. „Ich muss die Polizei benachrichtigen!“
Der eine Pfleger greift in die Tasche und zielt mit etwas auf Desmonds Gesicht. Instinktiv kneift Desmond die Augen zu und hebt eine Hand vor das Gesicht. In der Sekunde, als er erkennt, dass der Mann kein Pfefferspray in der Hand hält, sondern ein Handy, trifft ihn etwas hart in die Waden. Noch während er rückwärts auf das Bett fällt, zuckt Wut in ihm auf, dass er auf ein so primitives Ablenkungsmanöver hereingefallen ist. Sogleich knien sich die beiden Pfleger auf seine Arme, während sich der Arzt über seine Beine legt. Von allen Seiten festgenagelt versucht Desmond, sich freizukämpfen, aber gegen die drei Männer hat er keine Chance.
Die Krankenschwester beugt sich über ihn und rammt ihm eine Nadel in den Oberarm.
„Nein!“ Noch einmal bäumt sich Desmond auf. Eine warme Welle durchströmt seinen Körper. „Sagen Sie der Polizei, sie sollen nach der Caribbean Mermaid suchen – einer großen Privatyacht!“
Desmond hört, wie sein letztes Wort als ‚Piaaya‘ über seine Lippen kommt … dann taucht er ins Nichts, begleitet von dem vernichtenden Gefühl, die letzte Chance verspielt zu haben, Jean zu retten.
Bokor und Mambo
Ewarton – Samstag, 2:35 Uhr
Gramma Rose schaut an sich herunter. Es ist Jahrzehnte her, seit sie das weiße Kleid der Mambo-Priesterin getragen hat. Der Stoff ist löchrig, von Motten zerfressen, aber es ist das richtige Kleid für diese letzte aller Nächte.
Unwillkürlich stöhnt sie auf und fasst sich an die Wange. Der glühende Schmerz im Spinnenmal hat sich verändert, fühlt sich an, als bohrte ihr jemand ein stumpfes Messer in die Wange.
Ghede … er kommt!
Sie hat nie erfahren, warum der Bokor sie damals am Leben ließ. Damals, als er ihr als Warnung und als Zeichen seiner Überlegenheit das Licht des einen Auges nahm und ihr das giftige Symbol der Spinne auf die Wange hexte. Gramma Rose vermutet, dass er sie durchaus hätte töten können, dass ihm das Risiko aber, nicht unbeschadet aus diesem Zweikampf der Priester hervorzukommen, zu hoch erschien. Ein mentaler Angriff kann unkontrolliert verlaufen, kann wie ein Bumerang vom Opfer abprallen und zum Sender zurückkehren, diesen verletzen oder töten – und der Bokor wusste stets, dass er Rosalie Loloune nicht unterschätzen darf.
Aber etwas hat sich verändert, und diesmal wird der Besuch des Bokors keine Warnung sein.
Gramma Rose hält die Hand auf die Wange gedrückt, lässt heilende Energie einfließen, und der Schmerz lässt etwas nach. Sie setzt sich an den kleinen Tisch, dicht neben die Öllampe, mischt die Tarotkarten, zieht … und weiß, bevor sie die Karte umdreht, welche es sein wird.
Ein grinsendes Skelett. Auf dem knochigen Schädel ein Zylinder, in der Hand ein Spazierstock.
Baron Samedi.
Unwillkürlich berührt die Mambo-Priesterin das Amulett an ihrem Hals, eine zu einer doppelten Acht gewundene Jade-Schlange, das Zwillingsstück zum Amulett, das sie vor Jahren ihrer Urenkelin Jade geschenkt hatte, bevor diese sich gegen die Tradition entschied und den Kontakt zu Gramma Rose abbrach.
Meine Zeit ist abgelaufen.
Die letzte Hoffnung, sich gegen den bösartigen Schamanen behaupten zu können, zerbricht wie eine Tonvase, die zu Boden fällt. Ghede allein ist schon ein Feind, gegen dessen Macht Gramma Rose kaum eine Chance gehabt hätte. Doch jetzt, mit Samedi an seiner Seite …
Draußen im Dschungel herrscht plötzlich Totenstille, und eine Sekunde lang glaubt Gramma Rose, sie wäre schlagartig taub geworden. Dann hört sie ihren eigenen, keuchenden Atem, und versteht.
Er ist hier.
So schnell es ihr alter Körper erlaubt rappelt sie sich hoch, greift erneut nach dem Amulett an ihrem Hals.
Jade … ich muss sie warnen!
Ihr Blick gleitet zur Tür, und sie erstarrt. Leicht gebückt steht des Bokors riesige Gestalt im Türrahmen, schließt die knochigen Finger um einen Gegenstand in seiner Hand. Gramma Rose fühlt, wie ihr Brustkorb von einer unsichtbaren Macht zusammengequetscht wird, wie alle Luft aus ihrer Lunge weicht.
Sie schließt die Augen, das Amulett in der Hand, und visualisiert das Gesicht ihrer Urenkelin ... ein Gesicht, das das ihre sein könnte, als sie noch jung war, ein Gesicht, das sie nun nie mehr sehen würde.
Etwas knackt in ihrer Brust, als ihre Rippen brechen. Gramma Rose nimmt den Schmerz hin, fügt sich der physischen Qual des Sterbens. Da ist ein Anflug von Traurigkeit ... und eine überraschend heftige, fast jugendliche Wut. Wut darüber, dass Menschen wie Ghede sich einfach nehmen, was sie wollen, über das Leben anderer verfügen als wären sie Gottheiten.
In diesem Augenblick des Zorns muss Gramma Rose eine letzte, wichtige Entscheidung treffen. Mit der mentalen Energie, die ihr verbleibt, mit ihrem eigenen, ehrfurchtgebietenden Talent, kann sie den Bokor angreifen. Kaum töten, aber ihn vielleicht ein letztes Mal in die Flucht schlagen.
Sie weiß, dass die Wahrscheinlichkeit verschwindend gering ist.
Stattdessen tut sie das, was um Welten vielversprechender ist – und ihre Seele in Frieden ruhen lassen wird.
Jade, denkt sie, die Hand am Amulett, und in dem Gedanken ist all ihre Liebe, all ihre Kraft, alles, was von Bedeutung ist. Deine Zeit ist gekommen, eine Entscheidung zu treffen.
Sie schaut zu dem reglosen Skelettmann in der Tür, sieht seinen Mundwinkel zucken, und die Erkenntnis trifft sie wie ein Peitschenhieb.
Er hat meinen Gedanken gehört!
Die dunklen Augen des Bokors starren sie an.
Oh ja ... Sie fühlt seine Gier, schlüpfrige Finger, die ihr Gehirn betasten. Zuerst du … dann Jade!
Dann ist da nur noch der mörderische Druck, und ihr letzter Atemzug verpufft in einem kaum hörbaren Keuchen. Sie fühlt, wie ihre gebrochenen Rippen ihre Lungen durchbohren, fühlt, wie ihr Herz von eisernen Klauen zerquetscht wird, in ihrer Brust platzt. Gramma Roses gesundes Auge rollt nach oben, so dass nur noch das Weiße zu sehen ist, dann kippt sie rückwärts auf den Holzboden.
Der Bokor steht über ihr, turmlang, schwarz und stumm. Er hebt die Hand, schnippt mit den Fingern, und ein Funkenregen stäubt über Gramma Rose, brennt sich in das Kleid, das sie als Mambo-Priesterin trug. Augenblicke später schießen Flammen aus dem mürben Stoff, breiten sich über den Holzboden aus.
Der Bokor betrachtet die brennende Leiche einen Moment lang. Flammen züngeln in seinen dunklen Augen. Dann verlässt er die Hütte, ohne sich umzuschauen.
Erwachen
New Kingston, Jamaika – Samstag, 2:39 Uhr
In einem schmutzigen, nach Schweiß und Sperma riechenden Bett im ersten Stock des Nouveau Nightclubs, schreckt Jade Bustamante aus dem Schlaf.
Ich ersticke!
Ein tonnenschweres Gewicht liegt ihr auf der Brust, raubt ihr den Atem. Kein Traum! Sie versucht zu schreien, aber da ist keine Luft in ihrer Lunge. Todesangst überfällt sie.
Hilfe!
Keuchend katapultiert sie sich in eine sitzende Position, ringt nach Atem. Langsam, ganz langsam beruhigt sie sich. Der Schmerz lässt nach.
Doch ein Traum …?
Verwirrt schaut sie sich um, sieht einen fetten, nackten Mann neben sich im Bett. Die Erinnerung kracht auf sie nieder wie eine Lawine, und mit ihr das Elend ihres verpfuschten Lebens. Mit einem Gefühl der Bitterkeit schaut sie auf ihren Freier, der sich schnarchend auf den Rücken dreht; schaut auf das verschrumpelte Glied, dessen klebrige Ladung der Mann vor kurzem in sie abgespritzt hat. Jade weiß, dass es nichts bringt, sich etwas vorzumachen. Sie ist auf der Zielgeraden zum Untergang, hat den Niedergang von der Freizeitprostitution in den Drogenstrich in weniger als zwei Jahren geschafft. Seit einem Jahr hat sie kein Kondom mehr benutzt. Sex ohne Gummi wird besser bezahlt, der einzige Weg, sich weiterhin genügend Crystal Meth zu leisten, das verdammte Gift, das sie für ein paar wenige Stunden aus der Hölle des Alltags ins Nirwana der Ekstase schweben lässt, in einen gottähnlichen Zustand von Kraft, Verzückung und kosmischer Allmacht.
Jade fährt sich mit der Zunge über die Zähne, fühlt den Belag. Immer häufiger vergisst sie, sich die Zähne zu putzen, obwohl auch diese lästige Pflicht für ihr Geschäft wichtig ist. Einige Freier zahlen einen Aufpreis dafür, sie auf den Mund zu küssen, ihre Zunge zu fühlen, zahlen für ein feuchtes Trugbild von Liebe.
Die Rastlosigkeit setzt ein, jener fiese Strom in ihren Nerven, der sich so sehr wie Angst anfühlt. Ihr wird bewusst, wie nüchtern sie ist, wie wach und unerträglich nüchtern. Sie weiß, dass sie noch eine ganze Menge Restalkohol vom Abend in sich haben muss, aber sie fühlt nichts davon.
Ich brauche etwas Ice … nur ein wenig.
Die Unruhe wird schlimmer, und erst jetzt merkt sie, dass sie die eigene Lüge nicht schlucken kann. Es ist nicht der Entzug, der sie auf glühenden Kohlen sitzen lässt. Auch nicht der Albtraum ( – kein Traum, das war kein Traum! – ), der ihr das entsetzliche Gefühl des Erstickens brachte.
Ein … Vorgefühl.
Die quälende Gewissheit, dass etwas Schreckliches geschehen ist, und dass noch Schlimmeres naht.
Das Amulett zwischen ihren nackten Brüsten, die doppelte Schlangen-Acht, verbreitet eine unangenehme Hitze.
Gramma. Der Gedanke ist so schockierend wie unabwendbar. Sie ist tot.
Für den Bruchteil einer Sekunde sieht Jade einen Schatten, eine bedrohlich große, skelettartige Gestalt in der Ecke des Zimmers – eine Gestalt, die ihr den Rücken zudreht. Dann ist sie weg.
Er kann mich nicht sehen. Sie erschauert. Noch nicht.
Das leise Knirschen von Holz, wie von vorsichtigen Schritten.
Jade. Grammas Stimme, um sie herum, in ihrem Kopf. Deine Zeit ist gekommen, eine Entscheidung zu treffen.
Grammas Stimme ist erfüllt von Liebe und großer Sorge, was an der gespenstischen Situation das Beängstigendste ist. Jade hat ihre Urgroßmutter nie besorgt erlebt.
Niemals.
Unwillkürlich berührt Jade das Amulett, während ihre Brust sich viel zu schnell hebt und senkt. Ihre Hand schließt sich um die Schlange, während vor ihrem geistigen Auge Karten mit mystischen Bildmotiven erscheinen. Das Tarot-Kartendeck, dass ihre Urgroßmutter ihr – zusammen mit dem Amulett – zu ihrer ersten Menstruation geschenkt hatte; zu dem heiligen Tag, an dem Jade vom Mädchen zur Frau wurde. Zu dem Tag, an dem sie die erste wichtige Entscheidung ihres Lebens zu treffen hatte; wählen musste, ob sie als Mambo-Priesterin in die Fußstapfen ihrer Urgroßmutter treten würde – oder nicht.
Sie hatte es nicht getan. Während ihre Mutter und Großmutter schlicht das Talent nicht hatten, verwarf Jade Bustamante ihr Recht auf das heilige Amt aus freien Stücken, verweigerte ihre Pflicht aus Feigheit.
Und nun kommt der bittere Kelch der Entscheidung ein zweites Mal.
Vielleicht ein letztes Mal.
Hinter ihr ertönt ein blubbernder Furz, und der fette Mann dreht sich schmatzend auf die Seite.
Ice … nur ein paar Züge. Dann schauen wir weiter.
Zitternd schlüpft Jade in ihre Kleider und verlässt das schäbige Zimmer.
Chaos
Ocho Rios – Samstag, 12:47 Uhr
Desmond liegt auf dem Grund eines Teiches, liegt im weichen, kühlen Moor. Das Gefühl von Frieden, eben noch vollkommen, weicht einem plötzlichen Unbehagen. Etwas umschmeichelt ihn, etwas, das sich wie Algen anfühlt, die sich um seine Glieder wickeln, ihn sanft nach oben ziehen, zur Oberfläche, zur Erinnerung. Er sträubt sich, aber die Algen werden härter, werden zu Stacheldraht, dessen Stahldornen sich in seine Haut bohren.
Aufwärts, aufwärts, zum Licht, das er nicht sehen will, und dann taucht er auf ins Tagesbewusstsein, erwacht in einer Welt des Schmerzes.
Ziehende Schmerzen in Armen und Beinen.
Stechende Schmerzen im Brustkorb, bei jedem Atemzug.
Dumpfer Schmerz im Kopf.
Vorsichtig berührt er seine Schläfe, fühlt den Verband. Neben ihm läuft wieder die stumme Zackenkurve des EKGs über den Monitor. Auch die Infusion wurde frisch gesetzt, nur, dass sein Arm diesmal dick einbandagiert ist, vermutlich um ihn davon abzuhalten, die Kanüle erneut herauszureißen.
Dann kommt die Erinnerung, unendlich qualvoller als der körperliche Schmerz. Schlagartig setzt sich Desmond auf, schwingt die Beine aus dem Bett und schaut sich fieberhaft nach einer Uhr um. Nichts. Auch von seiner Kleidung keine Spur.
Natürlich … ich habe im Meer alles ausgezogen.
Er greift nach dem Rufknopf am Bettgalgen, drückt ihn wiederholt. Wie er von seinem Klinikaufenthalt im UWI weiß, bedeutet einmal drücken, dass man eine Krankenschwester zu sehen wünscht; zweimal drücken löst den Notruf aus.
Draußen ertönen Schritte, und ein gedrungener Arzt mit glänzender Glatze betritt das Zimmer, hinter ihm eine Krankenschwester.
„Guten Tag, Sir.“ Er bleibt vor Desmonds Bett stehen und schaut ihn ernst an. „Wie geht es Ihnen?“
„Ich brauche ein Telefon!“ Desmond rappelt sich hoch, schwankt, und fällt auf die Bettkante zurück. „Sofort! Meine Ex–Frau …“
„Immer sachte.“ Die Art des Arztes ist freundlich, aber bestimmt. „Ich bin Dr. Thompson, der Stationsarzt. Können Sie mir bitte Ihren Namen verraten?“
„Mein Name?“ Desmond unterdrückt eine sarkastische Bemerkung – dann wird ihm bewusst, dass er nackt und ohne Papiere eingeliefert wurde. „Mein Name ist Desmond Parker, aus Manhattan, New York. Bitte, ich muss zuerst mit der Polizei –“
„Dr. Maddock, der diensthabende Arzt, hat die Polizei noch in der Nacht verständigt.“ Dr. Thompson betrachtet ihn abwägend. „Dies, obwohl er Ihren Anfall verständlicherweise für ein akutes Delirium hielt.“
Desmond starrt den Arzt an. „Er … er hat die Polizei verständigt? Hat man die Yacht gefunden? Ist Jean – “
Der Arzt hebt die Hand. „Eines nach dem anderen, Mr. Parker. Sie haben großes Glück, dass Sie noch leben. Ein Fischer hat Sie am Hafen gefunden, als er sein Boot besser vertäuen wollte. Er fand Sie nackt und blutend auf dem Steinstrand zwischen den Booten und hat sogleich das Krankenhaus angerufen.“
„Was ist mit der Yacht?“ Desmond versucht, seine Stimme ruhig zu halten. „Haben Sie irgendwas gehört?“
Der Arzt wendet sich an die Schwester. „Sie können gehen, Tess.“
Während sie das Zimmer verlässt, zieht Dr. Thompson sein Handy aus der Kitteltasche, wählt eine Nummer und reicht es Desmond.
„Hier, sprechen Sie selbst mit der Polizei. Und danach wäre ich froh, wenn Sie mir ein paar Fragen beantworten könnten.“
Desmond lauscht dem Wählton. Eine teilnahmslose Stimme meldet sich.
„Ocho Rios Police Station, was kann ich für Sie tun?“
„Mein Name ist Parker. Desmond Parker. Meine Ex–Frau, Jean Madley, wurde letzte Nacht entführt, auf einer Yacht – “
„Bleiben Sie in der Leitung.“
Ein Klicken, und kurz darauf ein barsches „Calloway.“
Desmond setzt ein zweites Mal an, die Situation zu erklären. „Ein Dr. Maddock vom Ocho Rios Hospital hat gestern Nacht bei Ihnen angerufen – kann ich bitte mit dem zuständigen Sergeant sprechen?“
„Ich bin der zuständige Sergeant.“ Calloway macht keinen Versuch, seine Unlust zu verbergen. „Sie sind also derjenige, der behauptet, seine Frau –“
„Ex–Frau.“
„– sei von einem Mafioso entführt worden? Auf einer Luxus–Yacht?“
Desmond ignoriert die ironische Betonung des Polizisten. „Genau.“
„Okay.“ Calloway seufzt betont. „Geben Sie mir mal die Kurzfassung.“
So knapp wie möglich schildert Desmond die Ereignisse der letzten Stunden, von seiner Suche nach einer Heilerin, über Jeans Entführung bis zum Kampf auf der Yacht – wohl darauf achtend, den Bokor und dessen übersinnliche Fähigkeiten nicht zu erwähnen.
Ohne zu unterbrechen hört Calloway zu, brummt zwischendurch unverbindlich.
„Und warum genau wollte dieser Coppola Sie und Ihre Ex entführen? Sind Sie reich, oder ein Kronzeuge oder sowas?“
„Nein.“ Desmond überlegt fieberhaft. Falls er Calloway die Wahrheit sagt, ihm erzählt, dass Coppola ihn als seinen Screener missbrauchen wollte, als menschliches Diagnosegerät für gefährliche Krankheiten, würde man Desmond vom Krankenhaus direkt in die nächste psychiatrische Klinik verlegen. Falls er das Motiv des Mafioso aber verschweigt, steht die gesamte Entführungsgeschichte auf mehr als wackligen Beinen.
Calloway schnalzt mit der Zunge. „Ziemlich abenteuerliche Story, Mr. Parker, nicht wahr?“
Desmonds Hand verkrampft sich um das Handy.
„Haben Sie die Küstenwache informiert? Sie wird Ihnen bestätigen, dass es die Caribbean Mermaid gibt, und dass sie gestern Abend in Ocho Rios vor Anker lag!“
„Oh, die Küstenwache hat schon vor Stunden bestätigt, dass es das Schiff durchaus gibt. Nur, dass der Transponder offenbar ausgeschaltet oder durch den Sturm lahmgelegt wurde. Jedenfalls ist die Yacht momentan nicht aufzufinden.“
„Dann muss die Küstenwache mit Schiffen nach ihr suchen, oder mit Heli–“
„Mr. Parker, bei allem Respekt. Nach dem Sturm herrscht da draußen das völlige Chaos, und Sie sind nicht der Einzige, der jemanden vermisst. Die Küstenwache ist momentan völlig ausgelastet mit Rettungsaktionen von Booten, die in Seenot geraten oder gesunken sind. Und ich muss wohl nicht betonen, dass wir von der Jamaica Constabulary Force hier auf der Insel auch alle Hände voll zu tun haben. Ich schlage vor, Sie melden sich in zwei Stunden nochmals, dann kann ich Ihnen sagen, wie der Stand der Dinge ist.“
„Sergeant, Sie verstehen nicht! Wenn wir nicht sofort – “
„Nein, Mr. Parker, Sie verstehen nicht: Es gibt auch andere Menschen mit Problemen!“
Ein Klicken, und die Leitung ist tot.
Desmond reicht dem Arzt das Handy zurück, die Ahnung von drohendem Unheil stärker als je zuvor.
„Ruhen Sie sich aus“, sagt Dr. Thompson. „Auch wenn’s zynisch klingt, momentan können Sie nichts tun. Ich komme in zwei Stunden wieder vorbei, damit Sie nochmals anrufen können.“
„Danke, Doctor.“
Während der Arzt das Zimmer verlässt, bleibt Desmond auf der Bettkante sitzen. Er fährt sich mit den Händen über das Gesicht, und auf einmal ist er im tobenden Meer, sieht wie Jean hoch über ihm auf die Reling klettert, bereit, sich in die Fluten zu stürzen, mit ihm um ihr Leben zu schwimmen.
‚Spring!‘ brüllt Desmond – dann packt der Kalabrier sie um den Hals und reißt sie von der Reling, aus Desmonds Leben.
Desmonds Schultern zucken, als er den Impuls unterdrückt, zu schreien oder etwas kaputtzuschlagen. Langsam, ganz langsam, lässt er sich auf das Bett zurücksinken.
Jean … wo bist du?
Calloway
Ocho Rios – Samstag, 13:11 Uhr
In der Ocho Rios Police Station legt Sergeant Bill Calloway den Hörer auf und lehnt sich im Sessel zurück. Was für ein gottverfluchtes Schlamassel. Seit dem frühen Morgen hat er über fünfzig Telefonanrufe beantwortet, Menschen beschwichtigt, Suchaktionen koordiniert und gut zehn Blätter mit kaum lesbaren Memos vollgekritzelt – Notizen, die ihn während der unzähligen Stunden des Berichteschreibens begleiten würden.
Unwillkürlich denkt er an den Amerikaner. Wie war sein Name noch gleich? Parker … Dustin Parker oder so ähnlich. Calloway verzieht den Mund. Wie die meisten Menschen steckt auch der Yankee in dem Irrglauben, dass er die Hauptperson in einem Drama sei, das eine ganze Insel betrifft.
Aber da war etwas …
Irgendetwas in der Räubergeschichte des Amerikaners hatte Calloway aufhorchen lassen. Die Bemerkung, dass Dr. Branday tot sei, ermordet von demselben Mafioso, der Parkers Ex–Frau angeblich verschleppt hat.
Branday …
Calloway kennt den Namen. Vor Jahren hatte Sonny, Calloways Neffe, bei einem BBQ schwere Verbrennungen im Gesicht erlitten, als eine Gasflasche explodierte. Dr. Charles Branday hatte ihn in Kingston operiert, insgesamt viermal, bis Sonnys Gesicht wieder einigermaßen menschlich aussah. Eigentlich sogar ganz passabel.
Branday tot … wirklich?
Er greift zum Telefon und wählt die Zentrale. „Geben Sie mir das UWI Hospital in Kingston.“
Während der Sergeant mehrmals weiterverbunden wird, denkt er über die Geschichte des Amerikaners nach. Ein Psychologe auf der Suche nach einer Heilerin mitten im Nirgendwo. Ein berüchtigter Mafioso. Ein Gefecht im Urwald. Eine Multi–Millionen–Dollar–Yacht, die plötzlich vom Bildschirm verschwindet.
„Abteilung für Chirurgie“, unterbricht eine Frauenstimme seine Gedanken. „Hier Schwester Dorothy, wie kann ich Ihnen helfen?“
„Sergeant Calloway, Ocho Rios Constabulary Force. Können Sie mir sagen, ob Dr. Charles Branday heute zur Arbeit erschienen ist?“
Die Schwester macht einen missbilligenden Ton. „Ich weiß zwar nicht, was die Frage soll, Sergeant, aber ich kann Ihnen versichern, dass Dr. Branday in den fünfzehn Jahren, seit ich hier arbeite, noch nie gefehlt hat.“
Calloway kritzelt auf ein bereits volles Blatt Papier. „Also ist er auch heute zur Arbeit erschienen … wissen Sie um welche Zeit?“
„Moment.“ In der Leitung das Rascheln von Blättern. „Die erste OP war heute Morgen um 7:35 Uhr. Ich habe ihm dabei assistiert. Darf ich fragen, was hier vorgeht, Sergeant?“
Calloway ignoriert ihre Frage. „Schwester Dorothy, ist Ihnen an Dr. Branday irgendwas aufgefallen? Verhalten, Kleidung, irgendwas?“
Eine kurze Pause. „Nun ja … jetzt, wo Sie mich darauf ansprechen … er wirkte irgendwie anders als sonst. Vielleicht ein klitzeklein wenig … abwesend?“
Calloway macht sich eine weitere Notiz. „Aw–right. Bitte richten Sie Dr. Branday aus, dass ich noch heute nach Kingston fahre, um ihn zu treffen. Ich bin um 17:30 Uhr in seinem Büro.“
Amnesie
UWI Hospital, Kingston – Samstag, 13:36 Uhr
Im OP–Raum 2 schneidet Dr. Charles Branday den subkutanen Faden ab und inspiziert die Wunde. Tadellos. Er zieht sich die Latexhandschuhe von den Händen und schnipst sie in den Mülleimer.
„Brad, Sie können ihn zunähen. Cefazolin für eine Woche. Wir schauen uns die Wunde morgen früh bei der Visite an.“
Der Assistenzarzt nickt, und die OP–Schwester reicht ihm Nadelhalter und Pinzette.
Während Branday den Schleusenraum betritt und sich die Maske vom Gesicht zieht, überfällt ihn wieder ein leichter Schwindel, begleitet von einem leisen Unbehagen. Die letzten Stunden waren derart unwirklich, dass er sich zweimal gezwickt hat um sicherzugehen, dass er wirklich wach ist.
Ein Traum in einem Traum …
Da sind Fragmente von Erinnerungen, Teile von zerrissenen Fotos, die sich zu keinem Gesamtbild zusammenfügen lassen. Wie ein Schlafwandler wanderte er durch den Dschungel, ohne die geringste Ahnung, wie er dorthin gekommen war oder was er dort zu suchen hatte. Der freundliche Rasta, der ihn mitgenommen hatte, war ein Schutzengel, der ihn aus dem Alptraum befreite, doch auch der kurze Schlaf im Toyota brachte die Erinnerung nicht zurück.
Als sie Kingston um halb fünf Uhr morgens erreichten, war Branday zu seiner eigenen Verwunderung kein bisschen müde gewesen. Und nicht nur das, er schien sich an ziemlich alles zu erinnern, was vor seinem mysteriösen Abstecher in den Dschungel geschehen war.
Oder vielleicht doch nicht?
Er erinnerte sich an seinen Namen, seinen Job, an die Tatsache, dass seine Ehefrau Patra in Negril bei ihrer Schwester Tasha war ... aber was zur Hölle hatte er in den letzten vierundzwanzig Stunden getan? Oder in den letzten Tagen?
Eine partielle Amnesie ... aber wie weit reicht sie zurück?
Mit einem mulmigen Gefühl zog er sich die zerfetzten, blutigen Klamotten vom Leib (– von wegen Paintball! – ), nahm eine ausgiebige Dusche und fuhr gleich anschließend ins UWI Hospital, in der Hoffnung, dass die vertraute Umgebung irgendetwas in ihm wachrütteln würde. Sie tat es nicht. Dafür wurde Branday sogleich zu einer Revisionsoperation gerufen, einem Infekt nach einer Gallenblasenentfernung. Die Routine des Operierens tat gut, aber die Amnesie blieb.
Brandays Handy vibriert, und er hört Schwester Dorothys energische Stimme: „Ein Sergeant Calloway aus Ocho Rios hat angerufen. Er möchte Sie um 17:30 Uhr in Ihrem Büro sprechen.“
„Hat er gesagt, um was es geht?“
„Nein, aber er stellte ein paar ziemlich schräge Fragen.“
„Danke Dorothy.“
Verwirrt drückt Branday die Trenntaste.
Ein Cop? Warum…?
Nachdenklich schreitet er durch den Krankenhauskorridor zu seinem Büro, ohne die geringste Ahnung, dass er knapp vierundzwanzig Stunden zuvor von einem psychopathischen Mafioso entführt, im tiefsten Dschungel um ein Haar erschossen und in letzter Sekunde von einem Bokor gerettet wurde.
Suche
Ocho Rios – Samstag, 15:22 Uhr
Mit langen Schritten marschiert Lieutenant Phil Donegan auf den militärgrünen Bell 212 Helikopter zu. Die Maschine, frisch aufgetankt und technisch geprüft, steht flugbereit auf dem Landeplatz des Küstenwachenstützpunktes Turtle River in Ocho Rios.
Ein kurzer Blick zum Himmel, und Donegan nickt zufrieden. Der Sturm ist vorbeigezogen, der Himmel wolkenlos blau. Perfekte Sichtverhältnisse. Gemäß der Meteo–Zentrale der Küstenwache sind die Windgeschwindigkeiten über dem Meer auf vierzig Meilen pro Stunde abgeflaut. Kein Problem für den Bell, mit dem Donegan schon wesentlich härtere Wetterbedingungen gemeistert hat.
Donegan steigt in die Kanzel, zieht sich die Kopfhörer über, prüft die Instrumente und startet die beiden Triebwerke. Während sich die Rotorblätter über ihm schneller und schneller drehen, macht er einen Eintrag ins Logbuch.
Das harte Trappeln von rennenden Kampfstiefeln, knapp hörbar über den lauter werdenden Turbinen. Jerry McDermott schwingt sich auf seinen Sitz, ein breites Grinsen im dunklen Gesicht.
„Ich weiß echt nicht, was geiler ist: Sex oder Fliegen.“
Donegan schaut ihn mit gerunzelter Stirn an. „Zehn Minuten für einen verdammten Quickie? Du wirst alt.“
McDermott zwinkert ihm zu. „Was soll ich sagen? Die Kirsche im Hangar machte einen auf Gleichberechtigung und wollte auch einen Orgasmus.“
Donegan schüttelt den Kopf. „Kein Scheiß, Bway, du schwitzt verdammte Pheromone aus. Keine Ahnung, wie du mit deiner Fresse an jede Muschi rankommst, die dir über den Weg läuft.“
„Das hat deine Mama auch gesagt, bevor sie sich für mich ausgezogen hat.“
„Hoffentlich hat sie dir ihren Tripper angehängt.“
Donegan wirft einen Blick auf den Drehzahlmesser. Sechsundneunzig Prozent. Langsam zieht er den Hebel für die kollektive Blattverstellung nach hinten, und der Helikopter erhebt sich senkrecht in die Höhe.
Nach vier Einsätzen über dem Festland – zwei Erkundungsflügen zur Schadensbeurteilung und zwei Bergungsaktionen – hat der Tower die Suche über dem Meer freigegeben. Während ein Teil der Jamaican Defense Force mit Hilfe der Polizei und Zivilbevölkerung Trümmer aus dem Weg räumt und Verletzte birgt, sucht das Luftgeschwader – sechs Kleinflugzeuge und sieben Helikopter – das Meer rund um Jamaika nach Schiffen in Seenot, Rettungsbooten und Schiffbrüchigen ab.
„Okay.“ Donegans Blick schweift über die Karibische See nördlich von Ocho Rios. „Jetzt, wo dein Hormonhaushalt wieder im Gleichgewicht ist, lass uns ein paar verlorene Seelen retten …“
Kapitel 8
JETZT
Todesengel
Blue Oak Forensic Clinic, Clifton, New Jersey – Freitag, 14:36 Uhr
Mit ungelenken Bewegungen klettern die beiden Babys aus ihren Holzkrippen, ein wissendes Lächeln auf den Lippen.
Desmond weiß, dass es ein Albtraum ist, ein dämonischer Traum, der ihn für alle Zeiten verfolgen wird, aber er kann nicht aufwachen. Seine Füße scheinen wie festgeklebt.
Doch diesmal ist etwas anders.