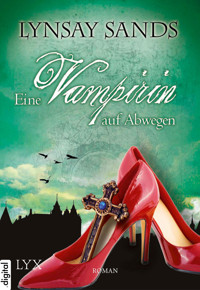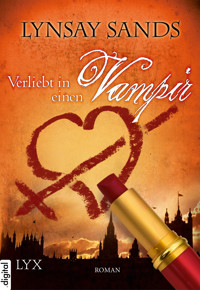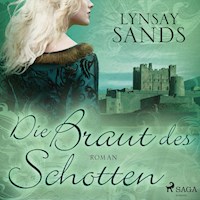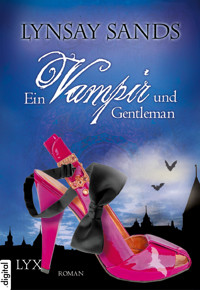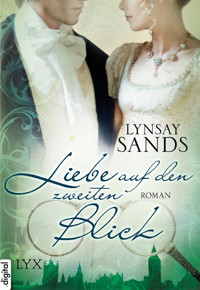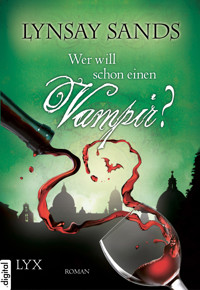9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Highlander
- Sprache: Deutsch
Ein Krieger wie kein anderer!
Claray MacFarlane hat sich ihre Hochzeit schon oft ausgemalt - vor den Altar gezwungen zu werden, um einen Schurken zu heiraten, war allerdings nicht Teil ihrer Träume. Zum Glück taucht in letzter Sekunde der berüchtigte Highlander Conall auf, den alle nur den "Wolf" nennen, und bewahrt sie vor diesem Schicksal. Obwohl sie von seinem Ruf als gerissenem Krieger, dessen Vergangenheit niemand kennt, weiß, fühlt sich Claray sofort zu ihm hingezogen. Auch Conall ist verzaubert von der unschuldigen Schönheit. Doch um ihr eine Zukunft und Sicherheit bieten zu können, muss er sich zuerst seinen Dämonen stellen und sein Geburtsrecht einfordern, das ihm seine Feinde gewaltsam entrissen haben.
"Ich greife zu jedem Buch von Lynsay Sands, denn ich weiß einfach, dass ich es mit einem glücklichen Lächeln auf dem Gesicht beenden werde." BETTY LOO’S BOOK REVIEWS
Band 10 der HIGHLANDER-Reihe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Die Autorin
Die Romane von Lynsay Sands bei LYX
Impressum
LYNSAY SANDS
Der Sieg des Highlanders
Roman
Ins Deutsche übertragen von Susanne Gerold
Zu diesem Buch
Claray MacFarlane hat sich ihre Hochzeit schon oft ausgemalt – dass sie allerdings von ihrem raffgierigen Onkel vor den Altar gezerrt werden würde, um einen Schurken zu heiraten, war nicht Teil ihrer Tagträume. Zum Glück taucht in letzter Sekunde der berüchtigte Highlander auf, den alle nur den »Wolf« nennen, und bewahrt sie vor diesem Schicksal. Der attraktive Söldner mit den schwarzen Haaren trägt nicht umsonst den Namen eines Raubtiers, ist er doch genauso tödlich und gerissen. Obwohl sie seinen Ruf kennt, fühlt sich Claray sofort zu ihm hingezogen. Sie ahnt nicht, dass der Wolf ihr tot geglaubter Verlobter Conall ist, der ihr bereits im Kindesalter versprochen wurde. Conall ist der warmherzigen Schönheit ebenfalls bald mit Haut und Haar verfallen und würde sie am liebsten nie mehr aus seinen Armen lassen. Doch um ihr ein Heim und eine Zukunft bieten zu können, muss er zuerst die Schuldigen finden, die seine Familie auf dem Gewissen haben, und seinen Titel und sein Land wiedererlangen. Denn er weiß, dass seine Feinde nicht davor zurückschrecken würden, Claray Schaden zuzufügen.
1
Claray stand am Fenster und überlegte, welchen Vorteil es haben könnte, in den Tod zu springen, statt Maldouen MacNaughton zu heiraten, als es an der Tür klopfte. Sie erstarrte. Das laute Geräusch klang wie eine Totenglocke. Es sagte ihr, dass ihre Zeit um war. Sie waren gekommen, um sie in die Kapelle zu bringen.
Clarays Finger schlossen sich einen Moment um den steinernen Fenstersims, und sie spannte sich an, machte sich bereit, hinaufzuklettern und sich in die Tiefe zu stürzen. Aber sie konnte es nicht tun. Father Cameron sagte, dass es eine Sünde war, sich selbst zu töten, und man dafür in die Hölle kam. Claray war sich ziemlich sicher, dass es immer noch besser war, zehn oder zwanzig Jahre Hölle auf Erden als MacNaughtons Gemahlin zu ertragen, statt als eine von Satans Dienerinnen eine ganze Ewigkeit in der wahren Hölle zu verbringen.
Ihre Schultern sackten nach unten. Sie drückte ihre Wange gegen den kalten Stein und schloss die Augen, schickte ein letztes Stoßgebet zum Himmel. »Lieber Gott, wenn du keinen Weg findest, mich vor dem hier zu bewahren … gewähre mir wenigstens einen schnellen Tod.«
Es klopfte erneut, dieses Mal lauter und dringlicher. Claray richtete sich mühsam auf und ging zur Tür, strich auf dem Weg dorthin den Rockteil ihres hellblauen Kleides glatt. Es überraschte sie nicht, ihren Onkel Gilchrist zu sehen, begleitet von den beiden Männern, die vor ihrer Tür Wache standen, seit sie drei Tage zuvor hier angekommen war. Dass sich für einen kurzen Moment der Ausdruck eines schlechten Gewissens in seiner Miene widerspiegelte, überraschte Claray dann aber doch, und für einen Augenblick keimte Hoffnung in ihr auf. Aber noch bevor sie ihn bitten konnte, das hier nicht zu tun, hob Gilchrist Kerr eine Hand und gebot ihr Schweigen.
»Es tut mir aufrichtig leid, Nichte. Aber ich bin nicht länger gewillt, als Lowlander geringgeschätzt zu werden, und MacNaughton hat mir MacFarlane versprochen, wenn ich der Heirat zustimme. Du wirst seine Frau werden, ob du willst oder nicht.«
Claray presste die Lippen aufeinander und nickte resigniert, aber dann überkam sie der Drang, doch etwas zu sagen: »Hoffen wir also, dass Ihr lange genug lebt, um es zu genießen, Onkel. Denn ich fürchte, dass Ihr wegen Eurer Entscheidung ein Leben lang in der Hölle schmoren werdet.«
Bei diesen Worten huschte der Ausdruck von Furcht über sein Gesicht, dem gleich darauf der von Wut folgte. Seine Hand schloss sich so fest um ihren Arm, dass es wehtat. Er zerrte sie auf den Korridor hinaus und fauchte: »MacNaughton wird dir schon noch beibringen, deine Zunge zu hüten, Mädchen. Sonst landest du noch vor mir in der Hölle.«
Claray hob das Kinn und starrte stur geradeaus, während er sie den Gang entlang zur Treppe zog. »Niemals. Mein Gewissen ist rein. Vielleicht sterbe ich vor Euch, aber im Gegensatz zu Euch werde ich in den Himmel kommen.«
Claray hatte gewusst, dass sie ihn mit diesen Worten noch wütender machen würde. Deshalb wunderte es sie nicht, dass er noch fester zupackte – so fest, dass sie befürchtete, er würde ihr den Knochen brechen. Aber Worte waren jetzt ihre einzige Waffe, und wenn das, was sie gesagt hatte, ihm mehr als eine oder zwei schlaflose Nächte bescherte, bis er vor seinen Schöpfer trat, war das zumindest etwas.
Claray versuchte, sich auf diesen Gedanken zu konzentrieren statt an das ihr bevorstehende Schicksal, als ihr Onkel sie die Treppe hinunterzog und aus dem Wohnturm zerrte. Er war größer als sie, seine Beine waren länger, aber darauf nahm er keine Rücksicht. Unbarmherzig schleifte er sie über den Burghof, und sie musste laufen, um mit ihm Schritt zu halten. Claray richtete ihre Aufmerksamkeit so sehr darauf, dass sie fast gestolpert wäre, als er auf halbem Weg zur Kapelle plötzlich stehen blieb. Hätte er sie nicht so fest am Arm gehalten, sie wäre gestürzt.
Einen Moment lang flackerte erneut die Hoffnung in ihr auf, sein Gewissen könnte sich gemeldet und ihn zu einem Sinneswandel bewogen haben. Doch ein Blick in sein Gesicht verriet ihr, dass seine Aufmerksamkeit nicht ihr galt. Die Stirn gerunzelt schaute er zum Tor, wo ein kleiner Tumult ausgebrochen war. Von dort war Hufgetrappel zu hören.
Der Hoffnungsfunken in Claray erstarb, während sie gleichgültig zusah, wie drei Männer zu Pferde die Zugbrücke überquerten. Vermutlich Hochzeitsgäste, die sich verspätet haben, dachte sie unglücklich und richtete den Blick auf die Kapelle, wo eine große Menschenmenge auf sie wartete. Die Zeugen ihres Unglücks, hauptsächlich MacNaughtons Soldaten und einige wenige Mitglieder vom Clan Kerr. Die meisten wollten mit dem Verrat, den ihr Laird an seiner eigenen Nichte beging, offensichtlich nichts zu tun haben.
»Der Wolf«, murmelte ihr Onkel. Seine Stimme klang bestürzt.
Claray sah ihn an und stellte fest, dass er ratlos dreinblickte. Die drei Reiter befanden sich jetzt im Burghof und kamen im leichten Galopp – nicht im Schritt – geradewegs auf sie und ihren Onkel zu. Clarays bisheriges Desinteresse verflog augenblicklich. Die Männer waren große, kräftige Krieger. Sie alle trugen ihr Haar lang, der Reiter an der Spitze hatte schwarzes Haar, der ihm folgende dunkelbraunes, und der letzte Reiter war blond. Und alle drei sahen gut aus, konnten vielleicht sogar schön genannt werden, wie Claray unwillürlich befand, als sie näher kamen.
Claray musste nicht fragen, was oder wer von den dreien der Wolf war. Bei den Troubadouren war der Krieger, der den Spitznamen »der Wolf« trug, bereits seit einiger Zeit ein beliebtes Thema. Jedes zweite Lied handelte von ihm, pries ebenso seinen Mut und seine Kühnheit im Kampf wie sein hübsches Gesicht und seine schönen Haare, die als »schwarz wie die Sünde« besungen wurden. Den Liedern zufolge war der Wolf ein Krieger, der genauso klug und todbringend war wie das Tier, nach dem er benannt wurde. Allerdings tauchte er in all diesen Liedern immer als einsamer Wolf auf. Er galt als wortkarg und war keinem der Clans besonders verbunden. Stattdessen bot er seinen Schwertarm gegen Münzen an. Er war ein Söldner, aber ein ehrbarer. Es hieß, er würde nur jenen dienen, die eine gerechte Sache verfolgten.
»Was zum Teufel hat der Wolf hier zu suchen?«, murmelte ihr Onkel jetzt.
Claray vermutete, dass er mehr mit sich selbst sprach, daher machte sie sich nicht die Mühe, darauf zu antworten. Abgesehen davon hatte sie keine Ahnung, warum der Mann hier war. Sie dankte ihm trotzdem im Stillen, begrüßte sie doch jede Verzögerung der ihr aufgezwungenen Heirat.
»Laird Kerr«, sagte der Wolf zur Begrüßung, während er sein Pferd vor ihrem Onkel und ihr zügelte. Er griff in sein Plaid und holte eine Pergamentrolle heraus. Als er das mit einem Siegel versehene Schreiben in der Hand hielt, ließ er seinen Blick kurz über Claray schweifen, ehe er sich wieder ihrem Onkel zuwandte. »Soviel ich weiß, ist Claray MacFarlane hier zu Besuch. Ist sie das?«
»Aye«, murmelte ihr Onkel und starrte wie gebannt auf die Pergamentrolle.
Der Wolf nickte, beugte sich vor und reichte ihm die versiegelte Botschaft. Clarays Onkel ließ ihren Oberarm los und nahm das Schreiben entgegen. Sie zwang sich, nicht dem Drang nachzugeben, über die Stelle zu reiben, an der er sie so brutal gepackt hatte. In ihrem Arm pochte der Schmerz, aber sie hatte ihren Stolz und sah deshalb ruhig zu, wie er das Siegel brach und das Schreiben zu entrollen begann.
Doch ihre Ruhe war nur vorgetäuscht, während sie abwartete. In ihr war erneut Hoffnung aufgestiegen, denn es bestand immerhin die Möglichkeit, dass das Schreiben von ihrem Vetter Aulay Buchanan kam. Es konnte seine Antwort auf die Bitte seiner Kusine Mairin sein, ihr zu helfen. Noch war es möglich, dass sie vor dem Schicksal bewahrt wurde, das MacNaughton ihr aufzwingen wollte. Sie war so in Gedanken versunken, dass es sie vollkommen überraschte, als der Wolf sie plötzlich um die Taille packte, hochhob und zu sich in den Sattel zog.
Sie schnappte nach Luft, während ihr Onkel laut protestierte, doch schon hatte der Wolf sein Pferd scharf herumgerissen und galoppierte auf das Burgtor zu.
Claray war so verblüfft über diese unerwartete Wendung, dass sie gar nicht daran dachte, sich zu wehren. Als sie einen Blick zurück auf den Burghof warf, sah sie, dass die beiden Begleiter des Wolfes ihnen dichtauf folgten. Dahinter erkannte sie das hochrote Gesicht ihres Onkels, der jetzt brüllte, dass die Tore geschlossen und die Zugbrücke hochgezogen werden sollten. Ein rascher Blick nach vorn verriet Claray, dass die Männer auf der Mauer sich beeilten, seine Befehle auszuführen, aber das Tor wurde einen kleinen Moment zu spät heruntergelassen. Der zugespitzte untere Teil knallte hinter dem letzten Pferd in den Boden, nicht vor ihnen, und die Zugbrücke begann sich zwar schon zu heben, aber nur sehr langsam. Sie war vielleicht zwei oder drei Fuß vom Boden entfernt, als die Gruppe über sie hinwegritt.
Das Pferd des Wolfs sprang ohne zu zögern über den allmählich größer werdenden Spalt. Claray schloss instinktiv den Mund, um sich beim Aufprall nicht auf die Zunge zu beißen. Was sich als gut erwies, denn sie kamen tatsächlich so hart auf dem Boden aus festgetretener Erde auf, dass sie bis auf die Knochen durchgeschüttelt wurde. Claray biss die Zähne zusammen, um gegen den Schmerz anzukämpfen, der durch sie hindurchjagte, dann warf sie wieder einen Blick zurück und sah, dass die anderen beiden Männer ebenfalls die Brücke hinter sich gelassen hatten. Sie war mehr als nur ein wenig überrascht, als der blonde Krieger ihr erst aufmunternd zulächelte und ihr dann kurz zuzwinkerte, als sich ihre Blicke kreuzten.
Errötend wandte Claray den Blick ab und schaute wieder nach vorn. Sie versuchte zu begreifen, was geschehen war und welche Gefühle das bei ihr auslöste. Allerdings musste sie sich eingestehen, nicht allzu fähig zu sein, klar zu denken. In den vergangenen drei Tagen hatte sie – abgesehen von dem, was Mairin ihr heute Morgen hatte heimlich zustecken können – kaum etwas gegessen und überhaupt nicht geschlafen. Stattdessen war sie in ihrer Kammer entweder hin- und hergegangen und hatte über eine Lösung für ihre missliche Lage gegrübelt, oder sie hatte auf den Knien zu Gott gebetet, er möge einschreiten. Sie war erschöpft und verwirrt, und tatsächlich schien ihr Geist in diesem Moment zu keiner anderen Schlussfolgerung gelangen zu können als der, dass dies hier eine Antwort auf ihre Gebete war. Sie würde Maldouen MacNaughton an diesem Tag nicht heiraten.
Erleichterung erfüllte sie, und sie holte tief Atem und erlaubte sich dann, sich in den Armen ihres Entführers zu entspannen.
»Sie schläft.«
Conall wandte den Blick von dem Mädchen ab, das sich an seine Brust schmiegte, und richtete ihn auf auf Roderick Sinclair, der zu seiner Rechten ritt. Roderick wirkte sowohl überrascht als auch amüsiert darüber, wie die Frau auf die Situation reagierte, in der sie sich befand. Conall schaute wieder auf das Mädchen und nickte. Er musste zugeben, dass auch er überrascht war.
Lady Claray MacFarlane war eingeschlafen, kaum dass sie die Zugbrücke von Burg Kerr hundert Fuß hinter sich gelassen hatten. Es erstaunte Conall, schließlich hatte er sie entführt, und sie hatte keine Ahnung, wer er war. Trotzdem hatte sie sich weder gewehrt noch Einwände erhoben. Stattdessen hatte sie sich wie ein Kätzchen in seinem Schoß zusammengerollt und war eingeschlafen. Er wusste nicht, was er davon halten sollte, und hatte während des langen Ritts – nachdem sie zunächst auf seine anderen Männer gestoßen und dann den ganzen Tag nach Norden geritten waren – darüber nachgedacht. Sie hatten ein rasches Tempo vorgelegt, und erst jetzt ritten sie langsamer, weil die Sonne unterzugehen begann.
Conall wusste, dass die Pferde dieses Tempo nicht ewig durchhalten konnten, und er wollte auch nicht riskieren, dass sich eines von ihnen oder einer der Männer bei einem zu schnellen Ritt in der Dunkelheit verletzte. Sie mussten in der Nacht langsamer reiten und wachsamer sein. Aber sie würden keine Rast einlegen. Er zweifelte nicht daran, dass Kerr seine Männer hinter ihnen herschicken würde, trotz der Nachricht, die Conall ihm überbracht hatte. Und selbst wenn Clarays Onkel darauf verzichtete, würde MacNaughton es ganz sicherlich tun. Nach allem, was er wusste, war der Mann wild entschlossen, das Mädchen zu heiraten, ob ihr Vater damit einverstanden war oder nicht.
Conall konnte sich nicht so recht erklären, warum MacNaugthon dieses Vorhaben so hartnäckig verfolgte. Claray war sicherlich ganz hübsch, wie er zugeben musste, als sein Blick über ihr rotblondes Haar glitt, das ihr herzförmiges Gesicht in weichen Wellen umrahmte. Aber so schön, dass es sich lohnte, ihretwegen mit dem Nachbarn einen Krieg anzufangen, war sie nun auch wieder nicht.
»Dann hast du ihr während des Ritts bereits gesagt, wer du bist?«, fragte Payton. Seine Überraschung war nicht zu überhören, und Conall wusste, warum ihn das erstaunte: Bei dem Tempo, in dem sie geritten waren, wäre es schwer gewesen, miteinander zu reden. Sie hätten sich anschreien müssen, um das Hufgetrappel so vieler Pferde und das Rauschen des Windes zu übertönen.
Conall zögerte, aber dann gestand er: »Ich habe ihr noch gar nichts gesagt.«
Seinen Worten folgte Schweigen, und die beiden Männer schauten verblüfft auf Claray, die friedlich in seinem Schoß schlief.
»Aber …«, begann Payton, ehe er innehielt und einfach nur den Kopf schüttelte. Offenbar fehlten ihm die Worte, um seine Verwunderung auszudrücken.
»Sie schläft schon seit einer ganzen Weile«, sagte Roderick plötzlich. Ein Hauch Sorge schwang in seiner Stimme mit. »Ist sie krank?«
Conall spannte sich bei diesen Worten an und betrachtete sie näher. Sie wirkte blass und hatte dunkle Ringe unter den Augen, die von Erschöpfung zeugten. Er nahm die Zügel in die Hand, mit der er Claray umschlungen hielt, damit sie nicht vom Pferd rutschte. Dann betastete er mit der anderen beunruhigt ihre Stirn. Zu seiner großen Erleichterung fühlte sie sich nicht übermäßig erhitzt an. Doch offensichtlich weckte diese Berührung das Mädchen, denn es öffnete langsam die Lider und die von langen, geschwungenen Wimpern umrahmten Augen, die so blau waren wie der Himmel an einem Frühlingsmorgen. Claray blinzelte ihn an, dann richtete sie sich abrupt auf und sah sich um.
»Halten wir an?« Ihre Stimme klang weich und noch heiser vom Schlaf, während sie ihre Umgebung musterte.
Conall öffnete den Mund; er wollte »Nein« sagen, doch stattdessen fragte er »Ist es nötig?«, als er begriff, dass sie sich vielleicht nach so langer Zeit im Sattel erleichtern wollte. Genau genommen konnte er selbst aus dem gleichen Grund eine Pause gut vertragen.
Claray schenkte ihm ein schüchternes Lächeln und nickte sichtlich verlegen. »Tatsächlich ist das so, Laird Wolf.«
Conall stutzte, als sie den Namen aussprach, unter dem er die letzten zwölf Jahre gekämpft hatte. Er verbarg seine Überraschung, indem er sich umwandte und den Blick über die Landschaft schweifen ließ. Er war hier schon oft entlanggeritten. Er kannte diesen Weg und wusste genau, wo er war und was vor ihm lag. »Nicht weit von hier ist ein Fluss, falls Ihr noch ein paar Momente warten könnt. Aber wenn es dringend ist, können wir auch hier anhalten.«
Claray betrachtete die Bäume beiderseits des Pfads, auf dem sie ritten, dann warf sie einen Blick über die Schulter und versteifte sich. Ihre Augen wurden groß.
Conall sah sich daraufhin ebenfalls um, konnte sich aber nicht erklären, was sie so verblüffte. Hinter ihnen waren nur seine Männer, aber vielleicht waren gerade sie es, die sie so erstaunten. Als sie Kerr verlassen hatten, waren sie nur zu viert gewesen. Claray hatte geschlafen, als sie auf seine anderen Krieger gestoßen waren, die im Wald vor Kerr gewartet hatten. Conall hatte seine Begleiter dort zurückgelassen und sich mit Payton und Roderick allein zur Burg aufgemacht, um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Und wie sich gezeigt hatte, waren die vielen Männer gar nicht nötig gewesen, und daher war es gut, dass er sie nicht mitgenommen hatte. Sicherlich hätte man ihn anders empfangen, wäre er mit einer ganzen Armee in die Burg geritten.
Er sah Claray an und hob fragend die Brauen. »Hier oder am Fluss?«
»Ich kann warten, bis wir den Fluss erreichen«, versicherte sie ihm rasch und brachte ein Lächeln zustande. »Ich würde mir gern das Gesicht waschen, um wach zu werden, bevor ich mich um andere Angelegenheiten kümmere.«
Conall nickte und hielt sie fester, während er sein Pferd zum Galopp antrieb und seine Begleiter hinter sich ließ. Wenig später zügelte er das Tier bei einem Fluss, der im Grunde kaum mehr als ein murmelnder Bach war. Claray schien allerdings damit zufrieden zu sein. Sie schenkte ihm ein kurzes Lächeln, bevor sie sich unter seinem Arm wegduckte und vom Pferd gleiten ließ.
Sie war so flink, dass Conall gar nicht die Möglichkeit hatte, ihr beim Absteigen zu helfen; stattdessen saß er auch ab und eilte in den Wald auf der anderen Seite der Lichtung, um seine Notdurft zu verrichten.
Als er wenige Augenblicke später zurückkehrte, hatten seine Begleiter zu ihm aufgeholt. Roderick, Payton und Conalls Erster Offizier, Hamish, warteten auf der kleinen Lichtung bei seinem Pferd, während die übrigen Männer sich auf dem Pfad daneben verteilten. Einige stiegen ab und verschwanden im Wald, um sich zu erleichtern, andere kümmerten sich um die Pferde.
»Wo ist Lady Claray?«, fragte Payton, als Conall zu seinem Pferd trat.
Conall wies mit einem Kopfnicken zu den Bäumen, zwischen denen sie verschwunden war.
Payton hob leicht die Brauen. »Du hast sie allein in den Wald gehen lassen?«
Conall, der bereits wieder im Sattel saß, sah ihn überrascht an. »Natürlich. Sie möchte sicher keine Eskorte haben, während sie sich ihren persönlichen Angelegenheiten widmet. Abgesehen davon ist es nicht so, als könnte sie hier verloren gehen.«
»Aye, aber …« Payton verzog das Gesicht und fragte dann: »Und wenn sie versucht, wegzulaufen?«
Dieser Einwand erstaunte Conall. »Warum sollte sie versuchen, wegzulaufen? Wir sind gekommen, um sie zu retten.«
Jetzt mischte sich Roderick ein. »Das mag so sein. Aber du hast gesagt, dass du noch nicht die Möglichkeit hattest, ihr etwas zu erklären, also weiß sie das noch nicht. Sie könnte aus Angst vor dem weglaufen, was du mit ihr vorhaben könntest.«
Conall runzelte die Stirn, als Roderick mit seiner tiefen, grollenden Stimme diese Worte sprach. Er redete gewöhnlich nicht viel. Weshalb Conall und alle anderen, die ihn kannten, zuhörten, wenn er es dann doch einmal tat.
»Sie schien mir nicht besonders viel Angst zu haben«, murmelte Conall, suchte aber mit den Blicken den Wald ab, in dem Claray verschwunden war. Er machte sich jetzt doch Sorgen, weil sie noch nicht zurückgekehrt war, und überlegte, ob sie vielleicht doch die Flucht ergriffen hatte, kaum dass sie außer Sicht gewesen war. Vielleicht kämpfte sie sich gerade jetzt durch den Wald.
»Besonders verängstigt wirkte sie in der Tat nicht«, bestätigte Payton, aber diese Tatsache schien ihn eher zu beunruhigen. »Kommt dir das nicht seltsam vor? Ich meine, du hast sie von ihrem Onkel weggerissen und bist mit ihr auf und davon, kurz bevor sie heiraten sollte.«
»Sie sollte Maldouen MacNaughton heiraten«, erinnerte Conall ihn grimmig. Die Vorstellung widerte ihn immer noch an. »Der Mann ist ein Lügner und ein hinterhältiger, mörderischer Bastard.«
»Aber weiß sie das?«, fragte Roderick.
»Wahrscheinlich nicht«, räumte Payton an seiner Stelle ein. »Sie weiß wahrscheinlich nur, dass er gut aussieht, wohlhabend ist und sie heiraten will. Und zweifellos hat er sich die Mühe gemacht, sie auf charmante Weise zu umwerben.« Der Krieger schüttelte den Kopf. »Du dagegen hast sie entführt, ohne irgendeine Erklärung dafür zu geben. Selbst wenn sie nicht von seinem guten Aussehen und den süßen Lügen beeindruckt wäre, müsste sie doch erschrocken darüber sein, dass sie entführt wurde?«
»Ich habe sie nicht entführt«, knurrte Conall. »Ihr Vater hat mich geschickt, um sie zu retten.«
»Aber das weiß sie doch nicht«, erinnerte Roderick ihn.
Conall verspürte einen unangenehmen Druck in seiner Brust. Er schaute zum Waldrand, dachte über die Angelegenheit nach, dann fluchte er und stieg ab. Er hatte nicht den Wunsch, die Frau in Verlegenheit zu bringen, indem er in ihre Privatsphäre eindrang, wenn sie sich erleichterte, aber jetzt sorgte er sich doch, sie könnte weggelaufen sein. Er hätte ihr zwar nicht gesagt, dass er ihr Verlobter war – das musste ein Geheimnis bleiben –, aber er hätte ihr erklären können, dass ihr Vater ihn geschickt hatte, um sie nach Hause zu holen. Das hätte sie gewiss beruhigt, und er schalt sich dafür, dass er es nicht getan hatte. Er hätte es ihr sagen müssen, bevor er sie allein in den Wald hatte gehen lassen.
Was bin ich doch für ein Idiot, dachte er und ging in den Wald.
2
Conall hatte gehofft, Claray entweder auf ihrem Rückweg zur Lichtung zu begegnen oder dass sie, wenn er auf sie traf, vielleicht fünf bis zehn Fuß tief im Wald hinter einem großen Baum hockte und ihre Notdurft verrichtete. Aber nach fünf bis zehn Fuß den Wald hinein war sie nicht zu sehen … und auch nicht zwanzig. Conall war kurz davor, seine Männer um Hilfe zu rufen, als er zwischen dem Braun und Grün der Bäume ein Stück voraus etwas Hellblaues aufblitzen sah.
Er erkannte die Farbe ihres Kleides und atmete erleichtert auf, während er langsam weiterging. Er wollte sich so weit nähern, bis er sicher sein konnte, dass sie es war. Dann würde er sich umdrehen und ihr die Privatsphäre gewähren, die ihr zustand.
Einige Schritte später war Conall sicher, dass sie es war, aber er war auch ein wenig irritiert darüber, was sie tat. Sie hockte nicht, vielmehr sah es so aus, als kniete sie leicht vornübergebeugt auf dem Boden – ganz so, als hätte sie Bauchschmerzen. Er vergaß seinen Wunsch, ihre Privatsphäre nicht zu stören, und ging auf sie zu. Er erreichte den Waldrand und fand sich auf einem breiten Grasstreifen wieder, der den Bach säumte. Als Conall den Kopf nach rechts wandte, konnte er etwa zwanzig Fuß entfernt die Lichtung sehen. Sie waren nicht wirklich weit weg von den anderen, erkannte er.
»So, so, nun. Es ist vorbei.«
Conall schaute in Clarays Richtung, als er sie diese Worte murmeln hörte. Den Rücken ihm zugewandt, kniete sie am Ufer. Es schien niemand bei ihr zu sein, mit dem sie hätte reden können … Sprach sie sich selbst Trost zu? Vielleicht war sie krank gewesen und redete sich jetzt gut zu, sagte sich, dass es vorbei war?
»Was ist vorbei?«, fragte er schroff.
Claray zuckte zusammen und wandte den Kopf. Ihre Augen weiteten sich, als sie Conall dicht hinter sich stehen sah. »Oh, Himmel, Mylaird. Ihr habt mich erschreckt.«
Während Conall eine Entschuldigung murmelte, weil er sie geängstigt hatte, stand sie auf und drehte sich zu ihm herum. In ihren Händen hielt sie ein Kaninchen. Sein Fell war nass, und es bewegte sich nicht. An seiner Flanke waren drei lange Wunden zu sehen.
Conall musterte das Tier rasch; er fragte sich, wie sie es getötet hatte. Sie hatte weder Bogen noch Pfeile, daher vermutete er, dass sie ihr Sgian Dubh benutzt hatte, um das Leben des kleinen Tieres zu beenden. Es war beeindruckend, und er war nicht überrascht, dass sie nach dem langen Ritt hungrig war, aber –
»Claray, ich bin mir sicher, dass MacNaughton seine Männer ausgeschickt hat, um uns zu jagen«, sagte er ernst. »Wir haben nicht die Zeit, ein Kaninchen zu häuten und zu braten.«
Clarays Augen weiteten sich bei diesen Worten entsetzt, und sie drückte das Kaninchen beschützend an ihre Brust. »Niemand wird dieses Kaninchen häuten!«
Conall musterte sie unsicher. »Warum habt Ihr es dann getötet? Es ist falsch, ein Tier zu töten, wenn man nicht vorhat, es zu essen.«
»Ich habe es nicht getötet!«, rief sie und schaute das Tier besorgt an. »Ich habe nur das Blut abgewaschen … und es ist nicht tot, nur verwundet. Ich denke, ein Habicht oder ein Falke hat versucht, es wegzutragen, und dann irgendwie fallen gelassen. Es hat Wunden an der einen Seite, die von Krallen stammen könnten.«
Conall betrachtete wieder das Kaninchen und verzog leicht das Gesicht, als er eines der langen Ohren zucken sah. Es lebte, und er hatte das ungute Gefühl, dass sie vorhatte –
»Ich werde es mitnehmen. Es ist zu schwer verletzt, um hier draußen überleben zu können, und wird nur eine leichte Beute für den ersten Habicht sein, der es erspäht.«
Conall musste die Lippen zusammenpressen, um nicht instinktiv zu protestieren. Sie waren auf der Flucht. Er musste sie in die Sicherheit von MacFarlane und ihrem Vater schaffen, bevor MacNaughtons Männer – und vielleicht sogar die ihres Onkels – sie einholten und versuchten, Claray trotz des Schreibens, das er Gilchrist Kerr überbracht hatte, in ihre Gewalt zu bringen. Die Nachricht war von ihrem Vater gewesen, der darin behauptete, dass zu Hause etwas Unerwartetes geschehen war und er sie dringend benötigte, weshalb der Wolf und seine Kameraden sie sofort mitnehmen müssten.
Die Sache mit der Nachricht war MacFarlanes Idee gewesen. Aus irgendeinem Grund hatte er gehofft, dass er seine Tochter damit retten würde. Conall hatte es für einen törichten Versuch gehalten. Schließlich hatten Kerr und MacNaughton geplant, die junge Frau ohne ihre eigene Zustimmung oder der ihres Vaters zur Heirat zu zwingen. Wieso sollte es die beiden dann bekümmern, dass er seine Tochter zu Hause haben wollte? Wie auch immer, die Nachricht hatte sich als geeignet genug erwiesen, um Kerr lange genug abzulenken, sodass er das Mädchen hatte packen und mit ihm davonreiten können.
Tatsächlich hatten sie Glück bei alldem gehabt. Er hatte sich Sorgen gemacht, dass sie zu spät gekommen waren, als er in den Burghof geritten war und die vor der Kapelle versammelten Menschen gesehen hatte. Aber dann hatte er bemerkt, dass Kerr eine junge Frau vom Wohnturm zur Kirche zerrte, und ihm war klar geworden, dass er zu gar keinem besseren Zeitpunkt hätte eintreffen können.
Jetzt konnte er kaum glauben, wie leicht es gewesen war, und er machte sich eher Sorgen, dass sein Glück nicht anhalten würde. Dabei beunruhigte ihn weniger die Vorstellung, er könnte es mit den Männern von MacNaughton und Kerr nicht aufnehmen. Seine Krieger zählten zu den besten Schwertkämpfern in ganz Schottland und sogar England. Ihm gefiel aber die Möglichkeit nicht, dass ein Kampf ausbrechen könnte, während Claray zugegen war. Sie konnte nur zu leicht von einem verirrten Pfeil oder einem Schwerthieb verletzt oder gar getötet werden. Er würde sie lieber ohne eine kriegerische Auseinandersetzung sicher nach Hause bringen.
»Wir sollten gehen, Laird Wolf«, sagte Claray plötzlich. »Wie Ihr schon sagtet, MacNaughton und mein Onkel haben vielleicht Männer hinter uns hergeschickt. Wir dürfen keine Zeit verlieren.«
Conall schob seine Gedanken beiseite und stellte verwundert fest, dass Claray sich bereits auf den Weg gemacht hatte, ohne darauf zu warten, ob er mitkam. Das Kaninchen hielt sie immer noch an ihre Brust gedrückt.
Er murmelte leise etwas vor sich hin und folgte ihr rasch, holte sie kurz vor dem Waldrand ein. Er musterte sie einen Moment von der Seite, während sie das Kaninchen streichelte. Er räusperte sich und sagte: »Claray, ich weiß, dass Ihr keine Ahnung habt, wer ich bin, oder warum ich Euch mitgenommen habe, aber –«
»Natürlich weiß ich das.«
Er musterte sie scharf. »Ihr wisst es?«
»Aye.« Sie machte sich nicht die Mühe, von dem Kaninchen aufzusehen. »Ihr seid der Wolf, ein mutiger und ehrenhafter Krieger, der nur dann in die Schlacht zieht, wenn er an die Sache glaubt.«
Conall verzog bei dieser Beschreibung das Gesicht; er kannte die dummen Lieder, die die Troubadoure über ihn sangen.
»Und Gott hat Euch geschickt, um mich zu retten«, fügte sie hinzu.
Conall wäre beinahe über seine eigenen Füße gestolpert, als sie das sagte. »Gott?«, brachte er mühsam heraus.
»Aye. Ich habe drei Tage und Nächte zu Ihm gebetet, dass er mich vor MacNaughton rettet. Er hat Euch geschickt«, erklärte sie und fragte dann: »Habt Ihr irgendeinen Stoffstreifen, den Ihr entbehren könnt, Mylaird?«
»Einen Stoffstreifen?«, wiederholte er verwirrt, als sie so abrupt das Thema wechselte. »Nein. Wofür?«
»Ich denke, es wäre wirklich besser, wenn wir Brodies Wunden verbinden könnten«, erklärte sie.
»Wer ist Brodie?«, fragte er, jetzt noch verwirrter als zuvor.
»Das Kaninchen«, erklärte sie.
»Ihr habt ihm einen Namen gegeben?«, krächzte er ungläubig.
»Nun ja, ich kann es unmöglich weiter nur Kaninchen nennen«, antwortete sie und murmelte dann: »Vielleicht hat einer Eurer Männer etwas, womit ich ihn verbinden kann.« Und mit diesen Worten eilte sie ihm voraus zur Lichtung.
Conall folgte ihr langsam; er sah zu, wie sie zu Roderick, Payton und Hamish ging. Die Reaktion seiner Männer überraschte ihn nicht sehr, als sie sahen, dass sie ein verletztes Kaninchen bei sich hatte. Alle drei waren zunächst sprachlos, dann amüsiert. Schließlich griff Hamish in eine seiner Satteltaschen und holte einen Stoffstreifen hervor, der für ihre Zwecke groß genug war. Er stieg sogar vom Pferd ab und half ihr, das Kaninchen zu verbinden.
Conall schüttelte nur den Kopf. Hamish war stets auf alles vorbereitet. Deshalb war er auch sein Erster. Was auch immer passierte, er hatte gewöhnlich alles dabei, was in irgendeiner Situation gebraucht wurde: Stoffstreifen für Verbände, Kräuter für Heilmittel und Tinkturen, zusätzliche Lederstreifen, um beschädigte Stiefel zu flicken, einen kleinen Wetzstein, um das Sgian Dubh zu schärfen, einen Sack Hafer, um an einem Feuer auf einem heißen Stein Haferkekse zu backen … Hamish schien an alles zu denken. Außerdem arbeitete er schnell, und die beiden waren mit dem Verbinden bereits fertig, als Conall sein Pferd erreichte und in den Sattel stieg.
Als er aufstieg, hörte er Claray Hamish nach seinem Namen fragen, dann dankte sie ihm für seine Hilfe. Die schroffe, leicht verlegene Antwort seines Ersten ließ Conall schmunzeln. Niemand von ihnen war an die Anwesenheit von Ladys gewöhnt, und sein Erster fühlte sich in ihrer Gegenwart offensichtlich unbehaglich. Aber vielleicht war es ihm auch nur peinlich, dass er dabei half, ein Kaninchen zu versorgen, dachte Conall, während er sich bemühte, den forschenden Blicken von Roderick und Payton auszuweichen. Sie wollten wissen, ob er ihr erklärt hatte, wer sie waren. Aber das hatte er nicht, und jetzt war er leicht verärgert darüber, dass sie ihm nicht die Gelegenheit gegeben hatte, es zu tun.
»Mylaird?«
Noch in Gedanken versunken sah Conall auf Claray, die neben seinem Pferd stand und unschlüssig zu ihm hochschaute.
»Werde ich wieder mit Euch reiten? Oder habt Ihr eine Stute für mich mitgebracht, damit ich – oh!« Sie schnappte überrascht nach Luft, als er sich herunterbeugte, sie mit einem Arm um die Taille packte, hochhob und mitsamt ihrem Kaninchen vor sich auf das Pferd setzte.
Kaum dass sie vor ihm saß, lenkte er sein Reittier auf den Pfad zurück und fragte: »Dann könnt Ihr also reiten?«
»Natürlich. Pferde mögen mich«, versicherte sie ihm.
Conall versuchte, einen Blick auf ihre Miene zu werfen, um zu entscheiden, ob sie ihn aufzog oder nicht. Die Antwort kam ihm unsinnig vor. Aber er konnte nur ihren Scheitel sehen, nicht ihr Gesicht. Mit einem Schulterzucken ließ er die Sache auf sich beruhen und konzentrierte sich auf den Weg und den Ritt, der noch vor ihnen lag.
Die Sonne spähte jetzt kaum noch über den Horizont; das Tageslicht schwand. Wenn sie nachts langsam im Schritt und tagsüber in einem leichten Trab ritten, würden sie MacFarlane in zwei bis drei Tagen erreichen. Dort angekommen konnte er Claray ihrem Vater übergeben und diesen alles erklären lassen. Er würde MacFarlane auch empfehlen, seine Tochter erst einmal bei sich zu Hause zu behalten, bis er bereit war, seinen Anspruch auf sie geltend zu machen. Conall hatte nicht das Bedürfnis, sie ständig vor Leuten wie MacNaughton retten zu müssen, und ihr Vater war für ihre Sicherheit verantwortlich, bis sie verheiratet waren.
Conall wurde von diesen Gedanken abgelenkt, als er bemerkte, wie Claray sich im Sattel wand. Sie verhielt sich so unruhig, als hätte sie ein Eichhörnchen unter ihren Röcken. Außerdem bemerkte er, dass sie unaufhörlich seufzte.
»Claray«, sagte er besorgt.
»Brodie hat mich abgelenkt, und ich habe vergessen … äh … mich um das zu kümmern, wofür wir angehalten hatten«, platzte sie heraus, ehe er sie fragen konnte, ob etwas nicht in Ordnung war.
Aus irgendeinem Grund zuckten Conalls Lippen bei diesem Geständnis. Er hatte keine Ahnung, warum. Er sollte eigentlich verärgert sein, aber er war nur erheitert. Allerdings presste er die Lippen fest zusammen, um sein Lachen zu verbergen, als sie ihn besorgt anblickte.
»Ich verstehe, dass Ihr verärgert sein müsst, aber –«
»Ich bin nicht verärgert«, versicherte er ihr ernst und beendete damit, was immer sie hatte sagen wollen. Dann trieb er sein Pferd rasch um die nächste und die übernächste Biegung, sodass seine Männer ein Stück zurückblieben, bevor er es an den Waldrand lenkte. Conall hatte das Tier kaum zum Stehen gebracht, als er bereits abstieg. Sofort hob er Claray aus dem Sattel und machte einen Schritt zurück.
Sie drehte sich um und war bereits einige Schritte gegangen, als sie plötzlich stehen blieb. Sie wirbelte herum, eilte zu ihm zurück und drückte ihm das Kaninchen in die Hände. »Könntet Ihr? Ich kann es nicht festhalten und –« Claray beendete den Satz nicht. Conall hatte reflexhaft zugepackt, und als sie das sah, hörte sie auf zu sprechen und eilte in den Wald davon.
Seufzend starrte Conall auf das kleine Tier und drehte sich dann zu Roderick, Payton und Hamish um, die jetzt bei ihm ankamen, dicht gefolgt von den anderen Männern.
»Sie hat sich bei unserem letzten Halt von dem Kaninchen ablenken lassen und nicht um ihre Angelegenheiten gekümmert«, knurrte er, als sie ihn fragend ansahen.
Die drei Männer wechselten Blicke, und dann sagte Payton: »Nun, dann wollen wir hoffen, dass sie dieses Mal nicht durch ein anderes Kaninchen abgelenkt wird.«
»Aye«, pflichtete Hamish ihm bei und blickte bei dieser Vorstellung leidgeprüft drein.
Conall, den dieser Gedanke beunruhigte, schaute zu der Stelle, an der Claray im Wald verschwunden war.
»Hast du ihr gesagt, dass ihr Vater uns geschickt hat, um sie zu holen?«, fragte Payton, nachdem einige Zeit vergangen war.
»Nein«, fauchte Conall. Sein Blick glitt vom Wald zu dem Kaninchen in seinen Händen. Er kam sich dumm und unbeholfen vor, wie er mit dem verflixten Tier dastand. Es war noch nicht ganz ausgewachsen, zu klein, um wirklich als Mahlzeit dienen zu können, aber es fühlte sich weich und warm an und zitterte heftig. Kaninchen waren nicht dafür bekannt, sich einer Gefahr mutig entgegenzustellen, und dieses hier fühlte sich ganz offensichtlich sehr bedroht. Wahrscheinlich würde es tot sein, bevor sie MacFarlane erreichten. Conall hoffte, dass Claray nicht ihm die Schuld dafür geben würde.
»Du glaubst also nicht, dass sie weglaufen könnte?«, fragte Payton, nachdem noch mehr Zeit verstrichen war. Conall schaute ihn finster an. Payton zuckte mit den Schultern. »Es kommt mir so vor, als würde sie sich übermäßig viel Zeit lassen.«
»Vielleicht hat sie sich verirrt«, gab Hamish zu bedenken.
»Hier, halt das mal. Ich werde sie suchen«, sagte Conall frustriert. Er trat zu Hamish und drückte ihm das Kaninchen in die Hand, die sein Erster zögernd ausgestreckt hatte. Dann machte er auf dem Absatz kehrt und stapfte in den Wald, um seine verloren gegangene Verlobte zu suchen. Es dauerte eine Weile, bis er sie fand – oder besser ihr blaubekleidetes, in die Luft ragendes Gesäß. Claray kniete im Gras, den Kopf dicht am Boden, während sie mit einer Hand in der Höhlung eines Baumes nach irgendetwas tastete.
Als Conall das sah, blieb er abrupt stehen; dann schüttelte er den Kopf und ging zu ihr. »Was zum Teufel tut Ihr da? Ihr werdet noch Euer Kleid ruinieren. Steht auf.«
Claray blieb weiter auf den Knien, aber sie richtete sich sofort auf, ließ das Gesäß auf die Fersen sinken. Sie sah ihn über die Schulter an. Dann drehte sie sich wieder zum Baum um, hob mit ihren hohlen Händen etwas auf und zeigte es ihm. »Seht mal, was ich gefunden habe, Laird Wolf. Ist es nicht süß?«
Conall ließ sich neben ihr nieder und blinzelte auf die kleine hellsilbrige Fellkugel, die sie in den Händen hielt. Er wusste sofort, was es war, schloss die Augen und betete um Geduld.
»Es ist noch so klein, dass ich fast darauf getreten wäre«, sagte Claray jetzt. »Neben ihm waren ein rotbrauner Fleck und ein bisschen Blut. Ich vermute, dass seine arme Mutter ihn zu einem neuen Nest gebracht hat, als sie angegriffen und weggeschleppt wurde. Ich habe gerade versucht, ihr Nest zu finden, um herauszufinden, ob noch irgendwelche kleinen Brüder oder Schwestern zurückgeblieben sind. In dieser Höhlung scheint sich tatsächlich ein Nest aus Gras und Blättern zu befinden, aber es ist leer. Es muss ein altes Nest sein. Ich habe daran gedacht, nach dem neuen zu suchen, aber ich fürchte, dass ich es nicht finden werde. Es könnte überall sein, und wir haben wirklich nicht die Zeit für eine ordentliche Suche, daher denke ich, dass ich sie zurücklassen muss«, sagte sie traurig.
»Und das da auch«, knurrte Conall.
»Was?«, fragte sie überrascht und sah ihn stirnrunzelnd an.
»Es ist Ungeziefer, Mädchen«, sagte Conall kurz angebunden. »Lasst es einfach liegen, und dann verschwinden wir von hier.«
»Es ist ein junges Wiesel«, sagte Claray und sah ihn vorwurfsvoll an.
»Aye. Ungeziefer«, wiederholte er gereizt.
»Aber es ist noch ganz jung, Mylaird. Es hat erst ein einziges Auge geöffnet, und das bedeutet, dass es erst fünf Wochen alt ist. Es wird sterben, wenn es sich selbst überlassen bleibt«, wandte sie ein.
»Es ist Ungeziefer«, sagte Conall zum dritten Mal, und dieses Mal deutlich verärgert. »Abgesehen davon können junge Wiesel wie das da sich nicht selbst warmhalten. Es wird wahrscheinlich sowieso sterben.«
»Oh, aye«, murmelte sie und musterte es besorgt. Dann zog sie zu seiner großen Überraschung das Oberteil ihres Kleides ein bisschen von ihrer Brust weg und ließ das kleine Wesen zwischen ihre Brüste sinken. »Das müsste es warmhalten.«
Conall gaffte sie so benommen an, dass er nicht einmal auf die Idee kam, ihr zu helfen, als sie mit einiger Mühe aufstand.
»Wir sollten jetzt vermutlich gehen, Mylaird. Die Männer von MacNaughton werden uns auf den Fersen sein«, erinnerte sie ihn, während sie wegging.
Conall starrte ihr kurz nach, dann schüttelte er den Kopf und beeilte sich, ihr zu folgen.
»Wartet. Claray, Ihr könnt nicht …« Seine Worte erstarben ihm auf den Lippen, als sie stehen blieb, sich umdrehte und ihn anlächelte, den Kopf leicht geneigt. Er hatte darauf bestehen wollen, dass sie das Wiesel zurückließ, aber sie sah so verdammt süß aus … Mit einem resignierten Seufzer fragte er daher nur: »Habt Ihr Euch um Eure Angelegenheit gekümmert, bevor Ihr das kleine Tier gefunden habt, oder braucht Ihr noch einen Moment?«
»Oh.« Sie errötete, aber dann schüttelte sie den Kopf. »Nein. Es ist alles in Ordnung, Mylaird. Ich habe das Wiesel gefunden, nachdem ich …« Sie beendete den Satz nicht, machte vielmehr eine Geste in Richtung des Weges, den sie gekommen waren, aber er verstand auch so.
Conall konnte nur dankbar sein. Hätte sie sich nicht bereits erleichtert, wäre sie vermutlich über das Nest mit den anderen verwaisten Wieseln gestolpert und hätte darauf bestanden, sie ebenfalls mitzunehmen. MacFarlanes Tochter schien ein weiches Herz für kleine Kreaturen zu haben. Das war etwas, an dem er mit ihr würde arbeiten müssen, wenn er sie als seine Braut beanspruchte, vermutete er. Aber im Augenblick nickte Conall nur ernst, nahm sie am Arm und führte sie aus dem Wald zu seinem Pferd.
Er bemerkte die fragenden Blicke von Payton, Roderick und Hamish, aber er beachtete sie nicht, als er auf sein Pferd stieg und sich dann nach unten beugte, um Claray hochzuheben und vor sich in den Sattel zu setzen. Kaum hatte sie sich zurechtgerückt, lenkte Hamish sein Pferd neben ihn und reichte Claray ihr Kaninchen.
»Oh, danke.« Sie schenkte dem Mann ein strahlendes Lächeln, nahm das Kaninchen und drückte es sofort an ihre Brust.
Conall überlegte kurz, ob er darauf hinweisen sollte, dass sich das Wiesel in ihrem Kleid befand und sie vorsichtig sein sollte, um es nicht zu zerquetschen. Doch dann besann er sich und schüttelte den Kopf. Beide Tiere werden vermutlich tot sein, bevor wir MacFarlane erreichen, dachte er und trieb sein Pferd zum Weiterritt an.
3
Conall rechnete damit, dass Claray sich wieder an ihn lehnen und weiterschlafen würde, wie sie es während des ersten Teils ihrer Reise getan hatte. Sie setzte sich jedoch stattdessen etwas auf und drehte bei jedem Geräusch, das in dem Wald erklang, durch den sie ritten, den Kopf hierhin und dorthin. Er wusste nicht, warum sie das tat – es gab nicht viel zu sehen. Die Sonne war jetzt ganz untergegangen, und die Nacht hatte sich wie eine dunkle Decke auf das Land gelegt. Der Wald um sie herum war nichts als eine dunkle Masse, die sie durchquerten. Aber ihre Anspannung ließ auch Conall angespannter werden, und schließlich drückte er ihren Kopf in einer stummen Aufforderung, zu schlafen, an seine Brust.
Sie ließ ihn einen Herzschlag lang dort ruhen, dann richtete sie sich abrupt wieder auf.
Conall stand kurz davor, ihr deutlich zu sagen, dass sie schlafen sollte, als sie fragte: »Von wem kam die Nachricht, die Ihr meinem Onkel gegeben habt?«
Conall verzog finster das Gesicht, aber da sie es nicht sehen konnte, antwortete er am Ende nur: »Von Eurem Vater.«
»Oh.« Sie schien kurz darüber nachzudenken und fragte dann: »Was stand darin?«
»Dass Ihr zu Hause gebraucht werdet«, antwortete Payton, als Conall nichts sagte.
»Dann hat mein Vater Euch geschickt, um mich zu retten?«, fragte sie. Sie drehte sich jetzt zu Conalls blondem Freund um.
»Aye«, sagte Payton und fügte hinzu: »Es scheint Euch zu überraschen.«
»Das stimmt«, gab sie zu. »Ich dachte, Ihr wärt wegen der Nachricht hier, die Mairin an unseren Vetter Aulay Buchanan geschrieben hat. Dass ihr mich deshalb holen wolltet.«
»Wer ist Mairin?«, fragte Roderick.
»Lady Mairin Kerr, meine Kusine«, erklärte sie. »Ihretwegen bin ich nach Kerr gereist. Ihre Mutter – die Schwester meiner Mutter – ist vergangenen Monat gestorben. Seither ist Mairin die Herrin der Burg. Sie hat mir geschrieben, dass sie sich etwas überfordert fühlt und es schätzen würde, wenn ich ihr mit Rat und Tat zur Seite stehe, bis sie sich an ihre neue Rolle gewöhnt hat. Natürlich konnte ich ihr diesen Wunsch nicht abschlagen. Ich weiß, wie schwer es ist, sich an eine solche Rolle zu gewöhnen. Besonders, wenn man noch trauert.«
Conall runzelte leicht die Stirn, als er daran dachte, was sein Onkel ihm erzählt hatte. Vier Jahre zuvor war Clarays Mutter gestorben, Lady MacFarlane. Claray musste damals genauso gezwungen gewesen sein, ihre Pflichten als Lady MacFarlane zu übernehmen, wie ihre Kusine jetzt auf Kerr.
»Ihr habt also Euren Onkel Gilchrist und Eure Kusine Lady Mairin besucht. Und dann ist MacNaughton aufgetaucht, um Euren Onkel zu zwingen, in eine Heirat einzuwilligen?«, fragte Hamish. Die drei Männer ritten so dicht beieinander, wie es möglich war, damit alle das Gespräch mit anhören konnten.
»Nein. Mein Onkel hat mit MacNaughton gemeinsame Sache gemacht«, erzählte sie mit einigem Verdruss. »Es war ein raffinierter Plan. Mein Onkel hat seiner Tochter Mairin vorgeschlagen, mich einzuladen, damit ich ihr helfen könnte. Sie war ihm dankbar für diesen Vorschlag und hat mir sofort geschrieben. Dann hat sie genauer darüber nachgedacht. Ihr ist klar geworden, dass es gar nicht zu ihrem Vater passte, über ihre Probleme auch nur nachzudenken. Mein Onkel ist normalerweise ziemlich egoistisch.« Sie machte eine Pause, ehe sie weitersprach. »Sein Vorschlag kam Mairin einfach zu fürsorglich und rücksichtsvoll vor. Das war das Erste, was ihr Misstrauen erregt hat.«
»Und was war das Zweite?«, fragte Payton interessiert.
»Ihr ist aufgefallen, dass plötzlich eine ganze Menge Nachrichten eintrafen und verschickt wurden. Nachrichten, um die ihr Vater ein großes Geheimnis machte. Das alles weckte ihren Argwohn so sehr, dass sie beschloss, sich diese Schreiben anzusehen. Während einer der Abwesenheiten ihres Vaters von der Burg hat sie in seinem Zimmer nach ihnen gesucht.«
Sie machte eine Pause und tätschelte das Kaninchen, dann wandte sie den Blick zu Payton und Hamish, die Seite an Seite zu Conalls Rechter ritten. »Das war sehr mutig von ihr«, erklärte sie. »Die Fäuste meines Onkels sitzen locker, wenn er verärgert ist, und hätte er herausgefunden, dass sie seine privaten Papiere durchsucht hat, wäre er sehr zornig geworden …«
»Verstehe«, murmelte Payton, und Conall glaubte, in seiner Stimme Anteilnahme für die Kusine hören zu können, die das Risiko eingegangen war, ihren Vater zu erzürnen.
Claray war offensichtlich zufrieden, dass Payton die Bedeutung dessen begriff, was ihre Kusine getan hatte, und dass es keine Kleinigkeit gewesen war. Sie wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Kaninchen zu. »Glücklicherweise hat Mairin die Nachrichten, die er erhalten hatte, schnell gefunden«, erzählte sie weiter. »Es gelang ihr, sie alle zu lesen, wieder an ihren Platz zu legen und das Zimmer ihres Vaters zu verlassen, ohne entdeckt zu werden.«
»Waren die Nachrichten von MacNaughton?«, fragte Payton, obwohl das eigentlich nicht mehr infrage stand. Sie alle wussten, dass es so sein musste.
»Aye.« Sie atmete tief aus, während sie dieses Wort sprach, und Conall sah, wie sie den Kopf schüttelte. »Der Mann ist bösartig«, erklärte sie ihnen ernst. »Er hat vom Tod meiner Tante erfahren und daraufhin meinem Onkel vorgeschlagen, dass Mairin mich einladen sollte, um ihr in dieser schweren Zeit zu helfen. Er wusste, dass ich mich nicht weigern würde.«
»Woher wusste er das?«, fragte Payton stirnrunzelnd. »Kennt Ihr den Mann?«
Claray nickte verdrießlich. »Er ist unser Nachbar, und wir haben ihn für einen Freund gehalten. Er kennt die ganze Familie.«
»Oh«, sagte Payton.
»Wie auch immer«, sprach Claray weiter. »Mein Onkel sollte ihn benachrichtigen, sobald ich auf Kerr eintreffen würde. Daraufhin wollte er mit seinem Priester kommen und mich mithilfe meines Onkels zur Heirat mit ihm zwingen. MacNaughton wollte dann dafür sorgen, dass meine ganze Familie getötet werden würde, sodass mein Onkel MacFarlane erben und so seine Reichtümer verdoppeln könnte.«
»Was?«
Conall spürte, wie Claray zusammenzuckte, als alle vier gleichzeitig entsetzt reagierten. Sie fasste sich allerdings rasch und nickte zur Bestätigung dessen, was sie gesagt hatte.
»Er wollte Eure ganze Familie töten?«, fragte Payton bestürzt. »Und Euer Onkel war damit einverstanden?«
»Natürlich war er das. Er ist ein gieriger Narr«, sagte sie verärgert. »Und dumm genug zu glauben, dass MacNaughton ihm MacFarlane wirklich überlassen würde.«
»Ihr glaubt nicht, dass er das tun würde?«, fragte Conall ruhig. Er selbst war sich ziemlich sicher, dass MacNaughton es nicht getan hätte, auch wenn ihre Pläne nicht in dem Moment durchkreuzt worden wären, als er Claray noch vor der Hochzeit entführt hatte. Es interessierte ihn jedoch zu hören, was sie darüber dachte.
»Oh, denkt logisch«, sagte sie und klang entnervt. »Ich bin sicherlich nicht die große Schönheit, für die ein Mann töten würde.«
Conall runzelte die Stirn; was sie gesagt hatte, gefiel ihm nicht, auch wenn er nicht genau wusste, warum. Dabei war es genau das, was er auch spontan gedacht hatte, als er ihr begegnet war. Bevor er darüber nachdenken konnte, wieso ihre Auffassung ihn so aufregte, sprach sie weiter.
»Abgesehen davon … wenn es ihm nur darum gehen würde, mich zur Gemahlin zu bekommen, müsste er meine Familie nicht mehr ermorden, wenn er die Heirat bereits erzwungen hat«, erklärte sie. »MacNaughton will MacFarlane für sich selbst haben. Wäre meine Familie tot, würde ich erben, nicht mein Onkel. Er ist kein MacFarlane und mit uns nur verwandt, weil er meine Tante geheiratet hat. Die ist eine Buchanan, genauso wie meine Mutter, ihre Schwester.«
»Aber als Euer Gemahl hätte MacNaughton Eurem Onkel das Erbe überschreiben können, um ihn zum Schweigen über all das zu bringen«, sagte Payton.
»Darüber, dass er mich zur Heirat mit ihm gezwungen und meine Familie getötet hat, obwohl das gar nicht mehr nötig war, wenn er mich durch die erzwungene Heirat bereits zur Gemahlin bekommen hat?«, entgegnete sie trocken. »Eine erzwungene Heirat, die mein Onkel mit auf den Weg gebracht hatte, was bedeutet, dass er sich kaum beim König darüber beklagen könnte?«
»Oh«, sagte Payton, der jetzt begriff.
»Aye, oh«, sagte Claray unglücklich und schüttelte den Kopf. »MacNaughton will mich nicht wirklich. Er will nur MacFarlane, und hätte ich mich aus dem Fenster des Zimmers gestürzt, in das sie mich drei Tage lang gesperrt hatten, oder mich einfach geweigert, ihn zu heiraten, hätte er eine meiner Schwestern dazu gezwungen. Und die anderen hätte er trotzdem getötet, um MacFarlane zu bekommen.«
Conall runzelte bei ihren Worten die Stirn. Hatte sie wirklich daran gedacht, sich zu töten, um der Heirat mit MacNaughton zu entgehen? Er dachte noch darüber nach, als Hamish fragte: »Wieso will er MacFarlane so unbedingt haben?«
»MacNaughtons Land grenzt an einer Seite an Loch Awe, an der anderen an MacFarlane und oben und unten an das Land der Campbells«, erklärte Claray. »Es ist sicherlich unangenehm, so von den Campbells eingekeilt zu sein. Vermutlich befürchtet MacNaughton, die Campbells könnten eines Tages auf die Idee kommen, ihm sein Land zu rauben, um einen richtig großen Landstrich zu besitzen. Zweifellos hofft er, dass so etwas niemals passieren würde, wenn ihm das Land der MacFarlanes gehört – und ihre Soldaten und ihr Reichtum.«
Conall unterdrückte bei diesen Worten ein Lächeln. Sie hatte laut ausgesprochen, was er selbst dachte, und er war seltsam stolz darauf, dass sie die Strategie durchschaute, die hinter MacNaughtons Plan steckte. Tatsächlich war sie ziemlich gut.
»Also denkt Ihr, er hatte vor, Euch zu heiraten, Euren Vater und Eure Geschwister zu töten – und dann was? Einfach zuzulassen, dass Euer Onkel vor Wut schäumt, weil er MacFarlane nicht bekommen hat?«, fragte Payton und meinte dann: »Sicher wird er MacFarlane an Euren Onkel geben müssen, um ihn davon abzuhalten, dass er überall herumerzählt, dass es MacNaughton war, der Eure Familie getötet hat.«
»Nicht, wenn er auch ihn tötet«, sagte sie. »Zum Plan gehörte, dass mein Onkel mich nach dem Vollzug der Ehe zu meinem Vater zurückbringt und ihm sagt, dass ich mit MacNaughton verheiratet bin. Offensichtlich sollte mein Onkel dann behaupten, dass MacNaughton sich um meinetwillen das Zustandekommen einer Vereinbarung wünscht. Wenn sich dann die Wut meines Vaters etwas gelegt und er sich einverstanden erklärt hätte, MacNaughton zu sehen, wäre dieser hereingekommen und hätte ihn und meine Schwestern getötet.« Sie zuckte mit den Schultern. »Aber ich vermute, dass er auch meinen Onkel getötet hätte. Oder vielleicht hätte er zugelassen, dass mein Onkel eine kleine Weile MacFarlane hat. Aber er hätte mich und meinen Onkel dann später getötet und Mairin gezwungen, ihn zu heiraten. Auf diese Weise hätte er sowohl MacFarlane als auch Kerr in seinen Besitz gebracht, was ihn nur noch stärker gemacht hätte.«
Ein Moment herrschte Schweigen, als alle darüber nachdachten. Dann fragte Roderick: »Hat Eure Kusine gesagt, ob in den Nachrichten auch stand, auf welche Weise MacNaughton alle töten wollte?«
»Mit Gift.«
Das Wort war kaum mehr als ein Flüstern, aber es schnitt wie ein Messer durch Conall hindurch, scharf und atemberaubend schmerzhaft.
»MacNaughton hielt es für passend, weil auf diese Weise vor etwa zweiundzwanzig Jahren mein Verlobter ermordet wurde«, sagte Claray ruhig. »So würden mir alle in meinem Leben auf die gleiche Weise genommen werden.«
»Euer Verlobter?«, fragte Payton scharf und warf Conall einen Blick zu.
Claray nickte. Ihre Stimme klang traurig, als sie gestand: »Ich war erst ein paar Monate alt, als mein Verlobter Bryson MacDonald, seine Eltern Bean und Giorsal MacDonald und die meisten ihres Clans mit Gift getötet wurden. Es geschah einen Tag nach dem Besuch meiner Eltern dort. Sie waren nach MacDonald geritten, um den Verlobungsvertrag fertigzustellen und zu unterzeichnen, und hatten sich bereits auf dem Rückweg befunden, als es passierte.« Sie schüttelte seufzend den Kopf. »Offenbar waren meine Eltern nur eine Tagesreise weit gekommen, als ein Bote sie mit der Nachricht einholte. Sie haben sofort kehrtgemacht und sind nach MacKay geritten.« Sie unterbrach die Geschichte kurz und erklärte: »Ross MacKay war Giorsals Bruder, Brysons Onkel und Beans bester Freund und außerdem ihr nächster Nachbar. Die Nachricht war von ihm gekommen.«
»Wieso sind sie umgekehrt?«, fragte Conall. Er kannte den wahren Grund, aber er fragte sich, was man ihr erzählt hatte.
»Meine Eltern waren ebenso mit Giorsal und Bean befreundet wie mit den MacKays. Deshalb war der Verlobungsvertrag ja auch geschlossen worden. Mein Vater wollte natürlich helfen, die Leichen zu begraben, und herausfinden, wer sie ermordet hatte. Aber sie haben es nie geschafft.« Sie sank gegen seine Brust, als wäre sie plötzlich erschöpft. »Ich weiß, dass mein Vater sich bis heute darüber ärgert und versucht, in Gedanken durchzuspielen, wer es gewesen sein könnte. Er sagt, Bean und Giorsal wären wunderbare Menschen gewesen und hätten Gerechtigkeit verdient. Selbst jetzt, nach all diesen Jahren, kann er es immer noch nicht loslassen.« Sie schwieg eine Weile und fügte dann mit trauriger, heiserer Stimme hinzu: »Ich glaube, deshalb hat mein Vater niemals eine neue Verlobung für mich arrangiert. Es hätte bedeutet, zuzugeben, dass sie tot sind, und ich befürchte, das zu tun, hätte ihm das Herz gebrochen.«
Conall wusste, dass Payton ihn finster anstarrte. Sein Vetter Payton MacKay wollte von ihm, dass er Claray sagte, dass er Bryson MacDonald war, der Sohn von Bean und Giorsal MacDonald, Neffe von Ross und Annabel MacKay und ihr Verlobter. Aber das wollte er nicht. Nur wenige Menschen wussten von seiner wahren Identität, und Claray zählte aus einem bestimmten Grund nicht dazu. Dieser Grund hatte sich nicht geändert. Abgesehen davon hatte sie genug geredet. Ihre Stimme war heiser und rau geworden. Sie musste sich ausruhen und schien dies jetzt auch zu tun, wie er bemerkte, als sie sich mit einem kleinen Seufzer an seiner Brust zurechtrückte. Claray war eingeschlafen, und diese Erkenntnis brachte ihn zum Lächeln. Es gefiel ihm, dass sie ihm so vertraute. Ihm gefiel auch die Art und Weise, wie sie sich an ihn schmiegte. Er konnte die Wärme ihres Körpers an seinem spüren. Und er mochte ihren Geruch. Jedes Mal, wenn ihre Haare gegen sein Gesicht wehten, nahm er den Duft von Wildblumen und Frühlingsregen wahr. Er hätte dann am liebsten den Kopf gesenkt und ihren Geruch noch tiefer eingeatmet. Als sie schließlich seufzte und sich im Schlaf bewegte, tat Conall genau das.
Er senkte den Kopf, bis seine Nase ihr Haar berührte, atmete tief ein und schloss die Augen, während ihr Duft ihn überwältigte, süß und frisch trotz der stundenlangen Reise. Er hätte gern mit den Händen durch ihr herrliches Haar gestrichen und sein Gesicht in den weichen Locken vergraben, während er weiter ihren Duft einatmete. Allerdings machte die Anwesenheit der anderen Männer das unmöglich, und zögernd hob er den Kopf und richtete den Blick und die Aufmerksamkeit auf den Pfad vor ihm, während er versuchte, die Frau zu ignorieren, die sich so weich an ihn schmiegte und im Schlaf leise seufzte.
Claray wusste nicht mehr, wann sie eingeschlafen war, aber jetzt weckte das Knurren ihres Magens sie auf. Sie stöhnte über den Schmerz in ihrem Bauch, öffnete die müden Augen und blinzelte, dann drehte sie das Gesicht in die Bettlaken, um sich vor dem grellen Sonnenlicht zu schützen. Nur war es kein Bettlaken, wie sie begriff, als etwas an ihrer Wange auf und ab hüpfte und ein leises Lachen an ihre Ohren drang.
»Seit wir von Kerr aufgebrochen sind, habt Ihr fast nur geschlafen. Trotzdem scheint Ihr den Morgen nicht sehr zu mögen«, neckte der Wolf sanft.
Claray zog eine finstere Miene und richtete sich auf. Ihre Stimme klang heiser, als sie ihm versicherte: »Tatsächlich mag ich den Morgen sogar sehr, aber seit ich auf Kerr angekommen bin, habe ich weder geschlafen noch etwas gegessen. Anscheinend macht mich das müde und gereizt.«
Bei ihren Worten wich seine Heiterkeit einem besorgten Stirnrunzeln. »Ihr habt vier Tage lang nichts mehr gegessen?«
»So lange ist es her?«, fragte sie erschöpft. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Ihre Kehle war wund, und das Sprechen schmerzte regelrecht.
»Nein, ich schätze, dies ist der Beginn des fünften Tages«, murmelte er, hob den Kopf und sah sich um.
Claray verzog bei der Bemerkung das Gesicht und gab dann zu: »Mairin ist es am letzten Morgen gelungen, ein kleines Stück Brot und etwas Käse in mein Zimmer zu schmuggeln, während sie dabei geholfen hat, mich für die Hochzeit vorzubereiten. Ich war also nicht die ganze Zeit vollkommen nüchtern.«
Sie blickte an dem Kleid hinunter, das sie trug. Als man es ihr gegeben und sie dazu gebracht hatte, es anzuziehen, war es tatsächlich ziemlich hübsch gewesen. Doch jetzt war es verknittert und staubbedeckt von der Reise. Sie vermutete, sie sollte sich darum nicht grämen. Schließlich war dies das Kleid, in dem sie MacNaughton hatte heiraten sollen. Vermutlich sollte sie sich lieber wünschen, es bei der nächstbesten Gelegenheit ablegen und verbrennen zu können. Aber es kam ihr ungerecht vor, das Kleid für MacNaughtons Schlechtigkeit verantwortlich zu machen. Gereizt rückte sie vom Wolf weg, als er begann, in seiner Tasche herumzukramen.
»Hier.«
Ein Haferkeks tauchte vor ihrem Gesicht auf, und Clarays Augen weiteten sich erstaunt. Sie war so hungrig, dass sie sich einfach nur das nötige kleine Stück nach vorn beugte und hineinbiss. Als sie begriff, was sie tat, sah sie hoch und in das verblüffte Gesicht des Wolfs. Sofort nahm sie ihm den Keks aus der Hand und begann, den ersten Bissen zu kauen.
Unglücklicherweise hatte sie in den vergangenen vier Tagen auch nicht viel getrunken. Am ersten und dritten Tag hatte man ihr einen Krug mit Met gebracht, der mit Wasser verdünnt worden war, aber das war auch alles gewesen. Allerdings hatte man ihr am Morgen des vierten Tages, am Tag der Hochzeit, noch einmal welchen gebracht. Dieses Mal war der Met jedoch nicht verdünnt gewesen. Claray hatte vermutet, dass ihr Onkel gehofft hatte, die Mischung aus starkem Met und mangelnder Nahrung würde sie gefügiger machen. Diese Vermutung hatte genügt, sie davon abzuhalten, mehr als ein Glas zu trinken, obwohl sie sich ausgetrocknet gefühlt hatte. Jetzt war ihr Mund so trocken, dass sie noch nicht einmal ein bisschen Speichel zusammenbrachte. Keine gute Voraussetzung, um harte, trockene Haferkekse zu essen, wie Claray begriff, als sie versuchte zu schlucken und sofort zu würgen begann.