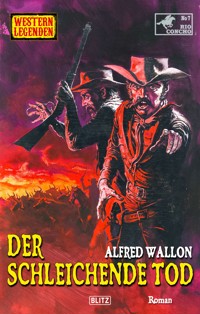Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Allgemeine Reihe
- Sprache: Deutsch
Robert Morgan, Offizier der britischen Navy, fällt durch ein Komplott in Ungnade und wird zum Todfeind der britischen Krone. Seitdem ist er mit seinem Schiff Seeadler und seiner eingeschworenen Mannschaft der Schrecken der Handelsmarine. Robert Morgan hat ein Geheimnis. Sein Sohn Jeffrey wächst in Bristol bei einer angesehenen Familie auf. Doch diese Tarnung wird zerstört und Jeffrey verhaftet. Eingesperrt in den finsteren Kerkern des Londoner Towers wartet er auf seinen Prozess. Robert Morgan plant sofort, seinen Sohn aus den Händen der Briten zu befreien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen:
001 Stefan Melneczuk Marterpfahl
7002 Frank W. Haubold Die Kinder der Schattenstadt
7003 Jens Lossau Dunkle Nordsee
7004 Alfred Wallon Endstation
7005 Angelika Schröder Böses Karma
7006 Guido Billig Der Plan Gottes
7007 Olaf Kemmler Die Stimme einer Toten
7008 Martin Barkawitz Kehrwieder
7009 Stefan Melneczuk Rabenstadt
7010 Wayne Allen Sallee Der Erlöser von Chicago
7011 Uwe Schwartzer Das Konzept
7012 Stefan Melneczuk Wallenstein
7013 Alex Mann Sicilia Nuova
7014 Julia A. Jorges Glutsommer
7015 Nils Noir Dead Dolls
7016 Ralph G. Kretschmann Tod aus der Vergangenheit
7017 Ralph G. Kretschmann Aus der Zeit gerissen
7018 Ralph G. Kretschmann Vergiftetes Blut
7019 Markus Müller-Hahnefeld Lovetube
7020 Nils Noir Dark Dudes
7021 Andreas Zwengel Nützliche Idioten
7022 Astrid Pfister Bücherleben
7023 Alfred Wallon Der Sohn des Piratenkapitäns
7024 Mort Castle Fremde
7025 Manuela Schneider Die Waffe des Teufels
DER SOHN DES PIRATENKAPITÄNS
ROBERT MORGAN NO.01
ALLGEMEINE REIHE
BUCH DREIUNDZWANZIG
ALFRED WALLON
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2024 Blitz Verlag, eine Marke der Silberscore Beteiligungs GmbH, Mühlsteig 10, A-6633 Biberwier
Redaktion: Danny Winter
Titelbild: Mario Heyer unter Verwendung der KI Software Midjourney
Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Satz: Gero Reimer
Alle Rechte vorbehalten.
www.blitz-verlag.de
7023 vom 24.08.2024
ISBN: 978-3-68984-069-3
INHALT
Vorwort
Wegelagerer
Der Verräter
Jeffreys Ergreifung
Der Plan
Begegnung im Sturm
In den Kerkern des London Tower
Im Feindesland
Meuterei
Ein riskanter Plan
Unerkannt unter Feinden
Stunde der Entscheidung
Waghalsige Flucht
In letzter Minute
VORWORT
Dies ist der erste Teil einer Trilogie, in deren Mittelpunkt ein Mann namens Robert Morgan steht. Es ist eine Geschichte aus einer wilden Zeit voller Abenteuer, Gefahren und Legenden. Diese Epoche ist auch unter der Bezeichnung „Goldenes Zeitalter der Piraterie“ bekannt. Namen wie Bartholomew Roberts, Captain Kidd oder William Teach waren stellvertretend für diese Zeit. Männer, die ein raues und sehr gefährliches Leben führten, glorifiziert in unzähligen Geschichten, Legenden und Liedern, die die Phantasie geradezu sprießen ließen.
Wer waren diese Männer, die ein Leben fernab der Zivilisation führten, sich nicht unterordnen wollten und für die nur ein einziges Gesetz galt, das von jedem anderen Piraten, Korsar oder Freibeuter ohne Wenn und Aber akzeptiert wurde?
Diese wilden und rauen Gesellen lebten in ihrer eigenen Welt, in der die Regeln der Gesellschaft nicht galten. Denn die politischen und gesellschaftlichen Systeme jener Zeit hatten sie ausgestoßen und gewissermaßen als Aussätzige gebrandmarkt. Hinter jedem dieser Männer, die im Volksmund als grausame Schlächter oder als Schrecken der sieben Meere bezeichnet wurden, steckte aber ein Mensch mit einer persönlichen Vergangenheit. Ein Mensch, der dieses Leben von Anfang an nie so geplant oder erstrebt hatte, sondern den vielmehr das eigene Schicksal in diese Richtung getrieben hatte oder die geradezu unglaublichen Verlockung, ein freier Mann zu sein und wenigstens die Chance zu haben, reich werden zu können.
Wir dürfen nicht vergessen, dass nur eine sehr kleine Schicht in großem Reichtum lebte, aber sehr viele andere Menschen am Rande der Existenz vegetierten. Gar mancher, der nicht mehr weiterwusste, heuerte auf einem Schiff an und suchte sein Glück in der Fremde. Oder auf einem Piratenschiff, auf das er mit Gewalt gepresst wurde.
Das anfangs raue und gefährliche Leben formte diese Männer, und mit der Zeit verschmolzen sie zu einer verschworenen Gemeinschaft. Beute und Reichtum lockten und waren oft greifbar nahe. Die Zahl der Schiffe, die in all diesen stürmischen Jahren von Piraten gekapert, erobert und auch versenkt wurden, ist legendär.
Robert Morgan war solch ein Mann, den das Schicksal auf die andere Seite des Gesetzes stellte. Ein Mann, vor dessen Namen bald viele Handelskapitäne und die Offiziere der britischen Marine zitterten. Von ihm und seinen Gefährten will ich erzählen.
Augsburg, im Sommer 2024
Alfred Wallon
WEGELAGERER
Hugh Gordon fluchte, als ihm der Wind die ersten Regentropfen ins Gesicht blies. Vor einer knappen Stunde waren die ersten dichten Wolken am nachmittäglichen Himmel aufgezogen, ein sicheres Zeichen dafür, dass das Wetter bald umschlagen würde. Gordon hatte dennoch gehofft, vor Einbruch der Dunkelheit einen trockenen Unterschlupf zu finden. Aber nun hatte ihm das einsetzende Unwetter einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Die vereinzelten Regentropfen verwandelten sich wenige Minuten später in einen heftigen Schauer. Der Wind trieb einen dichten nassen Schleier vor sich her. Gordons Umhang war im Nu durchnässt, und er spürte die unangenehme Kälte, die ihn frösteln ließ. Am fernen Horizont zuckten die ersten Blitze auf, gefolgt von einem grollenden Donner.
Gordon lenkte sein Pferd in die Büsche und suchte Schutz vor dem prasselnden Regen in einem nahe gelegenen Wäldchen. Der Himmel war mittlerweile so trüb, dass man glauben konnte, die Sonne sei längst untergangen. Dabei war es erst später Nachmittag, aber in dieser Gegend spielte das Wetter um diese Jahreszeit manchmal verrückt.
Gordon zitterte, während er rasch vom Pferd stieg und sein Tier an den Zügeln tiefer ins Unterholz führte. Immer wieder musste er tief herabhängenden Zweigen ausweichen und sich mehrmals bücken. Hier wuchsen die Sträucher und Farne besonders dicht. Aber wenigstens spendeten die Kronen der dichten Laubbäume etwas Schutz vor dem Regen. Nur die unangenehme Nässe blieb und ließ einen ersten Hustenreiz aufkommen.
Weiter draußen vor dem Wald hatte das Unwetter jetzt seinen Höhepunkt erreicht. Es regnete so heftig, dass man nicht weit sehen konnte. Immer wieder donnerte und blitzte es, und Gordon seufzte, als ihm klar wurde, dass er vor Einbruch der Dunkelheit sein Ziel nicht mehr erreichen würde.
Er musste Ausschau nach einem Unterschlupf halten, wo er seine Kleider trocknen und in Ruhe das Ende des Unwetters abwarten konnte. Aber das war leichter gesagt als getan, denn in der näheren Umgebung wies nichts darauf hin, dass es hier Ansiedlungen oder abgelegene Gehöfte gab. Vor seinen Blicken erstreckte sich nur der dichte undurchdringliche Wald.
Gordons Pferd begann nervös zu schnauben. Das Tier sträubte sich dagegen, weiter ins Unterholz vorzudringen. Aber Gordon zog das Tier einfach weiter mit sich und schaute sich dabei nach allen Seiten um.
„Komm schon“, murmelte er und zog stärker an den Zügeln, um dem Pferd zu zeigen, dass es zu gehorchen hatte. Mühsam bahnte er sich mit dem Tier einen Weg durch die Büsche und erreichte schließlich höheres Gelände. Vor ihm erstreckten sich bewaldete Hügel, aber nirgendwo gab es Wege, die er benutzen konnte. Aber je näher er Bristol kam, umso besser war es, die bekannten Straßen und Routen zu meiden. Denn er hatte keine Lust, den Soldaten des Königs zu begegnen und dann in eine Kontrolle zu kommen. Zwar hatte er entsprechende Vorkehrungen getroffen und sein Äußeres so verändert, dass es nichts mehr gemeinsam hatte mit den Beschreibungen, die der Obrigkeit bekannt waren. Aber wenn man ihn kontrollierte und beim Durchsuchen den Lederbeutel mit den Goldmünzen fand, dann würde man ihm womöglich sehr unangenehme Fragen stellen. Vor allen Dingen deshalb, weil es mehr Geld war, als ein Mann normalerweise bei sich führte.
Während er jetzt wieder in den Sattel stieg und dem Pferd die Zügel freigab, dachte er daran, welches Risiko er jedes Mal auf sich nahm, um den Anwalt Howard Johnston aufzusuchen. Dazu gehörten aber auch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, die er treffen musste. Mit einem Schiff aus Westindien war er vor einigen Tagen in Plymouth angekommen, und mit einem anderen Schiff würde er in Bristol wieder in See stechen. Die Passage war dort bereits gebucht. Diese Vorgehensweise war zwar ein wenig umständlich, stellte aber sicher, dass man eine Spur bis zu ihm nur sehr schwer zurückverfolgen konnte. Aber all dies musste sein, denn nur auf diese Weise konnte er sicherstellen, dass er auch halbwegs regelmäßige Neuigkeiten über Jeffrey erfuhr, ohne dass das jemand bemerkte
Morgan würde alles für den Jungen tun, dachte Gordon. Obwohl er nicht weiß, ob das alles überhaupt einen Sinn ergibt. Jeffrey weiß nichts über seine Herkunft, und wahrscheinlich ist es auch besser so. Er würde sich schon sehr wundern und wahrscheinlich entsetzt darüber sein, wenn er wüsste, dass …
Seine Gedanken brachen ab, als er plötzlich einen Lichtschimmer zwischen den Bäumen bemerkte. Zuerst hielt er es für eine Täuschung, aber als er weiter in die betreffende Richtung ritt, wurde ihm klar, welchen Ursprung dieser Lichtschimmer hatte. Er kam aus der Fensteröffnung einer kleinen, sehr baufällig wirkenden Hütte. Erstaunt zügelte Gordon für einen kurzen Moment sein Pferd, um sich erst einmal ein genaueres Bild zu machen. Diese Hütte sah nicht danach aus, als wenn hier dauerhaft jemand wohnte. Der angrenzende Schuppen war eingestürzt, und der Zaun, der die Hütte umgab, wies ebenfalls einige Lücken auf. Alles wirkte so, als wenn hier schon seit vielen Monaten niemand mehr nach dem Rechten gesehen hatte.
Gordon überlegte kurz, ob er das Wagnis eingehen sollte, sich der Hütte zu nähern und um Gastfreundschaft zu bitten. Einerseits stellte dies sicher ein Risiko ein, aber andererseits war niemandem damit gedient, wenn er sich eine Lungenentzündung holte und dann so krank wurde, dass er seine Mission nicht zu Ende bringen konnte. Das konnte und durfte er nicht tun, denn schließlich bezahlte ihm Morgan eine sehr gute Prämie dafür. Bisher hatte dieser sich immer auf Gordon verlassen können, und das würde auch weiterhin so bleiben.
Ein erneutes Frösteln gab schließlich den Ausschlag, dass Gordon weiter zu der Hütte ritt. Noch zeigte sich niemand, aber das musste nichts bedeuten. Wahrscheinlich beobachtete man ihn schon durch das Fenster.
„Ich bin ein Freund!“, rief Gordon in Richtung der Hütte und hob die rechte Hand. „Ich suche nur eine Unterkunft und ein trockenes Plätzchen für die Nacht!“
Niemand antwortete. Gordon runzelte die Stirn. Im ersten Moment wollte er sein Pferd wieder wenden, weil er jetzt misstrauisch geworden war. Aber jetzt öffnete sich die Tür, und ein Mann trat ins Freie. Ein hagerer, ärmlich gekleideter Kerl mit fettigen Haaren und einem stoppligen Bart, der abwartend zu Gordon schaute.
„Rührt Euch ja nicht von der Stelle!“, erklang auf einmal eine zweite drohende Stimme hinter ihm. Gordon zuckte zusammen und verfluchte sich selbst dafür, dass er einen entscheidenden Augenblick lang unaufmerksam gewesen war. Sonst hätte es der zweite Mann niemals geschafft, sich in seinen Rücken zu schleichen und ihm auf diese Weise verdammt gefährlich zu werden.
Langsam drehte sich Gordon im Sattel um und erkannte einen untersetzten, grimmig dreinblickenden Mann, der in seiner rechten Hand eine doppelläufige Steinschlosspistole hielt und keinen Zweifel daran ließ, dass er auch abdrücken würde, falls Gordon auf dumme Gedanken kam.
„Einen Moment mal“, ergriff Gordon das Wort und hob beide Hände, um die angespannte Situation ein wenig zu entkrampfen. „Ich bin ein friedlicher Reisender, der nur etwas Schutz vor dem Unwetter sucht. Wenn Ihr mir keine Gastfreundschaft gewähren wollt, dann ziehe ich einfach weiter. Einverstanden?“
„Wohin wollt Ihr?“, fragte nun der zweite Mann, der mit vor der Brust verschränkten Armen immer noch vor der Tür stand und Gordon mit einer Mischung aus Misstrauen und Zorn musterte. Ihm und seinem Kumpan schien es ganz und gar nicht zu passen, dass Gordon sie gestört hatte. Bei was auch immer.
„Nach Bristol, aber das Unwetter hat das verhindert“, erwiderte Gordon wahrheitsgemäß. „Deshalb dachte ich mir, es wäre vielleicht besser, wenn ich ...“
„Steigt ab und bringt Euer Pferd hinters Haus“, fiel ihm der Mann ins Wort und gab dem anderen einen kurzen, aber eindeutiges Zeichen. Daraufhin ließ dieser seine Waffe sinken und kam näher. Aber seine Blicke sprachen Bände. Es bedurfte keiner großen Phantasie, um sofort zu erkennen, dass den beiden dieser überraschende Besucht nicht recht war. Zwar bemühten sie sich, dies vor Gordon zu verbergen, aber natürlich hatte er das längst erkannt.
Ich darf mir nur nichts anmerken lassen, dachte Morgan und tat das, worum ihn einer der Männer gebeten hatte. Er führte das Pferd hinters Haus und band es dort unter einem schützenden Vordach an. Anschließend nahm er dem Tier den Sattel ab und rieb es trocken. Dabei wurde er die ganze Zeit über aus einiger Entfernung von den beiden Männern beobachtet. Sie sagten nichts, sondern schauten genau zu, was Gordon tat. Als wenn es für sie ganz wichtig war, ihn keine einzige Sekunde aus den Augen zu lassen!
„Hört mal“, lenkte Gordon ein, nachdem er seine Arbeit beendet hatte und auf die beiden Männer zuging. „Natürlich möchte ich Euch keine Umstände machen. Ich will nur abwarten, bis der Regen nachgelassen hat. Dann reite ich sofort weiter.“
„Wir sind hier draußen immer ein wenig misstrauisch bei Leuten, die wir nicht kennen, Mister“, sagte der Größere der beiden Männer. „Abel hat schlechte Erfahrungen mit Fremden gemacht. Das dürft Ihr ihm nicht übelnehmen. Aber wir wollen Euch selbstverständlich Gastfreundschaft gewähren, wie es üblich ist. Kommt herein ins Haus ans wärmende Feuer. Es ist auch noch etwas Essen übrig, wenn Ihr Hunger habt.“
Das freundliche Lächeln erreichte jedoch nicht seine Augen, so dass sich Gordons Misstrauen nicht legte. Trotzdem folgte er den beiden Männern in die Hütte. Aber seine Wachsamkeit blieb.
Innendrin sah es so aus, wie er schon im Stillen vermutet hatte. Auch hier hatten es die Besitzer (falls es sich dabei wirklich um die beiden Männer handelte) nicht für nötig gehalten, gründlich aufzuräumen oder zumindest dafür zu sorgen, dass man es sich hier halbwegs bequem machen konnte. Wohin Gordon auch blickte: Überall lag Dreck und Staub, und es roch muffig. Aber wenigstens spendete ein flackerndes Feuer im Kamin Wärme und ließ ihn spüren, dass er dringend seine Kleidung trocknen musste.
„Setzt Euch“, forderte ihn Abel mit einer Geste auf, die aber dennoch wie ein Befehl wirkte. „Josh, gib unserem Gast etwas zu essen. Beeil dich. Er ist bestimmt hungrig. Das stimmt doch, Mister, oder?“
„Wie man´s nimmt“, erwiderte Gordon achselzuckend, nachdem er am Tisch Platz genommen hatte und zusah, wie Josh einen Teller füllte und ihn anschließend wortlos auf den Tisch stellte. Gordon wusste nicht genau, was es war, aber es roch gut, und seine angespannte Haltung begann sich etwas mehr zu entkrampfen. Er aß etwas von dem Eintopf, nickte anerkennend und sah, wie die beiden Männer grinsten.
„Ist nur ein Eintopf, aber es füllt wenigstens den Magen“, meinte Josh.
„Stimmt“, meinte Gordon. „Aber ich bin es gewohnt, dass ich mich auch mit wenig zufriedengebe. Die Zeiten sind nicht einfach.“
„Habt Ihr in Bristol geschäftlich zu tun?“, wollte Abel auf einmal wissen. „Wenn ja, dann hättet Ihr eigentlich die Straße weiter westlich nehmen müssen, um schneller voran zu kommen und ...“
„Ich sagte bereits, dass ich vor dem Unwetter Schutz gesucht habe“, fiel ihm Gordon ins Wort und bemerkte, wie es dabei in Abels Augen wütend aufflackerte. Der Mann hatte sich nicht unter Kontrolle. Ein gutes Zeichen war das nicht, und Gordon ertappte sich bei dem Gedanken, dass es vielleicht doch besser war, so schnell wie möglich seinen ursprünglichen Weg fortzusetzen.
„Entschuldigt bitte die schlechten Manieren meines Vetters, Mister“, lenkte Josh nun ein und warf ihm dabei einen zornigen Blick zu. „Es gehört sich nicht, andere Leute einfach auszufragen. Aber es stimmt schon, was er sagt. Trotzdem müsst Ihr Euch vorsehen. Hier in den Wäldern kommt man sehr schnell vom Weg ab und verirrt sich.“
„Ich finde schon wieder zurück“, winkte Gordon ab und bewegte seine rechte Hand auf die Tischkante zu. Unauffällig ließ er sie sinken und brachte sie in die Nähe seines Gürtels, in dem ein scharfes Messer steckte.
Mit jeder weiteren Sekunde fühlte er sich immer unwohler in Gesellschaft dieser beiden Männer. Aber ihnen das zu zeigen, hätte vermutlich fatale Folgen für ihn gehabt. Also blieb Gordon nichts anderes übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen und weiterhin den Ahnungslosen zu mimen. Aber in Wirklichkeit waren seine Sinne aufs höchste gespannt, denn er rechnete instinktiv damit, dass es nicht mehr lange friedlich bleiben würde. Diese beiden Kerle hatten etwas vor, und sie würden ihm ihr wahres Gesicht schon sehr bald zeigen!
Urplötzlich erhob sich Josh und ging zum Kamin. Er bückte sich nach einem Holzscheit, legte es jedoch nicht ins Feuer, sondern wirbelte auf einmal herum und schleuderte es in Gordons Richtung. Dieser hatte jedoch Joshs Absicht geahnt und sich instinktiv geduckt, so dass das Stück Holz an ihm vorbeiflog und hart gegen die Holzwand der Hütte prallte.
„Schieß doch, Abel!“, hörte Gordon den aufgebrachten Mann rufen und sah, wie Joshs angeblicher Vetter plötzlich seine Steinschlosspistole hochriss und damit auf Gordon zielte. Bruchteile von Sekunden später drückte Abel ab. Das Donnern des Schusses dröhnte in Gordons Ohren, während er sich zur Seite warf und dadurch der tödlichen Kugel entging.
Im Fallen zog er sein Messer aus dem Gürtel und schleuderte es in Abels Richtung. Die Klinge bohrte sich in die Brust des untersetzten Mannes und ließ ihn taumeln, während ein lautes und schmerzhaftes Stöhnen über seine Lippen kam.
Rasch rappelte sich Gordon wieder auf und konnte gerade noch rechtzeitig den Angriff des zweiten Gegners abwehren. Josh hatte seinen Kumpan fallen sehen und griff nun Gordon mit einem Schürhaken an, der neben dem Kamin lag. Aber blinder Zorn war schon immer ein schlechter Ratgeber gewesen, wenn es darum ging, sich im entscheidenden Moment einen Vorteil zu verschaffen.
Der wuchtige Hieb streifte Gordon nur kurz an der linken Schulter, reichte aber aus, um ihn den Schmerz sofort spüren zu lassen. Er biss die Zähne zusammen und trat nach dem Angreifer, der nun zu einem zweiten Hieb ausholte. Gordons Stiefel trafen Josh in den Magen und stießen ihn zurück. Josh brüllte wütend, während er gegen die Tischkante prallte und noch mehr ins Taumeln geriet.
Gordon gab seinem Gegner keine zweite Chance und setzte sofort nach. Seine rechte Faust zuckte vor und traf Josh im Gesicht. Blut schoss aus der in Mitleidenschaft gezogenen Nase hervor, während Josh jetzt den Schürhaken fallen ließ und stattdessen beide Hände vors Gesicht schlug. Nun war er für einige Sekunden schutzlos, und diesen Moment nutzte ein erfahrener Kämpfer wie Gordon. Denn er wusste, dass Josh und Abel ihm auch keine Chance gelassen hätten.
Wieder trafen Gordons Fäuste Josh im Gesicht. So heftig, dass dieser nach hinten fiel und mit dem Hinterkopf gegen die steinerne Umfassung des Kamins fiel. Ein hässliches Geräusch ertönte, und Joshs Stöhnen verstummte von einem Augenblick zum anderen.
Keuchend hielt Gordon inne und schaute kurz hinüber zu dem anderen Gegner, den er zuerst erwischt hatte. Auch Abels Stöhnen war leiser geworden. Der Körper zuckte noch kurz, dann lag er still.
Ein kurzer Blick reichte, um zu erkennen, dass von Abel keine Gefahr mehr ausging. Gordons Messer hatte mitten ins Leben getroffen, und auch Josh lebte nicht mehr. Der harte Stein hatte sein Genick gebrochen.
Der ganze Kampf hatte noch nicht mal zwei Minuten gedauert, aber zwei Tote waren die Folge gewesen. Gordon machte sich jedoch keine Vorwürfe, weil er wusste, dass Josh und Abel ohnehin nur darauf gewartet hatten, ihn zu überrumpeln. Wahrscheinlich waren sie selbst Wegelagerer gewesen, die nur auf das nächste ahnungslose Opfer gewartet hatten, das ihren Weg kreuzte. Das hatten sie diesmal allerdings selbst mit dem Leben bezahlen müssen.
Gordon überlegte kurz, was er als nächstes tun sollte. Ein kurzer Blick aus dem Fenster zeigte ihm, dass sich die Abenddämmerung langsam über den Wald senkte. Jetzt weiterzureiten, wäre nicht ratsam gewesen.
Kurzentschlossen packte Gordon den toten Josh und brachte ihn aus der Hütte. Er schleppte ihn ins Gebüsch, ließ ihn dort liegen und ging zurück. Den zweiten toten Wegelagerer schleppte er ebenfalls aus der Hütte und legte ihn unweit von Josh in den Büschen nieder. Erst nachdem er einige dicht belaubte Zweige über die Leichen gelegt hatte, kehrte er in die Hütte zurück.
Das Feuer war zwischenzeitlich schon fast niedergebrannt. Höchste Zeit, neues Holz nachzulegen, damit die Kälte der Nacht hier keinen Einzug hielt. Kurz darauf flackerten die Flammen wieder empor und sorgten für eine behagliche Wärme.
Gordon zog seine feuchte Kleidung aus, hing sie über einen wackligen Stuhl und stellte diesen in die Nähe des Feuers. Er entdeckte zwei Decken, die zwar alles andere als einen angenehmen Geruch verströmten, aber sie waren wenigstens trocken.
Er legte eine der Decken auf den Boden, streckte sich aus und zog die zweite über sich. Gordon hatte zwar schon weitaus bequemer geschlafen, aber Hauptsache, er hatte ein Dach über dem Kopf und konnte seine Kleidung trocknen. Mit diesem Gedanken schlief er eine knappe Viertelstunde später ein.
Als er kurz nach Sonnenaufgang erwachte, kam es ihm vor, als hätte er nur wenige Minuten Schlaf gehabt. Er fühlte sich erleichtert, als er feststellte, dass seine Kleidung wieder trocken war. Rasch zog er sich an und verließ die Hütte. Das Pferd zu satteln, nahm nur wenige Minuten in Anspruch.
Als die Morgensonne die Wolken durchstieß, war Hugh Gordon schon längst auf dem Weg nach Westen. An die beiden toten Wegelagerer verschwendete er keinen einzigen Gedanken mehr.
DER VERRÄTER
Draußen von der See her wehte ein starker Wind und trieb dunkle Wolken nach Bristol, die sich allmählich zu verdichten begannen. Schon bald darauf fielen die ersten Regentropfen, und schließlich begann ein heftiger Wolkenbruch, der die Menschen von der Straße in ihren Häusern Schutz suchen ließ. Der Wind wurde noch stärker und fegte dichte Regenschleier vor sich hin, gefolgt von einem grollenden Donner am fernen Horizont.
Arthur Pembroke blickte hinüber zum Fenster und zuckte zusammen, als ein heftiger Donnerschlag das Heulen des Windes und das Prasseln des Regens unterbrach. Am liebsten würde er jetzt zuhause sitzen, vor einem behaglichen Feuer im Kamin, die Beine ausgestreckt und ein Glas Punsch in der Hand.
Stattdessen hockte er immer noch in der Kanzlei des Anwalts Howard Johnston und schrieb zwei wichtige Briefe, die heute noch unbedingt fertig werden mussten. Der Anwalt hatte darauf bestanden, und Pembroke kannte ihn lange genug, um zu wissen, dass Johnston äußerst ungehalten werden konnte, wenn diese Arbeit nicht mit der gewünschten Perfektion erfüllt wurde. Howard Johnston war ein gewissenhafter Mann, und genau das verlangte er auch von den Menschen, die für ihn arbeiteten.
So ignorierte der hagere und sehr unscheinbar wirkende Pembroke das Knurren seines Magens, obwohl es sich seit einiger Zeit immer deutlicher bemerkbar machte, und konzentrierte sich umso mehr auf die letzten beiden Briefe, die er zu schreiben hatte. Er tauchte die Feder in das Tintenfass und schrieb dann mit akkurater und sehr deutlicher Schrift das auf, was ihm der Anwalt vorher gesagt hatte. Nichts, was Pembroke Probleme bereitet hätte, denn er arbeitete schon seit sieben Jahren für den renommierten Anwalt und hatte somit sein Auskommen. Was man von vielen anderen Menschen in Bristol nicht sagen konnte, denn es waren harte und schwere Zeiten.
Er war so in seine Arbeit vertieft, dass er zusammenzuckte, als die Tür plötzlich geöffnet wurde.
„Es ist Zeit, Pembroke“, sagte Howard Johnston. „Geht jetzt. Ihr könnt morgen früh den Rest der Arbeit erledigen.“
„Aber ich bin noch nicht fertig mit dem letzten Brief“, erwiderte Pembroke. „Ihr sagtet doch zu mir, dass ich beide heute unbedingt noch fertig stellen soll.“
„Das ist richtig, Pembroke“. Der Anwalt winkte mit einer beschwichtigenden Geste ab. „Aber Ihr könnt jetzt trotzdem nach Hause gehen. Es war ein langer und auch anstrengender Tag. Seid morgen früh pünktlich in der Kanzlei, aber jetzt ist es Zeit zu gehen.“
Pembroke blickte ein wenig erstaunt von seinem Brief auf, als er Johnstons Worte vernahm. Der Anwalt wirkte ungeduldig und nervös, als wäre es ihm gar nicht recht, dass sich Pembroke zu dieser Stunde noch in seiner Kanzlei aufhielt. Dabei war dies, bei Gott, nichts Ungewöhnliches, denn er hatte es längst aufgegeben, die vielen Stunden zu zählen, an denen er noch lange nach Sonnenuntergang hier gesessen und gearbeitet hatte. Weil dies oft erforderlich gewesen war. Und Pembroke als gewissenhafter Mensch hatte dies natürlich akzeptiert, ohne sich jemals zu beklagen.
„Schaut mich nicht so erstaunt an, Pembroke. Es hat schon alles seine Richtigkeit. Und jetzt geht endlich!“
Die Stimme des Anwalts klang jetzt ungeduldiger. Pembroke bemerkte das nervöse Flackern in Johnstons Augen. Eine Tatsache, die ihn ein wenig beunruhigte. Aber das ging ihn nichts an, denn schließlich war er ja nur ein Schreiber, es ziemte sich nicht, seinem Herrn neugierige Fragen zu stellen.
„Selbstverständlich“, ereiferte er sich und erhob sich rasch vom Schreibtisch. Aber nicht, ohne das Tintenfass zu verschließen und die Feder zu reinigen. Beides stellte er akkurat an den Platz zurück und griff dann nach seinem Hut und Mantel.
„Es ist ein entsetzliches Wetter“, sagte der Anwalt mit einem kurzen Blick zum Fenster, gegen dessen Scheiben der aufbrausende Wind immer neue Regentropfen klatschte. „Beeilt Euch, damit Ihr nach Hause kommt.“
Pembroke nickte nur und verbeugte sich vor Johnston noch einmal kurz, bevor er das Arbeitszimmer verließ und dann über die breite, geschwungene Holztreppe nach unten ging. Wenige Augenblicke später öffnete er die Haustür und trat hinaus ins Freie.
Er musste den Kragen seines Mantels sehr hochziehen, weil der Wind ihm die Regenschleier direkt ins Gesicht blies. Nur wenige Lampen erhellten die verlassene Straße und die alten Steinhäuser, hinter deren Fenstern einige Lichter blinkten. Außer ihm war sonst kein Mensch mehr auf der Straße.
Er hielt den Kopf gesenkt, beschleunigte seine Schritte und versuchte sich stets dicht bei den Häusern zu halten, um auf diese Weise den Regenschleiern zu entgehen, die der Wind durch die Straße peitschte. Zum Glück wohnte er nicht weit von der Kanzlei entfernt. Sein Haus befand sich in unmittelbarer Nähe des Hafens, eine gute halbe Stunde Fußmarsch bis dahin, vorbei an einigen verkommenen Hütten und Kneipen, in denen es auch bei diesem Hundewetter sicher wieder hoch herging. Aber das hatte Pembroke noch nie interessiert, denn er lebte immer sehr zurückgezogen und war ein ganz bescheidener Mensch, dem nichts an Vergnügungen und Saufgelagen lag.
Der Wind wurde auf einmal so stark, dass er Pembroke beinahe den Hut vom Kopf gerissen hätte. Unwillkürlich suchte er zwischen zwei Häusern Schutz vor den Windböen und wartete dort einige Sekunden ab. In dem Moment entdeckte er am Ende der Straße einen Mann, der es offensichtlich sehr eilig hatte. Er hielt sich stets im Schatten der Häuser, blieb oft stehen und blickte sich immer wieder um.
Pembroke stand in einer Nische, so dass ihn der andere nicht erkennen konnte. Noch vor wenigen Minuten hatte er sich danach gesehnt, es sich zuhause gemütlich zu machen. Doch jetzt, als er feststellte, dass der Mann sich dem Haus des Anwalts vorsichtig, sich immer wieder nach allen Seiten umsehend, näherte, beschloss er umzukehren.
Vergessen waren das gemütliche warme Zimmer in seinem Haus und das gute Essen, das ihm seine Frau sicherlich schon zubereitet hatte. Wahrscheinlich erwartete sie ihn schon mit Ungeduld und glaubte, dass er auch heute wieder einmal viel zu lange in der Kanzlei des Anwalts arbeiten musste.
Pembroke folgte dem unbekannten Mann und bemühte sich, einen sicheren Abstand zu halten, damit ihn der andere nicht entdecken konnte. Währenddessen fragte er sich, weshalb dieser Mann den Anwalt Howard Johnston zu solch später Stunde noch aufsuchte. Ob das der Grund war, warum der Anwalt so vehement darauf bestanden hatte, dass er seine Arbeit für heute beenden und nach Hause gehen sollte? Hatte er womöglich irgendetwas zu verheimlichen, was niemand wissen durfte, oder steckte er gar in Schwierigkeiten?
Dies wäre ziemlich außergewöhnlich, denn Howard Johnston war ein Mann, der einen sehr guten Ruf genoss und es eigentlich nicht nötig hatte, geheimnisvolle fremde Besucher zu empfangen.
Da stimmt etwas nicht, dachte Pembroke. Vielleicht ist der Anwalt in Gefahr.
Er beobachte von einem dunklen Eingang eines Nachbarhauses, wie der Fremde jetzt vor Johnstons Tür stehenblieb und noch einmal misstrauisch nach allen Seiten spähte, bevor er sich mit einem Klopfen bemerkbar machte. Er musste aber gar nicht lange warten, denn nur wenige Sekunden später öffnete der Anwalt seinem Besucher die Tür und deutete ihm mit einer kurzen, aber dafür umso deutlicheren Geste an, rasch hineinzukommen.
Jetzt wurde es für Pembroke immer mehr zur Gewissheit, Johnston wollte nicht, dass irgendjemand etwas von dem Besuch des Fremden mitbekam. Nur deshalb hatte er Pembroke nach Hause geschickt und wohl gehofft, dass dies ausreichen würde. Aber da kannte der Anwalt seinen Schreiber nicht. Arthur Pembroke war nämlich ein recht neugieriger Mensch, der erst dann Ruhe gab, wenn er ein Problem gelöst hatte. Und deshalb ignorierte er den strömenden Regen, ging mit schnellen Schritten durch die Pfützen und näherte sich jetzt der Tür des Hauses von Howard Johnston.
Pembroke blickte noch einmal zurück. Denn die Soldaten des Königs gingen regelmäßig in dieser Gegend auf Patrouille. Bristol war zwar im Vergleich zu London eine verhältnismäßig sichere Stadt, aber in der Nähe des Hafens wurden schon seit einigen Jahren besondere Vorkehrungen getroffen, um Herr über das Gesindel zu werden, das sich während der Nacht hier herumtrieb. Und die Soldaten waren unerbittlich, wenn es darum ging, einen Trunkenbold aufzugreifen oder einen Dieb auf frischer Tat zu ertappen.
In seiner Eigenschaft als Kanzleischreiber hatte Pembroke Kenntnis von diesen Vorfällen und war nicht darauf erpicht, selbst in solche Ereignisse hineingezogen zu werden. Deshalb lauschte er nur kurz an der Tür, musste dann aber rasch feststellen, dass der Anwalt den späten Gast wahrscheinlich schon in sein Arbeitszimmer gebeten hatte.
Pembroke lief vorsichtig am Haus entlang. Er war froh, dass der Regen wenigstens etwas nachließ, denn er war bereits durchnässt bis auf die Haut und fror entsetzlich.
Er schlich um das Haus herum und kroch ganz vorsichtig an das Fenster heran, hinter dem sich das Arbeitszimmer des Anwalts befand. Licht erhellte die Dunkelheit und ließ die Regentropfen an der Fensterscheibe glitzern. Der Schreiber wagte kaum zu atmen, als er entdeckte, dass das Fenster einen Spalt offenstand. Johnston war ein starker Pfeifenraucher. Wahrscheinlich hatte er deswegen das Fenster geöffnet, um wieder frische Luft hineinzulassen.
Pembroke atmete ganz flach und riskierte jetzt einen vorsichtigen Blick ins Zimmer hinein. Wie er es vermutet hatte, stand der Anwalt direkt vor seiner Bücherwand. In der rechten Hand hielt er die unvermeidliche Pfeife. Und mit der Linken wies er mit einer einladenden Geste auf den Sessel vor seinem großen Schreibtisch.
„Setzt Euch“, forderte er seinen Besucher auf, der gerade Hut und Mantel ablegte und Pembroke noch den Rücken zugewandt hatte. „Ich hatte eigentlich schon gestern Abend mit Euch gerechnet. Ihr seid spät.“
„Es gab eine Verzögerung“, erwiderte der bärtige Mann. „Das hatte ich nicht mit eingeplant. Aber es ging alles gut.“
„Was meint Ihr damit?“, erkundigte sich der Anwalt.
„Ich glaube, die Einzelheiten wollt Ihr besser nicht wissen, Mister Johnston“, fuhr der bärtige Mann fort. „Konzentrieren wir uns lieber auf das Wesentliche.“
Erst als er sich umdrehte sah der Schreiber sein bärtiges, sonnenverbranntes Gesicht. Der Mann war von großer Gestalt und sehr kräftig. Seine Kleidung war nicht mehr neu, wirkte aber dennoch gepflegt und sauber. Wahrscheinlich war der Mann ein Händler, also jemand, der sich nicht die Hände schmutzig zu machen brauchte.
„Ich bringe Euch neue Nachrichten, Sir“, ergriff nun der Fremde das Wort. „Und selbstverständlich wieder eine bescheidene finanzielle Anerkennung meines großzügigen Auftraggebers.“
Howard Johnstons Blicke hefteten sich auf den Lederbeutel, den der Mann aus seiner Tasche geholt und ohne weitere Worte auf dem Schreibtisch des Anwalts deponierte hatte, als wenn es sich dabei um eine ganz selbstverständliche Angelegenheit handelte.
„Ihr könnt ruhig nachzählen“, forderte ihn der Fremde auf. „Oder habt Ihr kein Interesse?“
„Ich vertraue Euch und Eurem Auftraggeber voll und ganz in diesen Dingen“, erwiderte der Anwalt und streckte seine rechte Hand nach dem Beutel aus. Seine Hand zitterte, als er das Klimpern der Münzen vernahm. „Ich werde dafür sorgen, dass das Geld seinem Zweck zugeführt wird.“
„Meinen Auftraggeber wird das sehr zufrieden stellen“, erwiderte der bärtige Mann und nahm erst jetzt in dem Sessel Platz. „Was könnt Ihr mir berichten, Sir?“
„Es ist bis jetzt alles sehr positiv. Der Junge ist aufgeweckt und schon fast ein Mann. Er vertieft sich sehr in seine Bücher. Medizin interessiert ihn besonders, ich glaube, dass er eines Tages ein sehr guter Arzt sein wird.“ Johnston lehnte sich bequem in seinem Sessel zurück. „Auf jeden Fall wird alles dafür getan, dass ihm die Lehrer all ihre Aufmerksamkeit geben. Ihr wisst ja, dass die Erbengemeinschaft in dieser Sache nicht kleinlich ist. Und ich werde in ihrem Namen immer ein waches Auge darauf haben, dass Jeffrey eine sehr gute Ausbildung bekommen wird.“
„Ihr seid aber nach wie vor wachsam, oder?“ fragte jetzt der Gast des Anwalts, von dem Johnston nur den Namen wusste: Hugh Gordon. Alles andere spielte ohnehin keine Rolle, denn Gordon erschien jedes Jahr zu Beginn des Sommers immer pünktlich in seiner Kanzlei und lieferte den versprochenen Betrag ab. Alles, was der Anwalt dafür tun musste, waren Quartier und Ausbildung eines jungen Mannes zu bezahlen, um ihm später einmal eine gute Chance zu ermöglichen. Der junge Mann selbst wusste davon nichts, denn er lebte als Pflegekind in der Familie eines angesehenen Apothekers in Bristol.
Weder Howard Johnston noch sein Gast wussten, dass ein Dritter ganz nahe am Fenster stand und mit großer Neugier das Gespräch verfolgte.
„Mein Auftraggeber wird mich fragen, wie oft Ihr nach ihm schaut“, riss die Stimme des Besuchers Johnston aus den Gedanken. „Für diese Entlohnung verlangt er umfassende Informationen. Ihr könnt sie ihm doch geben, oder?“
„Nennt mir einen Grund, weshalb dies nicht der Fall sein sollte“, erwiderte der Anwalt mit entrüsteter Stimme. „Ich pflege die getroffenen Vereinbarungen zu halten. Und zudem bin ich mit den Einzelheiten sehr gut vertraut. Habe ich das noch nicht erwähnt?“
Er beobachtete seinen Besucher und wartete auf eine bestimmte Reaktion. Aber der Mann blieb nach außen hin ruhig und gelassen. Er fuhr sich mit der rechten Hand nur ab und zu durch den dunklen Bart.
„Kann sein, dass Ihr es schon einmal erzählt habt“, fuhr der Mann jetzt fort. „Wichtig ist, dass der Junge ohne jegliche Probleme heranwächst. Er soll ein sorgenfreies Leben haben. Falls das Geld dafür nicht ausreicht, müsst Ihr es mir nur sagen. Ich bin sicher, dass mein Auftraggeber dafür Verständnis hat und Euch diese zusätzlichen Mittel rasch zur Verfügung stellt. Wollt Ihr das?“
Als Johnston zögerte, fasste dies sein Gast als Zustimmung auf und holte mit einem wissenden Lächeln einen weiteren Beutel aus seiner Tasche hervor, den er auf den Schreibtisch stellte.
Der Anwalt grübelte einen winzigen Moment, steckte dann aber das Geld ein.
„Er braucht zusätzliche Bücher und vielleicht mit der Zeit auch die ersten Kontakte, damit er erfolgreich wird“, sagte er. „Dieses Geld wird es ihm ermöglichen, obwohl ...“
„Obwohl?“
„Es ist Blutgeld“, stieß Johnston hervor. „Ihr wisst es genauso gut wie ich. Es ist kein angenehmer Gedanke, darüber nachzudenken, dass ...“
„Schweigt!“, fuhr ihn der bärtige Mann an. „Oder habt Ihr schon vergessen, dass genau dieses Blutgeld, wie Ihr es nennt, auch Euch ein sorgenfreies Leben garantiert? Fühlt ihr Euch im Nachhinein zu schade, Geld von einem Menschen zu nehmen, der von der Admiralität gesucht wird?“
„Wir reden nicht von irgendeinem Menschen, sondern von einem Teufel!“, sagte Johnston und sah besorgt aus.
„Habt Ihr Robert Morgan jemals gegenübergestanden?“, fragte der Bärtige. „Oder plappert Ihr nur das nach, was man sich in den Häfen und Spelunken von diesem Mann erzählt? Kann ein Mann wirklich ein Teufel sein, der so besorgt um die Zukunft seines einzigen Sohnes ist? Zwar weiß der Junge nicht, wer sein richtiger Vater ist, aber das tut nichts zur Sache. Es zählt nur, dass der Mann, den die meisten Schwarzer Pirat nennen, längst nicht so grausam ist. Ihr kennt seine Geschichte nicht, aber ich schon, Sir“, sagte der Fremde vorwurfsvoll. „Und deswegen stehe ich auch weiter zu ihm. Oder seid Ihr nun doch ins Wanken geraten?“
„Manchmal weiß ich es selbst nicht“, erwiderte der Anwalt wahrheitsgemäß. „Es ist alles irgendwie verrückt und irreal. Ich sorge dafür, dass der Sohn des am meisten gesuchten Piraten unerkannt in England bei Pflegeeltern aufwächst und einen Platz in einer der besten Schulen von ganz England bekommt. Nur dies ermöglicht Jeffrey Masters, eine solche Ausbildung zu genießen.“
„Und was ist daran so verwerflich?“, wollte der andere wissen. „Schließlich kann er nichts dafür, wer sein Vater ist. Oder wollt Ihr den Jungen dafür verantwortlich machen?“ Er sah, wie Johnston kurz abwinkte. „Seht Ihr?“ fuhr er dann fort. „Also zerbrecht Euch nicht länger den Kopf über diese Dinge. Wenn alles gut läuft, wird aus diesem jungen Mann ein Gelehrter, der eines Tages vielen Menschen helfen wird. Nur das ist wichtig.“
Trotzdem konnte Johnston nicht verhindern, dass ihm ein kalter Schauer über den Rücken lief, wenn er an den Mann dachte, der der leibliche Vater des Kindes war. Instinktiv erhob er sich und ging hinüber zum Fenster, um es zu schließen, denn der Wind war jetzt unangenehm kalt geworden.
* * *
Pembroke konnte sich buchstäblich in letzter Sekunde ducken, bevor der Anwalt das Fenster erreicht hatte und es Sekunden später schloss. Der Schreiber wagte sich kaum zu rühren. Seine Hände zitterten und sein Herz pochte heftig, während ihm tausend Gedanken durch den Kopf gingen. Nie im Leben hätte Pembroke vermutet, dass ausgerechnet ein ehrenwerter Anwalt wie Howard Johnston in Dinge verstrickt war, die schon fast an Hochverrat grenzten. Was für ein schändliches Verbrechen, den Sohn eines berüchtigten Piraten finanziell zu unterstützen und ihm sogar noch ein gutbürgerliches Zuhause zu ermöglichen!
Hätte ihm gestern noch jemand erzählt, dass ausgerechnet der ehrenwerte Howard Johnston dunkle Geschäfte machte, dann hätte er wahrscheinlich nur den Kopf geschüttelt. In all den Jahren, in denen Pembroke als Schreiber für die Anwaltskanzlei arbeitete, hatte es nie einen Zweifel an Johnstons Integrität gegeben. Jetzt aber sah alles ganz anders aus.