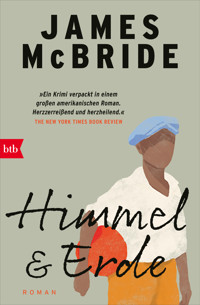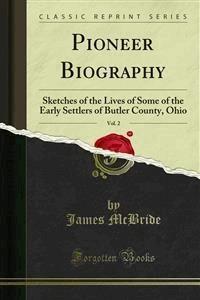15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein Erzählband wie ein Flipperautomat: James McBride in Bestform.« New York Times Book Review
Ein Spielzeug-Sammler, der im Haus eines armen Predigers eine sensationelle Entdeckung macht. Ein Waisenjunge, der über die Schlachtfelder des amerikanischen Bürgerkriegs wandert und glaubt, der Sohn Abraham Lincolns zu sein. Fünf junge Musiker einer Band aus einem Vorort von Pittsburgh, die feststellen müssen, dass überall in ihrem Viertel dunkle Geheimnisse lauern. Ein Löwe im Zoo, der eine plötzliche Ahnung bekommt von der Schönheit des Lebens. Ein Schwergewichtsboxer, der boxt wie Muhammad Ali, als es darum geht, den Torwächter der Hölle zum Kampf gegen die ewige Verdammnis herauszufordern…
Was macht den Mensch zum Menschen? James McBride erzählt von Krieg und Geschichte, von Herkunft und Identität, vom Versuch, die Welt zu verstehen und sich selbst – fantasievoll, skurril, berührend und immer überraschend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Buch:
Ein Spielzeug-Sammler, der im Haus eines armen Predigers eine sensationelle Entdeckung macht. Ein Waisenjunge, der über die Schlachtfelder des amerikanischen Bürgerkriegs wandert und glaubt, der Sohn Abraham Lincolns zu sein. Fünf junge Musiker einer Band aus einem Vorort von Pittsburgh, die feststellen müssen, dass überall in ihrem Viertel dunkle Geheimnisse lauern. Ein Löwe im Zoo, der eine plötzliche Ahnung bekommt von der Schönheit des Lebens. Ein Schwergewichtsboxer, der boxt wie Muhammad Ali, als es darum geht, den Torwächter der Hölle zum Kampf gegen die ewige Verdammnis herauszufordern …
Was macht den Mensch zum Menschen? James McBride erzählt von Krieg und Geschichte, von Herkunft und Identität, vom Versuch, die Welt zu verstehen und sich selbst – fantasievoll, skurril, berührend und immer überraschend.
Zum Autor:
James McBride – Autor, Musiker, Drehbuchschreiber, Journalist – wurde weltberühmt durch seinen autobiografischen Roman »Die Farbe von Wasser«. Das Buch gilt inzwischen als Klassiker in den Vereinigten Staaten, es stand zwei Jahre lang auf der New York Times-Bestsellerliste. Sein Debüt »Das Wunder von St. Anna« wurde vom amerikanischen Kultregisseur Spike Lee verfilmt. Für »Das verrückte Tagebuch des Henry Shackleford« erhielt James McBride den renommierten National Book Award. 2015 wurde er von Barack Obama mit der National Humanities Medal ausgezeichnet.
James McBride
Der Spielzeug-Sammler
Erzählungen
Aus dem Amerikanischenvon Werner Löcher-Lawrence
Für Sonny Rollins,der mir das große Ganze gezeigt hat
Inhalt
Der Under-Graham-Railroad-Zug9
Die Five-Carat Soul Bottom Bone Band63
1. Buck Boy65
2. Ray-Rays Bilderschachtel79
3. Blub99
4. Goat117
Vater Abe149
Die Klagebank167
Der Weihnachtstanz197
Der Fischmann-Engel235
Mr P. und der Wind251
Kapitel 1: Die vierundzwanzigste Stunde251
Kapitel 2: Höhere Ordnungen272
Kapitel 3: Der Wind286
Kapitel 4: Reibt kommt raus302
Kapitel 5: Krieg308
Anmerkung des Autors317
Editorische Notiz318
Der Under-Graham-Railroad-Zug
Ich verkaufe alte Spielzeuge. Alle Arten von Spielzeugen. Schafe, die Popcorn spucken, Puppen, die Geheimnisse flüstern, Nikoläuse aus Papiermaschee, Halloween-Masken, Kinderreimbücher, tutende Feuerwehrautos von 1823 und aufziehbare, die »Die Zeit ist um, Opa!« rufende Uhren von 1834. Ich verkaufe Dreiräder aus der Zeit der Weltwirtschaftskrise, Spielzeugkaffeemühlen aus dem Frankreich des Zweiten Weltkriegs und zwei Versionen der Original-Rock-’Em-Sock-’Em-Robots-Mini-Action-Puppen von 1964, von denen eine wie Peter O’Toole aussieht, die andere wie Sammy Davis Jr. Ich verkaufe Zinnsoldaten, eiserne Züge, hölzerne Autos, Pappflugzeuge, Steingutsparschweine und Flipperautomaten. Ist es was Altes, verkaufe ich es.
Ich bin ein Ein-Mann-Betrieb, arbeite auf Kommissionsbasis und helfe Sammlern beim Verkauf ihrer Spielzeuge. Sie lieben mich. Wenn ich einen möglichen Kunden anspreche, oft eine alte Witwe, die die Sammlung ihres Mannes verkaufen will, oder eine Wall-Street-Größe, die mal ein Vermögen gemacht hat, mittlerweile aber auf dem letzten Loch pfeift, kleide ich mich entsprechend. Ich trete ganz anders auf als meine Konkurrenten von Sotheby’s oder Christie’s mit ihren frisch gestärkten, gebügelten Hemden und steifen Nadelstreifenanzügen, die Frauen elegant frisiert, die Männer glatt rasiert, die Nägel gepflegt. Ich gebe den Antiquitätenprofessor, einen gelehrten Mann, komme zehn Minuten zu spät, klopfe an, trage eine Fliege, ein Hemd mit geknöpftem Kragen und Slipper, rücke mir die Brille zurecht und fahre mir mit der Hand durch den Bart. Ich tapse aus dem Wohnzimmer in die Küche, lasse meinen Stift fallen und entschuldige mich bei den Wänden, gegen die ich laufe. Ich bin ein zerstreuter Professor, ein Spielzeugweiser, der sich in Einzelheiten der vom großen Spielzeugmacher D. U. Edward 1851 in Deutschland gebauten Puppenhäuser verliert, lasse den Löffel in den Teller Hühnersuppe fallen, den ich mit demütigstem Dank von meiner großzügigen Gastgeberin entgegennehme, und singe ein Loblied auf die um 1834 vom Franzosen J. D. Gourhand in Paris präzisionsgefertigten Flipper. Mit Tränen in den Augen preise ich die wundersamen, glorreichen, überwältigenden blechernen Hähne von T. J. McConnell aus Belfast, der beim irischen Osteraufstand zu Tode kam.
Spielzeugsammler lieben enthusiastische, zerstreute Professoren. Zerstreute Professoren sind trottelig, vergesslich und süß – und sie vermitteln den Verkäufern den irrigen Eindruck, dass sie ihnen den bestmöglichen Preis für ihre Stücke zahlen werden. Ja, sie lieben mich.
Ich habe mich während der letzten dreißig Jahre recht gut geschlagen. Ganz bestimmt nicht schlecht für einen Juden aus Queens, der eine Ausbildung zum Shakespeare-Schauspieler gemacht hat und sich anschließend, völlig verkannt, in Sommertheater-Aufführungen in Upstate New York abmühte, wo er einem Publikum aus pensionierten New Yorker Textilarbeitern, das einen fünfhebigen Jambus nicht von einer Beißzange unterscheiden konnte, sein »Stürm, stürm, du Winterwind!« entgegenrief. Mehr Jahre, als ich Finger an den Händen habe, habe ich mich so durchgeknechtet. Dankenswerterweise ist mein Publikum heute weit feinsinniger.
Aber Feinsinn hin oder her, von Amsterdam bis Anaheim vermag kein Spielzeugsammler meinem Charme zu widerstehen, keine weinende Witwe, deren verstorbener Mann ihr eine wertvolle Sammlung von Herman Beavers Specialty Trains hinterlassen hat, kein millionenschwerer, knapp vor dem Ruin oder dem Ableben stehender Vorstandsvorsitzender, sosehr er sich auch an seine wertvolle, im Laufe seines Lebens durch clevere Verhandlungen zwischen Spanien und Alabama aufgebaute Sammlung Henry Ford Toy Racers, Serie 922, klammern mag. Ganze Spielzeugabteilungen bei Sotheby’s und Christie’s erschaudern, wenn sie meinen Namen hören: Leo Banskoff.
Die Welt der Spielzeugsammler ist klein, und in ihr bin ich Pete Rose, Henry Aaron und Babe Ruth, das große Dreigestirn des Baseballs, in einer Person. Während der letzten zwanzig Jahre lag meine Trefferquote bei fast hundert Prozent, ich habe nie einen Kunden verloren. Niemand kann meiner Mischung aus Wissen, Wahrnehmungskraft und, vor allem, Gewinnverspechen widerstehen, niemand meinem Charme.
Das heißt, einen gab es doch.
Ich hörte von Reverend Spurgeon Hart durch einen alten Freund, Milton Schneider, einen New Yorker Steueranwalt und Investor, der sich so gewandt wie diskret um Nachlässe und Scheidungen kümmert, was ihm über die Jahre beträchtliche Summen eingebracht hat. Milton ist ein cleverer, beschwingter Bursche, der sich durch die scheidungsbedingt zerschlagenen Portfolios und wirtschaftlichen Trümmer seiner wohlhabenden Klienten arbeitet, wobei er gelegentlich auf einen unverhofften Schatz im Spielzeugbereich stößt, den er an mich weiterreicht. Junge Ex-Frauen von Millionären sind nicht an Spielzeugen interessiert, schon gar nicht, wenn sie selbst Überbleibsel einer Ehekatastrophe und nur mehr Kerbe drei oder vier am Totempfahl eines millionenschweren Liebeslebens sind. Milton schnüffelt sich da locker durch, und wittert er Spielzeuggold, übergibt er an mich. Ich mache dann die Drecksarbeit, erkunde die Beute, klopfe an, rede den Preis herunter, verkaufe die Stücke, streiche meine Kommission ein und lasse Milton für seine Bemühungen eine kleine Anerkennung zukommen. Alle sind glücklich. Ein klassisches Win-win.
So schien es auch im Fall Spurgeon Hart zu sein. Milton schickte per Overnight-Kurier einen braunen Umschlag mit der Notiz: »Die Chancen stehen nicht allzu gut, aber schaden kann es nicht.« Ich war argwöhnisch, da Milton zuletzt dreimal danebengelangt und ich ihm gerade erst geschrieben hatte, dass er mir etwas schuldig sei, sollte auch sein nächster Tipp in die Hose gehen. Zuletzt hatte mich der neue Freund und Personal Trainer einer ältlichen Upper-East-Side-Witwe, ein Afroamerikaner etwa von der Größe Milwaukees, unsanft vor die Tür gesetzt. Ich hatte ihn mit meiner Meinung zu einem seltenen Stück in ihrer Sammlung beleidigt, einer Puppe, die einen berühmten Boxer namens Joe Frazier darstellte. Die Puppe trug eine Boxerhose und den Federschmuck eines Indianerhäuptlings, dazu ein Handtuch mit der Aufschrift »Thrilla in Manila mit dem Gorilla« um die Schultern. Wenn man an dem Handtuch zog, kam die Zunge heraus. Es war ein entzückendes Stück, nicht alt, aber eine Rarität. Insgesamt waren davon weltweit nur vierzehn produziert worden, bevor die Sache gerichtlich gestoppt wurde. Nach einer sechswöchigen Recherche und intensiven Gesprächen mit dem Hersteller entschied ich jedoch, dass die Puppe eine Fälschung aus Taiwan war. Das versetzte den Geliebten der Witwe, einen großen Fan von Smokin’ Joe, in Aufruhr, und nach einigen erhitzten Kommentaren zu meinem Judentum, zu Rasse, Motiven und Gebaren, war ich gezwungen, das Haus zu verlassen, wobei ich ausdrücklich davor gewarnt wurde, mich noch einmal sehen zu lassen, unterstrichen durch freimütige Beschreibungen dessen, was mit verschiedenen Teilen meiner Anatomie geschehen würde, sollte ich den Fall dennoch weiterverfolgen.
Aber ich hatte mit Milton über die Jahre eine schöne Summe verdient, und so öffnete ich den braunen Umschlag, gleich als er kam. Darin enthalten war ein verstaubtes Kunststoff-Portfolio mit dem Aktienbestand eines gewissen Reverend Spurgeon Thelonius Hart aus Springfield Gardens in Queens, das von einem von Miltons jungen Referendaren in der Rundablage gefunden worden war. Ich setzte mich und blätterte durch die Seiten. Wie es aussah, hatte die Mutter des guten Reverends als Hausangestellte für die Von Kleeses gearbeitet, in den 1920ern eine der wohlhabenden Familien New York Citys. Die Aktien sowie ein paar Familienerbstücke waren Geschenke für ihre jahrelangen Dienste, bevor die Familie ausstarb.
Offenbar war der Wohlstand der Von Kleeses aber mit den letzten Familienmitgliedern verblichen, jedenfalls schien nichts im Portfolio noch etwas wert zu sein: Es gab ein, zwei wirre Bonds, ein paar Anlagefonds und einige alte Staatspapiere von vor 1927, auf denen ein »Gepfändet«-Stempel prangte, was wohl hieß, dass sie wertlos waren. Ich wollte das Ganze schon wieder in den Umschlag stecken und zurück an Milton expedieren, als ich in der hinteren Klappe des Portfolios eine verblichene Schwarz-Weiß-Fotografie entdeckte.
Fast wäre ich vom Stuhl gefallen, als ich sah, um was es sich handelte.
Es war ein Spielzeugzug. Aber nicht irgendeiner. Eine 1859er Piper-Coal-Lokomotive, Smith-Deckert 2350, Blue-Tone, dampfgetrieben. Mit vier Waggons. In makellosem Zustand.
Lassen Sie mich Ihnen den Wert – und damit auch den Geldwert – alter Spielzeuge erklären. Ich habe eine Freundin, eine Kunstsammlerin namens Muriel, mit der ich gelegentlich darüber debattiere, wer von uns das lukrativere und für die Weltgeschichte wichtigere Feld beackert, und in aller Regel gewinnt Muriel. An einem unserer Abende jedoch, nach einer beträchtlichen Menge Bourbon (den ich großzügig zur Verfügung gestellt hatte), sagte ich: »Muriel, nenne mir ein Kunstobjekt auf dieser Erde, dessen Wert letztlich nicht mehr in Zahlen zu fassen ist, ein Objekt, das die Bedeutung der Geschichte für die Gegenwart greifbar macht. Ein einziges.«
Muriel lehnte sich nachdenklich zurück, eine Gauloise in der einen und ihr Glas in der anderen Hand. »Da fallen mir einige ein«, sagte sie. »Die Sixtinische Kapelle. Michelangelos David. Verschiedene Impressionisten. Monet. Van Gogh. Alles und alle unbezahlbar, und sie transportieren ein gutes Stück Geschichte in die Gegenwart.«
»Aber haben sie auch einen inneren Wert? Einen, der sich beziffern ließe?«, fragte ich.
»Ich denke, schon.«
»Aha!«, sagte ich und hakte nach. »Da liegt der Unterschied. Alte Spielzeuge funktionieren anders. Sie haben einen emotionalen Wert, wobei die Spielzeuge, die sich im besten Zustand befinden, meist die traurigste Geschichte haben, und je trauriger die Geschichte, desto wertvoller das Spielzeug. Das ist ein menschliches Element, über das kein Gemälde verfügt. Die spezifische Geschichte von Freud und Leid im Leben eines Kindes bedeutet preislich gesehen, dass es nach oben keine Grenze gibt. Weil auch die Trauer über das Leiden eines Kindes keine Grenze kennt, genauso wenig wie das Glück der Eltern über das Wunder, das ihr Kind darstellt. Das im Objekt enthaltene Gefühl bemisst sich am Wert eines Kinderlebens und ist mit dessen Unschuld verbunden, was das Spielzeug unbezahlbar macht.«
»Ich bin noch nicht fertig«, sagte sie. »Es gibt noch andere Faktoren. Sagen wir, du würdest eine von Jesus höchstpersönlich angefertigte Zeichnung finden oder die Bundeslade. Oder ein Tuch mit einer Skizze von der Hand des Propheten Mohammed. Das alles wäre ebenfalls unbezahlbar und nicht mehr nur Kunst. Es wäre Teil unserer menschlichen Geschichte und damit, sagen wir, so viel wert wie ganz Argentinien. Nimm Spanien und Portugal noch mit dazu. Wir reden hier nicht von Millionen, sondern von etlichen hundert Millionen. Vielleicht sogar einer Milliarde. Kannst du dir etwas Ähnliches in deinem Bereich vorstellen?«
Da wollte mir nur eines einfallen, etwas, das sowohl für ein Stück zentraler Weltgeschichte als auch den unschätzbaren Wert kindlicher Unschuld stand. Und ich starrte gerade ein Bild davon an.
Den Under-Graham-Railroad-Zug.
Dieser Zug ist mit keinem anderen zu vergleichen. Die meisten Spielzeugzüge, selbst die seltenen, wurden mehrfach hergestellt. Zum Beispiel der in Brüssel produzierte, von einer Dampflok gezogene Marronier-Rozinski-Zug. Vier sind davon angefertigt worden, einer gehörte Winston Churchill. Oder der Staffjehuid-Prometheus-Zug des großen flämischen Spielzeugmachers Noel Tobias Eisenhauer, ebenfalls vierfach hergestellt, und einer landete bei George IV. Oder der außergewöhnliche Cuddinsky-Routes-Quêteur des bekannten französischen Spielzeugmachers Jean Pierre DuBlanc Rudan, achtmal gab es ihn, zwei davon gibt es heute noch, einer ist im Besitz des Königs von Saudi-Arabien.
Der Under-Graham-Railroad-Zug aber ist noch einmal eine andere Geschichte. Er ist im wahren Wortsinn einmalig, es gibt ihn kein zweites Mal. Und er ist auch in jeder anderen Hinsicht etwas Besonderes. Um es einfach auszudrücken: Vielleicht handelt es sich bei ihm um das wertvollste Spielzeug der Welt.
Sein Wert ist mit dem Verlauf der Geschichte verbunden, natürlich, er wird gesteigert durch die spezifische Zeit, den Krieg und die irrationale Emotionalität von Freud und Leid eines Kindes.
Er war ein Geschenk General Robert E. Lees von den Konföderierten an seinen fünfjährigen Sohn Graham, der jedoch starb, bevor er damit spielen konnte. Aber es ist nicht allein das Spielzeug selbst, auch nicht der tragische Tod Grahams, woraus der spezielle Wert des Zuges erwächst. Es gibt weitere Faktoren. Zum einen gab Lee den Zug 1859 in Auftrag, direkt vor Beginn des amerikanischen Bürgerkriegs, und das für die unerhörte Summe von 3100 Dollar. Das Geld ging an Horace Smith, berühmt als Teil von Smith & Wesson und selbst ein Spielzeugsammler, der damals als eine Art Fabergé der Spielzeugmacher galt.
Der zukünftige Befehlshaber der Armee Nord-Virginias wusste, dass es Krieg geben würde. Darüber hinaus war ihm bewusst, dass Horace Smith, dessen Entwürfe später vom deutschen Waffenschmied Franz Wiltgard übernommen werden sollten, um damit die deutsche Kriegsmaschinerie im Ersten Weltkrieg zu befeuern, ein Waffenbauer-Genie war.
Smith gelang ein Meisterwerk. Der Zug bestand aus fünf Teilen, einer Lokomotive mit rauen Gummirädern, drei Waggons und einem außergewöhnlich großen Kohlentender mit einem winzigen Kohleofen und einem daumennagelgroßen Kompressor, der Wasser über eine Metallröhre in einen winzigen Kessel leitete. Der Zug fuhr mit Dampf, und es hieß, dass er auf einer speziell für ihn gefertigten Gleisanlage mit einem einzigen Stück Kohle und einem vollen Wassertank vier Stunden lang mit einer Höchstgeschwindigkeit von vierzig Stundenkilometern fahren konnte – schneller als jedes Pferd und jede Kutsche es in jenen Jahren auch nur kurzzeitig vermochten. Es war ein unglaubliches Wunder der Ingenieurskunst.
Aber Schicksal oder Vorsehung forderten ihren Tribut. Zwei Tage vor der Kriegserklärung kam der Zug zur großen Freude von Lees kleinem Sohn Graham im Haus des Generals an. Dann brach der Krieg aus, und Lee wurde nach Arlington, Virginia, beordert, um die konföderierten Kräfte an der Küste Georgias und South Carolinas zu organisieren. Zwei Wochen später, in South Carolina, erreichte ihn per Telegramm von zu Hause die niederschmetternde Nachricht, dass sein geliebter Sohn Graham plötzlich erkrankt und an Auszehrung gestorben war. Darüber hinaus waren der neue Zug des Kindes und die Sklavin, die sich um den Jungen gekümmert hatte, verschwunden (beides wertvolle Objekte, da Sklaven in jenen Tagen einen beträchtlichen Geldwert besaßen). Die Frau war nach Norden in die Freiheit geflohen. Ein doppelter Verlust für den General. Ein dreifacher, wenn man bedachte, dass die Kinderfrau offenbar ein geschätztes Familienmitglied gewesen und von dem armen verstorbenen Jungen sehr geliebt worden war – und jetzt hatte sie auch noch seinen Zug mitgehen lassen.
Der General war außer sich. Er schwor, die Diebin zu finden, und gab während des Kriegs und danach viel Geld aus, um sie zu fassen, doch ohne Erfolg. Fast hätte er es 1863 geschafft, als ein von ihm angeheuerter Detektiv herausfand, dass sie mit der Underground Railroad nach Norden geflohen und eine Zeitlang in Hell’s Kitchen in New York City gelandet war. Aber dort verlor sich die Spur. Zwei Jahre später endete der Krieg, und der General starb 1870, ohne herausgefunden zu haben, was aus dem verlorenen Spielzeug seines geliebten Sohnes geworden war.
Die Lebensdaten der Diebin wurden nie ganz bestätigt. Aber es gibt keinen Zweifel, dass es den Zug wirklich gab. Ein Gemälde des gestohlenen Stücks hing nach dem Tod des Generals, wie man wusste, jahrelang in dessen Haus, zudem gibt es verschiedene Entwurfsskizzen, die in den Unterlagen einiger prominenter Waffenschmiede in Deutschland und Frankreich gefunden wurden. Im Ersten Weltkrieg wurde der Grundentwurf im deutschen Kriegsministerium zur Entwicklung neuer Geschütze genutzt, der General selbst hatte den Verlust in seinen Briefen erwähnt.
Womit wir beim zweiten Grund für den inneren Wert und die Bedeutung dieses kleinen mechanischen Wunders wären: In seinen winzigen Schleifen, Kurbeln und Steuerelementen verbarg sich eine Kriegswaffe. Welche andere mechanische Vorrichtung, angetrieben durch ein winziges Stück Kohle und eine derart kleine Menge Wasser, vermochte in jenen Jahren einen Zug vier Stunden lang mit vierzig Stundenkilometern voranzutreiben, schneller und länger als es jede Pferdekutsche jener Zeit durchgehalten hätte?
Während des Bürgerkriegs begriff der General, dass die Ingenieure des Südens das Kriegsglück mit Hilfe der Technologie des kleinen Zuges umkehren könnten. Eine mit ihr ausgestattete ausgewachsene Dampfmaschine würde Kanonenkugeln kilometerweit schießen und Tausende Soldaten samt Vorräten, Pferden und Munition über weite Strecken verlegen können, ohne frischen Brennstoff aufnehmen zu müssen – ganz zu schweigen davon, dass sich damit völlig neue Geschütze und Gewehre entwickeln ließen, die dem Norden den Garaus machen könnten. Die Möglichkeiten waren so groß, dass Lee den Präsidenten der Konföderierten, Jefferson Davis, zu überzeugen vermochte, Agenten nach Connecticut zu schicken, um Horace Smith zu entführen, damit sie ihn zwingen konnten, den Zug als Kriegswaffe neu zu produzieren. Der Vorstoß führte zu nichts, zudem wurde seine Realisierung durch den Umstand verkompliziert, dass Smith nach Ausbruch des Kriegs bewusst wurde, welche wahre Absicht hinter dem Auftrag Lees gesteckt hatte, und er, von Schuldgefühlen erfüllt, einen Brief an den General schrieb, in dem er den Süden verurteilte und sich selbst zum Abolitionisten erklärte. Im Übrigen verlangte er den Zug umgehend zurück, da der Sohn des Generals tot sei und keine Verwendung für das Spielzeug mehr habe. Darüber hinaus bestand Smith darauf, dass die Entwicklungskosten für den Zug weit über die gezahlten 3100 Dollar hinausgegangen seien, schließlich handelte es sich um ein absolutes Unikat.
Der General war verständlicherweise wütend. Erzürnte Briefe wechselten zwischen Virginia und Connecticut hin und her, und zwischen den beiden Staaten hätte eine zusätzliche Front aufbrechen können, hätte nicht ein neugieriger Reporter des Hartford Courant Wind von dem Disput bekommen und in einem Artikel vom »mysteriösen Under-Graham-Railroad-Zug« gesprochen, einem bösen Wortspiel aus dem Namen des Generalssohns und der Art und Weise, wie der Zug nach Norden entschwunden war, angeblich in einem weiteren Zug, der Underground Railroad. So kam das Spielzeug zu seinem Namen und verschwand auf ein stilles Nebengleis der Geschichte, denn die drohende zusätzliche Öffentlichkeit ließ beide Seiten zurück in ihre Ecken stolpern. Wäre herausgekommen, dass Smith & Wesson den Verkauf von Waffen an den Süden auch nur diskutiert oder dem Gedanken Vorschub geleistet hätte, wäre Horace Smith an die Wand gestellt worden. Hätte Davis’ Regierung auf der anderen Seite zugeben müssen, dass sich die militärische Strategie der Konföderierten unter anderem auf einen Spielzeugzug kaprizierte, der von einer Schwarzen gestohlen und mit der Underground Railroad nach New York gebracht worden war, hätte sie sich zur Zielscheibe des Gespötts der Europäer gemacht, von denen sie sich Geld leihen musste, um ihre Kriegsanstrengungen zu finanzieren.
Angesichts dieser Szenarien verstummten beide Seiten, und die Diskussion erstarb. Die Geschichte tat ein Übriges. Der Krieg endete, der General verschied und 1893 auch Horace Smith.
Der Zug war aus der Geschichte verschwunden und nie wieder gesichtet worden. Natürlich tauchte er von Zeit zu Zeit in irgendwelchen Meldungen auf. So behauptete 1923 ein französischer Spielzeugmacher, dass er ihn sich beschafft habe, doch das Ganze stellte sich als Schwindel heraus. 1945 schwor eine schwarze Näherin aus Baltimore, ihre Großmutter habe den Zug in ihren Besitz gebracht, aber das Foto, das sie vorwies, erwies sich ebenfalls als Fälschung. Seit einhundertdreißig Jahren hatte es keine glaubhafte Sichtung des Under-Graham-Railroad-Zuges gegeben.
Das heißt, bis zu jenem milden Nachmittag im Jahr 1992 nicht, da ich in meinem Büro saß und ein altes Foto aus dem wettergegerbten Portfolio Reverend Spurgeon T. Harts anstarrte.
Ich war so perplex, dass ich den Blick einige Minuten lang nicht von dem Zug nehmen konnte. Endlich stand ich auf, sammelte mich, stakste in die Küche, schüttete einen Bourbon hinunter und schickte einen Teelöffel Erdnussbutter hinterher. Die Mischung betäubt meine Nerven normalerweise. Ich hatte das Gefühl, Sand zu essen. Trotzdem, als ich mich zurück an meinen Schreibtisch setzte, um die Fotografie erneut zu betrachten, spürte ich, wie mein Herzschlag langsamer wurde und sich mein schneller, flacher Atem vertiefte. Wieder starrte ich das Bild an.
Dann wurde ich aktiv. Ich schaltete meinen Computer ein, scannte das Foto auf meine Festplatte und verglich es mit den Skizzen, die auf einer speziellen, nur für registrierte Benutzer zugänglichen Spielzeug-Website verfügbar waren. Sie passten zu dem Foto, und ich sagte alle Termine für die nachfolgende Woche ab, bestellte meine beiden Assistenten ein und rief einen Spielzeugsammler-Kollegen an, der mir zwei weitere Helfer schickte. Nachdem ich die Truppe so aufgestockt hatte, entwickelte ich meinen Schlachtplan.
Einen Assistenten schickte ich in die Library of Congress in Washington, D. C., um nach einschlägigen Unterlagen in den Beständen zu suchen, einen weiteren zur Washington and Lee University in Lexington, Virginia, deren Präsident Lee nach dem Krieg geworden war, um eine Kopie einer Zeichnung des Zuges zu machen, die der General selbst angefertigt hatte. Mein Topassistent fuhr nach Norwalk, Connecticut, und suchte in den Archiven von Smith & Wesson nach Beschreibungen und frühen Skizzen des Zuges. Ich selbst setzte mich hin und studierte das Foto ein weiteres Mal.
Einen ganzen Tag studierte ich es. Es zeigte einen dunkelhäutigen afroamerikanischen Jungen, vielleicht sechs oder sieben Jahre alt, der neben einem kargen, mitgenommenen Weihnachtsbaum saß. Er trug eine zerlumpte Hose und ein ebenso zerlumptes Hemd mit geknöpftem Kragen. Wie ein Indianer saß er da, im Schneidersitz, und sah in die Kamera. Vor ihm, ordentlich aufgereiht, aber auf der Seite, damit sie besser ins Bild kamen, lagen die drei Waggons, der berühmte Tender und die Lokomotive des Under-Graham-Railroad-Zuges.
Lange sah ich das Foto an und stellte es schließlich auf das Bücherregal über meinem Schreibtisch, wo ich es weiter betrachten konnte. Es war fast Mitternacht, als ich endlich zu Bett ging. Ich schlief ein und träumte von Zügen, Betrügern und Narren, die hinter Millionen her waren. Tief schlief ich nicht, sondern eher mit offenen Augen.
Am nächsten Morgen stand ich auf und ging mit dem Bild zu einem mir bekannten namhaften Fachmann für Fotografie. Er brauchte keine zwei Stunden, um zu bestätigen, dass das Foto echt war, wollte es aber noch genauer untersuchen, was eine Reihe Tests erforderte. Ich stimmte ihm hastig zu.
Tags darauf rief er an und sagte, angesichts des Alters des Fotopapiers und der spärlichen Möblierung um den Jungen herum (es war nur ein Teil eines Stuhls und eine schmale Wand hinter dem Jungen zu sehen) sei das Bild wahrscheinlich in einem kaum isolierten Bau aufgenommen worden, vielleicht einer Art Hütte. Mit dem Vergrößerungsglas hatte er verschiedene feine Lichtstrahlen durch die Wand hinter dem Kind dringen sehen, die aus Holzlatten zu bestehen schien.
»Nach der Art der Holzkonstruktion zu urteilen«, sagte er, »der Bodenbeschaffenheit und dem Lichteinfall wurde das Foto irgendwann in den späten 1930ern im Süden aufgenommen.« Er stützte seine Theorie auf verschiedene Gleichungen, die er mit einem Lineal, einer Tabelle, einer Himmelskarte und einem billigen Taschenrechner aufgestellt hatte, mit dem er auch sein beeindruckendes Honorar berechnete.
Alles zusammengerechnet, gab ich in jenen ersten zwei Wochen mehrere tausend Dollar für den Under-Graham-Railroad-Zug aus, eine ordentliche Summe, aber ein Nichts, sollte sich der Zug als echt erweisen, was ich als sicher gegeben ansah.
Auf all meine Belege gestützt, machte ich mich daran, Reverend Spurgeon Hart, den Besitzer der Fotografie, zu kontaktieren, dessen Adresse im Portfolio stand. Um das Eis zu brechen und die gute Nachricht zu überbringen, rief ich zunächst an. Mrs Hart kam ans Telefon. Es freute mich zu hören, dass ihr Mann noch lebte und bei guter Gesundheit war. Ich stellte mich als Freund der Firma vor, die das Portfolio ihres Mannes bearbeite, und fragte, ob ich sie einmal besuchen kommen könne.
»Warum?«, fragte sie. Sie schien argwöhnisch.
»Ich bin Spielzeugsammler und interessiere mich für einen Zug, von dem ein Foto im Portfolio Ihres Mannes steckt.«
»Ach, der«, sagte sie.
Ich wurde fast ohnmächtig. Mein Herz schlug so heftig.
»Hat Ihr Mann ihn noch?«, vermochte ich herauszuwürgen.
»Oh, Spurgeon hat das alte Ding irgendwo herumliegen«, sagte sie.
Bei ihrem »irgendwo herumliegen« wurde mir schwindelig.
»Wissen Sie zufällig, wo der Zug im Moment ist?«
»Natürlich tu ich das.«
»Dürfte ich kommen und ihn mir ansehen?«
»Da müssen Sie Spurgeon fragen. Ich bin sicher, es ist ihm egal.«
»Dürfte ich ihn sprechen?«, fragte ich.
»Er ist nicht hier, Mister.«
»Und wann wird er da sein?«, fragte ich und zwang mich, ruhig zu klingen. Ich hatte Angst. Angst vor einer Enttäuschung, denke ich. Meine Fantasie spielte verrückt. War es falsch von mir zu glauben, dass ich über den Traum eines jeden Sammlers alter Spielzeuge gestolpert war? Ich hatte keine Kinder, keine Frau, keinen Hund und war mit meinen siebenundfünfzig Jahren zu meinem eigenen Vater geworden. Selbst mein Gang hatte etwas Dahintreibendes, Schweifendes wie seiner früher. Die Hose hing mir locker um den Bauch, und auf meinem Gesicht lag ein leicht verwundertes, verwirrtes, nach innen gerichtetes Grinsen. Ich war geworden, wovor ich mich immer gefürchtet hatte: ein furzender, uralt wirkender Sack, der in einem neu geleasten Mercedes-Benz durch das schöne Bucks County, Pennsylvania, kurvte. Der Wagen stand vorn in meiner umgebauten Scheune aus dem Jahr 1726, die wie ihr Besitzer den Anschein von Großzügigkeit und Wohlstand erweckt, drinnen aber leer, verbraucht und morsch ist und voller nutzloser alter Dinge steht. Ich wollte einen Inhalt, ein Ziel. Und eine anständige Rente, Himmel noch mal. Und zum ersten Mal in meinem Leben stand ich unmittelbar vor der Tür zu all diesen Dingen und mehr, und die Frau am anderen Ende hielt den Schlüssel in der Hand.
Ich hörte ein Krachen im Hintergrund, dann bellten zwei Hunde. »Einen Moment«, sagte sie, und ich hörte Schreien, Fluchen und mehr Gekläffe. Kurz darauf meldete sie sich wieder.
»Also, was wollten Sie noch mal?«, fragte sie. Sie schien durcheinander.
»Wegen des Zuges«, sagte ich.
»Ach ja«, sagte sie. »Nun, im Augenblick habe ich keine Zeit, um darüber zu reden. Mein Hund legt sich mit dem Nachbarshund an. Sie wissen, dass ein Rottweiler ein vollkommen nutzloses Tier ist? Hatten Sie schon mal einen Rottweiler?«
Ich gestand, dass ich noch keinen besessen hatte. »Was das Spielzeug angeht. Könnten Sie Ihrem Mann ausrichten, dass ich es gern einmal ansehen würde?«
»Mister, wenn Sie mit Spurgeon über den alten Ramsch reden wollen, machen Sie sich besser auf den Weg und kommen her. Ich hab keine Zeit, über irgendwelches Spielzeug zu quasseln.«
»Könnte ich heute kommen?«
»Kommen Sie, wann immer Sie wollen.«
»Wann wird er zu Hause sein? Ihr Mann, meine ich.«
»Kann ich Ihnen nicht sagen. Der alte Spurge ist schwer zu erwischen. Er arbeitet ständig. Für den Boss, wie sie das nennen.«
Ich spürte, wie sich Schweißperlen in meinem Nacken bildeten. »Wer ist sein Boss?«
»Der Menschensohn.«
Sie legte auf.
Es sind vier Stunden von meiner Gentleman-Farm in Bucks County nach Springfield Gardens in Queens, wo Reverend Hart wohnt. Ich schaffte es in dreien. Es wäre noch schneller gegangen, aber ich musste mich erst vorbereiten und meine Requisiten zusammenstellen. Meinen gewohnten Aufzug als zerstreuter Professor ersetzte ich durch einen Maßanzug mit Schlips und polierten Schuhen und packte einen Aktenkoffer mit 90 000 Dollar in meinen Mercedes, in sorgfältig abgezählten und von Gummibändern zusammengehaltenen 9000er-Bündeln. Das war alles, was ich an Bargeld so schnell auftreiben konnte. Wobei mir ein befreundeter Steuerberater erklärt hatte, dass Bankeinzahlungen unter 10 000 Dollar von der Steuerbehörde nicht weiter beachtet werden. Ich ging davon aus, dass es Verhandlungen mit Hart geben würde. Ich wollte mit neun Riesen anfangen und mein Angebot jeweils um die gleiche Summe steigern. Mit den Bündeln konnte ich jeweils 9000 aus meinem Aktenkoffer ziehen, ohne aus Versehen mehr oder weniger hervorzuholen, und hinterher den Harts raten, immer nur eins von den Bündeln einzuzahlen, um unter dem IRS-Radar zu bleiben, was sie nachträglich noch von meinen guten Absichten überzeugen würde. Ich hatte auch bereits eine Abtretungserklärung dabei. Ich wollte Nägel mit Köpfen machen.
Ich fuhr zur Adresse des Reverends und parkte direkt vor dem Haus. Es war rot und winzig, lag am Ende einer Reihe besserer Holzverschläge, und allein die Gnade Gottes und der Stift des Flughafenplaners hatten es davor bewahrt, mitten auf der Start- und Landebahn 12 des Kennedy-Airports zu stehen, hätte die noch ein paar Meter zusätzlichen Teer gebraucht. Der Anblick der mächtigen 757-Jumbos nur drei Querstraßen weiter und das Aufblitzen der riesigen Airline-Logos in der Sonne, wenn sie direkt hinter dem Flughafenzaun auf die Startbahn bogen und die Triebwerke aufdrehten – der Lärm gab der Szenerie etwas Zermürbendes. So was nannte man dann eine gute Lage. Die Häuser hier gehörten zur untersten Schrottkategorie jedes Immo-Maklers.
Ich ging auf das Haus zu und sah ein Schild über der Tür vorn, auf dem stand: »Der Herr hört deinen Schwachsinn!«
Als ich die angefaulten, ausgetretenen Stufen zur Haustür hinaufstieg, drehte ich mich noch einmal um und sah, dass mein Benz Verehrer gefunden hatte. Einige junge Männer, die, als ich vorgefahren war, noch auf einer Treppe gegenüber gehockt und teuflisch lautem Rap-Getöse aus einem riesigen Gettoblaster gelauscht hatten, waren aufgestanden und schlichen anerkennend nickend auf den Wagen zu. Da ich mir bewusst war, dass ich praktisch die gesamten Ersparnisse meines Lebens in bar dabeihatte, achtete ich nicht weiter auf sie, sondern konzentrierte mich auf die Tür. Ich klopfte laut an.
Einen Moment später öffnete mir eine enorm große Kreatur. Sie maß mindestens eins neunzig und füllte fast die ganze Tür aus. Ich schluckte und nahm an, dass es sich um eine Frau handelte. Sie trug eine Elastanhose, die so eng war, dass man die Jahreszahlen auf den Münzen in ihren Taschen gesehen hätte, wären denn welche darin gewesen, was wohl nicht der Fall war. Ihre Hüften waren breit genug, um von Türstock zu Türstock zu reichen, und ihr Hinterteil schien weit in die gähnende Dunkelheit hinter ihr zu ragen. Sie trug ein Sweatshirt mit der Aufschrift: »Ruhe jetzt! Komm raus, Jesus!« Das kurz geschnittene Haar klebte ihr in ordentlichen kleinen Wellen wie das sich kräuselnde Wasser eines Teiches auf dem Schädel und war blond gefärbt – weshalb ich, wie ich annehme, zunächst Schwierigkeiten hatte, ihr Geschlecht zu erkennen. Im Ganzen bot sie einen beeindruckenden Anblick, denn ihr Gesicht war sanft und angenehm, durchaus anziehend. Sie war eine absolut bizarre Amazone.
»Sehen Sie sich die da an«, sagte sie und nickte über meine Schulter hinweg zu den Jungen mit dem Gettoblaster, die sich meinem Wagen näherten. »Das ist alles, was sie tun. Sich Müll ins Gehirn pumpen. Was wollen Sie, Mister? Sind Sie ein Zeuge Jehovas? Gehen Sie, ich habe keinen Bedarf.«
»Ich bin der Spielzeugsammler.«
»Wer?«
»Der Mann, der wegen des Zuges angerufen hat. Aus Pennsylvania.«
Sie legte den Kopf in den Nacken und fing ungläubig an zu lachen, und bei Gott, so schien sie über zwei Meter groß und ragte hoch über mir auf. Den Kopf lachend erhoben, erlaubte sie mir einen Blick in einen enormen Mund voller blitzend weißer Zähne. Dann sah sie mich erneut an und registrierte meinen Anzug und den silbernen Benz hinter mir, um den sich die Jugendlichen geschart hatten, um durch die getönten Scheiben zu linsen.
»Sie sind den ganzen Weg von Pennsylvania hergefahren? Wegen dem alten Zug?«
»Ja, das bin ich«, sagte ich.
»Sie sind ’n bisschen alt für Spielzeug, oder?«
Sie winkte mich herein. Als wir den Flur hinuntergingen, hörte ich das Fauchen eines Hundes, und plötzlich schoss ein mächtiger Pitbull aus einer Tür auf mich zu. »Buster!«, fuhr die Frau ihn an. Sie tat einen Schritt vor, erwischte ihn beim Halsband, stieß ihn in ein Schlafzimmer und knallte die Tür zu. Der Hund jaulte. Die Frau führte mich nach hinten in die Küche und bedeutete mir mit einer Geste, ich solle mich setzen.
»Sind Sie sicher, dass Sie hier richtig sind, Mister? Sie haben sich nicht irgendwie getäuscht?«
Schreiben Sie es meinem beruflichen Instinkt zu, wenn Sie wollen, aber ich habe die Angewohnheit, einen Menschen mit einem schnellen Blick finanziell einzuschätzen. Es ist fast schon eine Art Ritual, und ich nehme an, meine leicht morbide Neugier rührt von dem Umstand her, dass die meisten meiner Kunden millionenschwer sind, einige Spielzeugsammler jedoch wie Hunde leben. Es geht mich eigentlich nichts an, und Gott weiß, dass viele von ihnen ein besseres Leben als ich haben. Aber nach allem, was ich hier sehen konnte, war der gesamte Besitz der Harts, einschließlich Inneneinrichtung, Möblierung, Hund, dem frisch gepinselten Äußeren des Hauses, die Lage nicht zu vergessen, etwa die Hälfte der 90 000 Dollar wert, die ich in meinem Aktenkoffer herumtrug.
Der Küchentisch, an dem wir saßen, war eine der großen Kabeltrommeln, auf denen Telefongesellschaften ihre Erdkabel transportieren und die sie gelegentlich zurücklassen, wenn die Arbeit getan ist. Um ihn herum standen drei Klappstühle. Die aus Binsen geflochtenen Tischsets waren an den Ecken angefressen. Der Gasherd sah aus wie aus den 1950ern – so was fand man in meiner Ecke von Bucks County in Antiquitätenläden. Er wurde mit Streichhölzern entzündet. An der Decke hing eine nackte Birne und am Ende der Schalterschnur ein in der Dunkelheit fluoreszierendes Kruzifix mit einem aus seinen Wunden blutenden Jesus. Überhaupt fanden sich überall im Raum Bilder von Jesus in den verschiedenen Stadien von Ruhe und Folter: Jesus mit seiner Mutter Maria, Jesus, wie er getreten wurde, Jesus am Kreuz, Jesus mit blutendem Kopf und unter allen möglichen Gräueln leidend.
Die Frau stand vom Tisch auf, ging zum Kühlschrank und holte eine große Auflaufform heraus. »Wollen Sie etwas Süßkartoffelauflauf?«, fragte sie.
»Nein, danke«, sagte ich.
»Scheuen Sie sich nicht«, sagte sie. »Man sollte keine Mahlzeit auslassen.« Sie nahm ein Buttermesser, schnitt ein großes Stück aus der Form und stellte es vor mich hin. »In der Bibel steht, der Mensch soll essen und fröhlich sein. Es sei denn, Sie haben einen Widder in der Hecke«, sagte sie. »Haben Sie einen Widder in der Hecke?«
»Nein, aber ich habe eine Katze.«
Sie sah mich argwöhnisch an. »Das hier ist ein geweihtes Haus«, sagte sie ernst. »Da gibt’s keine Katzen in der Hecke.« Sie sagte das wie eine Art Warnung.
»Entschuldigen Sie. Ich bin gekommen, um mit Ihrem Mann über den Zug zu sprechen.«
»Er ist nicht hier. Er arbeitet.«
»Kommt er bald nach Hause?«
»Das weiß Gott.«
»Wo arbeitet er?«
»Überall.«
»Und für wen arbeitet er?«
Sie sah mich seltsam an. »Er arbeitet für den König der Könige, Mister.«
»Natürlich«, sagte ich.
»Jesus«, sagte sie. »Jesus ist sein Boss. Tragen Sie Jesus in Ihrem Herzen?«
Ich wollte es ihr nicht sagen, aber ich bin ein Jude, der seit vierzehn Jahren nicht im Tempel war, seit dem Tod meiner Mutter nicht. Rosch ha-Schana und Jom Kippur schaffen es manchmal auf meinen Kalender, und alle Jubeljahre auch Chanukka und Pessach. Schawuot und Sukkot sind allerdings problematisch. Ich meine, ich verkaufe Spielzeug. Ich brauche Geld. Wer hat die Zeit für all diese Feste?
Statt also etwas zu sagen, gab ich einfach nach und aß etwas Auflauf, um die Stimmung zu beruhigen. Er schmeckte fürchterlich.
»Ein wunderbarer Auflauf«, sagte ich.
»Danke, Mister.«
»Hat Ihr Mann den Zug vielleicht herausgelegt, dass ich ihn mir ansehen kann?«
»Dieses Ding?«, lachte sie. »Spurgeon überlässt ihn Ihnen gern.«
»Wirklich?«
Sie gluckste. »Männer und ihre Spielzeuge. Aber essen Sie erst mal Ihren Auflauf.« Sie schnitt sich auch ein Stück ab und schlang es herunter, während ich in meinem herumstocherte. Ich bekam das Zeugs kaum herunter.
Meine Augen tränten bei jedem Bissen. Der Auflauf schmeckte wie Brei mit altem Ziegenkäse. Ich aß eine Gabel, und dann noch eine und wischte mir mit meinem Taschentuch über die Augen.
»Spurgeon hat Spielzeug noch nie gemocht«, sagte sie.
»Nun, ich befreie ihn davon. Und ich zahle dafür. Ich möchte ihn wirklich haben. Der Zug ist … Ich glaube, er ist einiges wert.«
»Sparen Sie sich Ihr Geld, Mister. Spurgeon hat kurz nach Ihnen angerufen, und als ich ihm von Ihrem Anruf erzählt habe, sagte er, Sie können ihn haben.«
Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. »Aber ich bin hier, um ihn zu kaufen«, sagte ich. »Will er nicht über den Preis reden?«
»Das interessiert ihn nicht. Warum wollen Sie ihn überhaupt kaufen? Sie haben ihn ja noch nicht mal gesehen.«
»Ich bin ein Spielzeugsammler, und ich zahle eine Menge dafür, wenn es der ist, der ich denke. Ich liebe alte Spielzeuge.«
»Spurge hat gesagt, ich soll ihn Ihnen schenken. Ich kann kein Geld dafür nehmen, wenn er sagt, er schenkt ihn Ihnen.«
»Haben Sie Kinder, Mrs Hart?«, fragte ich.
»Nur eins«, sagte sie. »Junior ist bei der Chorprobe.« Sie ging zum Kühlschrank, holte eine Milch heraus, schenkte etwas davon in ein altes Mayonnaiseglas und stellte es vor mich hin. »Trinken Sie etwas Buttermilch dazu. Dann rutscht der Auflauf besser.«
»Mrs Hart. Ich bringe keinen Bissen mehr herunter. Was den Zug angeht …«
Sie winkte ab. »Aber Sie haben Ihre Buttermilch noch nicht getrunken, die ich extra frisch gemacht habe. Und Ihren Auflauf haben Sie auch noch nicht gegessen. Was soll ich denn jetzt damit machen?«
»Ich kann nicht mehr, Mrs Hart. Das ist ein schöner Auflauf. Ich nehme ihn mit.«
»Dann verdirbt er. Man darf nichts verschwenden. In der Bibel steht, Jesus sagte zu seinen Jüngern: ›Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme!‹ Johannes 6, 12, Sir. Geben Sie her.« Sie zog meinen Teller zu sich heran und machte sich über meinen Auflauf her, nahm auch meine Milch und goss sie sich mit einem beeindruckenden, mächtigen Schluck die Kehle hinunter.
»Wegen des Zuges«, sagte ich zaghaft. »Woher stammt er?«
»Es ist einfach ein altes Spielzeug von seiner Grandma oder so«, antwortete sie zwischen zwei Bissen. »Spurgeon sagt, nehmen Sie ihn. Also nehmen Sie ihn.«
»Ich muss Sie dafür bezahlen.«
»Er hat nicht gesagt, verkauf ihn, sondern, gib ihn ihm. In der Bibel steht: ›Sage nicht zu deinem Nächsten: Geh und komm später wieder, morgen will ich dir etwas geben – wenn du es jetzt vermagst.‹ Sprüche 3, 28, glaube ich.« Damit stand sie wieder auf, langte oben auf den Kühlschrank, holte einen großen Schuhkarton herunter und stellte ihn auf den Tisch.
Wie würden Sie sich fühlen, wenn jemand einen Rembrandt vor Sie hinstellte? Oder wenn diese Person Ihnen die Reichtümer eines alten ägyptischen Pharaos in den Schoß legte, oder Goldbarren aus Maya-Ruinen, seelenruhig, sich hinsetzte und ihren Süßkartoffelauflauf äße, als wären die nur Zentimeter von ihrem Teller entfernten Preziosen nicht mehr als die Krümel und die Buttermilch, die sie in ihrem Schlund verschwinden ließe?
Ich habe die Afroamerikaner immer gemocht. Sie haben einiges mitgemacht, das ist gut dokumentiert. Aber in diesem Moment hätte ich die Frau erwürgen können. Solch eine Respektlosigkeit angesichts eines so wertvollen Gegenstands, einem echten Teil der amerikanischen Geschichte, das war zu viel. Ich wäre vor Wut fast geplatzt.
Doch dann überwältigte mich meine Erregung, und ich wollte sie vor Freude laut herausschreien, als die Frau den Karton mit dem Ellbogen zu mir hinschob, um die Gabel nicht weglegen zu müssen und womöglich etwas von ihrem wunderbaren Süßkartoffelauflauf zu verkleckern.
Ich wandte meine ganze Willenskraft auf, um ruhig die Hand auszustrecken und den Karton zu mir heranzuziehen, ihn zu öffnen und meine Zukunft in Augenschein zu nehmen.
»Könnte ich ein Glas Wasser bekommen?«, fragte ich.
»Klar«, sagte sie.
Ich inspizierte den Zug eine ganze Stunde lang. Er war in perfektem Zustand. Die drei Waggons, der Kohlentender und die Lok. Und das alles, Allmächtiger, in einem alten Thom-McAn-Schuhkarton. Ein paar kleine Teile schienen abgebrochen, hauptsächlich war hier und da etwas Farbe abgeschabt, und am Tender fehlten ein paar winzige Stückchen Leitung, aber das alles war nichts, was einer der großen österreichischen oder belgischen Spielzeugrestaurateure nicht hätte richten oder ersetzen können. Die winzigen Abteile, das Führerhaus, die Geländer der Personenwagen, das alles war außergewöhnlich. Die handwerkliche Ausführung kam mir wie von tausend winzigen, fingerhutgroßen Ingenieuren ausgeführt vor, in jeder Hinsicht perfekt: die Spurweiten, Apparaturen, Schalter, Leitungen, Armaturen, Verschraubungen, bis ins kleinste Detail. Es war die reine Magie. Nicht von dieser Welt. Makellos. Mir wurde ganz schwach bei meiner Inspektion.
»Ich träume«, flüsterte ich.
Sie sah mich verwirrt an. »Es gibt viel zu wenig gesunden Menschenverstand in dieser Welt«, sagte sie und kaute dabei weiter. »Dass eine Seele sich so von einem kleinen Spielzeug beherrschen lässt. Gesegnet sei der Herr.«
Ich hörte sie kaum. Sie war eine Närrin, und ich war verliebt. Ich sah sie nicht, ich sah nur diesen Zug. Ich wollte ihn. Ich musste ihn haben. Mein erster Gedanke war, ihn den beiden mit den 9000er-Bündeln aus meinem Aktenkoffer quasi zu stehlen, notfalls mit den vollen 90 000, denn letztendlich war er viel mehr wert. Aber ich verwarf den Gedanken und beschloss, ihnen das Geld als Anzahlung anzubieten.
»Haben Sie eine Vorstellung davon, was das ist?«, vermochte ich zu krächzen. Meine Stimme brauchte eine volle Minute, um wieder normal zu werden.
»In diesem Haus sind uns Seelen wichtig, Sir. Das Wort Gottes. Spielzeuge zählen nicht. Wollen Sie Ihr Wasser nicht? Sie haben es nicht angerührt. Wir verschwenden in diesem Haus nichts. Wie gefällt Ihnen Ihr Geschenk?«
»Ich kann das nicht als Geschenk annehmen«, sagte ich. »Aber würde Ihr Mann ihn mir verkaufen?«
»Er will kein Geld«, sagte sie. »Spurgeon sagt, schenk ihn ihm. Wie oft müssen Sie das noch hören?«
»Das kann ich nicht annehmen«, sagte ich. »Er ist wertvoll.«
»Sie sind frei, weiß und über einundzwanzig, Mister. Tun Sie, was Sie wollen.«
»Ich bezahle ihn. Ich bestehe darauf. Ich zahle ihm viel dafür.«
Sie sah mich seltsam an. »Was ist mit Ihnen? Der kleine alte Zug ist nichts als ein weltliches Ding, und Spurgeon ist kein weltlicher Mann«, sagte sie stolz. »Er ist ein Mann Gottes. Er hat ein Versprechen gegeben. In der Bibel, Prediger 5, 3 steht: ›Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, zögere nicht, es zu erfüllen! Denn er hat keinen Gefallen an den Toren.‹ Gott steht in Spurgeons Leben an erster Stelle«, erklärte sie. »In meinem auch. Wissen Sie, im kommenden August hat Spurgeon die First Tabernacle Church an der Fulton Avenue in Brooklyn seit sechsundzwanzig Jahren geleitet.«
»Wie schön. Könnte Ihre Kirche nicht etwas Geld brauchen?«
Sie überlegte einen Moment. »Die First Tabernacle schon, denke ich. Die zerfällt langsam. Und wir brauchen einen neuen Transporter. Einen amerikanischen. Aber da müssen Sie mit Spurgeon reden.«
»Nun, ich werde Ihnen genug für einen Transporter zahlen. Und um die Kirche instand zu setzen. Und auch für ein Auto für Ihre Familie«, sagte ich.
»Sie reden Unsinn. Warum sollten wir ein Auto nehmen, wenn die Kirche repariert werden muss?«
»Sie können mit dem Geld machen, was Sie wollen.«
Sie sah mir ins Gesicht. »Reden Sie auf jeden Fall mit Spurgeon. Wir stehen kurz davor, dass sie uns das Telefon abschalten, und Junior braucht ein Paar neue Schuhe, dazu isst er für zwei. Er wächst so schnell, dass ich nicht mehr mitkomme. Mensch, er ist zwölf und bereits größer als ich!«
Angesichts ihrer Ausmaße musste Junior so groß sein, dass sie ihn mit einer Harpune fütterten.
»Lassen Sie mich erklären, was es mit dem Zug auf sich hat«, sagte ich. »Sehen Sie den Tender hier?«
»Mister«, sie wurde langsam ungeduldig, »wenn da nicht Gottes Königreich drinsteckt, bin ich nicht interessiert. Jesus, Mister. Jesus! Lassen Sie Jesus in ihr Herz. Spurgeon wird Sie zu erretten versuchen, wenn Sie ihn treffen. Sind Sie bereits errettet?«
»Errettet?«
»Tragen Sie Jesus in sich, Mister?«
»Nun, ähm. Ich mag ihn … aber können wir nicht über den Zug sprechen? Und den Preis?«
»Es war nett von Ihnen, den ganzen Weg herzukommen. Aber in einer halben Stunde habe ich eine Andacht. Spurgeon hat gesagt, was ich Ihnen sagen soll, und das habe ich. Er sagt, ich soll Ihnen das Ding schenken. Tun Sie, was Sie für das Beste halten.«
»Ich muss mit ihm sprechen. Kann ich ihn heute noch erreichen?«
»Er ist draußen auf Rikers Island und hält eine Gefängnismesse ab.«
Das schien mir etwas gefährlich. Selbst ich gehe nicht überall hin, um über Spielzeug zu reden. »Morgen?«, fragte ich.
»Gebetsstunden von mittags bis sieben.«
»Freitag?«
»Power-Bibelunterricht. Er hat drei Kurse.«
»Samstag?«
»Morgens Kirchen-Bingo, abends die Obdachlosenspeisung. Und dann hat er seinen Hausmeisterjob am Brooklyn College bis zwei Uhr morgens, weil er dafür spart, Junior nach Disney World schicken zu können. Danach kommt sein regulärer Job in der Domino-Zuckerfabrik in Williamsburg, und von da geht er ins Asyl in der Kent Avenue, um mit den Obdachlosen zu arbeiten, bis Mittag. Freitags hat er noch einen dritten Job in einem schrecklichen Club irgendwo in Brooklyn, wo er bis vier Uhr früh die Böden fegt. Aber wie ich sagte, er will Junior ein Ticket für Disney World kaufen.«
»Schläft er nie?«
»Sie schlafen nicht, wenn Sie eine Berufung haben.«
»Was ist mit Samstag vorm Kirchen-Bingo? Das fängt doch nicht schon um acht an, oder?«
»Samstags feiert er morgens um sieben eine Messe im Gefängnis in Newark. Auch in New Jersey brauchen sie Gott.«
»Sonntag?«
Sie sah mich merkwürdig an. »Sonntag ist Kirchentag, Mister.«
»Wie kann ich ihn dann treffen?«
Sie stand vom Tisch auf. »Keine Sorge. Nehmen Sie das Spielzeug. Ich werde ihm sagen, dass Sie hier waren. Wenn Sie uns ein paar Dollar geben wollen, gut, aber Sie müssen’s nicht. Spurgeon hat gesagt, Sie sollen ihn nehmen. Klar und deutlich.«
Ich starrte meinen Aktenkoffer an. Neunzigtausend Dollar und eine Abtretungserklärung, und ich hatte für den Rest meines Lebens ausgesorgt. War ein reicher Mann. Befreit von Bucks County. Kam aus der zugigen umgebauten Scheune mit ihrer lausigen Heizung und den Feldmäusen heraus. Musste nicht länger für dämliche Kunden, die bereit waren, sich für hundert Jahre alte Puppen aus Holz und Porzellan gegenseitig umzubringen, den Professor mimen. War nicht mehr der einzige Jude im Raum, ohne Verbindung zu irgendwas oder irgendwem. Konnte mir einem Tempel suchen, der mir gefiel. Gott, ich würde mir selbst einen bauen können. Auch mit den dazugehörigen Klagen, der schlechten Publicity und noch mehr Klagen (eine Geschichte wie diese lockte mehr Anwälte an als ein Haufen Dung Schmeißfliegen) würde mir der Zug einen angenehmen Lebensabend auf Maui verschaffen. Das war mein Traum. Maui. Ich sah es vor mir. Ich hatte nie gedacht, dass es möglich sein würde.
Trotzdem ertrug ich es nicht. Ich bin ein Händler, ein Geschäftsmann, kein Dieb. Ich wollte einen klaren, sauberen Deal. Im Übrigen war der Reverend der Besitzer des Zuges, nicht seine Frau. Ursprünglich hatte er seiner Großmutter gehört, sagte sie. Ich brauchte diese Geschichte im Hintergrund. Ein Spielzeughändler ist nur so gut wie die Geschichte seiner Spielzeuge. Er braucht sie, um seine Sachen zu verkaufen. Die Geschichte stellt einen guten Teil des Wertes eines Objektes dar. Sie ist wichtig. Die Geschichte verkauft das jeweilige Objekt, und angesichts der Seltenheit dieses Zuges war sie unabdingbar.
»Dann warte ich auf ihn. Hier. Wenn Sie nichts dagegen haben.«
»Das geht nicht«, sagte sie. »Ich muss aus dem Haus, und Sie können hier nicht mit Buster bleiben. Nicht allein. Der Hund ist verrückt. Und wollen Sie, dass Junior von der Chorprobe kommt, einen weißen Mann in einem Anzug am Tisch vorfindet, und niemand hat ihm was erklärt? Er erschreckt sich zu Tode. Wollen Sie das Ding nun mitnehmen oder nicht?«
So groß die Versuchung war, ich durfte mir keinen Fehler erlauben. »Ich kann nicht. Ich brauche das Einverständnis Ihres Mannes schriftlich. Er muss das unterschreiben.«
Sie zuckte mit den Schultern und stand auf. »Wie Sie wollen. Ich bin bereits zu spät dran für die Andacht. Wollen Sie noch etwas Auflauf mitnehmen?«
Ich nickte aus Höflichkeit. Sie packte ein Stück in ein Küchentuch, gab es mir und ging zur Tür. Entsetzt sah ich, dass sie den Zug auf dem Tisch liegen ließ.
Ich versuchte, meinen Unglauben zu verstecken und zirpte: »Mrs Hart. Der Zug … Er sollte nicht auf dem Tisch stehen bleiben.«
»Oh, Sie haben recht«, sagte sie. »Spurgeon ist komisch, was das verflixte Ding angeht.«
Sie nahm den seltensten, wertvollsten Spielzeugzug dieser Welt, ließ ihn zurück in den Schuhkarton fallen, als wäre es alter Trödel, und packte ihn zurück auf den klapprigen Kühlschrank, neben eine Schachtel mit der Aufschrift »Rattengift«.
»Er war früher mal in einer kleinen Holzschachtel«, sagte sie. »Extra dafür gemacht. Ein hübsches kleines Ding. Muss hier auch irgendwo sein. Junior hat sein Lego drin.«
An diesem Punkt musste ich mich ernsthaft zügeln, ihr nicht an die Kehle zu gehen – immer angenommen, ich wäre überhaupt an sie herangekommen – und ihr den Kopf auf den Tisch zu knallen. Spielzeugkästen in gutem Zustand sind oft fast so wertvoll wie das Spielzeug selbst. In diesem Fall würde er, Gott allein konnte es sagen … viele Millionen wert sein.
»Mrs Hart, nur dass Sie es wissen, dieser Zug ist ziemlich viel Geld wert«, wiederholte ich. »Genauer gesagt …«
Sie unterbrach mich und tätschelte mir geduldig die Hand. »Mister, der einzige Zug, der mir was bedeutet, ist der ins Reich Gottes. Jesus, Mister! Kommen Sie zu Jesus! Sie sind noch nicht errettet. Das sehe ich. Aber keine Sorge, Spurgeon bringt das in Ordnung.«
Sie stützte die Hände in die Hüften. Es war Zeit zu gehen.
»Kann ich ihn heute Abend anrufen?«, fragte ich.
»Ich hab Ihnen doch gesagt, dass sie uns das Telefon abschalten. Heute um fünf ist Schluss. Das haben sie so angekündigt, und die kaspern nicht rum. Wir zahlen unsere Rechnung nächste Woche, dann geht’s wieder. Dann ruft er Sie zurück. Keine Sorge.«
»Gibt es nicht doch irgendeine Möglichkeit, ihn vorher zu erreichen?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Also ich denke, Sie könnten rüber zur Domino-Fabrik fahren, wenn Sie wollen«, sagte sie. »Er hat da Nachtschicht.«
»Sind Sie sicher, dass ich ihn da sprechen kann?«
»Warum nicht?«, sagte sie und schob mich zur Tür hinaus auf die Stufen. Ich warf einen Blick zu meinem Auto hinüber, das glücklicherweise unbeschädigt schien.
»Die Schicht beginnt um elf. Bis dann, Mister. Und passen Sie auf sich auf. Hinter einem dummen kleinen Zug herzulaufen. Es wartet ein größerer auf Sie. Der Große Zug, Honey, in die Herrlichkeit. Bereiten Sie sich besser drauf vor.«
Damit schob sie mich die Stufen hinunter und schloss die Tür.
An dem Abend, allein in meinem Zimmer im Hilton an der Sixth Avenue, rief ich zur vorsichtigen Sondierung des Terrains drei meiner wichtigsten Käufer an, unglaublich reiche Leute, die sich rein aus Spaß, Übermut und zur Pflege ihres übergroßen Egos gegenseitig zu überbieten versuchen. Nachdem ich einige Minuten damit verbracht hatte, sie davon zu überzeugen, dass ich keine Witze machte, sondern womöglich bald unter großen Kosten den Under-Graham-Railroad-Zug anzubieten hätte, der einst General Robert E. Lee gehört habe, wurde aus ihrem Lachen und Unglauben zunächst ein erschrockenes Schweigen, das aber bald schon in Überschwang mündete, und am Ende schossen sie Zahlen auf mich ab, erst leise, dann laut herausgeschrien. Es begann mit Millionenbeträgen, die schnell im zweistelligen Bereich landeten. Mir brach der Schweiß aus. Ich sagte, ich werde mich wieder melden, und legte auf.