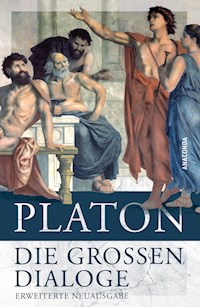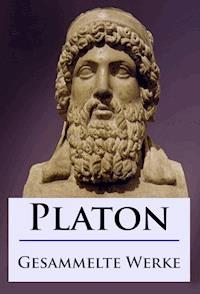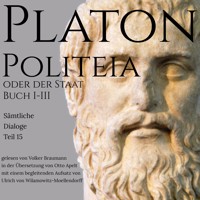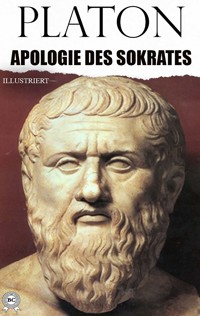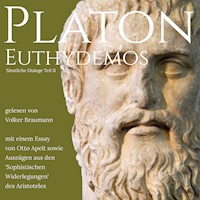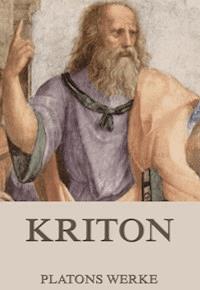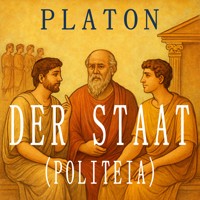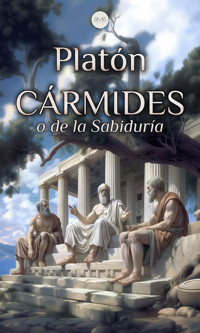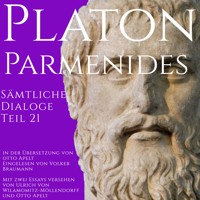10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Platons Politeia ist eine der wirkmächtigsten Schriften der Antike. Wie könnte ein gerechter Staat aussehen? Wie eine gerechte Gesellschaft? Platon entwirft einen Idealstaat, in dem Männer und Frauen der herrschenden Klasse gleichberechtigt sind, es weder Heirat noch Familie gibt, alle Kinder gemeinsam erzogen werden – ohne dass sie ihre Eltern kennen –, niemand etwas besitzt, eine kultivierte Elite über Recht und Ordnung wacht und Philosophen die Geschicke lenken. Einem jeden gehe es nicht um sein persönliches Glück, sondern um das Wohl des Staates: Ideal oder totalitäre Horrorvision? Gernot Krapingers Neuübersetzung und Neukommentierung dieses Dialogs, der u.a. das berühmte Höhlengleichnis enthält, lässt auch den philosophisch nicht vorgebildeten Leser diesen Urtext aller politischen Theorien verstehen. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 768
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Platon
Der Staat
Übersetzt und herausgegeben von Gernot Krapinger
Reclam
Griechischer Originaltitel: Politeía
2017 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2017
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961304-8
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-019512-3
www.reclam.de
Inhalt
[5]Der Staat1
[7]Erstes Buch
(Erzählt wird aus der Perspektive des Sokrates.) 1 [327a] Gestern ging2 ich mit Glaukon3, dem Sohn des Ariston, in den Piräus hinunter, um zur Göttin4 zu beten; zugleich wollte ich mir den Ablauf des Festes anschauen, das man ja jetzt zum ersten Mal feierte. Der Festzug der Einheimischen gefiel mir wirklich gut, nicht weniger aber gefiel mir der, den die Thraker veranstalteten. [b] Nachdem wir unser Gebet verrichtet und die Feier angesehen hatten, wandten wir uns wieder der Stadt zu. Da sah uns nun, wie wir auf dem Heimweg waren, von Weitem Polemarchos5, der Sohn des Kephalos, und befahl seinem Sklaven, uns nachzulaufen und uns aufzufordern, auf ihn zu warten. Der Sklave fasste mich von hinten am Gewand und sprach: »Polemarchos heißt euch, auf ihn zu warten.« Ich wendete mich um und fragte, wo denn sein Herr6 sei. »Dort hinten«, sagte er, »kommt er; wartet nur auf ihn.« »Nun gut, so wollen wir auf ihn warten«, sagte Glaukon.
[c] Und bald darauf kam Polemarchos und mit ihm Adeimantos, Glaukons Bruder, ferner Nikeratos7, des Nikias Sohn, und einige andere, offenbar kamen auch sie gerade vom Festzug her.
Da sagte nun Polemarchos: »Wie mir scheint, Sokrates, seid ihr auf dem Rückweg zur Stadt.«
»Ganz richtig«, sagte ich.
»Siehst du«, sagte er, »wie viele wir sind?«
»Freilich.«
»Entweder, ihr seid stärker als wir oder ihr müsst hierbleiben.«
»Gibt es da nicht noch eine dritte Möglichkeit«, sagte ich, »nämlich dass wir euch überreden, uns gehen zu lassen?«8
»Könntet ihr uns auch überreden«, meinte er, »wenn wir euch nicht zuhören?«
[8]»Gewiss nicht«, erwiderte Glaukon.
»So rechnet damit, dass wir euch nicht zuhören werden.«
[328a] Da sagte Adeimantos: »Ihr wisst womöglich nicht, dass am Abend zu Ehren der Göttin ein Fackellauf zu Pferde stattfinden soll?«
»Zu Pferde?«, sagte ich, »Das ist ja etwas ganz Neues. Sie halten Fackeln in den Händen und reichen sie während des Pferderennens untereinander weiter?9 Oder wie meinst du das?«
»Genau so«, erwiderte Polemarchos, »und außerdem wird es noch eine Nachtfeier geben, die sehenswert ist. Wir wollen also nach dem Abendessen aufbrechen und uns diese Nachtfeier anschauen. Dort werden wir auch mit vielen jungen Leuten zusammenkommen und uns mit ihnen unterhalten.10 Bleibt also [b] und kommt mit uns.«
Da sagte Glaukon: »Ich glaube, wir sollten doch bleiben.«
»Wenn du meinst«, sagte ich, »dann soll es so sein.«
2 Wir gingen also mit Polemarchos nach Hause und trafen dort seine beiden Brüder Lysias und Euthydemos11, ferner auch Thrasymachos aus Chalkedon, Charmantides aus dem Demos Paiania und Kleitophon12, den Sohn des Aristonymos. Im Haus war auch Polemarchos’ Vater Kephalos13. Recht alt schien er mir geworden, hatte ich ihn doch lange Zeit nicht gesehen. [c] Er saß auf einem Stuhl mit Kopfpolster und war noch bekränzt, weil er eben im Hof ein Opfer dargebracht hatte. Wir setzten uns also zu ihm, denn es standen dort einige Stühle im Kreis herum.
Kaum hatte mich Kephalos erblickt, begrüßte er mich und sprach: »Sokrates, du kommst aber auch gar nicht oft zu uns in den Piräus herunter;14 und doch solltest du es. Wäre ich noch kräftig genug, den Weg in die Stadt mühelos zurückzulegen, müsstest du nicht hierherkommen; [d] dann kämen wir zu dir. So aber solltest du öfter hierherkommen. Denn wisse wohl: Je mehr mir sonst die leiblichen Genüsse dahinschwinden, umso [9]größer wird mein Verlangen nach und die Lust an Gesprächen.15 Darum tu uns doch den Gefallen und pflege nicht nur den Umgang mit diesen jungen Leuten16, sondern geh auch hier bei uns ein und aus, wie bei Freunden und guten Bekannten.«
»Auch ich, Kephalos, unterhalte mich gern mit hochbetagten Männern«, entgegnete ich. [e] »Denn ich meine, man sollte sie, die uns gewissermaßen einen Weg vorausgegangen sind, den auch wir vielleicht noch zu gehen haben, fragen, wie dieser Weg ist, rau und beschwerlich oder leicht und bequem.17 Und da du ja schon in dem Alter bist, möchte ich dich gern fragen, was du von dem hältst, was die Dichter ›an der Schwelle des Greisenalters‹18 nennen, ob das der beschwerliche Teil des Lebens ist, oder wie du es sonst bezeichnen möchtest.«
3 [329a] »Beim Zeus, Sokrates«, erwiderte er, »ich will dir sagen, was ich davon halte. Oft treffen wir uns, einige in etwa gleichem Alter, getreu dem alten Sprichwort19. Bei diesen Treffen jammern dann die meisten von uns und sehnen sich zurück nach den Freuden der Jugend;20 sie denken dabei an ihre Liebesabenteuer, ans Zechen und an die Gastmähler und was sonst noch dazugehört, und sind verdrießlich, als hätten sie weiß Gott was verloren; damals hätten sie ein herrliches Leben geführt, heute aber sei das kein Leben mehr. [b] Einige beschweren sich auch über die Kränkungen seitens ihrer Angehörigen wegen ihres hohen Alters und stimmen deshalb ein Klagelied darüber an, welche Leiden das Alter für sie mit sich bringe. Und doch, Sokrates, treffen sie mit ihren Anschuldigungen, wie mir scheint, nicht die eigentliche Ursache. Denn läge es wirklich am Alter, so hätte es ja auch mir und all den anderen in diesem Alter so ergehen müssen. Nun habe ich aber auch andere getroffen, denen es nicht so erging; vor allem war ich einmal mit dem Dichter Sophokles beisammen, als jemand ihn fragte: ›Sophokles, wie [c] steht es bei dir mit der Liebe? [10]Kannst du noch mit einer Frau schlafen?‹ Da sagte jener: ›Gott bewahre,21 Mensch! Ich bin herzlich froh, dass ich davon erlöst bin, wie ein Sklave, der seinem tollen und wilden Herrn entsprungen ist.‹22 Schon damals schien mir das eine treffliche Antwort und heute nicht weniger. Denn diesbezüglich hat man im Alter wenigstens gänzlich Frieden und volle Freiheit. Wenn die Begierden aufhören, heftig zu sein, und nachlassen, dann bewahrheitet sich vollends das Wort des Sophokles: [d] Man ist von gar vielen rasenden Gebietern befreit.23 Aber daran und auch an den Schwierigkeiten mit den Angehörigen ist nur eines schuld, und das ist nicht das Alter, Sokrates, sondern der Charakter der Menschen. Sind sie nämlich maßvoll und zufrieden, dann ist auch das Alter keine schwere Last; andernfalls, Sokrates, ist für einen solchen Menschen das Alter gleich wie die Jugend beschwerlich.«
4 Ich freute mich über seine Worte und wollte [e] von ihm noch Weiteres hören; daher sagte ich, um ihn dazu zu bewegen: »Kephalos, ich glaube, die meisten werden mit dem, was du da sagst, nicht einverstanden sein; sie glauben vielmehr, dass du das Alter nicht wegen deines Charakters so leicht erträgst, sondern weil du im Besitz eines großen Vermögens bist. Denn die Reichen, so sagen sie, können sich über vieles hinwegtrösten.«
»Da hast du recht«, sagte er, »sie sind in der Tat nicht einverstanden. An dem, was sie sagen, ist auch etwas dran, freilich nicht so viel, wie sie glauben. Da ist nun das Wort des Themistokles am Platze: Als ihn jener Mann aus Seriphos schmähte und sagte, [330a] er verdanke seinen guten Ruf nicht sich selbst, sondern seiner Heimatstadt, antwortete er, gewiss wäre er, wenn er aus Seriphos käme, nicht berühmt geworden, jener aber wäre es auch nicht, wenn er Athener wäre.24 Dieser Ausspruch passt auch gut auf Leute, die nicht reich sind und das Alter schwer ertragen; denn weder wird der Vernünftige das [11]Alter in Armut ganz leicht ertragen, noch wird der Unvernünftige, wenn er auch reich ist, mit sich je zufrieden sein.«25
»Hast du, Kephalos«, sagte ich, »den Großteil deines Vermögens geerbt oder hast du es selbst erworben?«
[b] »Was ich erworben habe, Sokrates?«, erwiderte er. »Mit meinem Vermögen halte ich etwa die Mitte zwischen meinem Großvater und meinem Vater. Mein Großvater, der wie ich Kephalos hieß, erbte etwa so viel, wie ich jetzt besitze, und vermehrte seinen Besitz um ein Vielfaches; mein Vater Lysanias verringerte das Vermögen, bis es zuletzt weniger war als heute. Ich aber bin zufrieden, wenn ich meinen Söhnen hier nicht weniger hinterlasse, sondern etwas mehr, als ich geerbt habe.«
»Ich fragte dich deshalb«, sagte ich, »weil ich den Eindruck hatte, dass du keinen [c] besonderen Wert auf Geld legst, das aber tun meistens die, die es nicht selbst erworben haben. Wer es selbst erworben hat, liebt es zweimal mehr als die anderen. Wie die Dichter ihre Werke und wie die Väter ihre Söhne lieben, so kümmern sich die, die ein Vermögen gemacht haben, ernsthaft um dasselbe, weil es ja ihr Werk ist;26 sie tun dies aber auch, wie die anderen, weil es nützlich ist. Daher ist auch der Umgang mit ihnen schwierig, weil sie nichts billigen wollen als den Reichtum.«
»Wie wahr«, entgegnete er.
5[d] »Gewiss«, erwiderte ich, »doch sage mir noch Folgendes: Was, meinst du, ist der größte Vorteil, den du aus deinem großen Reichtum gezogen hast?«
»Wenn ich das sage«, sprach er, »werde ich wohl nicht viele davon überzeugen. Wisse wohl, Sokrates: Wenn man sich dem Tod nahe fühlt, dann beschleichen einen Furcht und Sorge um Dinge, um die man sich früher nicht kümmerte. Bis dahin lacht man über die Mythen vom Hades, die man sich erzählt, dass nämlich, wer hier Unrecht getan hat, dort bestraft [12]werde, [e] jetzt aber quält einem in der Seele, ob sie am Ende nicht doch wahr seien. Ist es nun die Schwäche des Alters oder weil man, der Unterwelt schon näher gekommen, ihr jetzt mehr Aufmerksamkeit schenkt, man wird voll Zweifel und Angst und überlegt hin und her, ob man jemandem Unrecht getan hat. Findet man in seinem Leben viele ungerechte Taten, schreckt man wie die Kinder oft aus dem Schlaf auf, fürchtet sich [331a] und lebt in schlimmen Erwartungen. Wer sich aber keines Unrechts bewusst ist, dem steht stets eine freudige und gute Erwartung zur Seite, die Pflegerin des Alters, wie auch Pindar sagt.27 Denn fürwahr feinsinnig, mein Sokrates, sagte er:
Wer gerecht und fromm sein Leben verbracht hat,
den begleitet die süße Hoffnung,
die herzerfrischende Pflegerin des Alters,
die am meisten der Sterblichen schwankenden
Sinn lenkt.29
Schön sagt er das, ganz wunderbar. Dazu füge ich noch hinzu, dass der Besitz des Geldes sehr wertvoll ist, aber nicht [b] für jedermann, sondern für den Vernünftigen und Ordentlichen. Denn dass man ohne Furcht, jemanden auch nur unabsichtlich betrogen oder belogen zu haben und weder einem Gott ein Opfer noch einem Menschen Geld zu schulden, hinübergehen kann, dazu trägt der Besitz von Geld zum großen Teil bei. Er hat aber auch noch viele andere Vorteile. Jedoch eins gegen das andere aufgerechnet, möchte ich diesen Vorteil, Sokrates, für den größten halten, den der Reichtum einem vernünftigen Menschen bringt.«
[c] »Das hast du sehr schön gesagt, Kephalos«, erwiderte ich. »Doch was nun gerade dies, nämlich die Gerechtigkeit, betrifft, wollen wir behaupten, sie bestehe einfach in der [13]Wahrheit und dass man das, was man von jemandem empfangen hat, wieder zurückgibt, oder ist ein solches Handeln manchmal gerecht, ein andermal aber ungerecht? Ich meine damit beispielsweise: Wenn jemand von einem Freund, der ganz bei Sinnen ist, Waffen empfängt und dieser dann in Wahnsinn verfällt und sie wieder zurückfordert, so wird wohl jeder sagen, dass man sie nicht zurückgeben darf und dass derjenige, der es doch tun wollte, nicht gerecht wäre; auch dürfe man einem Wahnsinnigen gegenüber nicht immer die volle Wahrheit sagen.«30
[d] »Ganz richtig«, sagte er.
»Somit ist das keine Definition der Gerechtigkeit: die Wahrheit zu sagen und zurückzugeben, was man jeweils empfangen hat.«
»O doch, Sokrates«, warf Polemarchos ein, »wenigstens wenn man dem Simonides glauben darf.«
»Ich denke schon«, sagte Kephalos, »und hiermit überlasse ich euch das Gespräch; denn ich muss mich jetzt um die Opfer kümmern.«
»Soll jetzt nicht«, sagte ich, »Polemarchos dich in deiner Rolle beerben?«31
»Gewiss«, antwortete er lachend und ging damit zum Opfer.32
6 [e] »So sage denn du, da du ja sein Gesprächserbe bist«, begann ich, »was, meinst du, sagt Simonides ganz zutreffend über die Gerechtigkeit?«
»Dass es gerecht ist«, sagte er, »jedem zu geben, was man ihm schuldet;33 damit scheint er mir durchaus recht zu haben.«
»Gewiss«, sagte ich, »dem Simonides nicht zu glauben, fällt schwer, ist er doch ein weiser und göttlicher Mann.34 Indessen, was er damit meint, verstehst vielleicht du, Polemarchos, ich jedenfalls nicht. Offenbar meint er nicht, wie wir soeben gesagt haben, jemandem, wenn er von Sinnen ist, ein [14]anvertrautes Gut zurückzugeben, sobald er es verlangt. [332a] Und doch handelt es sich dabei um etwas, das man ihm schuldet. Oder nicht?«
»Ja.«
»Man darf es also keineswegs zurückgeben, wenn der, der es fordert, nicht bei Verstand ist?«
»Richtig«, sagte er.
»Es scheint also Simonides etwas anderes damit zu meinen, wenn er sagt, es sei gerecht zurückzugeben, was man schuldet.«
»Beim Zeus, freilich meint er etwas anderes«, entgegnete er, »er meint nämlich, Freunde seien verpflichtet, ihren Freunden Gutes zu tun, aber niemals Schlechtes.«
»Verstehe«, sagte ich. »Wer etwa Gold anvertraut bekam und es zurückgibt, der stattet keine Schuld ab, wenn Rückgabe [b] und Empfang mit einem Schaden verbunden wären und Empfänger und Geber Freunde sind. Glaubst du nicht, dass Simonides es so meint?«
»Ganz gewiss.«
»Wie nun? Muss man den Feinden geben, was man ihnen schuldet?«
»Was man ihnen schuldig ist, ganz gewiss«, sagte er. »Ein Feind aber schuldet dem Feind, denke ich, was ihm gebührt, nämlich Böses.«
7 »Also sprach Simonides«, entgegnete ich, »über das Wesen der Gerechtigkeit in Rätselworten, wie bei Dichtern üblich. [c] Denn er meinte offenbar, gerecht sei, jedem das ihm Gebührende abzustatten,35 das aber nannte er Schuld.«
»Was meinst du denn sonst?«, fragte er.
»Beim Zeus«, erwiderte ich, »wenn ihn nun einer fragte: Wie ist es nun mit der sogenannten Heilkunst? Wem stattet sie die gebührende Schuld ab und worin besteht diese? Was, glaubst du, würde er uns darauf antworten?«
[15]»Das ist klar«, sagte er, »sie gibt dem Körper Heilmittel, Speise und Trank.«
»Und wie steht’s damit bei der sogenannten Kochkunst?«
[d] »Sie gibt den Speisen den Wohlgeschmack.«
»Gut! Was und wem gibt nun eine Kunst, die man Gerechtigkeit nennt?«
»Wenn man sich an das vorher Gesagte halten soll, Sokrates«, sagte er, »so bringt sie den Freunden Beistand und den Feinden Schaden.«36
»Also den Freunden Gutes und den Feinden Böses tun, nennt er Gerechtigkeit?«
»Ich glaube schon.«
»Wer kann nun am meisten den kranken Freunden Gutes tun und den Feinden Böses im Hinblick auf Krankheit und Gesundheit?«37
»Der Arzt.«
[e] »Und wer den Seefahrern, was die Gefahren des Meeres betrifft?«
»Der Steuermann.«
»Wie ist’s nun mit dem Gerechten? Bei welcher Handlung und zu welchem Werk kann er am meisten den Freunden nützen und den Feinden schaden?«
»Im Krieg und beim Waffenbündnis, glaube ich.«
»Gut. Für Gesunde, mein lieber Polemarchos, ist doch der Arzt überflüssig.«
»Allerdings.«
»Und für die, die nicht zur See fahren, der Steuermann.«
»Ja.«
»Also ist auch für Menschen, die nicht Krieg führen, der Gerechte überflüssig?«
»Das glaube ich keineswegs.«
»Dann ist die Gerechtigkeit auch im Frieden nützlich?«
[333a] »Gewiss.«
[16]»Und auch der Ackerbau; oder nicht?«
»Ja.«
»Und zwar, um Feldfrüchte zu gewinnen?«
»Ja.«
»Und auch das Schusterhandwerk?«
»Ja.«
»Um Schuhe zu erwerben, wirst du vermutlich sagen?«
»Sicher.«
»Wie nun? Wozu braucht man im Frieden die Gerechtigkeit und wozu ist sie deiner Meinung nach nützlich?«
»Zum Verkehr miteinander38.«
»Mit Verkehr miteinander meinst du das, was man gemeinsam tut, oder?«
»Natürlich.«
[b] »Ist also der Gerechte ein guter und nützlicher Genosse beim Setzen der Steine beim Brettspiel39 oder ist das nicht vielmehr der geübte Brettspieler?«
»Natürlich ein geübter Brettspieler.«
»Oder beim Setzen von Ziegeln und Bausteinen, ist da der Gerechte ein nützlicherer und besserer Genosse als der Baumeister?«
»Gewiss nicht.«
»Aber für welches Gemeinschaftswerk ist nun der Gerechte in der Weise ein besserer Genosse als der Baumeister oder Zitherspieler, wie etwa umgekehrt Letzterer die Zither besser schlägt als der Gerechte?«
»Beim Geldverkehr, glaube ich.«
»Ausgenommen vielleicht, Polemarchos, beim Gebrauch des Geldes zum gemeinsamen Kauf oder Verkauf eines Pferdes. Da ist, [c] wie ich meine, der Pferdekenner besser, nicht wahr?«
»Offenbar.«
»Und wenn es um ein Schiff geht, der Schiffsbauer oder der Steuermann?«
[17]»Es scheint so.«
»Bei welchem gemeinsamen Gebrauch von Gold oder Silber sollte nun der Gerechte nützlicher sein als alle anderen?«
»Wenn man es hinterlegen und sicherstellen will, Sokrates.«
»Meinst du damit, wenn man es nicht zu verwenden braucht, sondern einfach liegen lässt?«
»Allerdings.«
»Wenn man also das Geld nicht braucht, dann braucht man dafür [d] die Gerechtigkeit?«
»Es scheint so.«
»Und wenn man ein Rebmesser aufbewahren soll, dann ist die Gerechtigkeit von Nutzen, sowohl für die Öffentlichkeit als auch für den privaten Bereich. Sobald man es aber verwendet, dann ist die Kunst des Winzers nützlich?«
»Offenbar.«
»Willst du also sagen, wenn es darum geht, einen Schild und eine Leier aufzubewahren und nicht zu gebrauchen, ist die Gerechtigkeit nützlich, sobald man aber von ihnen Gebrauch macht, die Waffenkunde und die Musik?«
»Genauso ist es.«
»Ist es auch in allen anderen Bereichen so, dass die Gerechtigkeit beim Gebrauch eines jeden unnütz ist, beim Nichtgebrauch aber nützlich?«
»Es scheint so.«
8 [e] »Dann wäre also, mein Freund, die Gerechtigkeit nicht gar so erstrebenswert, wenn sie nur fürs Nichtgebrauchen nützlich ist. Wir wollen aber noch Folgendes in Betracht ziehen: Kann sich nicht im Kampf, sei es nun im Faustkampf oder auch in irgendeinem anderen, der am besten verteidigen, der am kräftigsten zuschlägt?«
»Sicher.«
»Und wer es versteht, sich vor einer Krankheit zu schützen, [18]ist der nicht am ehesten imstande, andere heimlich anzustecken?«
»Ich denke schon.«
[334a] »Ein guter Beschützer seines Heeres ist doch wohl der, der heimlich ausspioniert, was die Feinde planen und tun?«
»Ja.«
»Wo einer ein tüchtiger Beschützer ist, dort ist er auch ein tüchtiger Dieb.«
»Es scheint so.«
»Wenn also der Gerechte geschickt ist, das Geld zu bewahren, dann ist er auch geschickt, es zu stehlen.«
»Das zeigt wenigstens unsere Untersuchung«, sagte er.
»Also hat sich, wie es scheint, der Gerechte als Dieb entpuppt. Offenbar hast du das bei Homer gelernt. Denn auch er [b] hat für Autolykos40, den Großvater des Odysseus mütterlicherseits, eine Vorliebe und sagt, er habe sich in der Kunst des Stehlens und beim Wortbruch unter allen Menschen hervorgetan. Es scheint also die Gerechtigkeit nach dir, nach Homer und nach Simonides eine Art Kunst des Stehlens zu sein, allerdings zum Nutzen der Freunde und zum Schaden der Feinde. Meintest du es nicht so?«
»Beim Zeus, nein!«, sagte er. »Doch ich weiß gar nicht mehr, was ich gemeint habe. Eines jedoch meine ich immer noch: dass die Gerechtigkeit den Freunden nützt, den Feinden aber schadet.«
[c] »Verstehst du unter Freunden diejenigen, die ein jeder für brauchbar hält, oder jene, die es wirklich sind, auch wenn sie nicht als solche gelten? Und ebenso auch bei den Feinden?«
»Natürlich«, sagte er, »liebt man die, die man für brauchbar hält, und hasst die, die man für schlecht hält.«
»Täuschen sich die Menschen aber nicht darin, dass sie viele für brauchbar halten, die es aber gar nicht sind, und umgekehrt?«
»Allerdings.«
[19]»Sind dann diesen die Guten verhasst, die Schlechten aber lieb?«
»Ja.«
»Ist es gleichwohl dann für sie gerecht, den Schlechten [d] zu nützen, den Guten aber zu schaden?«
»Offenbar.«
»Aber gute Menschen sind doch gerecht und nicht imstande, Unrecht zu tun?«
»Richtig.«
»Und doch ist es nach deinen Worten gerecht, Menschen, die kein Unrecht begangen haben, schlecht zu behandeln.«
»Keineswegs, Sokrates«, sagte er. »Diese Überlegung ist offensichtlich falsch.«
»Also ist es gerecht«, sagte ich, »die Ungerechten zu schädigen, den Gerechten aber zu nützen.«
»Das ist offenbar besser als vorhin.«
»Dann, Polemarchos, ergibt sich für viele, nämlich für alle, die sich in den Menschen getäuscht haben, [e] dass es für sie gerecht ist, den Freunden41 zu schaden – denn in Wahrheit sind sie ja schlecht für sie –, den Feinden aber zu nützen – denn tatsächlich sind sie ja gut. Somit behaupten wir gerade das Gegenteil von dem, was unserer Meinung nach Simonides sagt.«
»Gewiss«, sagte er, »das ergibt sich daraus. Aber wir wollen anders herum beginnen, denn wie es scheint, haben wir die Begriffe Freund und Feind nicht richtig gefasst.«
»Inwiefern, Polemarchos?«
»Wenn wir den, der uns brauchbar erscheint, für unseren Freund hielten.«
»Und wie wollen wir’s jetzt angehen?«, fragte ich.
»Freund ist derjenige«, sagte er, »der uns brauchbar erscheint und es auch tatsächlich ist; [335a] wer uns aber nur so erscheint, ohne es tatsächlich zu sein, erscheint nur als Freund, ist es aber nicht. Entsprechendes gilt auch für den Feind.«
[20]»Danach wäre also der Freund der Gute, Feind aber der Schlechte.«
»Ja.«
»Du verlangst also, dass wir unserer ersten Behauptung über das Gerechte, gerecht sei, den Freunden Gutes zu tun, den Feinden aber Schlechtes, noch etwas hinzufügen. Müssten wir jetzt außerdem noch sagen: Gerecht ist es, dem Freund, wenn er gut ist, Gutes zu tun, und dem Feind, wenn er schlecht ist, zu schaden?«
[b] »Jawohl«, entgegnete er, »so scheint es mir nun ganz richtig.«
9 »Darf aber wirklich«, fragte ich, »ein gerechter Mann auch nur irgendeinem Menschen schaden?«
»Gewiss«, sagte er, »den schlechten Menschen und Feinden muss er schaden.«
»Wenn man Pferden Schaden zufügt, werden sie dann besser oder schlechter?«
»Schlechter.«
»Verlieren sie dann ihre Tüchtigkeit42 als Pferd oder etwa eine Tüchtigkeit, wie sie Hunden zukommt?«
»Natürlich ihre Tüchtigkeit als Pferd.«
»Also werden auch Hunde, wenn man ihnen Schaden zufügt, in ihrer Tüchtigkeit als Hunde schlechter und nicht in der als Pferde?«
»Notwendigerweise.«
[c] »Also, mein Freund, müssen wir nicht auch sagen, auch die Menschen werden in ihrer menschlichen Tüchtigkeit schlechter, wenn sie geschädigt werden?«
»Gewiss.«
»Ist die Gerechtigkeit nicht eine menschliche Tüchtigkeit?«
»Auch das ist unbestritten.«
»Also müssen auch Menschen, mein Freund, ungerechter werden, wenn sie geschädigt werden.«
[21]»So scheint es.«
»Können nun Musiker durch ihre Musik andere unmusikalisch machen?«
»Unmöglich.«
»Oder Reiter durch ihre Reitkunst andere zu schlechten Reitern?«
»Nein.«
»Können aber die Gerechten durch ihre Gerechtigkeit andere zu Ungerechten machen? Oder können, [d] kurz gesagt, Gute mit ihrer Tüchtigkeit andere schlecht machen?«
»Nein, auch das ist nicht möglich.«
»Denn ich meine, die Aufgabe der Wärme ist es nicht, zu kühlen, vielmehr ist das die Aufgabe ihres Gegenteils.«
»Ja.«
»Trockenheit benetzt nicht, sondern ihr Gegenteil.«
»Gewiss.«
»Ebenso wenig schädigt das Gute, sondern das Gegenteil davon.«
»Offenbar.«
»Der Gerechte ist aber doch gut?«
»Freilich.«
»Also ist es nicht die Aufgabe des Gerechten, zu schaden, mein Polemarchos, weder einem Freund noch sonst jemandem, sondern die seines Gegenteils, nämlich des Ungerechten.«
»Damit hast du, wie mir scheint, völlig recht, Sokrates«, sagte er.
[e] »Wenn also jemand sagt, jedem das Schuldige zu geben, sei gerecht, und wenn er damit meint, der Gerechte schulde seinen Feinden Schaden, seinen Freunden aber Nutzen,43 dann war der, der so sprach, nicht weise. Denn er hat nicht die Wahrheit gesagt. Uns ist nämlich klar geworden, dass der Gerechte niemals jemandem Schaden zufügt.«44
[22]»Da stimme ich dir zu«, sagte er.
»Also wollen wir«, sagte ich, »gemeinsam, du und ich, dagegen ankämpfen, wenn einer sagt, Simonides oder Bias oder Pittakos45 oder auch sonst einer von den weisen und seligen Männern habe so etwas behauptet.«
»Ich bin jedenfalls bereit, mich am Kampf zu beteiligen«, sagte er.
[336a] »Aber weißt du«, sagte ich, »von wem meiner Meinung nach dieser Ausspruch stammt, dass es gerecht sei, den Freunden zu nützen und den Feinden zu schaden?«
»Von wem denn?«, fragte er.
»Ich glaube, er stammt von Periander oder von Perdikkas, von Xerxes oder Ismenias aus Theben46 oder sonst einem reichen Mann, der sich viel auf seine Macht einbildet.«47
»Ganz richtig«, entgegnete er.
»Nun gut«, sagte ich. »Da nun klar geworden ist, dass das nicht die Gerechtigkeit noch das Gerechte ist, was könnte es dann wohl sein?«
10 [b] Schon während wir redeten, hatte Thrasymachos mehrmals den Versuch unternommen, das Wort zu ergreifen, war aber von den Umsitzenden daran gehindert worden, weil diese unser Gespräch bis zum Ende verfolgen wollten. Als wir aber eine Pause machten und ich das gesagt hatte, konnte er nicht mehr an sich halten, sondern duckte sich wie ein Raubtier und ging auf uns los, als wollte er uns zerreißen.48
Polemarchos und ich fuhren erschreckt auseinander; er aber schrie mitten hinein in die Runde: »In welches Geschwätz habt ihr euch da so lange verstrickt, Sokrates? [c] Und wie einfältig und unterwürfig redet ihr da miteinander?49 Wenn du wirklich wissen willst, was das Wesen des Gerechten ist, dann stelle nicht nur immer Fragen50 und setze deinen Ehrgeiz nicht darein, die Antworten, die man gibt, zu widerlegen; du weißt ja wohl, dass Fragen leichter ist als Antworten; also antworte [23]auch selbst einmal und sag uns deine eigene Meinung über das Gerechte. Aber komme mir ja nicht mit der Antwort, das Gerechte sei das, [d] was nötig ist, oder was nützt, einträglich, ersprießlich oder zuträglich ist, sondern sage klar und deutlich, was du meinst, denn ein derartiges Geschwätz werde ich von dir nicht mehr hinnehmen.«
Als ich das hörte, erschrak ich und erbebte bei seinem Anblick, und ich glaube, wenn ich ihn nicht früher angesehen hätte, als er mich, es hätte mir die Rede verschlagen.51 Nun aber hatte ich ihn, gleich als ihn wegen unseres Gesprächs die Wut zu packen begann, zuerst fest angesehen, [e] so dass ich imstande war, ihm zu antworten, und, noch ein wenig zitternd, sagte: »Thrasymachos, sei uns nicht böse! Wenn ich und dieser da52 bei unserer Untersuchung etwa Fehler gemacht haben, so wisse wohl, es war nicht absichtlich.53 Wenn wir nach Gold suchten, so würden wir doch bei der Suche niemals freiwillig unterwürfig einander nachgeben und das Auffinden des Goldes aufs Spiel setzen; glaube also ja nicht, dass wir bei der Suche nach der Gerechtigkeit, einer Sache, die ja viel kostbarer ist als alles Gold, so unvernünftig einander nachgeben und uns nicht ernstlich darum bemühen, sie ans Licht zu holen. Davon kannst du überzeugt sein, mein Freund. Doch ich fürchte, wir sind dazu nicht imstande. Ihr Klugen solltet [337a] vielmehr Mitleid mit uns haben als uns zu schelten.«
11 Bei diesen Worten lachte Thrasymachos höhnisch und antwortete: »Beim Herakles, das ist wieder die berühmte Ironie des Sokrates.54 Ich wusste es ja gleich und habe es diesen Männern hier vorausgesagt: Du würdest nicht antworten wollen, sondern in deiner Ironie alles eher tun, als antworten, wenn einer dich fragt.«
»Du bist doch ein kluger Mann, Thrasymachos«, entgegnete ich. »Du wusstest es ja ganz genau: Wenn du jemand fragtest, wie viel zwölf sei, und ihm zugleich mit der Frage im Voraus [24]sagtest: [b] ›Mensch, sage mir nur ja nicht, zwölf ist zweimal sechs oder dreimal vier oder sechsmal zwei oder viermal drei, weil ich es nicht hinnehmen werde, wenn du so daherschwätzt‹, dann war dir wohl, glaube ich, von Anfang an klar, dass du auf eine solche Frage keine Antwort bekommst. Aber wenn man dir nun sagte: ›Thrasymachos, wie meinst du das? Ich darf keine der von dir vorher genannten Antworten geben? Auch nicht, wenn eine davon richtig ist, du wunderlicher Mensch, sondern soll etwas anderes sagen [c] als die Wahrheit? Oder wie meinst du das?‹ Was würdest du ihm darauf antworten?«
»Lass gut sein!«, sagte er. »Als ob das eine mit dem anderen zu vergleichen wäre.«
»Das macht nichts«, sagte ich. »Auch wenn es nicht damit zu vergleichen ist, es dem Gefragten aber so erscheint, glaubst du, er wird deshalb weniger offen seine Meinung äußern, ob wir es ihm nun verbieten oder nicht?«
»Also wirst du es auch so machen«, sagte er, »und wirst eine von den Antworten geben, die ich verboten habe?«
»Darüber würde ich mich nicht wundern«, antwortete ich, »wenn es sich nach reiflicher Überlegung als richtig erweist.«
[d] »Wie nun«, fuhr er fort, »wenn ich eine andere Antwort auf die Frage nach der Gerechtigkeit geben kann, die besser ist als all die bisherigen? Was soll dann mit dir geschehen?«55
»Nichts anderes, als was einem Unwissenden zukommt«, sagte ich, »nämlich vom Wissenden zu lernen. Das also soll auch mit mir geschehen.«
»Das ist ja ganz reizend von dir«, entgegnete er, »aber fürs Lernen musst du auch bezahlen.«
»Ja, wenn ich Geld habe«, sagte ich.
»Das hast du doch«, sagte Glaukon. »Wenn es ums Geld geht, dann sag es nur, Thrasymachos! Wir alle werden es schon für Sokrates aufbringen.«56
[e] »Das glaube ich wohl«, erwiderte er, »damit Sokrates wie [25]gewohnt fortfahren kann: selbst nicht antworten, die Antwort eines anderen aufgreifen und widerlegen.«
»Wie sollte denn, mein Bester«, sagte ich, »jemand antworten, der erstens selbst nichts weiß und auch nicht behauptet, etwas zu wissen, und zweitens, wenn er eine Vermutung hat, diese nicht aussprechen darf, weil es ihm ein nicht geringer Mann verbietet? Da solltest schon eher du [338a] reden, denn du behauptest ja, du wüsstest es und könntest es auch sagen. Rede also und antworte mir zuliebe und ziere dich nicht, diesen Glaukon hier und die anderen zu belehren.«
12 Auf meine Worte hin baten ihn auch Glaukon und die anderen, er möge doch sprechen. Es war offensichtlich, dass Thrasymachos geradezu begierig war zu sprechen, um Beifall zu ernten, glaubte er doch, eine großartige Antwort zu haben. Er tat aber so, als bestünde er darauf, dass ich antworte. Schließlich gab er nach und sagte [b] dann: »Darin also besteht die Weisheit des Sokrates: Er selbst will nicht lehren; er will nur herumgehen und von den anderen lernen, ohne dafür Dank abzustatten.«
»Dass ich von den anderen lerne«, sagte ich, »damit hast du recht, Thrasymachos; dass ich aber dafür keinen Dank abstatte, darin täuscht du dich. Denn ich statte meinen Dank ab, so gut ich nur kann. Ich kann aber nur loben, denn Geld habe ich keines. Wie gerne ich aber lobe, wenn mir einer gut zu reden scheint, wirst du sogleich erfahren, wenn du antwortest. Denn ich glaube, du wirst gut sprechen.«
[c] »So höre denn«, sagte er. »Ich behaupte, das Gerechte ist nichts anderes als der Vorteil des Stärkeren.57 Nun, wo bleibt dein Lob? Du willst mich nicht loben.«
»Ich muss erst verstehen, was du meinst«, entgegnete ich. »Noch weiß ich es nicht. Du sagst also, das Gerechte sei der Vorteil des Stärkeren. Was meinst du damit, Thrasymachos? Du willst doch wohl nicht Folgendes sagen: Wenn der Ringer [26]Pulydamas58 stärker ist als wir und wenn ihm für seinen Körper das Rindfleisch von Vorteil ist,59 dann ist diese [d] Speise auch für uns, die wir schwächer sind, vorteilhaft und damit gerecht?«
»Du bist wirklich unausstehlich, Sokrates«, sagte er. »Du legst meine Antwort so aus, wie du sie am besten verdrehen kannst.«
»Keineswegs, mein Bester«, sagte ich. »Doch sage deutlicher, was du meinst.«
»Weißt du nicht«, fuhr er fort, »dass von den Staaten die einen von Tyrannen regiert werden, während die anderen eine demokratische und wieder andere ein aristokratische Verfassung haben?«60
»Doch, natürlich!«
»Hat nicht in jedem Staat das, was regiert, die Macht inne?«
»Freilich.«
[e] »Jede Regierung erlässt die Gesetze zu ihrem eigenen Vorteil, die Demokratie demokratische, die Tyrannis tyrannische und so weiter.61 Indem sie das tun, erklären sie das für sie Vorteilhafte zum Gerechten für die Untertanen und bestrafen jeden, der sich dagegen vergeht, als Gesetzesbrecher und als einen, der Unrecht tut. Das ist es also, mein Bester, von dem ich behaupte, es gelte in allen [339a] Staaten gleicherweise als gerecht, nämlich der Vorteil der bestehenden Regierung. Diese ist an der Macht, so dass bei richtiger Überlegung daraus folgt, dass überall das Recht dasselbe ist, nämlich der Vorteil des Stärkeren.«
»Jetzt habe ich erst verstanden, was du meinst«, sagte ich. »Ob es aber richtig ist oder nicht, das will ich noch versuchen in Erfahrung zu bringen. Das Vorteilhafte ist also, nach deiner Aussage, Thrasymachos, gerecht – gleichwohl hast du mir eine solche Antwort verboten. Allerdings machtest du den Zusatz: vorteilhaft ›für den Stärkeren‹.«
[27][b] »Das ist vielleicht nur ein unbedeutender Zusatz«, sagte er.
»Noch ist nicht klar, ob er nicht bedeutend ist. Klar ist nur, dass man prüfen muss, ob du recht hast. Da auch ich dir zugebe, dass das Gerechte etwas Vorteilhaftes ist, du aber noch hinzufügst ›für den Stärkeren‹, was ich aber nicht verstehe, muss man auch das noch untersuchen.«
»Untersuche es nur«, sagte er.
13 »Das soll geschehen«, entgegnete ich. »Doch sage mir: Ist deiner Meinung nach auch Gehorsam gegenüber den Herrschenden gerecht?«
»Gewiss.«
[c] »Sind nun die Herrschenden in den Staaten unfehlbar oder können sie auch Fehler machen?«
»Sie können durchaus auch Fehler machen«, sagte er.
»Und bei der Gesetzgebung, erlassen sie da teils richtige Gesetze, teils nicht richtige?«
»Ich glaube schon.«
»Bedeutet richtig, wenn die Gesetze, die sie erlassen, für sie selbst vorteilhaft sind, nicht richtig aber, wenn sie unvorteilhaft sind? Oder wie meinst du das?«
»Genau so.«
»Was sie als Gesetz erlassen, müssen die Untertanen befolgen, und das ist dann das Gerechte?«
»Natürlich!«
[d] »Also ist es deiner Meinung nach nicht nur gerecht, das für den Mächtigeren Vorteilhafte zu tun, sondern auch das Gegenteil, das nicht Vorteilhafte.«
»Was behauptest du da?«, fragte er.
»Was auch du sagst, glaube ich. Doch überlegen wir es genauer: Sind wir uns nicht darüber einig, dass die Herrschenden, wenn sie ihren Untertanen befehlen, alles Mögliche zu tun, bisweilen ihr eigenes Bestes verfehlen, dass es aber für die [28]Untertanen gerecht ist, die Befehle der Herrschenden auszuführen? Darüber sind wir uns doch einig?«
»Ich glaube schon«, sagte er.
[e] »So glaube auch«, fuhr ich fort, »dass du damit zugegeben hast, es sei gerecht, etwas zu tun, was für die Herrschenden und Stärkeren von Nachteil ist, wenn diese nämlich unfreiwillig etwas befehlen, was für sie selbst schlecht ist, es aber für die Untertanen, wie du sagst, gerecht ist, ihre Befehle auszuführen. Ergibt sich daraus, mein weisester Thrasymachos, nicht zwangsläufig, dass es gerecht ist, das Gegenteil von dem zu tun, was du sagst? Denn den Schwächeren wird ja befohlen, das zu tun, was dem Stärkeren nicht vorteilhaft ist.«
[340a] »Beim Zeus, Sokrates«, sagte Polemarchos, »das ist vollkommen klar.«
»Zumal auch du es ihm bezeugst«, warf Kleitophon ein.
»Wozu bedarf es eines Zeugen?«, erwiderte jener. »Thrasymachos gibt ja selber zu, dass die Herrschenden bisweilen etwas befehlen, was für sie selbst schlecht ist, dass es aber für die Untertanen gerecht sei, diese Befehle auszuführen.«
»Den Befehlen der Herrschenden zu folgen, Polemarchos, das, behauptete Thrasymachos, sei eben gerecht.«
»Und ebenso behauptete er, mein Kleitophon, gerecht sei, was dem Mächtigeren zum Vorteil gereiche. [b] Nach diesen beiden Behauptungen gab er ferner zu, dass die Mächtigeren mitunter den Schwächeren und Untergebenen etwas befehlen, was für sie selbst nachteilig ist, und diese es ausführen. Aus diesen Zugeständnissen aber folgt, dass der Vorteil des Mächtigeren ebenso gerecht ist wie ihr Nachteil.«
»Aber«, entgegnete Kleitophon, »unter dem Vorteil des Mächtigeren verstand er doch, was dieser für sich selbst für vorteilhaft halte; das müsse der Schwächere tun, und das erklärte er zum Gerechten.«
»Davon war aber nicht die Rede«, erwiderte Polemarchos.
[29][c] »Das macht nichts, mein Polemarchos«, sagte ich; »wenn Thrasymachos es jetzt so meint, wollen wir es auch so gelten lassen.
14 Aber sage mir, Thrasymachos: Wolltest du den vermeintlichen Vorteil des Mächtigeren als gerecht bezeichnen, egal ob es nun tatsächlich ein Vorteil für ihn ist oder nicht? Sollen wir dich so verstehen?«
»Keineswegs!«, antwortete er. »Glaubst du denn, ich bezeichne einen, der sich irrt, als den Stärkeren, gerade wenn er sich irrt?«
»Ich freilich«, sagte ich, »glaubte schon, dass du es so meinst, weil du ja zugegeben hast, die Herrschenden seien nicht unfehlbar, sondern könnten sich auch irren.«
[d] »Im Gespräch bist du ein übler Verleumder62, Sokrates«, erwiderte er. »Denn um gleich ein Beispiel anzuführen, nennst du den einen Arzt, der sich bei den Kranken irrt, und zwar gerade deshalb, weil er sich irrt? Oder jenen, der sich beim Rechnen irrt, gerade dann einen Mathematiker, wenn er sich irrt und wegen seines Irrtums? Nein, ich glaube, wir sagen nur so leichthin, der Arzt habe sich geirrt, der Mathematiker, der Lehrer habe sich geirrt. Insofern aber ein jeder von ihnen das ist, [e] als was wir ihn bezeichnen, irrt er, glaube ich, nie. Genau genommen – und du nimmst es ja immer genau – irrt kein Fachmann. Wo ihn sein Wissen im Stich lässt, dort irrt der Irrende auf einem Gebiet, wo er eben kein Fachmann mehr ist. Kein Fachmann, kein Philosoph, kein Herrscher irrt, wenn er seiner Sache mächtig ist63, aber jedermann sagt, der Arzt habe sich geirrt, der Herrscher habe sich geirrt. Fasse also meine Antwort in diesem Sinne auf: Genau genommen ist es so: [341a] Insofern er tatsächlich Herrscher ist, irrt der Herrscher nicht; da er nicht irrt, erlässt er das für ihn Beste als Gesetz und der Untertan muss dieses befolgen. Somit ist es für mich, wie ich von Anfang an sagte, gerecht, den Vorteil des Mächtigeren auszuführen.«
[30]15 »Nun gut, Thrasymachos«, sagte ich. »Du meinst, ich sei ein übler Verleumder?«
»Durchaus«, erwiderte er.
»Du glaubst also, ich habe meine Frage absichtlich so gestellt, um dich damit reinzulegen?«
»Da bin ich mir ganz sicher«, sagte er. »Doch das wird dir nicht gelingen. [b] Ob es mir nun entgeht oder nicht, dass du mich reinlegen willst, du kannst mich in der Rede nicht übertreffen.«
»Das würde ich auch nicht versuchen, mein Bester«, erwiderte ich. »Doch damit es uns nicht wieder so geht, bestimme genau, ob du unter dem Herrscher und Stärkeren jenen verstehst, den man landläufig so bezeichnet, oder den im genauen Sinn des Wortes, wie du gerade sagtest, nämlich den, zu dessen Vorteil, als des Stärkeren, zu handeln für den Schwächeren gerecht ist.«
»Ich meine den Herrschenden im genauesten Sinn des Wortes«, sagte er. »Dagegen wende nun deine verleumderische Bosheit an, wenn du kannst. Du hast freie Hand. Aber du wirst nichts ausrichten.«
[c] »Hältst du mich für so verrückt, dass ich einen Löwen scheren64 und einen Thrasymachos überlisten will?«
»Eben hast du es noch versucht«, entgegnete er, »aber auch darin bist du nur ein Nichts.«
»Genug davon!«, sagte ich. Sage mir lieber: Ist der Arzt im genauen Sinn des Wortes, von dem du eben sprachst, ein Geschäftsmann oder ein Therapeut der Kranken? Sprich aber von dem wirklichen Arzt.«
»Ein Therapeut der Kranken«, antwortete er.
»Und was ist mit dem Steuermann? Ist der wahre Steuermann der Gebieter über die Seeleute oder ein einfacher Seemann?«
»Der Gebieter über die Seeleute.«65
[31][d] »Es kommt, glaube ich, nicht darauf an, dass er gerade in einem Schiff fährt, und man darf ihn deshalb66 nicht einen einfachen Seemann nennen; denn nicht weil er zur See fährt, wird er Steuermann genannt, sondern wegen seiner Kunst und weil er das Kommando über die Seeleute hat.«
»Richtig«, sagte er.
»Also gibt es für jeden von ihnen etwas Vorteilhaftes?«
»Gewiss.«
»Und ist nicht ihre Kunst«, fragte ich, »dazu da, jedem seinen Vorteil zu suchen und zu verschaffen?«
»Ja, dazu ist sie da«, erwiderte er.
»Gibt es nun für jede Kunst noch etwas anderes, das für sie vorteilhaft ist, außer dass sie möglichst vollendet ist?«
[e] »Was soll diese Frage?«
»Wenn du mich etwa fragtest, ob es dem Körper genüge, Körper zu sein, oder ob er noch etwas brauche, würde ich antworten: ›Natürlich braucht er noch etwas. Deswegen ist ja auch die moderne67 Heilkunst erfunden worden, weil der Körper mangelhaft ist und sich selbst nicht genügt. Um ihm das zu verschaffen, was ihm nützlich ist, dazu wurde die Heilkunst geschaffen.‹ Habe ich deiner Meinung nach damit recht oder nicht?«, fragte ich.
»Du hast recht«, sagte er.
[342a] »Aber nun weiter: Ist die Heilkunst an sich mangelhaft oder braucht überhaupt irgendeine andere Kunst noch eine weitere Tüchtigkeit – wie etwa die Augen die Sehkraft, die Ohren das Gehör – und ist daher bei ihnen noch eine weitere Kunst erforderlich, welche das, was für ihre Zwecke zuträglich ist, ausforscht und verschafft? Wohnt denn der Kunst an sich eine Art Mangel inne und bedarf sie einer anderen Kunst, die für sie untersucht, was vorteilhaft ist, und diese wieder bedarf einer weiteren und so fort bis ins Unendliche? [b] Oder sucht sich jede selbst das für sie Vorteilhafte? Oder aber bedarf sie [32]weder ihrer selbst noch einer anderen Kunst, um herauszufinden, was gegen ihren Mangel von Vorteil ist, denn keiner Kunst haftet irgendein Mangel oder Fehler an? Und kommt es keiner Kunst zu, für etwas anderes den Vorteil zu suchen als für ihren eigenen Gegenstand? Sie ist doch selbst als richtige Kunst ohne Mangel und Fehler, solange nur jede ganz genau sie selbst ist? Überlege das in jenem68 genauen Wortsinn. Ist es nicht so?«
»Offenbar ist es so«, erwiderte er.
[c] »Also sucht die Heilkunst«, sagte ich, »nicht ihren eigenen Vorteil, sondern den für den Körper.«
»Ja«, sagte er.
»Und ebenso die Kunst der Pferdehaltung den Vorteil für die Pferde. Überhaupt sucht keine Kunst ihren eigenen Vorteil – denn sie bedarf ja weiter nichts –, sondern den für den Gegenstand, dessen Kunst sie ist.«
»So scheint es«, sagte er.
»Die Künste, Thrasymachos, herrschen und regieren also jeweils über den Gegenstand, dessen Kunst sie sind.«
Dem stimmte er, wenn auch widerwillig, zu.
»Somit sucht und befiehlt keine Wissenschaft den Vorteil des Stärkeren, sondern den des Schwächeren und [d] ihr Untergebenen.«
Auch dem stimmte er schließlich zu, versuchte aber noch, es zu bestreiten. Als er dann nachgegeben hatte, sagte ich: »Kein Arzt also, sofern er Arzt ist, sucht seinen Vorteil und verordnet ihn, sondern den des Kranken? Wir waren uns ja einig, dass der Arzt im strengen Sinne Gebieter der Körper ist und kein Geschäftsmann. Oder nicht?«
Das gab er zu.
»Und auch, dass der Steuermann im strengen Sinne Kommandant der Seeleute ist, und nicht ein einfacher Seemann?«
[e] »Zugegeben.«
»Ein solcher Steuermann und Kommandant wird also nicht [33]den eigenen Vorteil im Auge haben und ihn anordnen, sondern was für den einfachen Seemann und Untergebenen vorteilhaft ist.«
Nur ungern gab er das zu.
»Nicht wahr, Thrasymachos«, sagte ich, »auch kein anderer in irgendeiner Machtposition wird, soweit er ein wirklicher Herrscher ist, seinen eigenen Vorteil suchen und anordnen, sondern den des Untergebenen und dessen, für den er seinen Beruf ausübt; und im Hinblick darauf und auf das, was für diesen zuträglich und angemessen ist, redet er alles, was er redet, und tut alles, was er tut.«
16 [343a] Als wir nun in unserem Gespräch hier angelangt waren und es allen klar war, dass sich der Satz über das Gerechte in sein Gegenteil verkehrt hatte, stellte Thrasymachos eine Frage, statt zu antworten: »Sage mir, Sokrates, hast du eine Amme?«
»Wieso?«, sagte ich. »Solltest du nicht lieber antworten, als solche Fragen stellen?«
»Weil sie nicht sieht, dass dir die Nase läuft, und dich nicht schnäuzt, obwohl du es nötig hättest, da du ihr Schafe und Hirten nicht unterscheiden kannst.«
»Wieso denn das?«, fragte ich.
[b] »Weil du glaubst, die Schaf- und Rinderhirten schauen nur auf das Wohl ihrer Schafe und Rinder und mästen und pflegen sie mit Hinblick auf etwas anderes als auf den Vorteil ihrer Herren und ihren eigenen; und ebenso glaubst du auch, die Herrscher in den Staaten, und zwar die wahren Herrscher, würden an ihre Untergebenen irgendwie anders denken als ein Hirte an seine Schafe69 und sie wären Tag und Nacht auf etwas anderes bedacht als auf ihren eigenen Nutzen. [c] Und so bist du in der Frage nach Recht und Gerechtigkeit, nach Unrecht und Ungerechtigkeit so weit vom Ziel entfernt, dass du nicht weißt: Gerechtigkeit und das Gerechte kommen in Wahrheit [34]dem anderen zugute, als Vorteil des Stärkeren und Herrschers, aber zum eigenen Schaden des Gehorchenden und Dienenden; umgekehrt die Ungerechtigkeit: Sie herrscht über die wahrhaft Einfältigen und Gerechten; vom Stärkeren beherrscht, tun sie, was diesem nützt, und machen ihn durch ihre Dienstbarkeit glücklich, [d] sich selbst aber ganz und gar nicht. So muss man also die Sache betrachten, mein einfältiger Sokrates, weil ein gerechter Mann in allem dem Ungerechten unterlegen ist. Einmal im gegenseitigen Geschäftsverkehr: Wo solche Menschen eine Geschäftsverbindung eingehen, wirst du bei der Auflösung derselben nirgends feststellen können, dass der Gerechte gegenüber dem Ungerechten einen Vorteil davonträgt, sondern im Gegenteil. Sodann im öffentlichen Leben: Wenn es sich um irgendwelche Steuern handelt, dann zahlt der Gerechte vom gleichen Vermögen mehr, der andere aber weniger; wenn es um staatliche Zuschüsse geht, [e] dann erhält der eine nichts, der andere hingegen viel. Und wenn beide irgendein Amt bekleiden, dann wird der Gerechte, wenn er schon keinen anderen Schaden erleidet, so doch wegen der Vernachlässigung seiner Privatangelegenheiten in Schwierigkeiten geraten;70 der Staatsdienst bringt ihm wegen seiner Gerechtigkeit keinen Gewinn; dazu macht er sich noch bei Freunden und Bekannten unbeliebt, wenn er ihnen nicht widerrechtlich etwas zukommen lassen will. Beim Ungerechten ist es in alledem gerade umgekehrt. Ich meine damit [344a] den, von dem ich eben gesprochen habe, der imstande ist, sich große Vorteile zu verschaffen.71 Ihn musst du im Auge behalten, wenn du beurteilen willst, um wie viel vorteilhafter es für ihn persönlich ist, ungerecht zu sein als gerecht. Am allerleichtesten aber wirst du es begreifen, wenn du die vollkommenste Ungerechtigkeit hernimmst72, die den, der Unrecht begangen hat, zum glücklichsten, doch den, der Unrecht erleidet und selbst es nicht einmal begehen will, zum unseligsten Menschen macht.73 Das [35]ist der Fall bei der Tyrannis, die fremdes Gut, ob es nun heilig oder profan, privat oder öffentlich ist, nicht verstohlen und Stück für Stück, sondern mit offener Gewalt und alles auf einmal an sich reißt. [b] Wenn sonst jemand auch nur bei einem einzelnen dieser Vergehen ertappt wird, wird er bestraft und sieht sich höchster Schande ausgesetzt; denn man nennt diejenigen Tempelräuber, Sklavenhändler, Einbrecher, Räuber und Diebe, welche auch nur eine dieser Untaten begehen; wer aber seinen Mitbürgern nicht nur den Besitz, sondern auch seine Freiheit raubt und sie zu Sklaven macht, der wird nicht mit derlei Schimpfnamen bedacht, sondern glücklich und selig gepriesen, [c] und zwar nicht nur von seinen Mitbürgern, sondern auch von allen anderen, die von seinem ganzen Unrecht Kenntnis haben.74 Man schmäht die Ungerechtigkeit ja nicht aus Furcht, Unrecht zu tun, sondern aus Furcht, Unrecht zu erleiden. So ist also, Sokrates, die Ungerechtigkeit, wenn sie nur groß genug ist, stärker, edler und mächtiger als die Gerechtigkeit; und wie ich anfangs sagte, der Vorteil des Mächtigeren ist das Gerechte, das Ungerechte aber ist das, was sich selbst nützt und vorteilhaft ist.«
17 [d] Nach diesen Worten wollte Thrasymachos weggehen, nachdem er uns wie ein Bademeister seinen gewaltigen Redeschwall über die Ohren gegossen hatte.75 Doch die Anwesenden ließen ihn nicht fort, sondern nötigten ihn zu bleiben und Rede und Antwort zu stehen. Auch ich bat ihn inständig und sprach: »Unseliger Thrasymachos, welche Rede hast du uns da hingeworfen und beabsichtigst jetzt fortzugehen, ehe du uns hinlänglich gezeigt oder dich selbst vergewissert hast, ob es sich wirklich so oder doch anders [e] verhält? Oder glaubst du, es handle sich um eine geringe Sache, die du da zu bestimmen suchst, und nicht vielmehr um ein ganzes Lebensprinzip, das einem jeden von uns, wenn er sich nur daran hält, das gewinnbringendste Leben verschaffen könnte?«
[36]»Ja bin ich denn anderer Meinung darüber?«, sprach Thrasymachos.
»Es scheint so«, sagte ich. »Denn fürwahr, um uns kümmerst und sorgst du dich nicht, ob wir schlechter oder besser leben, wenn wir deine Worte nicht verstehen. Sei doch so gut, mein Bester, und erkläre sie uns. [345a] Es wird dein Schaden nicht sein,76 wenn du uns, die wir doch so zahlreich sind, diesen Gefallen erweist. Was mich betrifft, so sage ich dir jedenfalls, ich bin weder davon überzeugt, noch glaube ich daran, dass die Ungerechtigkeit mehr Gewinn bringt als die Gerechtigkeit, selbst dann nicht, wenn man sie gewähren ließe und sie nicht daran hinderte zu tun, was sie will. Nein, mein Bester, mag einer ungerecht sein, mag er imstande sein, im Geheimen oder ganz offen Unrecht zu tun, gleichwohl wird er mich nicht davon überzeugen, dass das mehr Gewinn bringt als die Gerechtigkeit. Und so [b] empfindet es vielleicht auch manch anderer unter uns, nicht nur ich alleine. Überzeuge uns also, mein Bester, dass wir uns im Irrtum befinden, wenn wir die Gerechtigkeit höher schätzen als die Ungerechtigkeit.«
»Und wie soll ich dich überzeugen?«, fragte er. »Wenn du durch meine bisherigen Worte nicht überzeugt bist, was soll ich da noch mit dir machen? Soll ich dir etwa meine Lehre in die Seele eintrichtern?«77
»Nein, beim Zeus«, antwortete ich, »nur das nicht! Aber fürs Erste bleibe bei dem, was du gesagt hast, oder wenn du es abändern willst, dann tue es offen und täusche uns nicht. Du siehst doch, Thrasymachos [c] – und damit wollen wir noch einmal auf unsere früheren Überlegungen zurückkommen –, wie du zuerst den wahren Arzt definiert hast, es dann aber nicht mehr für nötig hieltst, dich beim wahren Hirten an diese genaue Bestimmung zu halten; vielmehr glaubtest du, er mäste als wahrer Hirte die Schafe nicht im Hinblick auf das Beste für die Schafe, sondern wie einer, der eine Mahlzeit halten und [37]einen Festschmaus geben will, oder im Hinblick auf einen guten Verkauf, [d] wie ein Geschäftsmann und nicht wie ein Hirte. Die Tätigkeit des Hirten hat doch nur die eine Aufgabe, nämlich für das, was ihr anvertraut ist, aufs Beste zu sorgen. Denn für ihr eigenes Wohl, dafür ist ja hinreichend gesorgt, solange sie es an ihrer ureigensten Bestimmung nicht fehlen lässt; und so war ich nun der Meinung, wir müssten uns darin einig sein, dass jede Regierung, sofern sie eine Regierung ist, einzig und alleine das Beste für den Beherrschten und für den ihrer Sorge Anvertrauten im Auge hat, und zwar im öffentlichen wie im privaten Leben. [e] Glaubst du, die Herrscher in den Staaten, die wahrhaften Herrscher, üben ihr Amt freiwillig aus?«
»Beim Zeus«, sagte er, »das glaube ich nicht nur, das weiß ich.«
18 »Wie nun, Thrasymachos«, sagte ich, »denkst du nicht an die anderen Ämter, die niemand freiwillig übernehmen will?78 Da fordern sie noch einen Lohn,79 weil aus ihrer Amtsausübung nicht sie selbst, sondern die Untergebenen einen Nutzen ziehen. [346a] Sag mir noch Folgendes: Behaupten wir nicht, dass sich jede einzelne Kunst von der anderen dadurch unterscheidet, dass sie ein besonderes Vermögen hat? Antworte nicht gegen deine Überzeugung, mein Bester, sonst kommen wir nicht weiter.«
»Ja, darin liegt ihr Unterschied«, erwiderte er.
»Und jede Kunst bietet uns einen besonderen, nicht etwa einen allen Künsten gemeinsamen Nutzen, so etwa die Heilkunst die Gesundheit, die Kunst des Steuermanns die Sicherheit bei der Seefahrt, und so auch die anderen?«
»Gewiss.«
[b] »Und die Erwerbskunst den Lohn? Denn das ist ja ihr Vermögen. Oder bezeichnest du die Heilkunst und die Kunst des Steuermannes als ein und dieselbe Kunst? Oder bezeichnest du, wenn du, wie du dir ja vorgenommen hast, ganz [38]genau sein willst, wenn einer als Steuermann gesund wird, weil ihm die Seefahrt gut bekommt, deshalb seine Kunst als Heilkunst?«
»Nein«, sagte er.
»Ebenso wenig, glaube ich, die Erwerbskunst, wenn einer beim Lohnerwerb gesund wird.«
»Auch nicht.«
»Wie nun? Nennst du die Heilkunst eine Erwerbskunst, wenn einer durch Heilen Geld verdient?«
[c] »Nein«, sagte er.
»Sind wir uns also darin einig, dass jede einzelne Kunst ihren besonderen Nutzen hat.«
»Meinetwegen«, entgegnete er.
»Den Nutzen, den alle Handwerker gemeinsam haben, haben sie offenbar davon, dass sie gemeinsam zusätzlich dazu noch etwas in Anwendung bringen.«
»So scheint es«, sagte er.
»Wir stellen also fest, dass der Lohn, den die Handwerker erwerben, daher rührt, dass sie zusätzlich noch die Kunst des Gelderwerbs anwenden.«
Dem stimmte er, wenn auch ungern, zu.
[d] »Demnach hat ein jeder diesen Nutzen, nämlich den Empfang des Lohnes, nicht von seiner eigentlichen Kunst, sondern genau genommen schafft die Heilkunst die Gesundheit, die Erwerbskunst den Lohn und die Baukunst das Haus, die mit ihr verbundene Erwerbskunst aber den Lohn; ebenso vollbringen auch alle anderen Künste ihr jeweils eigenes Werk und bringen den Nutzen, für den sie bestimmt sind. Wenn aber kein Lohn damit verbunden ist, hat dann der Handwerker einen Nutzen von seiner Kunst?«
»Offensichtlich nicht«, erwiderte er.
[e] »Schafft er dann keinen Nutzen, wenn er unentgeltlich arbeitet?«
[39]»Ich glaube doch.«
»Dann ist jetzt also klar, Thrasymachos, dass keine Kunst, keine Regentschaft ihren eigenen Nutzen schafft, sondern, wie wir ja schon früher gesagt haben, sie schafft und gebietet, was für den Untergebenen vorteilhaft ist, indem sie den Vorteil des Schwächeren im Auge hat und nicht den des Stärkeren. Deshalb, mein lieber Thrasymachos, sagte ich soeben, niemand wolle freiwillig ein Amt ausüben und sich mit der Behebung der Missstände anderer Leute befassen; [347a] vielmehr verlange er dafür einen Lohn; denn wer nach seiner Kunst richtig handeln will, handelt und befiehlt nie zu seinem eigenen Besten, wenn er seiner Kunst gemäß befiehlt, sondern zum Vorteil des Untergebenen. Aus diesem Grund muss es, wie ich glaube, für alle, die ein Amt übernehmen sollen, einen Lohn geben, sei es Geld oder Ehre oder auch eine Strafe, wenn einer nicht will.«
19 »Wie meinst du das, Sokrates?«, fragte Glaukon. »Die beiden Arten des Lohnes verstehe ich; was du aber mit Strafe meinst und wieso du sie in einem Atemzug mit dem Lohn genannt hast, das habe ich nicht begriffen.«
»Dann verstehst du also den Lohn der Besten nicht, um dessentwillen [b] die angesehensten Männer ein Amt ausüben, wenn sie dazu bereit sind. Oder weißt du nicht, dass Ehrgeiz und Geldgier als Schande gelten und es auch sind?«
»Doch, das weiß ich sehr wohl«, sagte er.
»Daher wollen die Guten weder des Geldes noch der Ehre wegen ein Amt ausüben. Denn sie wollen weder, wenn sie offen wegen ihres Amtes einen Lohn erhalten, Lohnarbeiter genannt werden, noch Diebe, wenn sie sich in ihrem Amt heimlich bereichern. Aber auch der Ehre wegen wollen sie es nicht machen; denn sie sind nicht ehrgeizig. Es muss also [c] bei ihnen ein Zwang und eine Strafe hinzukommen, wenn sie mit der Übernahme eines Amtes zögern. Daher gilt es offenbar als Schande, freiwillig ein Amt anzutreten und nicht darauf zu [40]warten, dass man dazu genötigt wird. Die größte Strafe aber ist es, von einem Schlechteren regiert zu werden, wenn man selbst nicht herrschen will. Aus Furcht davor, glaube ich, übernehmen die angesehenen Männer, wenn sie regieren, ein Amt, und dann gehen sie ans Regieren, nicht weil sie dabei etwas Gutes oder Annehmlichkeiten erwarten, sondern [d] weil es notwendig ist, da sie das Amt keinem übertragen können, der besser wäre als sie oder zumindest gleichwertig. Wenn es einen Staat von lauter guten Männern gäbe, so wäre dort das Nicht-Regieren genauso umstritten wie jetzt das Regieren; und dann würde sich klar zeigen, dass in der Tat der wahre Herrscher nicht dazu da ist, um auf seinen eigenen Vorteil zu schauen, sondern auf den des Untergebenen. Jeder Vernünftige würde es daher vorziehen, von einem anderen einen Vorteil zu erlangen, statt sich zu bemühen, einem anderen einen Vorteil zu verschaffen. Darin stimme ich [e] dem Thrasymachos niemals zu, dass das Gerechte der Vorteil des Stärkeren sei. Das aber wollen wir ein andermal80 untersuchen. Viel wichtiger scheint mir, was Thrasymachos jetzt behauptet; er sagt nämlich, das Leben des Ungerechten sei besser als das des Gerechten. Wofür entscheidest du dich, Glaukon?«, fragte ich. »Welche Behauptung hältst du für richtiger?«
»Ich für meinen Teil halte das Leben des Gerechten für gewinnbringender.«
[348a] »Du hast doch gehört«, sagte ich, »wie viele positive Seiten im Leben des Ungerechten Thrasymachos eben aufgezählt hat?«
»Ich hörte es«, sagte er, »aber es überzeugt mich nicht.«
»Willst du, dass wir ihn davon überzeugen, dass er nicht recht hat, falls uns das irgendwie gelingt?«
»Natürlich will ich das«, sagte er.
»Wenn wir nun«, fuhr ich fort, »seinen Argumenten unsere gegenüberstellen und ihm sagen, wie viele Vorteile das [41]Gerechtsein hat, und wir dann abwechselnd unsere Gründe dafür vorbringen, dann werden wir zählen und messen müssen, [b] wie viele Vorteile jeder in seiner Rede anführt, und um das zu entscheiden, werden wir etliche Richter brauchen. Wenn wir aber wie früher bei unseren Überlegungen zu einer Übereinstimmung kommen, dann sind wir selbst zugleich Richter und Anwalt.«
»Ja, gewiss«, sagte er.
»Welche Methode ist dir also lieber?«, fragte ich.
»Die zweitere«, sagte er.81
20 »Nun denn, Thrasymachos«, fuhr ich fort, »antworte uns noch einmal von Anfang an. Du behauptest also, die vollendete Ungerechtigkeit sei gewinnbringender als die vollendete Gerechtigkeit?«
[c] »Ja, das behaupte ich«, sagte er; »ich habe auch gesagt, warum.«
»Wie denkst du nun darüber? Nennst du die eine Tugend, die andere aber Laster?«
»Natürlich.«
»Die Gerechtigkeit also Tugend, die Ungerechtigkeit Laster?«
»Ja natürlich, mein Bester«, sagte er, »wo ich doch der Meinung bin, die Ungerechtigkeit sei nützlich, die Gerechtigkeit aber nicht.«
»Was also?«
»Gerade umgekehrt«, sagte er.
»Die Gerechtigkeit ist also ein Laster?«
»Nein, aber eine gutmütige Einfalt.«
[d] »Die Ungerechtigkeit nennst du dann also Böswilligkeit?«
»Nein, sondern Klugheit«, sagte er.
»Dann hältst du also, mein Thrasymachos, die Ungerechten für klug und gut?«
»Wenigstens die, die imstande sind, vollkommen Unrecht [42]zu tun, und sich Staaten und Völker unterwerfen können. Du glaubst vielleicht, ich rede da von Beutelschneidern. Auch das hat seinen Nutzen«, sagte er, »wenn man dabei nicht erwischt wird. Aber das ist nicht der Rede wert, wohl aber jenes, was ich soeben gemeint habe.«
[e] »Ich verstehe schon, was du sagen willst«, erwiderte ich, »aber ich wundere mich, wenn du die Ungerechtigkeit auf die Seite der Tugend und Weisheit stellst, die Gerechtigkeit aber auf die Gegenseite.«
»Allerdings, das tue ich.«
»Das ist schon recht stark, mein Freund«, sagte ich, »und es ist nicht leicht, was man dazu sagen soll. Denn hättest du nur behauptet, die Ungerechtigkeit sei nützlich, aber – wie das andere auch tun – zugegeben, dass sie ein Laster und etwas Schimpfliches ist, dann wüssten wir gemäß der allgemeinen Meinung einiges darauf zu antworten. Nun aber willst du offenbar behaupten, sie sei etwas Schönes und Starkes, und willst ihr all das zuschreiben, [349a] was wir dem Gerechten zuschreiben, da du es sogar gewagt hast, sie zur Tugend und Weisheit zu rechnen.«
»Deine Vermutung ist ganz richtig«, sagte er.
»Und doch darf man nicht zögern«, sagte ich, »deine Behauptung genau zu prüfen, solange ich annehmen darf, dass du sagst, was du wirklich denkst. Denn ich habe den Eindruck, dass du jetzt durchaus nicht scherzt, sondern sagst, was du in Wahrheit meinst.«
»Was macht es dir denn aus«, entgegnete er, »ob es meine wahre Meinung ist oder nicht, und was widerlegst du nicht einfach meine Behauptung?«82
[b] »Es macht mir gar nichts aus«, fuhr ich fort. »Doch versuche mir noch auf Folgendes eine Antwort zu geben: Glaubst du, der Gerechte will einen anderen Gerechten irgendwie übertreffen?«
[43]»Sicher nicht«, sagte er, »sonst wäre er ja nicht so vornehm und einfältig, wie er nun ist.«
»Wie ist es nun bei gerechten Handlungen, möchte er ihn da übertreffen?«
»Auch da nicht«, erwiderte er.
»Aber dem Ungerechten möchte er überlegen sein und hält dies für gerecht oder nicht?«
»Ja, das würde er für gerecht halten, und er möchte es auch sein, aber er wäre dazu nicht imstande«, sagte er.
»Danach frage ich dich nicht«, fuhr ich fort, »sondern ob [c] der Gerechte den Gerechten nicht zu übertreffen verlangt und es auch gar nicht will, wohl aber den Ungerechten?«
»So ist es«, sagte er.
»Wie steht es nun mit dem Ungerechten? Möchte er den Gerechten übertreffen und bei gerechten Handlungen überlegen sein?«
»Natürlich«, entgegnete er, »möchte er doch in allem überlegen sein.«
»Also wird der Ungerechte auch den Ungerechten und das ungerechte Handeln überbieten und wird danach streben, von allem das meiste zu bekommen.«
»So ist es.«
21 »Wir können also sagen«, fuhr ich fort, »der Gerechte will nicht seinesgleichen übertreffen, sondern nur den Ungleichartigen, der Ungerechte aber beide.«
[d] »Sehr richtig«, erwiderte er.