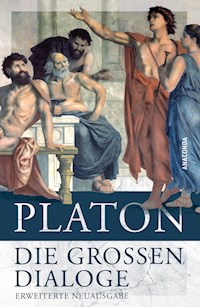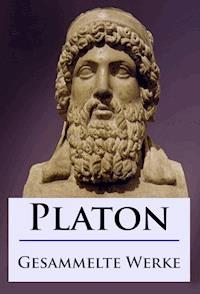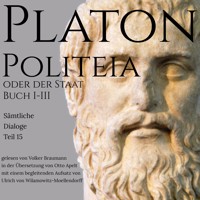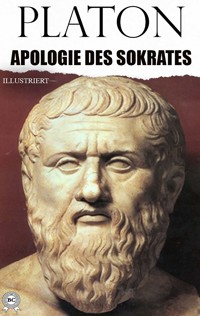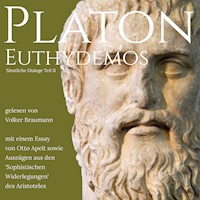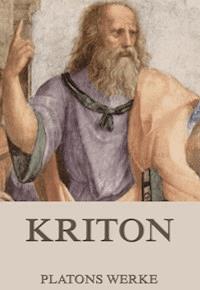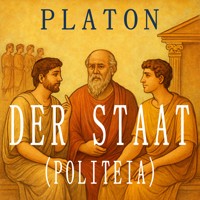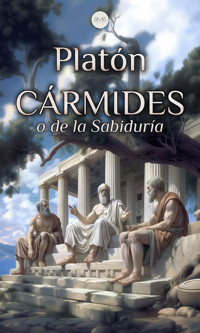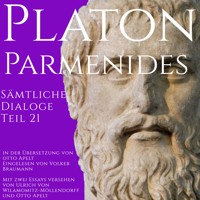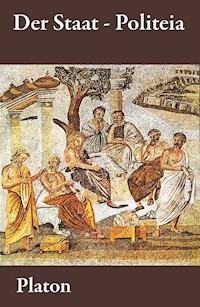
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Der Staat - Politeia" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Die Politeia (griechisch Politeía "Staat"), verfasst um 370 v. Chr., ist ein berühmter Dialog Platons. Sie gehört zu den am stärksten rezipierten Werken in der Geschichte der politischen Philosophie sowie der Philosophie überhaupt. Zentrales Thema der Politeia ist die Frage nach Gerechtigkeit. Die auftretenden Figuren sind Sokrates, der Greis Kephalos, dessen Sohn Polemarchos, der Sophist Thrasymachos sowie Platons Brüder Glaukon und Adeimantos. Platons Staatslehre wurde bereits von seinem Schüler Aristoteles kritisiert. In neuerer Zeit kritisierte sie vor allem Karl Popper. Popper meint, der "ideale Staat" Platons sei ein totalitär ausgerichtetes Gemeinwesen, denn Platon spreche sich in seiner Politeia explizit für Eugenik, Auslese und Kommunismus aus. Dieser Kritik wiederum wird entgegengebracht, dass sie Populismus sei und man in historischen Werken die Umstände ihrer Zeit berücksichtigend betrachten müsste. Platon (428/427 v. Chr. - 348/347 v. Chr.) war ein antiker griechischer Philosoph. Er war ein Schüler des Sokrates, dessen Denken und Methode er in vielen seiner Werke schilderte. Die Vielseitigkeit seiner Begabungen und die Originalität seiner wegweisenden Leistungen als Denker und Schriftsteller machten Platon zu einer der bekanntesten und einflussreichsten Persönlichkeiten der Geistesgeschichte. In der Metaphysik und Erkenntnistheorie, in der Ethik, Anthropologie, Staatstheorie, Kosmologie, Kunsttheorie und Sprachphilosophie setzte er Maßstäbe auch für diejenigen, die ihm - wie sein Schüler Aristoteles - in zentralen Fragen widersprachen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Der Staat - Politeia
Inhalt
Personen des Gesprächs
Inhalt
Sokrates (erzählend), Glaukon, Polemarchos, Thrasymachos, Adeimantos, KephalosVon den Personen des Gespräches ist, um von Sokrates abzusehen, Thrasymachos jener bekannte Sophist aus Chalcedon, welcher die Grundsätze der Sophistik auf die Theorie des Rechtes und des Staates anwendete (s. m. Uebers. d. gr. Phil. S. 48). Den Glaukon trafen wir schon als eine der Personen des »Gastmahles« (s. dort m. Anm. 1); weder ihn aber noch seinen Bruder Adeimantos kennen wir näher, insoferne beide wohl schwerlich für die gleichnamigen Brüder Plato’s zu halten sind, sondern einer älteren Generation anzugehören scheinen. Polemarchos wird auch im »Phädrus« erwähnt (s. dort m. Anm. 5S); er ist der ältere Bruder des Redners Lysias (s. über diesen m. Anm. 2 z. Phädr.), und Kephalos, der Vater dieser beiden, hatte ursprünglich gleichfalls als Redner in Syrakus gelebt, war aber zur Zeit des Perikles nach Athen übergesiedelt..
Uebersicht des Inhaltes.
Ueber die Stelle, welche dieser Dialog in dem Gesammtzusammenhange der platonischen Schriften einnimmt, s. m. Uebers. d. griech. Phil. S. 75, und über den Inhalt desselben im Allgemeinen ebend. S. 100 ff. Der Zweck des ganzen Dialoges ist die erschöpfende Darlegung der Gerechtigkeit, insoferne dieselbe in ihrer Verbindung mit Weisheit das wahre Princip des äußeren Menschen-Lebens in seiner höchsten Gestaltung, nemlich im Staate, ist, und es darf der öfters geführte Streit, ob der Inhalt dieser Bücher in einer Darstellung des Staates oder in einer Entwicklung der Idee der Gerechtigkeit bestehe, dahin geschlichtet werden, daß es sich in der That um das Zusammentreffen der Gerechtigkeit und des Wesens des Staates handle und somit keines dieser beiden allein den hauptsächlichen Kern der ganzen Untersuchung ausmache.
Die hervortretenden Hauptgruppen der gesammten Entwicklung sind folgendeDie schon aus dem Alterthume überlieferte Eintheilung des ganzen Werkes in zehn Bücher ist eine rein äußerliche und daher häufig in schroffem Widerspruche gegen die durch den inneren Zusammenhang gebotenen Abschnitte; sie entstand dadurch, daß man die Einleitung, welche als solche deutlich in die Augen springt und von Plato selbst so bezeichnet wird, als erstes Buch abtrennte, und den Rest schlechthin der Masse nach, d. h. gleichsam der Seitenzahl nach, in Abschnitte zerlegte, welche an Umfang dem ersten Buche gleich waren; auf diese Weise ergaben sich neun solche Abschnitte, und also im ganzen zehn Bücher.. Nach einer Einleitung, welche die äußere Veranlassung des Gespräches und eine vorläufige Wegräumung anderweitiger und namentlich der sophistischen Ansichten über die Gerechtigkeit und das staatliche Leben enthält (B. I), werden die gewöhnlichen populären Anschauungen hierüber vorgeführt (B. II, Cap. 1–9), und sodann der Staat als jener Organismus bezeichnet, in welchem die Gerechtigkeit in größerem Maßstabe als im Individuum vorliege (ebend. Cap. 10), und nachdem im Interesse der Untersuchung über den Staat die Entstehung desselben und namentlich die notwendige musische und gymnische Bildung des hauptsächlichsten Standes, d. h. der Wächter, und die erforderliche Unterordnung des Ganzen unter die Einsichtigen entwickelt worden war (B. II, Cap. 11 – B. IV, Cap. 5), werden die hervorragenden Vollkommenheiten des Staates (Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit, Gerechtigkeit) angegeben und dieselben nun in durchgängiger Parallele im Einzeln-Individuum nachgewiesen (B. IV, Cap. 6–18), so daß vorläufig auf den Gegensatz der Einen guten Staatsform gegen eine vierfache schlechte hingedeutet werden kann (Schluß des 18. Cap. d. IV. B.). Und es folgt nun zunächst die ideale Grundlegung des besten Staates, besonders bezüglich des Familienlebens (B. V, Cap. 1–16), und hierauf die mögliche Ausführbarkeit dieses Ideales, welche dadurch bedingt ist, daß die Weisheitsliebenden die Herrschenden seien (B. V, Cap. 17 – B. VI, Cap. 14), und es reiht sich darum die Fortsetzung des Bildungsganges an, durch welchen die Wächter zu wahrhaft Weisheitsliebenden werden, wodurch der beste Staat verwirklicht werde (B. VI, Cap. 15 – B. VII, Cap. 17). Hiernach nun werden die Formen der Ungerechtigkeit d. h. die vier schlechten Staatsverfassungen (Timokratie, Oligarchie, Demokratie, Gewaltherrschaft) in ihrem allmäligen Uebergange zum Schlechtesten und in ihrem Bestande, so wie in der steten Parallele mit dem Individuum erörtert (B. VIII, Cap. 1 – B. IX, Cap. 3). Und nun erst kann zum Schlusse die Frage über den Glücksstand des Gerechten und des Ungerechten entschieden werden, indem, was das irdische Leben betrifft, Letzterer als der Unglückliche und Ersterer als der Glückliche dargestellt wird, welcher namentlich vermöge seines Wissens sich vor den Täuschungen der Poesie bewahrt (B. IX, Cap. 4 – B. X, Cap. 8), und außerdem im Jenseits jeden von beiden der ihm gebührende Lohn erwartet (B. X, Cap. 9–16).
Näher im Einzelnen gestaltet sich dieser Verlauf der Untersuchung folgendermaßen:
Die Einleitung geht von der Erzählung über einen Festzug aus, bei welchem sich die Personen des Gespräches trafen (Erstes Buch, c. 1) und dann zu Polemarchos sich begaben, wo sie den greisen Kephalos und auch den Sophisten Thrasymachos fanden; mit Ersterem ergibt sich bald ein Gespräch über das Greisenalter (c. 2) und die Möglichkeit sinnlicher Vergnügungen in demselben (c. 3), wobei es jedoch auf den Vermögensstand ankomme (c. 4); und hieran nun knüpft sich die Frage über die Beziehung, in welcher der Gebrauch des Vermögens zur sittlichen Vortrefflichkeit überhaupt stehe, und nachdem hiemit als Gegenstand des Gespräches der Begriff des gerechten Lebens gewonnen ist, zeigt sich bald die Unzulänglichkeit der Definition der Gerechtigkeit, daß sie darin bestehe, ohne Trug Jedem das Seine zu geben (c. 5); und auch des Simonides Ausspruch, Gerechtigkeit sei, das Geschuldete zu erstatten (c. 6), wird widerlegt, da man dann nur den Freunden Gutes, den Feinden aber Schlechtes schulde, und somit nur im Kriege es Gerechtigkeit gebe, und im Frieden nur das gebrauchlose Aufbewahren hinterlegter Schätze als Gerechtigkeit übrig bliebe (c. 7), ja so gar an die Gewandtheit im Aufbewahren sich jene im Stehlen anschließe; ferner auch darum, weil erst noch zu unterscheiden sei, wer wirklich Freund oder Feind sei (c. 8), und dem wirklichen Feinde gegenüber eine solche Uebung der Gerechtigkeit nicht bessernd, sondern eher verschlechternd wirke, und daher zumeist Sache der Gewaltthätigen sei (c. 9). Nachdem hierauf Thrasymachos in schroffen Ausdrücken sich gegen jede Definition der Gerechtigkeit verwahrt, welche ihm eine bloß relative scheint, wird ihm bedeutet, daß man ja doch zur Erklärung Begriffe und Worte beiziehen müsse, welche in dem Ausdrucke der Gerechtigkeit enthalten sind (c. 10 und 11), und da nun Thrasymachos seine Definition ausspricht, gerecht sei das dem Stärkeren Zuträgliche, und dieß in staatlichem Sinne gemeint sein soll (c. 12), so wird zunächst darauf hingewiesen, daß der erzwungene Gehorsam der beherrschten Schwächeren auch bestehen müsse, wenn der Stärkere aus Irrthum etwas ihm Schädliches gebietet (c. 13), sodann daß zwischen scheinbar und wirklich Zuträglichem zu unterscheiden sei, und daß bei der Annahme, der wahre Herrscher verfehle sein Zuträgliches nie (c. 14), eben doch sich ergebe, daß er nach dem den Beherrschten Zuträglichen strebe, so wie jede Kunst, deren die ihr unterworfenen Dinge bedürfen, ja nur für diese Dinge, nicht aber für sich selbst das Zuträgliche suche (c. 15). Nachdem aber hierauf Thrasymachos in rhetorischer Darlegung von dem Vortheile des Stärkeren und Ungerechten gesprochen (c. 16), wird bemerkt, daß hiebei der Gewalthaber mit dem Gelderwerber verwechselt sei, während doch die Kunst des Lohnerwerbens überhaupt eine eigene Kunst für sich sei (c. 17 u. 18), und auch eigentlich der höchste Lohn des Herrschenden nur in der Vermeidung der höchsten Einbuße bestehe, welche darin läge, wenn er von einem Schlechteren beherrscht würde (c. 19), wenn ferner hiebei die Ungerechtigkeit als Weisheit und Vortrefflichkeit und Stärke bezeichnet werde, so ergebe sich zunächst bezüglich der ersteren zwei das Gegentheil; denn da der Gerechte es nur dem Ungerechten zuvorthun will, der Ungerechte aber sowohl dem Gerechten als auch dem Ungerechten, und zugegeben sei, daß der Wissende und Treffliche es dem Untüchtigen zuvorthun wolle, der Unwissende aber sowohl anderen Unwissenden als auch den Wissenden, so stehe ja der Wissende dem Gerechten und der Unwissende dem Ungerechten gleich (c. 20 u. 21); bezüglich der Stärke aber werde zugegeben, daß Ungerechtigkeit Kampf und Zwietracht, auch in einzelnen Menschen, und selbst gegen die Götter herbeiführe, daher auch eine ungerechte Unternehmung Mehrerer doch eines Grades von Gerechtigkeit bedürfe, die volle höchste Ungerechtigkeit aber nur Selbstentzweiung zur Folge habe (c. 22 u. 23); ferner habe, so wie Alles, so auch die Seele ihre eigentümliche Vortrefflichkeit, ohne die sie ihre eigenthümliche That nicht verrichten könne, eine Vortrefflichkeit aber sei die Gerechtigkeit, und es lebe daher die gerechte Seele glücklicher und vorteilhafter (c. 24).
Von diesem erreichten Schlußpunkte der Einleitung aus schreitet nun die Untersuchung mehr in der Form einer allmäligen Beweisführung folgendermaßen fort:
Die Gerechtigkeit gehört zu den Gütern überhaupt, und zwar, da es drei Arten der Güter gibt, nemlich erstens was nur an sich und ohne Rücksicht auf die Folgen gut ist, zweitens was an sich und in seinen Folgen gut ist, drittens was an sich lästig und nur in den Folgen gut ist, gehört sie zur vorzüglichsten, d. h. der zweiten dieser Arten ( zweites Buch, c. 1). Nach den gewöhnlichen Annahmen hingegen zählt man sie zur dritten, indem man meint, sie sei aus einem Vertrage zum Schutze gegen den Ungerechtigkeits-Trieb der Menschen entstanden (c. 2), daher auch Niemand sie freiwillig übe, sondern nur aus Furcht, entdeckt zu werden, und bei Wegnahme dieser Furcht Jeder ungerecht sei (c. 3), so wie ferner der Ungerechte, welcher mit dem Scheine der Gerechtigkeit sich umgebe, alle Mittel zur Ausführung seines Willens besitze und so als glücklich gelte, während der Gerechte, der den Schein verschmäht, verkannt und gepeinigt werde (c. 4 u. 5) Auch wird diese Ansicht durch die gewöhnliche Art der Erziehung und selbst durch die religiöse Sage gefördert, da man dem Gerechten Belohnung und dem Ungerechten Bestrafung verheißt (c. 6), und auch von der Schwierigkeit der Gerechtigkeit und von Zaubermitteln einer Erlösung spricht (c. 7); hiedurch aber werden die jungen Leute zur Falschheit und Hinterlist erzogen und ziehen es vor, durch Ungerechtigkeit Schätze zu erwerben, durch welche auch die Gunst der Götter erkauft werden könne, und wer die Macht dazu hat, ist lieber ungerecht, als daß er sich verlachen läßt (c. 8 u. Anf. v. c. 9). Darum muß zunächst auf den Werth der Gerechtigkeit an und für sich, auch abgesehen von ihren Folgen, zurückgegangen werden (c. 9).
Da aber dieß sehr schwierig ist, muß man davon ausgehen, wo bei größerem Maßstabe die Sache deutlicher als im Einzeln-Individuum ist, nemlich vom Staate, und zwar ist hiebei die Entstehung des Staates zu betrachten (c. 10).
Der Staat entsteht aus der Hülfsbedürftigkeit der Einzelnen; die äußeren Lebensbedürfnisse führen zunächst eine geringe Zahl zusammen, wobei Arbeitstheilung das Beste ist; so entsteht eine Mehrzahl von Gewerben (c. 11) und hieraus, da der Staat sich nicht selbst genügt, Handel um Tausch und Geld, wo noch bloß die einfachsten nothwendigen Bedürfnisse befriedigt werden (c. 12); so wie man aber über diese Gränze hinausgeht (c. 13), stellt sich Ueppigkeit und sämmtlicher Luxus ein, und das Land reicht nicht mehr hin; es entsteht daher Eroberungssucht und ein Kriegszustand, so daß Wächter nöthig sind, welche jedoch gleichfalls nur diese Beschäftigung ausschließlich betreiben (c. 14); dieselben sind wie ein Haushund sanft gegen Bekannte und muthig nach Außen (c. 15), und da die Vereinigung dieser Gegensätze auf Kenntniß und Nichtkennen beruht, also der Weisheitsliebe entspricht, so muß es eine Bildung und Erziehung der Wächter geben (c. 16). Die Bildung ist theils gymnisch theils musisch, und da der Anfang der letzteren in mündlichen Aussprüchen und erdichteten Reden beruht, so muß der Staat ein Aufsichtsrecht über die Dichter üben (c. 17), damit die Gottheit nur als eine gute, nicht aber als böswillige Urheberin des Schlimmen (c. 18 u. Anf. v. 19), noch als zauberisch täuschend, sondern als unwandelbar und wahrhaftig und truglos dargestellt werde (c. 19–21), so wie auch daß, um den Wächtern keine Todesfurcht einzuflößen, nicht die Schrecknisse des Hades vorgeführt oder Klagen über Todesfälle ausgesprochen werden (drittes Buch, c. 1 u. 2); in gleicher Weise soll auch nicht zu viel Lachen erregt, und überhaupt nur die Liebe zur Wahrheit gefördert werden, und um der Mäßigkeit und Besonnenheit willen soll weder ein Streben nach Lohn noch Rachsucht von den Dichtern dargestellt werden; bezüglich der menschlichen Verhältnisse aber ist von Dichtern stets eben nur die Gerechtigkeit zu erwähnen (c. 3–5). Was bei den dichterischen Produkten die Form des Aussprechens betrifft, so ist dieselbe entweder Erzählung oder Nachahmung oder eine Verbindung beider (c. 6); und da auch im Nachahmen jene Arbeitsteilung gilt (c. 7), so wird der Wächter nur das ihm Geziemende nachahmen, und überhaupt der Gute nur das Gute (c. 8), der Schlechte hingegen Alles; so bleibt Ersterer einfach, Letzterer aber wird bunt und vielfach; das Beste ist die unvermischte Darstellung des Guten, den Reiz des Bunten aber schicke man mit Dank fort (c. 9). Das Gleiche gilt auch bezüglich der Musik, wo mit Vermeidung der weichen und üppigen Tonarten nur die dorische und phrygische, und auch nur Saiten-Instrumente zulässig sind (c. 10). Ebenso entsprechend verhält es sich mit dem Rhythmus. Dieß Alles hängt mit dem Charakter (c. 11) und den schönen und unschönen Formen desselben zusammen, und indem die musische Bildung in solcher Weise die Idee des Schönen uns einpflanzt, fördert sie auch die wahre Liebe als ihren eigentlichen Zweck (c. 12). Die gymnische Bildung, welche auf der musischen als ihrer Basis beruht, bewirkt Mäßigkeit und Einfachheit im leiblichen, ohne in die eigentliche Athletik auszuarten (c. 13) – Ist in diesen beiden Bildungsweisen die Einfachheit vernachlässigt, so entstehen Ziellosigkeit und Krankheit, daher dann Richter und Aerzte nöthig werden, wohingegen im guten Staate Niemand Zeit hat, krank zu sein, und auch den Unheilbaren die Pflege entzogen wird, damit Thätigkeit und Wissen der Bürger nicht darunter leide; auch ist eben darum der wahre Arzt nicht geldsüchtig (c. 14 u. 15); der beste Arzt aber ist jener, der alle Körper-Gebrechen erfahren hat, wobei sein Geist ja unbeschädigt bleibt. Der Richter hingegen, welcher mit der Seele auf Seelen wirkt, darf die Fehler der Seele nicht selbst erfahren (c. 16). Arzt und Richter dienen nur dem Guten, und beide entfernen das Unfügsame, daher es das Beste ist, keines der beiden zu bedürfen. – So haben beide Bildungsweisen einen sittlichen Zweck (c. 17), und sie müssen ineinandergreifen, denn einseitig erzeugen sie Extreme, in ihrer Verbindung aber leiten sie das Muthige und zugleich das Weisheitsliebende (c. 18)
Ueber die so erzogenen Wächter herrschen nun Jene, welche das Wohl des Staates am besten erkennen und am eifrigsten betreiben, daher sie hierin erprobt und selbst in Versuchung geführt werden müssen (c. 19); die von ihnen beherrschten Jüngeren heißen dann nur Helfer (c. 20); daß aber eine solche Unterordnung bestehe, liegt in einem alten Mythus betreffs der verschiedenen, Jedem bei der Geburt beigemischten Metalle ausgesprochen (c. 21). Jene Helfer aber nun wohnen in einem geeigneten Orte gemeinsam und ohne allen Privat-Besitz, indem sie nur die nöthigen Lebensbedürfnisse von den Uebrigen erhalten (c. 22); und scheinen sie hiedurch im Vergleiche mit Anderen beeinträchtigt zu sein, so ist ja zu bedenken, daß es sich um das Wohl des Ganzen handle und hiefür an den Wächtern das Meiste liege (viertes Buch, c. 1); auch schaden Reichthum und Armuth überall durch Störung der Einheit, was sich auch bei einem Kriege gegen einen reichen Staat zeigt (c. 2). Nur der Einheit des Staates muß jede Einrichtung dienen, wohin auch die Arbeitstheilung abzielt; bewahrt aber wird sie durch Einheit der Erziehung, was auf Ehe-und Kinder-Gemeinschaft führt (c. 3); die geringste Neuerung in der Erziehung pflanzt sich zum Verderben fort, und Erziehung ist die umfassende Aufgabe der Gesetzgebung, denn wenn sie nicht bewahrt wird, zerrüttet man den Staat im Kleinen, ihn im großen zu erhalten wähnend; ferner aber gehört hiezu auch die Bewahrung der väterlichen apollinischen Religion, welche der Gesetzgeber nicht selbst aufstellt (c. 4 u. 5).
Ist auf diese Weise der Staat entstanden, so muß er, wenn er vollkommen sein soll, weise und tapfer und besonnen und gerecht sein. Weise ist er durch die Wohlberathenheit der Vorsteher (c. 6), tapfer durch die Wächter (c. 7), besonnen ist er, insoferne der schwächere Theil dem besseren sich fügt, und gegenseitige Harmonie besteht (c. 8 u. Anf. v. c. 9), die Gerechtigkeit aber liegt in dem schon Anfangs zu Grunde Gelegten, daß Jeder das Seinige thue, wodurch erst die vorigen drei Vollkommenheiten entstehen können (c. 9 u. 10). Hiemit ist auf den Ausgangspunkt zurückzukehren, und was bisher im großen Maßstabe sich zeigte, am Einzeln-Individuum zu erproben, wobei sich die Frage einstellt, ob die Seele des Menschen gleichfalls drei Formen habe (c. 11). Sie hat dieselben, da sie nicht anderswoher in den Staat kamen, und ihnen entsprechen auch die Tätigkeiten der Seele; denn Nichts kann an dem Nemlichen zugleich in Gegensätzen activ oder passiv auftreten (c. 12), Anziehung und Zurückstoßung aber sind solche Gegensätze, welche in Begehrung und Abneigung vorliegen; alles Begehren aber als solches bezieht sich auf das Allgemeine seines Gegenstandes, und nur als specielles auf einen speciellen Gegenstand; also wo ein Widerstreben gegen eine Begehrung sich findet, muß dieß in einer anderweitigen Kraft beruhen, und somit ist in der Seele neben dem Begehrlichen ein Vernünftiges (c. 13 u. 14); in dem Kampfe beider aber tritt das Muthige auf Seite des Vernünftigen als Helfer (c. 15). So sind im Einzelnen die nemlichen Arten der Vortrefflichkeit wie im Staate. Gerecht ist Jeder, bei welchem in Folge der Erziehung die Herrschaft über das Begehrliche dadurch ermöglicht ist, daß jeder Theil der Seele das Seinige thut; tapfer ist Jeder durch das Muthige, weise durch das Vernünftige, besonnen durch die Harmonie des Herrschenden und Beherrschten (c. 16); daraus fließt auch als äußeres Abbild der Gerechtigkeit, daß jeder Handwerker das Seinige thue; das innere Wesen derselben ist die Einheit der drei Theile, und Zwietracht zwischen diesen ist die Ungerechtigkeit. Hierdurch ist auch die Frage über den Nutzen der Gerechtigkeit erledigt (c. 17).
Hiemit ist das Princip festgestellt und eine der menschlichen Seele entsprechende Grundlage gewonnen zur Unterscheidung des Einen guten Staates von der Schlechtigkeit eines Staates, welche hauptsächlich in vier Formen auftritt (c. 18). In Bezug aber auf den guten Staat muß nun in einer allerdings schwierigen Untersuchung das bisher bloß angedeutete Wesen der Familie und überhaupt die ideale Vortrefflichkeit und die Ausführbarkeit eines solchen Staates erörtert werden ( fünftes Buch, c. 1 u. 2). Wie bei den Hunden das Weibliche dem Männlichen in gleicher Pflege gleichsteht, so müssen auch trotz den Spöttern, deren Meinung dereinst besserer Einsicht weichen wird, die Frauen die gleiche musische und gymnische Bildung erlangen wie die Männer (c. 3); denn dieß ist sowohl möglich, da der Unterschied der Geschlechter bezüglich des Staates ein zufälliger ist, und das Weib nur durch Schwäche vom Mann sich unterscheidet, als auch ist es das Beste, daß Alle am besten gebildet seien (c. 4–6). Für die Eingehung der Ehe ist festzusetzen, daß die Herrscher mit täuschender Anwendung des Looses die Frauen auswählen, die Zeiten und das passende Lebensalter für Kindererzeugung bestimmen, und für gemeinschaftliche Säugung, sowie dafür sorgen, daß kein Kind seine wahren Eltern kenne, sondern Alle als solche betrachte, welche den Jahren nach es sein können, so daß der ganze Staat Eine Familie darstellt (c. 7–9). Dieß ist das Beste, weil hiedurch der in Selbstsucht liegende Zwiespalt vermieden wird und alle Freuden und Leiden gemeinsam sind (c. 10), so daß in diesem einheitlichen Familienleben Streit und Mißhandlung wegfallen, und steter Friede ist; so haben denn die Wächter das glücklichste Leben und die Frauen nehmen daran Theil (c. 11–13). In den Krieg nehmen sie ihre Kinder mit, sie belehrend und vor Gefahren schützend; unter sich entehren sie den Feigen und ehren den Tapferen, ihm den reichsten Genuß der Liebe gestattend, den Todten erweisen sie göttliche Verehrung (c. 14 u. Anf. v. 15); sie knechten keinen Hellenen, plündern nicht die Leichen, beflecken keinen Tempel; Sengen und Brennen üben sie nur gegen Nicht-Hellenen, gegen welche allein eigentlicher Krieg bestehen kann, denn unter Hellenen gibt es nur Zwiespalt, welcher rechtlich geschlichtet werden soll (c. 15 u. 16).
Dieß Bisherige nun ist als Ideal zu betrachten, welches von der Wirklichkeit nie ganz erreicht wird, daher die Ausführbarkeit nur in der möglichsten Annäherung an das Ideal liegen kann (c. 17). Das wegzuräumende Hinderniß des Guten in den jetzigen Staaten beruht darin, daß nicht die Weisheitsliebenden die Herrscher sind und die Herrscher nicht in Weisheitsliebe sich bethätigen. Dieser angefeindete Ausspruch führt auf die Frage über das Wesen der Weisheitsliebe (c. 18). Sowie die Liebe jeder Art ihren Gegenstand in all seinen Theilen ergreift, so auch die Liebe zur Weisheit (c. 19); hiebei aber ist zu unterscheiden das Streben nach der vielheitlichen Erscheinung, nemlich das bloße Meinen, und die Einsicht in die einheitliche Idee; das Wissen nemlich bezieht sich auf das Seiende, sowie das Nichtseiende das nicht Wißbare ist (c. 20); hingegen was zwischen Seiendem und Nichtseiendem liegt, ist Gegenstand der Meinung, und dieses Mittlere ist eben die in der Vielheit vereinzelte Idee, da jedes Einzelne zugleich ist und nicht ist; im Gegensatze hievon aber erfaßt der Weisheitsliebende die Idee selbst (c. 21 und 22), und er allein ist daher fähig, die Einheit im Staate zu bewahren, so daß er der Herrscher und Führer desselben sein muß ( sechstes Buch, c. 1); er allein ja besitzt die nöthigen Geistesgaben und Großartigkeit des Sinnes und wird in sanfter Harmonie die vier obigen Arten der Trefflichkeit üben (c. 2). Wird nun dieß wohl zugegeben, aber eingewendet, die Mehrzahl der Weisheitsliebenden sei schlecht, und die geringe Zahl der Uebrigen jedenfalls unbrauchbar, so kann man den Staat füglich mit einem Schiffe vergleichen, in welchem die Führung des Steuerruders Gegenstand schlechter Parteibestrebungen ist, und die Ursache der Unbrauchbarkeit des Wissenden nicht in diesem, sondern in den Uebrigen liegt (c. 3 u. 4); nemlich ebenso befindet sich der Weisheitsliebende in einer schlechten Umgebung und wird durch sie selbst verschlechtert, da die gewöhnlichen schlechten Ansichten über den Werth der Dinge ihm durch Erziehung und Leben aufgedrungen werden (c. 5 u. 6), und nur ein wahrhaft göttlicher Einfluß könnte ihn schützen; denn während Alle dem Unthiere der Menge fröhnen, wird auch er von ihnen im Bestreben nach Großartigem fortgerissen, und hört zuletzt auf, ein Weisheitsliebender zu sein (c. 7 u. 8); so wird die Stelle des Weisheitsliebenden verwaist und von Nichtswürdigen ausgefüllt, welche dem ungebildeten Emporkömmlinge im bräutlichen Gewande gleichen (c. 9); ja nur durch Zurückgezogenheit von staatlichen Dingen kann die Reinheit des Wissens bewahrt werden (c. 10). Somit müßte es für den Weisheitsliebenden einen ihm entsprechenden Staat geben; aber andrerseits müßte auch die Weisheitsliebe nicht bloß in der Jugend gekostet und dann weggeworfen werden, sondern ihr Betrieb im Alter sich steigern (c. 11). Allerdings liegt noch kein Beispiel vor, daß ein Weisheitsliebender ein Herrscher gewesen sei; aber wenn es einträte, würde der Tadel der Weisheitsliebe schwinden (c. 12), sobald die Menschen erfahren, daß der Weisheitsliebende wirklich Gutes will; denn ein Solcher würde nach vorhergegangener Reinigung des Staates die Umrisse desselben durch eine Mischung des Göttlichen und Menschlichen entwerfen (c. 13). An der Möglichkeit, daß durch einen solchen Herrscher ein derartiger Staat gegründet werde, ist nicht zu zweifeln; schwierig wohl wird es stets sein (c. 14).
Frägt es sich demnach, wie solche Retter des Staates gebildet werden sollen, so ergibt sich Folgendes: sie müssen neben der obigen Bildung der Wächter noch die letzte höchste Stufe erreichen, nemlich die der Idee des Guten (c. 15 und 16), nach welcher Alles, wenn auch in verschiedener Weise, strebt. Sie ist für das Denken, was das Licht für das Sehen ist; nicht daß sie das Denken selbst sei, so wenig als das Licht das Sehen selbst ist, sondern sie ist die Ursache der Wahrheit und die Quelle der Wesenheit (c. 17–19). Wie die Welt des Sichtbaren getheilt ist in Abbilder und Gegenstände, so auch die des Denkbaren, indem theils auf Annahmen fortgebaut und Bilder gebraucht werden, theils die Annahmen als solche aufgehoben und zum Voraussetzungslosen fortgeschritten wird. So ergibt sich die Theilung in zwei Gruppen, deren jede zwei entsprechende Thätigkeiten enthält, nemlich: Vermuthen, Glauben, Nachdenken, Vernunft (c. 20 u. 21), welche aufsteigende Reihenfolge vergleichbar ist einem Aufenthalte in einer Höhle, in welcher Gefesselte nur Schattenbilder an der Rückwand derselben sehen, aber dann allmälig an das Licht der Sonne geführt werden ( siebentes Buch, c. 1 u. 2); daher Jene, welche das Licht geschaut haben, ebenso wenig im Dunklen sich zurecht finden, als die im Dunklen Verweilenden im Lichte, auch die Idee des Guten ebenso wenig plötzlich eingepflanzt werden kann, als das Licht dem Auge, sondern eine allmälige Leitung angewendet werden muß (c. 3 u. 4). Eben darum aber muß der Weisheitsliebende auch Beides, Licht und Dunkel, erleben, da er nicht selbstsüchtig nur für sich, sondern für das Wohl des Ganzen sorgen soll; so herrschen dann die Wissenden zwar ohne darnach zu streben, aber um Unwürdige auszuschließen (c. 5). Jener Bildungsweg aber, durch welchen diese künftigen Herrscher zum wahren Lichte geführt werden, geht über die gymnische und musische Bildung hinaus (c. 6) und betrifft zunächst dasjenige, wodurch die Sinneswahrnehmung vermittelst der Abstraction und des Begriffes der Einheit zum Denken aufgefordert wird, nemlich die Arithmetik, nicht aber um des Erwerbes, sondern um der intelligiblen Zahl willen (c. 7 u. 8); sondern die Geometrie, da sie vom Vergänglichen absehend eine Wesenheit erkennt (c. 9), und hierauf die Astronomie, indem die Stereometrie, welche eigentlich zunächst folgen würde, bisher noch nicht genügend ausgebildet ist; aber auch die Astronomie ist nicht etwa zu betreiben wegen des Blickes nach Oben, denn auch so bliebe sie noch ein bloßes Sinnesobject, sondern um des Ewigen willen (c. 10 u. 11); dann folgt das Entsprechende für den Gehörssinn, die Musik, und zwar nicht wegen der praktischen Ausübung, sondern um ihrer mathematischen Gesetze willen (c. 12). Die Vereinigung dieser Gegenstände und die Einsicht in ihre Verwandtschaft führt zur Dialektik und zur Erfassung der Idee, wodurch im Gegensatze gegen das Traumleben der praktischen Fächer der Gipfel des wahren Wissens erreicht wird (c. 13 u. 14). Hier muß daher von Jugend an eine strenge Erprobung stattfinden, daß nur der wahrhaft Befähigte zugelassen werde, und nicht erst die Greise sollen lernen (c. 15), sondern schon bei den Kindern handelt es sich um die Freudigkeit des Lernens; später dann muß bei den jüngeren Männern erprobt werden, wer das Seiende erfassen könne, wobei sie sich lossagen von den unächten Eltern geistiger Schmeichelei (c. 16), und zeigen, daß sie die Dialektik nicht zu Schlechtem mißbrauchen; noch später dann werden sie in die praktischen Verhältnisse zurückgebracht, und nachdem sie auch dort die Probe bestanden, herrschen und lehren sie glücklich und geehrt, sie und ihre Frauen. So werden die Weisheitsliebenden die Herrscher sein; die Kinder der jetzigen Generation aber soll man ferne von den jetzigen Sitten erziehen, um dereinst einen solchen Staat zu ermöglichen (c. 17).
Nun sind die Formen der Ungerechtigkeit, d. h. die vier schlechten Staatsverfassungen zu betrachten, nemlich: Timokratie, Oligarchie, Demokratie, Gewaltherrschaft; einer jeden aber muß auch im Individuum eine Beschaffenheit der Seele entsprechen, und es ist daher in dieser doppelten Beziehung der Uebergang zum Schlechten und das Auftreten desselben zu betrachten ( achtes Buch, c. 1 u 2). All solcher Uebergang liegt in einer Zwietracht des Herrschenden, und wenn bei der Geburt der Herrschenden nicht die richtigen Zahlen-Verhältnisse eingehalten wurden, tritt in Folge hievon eine Abweichung von der richtigen Erziehung ein. So geht die beste Verfassung zunächst in die Timokratie über, indem durch Vermischung des schlechten Metalles mit dem edlen Kampf entsteht und zur Schlichtung desselben Privat-Besitz eingeführt wird (c. 3); ein solcher Staat ist noch mit dem guten verwandt in der Stellung der Herrscher und in der Einrichtung gemeinschaftlicher Bürgermahlzeiten, aber streift bereits an das Oligarchische durch Ueberwiegen des Muthigen und durch Wertschätzung des Besitzes (c. 4) Der dieser Verfassung entsprechende einzelne Mensch ist kriegerisch und nimmt von einer ursprünglich guten Jugend an stets in Geldsucht und Ehrliebe zu (c. 5). Der Uebergang von da in die Oligarchie beruht im fortwährenden Wachsen der Gewinnsucht und des Gelderwerbes, wornach Alles, zuletzt selbst die Theilnahme am Herrschen, bemessen wird; ein solcher Staat verschmäht das Wissen und wird in zwei Parteien, Reiche und Arme, gespalten, welche mit allen Mitteln sich gegenseitig bekämpfen (c. 6 und 7). Der ihm entsprechende Einzeln-Mensch wendet sich aus Furcht vor äußeren Nachtheilen dem Begehrlichen zu und wird durch die zur Ansammlung von Schätzen angewendeten Mittel gefährlich, entbehrt aber auch jeden Sinnes für wahren Ruhm (c. 8 u. 9). Der Uebergang von da in die Demokratie tritt ein, wenn durch Unersättlichkeit der Einen die Andern verarmt sind und verletzt werden, worauf, da beiderseits es an Kraft zum Guten fehlt, bei dem leichtesten Anstoße von Außen die Armen die Oberhand gewinnen (c. 10); ein solcher Staat bewegt sich in dem bunten Belieben der Einzelnen und entbehrt des staatlichen Pflichtgefühles und vermag keinen eigentlich Tüchtigen zu wählen (c. 11). Der ihm entsprechende Einzeln-Mensch wendet sich bereits auf Luxus-Bedürfnisse, zumal durch Beihülfe äußerer Einflüsse, und gelangt hiedurch zu einer Verrückung aller Begriffe und einer inneren Anarchie, welche in dem Eintagsleben der Vergnügungen und des Beliebens erscheint (c. 12 und 13). Von hier aus findet endlich der Uebergang in die Gewaltherrschaft statt, indem durch Unersättlichkeit des Beliebens alle Gränzen überschritten werden und diejenigen, welche herrschen sollten, sich zu Sklaven Anderer herabwürdigen (c. 14); indem nemlich die Selbstsüchtigen und die Klasse der Besitzenden und die Masse des Volkes sich feindlich gegenüberstehen, das Volk aber von dem durch die Gewinnsüchtigen ihnen mitgetheilten Raube abhängt, entsteht Kampf und Argwohn gegen die Besitzenden, und das Volk stellt Einen aus seiner Mitte an die Spitze, welcher, sobald er Menschenblut gekostet, zum Wolfe wird und als Gewaltherrscher eine Leibwache verlangt (c. 15 u. 16); dieser Herrscher eines Staates ist Anfangs noch mild, hält aber das Volk um der Abhängigkeit willen im Kriegszustande, dann aber verfeindet er sich mit den Unabhängigen und Tapfern und befreundet sich mit den schlechten Sklaven, welche er freiläßt und in seine Umgebung einreiht, was dann selbst von Dichtern gepriesen wird; zu seinem Aufwande schont er nicht die Tempel und zuletzt nicht das Volk selbst, welches sein eigener Vater ist, und widersetzt sich ihm dieser, so schlägt er ihn (c. 17–19). Der diesem schlechtesten Staate entsprechende Einzeln-Mensch entsteht, wenn die nächtlichen Begierden, welche nur durch Geistesthätigkeit gebändigt werden, sich einstellen, und seine Seele sich mit dem Wahnsinne der Leidenschaften umgibt ( neuntes Buch, c. 1 und 2); in dem Bestreben, diese zu befriedigen, knechtet er durch List und Gewalt seine Eltern, stürzt sich dann auf fremdes Gut, und wird fortan von den nächtlichen Begierden auch bei Tage beherrscht, worauf er entweder aus seinem Staate verstoßen anderen Gewaltherrschern dient, oder sich gegen sein Vaterland wendet, nur befähigt, entweder Sklave der Gewaltherrscher zu sein, und am weitesten von der Gerechtigkeit entfernt lebend (c. 3).
Nunmehr also kann vermittelst des Gegensatzes zwischen dem Gerechtesten und dem Ungerechtesten die Frage über den Glücksstand beider beantwortet werden. Jene fünfte Staatsform ist die unglücklichste, sowie die erste die glücklichste, und ebenso entsprechend die Einzeln-Menschen (c. 4); denn die Form der Gewaltherrschaft ist an sich unfrei, voll Furcht und Klage, was im höchsten Grade dann eintritt, wenn ein jener Beschaffenheit Fähiger wirklich Gewaltherrscher wird; nemlich wie ein in eine feindselige Umgebung versetzter Herr vieler Sklaven wird er stets argwöhnischer und furchtsamer und hiedurch unglücklicher; den Gegensatz hievon aber bildet die erste, d. h. die gute, Form des Staates (c. 5 u. 6). Indem aber auch in Folge der Dreitheilung der Seele sich drei Lebensweisen ergeben, die des Geldliebenden, des Ehrliebenden, des Weisheitsliebenden, und hiebei jeder seine Wahl für die beste erklärt (c. 7), wird bei der Frage um das Angenehme an und für sich doch der Weisheitsliebende, da er der Umfassende ist, die Entscheidung geben, und hiernach die Reihenfolge der drei Lebensweisen entsprechend bestimmt werden (c. 8). Ferner da bei leiblichem Vergnügen und Schmerze der Zustand der Ruhe bald als das eine bald als das andere gilt und hiemit Alles unbestimmt ist (c. 9), und es sich wie beim Auf-und Absteigen an einer Linie verhält, wo Oben und Unten nur relativ sind, so ist hingegen geistiges Vergnügen das an sich seiende, welches im Gegensatze gegen die Trugbilder die wahre Höhe erreicht (c. 10); daher haben jene anderen Vergnügungen nur Werth in der Unterordnung unter dieses, und sie sind um so schlechter, je weiter sie hievon entfernt sind, wornach der Gewaltherrscher vom idealen Herrscher in einem Abstande entfernt ist, welcher selbst durch Zahlen sich ausdrücken läßt (c. 11). Denkt man sich ein Gebilde aus einem vielköpfigen Ungeheuer und aus einem Löwen und aus einem Menschen zusammengesetzt, so nährt der Ungerechte den ersten Theil, der Gerechte den dritten unter Beihülfe des zweiten gegen den ersten; und stets liegt das wahre Glück in der Herrschaft des Besseren, das Unglück aber in jener des Schlechteren, mag der Ungerechte unentdeckt bleiben oder nicht, da ja im Gegentheile durch eintretende Strafe der bessere Theil befreit wird. Alles demnach ist um des harmonischen Bestandes willen zu betreiben und aller Besitz und Ehre darnach zu regeln, und so stellt Jeder seinen inneren Staat her (c. 12 und 13), indem er durch das Wissen sich vor den Trugbildern der Poesie bewahrt, welche eben wegen dieses Trügerischen aus dem Staate zu verbannen ist. Nemlich da es von Allem Ideen gibt, und die Dinge Abbilder derselben sind, so verfertigt jede nachahmende Kunst nur wieder Abbilder jener Abbilder und steht also in dritter Linie von dem wahren Sein entfernt, durch den Schein die Unwissenden bezaubernd (zehntes Buch, c. 1 u. 2); hätten die Dichter wirklich ein Wissen, so würden sie doch lieber den höheren Ruhm einärndten, als bloß Nachahmer zu sein; auch ist durch Homer weder ein Staat noch eine Lebensweise, wie etwa von Pythagoras, gestiftet (c. 3), und, hätte er Ersprießliches geleistet, so hätte man ihn nicht so herumwandern lassen. So haben die Dichter kein Wissen, sondern nur eine bestechende Einkleidung; denn von Allem ja, was verfertigt wird, hat nur der Gebrauchende das Wissen, und von ihm hängt der Verfertiger ab; der bloße Nachahmer hingegen haftet am Scheine (c. 4). So dient die Poesie dem schlechteren Theile des Menschen, denn gerade von dem bloßen Scheine soll uns das Denken befreien, und in allen Verhältnissen hält uns nur das Wissen aufrecht, während wir innerlich in ein Besseres und ein Schlechteres gespalten sind; denn die Vernunft ist das Einfache in uns, wohingegen die Poesie auf die weichliche Seite wirkt, um der Menge zu gefallen (c. 5 u. 6); ja sie verführt selbst die Besseren dazu, dasjenige an Anderen zu loben, was sie an sich selbst tadeln, und in solcher Weise wirkt sie nachtheilig sowohl bezüglich des Mitleides als auch des Lachens. Darum ist alle auf die Affekte wirkende Poesie zu verbannen, und nur Hymnen dürfen zugelassen werden (c. 7) So ist auch der Streit zwischen Poesie und Weisheitsliebe schon alt, und erstere kann sich nur durch den wahren Nutzen vertheidigen, und wo sie diesen nicht bringt, ist sie aufgegeben wie eine gefährliche Liebschaft; der wahre Nutzen aber und das wahre Glück liegen nur im Wissen und in der Gerechtigkeit (c. 8).
Dieß Alles aber ist noch nicht der höchste Grad des Glückes des Gerechten; denn die Seele ist ja auch unsterblich; nemlich wenn etwas zu Grunde geht, kann es nur durch das ihm eigenthümliche Schlechte zu Grunde gehen; aber das der Seele einwohnende Schlechte vernichtet dieselbe ja nicht, wie etwa den Leib (c. 9), und durch das den Leib betreffende Schlechte wird die Seele nicht geändert. Wäre die Schlechtigkeit der Seele ihr tödtlich, so müßte die Schnelligkeit des Eintrittes des Todes proportionirt mit dem Grade der Schlechtigkeit sein, und auch außerdem wäre der Tod für den Schlechten ein Gewinn (c. 10). Somit ist die Seele unsterblich, und muß in ihrer Reinheit von irdischen Schlacken und in ihrer Verwandtschaft mit Gott betrachtet werden (c. 11). In dieser Beziehung handelt es sich nicht um äußerlichen Lohn, sondern um den wahren; und hierin ist Niemand dem Gotte verborgen, und der Gerechte ist gottgeliebt, der Ungerechte gottverhaßt; dem Gerechten schlägt Alles zum Guten aus, und bei den Menschen ist das Ende der Laufbahn des Gebens das Entscheidende, wobei der Ungerechte zuletzt doch der Lächerliche und der Gestrafte ist. So im Leben (c. 12).
Wie es aber nach dem Tode sein werde, zeigt die Erzählung eines vom Hades einmal Zurückgekehrten, welcher über die dortigen Wanderungen und Strafen der Seelen (c. 13), sowie über den Bau des Weltalles (c. 14) und die Vertheilung neuer Lebens-Loose an die zum Leben zurückkehrenden Seelen berichtete, – ein Mythus, durch welchen wir uns im Betriebe der Gerechtigkeit bewahren mögen (c. 15 u. 16).
Erstes Buch.
1. Ich ging gestern mit Glaukon, dem Sohne des Ariston, in den Piräus hinab, sowohl um zu der GöttinUnter der Bezeichnung »die Göttin« ist hier nicht, wie gewöhnlich bei Bezugnahme auf attische Verhältnisse, Athene gemeint, sondern die thrakische Mondgöttin Bendis, welche i. J. 430 v. Chr. in den attischen Kultus aufgenommen wurde; das ihr geweihte Fest, die sog. Bendidien (s. am Schlusse dieses Buches), wurde im Piräus am 19. oder 20. des attischen Monates Thargelion gefeiert. Daß bei jener erstmaligen Festfeier auch Thrakier selbst sich betheiligten, welche offenbar zur Uebersiedlung des Kultus waren beigezogen worden, geht aus Plato’s Worten selbst hervor. zu beten, als auch weil ich zugleich den Festzug anschauen wollte, auf welche Weise wohl sie ihn veranstalten würden, da sie ihn nemlich jetzt zum erstenmale aufführten. Schön nun schien mir zwar auch der Aufzug der Einheimischen zu sein, nicht weniger jedoch war offenbar jener sehr passend, welchen die Thrakier veranstalteten. Nachdem wir aber gebetet und zugeschaut hatten, gingen wir wieder fort gegen die Stadt zurück. Da sah uns nun, wie wir nach Hause zu aufgebrochen waren, von weitem Polemarchos, der Sohn des Kephalos, und hieß seinen Sklaven uns nacheilen und auffordern, auf ihn zu warten; und es ergriff mich der Sklave von hinten an dem Kleide und sagte: es heißt euch Polemarchos auf ihn warten. Und ich wendete mich um und fragte, wo jener selbst sei. – Hier hinter euch, sagte er, kömmt er heran; aber wartet nur auf ihn. – Gut, so wollen wir denn auf ihn warten, sagte Glaukon. – Und ein wenig später kam sowohl Polemarchos als auch Adeimantos, der Bruder des Glaukon und Nikeratos, der Sohn des Nikias, und einige Andere, eben wie von dem Festzuge her. Polemarchos nun sagte: O Sokrates, ihr scheint mir gegen die Stadt zu aufgebrochen zu sein, um wieder heimzugehen. – Nicht schlecht ja erräthst du es, sagte ich. – Siehst du also, erwiederte Jener, wie viele unser sind? – Warum sollte ich auch nicht? – Entweder demnach, sagte er, müßt ihr über uns Herr werden, oder ihr müßt hier bleiben. – Nicht wahr aber, sagte ich, Eins bleibt dabei noch übrig, der Fall nemlich, daß wir euch von der Nothwendigkeit überzeugen, uns willig fortzulassen. – Solltet ihr etwa gar, sagte er, uns hievon überzeugen können, wenn wir euch nicht anhören? – Dann sicher nicht, sagte Glaukon. – Stellt euch also, erwiederte er, die Sache nur so vor, als würden wir euch eben nicht anhören. – Und Adeimantos sagte: Wißt ihr also etwa nicht einmal, daß gegen Abend zu Ehren der Göttin ein Fackellauf zu Pferde sein wird? – Zu Pferde? sagte ich; das ist ja etwas ganz Neues; sie werden wohl Fackeln haben und dieselben der Reihe nach einander herumgeben, während sie mit den Pferden ein Kampfspiel aufführen, oder wie meinst du es sonst? – Eben so, sagte Polemarchos; und außerdem noch werden sie eine nächtliche Feier veranstalten, welche anzuschauen der Mühe werth ist; wir werden nemlich nach dem Abendessen uns wieder von demselben wegbegeben und der nächtlichen Feier zuschauen und dort selbst mit vielen jungen Männern beisammen sein und mit ihnen uns unterreden; aber bleibt ihr nur hier und thut es nicht anders. – Und Glaukon sagte: Es scheint wohl, daß wir bleiben müssen. – Wohlan also, sagte ich, wenn es so gut dünkt, müssen wir es wohl thun. –
2. Wir gingen also in das Haus des Polemarchos hinein und trafen dortselbst auch sowohl den Lysias als den Eythydemos, die Brüder des Polemarchos, und auch den Chalcedonier Thrasymachos und den Paianienser Charmantides und den Kleitophon, den Sohn des Aristonymos. Es war aber in dem Hause auch der Vater des Polemarchos, nemlich Kephalos, und es schien mir derselbe schon sehr alt zu sein; ich hatte ihn nemlich erst seit langer Zeit wieder einmal gesehen. Er saß aber da bekränzt auf einem mit einem Kopfkissen versehenen Stuhle; nemlich er hatte so eben vorher in dem Hofe des Hauses ein Opfer dargebracht. Wir setzten uns also neben ihn, denn es standen rings im Kreise einige Stühle dort. Sogleich nun, als Kephalos mich sah, liebkoste er mich und sagte: O Sokrates, du kömmst aber auch gar nicht häufig zu uns herab in den Piräus: und doch solltest du; wenn nemlich ich noch bei Kräften wäre, um leicht zur Stadt zu gehen, so brauchtest allerdings du nicht hieher zu kommen, sondern wir kämen dann zu dir; nun aber mußt du häufiger hieher kommen; denn wisse wohl, daß bei mir in eben dem Maße, als die leiblichen Vergnügungen schwächer werden, die Begierde nach begründenden Reden und die hierauf bezüglichen Vergnügungen zunehmen. Also thue es nicht anders, sondern pflege sowohl mit diesen Jünglingen da einen Umgang, als auch besuche uns hier als deine Freunde und dir völlig Verwandte. – Und in der That, o Kephalos, sagte ich, ich habe ja meine Freude daran, mit den sehr alten Männern mich zu unterreden; denn es scheint mir, als müßte von ihnen, welche gleichsam irgend einen Weg schon vorausgegangen sind, welchen auch wir vielleicht wandeln sollen, es erfahren, welcherlei Art derselbe sei, ob rauh und schwierig, oder ob leicht und gangbar; und so möchte ich denn auch von dir gerne erfahren, was dir, da du bereits in diesem hohen Alter stehst, denn jenes zu sein scheine, wovon die Dichter sagen, daß es »an der Schwelle des Greisenalters« sei; ob du es nemlich als einen schwierigen Theil des Lebens, oder wie sonst du es bezeichnest. –
3. Ich will, erwiederte er, bei Gott es dir sagen, o Sokrates, welcherlei es mir scheine. Es kommen nemlichDieß und das Folgende bis gegen das Ende des 5. Cap. gefiel dem Cicero so ausnehmend, daß er es theils wörtlich, theils in einem oberflächlichen Auszuge in seine Schrift de senectute einklebte, deren 3. Cap. hiemit zu den sprechenden Belegen dafür gehört, in welcher Art und Weise Cicero schriftstellerte. oft unser Einige, welche ungefähr das gleiche Alter haben, zusammen, indem wir hiemit das alte Sprüchwort bewahrenVerschiedene Wendungen des Sprüchwortes, welches bei uns lautet »Gleich und gleich gesellt sich gerne«, kommen bei den Alten vor, z. B. »der Altersgenosse erfreut den Altersgenossen«, oder »immer sitzt ein Rabe neben einem Raben« oder auch »Gleichen Gleiches«.; da jammern nun die meisten von uns, wenn wir beisammen sind, indem sie nach den in der Jugend genossenen Vergnügungen ein Verlangen haben und sich an dieselben zurückerinnern, sowohl betreffs des Liebesgenusses und der Trinkgelage und Schmausereien, als auch betreffs irgend anderer Dinge, welche an Derartiges sich knüpfen, und sie fühlen sich gedrückt, als wären sie irgend großer Dinge beraubt, und als wäre es wohl damals ein gutes Leben gewesen, jetzt aber nicht einmal mehr ein Leben; Einige aber beklagen auch die Beschimpfungen des Greisenalters von Seite ihrer Angehörigen, und singen darauf hin stets das Lied über das Greisenalter, an wie vielen Uebeln es für sie Schuld sei. Mir aber, o Sokrates, scheinen diese nicht dasjenige als Ursache anzugeben, was die Ursache ist; denn wenn dieses die Ursache wäre, so würde auch mir eben dieß Nemliche von wegen des Greisenalters widerfahren, und auch sämmtlichen Uebrigen, welche in diesem hohen Alter stehen; nun aber traf ich wenigstens bereits sowohl Andere, welche nicht so sich verhielten, als auch war ich einmal bei dem Dichter Sophokles, wie er eben von Jemandem folgendermaßen gefragt wurde: Wie steht es bei dir, o Sophokles, in Bezug auf den Liebesgenuß? Bist du noch im Stande, einem Weibe beizuwohnen? Und Jener antwortete: Sprich, o Mensch, nichts Frevelhaftes; höchst gerne ja bin ich doch solchem entflohen, gleichsam wie irgend einem wüthenden und wilden Gebieter. Sehr richtig also schien mir sowohl damals Jener dieses gesagt zu haben, als auch jetzt scheint es mir nicht weniger richtig zu sein; denn ganz und gar ja entsteht in dem Greisenalter bezüglich derartiger Dinge viel Friede und Freiheit; nemlich wann die Begierden uns zu spannen aufgehört und überhaupt nachgelassen haben, entsteht ganz und gar jenes, was Sophokles sagte: es ist nemlich möglich, von sehr vielen rasenden Gebietern los zu sein. Aber sowohl betreffs dieser Dinge als auch betreffs des Verhältnisses zu den Angehörigen gibt es irgendeine Ursache, und zwar ist diese nicht das Greisenalter, o Sokrates, sondern der Charakter der Menschen; wann sie nemlich ordentlich und zufrieden sind, ist auch das Greisenalter nur in mäßigem Grade lästig; wann aber nicht, dann, o Sokrates, ergibt sich für einen Derartigen sowohl das Greisenalter als auch die Jugend als etwas Schwieriges. –
4. Und ich nun freute mich über ihn, wie er dieses sagte, und indem ich den Wunsch hatte, daß er noch ferner spreche, suchte ich ihn hiezu zu veranlassen und sagte: Ich glaube, o Kephalos, daß die Meisten, wann du solches sagst, es nicht willig von dir annehmen, sondern der Ansicht sind, daß wohl du das Greisenalter leicht ertragest, nicht wegen deines Charakters, sondern weil du großes Vermögen besitzest, denn von den Reichen sagt man, daß sie gar viele Beschwichtigungsmittel haben. – Du sprichst wahr, erwiderte er; sie werden es wenigstens nicht willig annehmen, und sie bringen allerdings ihrerseits etwas vor, aber nicht so Bedeutendes, als sie glauben, sondern das Wort des Themistokles ist ganz richtig, welcher jenem SeriphierDie Bewohner von Seriphus, einer der cycladischen Inseln, scheinen überhaupt schon zur Zeit des Aristophanes (s. dessen Acharn. V. 516) wegen der Unbedeutendheit ihres Ländchens zur Zielscheibe des Spottes geworden zu sein; warum eigentlich, wissen wir nicht; denn die Insel war wohl unfruchtbar, aber besaß sehr bedeutende Bergwerke; auch hielten sich die Seriphier in den Perserkriegen höchst wacker. auf die Schmähung, daß er nicht wegen seiner selbst, sondern nur wegen seiner Vaterstadt ein berühmter Mann sei, antwortete, daß weder er selbst, wenn er ein Seriphier wäre, einen Namen bekommen hätte, noch Jener, wenn er ein Athener wäre. Auch für diejenigen denn nun, welche nicht reich sind, ihr Greisenalter aber schwer ertragen, ist eben der nemliche Ausspruch ganz richtig, daß weder der Süchtige gar leicht das Greisenalter verbunden mit Armuth ertragen dürfte, noch der Untüchtige, wenn er reich geworden, je in sich selbst zufrieden sein wird. – Hast du aber, o Kephalos, sagte ich, von demjenigen, was du besitzest, den größeren Theil schon überkommen oder ihn erst selbst erworben? – Was ich selbst erworben habe, sagte er, frägst du, o Sokrates? So ziemlich in der Mitte stehe ich bezüglich der Geldgeschäfte zwischen meinem Großvater und meinem Vater; mein Großvater nemlich, welcher ebenso hieß wie ich, hat ungefähr das gleiche Vermögen, welches ich jetzt besitze, überkommen, es aber dann vielmal so groß gemacht, als es war; hingegen Lysanias mein Vater machte es noch kleiner als das jetzige ist; ich aber bin es zufrieden, wenn ich es diesen da nicht kleiner hinterlasse, sondern um irgend ein Weniges größer, als ich es überkommen. – Weshalb aber ich dich fragte, sagte ich, liegt darin, weil es mir schien, als schätzest du das Geld nicht sehr außerordentlich; so machen es aber meistens jene, welche es nicht selbst erworben haben, hingegen diejenigen, welche es erwarben, lieben es doppelt so sehr als die Uebrigen; sowie nemlich die Dichter ihre Dichtwerke und die Väter ihre Kinder schätzen, so wenden diejenigen, welche sich Geld gemacht haben, sowohl in dieser Beziehung ihren Eifer auf das Geld als ihr eigenes Werk, als auch gemäß dem Bedürfnisse in der nemlichen Beziehung wie auch die Uebrigen. Schwierig ist daher mit ihnen umzugehen, weil sie nichts Anderes, als nur den Reichthum preisen wollen. – Da sprichst du wahr, sagte er. –
5. Allerdings wohl, erwiederte ich. Aber sage mir auch noch Folgendes: Welches ist das größte Gut, das du von dem Besitze eines großen Vermögens genossen zu haben glaubst? – Etwas, antwortete er, wovon ich vielleicht nicht Viele überzeugen könnte, wenn ich es ausspreche. Du weißt nemlich wohl, o Sokrates, daß wenn Jemand nahe daran ist, den bevorstehenden Tod zu erwarten, ihn Furcht und Bedenken über Dinge beschleichen, über welche sie ihn vorher nie beschlichen; denn sowohl die über die Verhältnisse im Hades allgemein verbreiteten Sagen, daß, wer hier Unrecht gethan, dort bestraft werde, über welche er bis dahin gelacht hatte, bringen dann nun in seiner Seele eine Wendung hervor, ob sie nicht vielleicht doch wahr seien, als auch er selbst sieht, entweder in Folge der Schwäche des Greisenalters, oder weil er gleichsam dem dortigen schon näher ist, diese Dinge irgend in höherem Grade. Am Schlusse des ganzen Werkes (nemlich B. X, Cap. 13) kehrt Plato auf diesen Punkt wieder zurück. Es hatte das Gespräch mit dem greisen Kephalos jetzt zur Erwähnung jener Belohnung oder Bestrafung geführt, welche dem gerechten oder ungerechten Leben im Jenseits nachfolgt; und nachdem diese Wendung des Gespräches in dem Munde eines Mannes, welcher selbst schon an der Grenze des Lebens steht, nahe genug gelegen war, ist es nun der eigenthümlichen Gesprächsweise des Sokrates völlig angepaßt, wenn derselbe einen einzelnen sich ergebenden Punkt aufgreift, um ihn der umfassenden begrifflichen Erörterung zu unterwerfen (vgl. m. Anm. 37 z. Gastmahl und Anm. 59 z. Phädrus). Somit dreht sich nun alsbald die Unterredung um den Begriff der Gerechtigkeit, und im Munde des Sokrates entfaltet sich diese Erörterung zur Lehre vom Staate; jene Wirkung aber des Gerechten und Ungerechten, welche sich über dieses Leben hinaus erstreckt, bildet wieder den Abschluß der gesammten Untersuchung.; von Besorgniß aber und Furcht wird er hiemit erfüllt, und er rechnet bereits zurück und erwägt, ob er Jemandem irgend Unrecht gethan habe. Derjenige also, welcher in seinem eigenen Leben vieles Unrecht findet, ist, indem er auch aus dem Schlafe, wie die Kinder, häufig erwacht, stets in Furcht und führt sein Leben mit schlimmer Erwartung; jenem hingegen, welcher sich nichts Ungerechtes bewußt ist, steht immer eine freudige und gute Erwartung zur Seite als Pflegerin seines Alters, wie auch PindarDie hier folgenden Worte Pindar’s sind ein uns weiter nicht bekanntes Fragment (s. in Böckh’s Ausg. IV, S. 672); auf metrische Uebersetzung derselben verzichtete ich gerne, da es sich hier mehr um den wörtlichen Sinn, als um die Versform handeln dürfte. sich ausdrückt; nemlich gar zierlich ja, o Sokrates, hat jener es ausgesprochen, daß, wer gerecht und heilig sein Leben geführt hat,
»diesem eine süße Erwartung, sein Herz aufnährend, als Pflegerin des Greisenalters das Geleit gibt, welche auch zumeist den vielbewegten Sinn der Sterblichen lenkt;« –
trefflich also sagt er dieß, wirklich in staunenswertem Grade. Im Hinblicke auf dieses demnach stelle ich die Behauptung auf, daß der Geldbesitz sehr viel werth sei, nicht jedoch für jedweden Mann, sondern nur für den tüchtigen; nemlich um auch nicht unfreiwillig Jemanden zu täuschen oder zu belügen, und um auch hinwiederum nicht in Furcht wegen einer Schuld, sei es an irgend Opfern gegen einen Gott oder sei es an Geld gegen einen Menschen, dorthin dann abzugehen, trägt der Geldbesitz gewiß einen großen Theil bei; derselbe hat aber auch andere vielfache Anwendungen; hingegen ja Eins gegen Eins gerechnet wäre eben jenes wenigstens nicht das unbedeutendste, bezüglich dessen ich für einen verständigen Mann, o Sokrates, den Reichthum als das nützlichste aufstellen möchte. – Sehr richtig, sagte ich, sprichst du, o Kephalos. Aber was eben dieses, nemlich die Gerechtigkeit, betrifft, sollen wir etwa in Wahrheit sagen, daß sie schlechthin gerade darin bestehe, Etwas wieder zu erstatten, wenn man es von Jemandem bekommen hat, oder kann man wohl auch selbst dieses bald in gerechter bald in ungerechter Weise thun? wie z. B. ich meine Folgendes: ein Jeder würde doch wohl sagen, daß, wenn Jemand von einem befreundeten, völlig bei Sinnen seienden Manne Waffen bekommen hat, er dieselben, falls jener im Zustande des Wahnsinnes sie zurückfordern würde, weder zurückerstatten solle, noch auch es gerecht wäre, sie zurückzuerstatten oder hinwiederum gegen den in einem solchen Zustande befindlichen die ganze Wahrheit sagen zu wollen. – Du hast Recht, sagte er. – Nicht also ist dieses die Begriffsbestimmung der Gerechtigkeit, daß man sowohl die Wahrheit sage, als auch zurückerstatte, was man bekommen hat.
Allerdings doch wohl, o Sokrates, sagte Polemarchos in die Rede fallend, woferne man wenigstens irgend dem SimonidesEinzelne sittliche Kernsprüche, welche in den lyrischen und elegischen Werken des bekannten Dichters Simonides von Keos (geb. 559 v. Chr., gest. 469) enthalten waren, werden öfters von Plato als Anfangspunkt begrifflicher Erörterungen benützt. glauben soll. – Und in der That ja auch, sagte Kephalos, überlasse ich euch hiemit die Fortsetzung der Unterredung, denn bereits ist es Zeit, daß ich meine Opfer besorge. – Nicht wahr also, sagte ich, Polemarchos ist der Erbe des deinigen? – Ja wohl, sagte jener lachend, und zugleich ging er fort zu seinen OpfernSehr einfältig ist es, wenn Cicero (ad Att. IV, 16, 3) als Grund des Zurücktretens des Kephalos aus dem Gespräche angibt, daß Plato es für unpassend gehalten habe, einen so bejahrten Mann in einem so langdauernden Gespräche als mitredend beizubehalten. Wer aber von der Einrichtung eines sokratischen Gespräches schlechterdings Nichts versteht, und nicht einmal bemerkt, daß der greise Kephalos von Plato nur dazu benützt ist, um an ein erfahrungsreiches und langdauerndes Leben die Erwähnung des Begriffes eines gerechten Lebens zu knüpfen (s. oben Anm. 7), würde jedenfalls besser thun, über solche Dinge ganz zu schweigen.. –
6. So sprich denn nun, sagte ich, du Erbe der Unterredung, von welchem Ausspruche des Simonides betreffs der Gerechtigkeit behauptest du, daß er richtig sei? –»Daß«, erwiederte jener, »das Zurückerstatten des einem Jeden geschuldeten gerecht ist«, – mit diesem Ausspruche scheint er mir wenigstens Recht zu haben. – Aber allerdings ja, sagte ich, ist es nicht leicht, gegen einen Simonides ungläubig zu sein; denn weise und göttlich ist dieser Mann. Jedoch eben jenes, was er hiemit sagen wolle, erkennst vielleicht du, o Polemarchos, ich hingegen verstehe es nicht; denn klar ist, daß er nicht dasjenige meint, wovon wir so eben sprachen, daß man, wenn Jemand Etwas zur Aufbewahrung übergeben hat, man es Jedwedem, welcher auch nicht bei voller Besinnung es zurückfordert, zurückerstatten solle; und doch ist ja wohl, was er zur Aufbewahrung übergab, ein Geschuldetes; oder wie? – Ja gewiß. – Zurückzuerstatten aber ist es ja auch in keinerlei Weise, wenn Jemand nicht bei voller Besinnung es zurückfordert? – Dieß ist wahr, sagte er. – Irgend etwas Anderes demnach als das derartige meint, wie es scheint, Simonides unter dem Ausspruche, daß gerecht sei, das Geschuldete zurückzuerstatten. – Ja wahrlich bei Gott etwas Anderes, erwiederte er; er meint nemlich, die Freunde seien den Freunden schuldig, ihnen etwas Gutes zu thun, aber nichts Schlimmes. – Ich verstehe es nun, sagte ich, daß hiebei nicht derjenige das Geschuldete zurückerstattet, welcher Jemandem das zur Aufbewahrung übergebene Gold zurückerstattet, wann nemlich die Zurückerstattung und das Zurückerhalten schädlich ist und beide, nemlich der Zurückerhaltende und der Zurückerstattende, einander befreundet sind. Sagst du nicht, daß so es Simonides meine? – Ja wohl, allerdings. – Was aber nun? Müssen wir den Feinden zurückerstatten, was ihnen eben geschuldet wird? – Ja wohl durchaus, erwiederte er, nemlich eben, was man ihnen schuldet; geschuldet aber wird ja, glaube ich, dem Feinde von dem Feinde, was denselben auch gebührt, nemlich irgend Schlimmes. –
7. In einem Räthsel also, sagte ich, hat, wie es scheint, Simonides in dichterischer Weise angedeutet, was das Gerechte sei; nemlich er hatte dabei, wie sich nun zeigt, in Gedanken, daß das Zurückerstatten des einem Jeden Gebührenden gerecht sei, dieß letztere aber nannte er das Geschuldete. – Aber was meinst du hiemit? sagte er. – Bei Gott, erwiederte ich, wenn ihn also Jemand folgendermaßen fragen würde: Höre Simonides, wem und welches Geschuldete oder Gebührende muß denn nun eine Kunst erstatten, um Arzneikunst genannt zu werden? was glaubst du, daß er uns da wohl antworten würde? – Klärlich, sagte er, ist es jene Kunst, welche den Körpern sowohl Arzneien als auch Speisen und Getränke erstattet. – Wem aber und welches Geschuldete oder Gebührende muß eine Kunst erstatten, um Kochkunst genannt zu werden? – Es ist jene, welche den Speisen die Gewürze erstattet. – Weiter; wem und was muß eine Kunst erstatten, um etwa Gerechtigkeit genannt zu werden? – Wenn ich irgend, o Sokrates, sagte er, dem vorher Gesagten folgen soll, so ist dieß jene, welche den Freunden und den Feinden Nutzen und Schaden erstattet. – Den Freunden also Gutes zu thun und den Feinden Schlimmes, nennt er hiemit Gerechtigkeit? – So scheint es mir. – Wer nun hat die meiste Fähigkeit, den darniederliegenden Freunden Gutes und den Feinden Schlimmes zu thun in Bezug auf Krankheit und Gesundheit? – Der Arzt. – Wer aber den zur See fahrenden in Bezug auf die Gefahren des Meeres? – Der Steuermann. – Was aber nun? Bei welchem Thun und in Bezug auf welches Ding hat der Gerechte die meiste Fähigkeit, den Freunden zu nützen und den Feinden zu schaden? – In der gegenseitigen Kriegführung und Bundesgenossenschaft, scheint mir wenigstens. – Weiter; aber nun ja, wenn sie nicht krank sind, dann, o lieber Polemarchos, ist ihnen der Arzt unnütz. – Ja wahrlich. – Und wenn sie nicht zur See fahren, dann wohl der Steuermann? – Ja. – Also ist wohl auch denjenigen, welche nicht Krieg führen, der Gerechte unnütz? – Dieß scheint mir nicht völlig so. – Also nützlich ist auch im Frieden die Gerechtigkeit? – Ja, nützlich. – Denn es ist dieß ja auch die Landbaukunde, oder nicht? – Ja. – Neulich ja zum Besitze der Feldfrucht? – Ja. – Und doch wohl nun auch die Kunst des Schusters? – Ja. – Nemlich ja zum Besitze der Schuhe, würdest du doch wohl, glaube ich, sagen? – Ja, allerdings. – Was aber nun weiter? zu wessen Gebrauch oder Besitz würdest du die Gerechtigkeit als etwas im Frieden Nützliches bezeichnen? – In Bezug auf den Geschäftsverkehr, o Sokrates – Unter Geschäftsverkehr aber verstehst du irgend eine Theilnehmerschaft oder sonst Etwas? – Nun gut, eine Theilnehmerschaft. – Wird also nun der Gerechte ein guter und nützlicher Theilnehmer beim Brettspiele in Bezug auf Anordnung der Spielsteine sein, oder derjenige, welcher das Brettspiel versteht? – Jener, welcher das Brettspiel versteht. – Aber in Bezug auf Anordnung der Backsteine und Bruchsteine, wird da der Gerechte ein nützlicherer und besserer Theilnehmer sein als der Baumeister? – Keinenfalls. – Aber zu welcher Theilnahme denn nun ist der Gerechte ein besserer Theilnehmer, als etwa der Citherspieler, sowie nemlich der Citherspieler zum Anschlagen der Saiten ein besserer ist als der Gerechte? – Zur Theilnahme am Gelde, scheint mir wenigstens. – Ja, nur vielleicht eben, o Polemarchos, nicht zur Verwendung des Geldes, wann man um Geld gemeinschaftlich ein Pferd kaufen oder verkaufen soll; denn dann ist, wie ich wenigstens glaube, der Pferdekundige der bessere; oder wie? – Ja, so zeigt sich’s. – Und nun aber, wann ein Fahrzeug, dann ist es der Schiffbauer oder der Steuermann? – Es scheint so. – Also bei welcher gemeinschaftlicher Verwendung des Silbers oder des Goldes ist der Gerechte nützlicher als die Uebrigen? – Wann man es zur Aufbewahrung übergeben und unversehrt wissen will, o Sokrates. – Nicht wahr, also du meinst hiemit, wann man es zu weiter Nichts verwenden, sondern dasselbe ruhig liegen lassen soll? – Ja allerdings. – Also wann das Geld unnütz ist, dann ist in Bezug auf dasselbe die Gerechtigkeit nützlich? – Es kömmt darauf hinaus. – Und demnach, wenn man eine Hippe aufbewahren soll, dann ist die Gerechtigkeit sowohl bezüglich der Theilnahme als auch für den Einzelnen nützlich; hingegen wann man sie verwenden soll, ist die Kunst des Weinbauers nützlich? – Ja, so zeigt sich’s. – Du wirst aber auch behaupten, daß wann man einen Schild und eine Leyer aufbewahren und zu Nichts verwenden soll, die Gerechtigkeit nützlich sei; wann man sie hingegen verwenden soll, die Kunst des Kriegers und die Tonkunst? – Ja, nothwendig. – Also auch bei dem sämmtlichen Uebrigen demnach ist die Gerechtigkeit für die Verwendung eines jeden einzelnen Dinges unnütz, für die Nutzlosigkeit desselben aber nützlich? – Es kömmt darauf hinaus. –