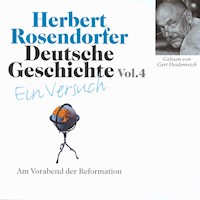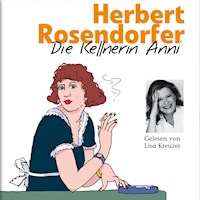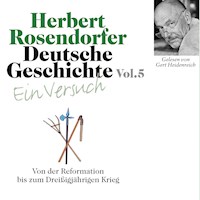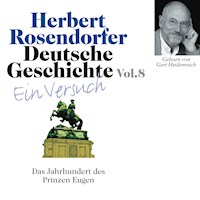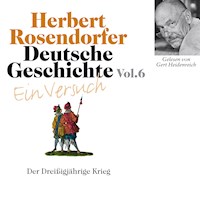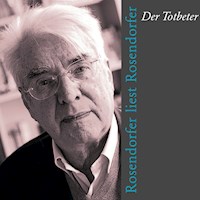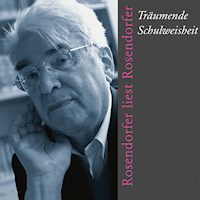9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit diesen hintergründigen und üppig wuchernden Grotesken und Visionen – darunter die Erzählung vom Abtransport des Eiffelturms zur Münchner Olympiade oder die zukunftsweisende Geschichte vom nicht alternden, weil in einer Tiefkühltruhe «stillgelegten» Menschen – führte der von der Kritik einmütig gefeierte Autor erneut die Frage ad absurdum, ob das Geschichtenerzählen noch einen Sinn habe. Rosendorfers Geschichten funkeln von satirischer Brillanz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Herbert Rosendorfer
Der stillgelegte Mensch
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Mit diesen hintergründigen und üppig wuchernden Grotesken und Visionen – darunter die Erzählung vom Abtransport des Eiffelturms zur Münchner Olympiade oder die zukunftsweisende Geschichte vom nicht alternden, weil in einer Tiefkühltruhe «stillgelegten» Menschen – führt der von der Kritik einmütig gefeierte Autor erneut die Frage ad absurdum, ob das Geschichtenerzählen noch einen Sinn habe. Rosendorfers Geschichten funkeln von satirischer Brillanz.
Über Herbert Rosendorfer
Herbert Rosendorfer wurde 1934 in Bozen/Südtirol geboren und wuchs in München und Kitzbühel auf. Nach dem Abitur studierte er zunächst an der Kunstakademie, dann Jura. Er lebte als Amtsgerichtsrat in München. 1970 erschien sein erster Roman «Der Ruinenbaumeister».
Inhaltsübersicht
In tiefer Ehrfurcht
Ihrer Durchlauchtigsten Hoheit
LOUISE NICOLÄA
Prinzessin von Lothringen-Harcourt-Armagnacund zu Marsan, hoch-ehrwürdige Äbtissinzu Remirmont, gewidmet
Knabe, mit einer Katze spielend
Der alte Oberstaatsanwalt F. erzählt:
Wenn Sie von hier aus zum Café ‹Hippodrom› gehen, das Sie ja, meine lieben jungen Kollegen, besser kennen als die Strafprozeßordnung, kommen Sie an einem alten Brunnen vorbei. Gleich neben dem Brunnen öffnet sich die Häuserfront ein wenig, denn dort mündet eine stille Gasse in den Lärm des vorüberflutenden Verkehrs – einer der wenigen stillen Winkel, die wir hier herum noch haben. Die stille Gasse erweitert sich drinnen ein wenig und bildet an der ziemlich schäbigen Hinterfassade eines großen Hotels einen dreieckigen Platz, den die alten Leute ‹Blasiusbergl› nennen; kein Mensch weiß warum, denn es geht dort weder bergauf noch bergab. Es ist wohl auch längst gleichgültig, denn die Gasse heißt inzwischen Straße und benennt sich nach irgendeinem vermutlich verdienstvollen Bürgermeister oder Bischof.
Das ‹Blasiusbergl› wird von der erwähnten schmutzigen sechsstöckigen Fassade der Hotelrückseite beherrscht, aber in ihrem Schatten gibt es ein paar alte Häuser, und in einem dieser Häuser würden Sie, ohne lange suchen zu müssen, einen jahraus, jahrein verschlossenen Laden finden, über dem in langsam abblätternden Goldbuchstaben ‹Kunsthandlung Krantz› steht. Im Mordfall Krantz hat es nie ein Urteil gegeben, obwohl nicht nur ich den Mörder kenne. Ob allerdings der Mörder heute noch lebt, weiß ich nicht, denn die Sache liegt viele Jahre zurück.
Anselm Krantz, der alleinige Inhaber der Kunsthandlung Krantz, war ein Sonderling gewesen. Ich habe ihn noch als Lebenden gekannt, war hie und da in seinem Laden und habe natürlich nicht geahnt, daß ich ihn eines Tages als Toten, als gräßlich verstümmeltes Opfer eines Mordes würde sehen müssen. Krantz lebte ganz allein, war unverheiratet, hatte keine näheren und, wie sich nach seinem Tod herausstellte, kaum entferntere Verwandte, hatte keinen Anhang und, jedenfalls schien es so, auch keine Freunde. Er war, sooft man in seinen Laden kam, gleichbleibend unfreundlich und strahlte ein penetrantes Mißtrauen aus, wie ich es sonst kaum jemals bei einem Menschen beobachtet habe. Es mag sein, daß das auf sein körperliches Gebrechen zurückzuführen war: der große, füllige Mann war verwachsen. Er hatte einen Buckel wie der Glöckner von Notre Dame. Mag sein, dies war schuld an seinem ständigen Mißtrauen, mag sein, auch etwas anderes …
Er war übrigens ein wirklicher Kunsthändler, ein Fachmann von Rang und nicht etwa einer von den zahlreichen größenwahnsinnigen Gemüsehändlern, die jetzt alte Kaffeemühlen verkaufen, so wie sie früher Gurken und Zichorie verkauft haben. Krantz galt als Spezialist für Ostasiatica und handelte außerdem sehr viel mit moderner Graphik.
Der Mord an Anselm Krantz wurde deswegen in Anbetracht der Krantzschen Lebensgewohnheiten verhältnismäßig rasch entdeckt, weil die Inhaber der Nachbarläden bemerkten, daß Krantz’ Laden einige Tage lang geschlossen blieb, wobei nur das Scherengitter vor den beiden Auslagen und der Tür geschlossen war, während Krantz, wenn er – was öfter vorkam – verreiste, stets auch die Rolläden herunterzog und an der Tür einen Zettel anzubringen pflegte, auf dem er für seine Kunden die Dauer seiner Abwesenheit vermerkte. Nie, ohne jede Ausnahme in all den Jahren, in denen er sein Geschäft betrieb, hatte er einen Angestellten oder eine Aushilfe, einen Buchhalter und nicht einmal eine Putzfrau beschäftigt.
Man fand Krantz in seinem Schlafzimmer. Die Wohnung lag hinter seinem Laden, auch zu ebener Erde. Wohnung ist dabei fast zuviel gesagt. Krantz hatte offenbar schon vor Jahren die hinteren Nebenräume seines Ladens zu einem Schlafzimmer, einer Art Wohnküche und einem Bad ausbauen lassen. Mehr brauchte Krantz wohl nicht, denn eigentlich lebte er im Laden zwischen seinen antiken Möbeln, von denen er immer nur soviel verkaufte, daß eine notdürftige Einrichtung zurückblieb.
Die hinteren Räume waren finster, verwinkelt und glichen einem Fuchsbau. Es gibt solche Häuser, die sich, an der Straßenfront schmal und engbrüstig, wie Kitt in einer verzahnten Fuge hinziehen und ausdehnen, an der unglaublichsten Stelle einen Innenhof haben und vielleicht sogar – wo man es am wenigsten erwartet – einen Garten. So ein Haus war das, in dem Krantz seinen Laden hatte. Sein Schlafzimmer war gewissermaßen das hintere Ende seines ‹Fuchsbaues›, und von dort aus führte nach einem kleinen Flur ein Separateingang auf eine ganz andere Straße hinaus. Eines war von vornherein klar, aber das half nicht viel, daß der Mörder durch diese hintere Tür die Wohnung nach der Tat verlassen haben mußte. Ob er die Wohnung auch durch diese Tür betreten hatte, war schon ungewiß.
Krantz lag mit dem Gesicht zur Erde mitten im Zimmer auf dem Boden. Er war nur mit Unterwäsche und einem Morgenmantel bekleidet. Die Arme waren seitwärts ausgestreckt. Die rechte Hand umklammerte die Lehne eines umgefallenen Stuhles. Krantz’ Schädel war völlig zertrümmert. Die Obduktion ergab, daß fünfzehn bis zwanzig Schläge mit einem stumpfen Gegenstand gegen den Schädel geführt worden waren. Da seit der Tat fünf bis sechs Tage vergangen waren, ehe man die Leiche fand, war sie schon in Verwesung übergegangen. Vor allem der zertrümmerte Schädel war grünlich verfärbt, und, mit allem Respekt vor dem lebenden Krantz, der tote stank bereits fürchterlich, als ich mit der Mordkommission – ich war damals Erster Staatsanwalt und hatte eines der Kapitaldeliktsreferate – das Zimmer betrat.
Der Polizeifotograf war gerade dabei, die Leiche und den Tatort zu fotografieren. Ich bemühte mich, den toten Krantz möglichst wenig zu sehen und vor allem nicht zu riechen, und schaute mir das Zimmer an. Ein großes, schweres Eichenbett war zerwühlt, aber nicht von einem Schlafenden, sondern so, als wäre jemand mehrmals auf das gemachte Bett geworfen worden. Das Bettzeug war blutverschmiert. Ein großer Blutfleck hatte den wertvollen alten persischen Seidenteppich getränkt, der offensichtlich vom gewaltigen Fall Krantz’ zusammengeschoben und aufgefaltet war. Neben der übrigen Unordnung, die, wie es so heißt, darauf schließen ließ, daß sich das Opfer verzweifelt gewehrt hatte, fielen vor allem drei Dinge auf: eine große bronzene Buddha-Statue, die mit Blut verschmiert und vermutlich der stumpfe Gegenstand war, mit dem der Mörder sein Opfer erschlagen hatte, weiter die Scherben einer großen chinesischen Vase, die keine Blutspuren aufwies, also vielleicht von Krantz dem Mörder auf den Kopf geschlagen worden war, und schließlich ein zierlicher Biedermeier- Sekretär aus Kirschbaumholz, dessen Schubladen durchwühlt worden waren. Es ergab sich also, um hier gleich spätere Erwägungen vorwegzunehmen, die Frage, ob der Mord an Krantz ein Raubmord war. Ob der Mörder in Krantz’ Sekretär nach Geld gesucht hatte oder nach etwas anderem, wußten wir nicht. Unter den ganzen Papieren, die verstreut an, in und um den Sekretär lagen, befand sich kein Geld. Ob der Mörder kein Geld gefunden oder aber das vorhandene Geld mitgenommen hatte, konnten wir nicht feststellen, weil ja niemand über Krantz’ Vermögensverhältnisse Bescheid wußte und ob und wo er Geld aufbewahrt hatte. Die Polizei neigte zur These ‹Raubmord›, denn auf dem Stuhl vor dem Sekretär lag eine große leere Geldtasche, eine Geldtasche, wie sie etwa Kellner haben: aus schwarzem Leder, ziehharmonikaförmig gefaltet, mit vielen Fächern. Mir schien aber diese Geldtasche so auffällig, so absichtsvoll und ins Auge springend hingelegt, als habe der Mörder seinen künftigen Verfolgern keinen Zweifel an seiner Raubabsicht lassen wollen. Diese leere Geldtasche war förmlich aufgepflanzt wie eine Fahne des Eroberers auf der gefallenen Festung. Das ist, drängte es sich mir auf, eine absichtliche Fährte, also eine falsche Fährte. Brauchbare Fingerspuren und ähnliches gab es übrigens nicht. Das Türschloß zur Wohnung war unversehrt, das hieß, das Opfer mußte seinen Mörder freiwillig in die Wohnung gelassen haben. Hatte das Opfer ihn gekannt?
Mit meinem Verdacht über die falsche Fährte kam ich bei der Polizei nicht recht an. Es war ja auch nur ein unwägbares, kaum zu schilderndes Gefühl bei mir. Demgegenüber brachte die Polizei sehr bald heraus, daß der Mörder tatsächlich etwa achthundert Mark mitgenommen haben mußte. Das war ziemlich einfach zu ermitteln, denn man überprüfte Krantz’ Bankkonten und seine recht sorgfältige Buchführung und kam so auf den fehlenden Betrag. Gut, sagte ich, der Mörder hat das Geld mitgenommen. Das besagt aber lange noch nicht, daß er es auf das Geld abgesehen hatte.
Es war da nämlich noch etwas anderes. Die große Buddha-Statue, mit der der Mörder Krantz erschlagen hatte, gehörte nicht zum Mobiliar von Krantz’ Schlafzimmer, sondern hatte vorher vorn im Laden gestanden. Der Buddha hatte einen eigenartig achteckigen Sockel mit geschweiften Ecken. Wir fanden vorn im Laden eine Stelle, einen Fleck, wo genau achteckig-geschweift weniger Staub war als rundherum. Der Sockel paßte genau auf den Fleck. Der Buddha mußte dort gestanden haben, und das war unmittelbar neben einer alten, gußeisernen Registrierkasse. In dieser Kasse waren 4000 Mark. Es war nämlich offenbar so, rekonstruierten wir, daß Krantz seine Tageseinnahmen jeden Abend mit nach hinten nahm und in die große Geldtasche tat. Alle zwei oder drei Wochen zahlte er, wenn er nicht irgend etwas ankaufte, das gesammelte Geld bei der Bank ein. Etwa zehn Tage, bevor er getötet wurde, hatte Krantz das letztemal etwas auf die Bank eingezahlt. In den zehn Tagen hatte er dann die vom Mörder mitgenommenen achthundert Mark eingenommen. (Angekauft hatte er in dieser Zeit nichts, das hätte er, wie stets, in seiner Buchführung vermerkt.) Am Tag seines Todes aber hatte Krantz ein größeres Stück verkauft. Es war ein alter chinesischer Wandteppich. Der Käufer, ein alter Kunde von Krantz, meldete sich auf den Suchaufruf hin bei der Polizei. Da sich der Käufer an den Tag erinnern konnte, an dem er das Stück gekauft hatte, wußten wir dann auch den Tag des Mordes. Aber was half das schon?
Der besagte Käufer hatte 4000 Mark für den chinesischen Teppich bezahlt; diese 4000 Mark waren in der Ladenkasse. Der Mörder hat zwar die 800 und soundsoviel Mark aus der Geldtasche mitgenommen, die 4000 Mark aus der Ladenkasse aber dagelassen, sagte ich zur Polizei, obwohl er im Laden vorn gewesen sein mußte, um seine Mordwaffe, den bronzenen Buddha, zu holen.
– Von den 4000 hat der Mörder eben nichts geahnt, sagte der Kriminalbeamte.
Ich deutete auf den oberen Teil der Registrierkasse. Dort stand noch die zuletzt registrierte Kassensumme: 4–0–0–0, in großen, deutlichen Emaille-Ziffern. Deutlicher, sagte ich, kann man es einem Raubmörder doch nicht sagen, daß Geld in der Kasse ist.
– Vielleicht, sagte der Inspektor, war der Mörder – wäre ja nicht verwunderlich – etwas verwirrt, in Eile, hat nicht daran gedacht? Außerdem – vielleicht war der Mörder gar nicht vorn im Laden? Vielleicht hat Krantz selber noch, aus irgendeinem Grund, den Buddha nach hinten getragen?
– Gut, sagte ich, aber merkwürdig ist es schon.
Es gingen Jahre ins Land. Der Mordfall Krantz wurde nicht geklärt. Man fand die eine oder andere Spur. Keine führte zu etwas. Es stellte sich heraus, daß Krantz eine etwas abartige Neigung zu ganz jungen Mädchen gehabt hatte, aber was half das weiter? Dienstlich hatte ich sehr bald nichts mehr mit der Sache zu tun, denn ich kam vom Kapitaldeliktsreferat weg. Die Öffentlichkeit hatte ohnedies den Mordfall nach kurzer Zeit vergessen.
Eines Tages besuchte ich die große Kunstausstellung, die, wie Sie wissen, jedes Jahr im Sommer mit Bildern und Plastiken zeitgenössischer Künstler veranstaltet wird. Ich ging, wie es meine Gewohnheit ist, zunächst einmal schnell und kursorisch durch die Räume der Ausstellung, dann ein zweitesmal langsam und gründlich. Dabei sah ich in einem der kleineren Nebensäle ein Bild, dessen Anblick mich wie der sprichwörtliche Keulenschlag traf.
Damals nämlich im Schlafzimmer von Krantz, im Mordzimmer, gab es noch etwas, was ich absichtlich bisher noch nicht erzählt habe. Der Tatort wies, wie es in den betreffenden Polizeiberichten immer heißt, Spuren heftigen Kampfes auf. Das habe ich schon erwähnt. Diese Spuren befanden sich naturgemäß größtenteils am Boden und waren vom Polizeifotografen im Bild festgehalten worden. Er hatte das Bett und einen halb heruntergerissenen Vorhang fotografiert, nicht aber das – es schien zugestandenermaßen unwesentlich –, was der Vorhang verdeckt hatte: ein Bild. Es war ein eigenartiges Bild, ein Ölbild von etwa eineinhalb mal einem Meter Größe im Hochformat. Es war das Porträt eines Kindes, eines sehr schönen Knaben von etwa sechs Jahren. Das Bild war offensichtlich von einem tüchtigen Porträtmaler der alten Schule des 19. Jahrhunderts gemalt, wies allerdings, wenn man so sagen kann, einen Anflug von Jugendstil auf: die Haltung des Kindes war ein wenig starr und geziert, die Staffage zum Ornament geronnen; die typischen pastosen Grün-, Lila- und vor allem Goldtöne herrschten vor. Der Knabe auf dem Bild blickte über die Schulter zum Beschauer und hielt mit der linken Hand einer Katze einen Ring hin. Die Katze langte spielerisch mit einer Pfote nach dem Ring, schaute aber, wie der Knabe, aus dem Bild heraus.
Und dieses Bild ‹Knabe, mit einer Katze spielend›, sah ich in der großen Kunstausstellung wieder, das heißt: nicht das Bild, die Darstellung sah ich wieder. Das Bild, das in der Kunstausstellung hing, war wohl etwas größer als das Krantzsche. Es war in der Manier des neuen ‹Phantastischen Realismus› gemalt, die Farben waren kräftiger, es waren sowohl ein anderes Kind als auch eine andere Katze abgebildet. Aber sonst war auf diesem Bild alles so wie auf jenem: der Knabe blickte über die Schulter zum Beschauer. In der linken Hand hielt er der Katze den Ring hin …, die Katze langte mit der Pfote spielerisch nach dem Ring …
Als ich diesen Knaben, mit einer Katze spielend, wiedersah, lag der Mordfall Krantz vier Jahre zurück. Vielleicht hatte mich die Sache, ohne daß ich es selber recht wußte, sozusagen unterschwellig die ganzen Jahre hindurch beschäftigt. Auch hatte ich mich oft ganz bewußt an den Fall erinnert, stets dann nämlich, wenn ich an dem Krantzschen Laden am Blasiusbergl vorbeiging. Nicht lange bevor ich jene Kunstausstellung besuchte, hatte ich bei so einer Gelegenheit gesehen, daß der Laden immer noch geschlossen war. Weinlein, um das hier anzufügen, hieß der Maler des Bildes in der Kunstausstellung: Sascha Weinlein.
Im Katalog stand, daß er gerade vierzig Jahre alt war, schon mehrere Preise gewonnen hatte und draußen in St. Xaver, einem Ort an einem See, lebte. Da diese Ausstellung stets auch eine Verkaufsausstellung ist, bekam ich, den Vorwand vorgebracht, ich interessiere mich für das Bild, unschwer die genaue Adresse des Künstlers. Aber was heißt Vorwand: ich interessierte mich ja wirklich brennend für das Bild, allerdings in einer Weise, die die Sekretärin im Ausstellungsbüro, die mir die Adresse gab, nicht ahnte.
Als ich die Ausstellung verließ, begann sich der Tag, ein schöner, warmer Sommersonntag, in einer sanften, breiten Rampe aus Zeit allmählich zur Dämmerung hinabzusenken. Sie wissen, ich bin Junggeselle, ich lebe allein, ich bin nicht mehr der Jüngste: so habe ich es nie eilig. Der Weg zu einem Restaurant, in dem ich häufig zu Abend esse, führte mich ohne einen großen Umweg am Blasiusbergl und an Krantz’ ehemaligem Laden oder, besser gesagt: an dem Laden des ehemaligen Krantz vorbei. Manchmal, in glücklichen Stunden, siegt die Vergangenheit. Am Blasiusbergl ist wochentags schon nicht mehr viel los. Am Sonntag rührt sich dort überhaupt nichts. Die Türme und die grüne Kuppel der Kajetanskirche leuchteten über den Dächern, während in den engen Gassen eine Dämmerung aus, Umbratönen die Häuserfassaden auflöste. Hie und da blinkte ein halboffenes Fenster in einem zufälligen Sonnenstrahl, und aus dem Schaufenster einer Bäckerei – dem Nachbarladen von Krantz – schimmerte wie aus der Tiefe eines Aquariums eine große goldene Brezel. Manchmal gibt es solche glücklichen Stunden, wo Augenblicke einer alten Zeit herüberwehen, wo in einem Winkel einer Stadt das zweite Gesicht der Fassaden herausbricht und die Gegenwart überstrahlt. Bei uns hier ist es dann meist eine Biedermeier-Vedute, in zarten Farben handkoloriert, mit lebhaft gegliederten, aber eleganten Fassaden und einem lichtgelben, ins blasse Violett spielenden Himmel. Ich blieb vor Krantz’ Laden stehen. Das Gitter war heruntergelassen. Dicker Staub lag auf allen Gegenständen, die man durch das schon fast blinde Fenster sehen konnte. Es war wohl alles so geblieben, wie es am Tag des Mordes vor vier Jahren war. Die buckelige alte Schaufensterscheibe spiegelte das wellige Gitter und nicht mein Bild, nein: einen Archivarius Lindhorst oder so etwas Ähnliches. Ich starrte lange in den düsteren Laden, bis ein einzelner Viertelstundenschlag vom Turm der Kajetanskirche den Bann zerriß. Ich wandte mich ab, ging hinaus auf den M.-Platz. Die Biedermeier-Vedute bröckelte ab und sank zurück in die Tiefe der Zeit.
Es hatte nicht Father Browns kleiner grauer Zellen bedurft, meine sicher bescheideneren hatten genügt, und auch die hatte ich nicht über Gebühr strapazieren müssen, als ich nachher – ich saß in meinem Restaurant und aß, wenn ich mich recht erinnere, ein Salbeischnitzel und Morcheln auf Toast – alles, fast alles von dem Mord wußte. Sie werden es sich ja auch schon zusammenreimen. Was ich dann am nächsten Tag über den Fall in Erfahrung bringen konnte (ich setzte mich natürlich sogleich mit meinem Nachfolger im Kapitaldeliktsreferat in Verbindung, ließ mir die Akten bringen, beanspruchte ein wenig die Mühe der Kriminalpolizei), bestätigte nur, daß ich richtig überlegt hatte.
Um Krantz’ Vermögen, das nicht unbeträchtlich war und zu dem auch das Haus seines Ladens gehörte, stritten sich immer noch die Erben, entfernte Verwandte von Krantz. Ein komplizierter Prozeß schwebte beim oder, besser, ruhte im Schoße des Oberlandesgerichts. Es ging dabei, soviel ich weiß, um grundsätzliche erbrechtliche Fragen. Der Nachlaß war noch nicht einmal inventarisiert. Das Nachlaßgericht hatte zur Sicherung des Nachlasses den Laden versiegeln lassen. Niemand, außer in den allerersten Tagen nach dem Tod des Inhabers der Nachlaßpfleger, vielleicht der Gerichtsvollzieher hat den Laden und die Wohnung Krantz’ betreten. Vorher, zu Krantz’ Lebzeiten, war, wie wir wußten, auch so gut wie niemand in seine Wohnung gekommen. Außerdem war das merkwürdige Bild von dem Vorhang verhüllt gewesen, den erst in der Verzweiflung des Kampfes das Opfer, wohl beim Versuch, sich irgendwo festzuhalten, heruntergerissen hatte. Es gab also nach menschlichem Ermessen nur einen einzigen, der das Bild kennen konnte: der Mörder. Und der Maler jenes Bildes, das ich eben in der Ausstellung gesehen hatte, mußte das Bild in Krantz’ Schlafzimmer gekannt haben. Es war eine Kopie aus dem Gedächtnis. Ein Zufall, eine Erfindung von so genauer Parallelität, erscheint mir, das muß ich auch bei strengster Beanspruchung der gebotenen juristischen Zweifel sagen, jenseits jeder denkbaren Wahrscheinlichkeit.
Als der Mörder, der Maler Sascha Weinlein, mit der schweren bronzenen Buddha-Figur ausholte, Krantz, der massige, bucklige alte Mann, im Sturz den Vorhang vor dem Bild mit sich riß und dann der Metallfuß der Figur wie ein gräßlicher Hammer auf den Schädel des Opfers niederkrachte, enthüllte der sterbende oder schon tote, verwachsene, häßliche und verstümmelte Krantz das Bild jenes schönen Kindes, das mit so merkwürdigen Augen über die Schulter aus dem Bild herausschaut. Es ist alles, stelle ich mir vor, so gut wie im gleichen Moment geschehen, und das Krachen des Mordwerkzeuges auf den Kopf des Opfers hat den Blick des Knaben auf dem Bild im Gedächtnis des Malers festgenagelt, unauslöschlich, ganz unauslöschlich fixiert. Es war, ich weiß nicht, ob Sascha Weinlein das gewußt hat, ein Porträt Krantzens, ein Porträt des häßlichen Krantz, als er noch ein schönes Kind war.
Ich besuchte dann natürlich auch den Maler Weinlein ganz scheinheilig draußen in St. Xaver am See. Er war sehr freundlich, freilich, er vermutete in mir einen Kunden. Ich hätte auch fast ein Bild von ihm gekauft … Der Besuch in seinem Atelier überraschte mich nicht. Er konnte zwar auch ein paar andere Bilder herzeigen, den überwältigend größeren Anteil seines Schaffens aber machten Bilder aus, die ein Kind darstellten, das einer Katze einen Ring zum Spielen hinhält. Die Darstellung gab es in großen und kleinen Formaten, mit verschiedenen Hintergründen, verschiedener Aufteilung der Proportionen, verschiedenen Farben, einige waren spiegelverkehrt, offensichtlich hatten unterschiedliche Katzen und unterschiedliche Kinder als Modelle gedient. Im wesentlichen war das Bild aber immer das gleiche.
Auf meine Frage, die mir angesichts der wohl jedem Beschauer auffallenden Häufung jener Darstellung in den Bildern Weinleins ganz harmlos erschien, warum er so oft dieses merkwürdige Sujet wähle, zuckte der Maler nur mit den Schultern. Ich habe nichts weiter gesagt. Fast hätte ich eines von den Kind-Katze-Bildern gekauft. Aber dann habe ich mir gedacht: besser vielleicht doch nicht.
Ja, das ist die Geschichte. Zu einem Prozeß gegen Sascha Weinlein ist es nie gekommen. Man sieht, wie wenig ernst die Kunst im sogenannten nüchternen Leben genommen wird. Auf meine Anordnung wurde der Fall zwar nochmals aufgerollt, sogar ein Ermittlungsverfahren gegen Weinlein eingeleitet, der, wohl von einem Verteidiger beraten, von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte. Ein paar Indizien, die im Laufe der neuerlichen Ermittlungen auftauchten, alarmierten zwar: Sascha Weinlein und Krantz hatten sich, das stand objektiv fest, gekannt. Krantz hatte mehrfach Bilder Weinleins an- und weiterverkauft. Wenige Tage nach der Tat hatte Weinlein eine Summe von 800 und einigen Mark der ‹Amnesty International› überwiesen, etwa den Betrag also, der nach dem Mord bei Krantz vermutlich entwendet worden war. Und endlich war Weinleins Frau, ein eher üppiges Wesen mit langen schwarzen Haaren – ich habe sie bei meinem Besuch in St. Xaver kurz gesehen –, gute zwanzig Jahre jünger als Weinlein, das heißt, sie war damals achtzehn, und das war vier, fünf Jahre nach dem Mord. Zur Zeit des Mordes muß sie also dreizehn, vierzehn gewesen sein. Krantz hatte einen Hang, wie ich schon erzählt habe, zu ganz jungen Mädchen. – Aber das alles, sagte bei einer abschließenden Dienstbesprechung, in der wir die Summe aller Verdachtsmomente zogen, der Erste Staatsanwalt Dr. H., der das zuständige Kapitaldeliktsreferat hatte, das alles nimmt uns letzten Endes kein Richter ab. – Ich mußte ihm beipflichten. Wir stellten dann das Verfahren ein.
– Es ist alles ganz schön, sagte Dr. H., Herr Oberstaatsanwalt, zu schön, ich möchte sagen: irgendwie poetisch. Sie sollten einmal eine Geschichte darüber schreiben.
Vielleicht tue ich es noch, eines Tages.
Der Eiffelturm
Bruno A. Rabe verteidigte sich später damit, daß die Idee ursprünglich gar nicht von ihm gewesen sei.
Sie stammte von einem Mann namens Hündlbacher, den Rabe als seinen Freund bezeichnete. Freund Hündlbacher äußerte die Idee so nebenbei, als Rabe wieder einmal versuchte, bei ihm Geld zu leihen. Später hatte Hündlbacher mit der Sache, die aus dieser Idee erwuchs, nichts mehr zu tun. Natürlich aber erfuhr er davon aus den Zeitungen.
Bruno A. Rabe war nicht eigentlich ein moderner Mensch, obwohl er sich – wie die Mittelinitiale zeigt – bemühte, up to date zu sein. Nur was unmodern ist, ist im Grunde genommen modern, das gilt für die Literatur genauso wie für die Damenoberbekleidung und ganz besonders für die Verbindung von beiden: für das Theater. In diesem Metier war Rabe tätig.
Obwohl man ihm mannigfache Talente fürs Theater nicht absprechen konnte, war er, kraß gesagt, zu dumm, um die heiklen Verflechtungen von Literatur und gesellschaftlichen Gegebenheiten zu erkennen. Konkret gesprochen: Rabe spielte unverdrossen Tennessee Williams, als unter wacheren Theaterleuten das Geraune um Ionesco längst zu einem Donner angeschwollen war. Als der Trend der Kellerbühnen zum Happening unverkennbar wurde, entschloß sich Rabe endlich, Ionesco zu spielen. Damals allerdings, als Rabe seinen Freund Hündlbacher anzupumpen versuchte, spielte er gar nichts. «Theaterferien», sagte er.
Es war Februar, eine ungewöhnliche Zeit für Theaterferien.
Theaterdirektor Rabe hatte zunächst, bevor er die Theaterferien deklarieren mußte, probeweise bei Kerzenlicht gespielt. Zwar war es ihm gelungen, Kerzen auf Kreditbasis zu beschaffen, aber schon bei der ersten Vorstellung erwies sich, daß die Kerzenbeleuchtung im Theater technisch kaum durchzuführen war, ganz abgesehen davon, daß diese Praxis vor der Feuerpolizei sorgsam verschwiegen werden mußte, also auch in der Werbung nicht verwertet werden konnte. Es war, mußte Rabe einsehen, letzten Endes einfacher, die schon überstrapazierten Geldquellen nochmals anzuzapfen und so das Geld für die offenen Lichtrechnungen irgendwie aufzutreiben.
Bei Hündlbacher war Rabes wünschelrutenfeine Nase für überzählige Zwanzigmarkscheine fündig geworden, als der Freund die erwähnte Idee von sich gab.
Diese Idee beruhte auf der Überlegung, daß es so gut wie ausgeschlossen ist, für ein Unterfangen, das nur im entferntesten im Geruch der Völkerverständigung steht, keine Subventionen zu bekommen.
«Aber was für eine Idee?» fragte Rabe.
«Mein Gott», sagte Hündlbacher, «die Idee kann gar nicht dumm genug sein. Olympische Spiele oder den Eiffelturm von Paris nach München tragen, zum Beispiel.»
Dieses Wort, möglicherweise mit einer zugleich aufleuchtenden Zahlen-Fata-Morgana im Bewußtseinshintergrund, muß in Bruno A. Rabes Vorstellungswelt wie der sprichwörtliche Blitz eingeschlagen haben. Rabe unterbrach jedenfalls seinen Pumpversuch bei Hündlbacher und empfahl sich.
Rabe erkundigte sich und erfuhr, daß in jenem Jahr in München für den Sommer eine deutsch-französische Freundschaftswoche geplant war. Unverzüglich gründete er ein Komitee (das zunächst nur aus ihm bestand) und rief eine ‹Internationale Jugendbewegung› ins Leben, die das Ziel hatte, den Eiffelturm von Paris nach München zu tragen.
«Das wird nicht gehen», warnten Rabes Freunde.
«Das geht», sagte Rabe.
Er selber konnte nur mit Vorbehalten zur eigentlichen Jugend gezählt werden. Wie alt er war, wußte niemand genau. Es war auch schwer zu schätzen, denn trotz seiner Stirnglatze und einiger Zahnlücken wirkte er, namentlich wenn man seine unvergorenen Ansichten hörte, jünger, als er vermutlich war. So nahm niemand Anstoß an Rabes kecker Firmierung ‹Jugendbewegung›.
Eine vorläufige Bestandsaufnahme ergab, daß der Eiffelturm – unbeschadet etwaiger Gewichtsverluste durch Rost – 1889 aus 9122243,28 Kilogramm Eisen errichtet wurde, an der Grundfläche 129,22 Quadratmeter mißt und 300 Meter hoch ist. Pro Quadratzentimeter Bodenfläche ergibt das eine Belastung von drei Kilogramm.
Rabe erkannte klar, daß er niemals auf einen Schlag die Subventionen für dieses riesige Unternehmen würde bekommen können. So machte er zuerst kleinere Beträge locker, aktivierte die Kolpingjugend, die Falken, die Pfadfinder, reiste per Autostopp nach Bonn (zurück kam er bereits im Schnellzug I. Klasse), und in kurzer Zeit waren so viel öffentliche Mittel und so viel allseitige Betriebsamkeit in das Unternehmen investiert, daß es kein Zurück mehr gab.
Anfang Mai versammelte sich ein Heer von jugendlichen Idealisten auf dem Champ-de-Mars. Fröhliches Lagerleben umtoste die vier Füße des Eiffelturmes, bis die Formalitäten erledigt waren. Dann wurde der Turm abgeschraubt. Ein Versöhnungsfeuer wurde entzündet; unter Absingen diverser Nationalhymnen erfolgte am 10. Mai bei Sonnenaufgang der feierliche Abhub.
Bruno A. Rabe, ein notorischer Langschläfer, versäumte diesen Augenblick. Als er, wie es seine Gewohnheit war, so gegen ein Uhr mittags aufwachte, nahm er – und er wußte sogleich, woher es rührte – ein leichtes Schaukeln seines Bettes wahr. Rabe hatte nämlich – in der wohl richtigen Überlegung, daß es bei rund neun Millionen Kilogramm auf sein Gewicht nicht mehr ankäme – in der Wohnung oben auf dem Turm Logis bezogen und beabsichtigte, sich nach München tragen zu lassen. Zwei Freundinnen leisteten ihm Gesellschaft.
Rabe erhob sich aus den Armen der Mädchen und trat ans Fenster. Es bot sich ihm ein überwältigendes Bild. Tausende von Pfadfindern und Kolpingsöhnen umdrängten die vier Eiffelturm-Stützen wie Bienen den Stock. Das vielsprachige «hau-ruck» der Anführer und Unterführer drang nur ganz leise zu Rabe herauf. Fast unmerklich schwankte der Turm, von einer milden Nachmittagssonne beschienen, an Charenton vorbei nach Osten.