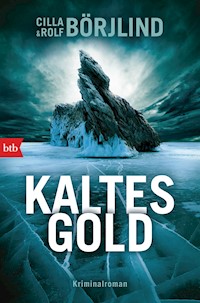16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wohlige Feel-good-Atmosphäre der schwedischen SPIEGEL-Bestsellerautoren Cilla & Rolf Börjlind
Sieben Menschen suchen ihr Glück in einem kleinen schwedischen Dorf am Meer.
An einer abgelegenen Bucht an der Westküste Schwedens liegt ein Dorf mit dem sprechenden Namen Schattenseite. Da der Ort von hohen Bergen umgeben ist, erreicht ihn die Sonne nur alle fünf Jahre. Ein astronomisches Phänomen, das genau zum Zeitpunkt auftritt, als diese Geschichte spielt. Wir schreiben das Jahr 1960. Unberührt vom Lauf der Zeit scheint das Leben in Schattenseite seinen Weg zu gehen. Die sechs Freunde Märta, Malte, Gustav, Picasso, Inka und Columbus waren eigentlich schon immer hier. Doch wenn sie ehrlich sind, passiert nichts wirklich Aufregendes mehr, seit die Hummer vor Jahren – warum, weiß niemand so genau – die Bucht verlassen haben. Dies ändert sich schlagartig, als eines Tages ein geheimnisvoller junger Mann auftaucht und behauptet, sein Name sei Georg von Nichts ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch
An einer abgelegenen Bucht an der Westküste Schwedens liegt ein Dorf mit dem sprechenden Namen Schattenseite. Da der Ort von hohen Bergen umgeben ist, erreicht ihn die Sonne nur alle fünf Jahre. Ein astronomisches Phänomen, das genau zu dem Zeitpunkt auftritt, als diese Geschichte spielt. Wir schreiben das Jahr 1960. Unberührt vom Lauf der Zeit scheint das Leben in Schattenseite seinen Weg zu gehen. Bis eines Tages ein Fremder auftaucht. Er trägt einen Pappkarton unter dem Arm und behauptet, sein Name sei Georg von Nichts. Schon bald verzaubert er die Dorfbewohner, die bislang in ihrer eigenen kleinen Welt lebten, mit seinen Talenten und bringt sie dazu, ihre tiefsten Geheimnisse mit ihm zu teilen. Sogar die Geheimnisse, die sie selbst zu vergessen versuchten …
Zum Autor / Zur Autorin
Cilla und Rolf Börjlind gelten als Schwedens wichtigste und bekannteste Drehbuchschreiber für Kino und Fernsehen. Ihre Serie um Polizistin Olivia Rönning und Kommissar Tom Stilton wurde sehr erfolgreich für das ZDF verfilmt. »Wundbrand« und »Kaltes Gold« standen wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Mit »Der Tag, an dem die Hummer wiederkamen« hat das Autorenduo erstmals das Krimigenre verlassen und stellt erneut sein schriftstellerisches Können und sein Gespür für gute Stoffe unter Beweis.
Schattenseite 1960
Cilla & Rolf Börjlind
Der Tag, an dem die Hummer wiederkamen
Roman
Aus dem Schwedischen von Julia Gschwilm
Die schwedische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Den häpnadsväckande historien om Georg von Ingenting« bei Norstedts, Stockholm.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe by Cilla & Rolf Börjlind
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Published by agreement with Grand Agency
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © Barbara van Ruyven
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30142-2V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Personenverzeichnis
Georg von Nichts
Strandfund und Zauberer
Märta Mild, genannt »die Schwarze Märta«
Tangsammlerin mit krimineller Vergangenheit
Columbus Mendelsohn
Hochexplosiver Kreisverkehrsdirigent
Evelyn »Sauertopf« Lundqvist
Kellnerin im Wirtshaus Häring mit harter Schale und weichem Kern
Gustaf Cylinder
Distinguierter Besitzer der Phallologischen Galerie
Malte Augustsson
Antiquar und hartnäckiger Atheist
Picasso Nilsson
Äußerst gut aussehender Anstreicher
Yuriana »Inka« Castillo
Wunderschöne und schüchterne Botanikerin, in Peru geboren
Marie & Thérèse Thervin
Vermögende eineiige Zwillinge und Eigentümerinnen des Wirtshauses Häring
Herr Schock
Deutschstämmiger Schuhmacher und notorischer Nörgler
Arto Vuorinen
Alleinstehender Pfarrer aus Tampere mit neun Kindern
Luigi
Heimlicher Liebhaber, zugleich cholerischer Koch im Wirtshaus Häring
Viola Fröberg
Lebensfrohe Schneiderin und nie versiegender Quell an Worten
Herr Mendelsohn
Wortkarger Fischer, verschlossen wie eine Auster
Frau Mendelsohn
Ehefrau des wortkargen Fischers, die von verschwundenen Hummern träumt
Brandur Blank
Riesiger, stummer Herrenfriseur von den Färöern
Elof Björkman
Ladenbesitzer und Sparfuchs, der den Pfennig stets ehrt
Johanna Björkman
Optikerin und heimlich schwanger
Ove Marmor
Engstirniger Briefträger
Vanja
Dorfälteste, die die Legende von Ymers Zahn erzählt
Pygge & Lehman
Möchtegern-Rowdys und Mitglieder der Rockband The Lobsters
Am Anfang war da nur eine tiefe Meeresbucht, hineingesprengt und eingeklemmt zwischen zwei dramatische Bergmassive, so hoch, dass eine bestimmte Stelle ganz hinten in der Bucht nur ein Mal alle fünf Jahre von den Strahlen der Sonne erreicht wurde. Dann entstand ein seltsames, unerklärliches Lichtphänomen, das man auf der ganzen Welt nur hier erleben konnte.
An diesem Ort siedelten sich Menschen an und gaben ihm den Namen Schattenseite.
*
1Die Schwarze Märta macht einen verblüffenden Fund am Strand
Die alte schwarz-weiße Heringsmöwe saß, wo sie immer saß, auf der Spitze des Leuchtturms Klein-Jan, und spähte nach allen Seiten; nichts entging ihren wachsamen Augen. Jetzt gerade, an diesem warmen Abend im Mai, blickte sie über die Hafeneinfahrt zum kleinen Dorf Schattenseite hinaus. Ein gottvergessener Ort, in dem es mehr oder minder die Dinge gab, die es in kleinen Ortschaften eben gibt: flammende Liebe, schwelende Kränkungen, unerträgliche Eifersucht und die Krankheit, die von der Flasche kam. Hier wohnten kleine Männer mit aussichtslosen Visionen, einsame Frauen mit schweigsamen Kindern, aber auch lachende Jugendliche, starke Damen mit Rückgrat und bernsteinhartem Willen und Herren mit unerschütterlichen Freundschaftsbanden und speziellen Interessen.
Ab und zu geschah es, dass lokale Fragen starke Polarisierungen in der zahlenmäßig bescheidenen Bevölkerung hervorriefen. Dann wurden Ränke gegen Nachbarn und Meinungsgegner geschmiedet, und mehr oder weniger gewaltsame Auseinandersetzungen konnten zwischen den verschiedenen Fronten entstehen. Doch glücklicherweise bewirkte die Macht des Vergessens immer wieder, dass das Leben in herzlicher Gemeinschaft, mit Festen und Tanz weitergehen konnte, bis der nächste Zankapfel auftauchte.
Den Aberglauben sog man hier mit der Muttermilch auf. Lebt man im immerwährenden Schatten mit Bergen und Meer als Eltern, ist das Deuten von Zeichen wichtiger als das Buchstabieren; hier konnten die Kinder Omen und Vorzeichen erkennen, bevor sie ihren eigenen Namen schreiben lernten.
Das meiste davon entging jedoch der Möwe auf der Leuchtturmspitze. Sie hatte andere Sorgen. Seit vielen Jahren saß sie schon hier und hielt Ausschau, immer auf der Suche nach etwas, womit sie ihren Schlund füllen konnte. Sie war so alt, dass sie die Zeit miterlebt hatte, die man hier im Volksmund als »die goldenen Jahre« bezeichnete, die Zeit, in der der Hummerfang und die Heringsfabrik noch im Mittelpunkt gestanden und die Dorfbewohner ernährt hatten. Und auch sie selbst und ihre Artgenossen. Zu jener Zeit gab es mindestens zweimal am Tag Fischabfälle. Inzwischen gähnten die Fenster der alten Heringsfabrik schwarz und leer, das einzige Leben, das sich dort noch fand, waren der Efeu, der an der alten Ziegelfassade emporkletterte, und ein paar Mauersegler, die noch immer unter den Dachpfannen nisteten. Und was die alte Möwe anging, so musste sie inzwischen darauf vertrauen, dass der einzig verbliebene Fischer des Dorfes, Herr Mendelsohn, mit einem einigermaßen guten Fang nach Hause kam.
Der Vogel geriet etwas ins Schwanken, als der Wind sein Federkleid ergriff und einen Duft nach Salz und Tang vom Meer zu ihm brachte, bevor er spielerisch weiter in den Hafen fegte, wo er in die alten, kaputten Netze fuhr, die an den windschiefen Fischerhütten hingen.
Auf der anderen Seite der Bucht türmte das Dorf selbst sich in seinem ganzen Glanz auf. Na ja, zumindest türmte es sich auf. Man konnte es eher als ein Wirrwarr aus verschiedenfarbigen Holzhäusern in unterschiedlichem Zustand bezeichnen, die gegenüber dem Aussichtsplatz der Möwe den Berg emporkletterten, ja, in manchen Fällen regelrecht an der Bergwand klebten. Die Strahlen der Sonne reichten bis zu den höchstgelegenen Häusern hinunter, der Rest des Dorfes lag im Schatten. Dort oben an den besten Plätzen prangten hochherrschaftliche Villen, die an die Blütezeit erinnerten, die das Dorf um die Jahrhundertwende erlebt hatte. Jetzt gehörten sie Sommergästen, alle außer einer. Dort wohnten zwei ältere, unverheiratete Zwillingsschwestern, Marie und Thérèse Thervin, die Töchter von Marie-Antoinette Thervin, geborene Fritzdotter. Eine bemerkenswerte Frau, die nach einer Frankreichreise und vor allem nach Cannes beschlossen hatte, dass die Strandpromenade des Dorfes von nun an Croisette genannt werden sollte. Diese Reise war im Übrigen die einzige, die sie in ihrem Leben machte, bevor sie mit 95 Jahren während eines Toilettenbesuchs mit einem Whiskyglas in der Hand starb. »Mutter ist glücklich gestorben«, pflegten die Schwestern zueinander zu sagen, und das war vermutlich das Einzige, worüber sie sich im Leben einig waren.
Wie auch immer.
Die Möwe hob ihren Kopf, sie fühlte sich mächtig, dort, wo sie saß. Der rote Fleck auf ihrem gelben Schnabel glänzte im Licht der Abendsonne, das gerade die Spitze des Leuchtturms berührte – ein weißer runder Leuchtturm mit einem breiten schwarzen Streifen in der Mitte und einem etwas schmaleren roten weiter oben. Es würde noch eine Weile dauern, bis Herr Mendelsohn eintraf, das wusste sie aus Erfahrung, also überlegte sie, ob sie einen Abstecher ins Dorf machen sollte, sehen, ob sie vielleicht irgendetwas Essbares in der Nähe des einzigen örtlichen Restaurants finden konnte, dem Häring. Mit würdevoller Ruhe wartete sie auf die nächste Windbö, nicht unähnlich einem Surfer, der geduldig auf die höchste Welle wartet, und als sie schließlich kam, breitete sie ihre großen Schwingen aus, hob vom Leuchtturm ab und glitt auf den Wirbeln davon, die über den Hafen fegten. Sie stieß ihren speziellen Ruf aus, als sie übers Wasser hinwegflog, um ihre Anwesenheit kundzutun und andere Vögel abzuschrecken, die sich zufällig, wider besseres Wissen, in ihr Territorium verirrt hatten.
Jetzt hatte sie Aussicht über so gut wie das ganze Dorf: die Hauptstraße, die sich zwischen den Häusern hindurchschlängelte, den kleinen Marktplatz ein Stück über dem Hafen, gesäumt von diversen Läden und gekrönt von einem aufsehenerregend schönen Brunnen. Doch das glitzernde Wasser des Bassins lockte sie nicht, das war das Revier der Tauben und Spatzen, und was sie betraf, sollten sie sich ruhig um die Krümel schlagen, die es dort gab. Sie hatte es auf das Restaurant an der Strandpromenade abgesehen, oder eher: Ihr Blick war auf den Kücheneingang gerichtet, der in einer kleinen Querstraße ein Stück oberhalb des Kais lag. Dort fand sie manchmal alte Essensreste, wenn der Koch den Deckel der Mülltonne nicht richtig geschlossen hatte. Natürlich nur, sofern ihr nicht die widerlichen Ratten zuvorgekommen waren. Ihr spähender Blick konstatierte, dass das heute leider der Fall war; die Tonnen waren umgekippt, und alles Essbare war verschwunden. Sie sah den Koch herauskommen und die ekelhaften Nager lautstark verfluchen, in einer Sprache, die melodisch und schön klang, nicht wie die der anderen Menschen im Dorf. Sie wandte den Blick ab und nahm wahr, dass eine Gruppe von Menschen vor dem Eingang des Restaurants stand, genauer gesagt vier Personen. Sie kannte sie alle und wusste: Wenn die Tür des Lokals sich öffnete und sie ins Warme eintreten durften, würde es nicht lange dauern, bis es so weit war.
Und sehr richtig.
Sobald die Tür hinter den Gästen ins Schloss gefallen war, hörte sie das unverkennbare Knattern, das vom Meer her herannahte. Der Fischer war mit der Mary Celeste, dem kleinen Kutter, auf dem Weg in den Hafen. Alles lief wie gewohnt und ganz nach Plan, in der Ferne konnte sie die Kirchenglocken sechsmal schlagen hören. Als sich das Boot dem Pier am anderen Ende der Bucht näherte, flatterte sie mit den Flügeln und änderte die Richtung. Jetzt war das Ziel einer der Stege dort drüben. Auf dem Weg ließ sie ihren glücklichsten Ruf erschallen, um ihren Wohltäter willkommen zu heißen, während sie auf einen abgewetzten Poller zusteuerte.
Und dort saß sie nun, erwartungsvoll, als das Fischerboot am Steg anlegte und Herrn Mendelsohns zerfurchtes Gesicht auftauchte und sie anlächelte.
»Hallo, John«, sagte er zu dem Vogel. »Gute Nachrichten. Das Meer war heute großzügig.«
Der Fischer beugte sich hinunter, nahm ein paar Heringe vom Schiffsboden und warf sie John auf dem Steg zu. Die Möwe verschlang sie im Ganzen, einen nach dem anderen, und alles war wie immer in dem kleinen Dorf.
Fast.
Gerade an diesem Abend, an dem unsere Geschichte ihren Anfang nimmt, sollte ein merkwürdiger Strandfund das Leben für einige der Dorfbewohner verändern, nicht zuletzt für die Person, die den Fund machte: eine voluminöse Frau mittleren Alters mit einigen wenigen Härchen auf der Oberlippe und einer schwarzen Tunika am Körper. Sie saß auf einem getunten Lastenmoped und fuhr in Richtung Meer. Von ihren Ohren baumelten zwei hübsche Schneckenhäuser, frühere Funde von der Küste, und das lange Haar war mit einer kräftigen Klammer hochgesteckt. Mit hoher Geschwindigkeit knatterte sie durch das Dorf zum Strand, sie beeilte sich, dorthin zu kommen, ehe die Dunkelheit hereinbrach, und ahnte nicht, was sie dort erwartete.
Sie wollte Tang sammeln. Frischen, braun-grünen Blasentang. Nicht für sich selbst, er sollte zum Wirtshaus geliefert werden und in Kombination mit frisch gefangenen Jakobsmuscheln in eine örtliche Spezialität verwandelt werden. Sie hatte die Aufgabe übernommen, zu dieser Jahreszeit die Zutat zu liefern.
Kurz vor dem Dorf passierte sie einen leicht gewölbten Kreisverkehr und winkte einem sehr kleinen Mann, der sie fieberhaft in die Richtung dirigierte, in die sie ohnehin unterwegs war. Da er ihre Tangroutinen in- und auswendig kannte, sah er ausgesprochen perplex aus, als sie an ihm vorbeifuhr. Normalerweise machte sie ihre Runde bei Tagesanbruch, wenn gerade die Morgenröte vom Horizont hereinbrach und ihr Licht über den Strand warf, aber heute früh war ein Ferngespräch vom Landesgefängnis in Växjö hereingekommen. Das hatte sie aufgehalten. Nicht das Gespräch an sich, das war kurz gewesen, aber seine Nachwirkungen. Den Rest des Tages musste sie Hunderte von Meeresschnecken und Glasstücken im Wohnzimmer umsortieren, um ihre Nerven zu beruhigen, weswegen sie nicht vor der Abenddämmerung losgekommen war.
»Transuse!«, schrie der kleine Mann ihr nach.
Die Frau bog zwischen ein paar Büscheln Strandroggen ein und bremste. Weiche Wellen leckten an den Reifen, und einige aufgescheuchte Austernfischer flatterten davon. Mit routinierten Bewegungen hob sie einen großen Metalleimer von der Ladefläche. Während des Tages hatte ein kräftiger Wind geweht, und der Tang war in dicken Haufen an Land gespült worden.
Ein guter Abend für Tang, dachte sie und zog ihre Schuhe aus. Sie mochte es, mit ihren frisch lackierten Zehennägeln barfuß durch den feinkörnigen Sand zu laufen und zu spüren, dass ihr Geist im Gleichgewicht war; das ärgerliche Telefongespräch war wie weggeblasen. Einen kurzen Moment stand sie still da und sog die Gerüche ein, die ihr entgegenströmten. Frische vom Meer, leicht ranzige vom Tang, ein Hauch von modrigem Gestank von einem an Land gespülten Katzenkadaver. Es passierte ab und zu, dass sie am Strand tote Katzen fand, sie hatte nie richtig begriffen, woher sie kamen. Manchmal begrub sie sie im Sand, ein Stück weiter oben hinter dem Strandroggen, doch diese hier sollte liegen bleiben. Des Kreislaufs der Natur wegen, verteidigte sie sich vor sich selbst.
Es ging schnell, den Eimer zu füllen und zu leeren, ein paar Mal, nach einer Viertelstunde war die Ladefläche halb voll. Sie startete das Moped wieder und fuhr langsam am Strand entlang, ihre Augen spähten über den Sand, hin und wieder fand sie nach windigen Tagen Bernstein. Nicht so oft, eigentlich sehr selten, aber die Chance bestand und durfte nicht verpasst werden. Einige Male hielt sie inne, wenn sie etwas aufblitzen sah, doch es waren nur Porzellanscherben oder Glasstücke. Und nun zuletzt ein verbogener Teelöffel. Doch auch diese Dinge betrachtete sie als kleine Schätze. Sie sammelte alles auf die Ladefläche und fuhr weiter. Wonach sie eigentlich suchte, im tiefsten Inneren, war ein wohl gehütetes Geheimnis, das sie noch nie jemandem verraten hatte.
Als sie sich dem Ende des lang gestreckten Strandes näherte, fuhr sie eine enge Kurve, um umzukehren. Eines der Räder blieb in einem Grasbüschel stecken und zwang sie dazu, abzusteigen und die Ladefläche anzuheben. Da entdeckte sie es. Ein Stück entfernt, ganz am Rand des Strandes, neben den Klippen.
Ist das ein Stein? Aber es sah gar nicht aus wie ein Stein.
Sie schlug sich die Hand vor den Mund und kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Ein Kopf? Ist das nicht ein Kopf? Vorsichtig ging sie näher heran und spürte, wie ihr Herz unter der schwarzen Tunika plötzlich doppelt so schnell schlug. Normalerweise war sie niemand, der sich leicht ängstigte, im Gegenteil, ihr kräftiger Körperbau in Kombination mit ihrer Vergangenheit machte sie in den meisten Situationen unerschrocken.
Aber dies hier war anders.
Dies hier war ein menschlicher Kopf, der im Sand lag oder daraus hervorragte. Sie musste näher herangehen, um zu erkennen, was für einer. Als sie bemerkte, dass sorgfältig zusammengelegte Kleidungsstücke in einem Stapel neben dem Kopf lagen, beruhigte sich ihr Herz wieder ein klein wenig. Sie trat ein paar Schritte darauf zu. Wie sich zeigte, gehörte der Kopf einem jungen Mann mit dunklen Locken, dessen Augen aufs Meer hinausblickten.
Er lebt jedenfalls, dachte sie und registrierte, dass ein Stück hinter dem Kopf ein brauner Karton im Sand stand. Sie ging in die Hocke und beobachtete den Mann. Er schielte zum Wasser hin, das ihm bis zum Kinn reichte, und schaute wieder aufs Meer hinaus. Sein ganzer Körper war fein säuberlich im Sand vergraben, was die Frau verblüffte. Wie hatte er das angestellt? Hatte ihm jemand geholfen? Sie blickte sich um und sah nur leere Sanddünen und Büschel von Strandroggen, weiter oben ein paar Krüppelkiefern, ansonsten war alles völlig einsam.
»Hallo«, sagte sie vorsichtig.
Der Mann drehte den Kopf eine Spur. Seine klaren braunen Augen betrachteten die schwarz gekleidete Frau, ein paar Sandkörner klebten an einer seiner Wangen.
»Was machst du da?«, fuhr sie fort, mit einem Dialekt, der deutlich von ihrer Abstammung aus dem Süden der Hauptstadt zeugte.
»Auf die Gezeiten warten«, antwortete der Mann, so leise, dass es kaum zu hören war. »Auf die Flut.«
Die Frau blickte aufs Meer hinaus: »Es ist gerade Flut.«
»Es ist Ebbe.«
»Nein, mehr Flut als so wird es nicht mehr, danach kommt die Ebbe, und das Wasser zieht sich bis zu dem Riff da draußen zurück … jetzt ist es am höchsten.«
Der Mann schaute auf das Wasser an seinem Kinn hinunter, sein Blick flackerte, als er ihn wieder an der Frau emporgleiten ließ. »Höher als so wird es nicht?«, flüsterte er.
»Nein.«
Die Augen des Mannes wandten sich zum Horizont, und die Frau sah, dass eine Träne durch die Sandkörner an der bleichen Wange hinunterlief. Sie unterdrückte einen Impuls, sie wegzuwischen.
Die Strahlen der Abendsonne strichen durch einen Wald von niedrigen Kiefern und braunes trockenes Heidekraut, zwischen den Stämmen knatterte ein Lastenmoped in voller Fahrt über die schmale Schotterstraße. Die schwarz gekleidete Frau kannte die Strecke wie ihre Westentasche, alle engen Kurven und hervorstehenden Felsen, doch diesmal hielt sie sich in den schwierigsten Passagen beim Gasgeben zurück: Sie hatte eine kostbare Fracht auf der Ladefläche.
Tang in rauen Mengen, aber vor allem einen jungen Mann, der vor Kurzem versucht hatte, sich das Leben zu nehmen, dabei aber an Ebbe und Flut gescheitert war. Sie beugte sich ein wenig nach vorn. »Ich heiße Märta«, sagte sie mit erhobener Stimme, um das Motorengeräusch zu übertönen. »Märta Mild! Aber alle nennen mich die Schwarze Märta! Wie heißt du?«
Es dauerte ein paar Sekunden, bis der Mann antwortete, und seine helle Stimme drang gerade noch zu Märta nach hinten: »Georg.«
»Ein schöner Name! Ich meinerseits habe ein sehr schönes Kleid bestellt, das einfach nicht ankommt, und wenn es kommt, ist es wahrscheinlich viel zu klein! Außerdem bin ich zu alt für Kleider! Frierst du?«
Georg schüttelte den Kopf. Er hatte sich die Kleider angezogen, die er am Strand so ordentlich zusammengelegt hatte, ein hellgrünes Flanellhemd und eine braune Cordhose. Den Karton drückte er fest an seine Brust. Märta richtete sich auf und trat ein bisschen aufs Gas.
Was er wohl in dem Karton hat?, dachte sie.
*
Die beiden hohen Bergmassive bildeten ein enges Tal, eine einzige Straße führte hindurch und endete unten in der Bucht, in der das Dorf lag. Die Endstation, wie es in einigen Reisereportagen formuliert wurde. Einen halben Kilometer vor der Dorfgrenze befand sich ein Kreisverkehr, genau der, durch den Märta schon eine Stunde zuvor gefahren war. Das Rondell war mit orangefarbenen und gelben Tagetes geschmückt und den Hügel in seiner Mitte krönte ein großes Schild: »Willkommen in Schattenseite«. Dicht daneben stand ein sehr kleiner und blasser Mann mit schlechten Zähnen. Sein sehniger Körper steckte in einem abgewetzten blauen Overall, der in zwei schwarzen Gummistiefeln endete. Auf dem Kopf trug er eine rote Mütze mit einem länglichen Schirm, der entfernt an einen Storchenschnabel erinnerte. Der Mann war gerade dabei, ein Auto zu dirigieren, das auf dem Weg in den Kreisverkehr war. Mit prägnanten und etwas gehetzten Bewegungen zeigte er, auf welcher Seite des Kreisverkehrs es fahren sollte, eine allem Anschein nach überflüssige Information, denn es gab nur einen Weg in diese Richtung. Gleichzeitig kam ein Auto aus der anderen Richtung, was den Mann zwang, sich herumzuwerfen. Durch die Bewegung geriet er mit seinem rechten Arm aus dem Takt und verlor das Gleichgewicht.
»Raser«, presste er hervor und hörte in der Ferne ein schwaches Motorengeräusch.
Der peitschende Wind riss an Märtas dunklem Haar, als sie auf die Verkehrsinsel zufuhr. Sie musste nicht nur daran vorbei, sie hatte dort auch etwas zu erledigen. Georg saß mitten im Tang auf der Ladefläche, den Karton an seine Brust gepresst, und hatte keine Ahnung, wohin sie unterwegs waren. Als sich die Equipage dem Kreisverkehr näherte, verlangsamte Märta ihre Fahrt und deutete nach vorn: »Das da ist Columbus. Der bei dem Schild, mit dem Käppi. Als die Heringsfabrik geschlossen wurde, wurde er Kreisverkehrsdirigent. Er behauptet, er hätte das absolute Verkehrsgehör. Eigentlich geht es um Flucht, glaube ich, eine Möglichkeit, von zu Hause wegzukommen. Er wohnt auf einem trockengelegten Lastkahn unten im Hafen, bei seinen Eltern, Herr und Frau Mendelsohn.« Märta richtete sich auf. »Er hat zu allem eine Meinung.«
Columbus entdeckte das Fahrzeug, lange bevor es den Kreisverkehr erreichte, und fing mit voller Kraft zu dirigieren an. Er sah, dass es das Lastenmoped der Schwarzen Märta war, doch auch sie musste instruiert werden. Als sie zu bremsen begann, senkte er den Arm, möglicherweise etwas enttäuscht. Märta hielt an und stieg ab.
»Bleib ruhig sitzen, Georg«, sagte sie. »Es dauert nur eine Minute.«
Märta stapfte mit einem wohlwollenden Lächeln auf den Lippen zu Columbus auf den Hügel. Auf dem Weg dorthin zog sie ein Stanniolpaket aus der Tasche.
»Warum warst du heute so spät dran?«, fragte Columbus.
»Kümmere du dich um deinen Kram, dann kümmere ich mich um meinen«, lächelte Märta und streckte ihm das Päckchen hin.
»Mutters belegte Brote?«
»Ja. Gebratener Hering auf Knäckebrot.«
»Jeden Tag dasselbe, total fantasielos, diese Frau.«
Märta hätte darauf hinweisen können, dass ein gewisses Maß an Dankbarkeit für die Verpflegung vielleicht angebracht gewesen wäre, besonders wenn man bedachte, dass er mit 36 Jahren zu Hause wohnte und, soweit sie wusste, noch nie eine einzige Krone für seinen Aufenthalt bezahlt hatte. Sie wollte den hitzigen Mann jedoch nicht weiter aufregen, Columbus war für seine kurze Zündschnur bekannt: Er war beleidigt geboren worden und als wandelndes Pulverfass aufgewachsen. »Eineinhalb Meter komprimierte Komplexe«, wie Malte, der Antiquar des Dorfes, ihn einmal beschrieb.
Also fragte Märta ganz einfach: »Und, wie läuft es hier?«
»Wie immer, windig und scheußlich, und die Leute fahren wie die Idioten. Wenn ich nicht hier wäre und den ganzen Scheiß kontrollieren würde, hätten wir von früh bis spät Massenkarambolagen, aber wer dankt es mir?«
»Du kriegst belegte Brote von deiner Mama.«
»Meiner Mutter.«
Columbus sagte immer Mutter und Vater zu seinen Eltern, damit nahm er es genau. Er wickelte das Stanniolpapier auseinander, knüllte es zusammen und streckte es Märta hin, als betrachtete er sie als seinen privaten Mülleimer. Sie nahm es entgegen, ohne eine Miene zu verziehen. Columbus biss in eines der Brote und wies mit dem langen Mützenschirm zum Moped hinunter.
»Wer ist das da?«
»Er sagt, er heißt Georg«, antwortete Märta. »Mehr weiß ich nicht.«
»Du nimmst Anhalter mit? Lebensgefährlich. Ich hab von einem Anhalter gehört, der allen, mit denen er gefahren ist, die Kehle durchgeschnitten und ihre Ohren aufgegessen hat. Hat er ein Messer?«
»Das weiß ich nicht, ich hab ihn am Strand gefunden, vergraben.«
»Aha, diese Art von Mensch. Brauchst du Hilfe?«
Märta blickte auf den wesentlich kleineren Columbus hinunter und lächelte erneut: »Du bist ein Ritter, Columbus … aber du wirst im Kreisverkehr gebraucht. Sieh nur zu, dass du dich nicht verkühlst.«
»Arbeit ist Arbeit, und jemand muss sie ja machen, aber danke für deine Fürsorge, die wärmt mir die Seele. Wir leben in einer geizigen Welt.«
Columbus salutierte rasch gegen sein Käppi, warf sich zu einem Regionalbus herum, der auf dem Weg in den Kreisverkehr war, und begann zu dirigieren.
Eine scheinbar lächerliche Aktivität, könnte man meinen, aber sie hatte einen verdienstvollen Hintergrund.
*
2 Der Sauertopf serviert im Häring einen Rettungsanker
Die Dämmerung war zu Dunkelheit geworden und die Leute zogen sich in die Häuser zurück. Ein Teil in ihre Wohnungen, andere in die einzige Wärmequelle, die Essen und Alkohol in angenehmer Gesellschaft bot, das Dorfwirtshaus Häring. Der Name war ursprünglich die Bezeichnung für den Fisch gewesen, der hier allgegenwärtig war, aber der Handwerker, der irgendwann einmal das imposante Holzschild über dem Eingang gemacht hatte, war aus einer anderen Gegend gewesen und hatte angenommen, dass man »Hering« so schrieb, wie er es aussprach: Häring.
Also blieb es dabei.
Die Eigentümer des Wirtshauses waren die Zwillinge Thervin, Marie und Thérèse. Sie hatten es von ihrer Mutter geerbt, einer umtriebigen Geschäftsfrau, die innerhalb kurzer Zeit zwei Restaurants im Dorf eröffnet hatte.
Das eine, das elegante Petit Trianon, hatte zugemacht. Aber der Häring lebte weiter und war der selbstverständliche Treffpunkt für alle Einsamen im Ort. Und Paare, die hier und da irgendetwas feiern wollten, oft Hochzeitstage oder die Misserfolge anderer. Die Mehrzahl der Gäste kam allerdings zum ursprünglichen Zweck dieser Art von Etablissements hierher: um zu trinken, zu reden, sich die Zeit zu vertreiben und zu streiten, hin und wieder unterbrochen von der Einnahme einer Mahlzeit.
So auch an diesem Abend.
Das authentisch eingerichtete Lokal war zwar nur halb voll, doch in Anbetracht dessen, dass es ein Werktag mitten unter der Woche war, war die Auslastung völlig akzeptabel. Alle saßen auf den Plätzen, auf denen sie schon seit Anbeginn der Zeiten gesessen hatten, oder zumindest seit ihrem ersten Besuch im Häring. Stammgäste hatten ihre angestammten Tische, und wehe dem, der sich, nichts Böses ahnend, versehentlich auf den falschen Platz setzte. Dann verbreitete sich eine düstere Stimmung im Lokal, die oft damit endete, dass der Sauertopf eingreifen musste. Der Sauertopf hieß Evelyn Lundqvist und war Kellnerin, eine mit allen Wassern gewaschene Dame mittleren bis höheren Alters, die die Haare immer zu einem strengen grauen Dutt gebunden trug. Ihr Gesicht zeichnete sich durch markante Wangenknochen und dünne Augenbrauen aus, die sie jeden Morgen mit Kajal nachzog. Sie hatte als junges Mädchen im Petit Trianon oben in der Villenstraße angefangen, doch als es schloss, musste sie in das deutlich einfachere Wirtshaus im Hafen wechseln, den Häring. Diesen Umstand ertrug sie mit Gleichmut; die Alternative wäre gewesen, aus Schattenseite wegzuziehen. Sie mochte ihren Job, auch wenn sich das nicht immer in ihrer Art widerspiegelte, nicht selten servierte sie ein Gericht mit Worten wie: »Kauen musst du aber selbst.« Sie war nicht gerade der unterwürfige Typ, daher der Spitzname Sauertopf. Barsch, aber von allen geschätzt. Und so war es an ihr einzugreifen, wenn sich jemand auf den falschen Platz setzte, oft indem sie ihm einen anderen Tisch anbot, etwa mit den Worten: »Von hier aus hat man Meerblick!« Das hatte man im Grunde zwar von den meisten Tischen im Lokal, aber es war ein Argument, das fast immer funktionierte.
An diesem Abend hatten die Stammgäste also ihre Tische in Beschlag genommen.
Und an dem Tisch, der für diese Geschichte von Bedeutung ist, saßen vier enge Freunde, drei Männer in unterschiedlichen Stadien des Rausches, und eine Frau, die nahezu Antialkoholikerin war. Es war ein länglicher Holztisch, aus den Dielen einer stillgelegten Snusfabrik gebaut und in diesem Moment mit Gläsern und Flaschen, einem Zigarettenpäckchen der Marke Chessman, einer Wasserkaraffe und einem gelben Aschenbecher mit der blauen Aufschrift Ricard bestückt. Die Gesellschaft war vertieft in eine existenzielle Debatte über die unerbittliche Endlichkeit des Lebens und die schmerzvolle Erosion des Körpers. Einer der Männer war Picasso Nilsson, ein breitschultriger, braunäugiger Anstreicher mit äußerst hübschem Gesicht, garniert mit einem dünnen, gepflegten Bleistiftbart, der an der wohlgeformten Oberlippe entlanglief. Was das Denken betraf, war er nicht so gesegnet, doch er war sehr beliebt und galt als Tausendsassa des Dorfes. Wenn etwas kaputtging, holte man Picasso. An just diesem Abend behauptete er, er hätte einen Tumor.
»Ich gehe davon aus, dass ich nur noch ein paar Wochen habe, vielleicht Tage«, sagte Picasso mit tränengefüllten Augen.
Die anderen waren nicht ganz überzeugt, aber sie hörten geduldig zu, sie wussten, dass sie mit Picasso vorsichtig umgehen mussten. Hinter seinem gut gebauten Äußeren steckte ein sensibler Mensch, den man mit Feingefühl behandeln musste. Vor allem, was seine Krebsphobie betraf. Sie reagierten also mit Respekt und Verständnis auf seine Angst und versuchten, sie zu lindern, ohne ihn bloßzustellen.
»Ich möchte also diese Gelegenheit nutzen, um mich von euch zu verabschieden, meine Brüder und Schwestern, meine Freunde, ich hoffe, ihr werdet euch mit Wärme an mich erinnern, obwohl ich …«
Picasso verstummte und fuhr sich mit der Hand über die Augen, was Gustaf Cylinder die Chance gab, ihn zu unterbrechen. Er war ein ausnehmend distinguierter Herr mittleren bis höheren Alters in einem Cheviot-Anzug aus grau meliertem Kammgarn und Eigentümer der Phallologischen Galerie. Letztere zur Sommerzeit eine große Touristenattraktion hier im Dorf.
»Wo sitzt der Tumor?«, wollte er wissen.
»In der Nase.«
Gustaf sah Malte an, den dritten Mann am Tisch, eine scharf geschnittene Gestalt mit straffem Hals. Malte schüttelte leicht den Kopf und legte einen Arm um Picassos Schultern. Malte führte im Dorf eine Mischung aus Antiquariat und Bibliothek und besaß nach Ansicht der Allgemeinheit Kenntnisse über Phänomene, über die der gemeine Mann nichts wusste. Hypochondrie zum Beispiel.
»In der Nase?«, sagte er mit rauchiger Stimme.
»Nichts geht mehr durch.«
»Tumore in der Nase sind sehr selten.«
»Dann ist es ja wohl typisch, dass es gerade mich treffen muss!«
Picasso erhob sein Weinglas mit zitternder Hand und nahm einen großen Schluck, es konnte ja das Letzte sein, das er in diesem Leben trank.
»Ich kann dir vielleicht helfen.«
Das sagte nicht Malte, sondern die Dame in der Runde, eine dunkelhaarige Frau mit dichten Augenbrauen und intensivem Blick. Sie war die einzige Vegetarierin im Ort, hatte ein großes schimmerndes Gewächshaus oben an der Nordseite und hörte meist auf den Spitznamen Inka. Aufgrund ihres attraktiven Äußeren war sie regelmäßig Gegenstand ungenierter Aufwartungen, doch alle Sehnsüchtigen erhielten dieselbe Antwort auf ihre Avancen: »Danke, aber nein danke.«
»Ich bin gleich zurück«, sagte Inka und stand auf.
*
Draußen in der Abenddämmerung näherte sich das Moped mit zwei unterschiedlichen Lasten auf der Ladefläche. Eine davon war eine Lieferung für die Küche des Häring, nämlich frischer Tang. Bei der anderen wusste Märta nicht, wohin sie sie liefern sollte, einen jungen Mann, der einen Karton fest an seine Brust drückte. Sie fuhr eine kurze Runde durchs Dorf und zeigte Georg ein paar besondere Orte, das dunkle Schaufenster des Schuhmachers, Violas Schere & Kurzwaren, das gegenüber von Augustssons Antiquariat lag, ein Stück entfernt den einzigen Lebensmittelladen mit gelb-blauem Schild, auf dem »Spezereien« stand, und mit einem großen Poster im Schaufenster, auf dem »Kent – der gute Trend« zu lesen war. Und dann noch das meistfrequentierte Geschäft, Eisenwaren & Diverses, ein Laden, der seinem Namen wirklich alle Ehre machte. Unter anderem bestellten die Dorfbewohner hier ihre alkoholischen Getränke, die zweimal die Woche aus der nächstgelegenen Kleinstadt geliefert wurden. Dieses Verfahren brachte es mit sich, dass der Ladenbesitzer über die Alkoholgewohnheiten jedes Einzelnen bis ins Detail Bescheid wusste. Er kannte Sorte, Prozentgehalt sowie die Frequenz der Bestellungen, eine nicht ganz unwichtige Information. Das Geschäft hatte auch einen kleinen Optikerbetrieb; die Tochter des Besitzers war ausgebildete Optikerin und bot Kunden Sehtests an, sofern Interesse bestand. Nicht gerade eine Goldgrube, wenn man ihren Vater fragte.
Märta bog in Richtung Hafen und auf die Croisette ab, eigentlich war es eine Fußgängerzone, doch das kümmerte sie nicht, sie fuhr bis zum Häring und bremste vor dem Kücheneingang in der Gasse.
Hier lieferte sie immer den Tang ab.
Sie klopfte an die Tür und wusste, was sie erwartete: ein konstant überarbeiteter Italiener mit bratfettigem Haar und einem Goldzahn im Oberkiefer. Luigi, der Koch des Häring, war mit einem Temperament geboren worden, das alle in seiner Umgebung nervös machte, bis auf die Zwillinge Marie und Thérèse.
Ganz richtig riss er im nächsten Moment die Tür auf, und eine Palette von Gerüchen strömte aus der Küche.
»Was hast du den ganzen Abend gemacht?«, schrie er und wedelte mit den Händen.
»Hallo, Luigi«, sagte Märta ruhig.
»Wo ist mein Tang? Bist du wieder im Kreisverkehr herumgefahren?!«
Er klingt ganz wie immer, dachte Märta. Und riecht auch so, eine Mischung aus Schweiß und saurem Wein. »Hat heute Abend denn schon jemand Tang bestellt?«, fragte sie mit ihrer sanftesten Stimme.
»Nein! Aber wer weiß schon, wann der nächste Gast frischen Tang will! Ich muss ihn haben, sonst ist die Speisekarte eine Katastrophe! Ein Bluffo! Her damit!«
Luigi riss einen Armvoll Tang an sich und stürzte wieder in die Küche.
Märta wandte sich zu Georg auf der Ladefläche und zuckte leicht mit den Schultern. »Luigi«, sagte sie. »Warte ein paar Minuten.« Und ging dem hitzköpfigen Koch nach.
»Hier!«, sagte Inka und reichte Picasso eine kleine gläserne Pipette, während sie sich wieder an den Tisch setzte.
»Was ist das?«
»Das ist ein Gebräu, das sehr effektiv gegen Tumore sein kann.«
»In der Nase?«
»Besonders in der Nase.«
Mit einiger Skepsis nahm Picasso vorsichtig die kleine Pipette. Inka beugte sich zu Malte hinüber und flüsterte: »Kochsalzlösung, gefärbt mit Extrakt aus Rotem Sonnenhut.«
Malte nickte, was das Reich der Flora anging, hatte er vollstes Vertrauen in Inka.
»Soll ich das trinken?«, fragte Picasso.
»Nein, du beugst den Kopf nach hinten und drückst dir mit der kleinen Gummihupe ein paar Tropfen in die Nase.«
Der Sauertopf hatte sich eine Weile in der Nähe des Tisches herumgedrückt, es hagelte an diesem Abend nicht gerade Bestellungen, und sie war neugierig. Diese Gesellschaft hier war die interessanteste. Obwohl sie durchaus wusste, dass der Glatzkopf drüben in der Ecke nach ihr winkte, das tat er bereits seit einer Viertelstunde, und sie wusste auch, was er wollte. Er saß schon in dieser Ecke, so lange sie hier arbeitete, und er hatte jeden Besuch mit demselben Wortwechsel beendet.
»Das Essen war unter aller Kanone! Nie wieder werde ich einen Fuß in dieses Lokal setzen!«
»Das hast du gestern auch gesagt.«
»Nichtsdestotrotz!«
An manchen Abenden, so wie an diesem, war sie also mehr an Picassos Tumoren interessiert als daran, sich mit dem Mann in der Ecke auseinanderzusetzen. Sie beobachtete, wie Picasso die Pipette nahm, zur Nase führte, ein paar Tropfen herausdrückte und wartete.
Alle um den Tisch warteten.
Es dauerte eine Weile, nicht besonders lange, doch plötzlich blickte Picasso mit schielenden Augen auf seine Nase hinunter, äußerst verblüfft, und sog Luft durch die Nasenlöcher.
»Er ist verschwunden«, flüsterte er. »Der Tumor hat sich aufgelöst!«
Im Rausch der befreienden Euphorie schlug er sofort vor, einen sordinierten Toast auszubringen.
»Auf Inkas Wundermittel!«
Alle lächelten, prosteten sich zu, tranken und stellten ihre Gläser ab, in Inkas Fall ein Seltersglas mit örtlichem Quellwasser. Sie betrachtete Picasso mit inniger Wärme.
»Darf ich ein Bandyspiel vorschlagen!«, sagte er.
Die Freunde um den Tisch nickten und applaudierten weich und dumpf mit hohlen Händen, als säßen sie mit gestrickten Fäustlingen in einem Bandymatch.
Das war die ultimative Huldigung.
Noch ein paar Worte über das Dorfwirtshaus Häring, den Ort des aktuellen Geschehens. Die eineiigen Zwillinge Marie und Thérèse, die das Lokal führten, waren um die sechzig, sehr vermögend und einander aus naheliegenden Gründen sehr ähnlich. Was das Aussehen betraf. In fast allen anderen Bereichen des Lebens hatten sie einen völlig unterschiedlichen Geschmack und divergierende Meinungen, obwohl sie einander sehr mochten. Ihre offenkundige Verschiedenheit hatte den Kreisverkehrsdirigenten Columbus einmal dazu veranlasst, sie als dreieiige Zwillinge zu bezeichnen. Ihre unterschiedliche Sicht der Dinge hatte sich im Häring für jedermann sichtbar manifestiert. Das Wirtshaus vereinte zwei diametral entgegengesetzte Stilrichtungen in sich; die Hälfte des Lokals war von Marie eingerichtet worden, die andere Hälfte von Thérèse. In Maries Hälfte dominierten dunkle, gedeckte Farben, es gab rustikale Möbel, ein eingebautes Aquarium, gedämpfte Beleuchtung und ein schwarzes Klavier in einer Ecke. Thérèses Hälfte war von Art déco inspiriert, sehr elegant, mit hellem Mahagonifurnier und schwarzen Intarsien, die Möblierung war italienisch, mit hübschen, geraden Stühlen und mehreren Glastischen. Die Wände hatte sie mit Schwarz-Weiß-Fotos von klassischen Sportwagen und Filmstars dekoriert, Rudolph Valentino war aus irgendeinem Grund mit zwei Bildern repräsentiert. Und in der Ecke hing ein großes Porträt einer beinahe lächelnden Greta Garbo, auf dem stand: »Für meine allerliebste Thérèse«.
Unsere Gesellschaft hatte ihren Tisch in Maries Abteilung.
Die geteilte Eigentümerschaft hatte auch zwei unterschiedliche Speisekarten mit sich gebracht: Maries Speisekarte und Thérèses Speisekarte. Die Gerichte waren im Prinzip dieselben, das hatte Luigi durchgesetzt, doch die Gewürze und kleinen Beilagen unterschieden sich ein wenig. Die Zwillinge hatten auch Pläne für einen jeweils eigenen Spezialdrink gehabt, was in ihrem großen Haus oben im Villenviertel zu einem lebhaften Wortgefecht hinter verschlossenen Türen geführt hatte. Beide wollten ihren Drink »Härings Spezial« nennen. Am Ende löste der Koch Luigi, der einen sehr guten Draht zu den Zwillingen hatte, den Konflikt, indem er einen Kompromiss vorschlug: einen gemeinsamen Drink mit dem Namen »Schattenseites Sonnenaufgang«.
»Und was soll drin sein?«, hatte Marie gefragt.
»Dunkler Rum als Basis, eine Prise Zimt, ein paar Tropfen Cointreau und zehn Zentiliter Orangensaft.«
Luigi war kein Bartender, ganz im Gegenteil, er kam aus einer Familie in Kalabrien, die sich von mageren Schafen und kümmerlichen Oliven ernährte, doch die Zwillinge fanden, der Drink klang spannend, und setzten ihn auf die Karte. Er wurde ein Erfolg, vor allem bei den Touristen, die eine Kostprobe der lokalen Tradition haben wollten.
Keiner von den Freunden um den Snusfabriktisch hatte ihn je getrunken.
Gustaf hatte gerade ein paar Weinflaschen auf dem Tisch beiseitegeschoben, die Stimme eine Spur gesenkt und berichtet, dass ihm am Morgen eine sehr begehrte Rarität angeboten worden war, ein kleiner intakter Steinpenis aus dem Mayareich, gefunden in der Muknal-Höhle in Belize, vermutlich illegales Schmuggelgut.
»Bekannten Quellen zufolge existieren nur noch zwei ähnliche Exemplare.«
Für einen Außenstehenden ist vielleicht eine kleine Erklärung zu Gustaf Cylinders Erwerbstätigkeit nötig: das Sammeln, Restaurieren und Bewahren von Phallussymbolen, ein Betrieb, in den Gustaf hineingeboren worden war. Sein Großvater, ein schweigsamer und introvertierter Seemann, der auf Handelsrouten rund um den Globus unterwegs war, hatte die Sammlung begründet. Auf seinen Reisen um die Welt kaufte er Kultobjekte und Fetische, alle mit demselben Grundmotiv. Da waren holzgeschnitzte Fruchtbarkeitssymbole aus Masai Mara, handgezeichnete japanische Shunga-Bilder und getrocknete Penisfutterale aus Papua-Neuguinea. In einem großen Schrein sammelte er Amulette mit erotischen Motiven aus fünf Kontinenten. Die Sammlung wurde von Gustafs Vater übernommen und erweitert, und nach dem Ableben des Vaters landete sie bei Gustaf, der es zu seiner Lebensaufgabe, seiner Berufung machte, sie zu vergrößern und auf internationales Niveau zu bringen. Was ihm auch gelang.
Heute besaß er eine einzigartige Sammlung aus aller Herren Länder, unter anderem war er der Einzige, der einen Bronzepenis von Dschingis Khan in Originalgröße hatte. Etwas, worum ihn die Mitglieder seines weltumspannenden Kontaktnetzes sehr beneideten. Viele Jahre später sollte er den Großteil der Sammlung dem Phallologischen Museum in Reykjavík spenden, unter der Bedingung, dass sein Name auf einer Plakette im Eingang stand.
Doch jetzt hatte er ein Angebot bekommen, das sein Gewissen quälte. Ein geschmuggelter Steinschniedel aus dem Mayareich! Normalerweise gab er sich niemals mit Diebesgut ab, aber dies war eine einzigartige Offerte, und die Versuchung war groß.
»Aber du bist größer!«, sagte Malte. »Wenn du deine Moral verkaufst, kannst du auch gleich alles verkaufen, und was bleibt dir dann?«
Gustaf senkte den Blick, er wusste, dass Malte recht hatte, die Grenze der Moral zu überschreiten ist einfach, aber es ist sehr schwer, wieder den Schritt zurück zu machen.
Inka, die eigentlich die Einzige am Tisch war, die eine relevante Meinung über einen Steinschniedel von einem Urvolk aus Zentralamerika hätte haben können, saß schweigend da. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Es quälte sie innerlich, dass die Kolonialmächte sich an den Heiligtümern der Ureinwohner bereicherten und sie ihres kulturellen Erbes beraubten. Doch sie hatte großen Respekt vor Gustaf, er hatte ihr finanziell geholfen, als ihre Mutter gestorben war und sie versuchte, hier Fuß zu fassen, und er war derjenige, der sie in die Dorfgemeinschaft eingeführt hatte. Jetzt sprach er von einem uralten Stück Stein in Form eines Phallus, das offenbar große Bedeutung für ihn hatte.
Sie äußerte sich also nicht zu der Sache.
»Und da kommt die Schwarze Märta!«, sagte Picasso. Er war noch immer glücklich über seine nasale Befreiung und wollte das ganze Wirtshaus an seinem neugeborenen Zustand teilhaben lassen: »Komm! Komm!«
Märta bahnte sich ihren Weg bis zum Tisch der Gruppe und setzte sich an ihren Platz.
»Wie lief es an der Tangfront?«, fuhr Picasso fort.
»Gut. Die Ladefläche war voll.«
»Da hat sich der Itaker sicher gefreut.«
»Der freut sich nie, der wurde mit einer Zitrone im Mund geboren. Oder einer Seegurke. Aber jetzt hört mal her …«
Märta senkte die Stimme und erzählte von dem Mann, der draußen am Kai auf der Ladefläche saß, und wie sie ihn gefunden hatte, im Begriff, sich das Leben zu nehmen. Ein paar Sekunden lang sagte niemand etwas.
»Wer ist er?«, wollte Gustaf wissen.
»Weiß nicht. Er heißt Georg, behauptet er.«
»Woher kommt er?«
»Ich hab nicht gefragt.«
»Hol ihn rein«, sagte Malte.
Märta stand auf und verließ den Tisch, während Picasso sich zum Raum umdrehte: »Sauertopf! Bringst du uns einen Rettungsanker, bitte?«
Alle blickten sich an. Ein Selbstmordversuch am Strand? Und noch dazu ein ziemlich spektakulärer.
»Glaubt ihr, er ist verzweifelt?«, fragte Picasso.
»Das sind ja wohl alle, die sich das Leben nehmen wollen«, meinte Inka.
»Überhaupt nicht«, erwiderte Malte. »Viele sind einfach lebensmüde und fertig mit ihrem Leben, müssen es aber auf eine Art und Weise beenden, die ihnen vom Staat aufgezwungen wird.«
»Vom Staat?«
»In diesem Land kann man sich nicht aussuchen, wann man sterben will, wenn man es nicht von eigener Hand tut. Sterbehilfe ist verboten.«
»Wofür wir vielleicht dankbar sein sollten«, sagte Gustaf und sah Malte mit festem Blick an.
Sowohl ihm als auch Malte war das Gesprächsthema aus persönlichen Gründen unangenehm, sie wichen ihm gern aus, doch jetzt hatte die Situation es mit sich gebracht.
Die Stimmung sank und das Gespräch geriet ins Stocken. Vor allem Picasso spürte, dass seine sprudelnde Nasenorgie ins Moll abglitt. Selbstmord? Nicht schön. Er leerte sein Glas, zündete sich eine Zigarette an und griff nach der Weinflasche.
»Das ist Georg.«
Märta näherte sich dem Tisch mit einem leicht zitternden jungen Mann an ihrer Seite. Er trug seinen Karton unter dem Arm. Inka nahm die Decke, die sie um die Beine hatte, und streckte sie Georg hin, er sah verfroren aus.
»Setz dich zu uns!«
Gustaf wies mit einer Geste auf einen leeren Stuhl. Er wusste sehr gut, wessen Stuhl es eigentlich war, doch in diesem Moment ging es um Mitmenschlichkeit. Georg setzte sich vorsichtig und legte den Karton auf seinem Schoß ab, Märta nahm neben ihm Platz. Alle am Tisch stellten sich vor.
»Und du heißt Georg?«, fragte Inka.
»Ja. Von Nichts«, antwortete er mit einem hellen, fast zwitschernden Klang in der Stimme.
Blicke wurden gewechselt, manche fragend, andere verwirrt.
»Georg von Nichts?«, erwiderte Inka schließlich.
»Ja.«
Georg schaute auf seinen Karton hinunter, und es wurde still um den Tisch. Picasso fuhr mit einem Finger an seinem Bleistiftbart entlang, und Inka folgte seiner Bewegung mit dem Blick. Schließlich räusperte sich Malte.
»Und was führt einen von Nichts in diese gottverlassene Gegend?«
Er wusste ja von dem Selbstmordversuch, aber er war neugierig, warum gerade hier? In ihrem abgelegenen Dorf?
»Das Schicksal … nehme ich an«, sagte Georg leise.
Hier hätte das Gespräch auf Grund laufen können, wäre nicht der Sauertopf mit einem Glas in der Hand angetrippelt gekommen. Ohne Umschweife stellte sie es vor Georg hin, sie war nicht umsonst schon seit zwanzig Jahren Kellnerin: »Ein Rettungsanker. Geheimrezept. Willst du was zu essen?«
Georg hob den Kopf und nickte. Die Gesellschaft um den Tisch prostete ihm zu, in der Hoffnung, der Rettungsanker würde weitere Informationen freigeben. Das tat er nicht, also beugte sich nach einer Weile Picasso zu ihm vor: »Ich meinerseits bin sehr anfällig für Tumore.«
Gustaf zog Picasso eine Spur zurück, stellte aber fest, dass sich der Hauch eines schüchternen Lächelns auf dem Gesicht des jungen Mannes zeigte.
»Gibt es hier eine Toilette?«, fragte er.
Märta zeigte ihm, wo sie lag, und Georg begab sich dorthin. Seinen Karton ließ er auf dem Stuhl.
Sofort entspann sich eine leise, aber intensive Konversation über die Lage. Ein »von Nichts«, vergraben am Strand, was konnte das bedeuten? War es ein Vorzeichen? Ein gutes oder schlechtes Omen? Ein Vorbote ungewisser Zeiten?
Aber vor allem: Was hatte er in dem Karton, der auf dem Stuhl lag?
*
Columbus’ selbst auferlegtes Kreisverkehrsdirigat war nicht nur eine Flucht von zu Hause, wie Märta angedeutet hatte. Es gab einen Hintergrund, einen Unfall, der sich ereignete, als der Kreisverkehr neu angelegt worden war. Einer der Dorfbewohner, gewohnt, jeden Tag den gleichen Weg zu fahren, war unaufmerksam und fuhr geradeaus direkt auf den Mittelhügel des Rondells. Die Bepflanzung wurde komplett zerstört, und der Mann im Auto, der Koch Luigi, verlor einen Zahn aus dem Oberkiefer, als er mit dem großen Schild zusammenstieß. Daraufhin griff Columbus ein und machte es sich zur Lebensaufgabe, ähnliche Unfälle in Zukunft zu verhindern. Auch, weil er nichts anderes zu tun hatte.
Doch jetzt hatte der Kreisverkehrsmann für diesen Abend aufgegeben, besiegt von der zunehmenden Kälte und den Scheinwerfern. Die letzte halbe Stunde war er von drei gnadenlosen Fernlichtern geblendet worden, die ihn dazu gezwungen hatten, hinter dem Schild Schutz zu suchen. Insofern war er extrem schlechter Laune, als er den Rückweg ins Dorf antrat. Besonders, weil sein Fahrrad einen Platten hatte und er es schieben musste, hungrig, frustriert und einsam. »Niemand verschwendet einen Gedanken an den kämpfenden Helden«, knurrte er. »Das ist das Los des Schicksals für einen Mann wie mich. Einen Columbus!« Er war stolz auf seinen Namen, stolz darauf, was man damit verband, einen bekannten Mann, der Großtaten vollbracht hatte. Er spürte oft, dass er in Fußstapfen trat, in berühmte Fußstapfen; manchmal, wenn er draußen am Leuchtturm Klein-Jan stand, fühlte er, wie die Flügelschläge der Geschichte vom Meer hereinfegten, und schrie: »Ich komme! Ich komme!« Jetzt trottete er in der Dunkelheit voran und zischte mit zusammengebissenen Zähnen sein Mantra: »Ich bin für andere Dinge bestimmt als Kreisverkehr.« Ein Gedanke, der auch seiner Mutter vorgeschwebt hatte, der Fischersfrau Mendelsohn. Als sie ihr einziges Kind erwartete, träumte sie von einem Seefahrer, einem Sohn, der die sieben Weltmeere besegeln und eventuell noch unbekannte Kontinente entdecken würde. Sie taufte ihn Columbus, lange bevor er geboren war. Nachdem er das Licht der Welt erblickt hatte, überlegte Frau Mendelsohn, ob der Taufname wirklich ideal war, hielt jedoch daran fest. Und wie die Jahre vergingen, musste sie einsehen, dass sie nicht das geboren hatte, was sie sich erhofft hatte, doch sie liebte ihren Sohn über alles in der Welt.
Herr Mendelsohn fischte, knüpfte Netze und fütterte die Möwe John.
*
Es war bereits nach Mitternacht und das Dorfwirtshaus Häring hatte sich schon fast geleert. Der Mann, der nie wieder seinen Fuß dorthin setzen wollte, war gegangen, würde jedoch am nächsten Tag wiederauftauchen, das wussten alle, nur die Gruppe um den vollgestellten Snustisch war noch da. Drei Männer, zwei Frauen und ein Karton. Der Besitzer des Kartons war so lange auf der Toilette geblieben, dass Märta sich hinübergeschlichen hatte, um zu kontrollieren, ob er auch keine Dummheiten machte. Versuchte, sich im Klosett zu ertränken. Derartiges. Sie kam mit positiven Nachrichten zurück: »Er ist noch da und macht, was er machen soll.«
Eine Information, die sie nicht weiter ausführen musste.
Die Gesellschaft versuchte also, Spekulationen über den missglückten Selbstmörder und seinen Hintergrund anzustellen. Aufgrund der beachtlichen Anzahl an Weinflaschen, die konsumiert worden waren, wurde die Diskussion ziemlich lautstark, so sehr, dass es eine Weile dauerte, bis die Musik hindurchdrang; die Töne kamen von dem Klavier in der Ecke von Maries Abteilung. Plötzlich verstummten alle und wandten sich um. Es war Georg, der spielte, den Kopf über die Tasten gebeugt.
Und er spielte schön.
»Chopin«, sagte Gustaf und sah Malte an.
»Dritte Sonate.«
»Vierter Satz.«
»Ein Mann mit gutem Geschmack.«
Alle lauschten andächtig der perlenden Musik. Sogar der Sauertopf sank auf einen Stuhl hinunter, ansonsten ein Tabu im Restaurant der Zwillinge: kein sitzendes Personal in Anwesenheit von Gästen. Doch jetzt saß sie da und lauschte genauso verzaubert wie alle anderen. Wäre nicht ein neuer, zorniger Gast gekommen, hätten sie vermutlich die ganze Nacht dort gesessen.
Columbus.
Er betrat das Lokal und warf die Tür mit einem Knall hinter sich zu, der Georg jäh mit dem Klavierspiel aufhören ließ. Grußlos ging Columbus zum Tisch, drehte den langen Schirm seiner Mütze nach hinten und bemerkte, dass ein Karton auf seinem Stuhl stand.
»Hat hier jemand gesessen?«, zischte er mit zusammengebissenen Zähnen.
»Ja. Von Nichts«, antwortete Märta. »Der junge Mann auf meiner Ladefläche. Jetzt sitzt er da drüben und spielt herrliche Musik. Oder hat gespielt.«
Märta deutete mit einer eleganten Geste auf Georg, der immer noch mit gebeugtem Kopf an der Klaviatur saß. Inka und Picasso rückten ein wenig auseinander und boten Columbus einen Platz zwischen sich an. Mit merklichem Widerwillen setzte er sich hin und drehte den Schirm wieder nach vorn, um nicht gegen die Wand in seinem Rücken zu stoßen. »Wie, von Nichts?«, fragte er. »Heißt er so?«
»Ja, offenbar.«
»Typischer Deckname.«
Jeder am Tisch kannte Columbus’ natürlichen Hang zu Verschwörungstheorien über alles und jeden. Sein intensiver Blick folgte Georg den ganzen Weg vom Klavier bis zum Stuhl. Seinem Stuhl, mit einem Karton darauf. Georg hob den Karton an und setzte sich im selben Moment, in dem Columbus sagte: »Hab ich dich nicht schon mal gesehen?«
»Ja, drüben beim Kreisverkehr.«
»Und davor? Vielleicht in irgendwelchen Schlagzeilen?«
Georg begriff nicht, was Columbus meinte, und suchte Unterstützung am Tisch. Die schnellste bekam er von Märta, seiner Schutzheiligen.
»Columbus ist nur neugierig«, sagte sie. »Kümmere dich nicht um ihn.«
Im Normalfall hätte Columbus diese Erniedrigung hinuntergeschluckt, doch heute Abend war er in Kampflaune. Zum tausendsten Mal gebratener Hering – und Verrückte im Kreisverkehr. Er hatte nicht vor, sich alles gefallen zu lassen, erst recht nicht von einem völlig Fremden, eventuell einem ausgebrochenen Irren. Von Nichts? Kapierten die denn nicht, was das signalisierte? Er strich mit der Hand an seiner langen Schirmmütze entlang und beendete die Geste mit einem ausgestreckten Zeigefinger in Richtung Georg: »Hier, an diesem Tisch, haben wir keine Geheimnisse. Wenn du welche hast, kannst du dich gleich wieder am Strand eingraben. War ich deutlich genug?«
Es folgten ein paar Sekunden unbehaglicher Stille. Inka schaute auf ihre Hände hinunter, und die Blicke der anderen irrten ein wenig umher; dermaßen gefühlskalt auf Georgs Selbstmordversuch anzuspielen, der erst ein paar Stunden her war, war eine klare Grenzüberschreitung. Selbst für Columbus. Die Frage war nur, wer zuerst reagieren sollte.
»Du hast wahrscheinlich keine Unterkunft für heute Nacht, nehme ich an?«, erkundigte sich Gustaf freundlich. Er hatte sich zu Georg gewandt und mit seiner Frage deutlich gemacht, was er von Columbus’ Unterstellungen hielt.
»Nein«, antwortete Georg.
»Du kannst ja in die Heringsfabrik einbrechen«, sagte Columbus. »Da gibt es sicher …«
»Ich habe einen Schlafplatz in meiner Werkstatt, hinter der Galerie«, unterbrach ihn Gustaf. »Du kannst heute Nacht dort schlafen. Wenn du möchtest.«
»Gern. Danke.«
Columbus stand sofort auf, drehte den Schirm um 180 Grad und verließ den Tisch. Das war das Signal für den Sauertopf. Sie kam zu ihnen und wies sie barsch darauf hin, dass das Restaurant schon vor einer Stunde hätte schließen sollen. »Die Bar ist leer und der Koch ist nach Hause gegangen.«
»Zu sich oder zu den Zwillingen?«
Das kam von Columbus, der sich umgewandt hatte, noch immer in Höchstform. Sein Kommentar gründete auf einem allgemein verbreiteten Gerücht über irgendeine Form von Ménage-à-trois.
Der Sauertopf ignorierte die Bemerkung und begann, Weinflaschen vom Tisch zu räumen. Die Gruppe kam auf ihre mehr oder weniger wackeligen Beine und begab sich in Richtung Ausgang. Auf dem Weg dorthin war Malte nahe daran, einen »Schattenseites Sonnenaufgang« zu bestellen, nahm aber seine ganze betrunkene Vernunft zusammen. Sogar im Land der Nebel gab es Grenzen.
*
3 Ein kurzer Besuch an der Fontana d’Aragosta
Einer der Vorteile der Ortschaft war ihre überschaubare Größe, alles ließ sich ohne größere Schwierigkeiten und mit geringem Zeitverlust zu Fuß erreichen. Vom Häring zur Phallologischen Galerie zu laufen, war normalerweise ein Spaziergang von ein bis zwei Minuten, in nüchternem Zustand. In dem Zustand, in dem Gustaf und einige seiner Freunde sich befanden, dauerte es fast eine Stunde, was unter anderem Picassos Vorschlag geschuldet war, einen kleinen Umweg für einen kurzen Besuch an der Fontana d’Aragosta zu machen, dem Mittelpunkt und Stolz des Dorfes. Er war auf die Idee gekommen, von Nichts den Ort zu zeigen.
Leicht verstreut und ziemlich lautstark bewegte sich also die angetrunkene Gesellschaft vom Kai eine enge, kopfsteingepflasterte Gasse hinauf, beleuchtet von spärlich platzierten Straßenlaternen. Hier und da wurden in Fenstern Lichter gelöscht und Vorhänge zugezogen, vermutlich wurde auch die eine oder andere Haustür zugesperrt. Doch das nahmen die Freunde nicht wahr, sie setzten ihre Wanderung fort, den Wind vom Meer im Rücken.
Das Schlusslicht bildete Columbus, ein gutes Stück hinter den anderen. Er verarbeitete noch immer eine Anzahl von Ungerechtigkeiten, die ihm seiner Meinung nach im Wirtshaus angetan worden waren, mal von diesem, mal von jenem. Die würde er sich merken! Die würden sie zurückkriegen!
Wenn man die Menge an Ungerechtigkeiten betrachtete, die ihm über die Jahre widerfahren waren, so ungefähr jeden Tag ein Dutzend, hätte sein Gedächtnisspeicher eigentlich inzwischen absolut überlastet sein müssen, doch gnädigerweise hatte der Schöpfer seine Möglichkeiten auf dieser Ebene begrenzt, er erinnerte sich im Grunde an nichts, das mehr als zwei Tage zurücklag.
»Hier ist sie!«
Picasso breitete die Arme aus, als sie auf den mit Kopfsteinpflaster ausgelegten Platz kamen: »Die Fontana d’Aragosta! Der weltberühmte Hummerbrunnen! Bekannt bei Poeten und Lustmördern!«
Georg war mit dem Karton unter dem Arm stehen geblieben. Er betrachtete den Brunnen. Er war wirklich besonders. In seiner Mitte thronte die beeindruckende, rot schimmernde Bronzestatue eines Hummers, gut vier Meter hoch. Sie war dem Dorf von der Mutter der Zwillinge Thervin gestiftet worden, im goldenen Zeitalter, als der Meeresboden nur so vor schwarzen Hummern wimmelte, einer Spezialität, die Leute von nah und fern anlockten. Die Hummer aus Schattenseite galten als die delikatesten des ganzen Landes und wurden sogar ins Rathaus der Hauptstadt geliefert, wenn auf dem Nobelfest Krustentiere serviert werden sollten.
Jetzt waren sowohl die Heringe als auch die Hummer fort, aber die Statue war noch da. Ihre langen Fühler wölbten sich in einem großen Bogen über den Körper nach hinten und spritzten Wasser in zwei langen Strahlen in ein darunter liegendes Bassin. Es war rund, mit gut dreißig Metern im Umfang und niedrigen Alabasterrändern, die im Schein der Straßenlaternen glänzten.
Georg ging zum Rand und blickte hinein. Die Oberfläche war blank und still, das Wasser sauber und frei von Algen. Der Grund war leer, ohne Münzen oder anderen Kram, der sonst in öffentlichen Brunnen landete. Er ging in die Hocke, stellte den Karton ab und senkte den Kopf auf die Brust. In der Ferne bellte eine Promenadenmischung, ein leiser, kurzer Laut. Die betrunkene Gesellschaft war ein paar Meter vom Brunnen entfernt stehen geblieben, alle beobachteten den jungen Mann, der vor seinem Rand hockte. Sogar Columbus war still.
»Was macht er?«, flüsterte Inka.
»Vielleicht beten«, antwortete Märta.
Aber Georg betete nicht. Er rief sich etwas in Erinnerung. Ein Bild, ein Gesicht aus der Vergangenheit. Er hielt es fest, so lange er konnte, vorsichtig tauchte er einen Finger ins Wasser, führte ihn in Kreisen herum, sah, wie kleine Wellen in unterschiedliche Richtungen davonschwappten. Dann verschwand das Gesicht.
Den Hund hörte er nicht.
»Wollen wir gehen?«
Malte fühlte sich etwas rastlos und brauchte Nachschub, er befand sich in einem Stadium, das zwischen Kollaps und weiterer Vorwärtsbewegung schwankte.
»Georg?«, fragte Märta mit ihrer vertraulichsten Stimme.
Georg hob den Kopf und zog die Hand zurück, der Finger war feucht vom Wasser. Er wischte ihn an seiner Hose ab, stand auf und nahm den Karton. Als er sich umwandte, bemerkte er, dass alle ihn ansahen.
»Das ist wirklich ein schöner Brunnen«, sagte er.
*
4 Ein fremder Vogel in der Phalluswerkstatt
Gustaf Cylinders Tätigkeit bestand hauptsächlich darin, seine Phallussammlung zu vergrößern und zu verfeinern, doch aus pekuniären Gründen restaurierte er auch einige Objekte, sofern es im Rahmen seines beruflichen Könnens lag. Außerdem fertigte und verkaufte er mehr oder weniger den Touristen zumutbare Skulpturen und kleine Fayence-Meisterwerke, alle mit demselben Thema. Im Fenster zum Kai hinaus konnte man ein breites Angebot seiner Produkte bewundern, aus Keramik, Glas, Stahl und einigen weniger bekannten Materialien. Während der Touristensaison zog die Galerie berechtigterweise Aufmerksamkeit auf sich; ein so unverblümtes Aufgebot an männlichen Geschlechtsorganen in allen erdenklichen Formen und Farben kannte man sonst üblicherweise nicht.
Es gab eine ganze Menge Dorfbewohner, die es anstößig fanden, Geschlechtsorgane auf diese Weise zu exponieren und sich darüber hinaus seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Andere waren gegenteiliger Meinung. Die beiden Fronten lagen weit auseinander und zementierten die Spaltung, die in der kleinen Gemeinde herrschte. Egal, worum es ging, es war für die eine Seite selbstverständlich, nicht derselben Meinung zu sein wie die andere.
Für oder gegen den Kreisverkehr war ein weiteres solches Beispiel. Der Konflikt hatte einige Jahre zuvor in einer öffentlichen Abstimmung geendet. Am Brunnen war eine große Urne aus Keramik aufgestellt worden, in die die Dorfbewohner ihre Stimme abgeben durften. Den Sommergästen wurde die Teilnahme an der Abstimmung nicht gestattet, das war das Einzige, worin man sich einig war. Die Pro-Kreisverkehr-Seite hatte mit knappem Vorsprung gewonnen, doch die andere Seite weigerte sich, das Ergebnis anzuerkennen. Sie behauptete, man habe während des Prozesses in großem Umfang betrogen und Außenstehende dafür bezahlt, nachts ungültige Stimmzettel in die Urne zu schmuggeln. Es ließ sich nie beweisen, verstärkte die Animositäten zwischen den beiden Fronten jedoch weiter.
Gustaf Cylinder kümmerte es nie, was die eine oder andere Hälfte der Bevölkerung von diesem oder jenem hielt, er liebte seinen Betrieb. Und um ihn in Gang zu halten, hatte er in der Galerie eine gut ausgerüstete Werkstatt eingerichtet, in der er seine Produkte restaurierte und herstellte. Sein handwerkliches Geschick war allgemein bekannt, er führte die filigransten Arbeiten mit links aus.
Die Phalluswerkstatt war sein Herz.
Dorthin war die wankende Gesellschaft jetzt unterwegs, dort hatte der Inhaber einem völlig Fremden einen Übernachtungsplatz angeboten, mitten in diesem Herzen.
Doch der erste Halt war die Galerie vor der Werkstatt. Über dem Eingang stand »Phallologische Galerie«, die Schrift war mit Goldfarbe per Hand direkt auf die Fassade aufgetragen worden. Hinter dem Eingang öffnete sich ein großer, hoher Raum mit zwei Fenstern zum Hafen. Sorgfältig austarierte Scheinwerfer hingen in geraden Reihen an der Decke und warfen ihr Licht auf die Wände und die verschiedenartigen Piedestale auf dem Boden. Die ganze Längsseite den Fenstern gegenüber wurde von einem avantgardistischen Regalsystem aus Glas eingenommen, in dem Hunderte von Objekten ausgestellt waren, alle mit kleinen bedruckten Karten mit Informationen über den jeweiligen Gegenstand vor sich. Auf den Piedestalen standen Objekte, die Gustaf nach unterschiedlichen Kriterien ausgewählt hatte. Einige aufgrund ihres historischen Interesses, andere aufgrund ihrer vollendeten Ästhetik. An der einen Schmalseite hingen drei Glasvitrinen, jede mit einem Geschlechtsorgan, das Gustafs Ansicht nach nicht berührt werden durfte. Sie waren verschlossen und wurden nur in sehr seltenen Fällen geöffnet, wie bei Besuchen von ausländischen Experten oder Sammlern aus anderen Teilen der Welt. In den Fensternischen hatte er Objekte platziert, die Passanten interessieren könnten, in der Sommerzeit meist Touristen. Er hatte auch eine Ecke ganz hinten im Raum, in der er unterschiedliche Fetische verkaufte, die mit seinem Geschäft in Verbindung standen. Zeitweise mit sehr gutem Umsatz.
Die Galerie zeigte jedoch nur einen Bruchteil seiner enormen Sammlung. Der weitaus größere Teil lag sorgfältig verpackt in Holzkisten im Keller des Hauses. Dort hatte niemand Zutritt außer ihm selbst.
In der Galerie gab es auch ein paar Stühle, einige Bänke und den Boden für Freunde mit geschmeidigeren Gliedern. Wie Inka. Sie ließ sich an einer Wand hinuntergleiten und bat Gustaf, ein paar Kerzen anzuzünden, was er auch tat. Er wusste, worauf es in dieser Situation ankam, es war nicht das erste Mal, dass ein durchzechter Abend in der Galerie endete. Aber ihm war es recht. Freunde waren dafür da, dass man sich um sie kümmerte. »Hat jemand Durst?«, fragte er.
Ohne eine Antwort abzuwarten, holte er ein paar Flaschen italienischen Rotwein und eine Flasche Whisky heraus. Für Malte, seinen Kombattanten und engsten Freund. Sie kannten sich schon ihr ganzes Leben lang, beide waren im Dorf aufgewachsen und dann viele Jahre getrennt an unterschiedlichen Orten gewesen, Gustaf in Rom für ein Langzeitstipendium, Malte in Paris und einigen anderen südeuropäischen Metropolen auf der Suche nach sich selbst. Doch als sie schließlich nach Schattenseite zurückkehrten und Wurzeln schlugen, wurde klar, dass die Bande zwischen ihnen unauflöslich waren.
Und unerträglich.