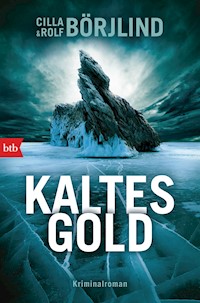14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Rönning/Stilton-Serie
- Sprache: Deutsch
SPIEGEL-Nummer-1-Bestseller-Autoren – Bücher erscheinen in 30 Ländern – Serie verfilmt (ZDF)
Als Olivia Rönning und Lisa Hedqvist ukrainische Flüchtlinge befragen, um Misshandlungen auf dem Fluchtweg zu dokumentieren, erfahren die beiden Polizistinnen von einem internationalen Netzwerk, das Menschenhandel organisiert. Wer steckt dahinter? • Tom Stiltons Partnerin Luna glaubt, dass er in einen Mordfall verwickelt war, aber Stilton scheint sich deswegen nicht schuldig zu fühlen. Als die Polizei ihn verhört, spitzt sich die Situation zu. Kann sie einen solchen Mann überhaupt lieben? • Ein Mann stürzt im Zentrum von Stockholm von einem Dach, nachdem er von zwei Männern gejagt wurde. Der Mann kann nicht identifiziert werden. Wer ist er, und wer hat ihn verfolgt? • Abbas, Toms und Olivias Freund, erhält unerwarteten Besuch von seiner Mutter, die er seit seiner Kindheit nicht mehr gesehen hat – eine schockierende Begegnung. Warum hat sie ihn aufgesucht? Alles hat mit einer Luxusjacht an der französischen Riviera und einem unbezahlbaren Schatz zu tun – einem verschwundenen Fabergé-Ei namens Auge der Nacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2024
Sammlungen
Ähnliche
Zum Buch
Als Olivia Rönning bei einer Fahrzeugkontrolle zwei ukrainische Frauen entdeckt, erfährt die Polizistin von einem internationalen Netzwerk, das die Not der Flüchtlinge ausnutzt und Menschenhandel organisiert. Wer steckt dahinter?
Ein Mann stürzt im Zentrum von Stockholm von einem Dach, nachdem er von zwei Männern gejagt wurde. Der Mann kann nicht identififiziert
werden. Tom Stilton muss herausfinden, wer er war und wer ihn verfolgt hat.
Abbas, Toms und Olivias Freund, erhält unerwarteten Besuch von seiner Mutter, die er seit seiner Kindheit nicht mehr gesehen hat – eine schockierende Begegnung. Warum hat sie ihn aufgesucht?
Alles hat mit einer Luxusjacht an der französischen Riviera und einem unbezahlbaren Schatz zu tun – einem verschwundenen Fabergé-Ei namens Auge der Nacht.
Zu den Autoren
CILLAUNDROLFBÖRJLIND gelten als Schwedens wichtigste und bekannteste Drehbuchschreiber für Kino und Fernsehen. Ihre Serie um Polizistin Olivia Rönning und Kommissar Tom Stilton wurde sehr erfolgreich für das ZDF verfilmt. Die Kriminalromane sind Bestseller und erscheinen in 30 Ländern.
Cilla & Rolf Börjlind
Das Auge der Nacht
Kriminalroman
Aus dem Schwedischen von Susanne Dahmann und Julia Gschwilm
Die schwedische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Nattens öga« bei Norstedts, Stockholm.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 by Cilla & Rolf Börjlind
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Published by Agreement with Grand Agency
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © Getty Images/Johner Images; ©shutterstock/Nerjon Photo, andrejs polivanovs
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978 -3-641-30034-0
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Society prepares the crime;
The criminal commits it.
Henry Thomas Buckle(1821–1862)
FRÜHJAHR 2022
Boris lehnte still an der samtweichen Wand, er war ganz schwarz gekleidet, neben seinem Hocker stand ein schimmernder Metalleimer. Manchmal passierte es, dass die Besucher sich übergeben mussten.
Heute Abend war der kleine Salon voll besetzt, acht Personen aus unterschiedlichen Teilen der Welt. Sämtlich Männer, tief eingesunken in rote Plüschsessel. Alle hatten sie ein Vermögen dafür bezahlt, hier sitzen zu dürfen.
Bevor sie den Raum betraten, hatte er die Beleuchtung an den Fußleisten heruntergedimmt, sodass der Raum fast im Dunkeln lag. Nur von dem Aquarium ein paar Meter vor ihnen fiel ein blauer Schein auf die Gesichter der Männer. Handykameras waren nicht erlaubt. Die geheime Dokumentation erfolgte indes durch ein winziges Loch im Feuermelder oben an der Lüftungsklappe.
Der Mann, der ganz außen saß, trug eine traditionelle Kufiya und eine rechteckige Brille. Der Mann daneben im hellblauen Seidenanzug, den er sich vermutlich auf der Savile Row hatte schneidern lassen, war Engländer.
Wie gewöhnlich war es fast ganz still, das Wasser dämpfte alle Geräusche dessen, was sich hinter der Glaswand abspielte. Boris beobachtete die Gesichter der Männer während des intensiven Aktes, ihre Augen und Münder, die Zungen, die hinein- und wieder herausglitten, um die Lippen zu befeuchten, während der ein oder andere Schweißtropfen die Nasenwurzel hinunterlief. Ihre perverse Erregung war leicht abzulesen.
Als die Reflexe des blauen Scheins in der Brille des Arabers allmählich in Rot übergingen, würde es nicht mehr lange dauern. Als er den Kopf neigte, war es vorbei.
Das Ende zog sich selten lang hin.
Die Gäste erhoben sich und verließen den Salon, keiner von ihnen sagte ein Wort. Boris drehte die Beleuchtung der Lampen im Boden hoch und vermied es, sich umzusehen.
Diesmal war der Eimer nicht nötig gewesen.
Er hieß Oleksij und hielt ein totes Katzenjunges auf dem Schoß, das vor einer Weile erfroren war. Seine Mutter ließ ihn das Tier bis auf Weiteres halten. Sie kauerten unter einer nassen Decke, verborgen auf der Ladefläche eines Lastwagens, und waren auf der Flucht aus Butscha. Ihr Ziel war die polnische Grenze.
Eine lange und gefährliche Reise. Nach einer Weile blieb der Fahrer stehen und bot ihnen an, drinnen in der Wärme des Führerhauses zu sitzen. Bedingung war allerdings, dass sie das tote Katzenjunge zurückließen.
»Das will ich hier drinnen nicht haben.«
Alina brachte ihren Sohn dazu, die tote Katze am Straßengraben abzulegen. Sie riss ein paar Grassoden aus und bedeckte das kleine Tier. Oleksij schaute mit leerem Blick zu. Er hatte in den letzten vierundzwanzig Stunden schon schlimmere Sachen gesehen, so schlimm, dass er nicht mehr schlafen konnte.
»Los, springt rein.«
Der Fahrer winkte, und Alina hob Oleksij in die Fahrerkabine. Er war sieben Jahre alt und hatte an seiner Schulbank gesessen, als eine russische Bombe das Gebäude traf, und jetzt fror er und schob die Hände unter den Pullover. Alina nahm ihn auf die Bank, setzte sich selbst daneben und zog die Tür zu. Die Wärme schloss sich um ihre Körper.
»Glaubst du, wir kommen bis zur Grenze durch?«, fragte Alina.
»Nein. Als ich am Mittwoch hier vorbeigefahren bin, lagen sie da und haben Lwiw beschossen. Wir können versuchen, weiter nach Norden zu fahren, aber sicher ist es dort auch nicht. Wenn ich umkehren muss, lasse ich euch raus, dann müsst ihr zu Fuß weitergehen.«
Alina betrachtete den grobschlächtigen Mann am Steuer, ein unbekannter Landsmann, der sie an einer zerschossenen Bushaltestelle mit den Worten »Versteckt euch auf der Ladefläche« aufgesammelt hatte.
Und jetzt hatte er vor, sie so weit zu fahren, wie er konnte. Um ihretwillen. Sie nahm an, dass er dann wieder nach Butscha zurückkehren und weiteren Flüchtlingen helfen würde.
»Danke, dass du uns fährst«, sagte sie.
Auf dem Weg begegneten ihnen nicht viele Fahrzeuge, denn der Mann wählte kleinere Straßen, um nicht entdeckt zu werden. Mehrere Tage schon hatten russische Panzer auf Lastwagen geschossen. Es herrschte Krieg, und sie waren von einer Großmacht überfallen worden.
Alina nahm ihren Sohn in den Arm. Sie spürte, wie der dünne Körper zitterte, und hoffte, dass es nur die Kälte wäre, die noch in ihm steckte. Doch im Grunde wusste sie, dass es wahrscheinlich andere, quälendere Gründe gab.
Wenn wir es über die Grenze schaffen, dann muss ich ihn dazu bringen zu reden, ehe er alles in sich einschließt, dachte sie und spürte den Druck auf ihrer Brust. Sie durfte nicht anfangen zu weinen. Nicht jetzt, nicht hier, nicht, wenn er wach war. Unter der Decke auf der Ladefläche war er für ein paar kurze Momente auf ihrem Schoß eingedöst, und da hatte sie es laufen lassen. Still, mit geschlossenem Mund, und vorsichtig, damit keine Tränen auf sein Gesicht fielen.
Das Trio im Führerhäuschen saß still, als das Auto aufs Land hinauskam. Die Felder um sie herum lagen öde, in den Dörfern sahen sie nur alte Leute und Kinder. Keine erwachsenen Männer, die waren im Krieg. Alina versuchte zu verstehen, worum es hier überhaupt ging. Warum hat man uns angegriffen und beschossen? Sie war in Butscha, ein Stück vor Kiew, aufgewachsen und arbeitete dort als Telefonistin. Sie hatte noch nie irgendwelche Nazis getroffen, von denen die Russen behaupteten, es gäbe sie überall. Lügen die einfach nur, um uns vernichten zu können? Sie kapierte es nicht, ebenso wenig wie ihre Freunde. Sie war 31 Jahre alt, doch in der letzten Zeit war ihr Gesicht gealtert. Die vielen durchwachten Nächte hatten Falten in ihre Haut gezogen, und die ständige Sorge um Bohdan, ihren Mann, hatte noch den Rest dazugetan. Er war bei der Armee und schon seit Kriegsbeginn weg. Ein paarmal hatte sie kurz Kontakt zu ihm gehabt, jedes Mal hatten sie gemeinsam ins Telefon geweint. Jetzt wusste sie nicht, wo er sich befand und ob er überhaupt noch lebte. In der ersten Zeit hatte Oleksij noch nach seinem Papa gefragt, dann hatte er damit aufgehört. Alle seine Freunde hatten Väter, die an der Front waren. Die von zu Hause weg waren und vielleicht niemals zurückkommen würden. Da tat es am wenigsten weh, wenn man nicht darüber redete.
Der Lastwagen fuhr langsamer, und Alina wurde aus ihren Gedanken gerissen. Schon hier? Würde er hier umkehren?
»Wohin willst du?«
Der Fahrer hatte die Scheibe heruntergedreht und sprach jetzt mit einem blonden jungen Mädchen in einem ausgeblichenen Pullover, das auf der anderen Straßenseite in ihrer Richtung lief. Sie hatte eine graue Bandage um den Arm.
»Zur Grenze«, antwortete sie.
»Möchtest du ein Stück mitfahren?«
Das Mädchen nickte und kam zu ihnen herüber. Alina öffnete die Tür für sie und drückte Oleksij näher an sich. Es wurde eng.
»Ich heiße Alina, das hier ist Oleksij.«
»Ivanna«, sagte das Mädchen.
»Woher kommst du?«
»Kiew.«
»Was hast du mit dem Arm gemacht?«, fragte Oleksij und zeigte auf Ivannas Bandage. Sie antwortete nicht.
»Du musst es nicht erzählen«, sagte Alina.
»Unser Haus …«, begann Ivanna und wandte das Gesicht ab. »Es ist von einer Granate getroffen worden und eingestürzt … ein großer rauchender Steinhaufen … meine Familie ist darunter begraben …«
Sie verstummte.
»Hast du dich da verletzt?«, fragte Oleksij.
Ivanna fuhr mit den Fingern über die Bandage auf dem Unterarm und ließ den Blick aus dem Seitenfenster wandern, ehe sie antwortete.
»Nein.«
Alina zog Oleksij an sich, sie wollte nicht, dass er Ivanna weiter ausfragte. Der Fahrer sah zu ihnen und deutete aufs Handschuhfach.
»Mach mal die Klappe auf«, sagte er. »Da sind Kekse und Wasser drin.«
Ivanna holte ein Päckchen Kekse heraus und gab Alina und Oleksij davon. Der Fahrer griff nach einer Plastikflasche mit Wasser.
»Meine kleine Katze ist gestorben«, sagte Oleksij und aß ein Stück Keks. »Jetzt liegt sie in einem Straßengraben.«
»Wie hieß sie denn?«, fragte Ivanna.
»Yasia. Ich habe sie unter einem brennenden Auto gefunden. Hast du ein Haustier?«
»Nein.«
Ivanna schaute schnell wieder aus dem Fenster, und Alina spürte, dass Oleksijs Frage an etwas gerührt hatte, worüber das Mädchen nicht sprechen wollte.
Das monotone Brummen des Lastwagens wirkte einschläfernd. Oleksij drückte seinen Kopf unter Alinas Arm und dämmerte weg, während die anderen schweigend dasaßen. Es gab nichts zu sagen. Alle waren sie Opfer derselben Tragödie und auf der Flucht vor einer schonungslosen Vernichtung.
»Mama! Was war das?«
Oleksij fuhr plötzlich hoch und zeigte mit dem Finger nach draußen.
Ein lautes Dröhnen war in das Führerhaus gedrungen, und in einiger Entfernung war eine hohe Feuersäule zu erkennen. Alina drückte den Sohn noch fester an sich. Er wusste, dass dies weder Donner noch Blitz gewesen war. Er hatte bereits gelernt, die zerstörerischen Kräfte der Natur von denen des Menschen zu unterscheiden.
»Jetzt muss ich umdrehen«, sagte der Fahrer, »sonst wird es zu gefährlich.«
Er hielt am Rand eines weitläufigen Ackers.
»Wie weit ist es zur Grenze?«, fragte Alina.
»Ein paar Kilometer. Am sichersten ist es, wenn ihr durch den großen Wald jenseits von Tjervonohrad geht, da drinnen seid ihr geschützt. Aber geht möglichst bei Tageslicht.«
»Warum?«
Der Fahrer antwortete nicht. Er wies nur auf die Tür bei Ivanna. Sie öffnete sie, und alle drei stiegen aus dem Führerhäuschen. Dann sahen sie den Lastwagen auf der Straße wenden und zurück Richtung Kiew fahren.
In Rauch und Schwefelgeruch gehüllt gingen sie über das Feld auf den Wald zu.
*
»Wie lange hast du die Uniform denn nicht mehr angehabt?«, fragte Lisa Hedqvist.
Sie und Olivia Rönning zogen sich gerade in der Polizeizentrale um.
»Bestimmt hundert Jahre«, antwortete Olivia.
Das war leicht übertrieben, aber sie hatte tatsächlich nur sehr kurze Zeit in Uniform verbracht, eigentlich nur das Jahr, nachdem sie die Polizeihochschule verlassen hatte. Dann hatte Kommissarin Mette Olsäter sie in die Kriminalpolizei geholt.
Ihre Uniform hatte sie also schon lange nicht mehr getragen.
Doch jetzt war das Pflicht für alle, die, wie auch Olivia und Lisa, nach Nynäshamn fahren würden.
Die Stockholmer Polizei hatte unter dem Namen Accepto einen Spezialeinsatz geplant. Ziel war es, Menschenhandel und Prostitution zu unterbinden, die es im Zusammenhang mit der Aufnahme geflüchteter ukrainischer Frauen gab. Da die Stockholmer Kollegen mit ihren Kräften bereits am Anschlag waren, hatten sie bei der Nationalen Operativen Abteilung NOA um Verstärkung gebeten. Olivia und Lisa gehörten zu denen, die sich bereit erklärt hatten.
Bei ihrem Einsatz sollten sie vor Ort dafür sorgen, dass Flüchtlinge nicht mit den falschen Personen in Kontakt kamen und in die Hände von Menschenhändlern gerieten, von denen sie dann zur Prostitution gezwungen würden. Es gab Hinweise, dass genau dies geschah, dass es Menschen gab, die den Frauen alles von der Fahrt zu einem Übernachtungsort bis hin zu einer vorübergehenden Wohnung anboten, was im schlimmsten Fall mit Freiheitsberaubung und Prostitution endete.
Im Moment war der Einsatz auf Nynäshamn konzentriert, den Hafen südlich von Stockholm, über den die meisten der vielen Geflüchteten nach Schweden kamen. Hier legten täglich Fähren aus Gdańsk in Polen an, mit manchmal bis zu 700 Flüchtlingen an Bord.
Also waren Olivia und Lisa auf dem Weg nach Nynäshamn.
Eigentlich gehörte dies nicht zum Spezialgebiet der beiden, normalerweise waren sie mit Mordermittlungen befasst, doch hier wurde die Verletzlichkeit von Frauen auf der Flucht ausgenutzt, und Sexhandel war etwas, das beide zutiefst hassten. Lisa hatte zudem persönliche Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen, die Demütigung würde ihren Körper nie wieder verlassen. Also hatte sie keinerlei Problem, sich für diesen Einsatz zu motivieren.
Ehe sie sich in die Arbeit stürzten, hatten sie ein paar Stunden damit verbracht, Berichte über verschiedene Polizeieinsätze gegen Trafficking durchzugehen, und dabei schreckliche Geschichten gelesen: von ausländischen Frauen, die monatelang gefangen gehalten und im Grunde rund um die Uhr gezwungen wurden, ihren Körper zu verkaufen. Die von Männern, denen alles außer Geld völlig egal war, zu Sexsklavinnen gemacht wurden.
»Wie sieht das aus?«, fragte Olivia und knöpfte die Jacke zu.
»Eng.«
»Eng?«
»Das war ein Witz. Nehmen wir unser Auto?«, fragte Lisa.
»Nein, wir fahren mit Lasse und Göran.«
Lasse Tingvall und Göran Borg waren ebenfalls Ermittler der NOA und schon seit einigen Jahren ihre Kollegen.
»Na denn«, sagte Lisa.
Olivia und sie verließen den Raum. Jetzt war es an der Zeit für eine Begegnung mit dem Flüchtlingsstrom.
*
Eine Reihe von Autos stand in einem Halbkreis, an den Seiten brannten kleine Feuer, die Funken sprühten in die Luft und verschwanden in der Dunkelheit. Eine hoch aufgehängte Baulampe verbreitete ein kaltes Licht über den Platz. Einige Männer und Frauen in Zivil trugen mehrere große weiße Plastikkisten mit dem Logo des Roten Kreuzes zu einem gerodeten Sandplatz und stapelten sie dort aufeinander.
»Sieh mal!« Eine grauhaarige Frau nickte zum Waldrand hin.
Zwischen den Bäumen taumelten langsam drei Gestalten heraus, dann warteten sie. Die Frau ging ihnen entgegen, legte die Hände vor der Brust über Kreuz und nickte ihnen zu.
»Willkommen! Jetzt seid ihr in Polen!«
Sie sagte das auf Ukrainisch, und das erschöpfte Trio begriff, dass es die Grenze passiert hatte. Alina sank an eines der Feuer, um sich zu wärmen. Oleksij hockte sich hin und strich ihr mit beiden Händen übers Haar.
»Bist du müde, Mama?«
»Ja.«
Fast einen Tag lang waren sie durch Schlamm und Stille gelaufen. Alina konnte die letzten Worte des Lastwagenfahrers nicht vergessen: »Aber geht möglichst bei Tageslicht.« Diese Warnung hatte sie auf ihrer Wanderung die ganze Zeit über in Anspannung gehalten, ihr ganzer Körper war völlig erschöpft.
»Ihr müsst ja fast erfroren sein«, sagte die Frau.
»Ja«, erwiderte Ivanna. »Und wir haben Hunger.«
»Wir können etwas Essen besorgen, aber ihr könnt leider nicht hierbleiben. Wir haben keine Übernachtungszelte.«
»Wohin sollen wir denn dann gehen?«, fragte Alina.
»Es gibt einen Transporter, der gleich nach Schweden zurückfahren wird, um dort noch mehr Sachspenden zu holen. Vielleicht könnt ihr mit dem fahren.«
Alina sah Ivanna an.
»Ich habe eine Cousine in Schweden, in Borås«, sagte Ivanna. »Da würde ich gerne hin.«
Alina hatte überhaupt keinen Plan gehabt, wie es weitergehen sollte, nachdem sie die Grenze passiert hatten. Sie hatte keine Verwandten außerhalb der Ukraine, hatte aber gehört, dass ukrainische Flüchtlinge in Schweden gut aufgenommen würden. Das Land hat dieselben Farben in seiner Flagge wie die Ukraine, dachte sie und musste über sich selbst den Kopf schütteln in Anbetracht dieses vollkommen irrelevanten Arguments.
»Dann fahren wir gern mit, wenn wir dürfen«, erwiderte sie.
»Gut.«
Die Frau drehte sich um und winkte einen Mann herbei, der vor einem modernen grauen Campingbus mit polnischem Kennzeichen stand. Der Mann rückte seine braune Kappe zurecht und kam zu der Gruppe.
»Ja?«, fragte er.
»Können diese drei vielleicht mit euch nach Schweden fahren?«, fragte die Frau. »Sie sind gerade über die Grenze gekommen.«
»Natürlich können sie mitfahren.«
Der Mann lächelte und wandte sich an Alina.
»Sprecht ihr Englisch?«
»Ja, ein wenig.«
»Wir werden nach Gdańsk fahren und die Fähre rüber nach Nynäshamn nehmen. Die Schweden dort werden sich um euch kümmern. Woher kommt ihr?«
»Aus Butscha und Kiew«, antwortete Alina.
»Verstehe. Wir werden euch helfen. Kommt.«
»Danke«, sagte die grauhaarige Frau.
Der Mann ging vor ihnen zum Campingbus und hielt die Tür auf. Das Trio stieg ein, und der Mann folgte.
»So sieht es hier aus«, erklärte er. »Einfach, aber funktional. Oben gibt es zwei weitere Betten, ihr könnt euch aussuchen, wo ihr schlafen wollt. Jacek und ich können uns nach euch richten.«
Er machte eine Handbewegung zu einem Mann mittleren Alters mit gut gepflegtem, schwarzem Bart, der auf dem Fahrersitz saß. Alina und Ivanna sahen sich um. Der Wagen hatte einen engen Küchenbereich, eine Küchenzeile mit Tisch und zwei Bänken an den Seiten, die zu Betten umgebaut werden konnten. Eine schmale Leiter führte hinauf zu den anderen Schlafplätzen.
»Ich nehme mal an, ihr seid ziemlich fertig, oder?«, fragte der Mann.
»Müde und hungrig«, erwiderte Ivanna.
»Und durchgefroren«, fügte Alina hinzu.
Der Mann zog die Tür hinter ihr zu und schob seine Kappe in die Stirn.
»Wir haben heiße Getränke. Tee, Kaffee, Kakao. Und Essen. Jacek! Kannst du ein bisschen was aufdecken?«
Jacek erhob sich vom Fahrersitz und ging in die Küchenecke. Rasch zauberte er Butter, Brot, diverse Aufstriche und ein paar fette polnische Würste hervor. Er schnitt die Würste in Scheiben und legte sie auf ein Brett, das er Ivanna hinhielt.
»Deftig, aber gut.«
Ivanna lächelte verhalten und nahm sich eine Scheibe. Wenn es nach ihrem knurrenden Magen gegangen wäre, hätte sie fünf nehmen können, doch sie hielt sich zurück. Der andere Mann kochte Wasser, schüttete es in ein Glas und rührte ein paar Löffel Kakaopulver hinein.
»Hier«, sagte er und streckte Oleksij das Glas hin. »Puste aber noch ein bisschen, das Wasser ist heiß.«
Alina übersetzte für Oleksij. Vorsichtig ließ sie sich auf einer der Bänke nieder, zog die Beine unter sich und wartete, bis sie eine Tasse Kaffee bekam. Sie war nur noch ein Wrack, versuchte aber, sich zusammenzureißen. Es war ihnen gelungen, vor dem Krieg zu fliehen und außer Landes zu kommen. Sie waren gerettet. Oleksij war in Sicherheit. Bestimmt gab es überall auf der Welt gute Menschen.
Ivanna schlief schon bald bei der leisen Musik des Autoradios auf der Bank gegenüber von Alina ein. Oleksij versuchte, die Augen offen zu halten, denn er fand es spannend, mit einem Wohnmobil zu fahren. Alina betrachtete ihren dunkelgelockten Sohn, der die Lippen zusammenpresste, um sich zu konzentrieren. Jacek hatte einen weißen Block und ein paar Buntstifte rausgeholt, und Oleksij hatte ein kleines Kätzchen gemalt und YASIA in eine Ecke geschrieben. Jetzt versuchte er, das Schulhaus zu malen. Das war schwer.
Wenn wir nach Schweden kommen, kriegt er den größten Zeichenblock der Welt, dachte Alina und merkte gar nicht, wie das Auto von der größeren Straße auf einen schmalen Waldweg abbog.
Dann hielten sie an.
Der Mann mit der braunen Kappe kam vom Fahrersitz nach hinten und zog Ivanna ein wenig am Bein. Sie schlug sofort die Augen auf.
»Geh du mal ein Weilchen mit dem Jungen raus«, befahl er.
»Warum das denn?«
»Wir müssen mit seiner Mutter reden.«
Alina setzte sich kerzengerade auf. Die Stimme des Mannes war verändert, der sanfte Ton war verschwunden.
»Worüber müssen wir reden?«, fragte sie.
»Wir müssen dir ein paar Sachen erklären.«
Der Mann öffnete die Tür und bedeutete Ivanna auszusteigen. Sie blickte Alina an. Der Mann trat einen Schritt auf sie zu.
»Jetzt mach mal kein Theater, nimm den Jungen und geh raus.«
Da sie nicht wusste, was passieren würde, wenn sie sich weigerte, nahm Ivanna den Kleinen an der Hand und stieg das kleine Treppchen vor der Tür herunter. Der Mann zog die Tür hinter ihr zu und schloss ab.
Alina sah es.
Ihr Magen zog sich zusammen, als ihr klar wurde, dass sie jetzt in einem Wald irgendwo in Polen zwei fremden Männern gänzlich ausgeliefert waren. Was wollten die?
»Ich nehme an, du hast einen Pass bei dir«, sagte der Mann.
»Ja.«
»Hol den mal raus.«
»Warum?«
»Wenn wir nach Schweden kommen, wirst du ihn nicht brauchen. Wir haben alle nötigen Papiere.«
»Was wollt ihr mit dem Pass?«
Sie konnte die Hand gar nicht so schnell wahrnehmen, da schlug sie ihr schon ins Gesicht. Alina wurde zurückgeschleudert, und das Kinn knallte ihr auf die Brust.
»Aber hier ist er ja … Alina? So heißt du doch, oder?«
Alina nickte schwach.
»Wir werden euch nach Schweden fahren wie versprochen, aber wir verlangen eine gewisse Entschädigung dafür.«
»Ich habe kein Geld, ich …«
»Du hast einen Körper.«
Alina hob den Kopf, ihr standen Tränen in den Augen, die Lippen wurden zu einem Strich. Sie begriff. Sie wusste.
»Und wenn ich mich weigere?«, fragte sie und zog den Kopf ein.
Der Mann beugte sich nach unten.
»Dann lassen wir deinen Sohn hier im Wald und fahren dich zurück zur Grenze. Wie alt ist er? Sechs Jahre? Sieben? Wie lange wird er wohl alleine in der Wildnis klarkommen? Du wirst dich nicht weigern. Zieh dich aus.«
Alina hielt die Hände fest geballt zwischen den Beinen, der Brustkorb war angespannt. Der Mann richtete sich auf und schaute zum Fahrersitz.
»Jacek, kannst du sie mal Probe reiten?«
Jacek begann seine Hose herunterzuziehen.
Ivanna hatte schon Geschichten von unfassbaren Übergriffen gehört, von russischen Soldaten, die Frauen auf Straßen, in Treppenhäusern, auf Höfen vergewaltigt hatten – eine Zeit lang war das überall passiert. Sie selbst war unbeschadet davongekommen, doch die Bilder hatten sich ihr eingebrannt und wallten jetzt in der Nacht im Mondschein vor dem Wohnmobil wieder auf.
Sie wusste, was da drinnen gerade passierte, und konnte doch nicht eingreifen. Wahrscheinlich hatten die Männer Waffen und würden sich auch nicht scheuen, sie zu benutzen, und sie alle drei womöglich erschossen hier zurücklassen.
Also konzentrierte sie sich auf Oleksij und versuchte, ihre zitternden Hände zu verbergen.
»Reden die lange?«, fragte der Junge.
»Nee, nicht so lange, glaube ich«, sagte Ivanna und zog ihn ein Stück mit sich. In diesem Moment hörten sie einen dumpfen, gequälten Laut aus dem Wohnmobil.
»Was war das?«, fragte Oleksij. »War das Mama?«
Er riss seine Hand los und lief zum Wagen.
»Mama!«
Kurz darauf drang Alinas Stimme zu ihm heraus: »Mama ist hier, Oleksij! Alles ist gut, ich …«
Die Stimme verstummte abrupt.
Ivanna zog Oleksij an sich und hielt die Arme über seine Ohren. Sie weinte hemmungslos und wusste nicht, was sie tun sollte. Da sah sie plötzlich Scheinwerfer im Wald. Erst wischten die Lichter nur zwischen den Bäumen hin und her, dann kamen sie direkt auf sie zu. Sie kniff die Augen zusammen und versuchte zu erkennen, was sich da näherte. Ein großer schwarzer Mercedes, auf dessen glänzendem Lack das Mondlicht reflektierte, fuhr die Straße entlang.
Ivanna ließ Oleksij los und fing an, verzweifelt mit den Armen zu winken, sie wollte das Auto um jeden Preis anhalten, und tatsächlich: Der Wagen bremste ein Stück vor ihr. Noch ehe sie hingelaufen war, ging die Tür auf, und eine schmale Frau mit schwarzem, von grauen Strähnen durchzogenem Haar stieg aus. Sie trug ein elegantes hellgraues Kleid und warf eine Zigarette auf die Erde, die sie mit einem Lederstiefel austrat. Ihre ganze Erscheinung verschlug Ivanna die Sprache, das hatte sie nicht erwartet.
»Hallo, ich heiße Sasja. Wie heißt du?«, sagte die Frau.
»Ivanna. Sie müssen uns helfen! Die da drinnen sind mit seiner Mutter im Auto und …« Ivanna wusste nicht recht, was sie sagen sollte, da Oleksij ja neben ihr stand, also rief sie noch einmal: »Sie müssen uns helfen!«
Tränen liefen ihr über die Wangen und den Mund. Sasja machte eine Handbewegung, also wollte sie ihr das Gesicht abwischen, besann sich dann aber und schaute zum Wohnmobil. Die Scheiben waren von innen beschlagen.
»Ich kann dir helfen«, sagte sie. »Du kannst mit mir fahren.«
»Aber wohin denn?«
»Weg von hier. Oder willst du es auch so haben?« Sasja nickte zum Wohnmobil, aus dem weiterhin erstickte Laute drangen. »Bestimmt bist du gleich danach an der Reihe«, fuhr sie fort.
Ivanna schaute verwirrt zu Oleksij.
»Aber ich kann ihn doch nicht alleinlassen!«
»Er hat seine Mutter da drinnen. Du bist allein. Willst du mitkommen?«
Ivanna zögerte. Oleksij klammerte sich an ihr Bein. Sasja beugte sich hinab und machte den Jungen los, führte ihn zum Wohnmobil und klopfte an die Tür. Der Mann mit der Kappe öffnete. Sasja hob Oleksij hoch, und der Mann zog ihn hinein. Ivanna kapierte nicht, was hier passierte. Sie biss sich auf die Hand. Sasja ging zu ihrem Mercedes, öffnete die Beifahrertür und wandte sich zu ihr.
»Steig ins Auto, Ivanna, dann wirst du nicht vergewaltigt oder noch schlimmer. Das da drin sind brutale Männer.«
Ivanna strich sich mit der Hand über die Wange, ratlos, verloren und voller Angst. Sie machte ein paar zögerliche Schritte auf Sasja zu, wandte sich zum Wohnmobil, erhob dann die Hand zu einem zaghaften Winken und stieg in das schwarze Fahrzeug. Sasja ging einmal ums Auto und setzte sich hinters Steuer. Mit etwas Mühe gelang es ihr, den Wagen auf der schmalen Straße zu wenden, und sie fuhren in die Richtung, aus der sie gekommen war.
Hinter ihnen wurde Oleksij wieder auf die Treppe geschoben und die Tür geschlossen. Er sank zu Boden und sah erst den Scheinwerfern nach, die im Wald verschwanden. Dann presste er die Hände auf die Ohren.
Wenn man als Tourist in der Dämmerung am Kai von Port Vauban stand, dann konnte man das, was da draußen auf der Reede lag, für ein gruseliges Raumschiff halten: glänzend schwarz, mehrere Stockwerke hoch, und mit Hunderten von kleinen runden Lämpchen, die ihr Licht übers Wasser warfen.
War man ortsansässig, dann wusste man, was dort lag. Eine enorme Luxusjacht, die vor mehreren Monaten in Antibes angelegt hatte. Ihr Name war Night Eye – 156 Meter lang, mit 36 Kajüten und 87 Mann Besatzung, wenn sie in Betrieb war. Außerdem vier Pools und zwei Helikopterlandeplätze.
Und wenn man das als Tourist dann erklärt bekommen hatte, folgte immer ganz selbstverständlich die Frage: »Und wem gehört die Jacht?« Als Anwohner blieb man die Antwort in der Regel schuldig: »Irgendeinem Oligarchen wahrscheinlich, nicht ganz klar, wem.«
In Wirklichkeit gehörte das Schiff einem internationalen Konglomerat, und zwar zu dem einen Zweck, seinen wirklichen Besitzer vor einer möglichen Beschlagnahme zu schützen.
Der wirkliche Besitzer hieß Grigorij Wladowskij, geboren im Kalten Krieg in Leningrad und zu Zeiten des Zusammenbruchs der Sowjetunion sehr aktiv. Ein Mann mit einem ereignisreichen Leben. Eine Weile hatte er sich mit gut trainiertem Körper, sehr maskulinem Aussehen, unwiderstehlichem Blick und kräftigem, dunklem Bart als Model verdingt. Im Laufe der Jahre wurde ein eloquenter und beliebter Vertreter einer starken patriotischen Agenda in öffentlichen Diskussionen aus ihm.
Das öffnete ihm eine Reihe von Türen in der Politik bis in die engsten Kreise der Duma – Kontakte, die er gut pflegte, als der Streit um die natürlichen Rohstoffvorkommen im kaputt gewirtschafteten Sowjetreich begann. So legte er den Grundstein zu seinem sagenhaften Vermögen.
Inzwischen hielt er sich in gehörigem Abstand von Russland, denn er wusste, dass seine Position und sein Lebenswandel der Führungsschicht im Kreml ein Dorn im Auge waren. Er hatte einen großen Teil seiner Geschäfte abgewickelt und dafür gesorgt, dass sein Geld in lichtscheuen Steuerparadiesen gut verwaltet wurde. Das alles, um unter dem Radar zu bleiben.
Um sich selbst machte er sich keine großen Sorgen, denn er stand weder auf der einen noch der anderen Seite des Konflikts, der zwischen den Zirkeln um Putin und der im Ausland befindlichen wirtschaftlichen Elite entstand. Er hatte Kontakte in beide Lager, und zwar bis in hohe Kreise, von denen er wusste, dass sie gezwungen wären, ihm zu helfen, falls er jemals in eine prekäre Lage geriete. Doch war er stolzer Vater einer Tochter, Julie, und er wollte nicht, dass sie in irgendetwas hineingezogen würde. Sie besuchte im letzten Schuljahr ein exklusives Internat in Nizza und war sein Augenstern.
»Soll ich dir ein Geheimnis verraten, Julie?«
Grigorij legte den Arm um seine Tochter. Sie hatte schulfrei und wohnte derzeit auf Papas vielgeliebter Jacht. Sie war verwöhnt, das wusste sie selbst, aber so war es schon ihr ganzes Leben gewesen, und sie hatte keine Vergleichsmöglichkeiten. Nun standen beide zusammen in einem kleineren Raum im Inneren des Schiffes. Es war ein sehr besonderer Raum, der nur für eine einzige Sache entworfen worden war. Die Wände waren dunkelgrün, in den Paneelen saßen kleine Spots, von der Decke hing eine zierliche Lichtleiste, und der Fußboden war mit rechteckigen Eichenfliesen bedeckt.
»Na klar«, antwortete Julie und lachte.
Grigorij holte eine kleine schwarze Dose heraus und richtete sie auf den Boden. Eine der Eichenplatten schob sich unter die benachbarte, und langsam fuhr ein weißes, knapp einen Meter hohes Podest heraus, auf dem ein Kubus aus schusssicherem Glas thronte. Darin lag ein glänzend schwarzes Ei aus Nero Marquina, dem spanischen Marmor mit weißen Kalziumadern. Es war groß wie ein Straußenei und ringsherum mit funkelnden Edelsteinen besetzt.
Julie schlug die Hände vor den Mund.
»Was ist das denn?«, brachte sie hervor.
»Das Auge der Nacht.«
Julie machte einen Schritt auf den Kubus zu und betrachtete das Ei.
»Das ist fantastisch!«, rief sie. »So schön!«
»Nicht wahr?«
»Sind das Diamanten?«
»Genau, und Saphire. Wenn man in der richtigen Reihenfolge auf die Steine drückt, dann öffnet sich das Ei«, erklärte Grigorij. »Die obere Hälfte wird dann von einem kleinen, erfindungsreichen Mechanismus aufgeklappt.«
»Ist was drin?«
»Ja.«
»Was denn?«, fragte Julie.
»Das wirst du sehen, wenn ich es öffne.«
»Kannst du das jetzt machen?«
»Nein.«
Julie hörte an der Stimme, dass dies ein Nein war, das auch nein bedeutete. Sie hakte ihren Vater unter und stellte sich dicht vor den Glaskubus.
»Warum hast du mir das noch nie gezeigt?«
»Weil das Ei eine sehr besondere Geschichte hat, und ich wollte, dass du reif genug bist, um sie zu verstehen.«
»Papa, ich bin neunzehn.«
Grigorij betrachtete das erwartungsvolle Gesicht seiner Tochter und erkannte, dass sie recht hatte. Sie war kein Kind mehr.
*
Die Strecke von Gdańsk nach Nynäshamn wurde von mehreren Reedereien bedient, eine davon Polferries. Im Moment war ihr Schiff, die Cracovia, nach einer rauen Überfahrt auf dem Weg in den schwedischen Hafen: Achtzehn Stunden mit zum Teil harten Winden und starkem Seegang auf der Höhe von Gotland hatten die Mägen vieler Passagiere von innen nach außen gekehrt.
Die große Mehrheit von ihnen waren ukrainische Flüchtlinge, diesmal ungefähr fünfhundert, fast ausschließlich Frauen und Kinder und einige ältere Männer. Die jüngeren waren zurückgeblieben, um ihr Land zu verteidigen. Die Kapazitäten der Fähre waren ausgereizt, viele saßen auf dem harten Boden, andere einander auf dem Schoß. Das Personal verteilte, so gut es ging, Wasser, vor allen Dingen an die Familien mit Kindern. Der Vorrat an Decken war, noch ehe sie Gdańsk verlassen hatten, aufgebraucht gewesen.
Auch das Fahrzeugdeck war vom Bug bis nach achtern mit einer Mischung aus Privatautos und Lastwagen voll besetzt. In der dritten Reihe fast ganz hinten stand ein polnisches Wohnmobil, ein grauer Van. Im Wagen befanden sich vier Personen. Sie hatten sich während der gesamten Überfahrt versteckt gehalten, denn eigentlich war es nicht erlaubt, im Auto zu bleiben.
Als die Fähre sich nun Nynäshamn näherte, stieg der Mann mit der Kappe mit einer Pistole in der Hand zum Schlafalkoven hinauf und machte eine Geste über den Mund. Kein Laut. Sie würden ungehindert nach Schweden gelangen. Alina hielt Oleksij eine Hand übers Gesicht. Der Mann kletterte wieder hinunter und nahm ein Gespräch auf seinem Handy an.
»Wir sind gleich in Nynäshamn«, sagte er leise. »Jacek kümmert sich um diese Sendung, ihr kriegt die nächste. Da oben quillt es nur so über die Grenzen. Stanislaw und Henryk übernehmen die Lieferungen, ich bleibe eine Weile in Schweden.«
In der abgenutzten Ankunftshalle wartete Personal von der Einwanderungsbehörde, dem Sozialdienst und der Kommune sowie eine große Anzahl Freiwilliger, die alles Mögliche von Essen und Hygieneartikeln bis hin zu Kuscheltieren bereithielten.
Auch uniformierte Polizisten waren da.
Zwei von ihnen waren Olivia und Lisa. Sie hatten den dritten Tag in Folge seit sieben Uhr morgens gearbeitet. Olivia hatte Kopfschmerzen, sie hatte zu wenig gegessen und getrunken, außerdem waren ihre Schuhe aus irgendeinem Grund zu eng. Sie war es auch nicht gewohnt, Uniform zu tragen, und fühlte sich daher insgesamt unwohl. Doch es gab Menschen, denen es viel schlechter ging – genauer gesagt: fünfhundert Flüchtlinge.
Das polnische Wohnmobil rollte von der Fähre und wurde von Lasse Tingvall auf eine Nebenspur geleitet. Olivia trat an das Führerhaus. Sie machte eine Geste zum Seitenfenster. Jacek ließ die Scheibe runterfahren und streckte ein paar Papiere heraus.
»Wir wollen nach Södertälje«, sagte er in gebrochenem Englisch. »Wir sollen einen Transport mit Hilfsgütern abholen, der runter nach Przemysl soll.«
»Wo liegt das?«
»An der ukrainischen Grenze.«
Olivia schaute die Papiere zweimal durch, alles sah korrekt aus. Sie reichte sie Jacek zurück, warf einen Blick ins Auto und winkte sie weiter. Jacek ließ den Motor an und fuhr von der Nebenspur. Olivia sah dem Auto nach, bis es, ohne noch einmal zu halten, das Hafengelände verlassen hatte. Dann ging sie zu Lasse zurück.
In dem kleinen Rückfenster im oberen Teil des Wohnmobils war das Gesicht eines Jungen zu sehen, er schaute der uniformierten Frau nach, die jetzt in der Ferne verschwand.
*
Vater und Tochter saßen dicht nebeneinander auf einem dunkelroten Ledersofa auf dem Achterdeck. Die Sonne glitt eben hinter den Horizont, der Himmel wurde von ihren letzten Strahlen rosa und orange gefärbt. Die Temperatur war angenehm lau, eine frische Brise vom Meer kühlte ihre Gesichter. Draußen in der Bucht jagten die Windsurfer mit mäßigem Erfolg hinter derselben Brise her. Bald würde es für sie an der Zeit sein, Richtung Pier zu paddeln.
»Möchtest du etwas trinken?«, fragte Grigorij und setzte – nicht wegen des Lichts, sondern aus Eitelkeit – eine Sonnenbrille auf.
»Gerne.«
»Was denn?«
»Eistee, weißt du doch.«
Grigorij winkte dem Mann in Livree, der ein Stück entfernt stand, und leitete die Bestellung der Tochter weiter. Der Mann zog sich mit einer Verbeugung zurück. Grigorij lehnte sich zu Julie hinüber. Sie nahm seinen markanten Duft wahr, kein Rasierwasser, sondern etwas anderes. So hatte er schon immer gerochen, seit sie klein war, und der Duft verströmte Geborgenheit.
»Du, Papa.«
»Ja?«
»Letzte Woche haben ein paar Leute in der Schule angefangen, über die ganzen Todesfälle zu reden, all die reichen Russen, die im Ausland leben und jetzt auf seltsame Weise gestorben sind. Sie meinen, dass Putin dahintersteckt … Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt hören sollte, aber ich musste echt viel drüber nachdenken. Das war nicht gerade angenehm.«
Grigorij war klar gewesen, dass die Frage früher oder später kommen musste. Auch wenn er es gerne wollte, so konnte er Julie doch nicht vor der Welt schützen.
»Das verstehe ich, aber es betrifft uns nicht.«
»Bist du mit Putin befreundet?«
»Früher war ich es einmal, jetzt aber nicht mehr. Seit dem Krieg in der Ukraine.«
»Du findest also auch, dass der schrecklich ist?«
»Ja. Und völlig unnötig. Dieser Krieg ist ein unbegreiflicher Fehler von Putin.«
Julie nahm den Eistee entgegen, der ihr gereicht wurde.
»Weiß er, dass du so denkst?«, fragte sie.
»Das nehme ich an.«
»Aber dann könnte er doch versuchen, auch dich zu töten?«
Grigorij sah seine Tochter an. Trotz der unerklärlichen Dinge, die mehreren seiner Freunde zugestoßen waren, war er überzeugt, selbst sicher zu sein, und das aus mehreren Gründen.
»Du musst dir keine Sorgen machen, es wird nichts passieren«, sagte er.
»Wie willst du das wissen?«
»Ich weiß es einfach.«
»Aber wie kannst du da so sicher sein? Hast du irgendjemanden in der Hand?«
Julie merkte sofort, dass sie mit dieser Frage eine Grenze überschritten hatte. Ihr Vater sprach niemals mit ihr über seine Unternehmungen. Sie wusste kaum, womit er sein Vermögen verdient hatte, das wurde nur »Geschäfte« genannt. Doch sie kannte sein hitziges Temperament und hatte im Laufe der Jahre schon genügend Gespräche mitgehört, um zu wissen, dass er recht hart sein konnte.
Als er nun ihre Frage ignorierte, mit den Fingern nach dem Mann in Livree schnippte und ihn um ein Glas eiskalten Chablis bat, wurde ihr klar, dass dies nicht der richtige Moment war, um hartnäckig zu sein. Vielleicht hatte sie gerade ins Schwarze getroffen, vielleicht aber auch nicht – das konnte sie nicht erkennen. Klar war jedenfalls, dass die Diskussion von seiner Seite beendet war, so gut kannte sie ihren Vater.
Jetzt würde er das Gesprächsthema wählen.
Julie nahm einen Schluck von ihrem Eistee, schob sich ein blaues Kissen in den Rücken, zog die Beine aufs Sofa und wartete. Sie beobachtete das Gesicht ihres Vaters, als er ein beschlagenes Glas entgegennahm, von seinem Wein trank und über den Horizont schaute. Er sah entspannt aus, und das ließ sie auch ruhig werden. Zumindest war er nicht böse. Nach einer Weile wandte er sich an sie.
»Weißt du etwas über Fabergé-Eier?«, fragte er.
Julie zuckte mit den Schultern.
»Nicht viel mehr, als dass sie unglaublich wertvoll sind. Und dass sie für die Zarenfamilie gemacht wurden«, antwortete sie, und mit einem Mal dämmerte es ihr. »Meine Güte, ist das Auge der Nacht etwa ein Fabergé-Ei?«
Grigorij lächelte und nickte seiner Tochter zufrieden zu. »Ja.«
»Ist das wirklich wahr?«
»Ja. Es ist seit vielen Generationen in unserer Familie.«
»Sind wir denn mit dem Zaren verwandt?«
»Nein«, lachte Grigorij, »aber du hast recht, anfangs wurden die Eier für die Zarenfamilie hergestellt, genauer gesagt war es Zar Alexander, der 1885 das erste Ei bestellte. Er suchte ein Ostergeschenk für seine Frau Maria Fjodorowna und wandte sich dazu an den Juwelier Peter Carl Fabergé, der ein Ei schuf, in dem sich ein goldener Dotter befand, darin wiederum ein vergoldetes Huhn und in dem Huhn eine kleine Krone mit drei angehängten Rubineiern.«
»Das ist ja krass!«
»Das fand Maria auch, und sie war so entzückt von dem Ei, dass Alexander ihr, bis er starb, zu jedem Osterfest ein Ei schenkte, und danach setzte ihr Sohn, Zar Nikolai, diese Tradition fort. Bis zur Revolution 1917 schenkte er sowohl seiner Mutter als auch seiner Frau jedes Jahr ein Ei. Insgesamt wurden für die Zarenfamilie 50 Eier hergestellt. Heute existieren noch 43 davon, wo die anderen sieben hin verschwunden sind, ist ein großes Rätsel.«
Grigorij nahm einen weiteren Schluck von seinem Wein, um die Worte bei Julie einsinken zu lassen.
Es dauerte eine Weile, dann sagte sie: »Willst du damit sagen, das Auge der Nacht ist eines von diesen sieben?«
»Ja.«
»Und niemand weiß, dass wir es besitzen?«
»Nein«, sagte Grigorij.
»Meine Güte, wie aufregend! Aber wie ist es denn bei uns gelandet?«
»Das ist eine lange Geschichte. Die Mutter meiner Großmutter mütterlicherseits, Alexandra Wasilewskaja, arbeitete am russischen Hof und stand der alten Zarin vor allem nach dem Tod des Zaren sehr nahe.«
»Als ihr Sohn Nikolai neuer Zar wurde?«
»Genau. Und als die Revolution ausbrach, lebte die alte Zarin in Kiew, sie hatte St. Petersburg verlassen, weil sie mit ihrem Sohn, vor allem aber mit ihrer Schwiegertochter, zunehmend uneins darüber war, wie das Land gelenkt werden sollte.«
»Und deine Urgroßmutter ist mit ihr gegangen?«
»Ja, sie gehörte zum Dienstpersonal.«
»Und was ist dann mit der Familie passiert?«
»Während der Revolution ist die alte Zarin von Kiew auf die Krim gebracht worden, wo sie unter dem Schutz der Weißen Armee stand.«
»Und das galt auch für Alexandras Familie?«
»Ja, aber dann eroberte die Rote Armee auch die Krim, und die alte Zarin wurde von ihren Vertrauten überredet zu fliehen, doch vorher gab sie Alexandra einen Auftrag.«
Grigorij griff wieder nach seinem Glas.
»Die alte Zarin weigerte sich nämlich zu glauben, dass ihr Sohn Nikolai ermordet worden sei«, fuhr er fort. »Deshalb gab sie Alexandra eines ihrer Fabergé-Eier mit dem Auftrag, damit für Nikolai und seine Familie die Flucht zu finanzieren. Während also die Kaiserinwitwe Maria Fjodorowna das Land mit zwei ihrer Töchter, ihrem Dienstpersonal und einer Reihe anderer zarentreuer Menschen verließ, wurde meine Urgroßmutter mit ihrer Familie nach St. Petersburg gebracht.«
»Aber der Zar, Nikolai, der war doch wirklich tot, oder?«
»Ja. Die ganze Familie war ermordet worden, seine Mutter wollte es nur nicht wahrhaben.«
»Das Ei blieb also in Alexandras Familie, und niemand wusste davon?«
»Niemand außer der Zarin selbst. Die gelangte schließlich in ihr ursprüngliches Heimatland Dänemark, und bei uns wurde das Ei ein gut gehütetes Familiengeheimnis. Niemand außerhalb der Verwandtschaft wusste davon, und so blieb es über Generationen.«
»Aber wie ist es denn Alexandra und ihrer Familie nach der Revolution ergangen? Sind sie in der Sowjetunion geblieben?«
»Ja, sie wurden niemals als Zarentreue entlarvt. Die Verwandtschaft hat es immer geschafft, sich in der Nähe des Machtzentrums aufzuhalten, und meine Großmutter war ebenso wie meine Mutter Alexandra davon überzeugt, dass das Ei die Familie beschützen würde. Das Auge der Nacht wurde zu einer heiligen Reliquie aus vergangener Zeit. Es heißt, das Auge könne alles durchschauen und seinem Besitzer helfen.«
»Stimmt das?«
»Ja.«
»Aber du glaubst ja wohl nicht daran, dass das Ei irgendeine mystische Kraft hat, oder?«
Grigorij warf seiner Tochter einen unergründlichen Blick zu und nahm einen Schluck aus dem Glas.
»Du glaubst das wirklich?«, hakte Julie ungläubig nach.
»Ich kann einfach nur feststellen, dass es unserer Familie weiterhin gut geht, nicht wahr?« Er machte eine vielsagende Geste über das lang gezogene Deck der Jacht.
Julie sah ihn erstaunt an, ihre Stimme verriet Skepsis. »Es ist ein Osterei, Papa. Ein kostbares Kunstwerk, aber ein Ei.« Sie konnte nicht umhin zu lachen, als sie das sagte. Für sie war der Gedanke lächerlich, und sie ging schlicht davon aus, dass ihr Vater derselben Ansicht sei. Alter Aberglaube schien ihr so gar nicht zu ihm zu passen, doch als sie seinem stahlblauen Blick begegnete, wurde ihr klar, dass er es zutiefst ernst meinte.
»Das ist schwer zu begreifen, das ist mir durchaus bewusst, Julie«, erwiderte Grigorij. »Aber eines Tages wirst du die Bedeutung dessen, was ich sage, verstehen, das weiß ich genau, denn du bist meine Tochter. Ich habe heute lieber nicht erzählt, wie es denjenigen in unserer Verwandtschaft ergangen ist, die das alles für Nonsens gehalten haben, aber sie wurden nicht alt, das kann ich dir versichern. Eines Tages wird das Auge der Nacht dir gehören, und ich möchte sicher sein können, dass du dann das Geheimnis bewahrst und die Geschichte unserer Familie weiterhin würdigst. Und sei es nur um deiner selbst willen. Du kannst dir nicht leisten, es darauf ankommen zu lassen. Sind wir uns da einig?«
Julie hatte schnell erkannt, dass es hier keine Widerrede mehr gab. Da sie wusste, dass Anpassungsfähigkeit belohnt wurde, antwortete sie: »Ja, Papa.«
»Gut.«
Grigorij nahm den letzten Schluck aus seinem Weinglas, schnippte mit den Fingern und machte deutlich, dass er nachgeschenkt haben wollte. Ein entferntes Geräusch ließ ihn zum Land schauen. Ein Helikopter war auf dem Weg von Cap d’Antibes zu seiner Jacht. Grigorij stand auf und zog eine goldfarbene Kreditkarte aus der Tasche.
»Jetzt geh du mal und mach dir einen netten Abend am Hafen. Du kannst mit dem Wasserscooter fahren, nimm den grünen.«
Julie stand vom Sofa auf und nahm die Karte entgegen.
»Danke.«
»Aber komm nicht so spät zurück … und keine Dummheiten.«
»Was denn für Dummheiten?«
»Du weißt schon, was ich meine, schließlich bist du neunzehn.« Grigorij lächelte.
Julie umarmte ihn kurz und wandte sich dann um, während sie gleichzeitig die Karte in die Tasche ihrer engen dunkelblauen Jeans schob. Grigorij schob seine Sonnenbrille hoch und beobachtete ihre Bewegungen und ihren jungen schlanken Körper, als sie übers Deck schlenderte. So hat ihre Mutter früher auch einmal ausgesehen, dachte er und winkte einen schwarz gekleideten Mann zu sich.
»Behalt sie im Blick«, sagte er. »Diskret.«
Der schwarz Gekleidete ging, und Grigorij hob den Blick zum Helikopter. Der stand ein paar Augenblicke über dem Schiff, dann senkte er sich auf die Plattform am Heck.
»Hier! Nimm meine Hand!«
Sasja stand unterhalb der kreisenden Rotorblätter und streckte die Hand zu Ivanna aus. Vorsichtig half sie dem Mädchen herunter. Gemeinsam liefen sie geduckt vom Helikopter zu einer Leiter. Auf dem Weg dorthin mussten sie einen gläsernen Fußboden passieren, der einen großen Teil des Zwischendecks ausmachte. Ivanna fuhr zurück, sie wagte nicht auf das Glas zu treten.
»Findest du das unangenehm?«, fragte Sasja.
»Ja.«
»Das fand ich anfangs auch, aber es ist ungefährlich, das Glas ist stärker als Holz. Komm.«
Sasja überredete Ivanna, auf das Glas zu treten, erst ganz vorsichtig. Es fühlte sich an, als würde man auf dünnem Eis gehen, und nach ein paar Schritten blieb sie stehen und starrte nach unten: »Was ist das denn, da unten?«
»Ein Aquarium.«
Ivanna sah Schwärme von rotbraunen Fischen sich in der Tiefe bewegen.
»Und was für Fische sind das?«
»Piranhas.«
Sasja brachte Ivanna in einen protzigen Salon. Überall Teak mit dunklen Mahagoniintarsien und glänzenden Messingbeschlägen. Auf der einen Seite des Rumpfes war eine lange Reihe Bullaugen angebracht, auf der anderen Seite hingen gerahmte Ikonen mit kleinen Lämpchen an den Seiten.
»Da drin ist das Badezimmer«, sagte Sasja und deutete auf die Tür. »Aber lass uns erst ein bisschen reden. Setz dich.«
Ivanna ließ sich auf einer an der Wand befestigten Bank nieder, Sasja sank in einen weißen Ledersessel ihr gegenüber und faltete die Hände vor sich.
»Das hier ist eine Luxusjacht«, begann sie. »Eines der größten Privatschiffe der Welt. Da gibt es viel Arbeit, man braucht viel Personal. Wenn du willst, kannst du hier an Bord arbeiten.«
Ivanna schwieg. Nach den Ereignissen in Polen war sie immer noch aus dem Gleichgewicht. Sasja hatte ihr im Auto ein paar Tabletten gegeben, damit sie sich beruhigte, fast den ganzen Weg hierher hatte sie geschlafen, war immer wieder aufgewacht und weggedämmert. Sie schaute sich im Salon um.
Ohne Sasja anzusehen, fragte sie leise: »Kannten Sie die Männer im Wohnmobil?«
Sasja zuckte ein wenig mit den Händen.
»Warum fragst du das?«
»Die haben gar nicht groß reagiert, als Sie geklopft und Oleksij dort gelassen haben.«
»War das der Junge?«
»Ja.«
»Nein, ich kannte die Leute nicht«, sagte Sasja. »Aber du hast mir nicht geantwortet.«
»Worauf?«
»Ob du an Bord arbeiten willst.«
»Ich weiß nichts über solche Boote.«
»Es ist kein Boot, sondern ein Schiff. Du wirst alles schnell lernen.«
Ivanna senkte den Kopf und nickte.
»Geh jetzt mal duschen«, fuhr Sasja fort, »nachher zeige ich dir alles.«
Ivanna stand auf und zog ihre Jacke aus. Sasja hielt ihr einen eleganten weißen Bademantel hin.
»Zieh den an, wenn du fertig bist, und warte hier.«
Ivanna nahm den Bademantel und ging zur Dusche. Sasja sah zu, wie sie im Badezimmer verschwand.
*
Direkt oberhalb des Hafens von Antibes saßen ein Mann und eine Frau mit gut gebügelten hellblauen Hemden in einem Mietwagen.
Die Frau hatte ein sehr starkes Fernglas aufs Meer und einen grünen Wasserscooter gerichtet.
»Die Tochter ist auf dem Weg in den Hafen«, sagte sie.
»Allein?«
»Nein, weiter draußen kommt noch ein Scooter.«
»Er hat Angst um sie.«
*
Grigorij hatte sich einen braunen Strickpullover übergezogen und noch ein Glas Wein bekommen. Das Gespräch mit der Tochter, bei dem es um Putins Jagd auf missliebige Oligarchen ging, hatte ihn verärgert. Er betrachtete sich nicht als Oligarchen. Gewiss, er war reich, und Teile seines Reichtums hatte er auf eine Art und Weise verdient, die man gemeinhin mit Oligarchen verband. Zumindest sah das die Gesellschaft so. Und Putin. Das war ihm durchaus bewusst. Er selbst betrachtete sich jedoch als Geschäftsmann, als Investor, der mehr und mehr von seiner Tätigkeit ins Ausland verlagert hatte, weg von Russland. Wahrscheinlich störte das den Potentaten im Kreml. Aber wie weit würde er gehen?
Grigorij nahm einen Schluck Wein und erwog, in den beleuchteten, grün gefliesten Pool zu steigen. Doch da kam Sasja mit einer Zigarette in der Hand über das Glasdeck. Das blaue Licht des Aquariums spiegelte sich in ihrem Gesicht wider und ließ sie blass und ungesund aussehen. Sie hat keinen Stil mehr, dachte Grigorij.
»Hallo«, sagte er. »Wie ich gesehen habe, hat es geklappt.«
»Ja. Aber das hier war das letzte Mal.«
»Was meinst du damit?«
»Dass du dir deine Mädchen in Zukunft von anderen liefern lassen musst.«
»Warum das denn? Hast du ein Problem mit meinen ›Mädchen‹?«
»Überhaupt nicht, aber ich bin es leid, dich zu bedienen. Wie du weißt, habe ich Wichtigeres zu tun.«
Sasja sank auf einen Liegestuhl neben dem Sofa, setzte eine Sonnenbrille auf und legte ihre Beine auf einen Hocker.
»Kannst du einen Negroni bestellen?«, sagte sie. »Viel Eis.«
Grigorij betrachtete sie ein paar Momente.
»Glaubst du, ich bin dein Diener?«, fragte er beherrscht.
Sasja ignorierte den Kommentar und winkte einem Besatzungsmitglied ein Stück entfernt.
»Was ist mit der Letzten passiert, die ich geholt habe?«, fragte sie. »Warum konntest du dich nicht mit ihr zufriedengeben?«
»Sie ist in den Hafen gefahren, um einzukaufen, und nie wiedergekommen.«
»Warst du gemein zu ihr?«
»Ich bin nie gemein zu Frauen, das solltest du wissen.«
Sasja schob die Sonnenbrille mit dem Zeigefinger hoch und sah Grigorij an.
*
Oleksij saß auf dem Bett im oberen Teil des Wohnmobils und schaute aus dem Fenster. Es war dunkel und regnete in Strömen, die schnurgerade Autobahn glänzte schwarz. Seine Mutter lag neben ihm und strich ihm mit der Hand über den Rücken.
»Alles wird gut, Oles, wir sind in Schweden, hier sind sie nett zu den Menschen.«
Oleksij nickte und sah die Tränen nicht, die Alinas Wangen hinunterliefen. Sie wischte sie mit einem Deckenzipfel weg. Oleksij durfte nicht merken, wie verzweifelt sie war. Sie musste stark sein. Irgendwie würden sie aus diesem Auto herauskommen und Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen können. Schweden. Sie musste einfach daran glauben. Dass alles gut werden würde. Dass sie nicht von einer Hölle in die andere geflohen waren.
Das durfte einfach nicht sein.
Sie war nicht religiös und glaubte an keinen Gott, das hatte sie nie gebraucht. Jetzt faltete sie die Hände unter der Decke und schloss die Augen. Und betete. Betete, dass es einen Gott geben möge, der ihren Sohn retten könnte. Der Finsternis in Licht verwandeln könnte. Wenn sie das hier überleben würden, so gelobte sie, würde sie in jeder Kirche, an der sie vorbeikam, eine Kerze anzünden.
Das Auto bremste und bog Richtung Fittja ab.
*
Sie ging mit ihrem Negroni in den kleinen Salon, um allein zu sein und nachdenken zu können. Das Verhältnis zu Grigorij war anstrengend und an der Grenze zu kaputt. Das spürten sie beide. Sollten sie getrennte Wege gehen? Sie trat an das Aquarium und betrachtete die Fische dort drinnen. Sie würde aus ihrer Beziehung nicht ohne Wohlstand herausgehen, das wusste sie. Er würde sie mit allem versorgen, was sie brauchte, nicht zuletzt wegen Julie. Doch es war ein großer Schritt, der schicksalhaft sein konnte, schließlich waren sie auf so vielen Ebenen miteinander verflochten. Und dann war da noch ein winziges Detail: In ihrem Herzen war Grigorij immer noch der Mann ihres Lebens.
Sie betrachtete die Piranhas, die hinter dem Glas hin und her schwammen. Zeitweilig war er verrückt, dunkel und mystisch, sein barbarischer Hintergrund brach manchmal in wenig angenehmer Weise durch. Nicht gewalttätig – er hatte nie die Hand gegen sie erhoben –, aber in Form von Schweigen, Härte und einer Kälte, mit der sie nicht umgehen konnte und die sie zu einer Spielfigur auf seinem Brett reduzierte.
Eigentlich wusste sie sehr wenig über seinen Hintergrund. Was sie wusste, hatte er ihr selbst erzählt, und sie hatte keine Ahnung, ob es stimmte. Sicher war hingegen, dass er Julie über alles auf der Welt liebte.
Sie schaute wieder ins Aquarium, ihr Blick wanderte zum Grund und zu den Gegenständen, die da lagen.
An einem davon hing eine dünne Fußkette aus Silber.
Sie kannte diese Kette.
Wie war die denn da hingekommen?
Sie starrte auf die Kette, und ihr wurde übel. Das Glas zitterte in ihrer Hand. Sie wich ein paar Schritte zurück, setzte sich in einen der roten Sessel und holte ihr Handy raus. Ehe sie anrief, kontrollierte sie kurz, dass die Tür hinter ihr geschlossen war.
Das Gespräch war kurz. Der Mann, mit dem sie telefonierte, bestätigte, was sie nicht hören wollte, und sie musste würgen.
Herbst 2022
Von ferne schon hörte man Lachen und Geschrei. Wenn man näher kam, sah man die bunten Lämpchen, die in den Apfelbäumen über einem langen, überbordend gedeckten Tisch hingen. Um den Tisch saßen achtzehn Personen höchst unterschiedlichen Alters, die meisten mit lustigen Papierhüten auf den Köpfen, nur die Teenager, die sich absolut weigerten, peinlich auszusehen, saßen ohne da. Es war ein warmer Abend Ende August, und bei Familie Olsäter in Kummelnäs vor Stockholm war Krebsfest. Alle Kinder und Enkelkinder waren dabei, und außerdem noch Olivia Rönning und Abbas el Fassi. Olivia war in ein Gespräch mit dem ältesten Sohn Jimi vertieft, und Abbas saß auf der anderen Seite des Tisches neben Jolene, Mettes und Mårtens jüngster Tochter, die inzwischen auch schon 29 Jahre alt war. Jolene war mit Downsyndrom geboren und das Kind aus der großen Schar, das Abbas am nächsten stand.
»Nein, Juuuuuniii. Pfui Teufel!«