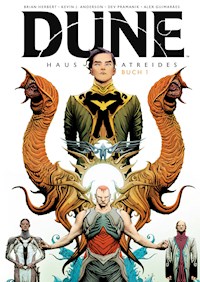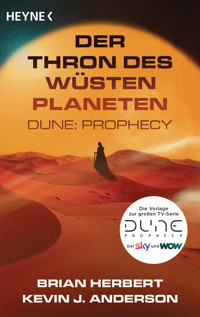
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Wüstenplanet - Great Schools of Dune
- Sprache: Deutsch
Vor dreiundachtzig Jahren wurden die Maschinen in der Schlacht von Corrin vernichtend geschlagen. Vor dreiundachtzig Jahren ernannte sich Faykan Butler zum Imperator des neuen, Planeten umspannenden Menschenreichs, und vor dreiundachtzig Jahren verschwand der Kriegsheld Vorian Atreides. Inzwischen sitzt Faykans Nachfahre Salvador Corrin auf dem Thron, doch von Frieden kann noch lange nicht die Rede sein: Vorians Feinde sind noch immer auf der Suche nach ihm, technologiefeindliche, fanatische Gruppen führen immer wieder Säuberungsaktionen durch und geheimnisvolle Mächte greifen nach der Vorherrschaft in der Galaxis. Eine davon ist der sagenumwobene Orden der Schwesternschaft der Bene Gesserit, die im Schutz des Dschungelplaneten Rossak eine Intrige schmieden, die das Schicksal der gesamten Menschheit für immer verändern könnte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 997
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
BRIAN HERBERT &
KEVIN J. ANDERSON
DER THRON DES
WÜSTENPLANETEN
Ein Roman aus dem Wüstenplanet-Zyklus
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Jahrtausende, bevor Paul Atreides auf Arrakis, dem Wüstenplaneten, zum Herrscher der Galaxis wurde, griffen andere nach der Macht. Faykan Butler führte einen Krieg gegen die Maschinen und ernannte sich selbst zum Imperator. Nun sitzt sein Nachfahre Salvador Corrin auf dem Thron, doch von Frieden kann keine Rede sein. Vorian Atreides, Pauls Vorfahre und Kriegsheld, ist verschwunden, und seine Feinde, allen voran Abulurd Harkonnen, suchen überall nach ihm. Butlers Anhänger führen immer noch gewaltsame Säuberungsaktionen durch, während auf dem Planeten Lampadas die ersten Mentaten, menschliche Rechenmaschinen, ausgebildet werden. In all dem Chaos erhebt sich nun eine geheimnisvolle Macht: die Schwesternschaft der Bene Gesserit. Im Schutz des Dschungelplaneten Rossak schmieden die Schwestern eine Intrige, die das Schicksal der gesamten Menschheit für immer verändern wird …
Die Autoren
Brian Herbert, der Sohn des 1986 verstorbenen Schöpfers von DUNE, Frank Herbert, hat selbst Science-Fiction-Romane verfasst, darunter den in Zusammenarbeit mit seinem Vater entstandenen Mann zweier Welten.Kevin J. Anderson ist einer der meistgelesenen Science-Fiction-Autoren unserer Zeit. Zuletzt ist von ihm die gefeierte Saga der Sieben Sonnen erschienen. Mit seinem Zyklus um Arrakis, den Wüstenplaneten, hat Frank Herbert eine Zukunftssaga geschaffen, die in ihrer epischen Wucht und ihrem außerordentlichen Detailreichtum nur mit J. R. R. Tolkiens Der Herr der Ringe zu vergleichen ist. Nach dem Tod des Autors 1986 schien diese Saga - zum Bedauern von Millionen von Leserinnen und Lesern rund um die Welt - zu einem Abschluss gekommen zu sein, bis Frank Herberts Sohn Brian, gestützt auf den umfangreichen Nachlass seines Vaters und gemeinsam mit Kevin J. Anderson, das atemberaubende Epos fortsetzte. In Der Thron des Wüstenplaneten erzählen sie die Geschichte der geheimnisvollen Schwesternschaft der Bene Gesserit - der Roman diente als Vorlage zur HBO-Serie DUNE: PROPHECY.
Eine chronologische Liste des Wüstenplanet-Zyklus finden Sie am Ende dieses Buches.
www.diezukunft.de
Dieses Buch ist den Heerscharen von Wüstenplanet-Fans in aller Welt gewidmet. Eure enorme Unterstützung hat die Entstehung dieses bemerkenswerten Universums ermöglicht.
Dank Frank Herberts begeisterter Leser ist Der Wüstenplanet der erste Roman, der die beiden höchsten Auszeichnungen der Science Fiction gewann, den Hugo und den Nebula Award. Später, als die Zahl der Fans zunahm, war Die Kinder des Wüstenplaneten der erste SF-Roman, der auf der New-York-Times-Bestsellerliste auftauchte. Als im Jahre 1984 David Lynchs Filmversion in die Kinos kam, schnellte Der Wüstenplanet auf Platz 1 der New-York-Times-Bestsellerliste.
Heute, fast fünfzig Jahre nach der Erstveröffentlichung des Wüstenplaneten, halten die Fans Frank Herberts glorreiches Vermächtnis am Leben und lesen weiterhin sowohl seine ursprünglichen Romane als auch unsere neuen Bände.
Es war eine Zeit der Genies, der Menschen, die bis an die Grenzen ihrer Vorstellungskraft gingen und sich fragten, welche Möglichkeiten ihrer Art offenstanden.
Aus der Geschichte der Großen Schulen
Man sollte meinen, dass die Menschheit nach der Niederlage der Denkmaschinen und der Bildung der Landsraad-Liga, die die alte Liga der Edlen ersetzte, Frieden finden würde, doch die Kämpfe hatten gerade erst begonnen. Nun, wo es keinen äußeren Feind mehr gab, begannen wir, uns gegenseitig zu bekämpfen.
Annalen des Imperiums
Dreiundachtzig Jahre sind vergangen, seit die letzten Denkmaschinen bei der Schlacht von Corrin zerstört wurden. Anschließend nahm Faykan Butler den Namen Corrino an und setzte sich selbst als ersten Imperator eines neuen Imperiums ein. Der große Kriegsheld Vorian Atreides wandte sich von der Politik ab und machte sich auf eine Reise ins Unbekannte, wobei er aufgrund der lebensverlängernden Behandlungen, die ihm sein berüchtigter Vater, der Cymek-General Agamemnon, hatte angedeihen lassen, nur unmerklich alterte. Vorians ehemaliger Adjutant Abulurd Harkonnen wurde der Feigheit in der Schlacht von Corrin für schuldig befunden und auf den düsteren Planeten Lankiveil verbannt, wo er zwanzig Jahre später starb. Seither geben seine Nachfahren Vorian Atreides die Schuld an ihrem Niedergang, obwohl man den Mann seit achtzig Jahren nicht mehr gesehen hat.
Auf dem Dschungelplaneten Rossak hat Raquella Berto-Anirul, die nach einem bösartigen und beinahe tödlichen Giftanschlag zur ersten Ehrwürdigen Mutter wurde, Methoden der beinahe ausgelöschten Zauberinnen übernommen, um ihre eigene Schwesternschaft zu gründen. Ihre Lehre zielt darauf ab, Frauen bei der Verbesserung ihrer geistigen und körperlichen Kräfte zu helfen.
Gilbertus Albans, einst der Zögling des unabhängigen Roboters Erasmus, hat auf dem ländlichen Planeten Lampadas ebenfalls eine Schule gegründet, in der er Menschen beibringt, ihren Verstand nach dem Vorbild eines Computers zu ordnen, und sie so zu Mentaten ausbildet.
Die Nachfahren von Aurelius Venport und Norma Cenva (die weiterhin am Leben ist, wenn auch in einer höchst weiterentwickelten Form) haben ein mächtiges Handelsimperium namens Venport-Holdings aufgebaut. Ihre Raumflotte setzt Holtzman-Triebwerke ein, um den Raum zu falten, und mutierte, gewürzgesättigte Navigatoren, um ihre Schiffe zu steuern.
Obwohl seit dem Sieg über die Denkmaschinen viel Zeit vergangen ist, tobt auf den von Menschen besiedelten Planeten nach wie vor der technologiefeindliche Eifer, und mächtige, fanatische Gruppen führen immer wieder gewaltsame Säuberungsaktionen durch …
1
Nachdem man uns tausend Jahre lang in Sklaverei hielt, haben wir die Streitkräfte des Computer-Allgeists Omnius schließlich überwunden. Doch unser Kampf ist noch längst nicht vorbei. Serena Butlers Djihad mag ein Ende gefunden haben, doch der Krieg geht weiter. Wir müssen nun gegen einen heimtückischeren und gefährlicheren Feind antreten: die menschliche Schwäche für Technologie und die Versuchung, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen.
Manford Torondo, Der einzige Weg
Manford Torondo hatte den Überblick über seine zahlreichen Missionen verloren. Einige wollte er vergessen, wie zum Beispiel jenen schrecklichen Tag, an dem ihn eine Explosion zerfetzt und ihn seinen Unterleib gekostet hatte. Doch diese neue Mission würde nicht nur einfacher sein, sondern darüber hinaus zutiefst befriedigend – es ging darum, weitere Überreste des größten Feinds der Menschheit auszuradieren.
Waffenstarrend und kalt hingen die Maschinenkriegsschiffe am Rande des Sonnensystems, wo das blasse Sternenlicht ihren Rümpfen nur einen schwachen Widerschein entlockte. Infolge der Vernichtung der überall verteilten Omnius-Allgeister hatte dieses Roboter-Kampfgeschwader niemals sein Ziel erreicht, und die Bevölkerung des nahen Sonnensystems der Liga hatte nicht einmal geahnt, dass sie ein Angriffsziel gewesen war. Jetzt hatten Manfords Kundschafter die Flotte aufgespürt.
Lange nach der Schlacht von Corrin hingen diese gefährlichen feindlichen Schiffe mit voll funktionsfähigen Waffensystemen reglos im All. Sie waren Relikte, Geisterschiffe – aber nichtsdestotrotz Abscheulichkeiten. Entsprechend war mit ihnen zu verfahren.
Als seine sechs kleinen Raumschiffe sich den mechanischen Monstren näherten, verspürte Manford ein urtümliches Erschaudern. Die treuen Anhänger seiner Butler-Bewegung waren darauf eingeschworen, alle Spuren verbotener Computertechnologie zu vernichten. Jetzt näherten sie sich ohne Zögern der herrenlosen Roboterflotte, wie Möwen, die über den Leichnam eines gestrandeten Wals herfielen.
Knisternd drang die Stimme von Schwertmeister Ellus, der sich auf einem Schiff in der Nähe befand, über die Sprechanlage. Bei dieser Operation flog der Schwertmeister an der Spitze und führte Butlers Jäger zu den heimtückischen Roboterschiffen, die jahrzehntelang unbemerkt durchs All getrieben waren. »Es handelt sich um ein Kampfgeschwader von fünfundzwanzig Schiffen, Manford – genau an der Stelle, die der Mentat uns genannt hat.«
Manford, der in einen eigens an seinen beinlosen Körper angepassten Sitz geschnallt war, nickte. Gilbertus Albans' geistige Kräfte beeindruckten ihn immer wieder. »Erneut beweist er mit seiner Mentatenschule, dass das menschliche Gehirn den Denkmaschinen überlegen ist.«
»Der Geist des Menschen ist heilig«, sagte Ellus.
»Der Geist des Menschen ist heilig.« Es war eine Segnung, die Manford in einer gottgesandten Vision offenbart worden war, und inzwischen war sie zu einem beliebten Wahlspruch in Butlers Gefolge geworden. Manford unterbrach die Verbindung und verfolgte die anlaufende Operation weiter von seinem eigenen kleinen Schiff aus.
Schwertmeisterin Anari Idaho, die neben ihm im Cockpit saß, begutachtete die Positionen der Roboterschlachtschiffe auf dem Schirm und tat ihre Einschätzung der Lage kund. Sie trug eine schwarz-graue Uniform mit dem Symbol der Bewegung am Revers, einem stilisierten Siegel, auf dem eine blutrote Faust zu sehen war, die ein Maschinenzahnrad zerdrückte.
»Wir haben genug Feuerkraft, um sie aus der Entfernung zu zerstören«, erklärte sie, »wenn wir unsere Sprengköpfe klug einsetzen. Es gibt keinen Grund, ein Risiko einzugehen, indem wir die Schiffe entern. Zweifellos werden sie von Kampf-Meks und vernetzten Drohnen bewacht.«
Manford blickte zu seiner Gehilfin und Freundin auf und wahrte dabei eine steinerne Miene, obwohl ihm beim Klang ihrer Stimme immer warm ums Herz wurde. »Es besteht kein Risiko – der Allgeist ist tot. Und ich will diese Maschinendämonen sehen, bevor wir sie unschädlich machen.«
Da sie sich Manfords Sache und ihm persönlich verschrieben hatte, akzeptierte Anari seine Entscheidung. »Wie Sie wünschen. Ich werde für Ihre Sicherheit Sorge tragen.« Als Manford den Ausdruck auf ihrem breiten, unschuldigen Gesicht sah, begriff er, dass er in ihren Augen praktisch unfehlbar war – und weil Anari ihm so ergeben war, verteidigte sie ihn mit wilder Kraft.
Manford gab knappe Befehle. »Teile meine Gefolgsleute in mehrere Einsatzgruppen auf. Wir haben keinen Grund zur Eile – ich ziehe eine fehlerfreie Ausführung einer schnellen vor. Schwertmeister Ellus soll die Vernichtungssprengsätze auf den Maschinenschiffen koordinieren. Nicht ein Fetzen darf von ihnen übrig bleiben, wenn wir hier fertig sind.«
Aufgrund seiner körperlichen Behinderung war die Beobachtung von derlei Zerstörungswerk eine seiner wenigen Freuden. Denkmaschinen hatten Moroko zerstört, den Heimatplaneten seiner Vorfahren. Sie hatten seine menschlichen Bewohner gefangen genommen und ihre Seuchen auf sie losgelassen. Keiner hatte überlebt. Wären seine Ururgroßeltern nicht gerade in geschäftlichen Angelegenheiten auf Salusa Secundus gewesen, wären auch sie in Gefangenschaft geraten und getötet worden. Und Manford wäre niemals zur Welt gekommen.
Obwohl sich all das vor Generationen ereignet hatte, hasste er die Maschinen bis heute und hatte sich geschworen, den Kampf gegen sie fortzusetzen.
Unter den Butler-Gefolgsleuten waren fünf ausgebildete Schwertmeister, die Paladine der Menschheit, die während Serena Butlers Djihad im Nahkampf gegen die Denkmaschinen angetreten waren. In den Jahrzehnten seit dem großen Sieg auf Corrin hatten zahlreiche Schwertmeister die letzten über zahlreiche Sonnensysteme verteilten Reste des Roboterimperiums aufgespürt und ausgemerzt. Dank ihrer Erfolge waren inzwischen nur noch wenige solcher Relikte zu finden.
Während die Schiffe der Butler-Bewegung sich der Maschinenflotte näherten, studierte Anari die Bilder auf ihrem Monitor. In einem leisen Tonfall, den sie nur Manford gegenüber verwendete, sinnierte sie: »Wie viele solche Flotten werden wir wohl noch aufspüren?«
Die Antwort war unmissverständlich. »Ich will sie alle.«
Die toten Roboter-Kriegsflotten waren leichte Ziele und die Siege über sie, die aufgezeichnet und ausgestrahlt wurden, rein symbolischer Natur. Doch in letzter Zeit machte sich Manford über die Fäulnis, Korruption und Versuchung Sorgen, die im neuen Corrino-Imperium zu beobachten waren. Wie konnten die Menschen die drohenden Gefahren nur so schnell vergessen? Schon bald würde er den Eifer seiner Gefolgsleute vielleicht in eine andere Richtung lenken und sie mit einer weiteren unvermeidlichen Säuberung unter den menschlichen Bevölkerungen beauftragen müssen …
Schwertmeister Ellus organisierte den Angriff, indem er ein Raster über die Roboterschiffe legte und den Gruppen ihre Ziele zuwies. Die fünf anderen Schiffe verharrten zwischen den herrenlosen Maschinen und hefteten sich jeweils an einen Rumpf. Dann sprengten die jeweiligen Gruppen Löcher in die Außenhüllen und gingen an Bord.
Die Angehörigen von Manfords Gruppe legten ihre Raumanzüge an und machten sich bereit, das größte der Roboterschiffe zu entern. Trotz der dadurch verursachten Umstände bestand er darauf, sie zu begleiten, um das Böse mit eigenen Augen zu sehen. Er würde sich niemals damit zufriedengeben, aus sicherer Entfernung zuzuschauen; er war es gewohnt, anstelle seiner Beine Anari zu haben und sein Schwert in der Hand zu halten. Sein stabiles Ledergeschirr war immer zur Hand, falls Manford sich ins Gefecht stürzen musste. Anari zog sich das Geschirr über die Schultern und rückte den Sitz auf dem Rücken zurecht. Dann befestigte sie die Gurte unter den Armen, über der Brust und an der Hüfte.
Anari war eine hochgewachsene und körperlich fitte Frau, und abgesehen davon, dass sie Manford gegenüber absolut loyal war, liebte sie ihn auch – das sah er ihr jedes Mal an, wenn er ihr in die Augen schaute. Aber all seine Gefolgsleute liebten ihn. Anaris Zuneigung war einfach nur unschuldiger und reiner als die der meisten anderen.
Es fiel ihr nicht schwer, seinen beinlosen Körper hochzuhieven und ihn in den Sitz hinter ihrem Kopf zu platzieren, wie sie es schon unzählige Male zuvor getan hatte. Er kam sich nicht wie ein Kind vor, wenn er auf ihren Schultern ritt; vielmehr fühlte er sich, als sei Anari ein Teil von ihm. Seine Beine waren von der Bombe eines geistesgestörten Technikfreunds abgerissen worden, die auch Rayna Butler getötet hatte, eine wahre Heilige, die die Bewegung gegen die Maschinen angeführt hatte. In den Sekunden, bevor sie ihren Verletzungen erlegen war, hatte sie Manford höchstpersönlich gesegnet.
Die Suk-Ärzte bezeichneten es als Wunder, dass er überlebt hatte, und genau das war es auch: ein Wunder. Es war ihm bestimmt gewesen, nach diesem grauenvollen Tag weiterzuleben. Trotz seines körperlichen Verlusts hatte Manford sich an die Spitze der Butler-Bewegung gesetzt und sie mit Feuereifer angeführt. Ein halber Mann und ein doppelt guter Anführer. Einige wenige Teile seiner Leistengegend waren ihm geblieben, doch unterhalb der Hüften war kaum noch etwas übrig. Trotzdem hatte er nach wie vor seinen Verstand und sein Herz, und sonst brauchte er nichts. Nichts außer seinen Gefolgsleuten.
Sein gekappter Leib passte genau in das Geschirr auf Anaris Rücken, sodass er weit oben auf ihren Schultern saß. Mit unmerklichen Gewichtsverlagerungen steuerte er sie, als wäre sie ein Teil seines Körpers unterhalb der Hüfte. »Bring mich zum Außenschott, damit wir als Erste an Bord gehen können.«
Dennoch war er ihren Bewegungen und Entscheidungen ausgeliefert. »Nein. Ich schicke die anderen drei vor.« Anari wollte mit ihrer Weigerung nicht seine Autorität infrage stellen. »Erst, wenn sie sich vergewissert haben, dass keine Gefahr besteht, bringe ich Sie an Bord. Meine Mission, Sie zu beschützen, ist wichtiger als Ihre Ungeduld. Wir gehen, sobald man mir mitteilt, dass keine Gefahr besteht, nicht einen Moment eher.«
Manford knirschte mit den Zähnen. Er wusste, dass sie es gut meinte, aber manchmal störte ihn ihre übertriebene Angst um seine Sicherheit. »Ich erwarte von niemandem, dass er an meiner Stelle ein Risiko auf sich nimmt.«
Anari warf ihm über die Schulter ein zärtliches Lächeln zu. »Natürlich nehmen wir an Ihrer Stelle Risiken auf uns. Wir alle würden unser Leben für Sie geben.«
Während Manfords Gruppe das tote Roboterschiff enterte, die metallenen Gänge absuchte und nach geeigneten Stellen Ausschau hielt, um die Sprengladungen anzubringen, blieb er auf seinem eigenen Schiff zurück und zappelte ungeduldig in seinem Geschirr. »Was haben sie herausgefunden?«
Anari ließ sich nicht erweichen. »Man wird schon Bescheid geben, wenn sie etwas Berichtenswertes entdecken.«
Schließlich meldete sich die Gruppe. »Hier an Bord sind Dutzende von Kampf-Meks, Herr – alle kalt und abgeschaltet. Die Temperaturen sind eisig, aber wir haben das Lebenserhaltungssystem wieder hochgefahren, sodass Sie ohne Unannehmlichkeiten an Bord kommen können.«
»Annehmlichkeiten interessieren mich nicht.«
»Aber Sie müssen atmen. Sie werden uns Bescheid geben, wenn sie so weit sind.«
Obwohl Roboter keine Lebenserhaltungssysteme benötigten, waren viele der Maschinenschiffe damit ausgerüstet, um menschliche Gefangene in den Laderäumen transportieren zu können. In den letzten Jahren des Djihads hatte Omnius alle funktionierenden Schiffe der Kriegsflotte zugeteilt, während er gleichzeitig riesige automatisierte Werften errichtet hatte, die Tausende von neuen Kampfkreuzern ausspien.
Und trotzdem hatten die Menschen gewonnen und alles für den einen Sieg geopfert, auf den es ankam …
Eine halbe Stunde später erreichte die Atmosphäre im Maschinenschiff ein Niveau, bei dem Manford ohne Raumanzug überleben konnte. »Sie können jetzt an Bord kommen, Herr. Wir haben mehrere geeignete Stellen gefunden, um Sprengladungen anzubringen. Und menschliche Skelette, Herr. Ein Laderaum mit mindestens fünfzig Gefangenen.«
Manford richtete sich auf. »Gefangene?«
»Schon lange tot, Herr.«
»Wir kommen.« Zufrieden mit dem, was sie gehört hatte, stieg Anari die Leiter zu dem Verbindungsschott hinab. Manford auf ihrem Rücken fühlte sich wie ein Eroberer. An Bord des großen Raumschiffs war die Luft immer noch dünn wie eine Messerklinge und eiskalt. Manford erschauderte und griff haltsuchend nach Anaris Schultern.
Sie bedachte ihn mit einem besorgten Blick. »Sollen wir noch fünfzehn Minuten warten, bis die Luft wärmer ist?«
»Es ist nicht wegen der Kälte, Anari – es ist wegen des Bösen, das in der Luft liegt. Wie kann ich all das Menschenblut vergessen, das diese Ungeheuer vergossen haben?«
An Bord des düsteren, spartanischen Schiffs brachte Anari ihn zu dem Raum, in dem die Butler-Anhänger eine versiegelte Tür aufgebrochen hatten und ein Gewirr von Skeletten zum Vorschein gekommen war, Dutzende von Menschen, die man hatte verhungern oder ersticken lassen, wahrscheinlich, weil sie den Denkmaschinen schlicht egal gewesen waren.
Die Schwertmeisterin trug eine zutiefst verstörte und betroffene Miene zur Schau. Sie mochte eine noch so abgehärtete Kämpferin sein, aber die achtlose Grausamkeit der Denkmaschinen erstaunte Anari Idaho dennoch immer wieder. Manford bewunderte und liebte sie für ihre Unschuld. »Anscheinend haben sie Gefangene transportiert«, bemerkte Anari.
»Oder Versuchsobjekte für den bösen Roboter Erasmus«, sagte Manford. »Als die Schiffe dann den neuen Befehl erhielten, dieses System anzugreifen, haben sie sich nicht mehr um die Menschen an Bord gekümmert.« Er murmelte ein leises Gebet, um die Seelen der Toten zum Himmel zu geleiten.
Als Anari sich mit ihm von der Kammer mit dem menschlichen Frachtgut abwandte, kamen sie an einem kantigen, abgeschalteten Kampf-Mek vorbei, der wie eine Statue im Gang stand. Seine Arme waren mit scharfen Klingen und Projektilwaffen bestückt; sein klobiger Kopf und seine optischen Fasern wirkten wie die Parodie eines menschlichen Gesichts. Manford musterte die Maschine angewidert und unterdrückte ein erneutes Schaudern. Etwas Derartiges darf nie wieder geschehen.
Anari zog ihr langes, stumpfes Pulsschwert. »Obwohl wir dieses Schiff ohnehin in die Luft jagen werden … dürfte ich trotzdem?«
Er lächelte. »Aber gerne doch.«
Wie eine Sprungfeder griff die Schwertmeisterin den bewegungslosen Roboter an. Ihr erster Schlag zerstörte die optischen Fasern des Meks, weitere Hiebe trennten seine Gliedmaßen ab und drückten den Rumpf ein. Aus dem seit Jahrzehnten abgeschalteten Mek strömten nicht einmal Funken oder Schmiermittel, während sie ihn in seine Einzelteile zerlegte.
Anari blickte schwer atmend zu Boden und sagte: »Zu Hause in der Schwertmeisterschule auf Ginaz habe ich Hunderte von diesen Dingern getötet. Die Schule kauft nach wie vor alle funktionsfähigen Kampf-Meks, damit die Auszubildenden an ihnen üben können.«
Allein schon der Gedanke verdarb Manford die Laune. »Ginaz hat meiner Meinung nach zu viele funktionsfähige Meks – dabei ist mir unwohl zumute. Man sollte sich keine Denkmaschinen als Haustiere halten. Es gibt keinen vernünftigen Zweck für komplexe Maschinen.«
Anari war verletzt, weil er ihre schönen Erinnerungen kritisiert hatte. »So haben wir gelernt, sie zu bekämpfen, Herr«, sagte sie kleinlaut.
»Menschen sollten im Kampf gegen Menschen trainieren.«
»Das ist nicht das Gleiche.« Anari ließ ihren Ärger an dem ohnehin schon ramponierten Kampf-Mek aus. Sie versetzte ihm einen letzten Hieb und ging dann steif weiter in Richtung Brücke. Unterwegs stießen sie auf mehrere andere Meks, die sie allesamt mit demselben wilden Zorn, den Manford auch in seinem Herzen verspürte, in ihre Einzelteile zerlegte.
Auf der Roboter-Kommandobrücke trafen er und Anari sich mit den übrigen Angehörigen ihres Teams. Die Butler-Anhänger hatten zwei deaktivierte Roboter an den Kontrollen umgestoßen. »Alle Triebwerke sind funktionsfähig, Herr«, berichtete ein schlaksiger Mann. »Wir können Sprengsätze in den Treibstoffbehältern deponieren, nur zur Sicherheit, oder wir können von hier aus eine Überhitzung der Reaktoren einleiten.«
Manford nickte. »Die Explosion muss genügend groß sein, um alle Schiffe in der Umgebung zu eliminieren. Sie sind zwar nach wie vor funktionsfähig, aber ich möchte sie nicht einmal als Rohmetall verwenden. Sie sind … kontaminiert.«
Er wusste, dass andere keine derartigen Bedenken hatten. Korrumpierbare Menschen, die sich seiner Kontrolle entzogen, suchten die Raumflugrouten nach unbeschädigten Flotten wie dieser ab, um sie zu bergen und zu reparieren. Prinzipienlose Aasgeier! Die VenHold-Raumflotte war dafür berüchtigt; sie bestand zu mehr als der Hälfte aus umgerüsteten Denkmaschinenschiffen. Manford hatte sich mit Direktor Josef Venport mehrmals über diese Angelegenheit gestritten, aber dieser gierige Geschäftemacher wollte einfach nicht vernünftig sein. Immerhin konnte Manford sich damit trösten, dass diese fünfundzwanzig feindlichen Kriegsschiffe nie wieder zum Einsatz kommen würden.
Die Butler-Anhänger wussten, dass Technologie verführerisch und voller verborgener Gefahren war. Nach Omnius' Sturz war die Menschheit weich und faul geworden. Immer wieder machten die Leute Ausnahmen. Sie wünschten sich Bequemlichkeit und Komfort und gingen zu ihrem vermeintlichen Vorteil bis an die Grenzen des Erlaubten. Sie lavierten herum und erfanden Ausreden: Jene Sorte Maschinen war vielleicht schlecht, aber diese etwas andere Technologie war akzeptabel.
Manford weigerte sich, solche Unterscheidungen herbeizureden. Es war eine Gratwanderung. Wenn sie nicht aufpassten, würde aus dem abschüssigen Pfad vielleicht schon bald ein Abgrund werden. Die Menschheit durfte sich nie wieder von Maschinen versklaven lassen!
Er wandte sich den drei Butler-Anhängern auf der Brücke zu. »Geht. Meine Schwertmeisterin und ich haben hier noch etwas zu erledigen. Schickt eine Nachricht an Ellus – innerhalb der nächsten fünfzehn Minuten sollten wir von hier verschwinden.«
Anari wusste genau, was Manford im Sinn hatte: Sie hatte bereits Vorkehrungen dafür getroffen. Kaum waren die übrigen Gefolgsleute auf ihr Schiff zurückgekehrt, holte die Schwertmeisterin eine vergoldete kleine Statuette aus einer Tasche in ihrem Geschirr, eine von vielen, die Manford hatte anfertigen lassen. Er hielt sie ehrfürchtig in den Händen und betrachtete das gütige Gesicht Rayna Butlers. Seit siebzehn Jahren trat er nun schon in die Fußstapfen dieser Visionärin.
Manford küsste die Statuette und reichte sie dann wieder Anari, die sie auf die Roboter-Armaturen stellte. Er flüsterte: »Möge Rayna unser heutiges Werk segnen und uns Erfolg bei dieser wichtigen Mission bescheren. Der menschliche Geist ist heilig.«
»Der menschliche Geist ist heilig.« Anari, deren warmer Atem in der Kälte zu Dampf wurde, eilte im Laufschritt zu ihrem Schiff zurück. Anschließend versiegelte ihr Team das Außenschott und legte ab. Ihr Schiff trieb von dem verminten Kampfgeschwader fort.
Innerhalb einer Stunde versammelten sich die Schiffe der Butler-Bewegung über der dunklen Roboterflotte. »Noch eine Minute, Herr«, übermittelte ihm Schwertmeister Ellus. Manford nickte nur, ohne den Blick vom Bildschirm abzuwenden. Worte waren überflüssig.
Eins der Roboterschiffe erblühte in einer Explosion aus Feuer und Trümmerstücken. In schneller Folge explodierten auch die übrigen Schiffe, als sich die Triebwerke überluden oder sich der Treibstoff entzündete. Die Schockwellen überlagerten sich und zogen die Trümmer in einen Sud aus Metalldämpfen und sich ausdehnenden Gasen. Einen Moment lang war der Anblick so hell wie der einer neuen Sonne und erinnerte Manford an Raynas strahlendes Lächeln … dann verblasste das Bild.
Durch die Stille sprach Manford zu seinen ergebenen Gefolgsleuten. »Unsere Arbeit hier ist getan.«
2
Wir sind das Barometer der menschlichen Entwicklung.
Ehrwürdige Mutter Raquella Berto-Anirul,
Worte an den dritten Abschlussjahrgang
Zwangsläufig hatte die Ehrwürdige Mutter Raquella Berto-Anirul einen langfristigen Blick auf den Lauf der Geschichte. Aufgrund des reichen Schatzes an einzigartigen Erinnerungen ihrer Vorfahren, über die sie verfügte – und bei denen es sich gewissermaßen um personifizierte Geschichte handelte –, sah die alte Frau die Vergangenheit in einer Weise, die niemandem sonst zugänglich war … noch nicht.
Da Raquella in Gedanken auf so viele Generationen zugreifen konnte, fiel es ihr nicht schwer, die Zukunft der Menschheit zu erkennen. Und die anderen Schwestern an ihrer Schule erwarteten, dass ihre einzige Ehrwürdige Mutter sie führte. Sie musste ihre Wahrnehmung der Geschichte an andere weitergeben, um das Wissen und die Objektivität ihres Ordens auszubauen; die körperlichen und geistigen Fähigkeiten, die die Angehörigen der Schwesternschaft von gewöhnlichen Frauen abhoben.
Raquella spürte Nieselregen auf dem Gesicht, während sie mit den anderen Schwestern auf einem Balkon an einem Steilhang stand, in dessen Felshöhlen sich die Schule von Rossak befand, die offizielle Ausbildungsstätte der Schwesternschaft. Sie war in eine schwarze Robe mit hohem Kragen gekleidet und ließ den ernsten Blick über die Kante und den silbrig-purpurnen Urwald zu ihren Füßen schweifen. Obwohl die Luft am Tag dieser feierlichen Zeremonie warm und feucht war, herrschte zu dieser Jahreszeit praktisch nie ernsthaft unangenehmes Wetter, weil immer wieder frische Brisen an den Steilhängen entlangwehten. Die Luft roch leicht säuerlich und hatte einen schwefligen Beigeschmack, der von den entfernten Vulkanen und der Mischung umweltbedingter chemischer Substanzen herrührte.
Heute stand ihnen ein weiteres Begräbnis einer verstorbenen Schwester bevor, ein weiterer tragischer Gifttod … und ein weiterer Fehlschlag bei dem Versuch, eine zweite Ehrwürdige Mutter zu erschaffen.
Vor über achtzig Jahren hatte Ticia Cenva, die sterbende, verbitterte Zauberin, Raquella eine tödliche Dosis des wirkungsvollsten verfügbaren Gifts verabreicht. Eigentlich hätte Raquella daran sterben müssen, doch tief in ihrem Geist, in ihren Zellen, hatte sie ihre Biochemie angepasst und die Molekularstruktur des Gifts umgebaut. Wie durch ein Wunder hatte sie überlebt, aber die schwere Prüfung hatte sie von Grund auf verändert und eine kriseninduzierte Verwandlung angestoßen, die ihren sterblichen Leib an seine äußersten Grenzen geführt hatte. Sie war unbeschadet, aber als eine andere Person daraus hervorgegangen, mit einer ganzen Bibliothek vergangener Lebenserinnerungen im Kopf und der neuen Fähigkeit, sich selbst auf genetischer Ebene wahrzunehmen. Sie verfügte nun über ein tiefgreifendes Verständnis für jede in Wechselwirkung stehende Faser ihres Körpers.
Krise. Überleben. Weiterentwicklung.
Aber in den darauffolgenden Jahren hatte trotz zahlreicher Versuche niemand etwas Vergleichbares erreicht, und Raquella wusste nicht, wie viele weitere Leben sie diesem flüchtigen Ziel guten Gewissens opfern konnte. Sie kannte nur eine Möglichkeit, eine Schwester an die Grenzen des Möglichen zu treiben: Sie musste sie in unmittelbare Todesnähe bringen, wo sie – vielleicht – die Kraft finden würde, sich weiterzuentwickeln …
Optimistisch und entschlossen glaubten ihre besten Schülerinnen weiterhin an sie. Und starben.
Raquella schaute betrübt zu, wie eine schwarz gewandete Schwester und drei Akoluthen in grünen Roben sich oberhalb des Blätterdachs aufstellten und die Tote in die feuchten Tiefen des silbrig-purpurnen Urwalds hinabließen. Man übergab sie den Raubtieren, sodass sie in den ewigen Kreislauf von Leben und Tod einging, durch den menschliche Überreste schließlich wieder zu Humus wurden.
Der Name der tapferen jungen Frau hatte Schwester Tiana gelautet, doch nun war ihr Leib in hellen Stoff eingewickelt und namenlos. Unten regten sich die Urwaldtiere, als das dicke Blätterdach die Bahre verschluckte.
Raquellas eigenes Leben währte schon über 130 Jahre. Sie hatte das Ende von Serena Butlers Djihad miterlebt, die Schlacht von Corrin zwei Jahrzehnte später und die darauffolgenden unruhigen Zeiten. Trotz ihres Alters war sie voller Lebensmut und von hellwachem Geist. Die schlimmsten Auswirkungen des Alterns hielt sie durch maßvollen Konsum der Melange vom Planeten Arrakis und durch die Manipulation ihrer körpereigenen Biochemie in Schach.
Die Kandidatinnen ihrer stetig anwachsenden Schule rekrutierten sich aus den Reihen der besten jungen Frauen des Imperiums, einschließlich der letzten Nachkommen jener Zauberinnen, die diesen Planeten in den Jahren vor dem und während des Djihads beherrscht hatten. Von Letzteren waren nur noch 81 geblieben. Insgesamt wurden hier elfhundert Schwestern ausgebildet, von denen zwei Drittel Schülerinnen waren. Bei einigen handelte es sich um Kinder aus den ordenseigenen Heimen, Töchter von Raquellas Missionarinnen, die sich von geeigneten Vätern hatten schwängern lassen. Anwerberinnen schickten hoffnungsvolle neue Kandidatinnen hierher, und die Ausbildung ging weiter …
Jahrelang hatten die Stimmen ihrer Weitergehenden Erinnerungen sie dazu gedrängt, mehr Ehrwürdige Mütter zu prüfen und auszubilden, bis ihre Fähigkeiten denen von Raquella gleichkamen. Sie und ihre Sachwalterinnen widmeten sich ganz der Aufgabe, anderen Frauen zu zeigen, wie sie ihre Gedanken, ihren Körper und die eigene Zukunft beherrschten. Jetzt, wo es keine Denkmaschinen mehr gab, mussten die Menschen weiter über sich hinauswachsen als je zuvor. Raquella würde ihnen den Weg weisen. Sie wusste, dass eine fähige Frau sich unter den richtigen Bedingungen in ein überlegenes Wesen verwandeln konnte.
Krise. Überleben. Weiterentwicklung.
Viele Absolventinnen von Raquellas Schwesternschule hatten ihren Wert bereits unter Beweis gestellt und den Planeten verlassen, um bei adligen Herrschern oder sogar am Hof des Imperators als Beraterinnen zu dienen. Manche besuchten die Mentaten-Schule auf Lampadas oder wurden zu talentierten Suk-Ärztinnen. Sie spürte, wie sich ihr unmerklicher Einfluss über das Imperium ausbreitete. Sechs der Frauen waren inzwischen voll ausgebildete Mentatinnen. Eine von ihnen, Dorotea, diente Salvador Corrino auf Salusa Secundus als vertrauliche Beraterin.
Raquella wünschte sich verzweifelt, dass mehr ihrer Anhängerinnen ein ebenso umfassendes Verständnis der Schwesternschaft und ihrer Zukunft und die gleichen geistigen und körperlichen Kräfte entwickeln würden wie sie selbst.
Doch aus irgendeinem Grund gelang ihren Kandidatinnen dieser Sprung nicht. Und so war eine weitere vielversprechende junge Frau gestorben …
Während die Frauen die sterblichen Überreste der toten Schwester mit ungewöhnlicher Nüchternheit entsorgten, machte Raquella sich Sorgen um die Zukunft. Trotz ihrer langen Lebensspanne gab sie sich nicht der Illusion persönlicher Unsterblichkeit hin, und falls sie starb, bevor jemand anders lernte, die Verwandlung zu überleben, würden ihre Fähigkeiten vielleicht für immer verloren gehen …
Das Schicksal der Schwesternschaft und ihrer weitreichenden Arbeit war sehr viel bedeutsamer als Raquellas eigenes Schicksal als Sterbliche. Die Zukunft der Menschheit hing auf lange Sicht von behutsamen Fortschritten und stetigen Verbesserungen ab. Die Schwesternschaft konnte sich das Warten nicht mehr leisten. Sie musste Nachfolgerinnen heranziehen.
Als die Leiche entsorgt und die Beisetzung beendet war, machten sich die anderen Frauen auf den Weg zurück in die Schule im Fels, um den Unterricht wieder aufzunehmen. Raquella hatte eine neue Kandidatin ausgewählt, eine junge Frau aus einer entehrten Familie, die kaum eine Zukunft hatte und diese Chance verdiente.
Schwester Valya Harkonnen.
Raquella beobachtete, wie Valya sich von den übrigen Schwestern löste und über den Weg am Hang zu ihr ging. Schwester Valya war eine gertenschlanke junge Frau mit ovalem Gesicht und haselnussbraunen Augen. Die Ehrwürdige Mutter begutachtete ihre geschmeidigen Bewegungen, die Art, wie sie den Kopf selbstsicher erhoben hielt, ihre gesamte Haltung – Kleinigkeiten, die jedoch von großer Bedeutung für den Menschen als Ganzes waren. Raquella zweifelte nicht an ihrer Wahl; wenige andere Schwestern widmeten sich ihrer Ausbildung so hingebungsvoll wie Valya.
Schwester Valya war dem Orden am Ende ihres sechzehnten Lebensjahres beigetreten und hatte ihren hinterwäldlerischen Heimatplaneten Lankiveil auf der Suche nach einem besseren Leben verlassen. Ihr Urgroßvater, Abulurd Harkonnen, war nach der Schlacht von Corrin wegen Feigheit dorthin verbannt worden. Während ihrer fünf Jahre auf Rossak hatte Valya sich als hervorragende Schülerin erwiesen und war zu einer von Raquellas treuesten und talentiertesten Schwestern geworden; sie arbeitete eng mit Schwester Karee Marques zusammen, einer der letzten Zauberinnen, und untersuchte neue Drogen und Gifte auf ihre Verwendbarkeit bei den Prüfungen.
Als Valya der alten Frau gegenübertrat, wirkte sie nicht besonders aufgewühlt von der Beerdigung. »Sie wollten mich sehen, Ehrwürdige Mutter?«
»Bitte folge mir.«
Valya war offensichtlich neugierig, doch sie behielt ihre Fragen für sich. Die beiden gingen an den Verwaltungs- und Wohnhöhlen vorbei. Zu ihren Hochzeiten während der vergangenen Jahrhunderte hatte diese Stadt im Fels Tausende von Männern und Frauen beherbergt, Zauberinnen, Medizinhändler, Forscher, die in die Tiefen des Urwalds vordrangen. Doch durch die Seuchen waren so viele gestorben, dass die Stadt heute beinahe leer war und nur die wenigen Angehörigen der Schwesternschaft beherbergte.
Ein ganzer Höhlenabschnitt war für die Behandlung der Fehlgeborenen reserviert gewesen, Kinder, die aufgrund von Giftstoffen in Rossaks Umwelt mit Missbildungen zur Welt gekommen waren. Dank sorgfältigen Studiums der Zuchtprotokolle wurden solche Kinder nur selten geboren, und diejenigen, die überlebten, wurden in den nördlichen Städten versorgt, fernab der Vulkane. Raquella gestattete nicht, dass Männer im Gemeinwesen ihrer Schule lebten, obwohl gelegentlich welche kamen, um Vorräte anzuliefern oder Reparaturen und andere Dienstleistungen durchzuführen.
Raquella führte Valya vorbei an verbarrikadierten Eingängen im Hang, die früher einmal in weite Bereiche der bienenstockartigen Höhlenstadt geführt hatten, die nun verlassen und abgeriegelt waren. Es waren unheimliche Orte, an denen es keine Spur von Leben gab. Die Leichen hatte man schon vor Jahren herausgeholt und im Urwald zur Ruhe gebettet. Sie deutete auf den trügerischen Pfad, der steil ansteigend am Hang entlang und bis hoch auf das Plateau führte. »Dorthin sind wir unterwegs.«
Die junge Frau zögerte für einen winzigen Augenblick und folgte der Ehrwürdigen Mutter dann vorbei an einer Barrikade und an Schildern, die den Zugang untersagten. Valya war zugleich aufgeregt und nervös. »Dort oben befinden sich die Zuchtprotokolle.«
»So ist es.«
In den Jahren der schrecklichen, von Omnius verbreiteten Seuchen, denen ganze Planetenbevölkerungen zum Opfer gefallen waren, hatten die Zauberinnen von Rossak – die seit jeher über das menschliche Erbgut Buch führten, um die besten Fortpflanzungspaarungen zu bestimmen – ein weitaus ehrgeizigeres Projekt ins Leben gerufen. Sie hatten eine Bibliothek aller Menschengeschlechter angelegt, einen umfassenden genetischen Katalog. Jetzt war es Raquella und ihren Schwestern zugefallen, diesen gewaltigen Wissensschatz zu hegen.
Der Weg führte in scharfen Serpentinen empor, zur einen Seite eine massive Felswand, zur anderen ein Steilhang, der bis zum dichten Urwald hinunterreichte. Der Nieselregen hatte aufgehört, aber der Stein unter ihren Füßen war noch immer glitschig.
Die beiden Frauen erreichten einen Aussichtspunkt, an dem sie von Nebelfetzen umwogt wurden. Raquella blickte über den Urwald hinweg zu den schwelenden Vulkanen in der Ferne – kaum etwas hatte sich an dieser Landschaft verändert, seit sie vor Jahrzehnten zum ersten Mal hier gewesen war, als eine Krankenschwester im Gefolge von Dr. Mohandas Suk, der Opfer der Omnius-Seuche behandelt hatte.
»Nur wenige von uns kommen überhaupt noch hier herauf – aber du und ich, wir gehen noch weiter.« Raquella neigte nicht zum Plaudern und hielt ihre Gefühle streng unter Kontrolle, aber dennoch verspürte sie eine gewisse freudige Erregung bei dem Gedanken daran, dass sie gleich jemanden in das größte Geheimnis der Schwesternschaft einweihen würde. Eine neue Verbündete. Nur so konnte die Schwesternschaft überleben.
Vor einem Höhleneingang inmitten klobiger Felsblöcke, kurz vor dem höchsten Punkt des Plateaus und weit über dem fruchtbaren, üppigen Urwald, blieben sie stehen. Vor dem Eingang hielten zwei Zauberinnen Wache. Sie nickten der Ehrwürdigen Mutter zu und ließen sie passieren.
»Die Zusammenstellung der Zuchtprotokolle ist vielleicht das größte Werk der Schwesternschaft«, erklärte Raquella. »Mit einer solch gewaltigen Datenbank über das menschliche Genmaterial können wir die Zukunft unserer Spezies extrapolieren … und sie vielleicht sogar steuern.«
Valya nickte ernst. »Ich habe von anderen Schwestern gehört, dass es eins der größten Archive ist, die jemals zusammengestellt wurden, aber ich habe nie begriffen, wie wir so viele Informationen verwalten können. Wie verarbeiten wir all das und ziehen Schlüsse daraus?«
Raquella beschloss, sich vorerst bedeckt zu halten. »Wir sind die Schwesternschaft.«
In den höchsten Höhlen betraten sie zwei große Kammern, in denen Holztische und Schreibpulte standen. Frauen liefen umher, sortierten Blätter aus dauerhaftem Papier, erstellten gewaltige DNS-Karteien und fassten Dokumente zur Archivierung in mikroskopisch kleinen Schriftzeichen zusammen.
»Vier unserer Schwestern haben unter Gilbertus Albans ein Mentatentraining absolviert«, fuhr Raquella fort. »Aber selbst für ihre weit fortgeschrittenen geistigen Fähigkeiten ist es immer noch ein überwältigendes Projekt.«
Valya bemühte sich, ihr ehrfürchtiges Erstaunen im Zaum zu halten. »Was für eine gewaltige Datenmenge …« Ihre leuchtenden Augen sogen die Informationen fasziniert auf. Sie fühlte sich zutiefst geehrt und stolz, dass man sie in den inneren Kreis der Ehrwürdigen Mutter aufgenommen hatte. »Mir ist bewusst, dass weitere Frauen unseres Ordens auf Lampadas ausgebildet werden, aber für dieses Projekt würde man ein Heer von Mentatenschwestern benötigen. Es geht hier um die genetischen Unterlagen von Abermillionen von Menschen auf Tausenden von Planeten.«
Als sie tiefer in die Tunnel vordrangen, die nur wenigen zugänglich waren, trat eine ältere Schwester in der weißen Robe einer Zauberin aus einem Archivraum. Sie begrüßte die Besucherinnen. »Ehrwürdige Mutter, ist dies die neue Rekrutin, die Sie mir bringen wollten?«
Raquella nickte. »Schwester Valya ist eine ausgezeichnete Schülerin und hat ihre Hingabe unter Beweis gestellt, indem sie Karee Marques bei ihrer pharmazeutischen Forschung unterstützt hat.« Sie versetzte der jungen Frau einen leichten Stoß. »Valya, Schwester Sabra Hublein gehört zu denjenigen, die damals während der Seuchenjahre begonnen haben, die Zuchtdatenbank zu erweitern, lange bevor ich nach Rossak kam.«
»Die Zuchtprotokolle müssen erhalten und bewacht werden«, sagte die andere Frau.
»Aber … ich bin keine Mentatin«, erwiderte Valya.
Sabra führte sie in einen leeren Tunnel und warf einen Blick über die Schulter, um sich zu vergewissern, dass niemand sie beobachtete. »Es gibt auch andere Möglichkeiten, uns zu helfen, Schwester Valya.«
Sie verharrten hinter einer Biegung. Der Gang endete vor einer glatten Steinwand. Raquella warf der jungen Frau einen Blick zu. »Fürchtest du dich vor dem Unbekannten?«
Valya brachte ein Lächeln zustande. »Die Menschen fürchten sich immer vor dem Unbekannten, wenn sie ehrlich sind. Aber ich kann mich meinen Ängsten stellen.«
»Gut. Dann komm mit mir. Wir wollen Bereiche betreten, die bislang kaum erforscht sind.«
Valya schien unbehaglich zumute zu sein. »Soll ich die nächste Freiwillige sein, die eine neue Verwandlungsdroge ausprobiert? Ehrwürdige Mutter, ich glaube nicht, dass ich bereit für …«
»Nein, hier geht es um etwas ganz anderes, wenn auch nicht weniger Wichtiges. Ich bin alt, Kind. Dadurch bin ich zynischer geworden, aber ich habe auch gelernt, meinen Instinkten zu vertrauen. Ich habe dich und deine Arbeit mit Karee Marques aufmerksam beobachtet – und ich möchte dich in diesen Plan einweihen.«
Valya sah nicht verängstigt aus, und sie behielt ihre Fragen für sich. Gut, dachte Raquella.
»Atme tief durch, und beruhige dich, Mädchen. Du wirst nun eins der bestgehüteten Geheimnisse der Schwesternschaft erfahren. Sehr wenige unseres Ordens haben dies jemals gesehen.«
Raquella nahm die junge Frau bei der Hand und zog sie in Richtung des scheinbar massiven Gesteins. Sabra ging neben Valya her, dann durchschritten sie die Wand – ein Hologramm – und betraten einen weiteren Raum.
Sie standen zu dritt in einem kleinen Eingangsbereich. Im hellen Licht blinzelnd, versuchte Valya, ihre Überraschung nicht zu zeigen. Ihre Ausbildung half ihr dabei.
»Hier entlang.« Die Ehrwürdige Mutter führte sie in ein großes, hell erleuchtetes Gewölbe, und Valya riss die Augen auf, als sie begriff, was sie vor sich sah.
Das Gewölbe war voller surrender und klickender Maschinen mit zahlreichen elektrischen Lichtern – eine Aneinanderreihung verbotener Computer, die sich auf mehreren Ebenen an den gewölbten Steinwänden entlangzogen. Sie waren durch Wendeltreppen und hölzerne Rampen miteinander verbunden. Einige wenige Zauberinnen in weißen Roben eilten geschäftig umher, und die Luft pulsierte von Maschinengeräuschen.
Valya stammelte: »Sind das … sind das …?« Anscheinend bekam sie die Frage nicht heraus, und schließlich rief sie: »Denkmaschinen!«
»Wie du selbst sagtest«, erklärte Raquella. »Kein Mensch, nicht einmal ein ausgebildeter Mentat, kann all die Daten aufnehmen, die die Frauen von Rossak im Laufe der Generationen zusammengetragen haben. Seit Generationen benutzen die Zauberinnen heimlich diese Maschinen, und einige unserer treuesten Frauen werden dazu ausgebildet, sie zu warten und zu bedienen.«
»Aber … warum?«
»Nur mithilfe von Computern können wir diese enormen Datenmengen bewahren und die notwendigen genetischen Vorausberechnungen über mehrere Generationen hinweg durchführen – und Computer sind strengstens verboten. Du verstehst also, warum wir diese Maschinen geheim halten müssen.«
Raquella musterte Valya aufmerksam. Ihr entging nicht die berechnende Miene ihrer Schülerin, als diese den Blick durch das Gewölbe schweifen ließ. Sie wirkte überwältigt, aber nicht etwa vor Entsetzen, sondern vor Erstaunen.
»Es gibt viel für dich zu lernen«, sagte Sabra. »Seit Jahren studieren wir die Zuchtprotokolle, und wir befürchten, dass die wahren Zauberinnen aussterben werden. Nur wenige von uns sind geblieben, und uns bleibt kaum noch Zeit. Dies ist vielleicht die einzige Möglichkeit, den Dingen auf die Spur zu kommen.«
»Und Alternativen zu finden«, fügte Raquella hinzu. »Wie zum Beispiel die Schaffung neuer Ehrwürdiger Mütter.« Sie achtete darauf, dass man ihrer Stimme weder ihre Verzweiflung noch ihre Hoffnung anmerkte.
Eine der Zauberinnen, die hier arbeiteten, führte ein kurzes Gespräch mit Sabra über ein genetisches Problem. Nach einem kurzen, neugierigen Blick in Valyas Richtung kehrte sie wieder zu ihrer Arbeit zurück. »Schwester Esther-Cano ist unsere jüngste reinblütige Zauberin«, sagte Raquella. »Sie ist gerade erst dreißig. Doch die Nächstjüngere ist ganze zehn Jahre älter als sie. Die telepathische Fähigkeit der Zauberinnen tritt bei den hier geborenen Töchtern nur noch selten auf.«
»Die Zuchtprotokolle der Schule enthalten Informationen über Menschen auf Tausenden von Planeten«, fuhr Sabra fort. »Wir verfügen über gewaltige Datenbanken, und wie du weißt, besteht unser Ziel darin, die Menschheit durch individuelle Verbesserung und Zuchtwahl zu optimieren. Mithilfe der Computer können wir DNS-Wechselwirkungen modellieren und die genetischen Potenziale einer praktisch unbegrenzten Zahl von Blutlinien-Kombinationen ermitteln.«
Valyas kurzer, reflexhafter Moment des Entsetzens war durch umso nachdrücklicheres Interesse ersetzt worden. Sie blickte sich in dem Gewölbe um und sagte nüchtern: »Sollten die Butler-Anhänger das jemals herausfinden, werden sie die Schule zerstören und uns bis auf die letzte Schwester töten.«
»Ja, das werden sie«, sagte Raquella. »Du begreifst also, welches Vertrauen wir in dich setzen.«
3
Ich habe mehr als meinen Teil zur Menschheitsgeschichte beigetragen. Über zweihundert Jahre lang habe ich den Lauf der Dinge beeinflusst und die Feinde bekämpft, die mir bestimmt wurden. Schließlich habe ich alldem den Rücken gekehrt und bin fortgegangen. Ich wollte nichts weiter, als sang- und klanglos vergessen zu werden, aber die Geschichte will mich einfach nicht in Ruhe lassen.
Vorian Atreides,
Das Tagebuch-Vermächtnis, aus der Kepler-Zeit
Als er von seiner einsamen Jagd in den Dornstrauchbergen zurückkehrte, sah Vorian unerwartet schmierige Rauchwolken, die sich in den Himmel emporkräuselten. Die dicken Wolken erhoben sich von dem Dorf, in dem seine Familie lebte, und von den umliegenden Äckern.
Er rannte sofort los.
Vorian war seinem Landhaus, seiner Frau, seiner weitläufigen Verwandtschaft und seinen Nachbarn fünf Tage lang ferngeblieben. Er jagte gern die schwerfälligen, flugunfähigen Gornet-Vögel, von denen einer genügte, um eine Familie mehr als eine Woche lang satt zu machen. Gornets lebten oben in den ausgedörrten Bergen, weit weg vom fruchtbaren, besiedelten Tal, und sie suchten häufig Schutz zwischen den mit rasiermesserscharfen Dornen bewehrten Sträuchern.
Doch mehr noch als an der Jagd erfreute Vor sich an der Einsamkeit, an der Gelegenheit, innerlich Ruhe und Frieden zu finden. Selbst wenn er allein in der Wildnis war, konnte er auf die Erinnerungen mehrerer Lebensspannen zurückgreifen, auf Beziehungen, die er geknüpft und wieder verloren hatte, auf Dinge, die er bereute oder die ihn noch immer glücklich machten … Freunde, Geliebte und Feinde – manchmal alles in Form einer einzigen Person, zu der sich sein Verhältnis im Laufe der Zeit gewandelt hatte. Seine gegenwärtige Frau Mariella hatte Jahrzehnte glücklich und zufrieden mit ihm verbracht. Sie hatten eine große Familie – Kinder, Enkel und Urenkel.
Obwohl er angesichts seiner Vergangenheit zuerst gezögert hatte, war Vor schließlich bereit gewesen, sich hier auf dem Planeten Kepler niederzulassen und ein ländliches Leben zu führen. Er hatte sich wie ein Mann gefühlt, der wieder in bequeme alte Kleider schlüpft. Vor vielen Jahrzehnten hatte er auf Caladan zwei Söhne gehabt, aber sie waren immer auf Abstand zu ihm geblieben und hatten sich von ihm entfremdet, und er hatte seit der Schlacht von Corrin weder sie noch ihre Nachkommen gesehen.
Vor langer Zeit hatte sein eigener Vater, der berüchtigte Cymek-General Agamemnon, ihm eine geheime lebensverlängernde Behandlung angedeihen lassen, ohne zu ahnen, dass Vorian sich dafür entscheiden würde, gegen die Denkmaschinen zu kämpfen. Generationen des Blutvergießens hatten ihn körperlich ausgelaugt und machten ihm auch seelisch zu schaffen. Als der Kriegsheld Feykan Butler das neue Imperium ins Leben gerufen hatte, war es Vor bereits gleichgültig gewesen. Er hatte sein Schiff und eine großzügige Belohnung vom neuen Imperator entgegengenommen, der Liga der Edlen den Rücken gekehrt und war ins Unbekannte hinausgeflogen.
Doch nachdem er jahrelang allein umhergestreift war, traf er Mariella, verliebte sich aufs Neue und ließ sich hier nieder. Das Leben auf Kepler war ruhig und befriedigend, und Vor nahm sich die Zeit, ein neues Zuhause für sich zu erschaffen, einen Ort, an dem er wirklich bleiben wollte. Er zog drei Töchter und zwei Söhne groß, die später andere Dorfbewohner von Kepler heirateten und ihm insgesamt elf Enkel und mehr als zwei Dutzend Urenkel schenkten, die inzwischen selbst alt genug waren, um Familien zu gründen. Er erfreute sich an den einfachen Dingen, an ruhigen Abenden. Seinen Nachnamen hatte er geändert, doch heute, ein halbes Jahrhundert später, kümmerte er sich nicht groß darum, ihn geheim zu halten. Welche Rolle spielte es schon? Schließlich war er kein Verbrecher.
Während die Jahre an Vor kaum äußerliche Spuren hinterließen, alterte Mariella sichtlich. Am liebsten verbrachte sie ihre Zeit mit der Familie, aber sie ließ Vor zum Jagen in die Berge ziehen, wann immer er wollte. Nach zweihundert Jahren wusste er, wie man allein zurechtkam. Er dachte nur selten an das Imperium dort draußen, obwohl es ihn nach wie vor manchmal belustigte, wenn er alte imperiale Münzen mit seinem Abbild darauf sah …
Doch jetzt, als er von der Jagd zurückkehrte und feststellte, dass Rauch von den Bauernhäusern aufstieg, fühlte sich Vor, als hätte ein Sturm die Tür zu seiner Vergangenheit weit aufgestoßen. Er warf zwanzig Kilo eingewickeltes frisches Gornet-Fleisch ab und rannte nur mit seinem altmodischen Projektilgewehr bewaffnet den Pfad hinab. Vor ihm lag der Flickenteppich aus Ackerland, der nun von den braunen und schwarzen Narben überzogen war, die die durchs Korn eilenden orangefarbenen Flammen hinterließen. Drei große Raumschiffe waren auf den Feldern statt auf der ihnen zugedachten Fläche gelandet. Es waren keine Kriegsschiffe, sondern plumpe, zigarrenförmige Transporter für Fracht oder Personal. Hier ging etwas Schreckliches vor.
Eins der großen Schiffe stieg gemächlich in den Himmel auf, und wenige Augenblicke später ließ ein zweites Schiff Staub- und Abgaswolken aufwirbeln, als es ebenso schwerfällig vom Boden abhob. Besatzungsmitglieder versammelten sich eilig um das dritte Schiff, das sich ebenfalls auf den Abflug vorbereitete.
Obwohl Vor noch nie ein solches Schiff hier auf Kepler gesehen hatte, wusste er aus jahrelanger Erfahrung, wie Sklavenjäger aussahen.
Er rannte Hals über Kopf bergab und dachte dabei an Mariella, an seine Kinder, Enkel und all ihre Männer, Frauen und Nachbarn – das hier war sein Zuhause. Aus dem Augenwinkel sah er das Bauernhaus, in dem er viele Jahre lang gelebt hatte. Das Dach schwelte, doch der Schaden war längst nicht so schlimm wie bei vielen der anderen Häuser. Die Nebengebäude des Hofs seiner Tochter Bonda standen in Flammen, das kleine Rathaus war ein tosendes Inferno. Zu spät – zu spät! Er kannte all diese Leute, jeder Einzelne war mit ihm durch Bande des Bluts, der Ehe oder der Freundschaft verbunden.
Vor atmete so schwer, dass er keinen Ruf herausbekam. Er wollte den Sklavenhändlern zuschreien, dass sie aufhören sollten, aber er war ganz allein, und sie würden niemals auf ihn hören. Sie hatten keine Ahnung, dass er Vorian Atreides war, und nach so langer Zeit wäre es ihnen vielleicht auch egal gewesen.
Die verbliebene Handvoll Sklavenhändler schleifte ihre leblos wirkende menschliche Fracht an Bord des dritten Schiffs. Selbst aus dieser Entfernung erkannte Vor seinen Sohn Clar mit dem langen Pferdeschwanz und dem lilafarbenen Hemd; offenbar hatte man ihn betäubt, und die Invasoren trugen ihn soeben an Bord. Einer der Sklavenhändler hinkte und ging ganz hinten, während seine vier Begleiter ihre letzten Opfer die Rampe empor und durch die offene Ladeluke trugen.
Als Vor in Reichweite war, ließ er sich auf ein Knie nieder, hob sein Gewehr und zielte. Obwohl ihm das Herz in der Brust hämmerte und er keine Luft bekam, zwang er sich für einen Moment zur Ruhe, konzentrierte sich und schoss auf den vordersten Sklavenhändler. Er wollte es nicht darauf ankommen lassen, seine eigenen Leute zu treffen. Er war davon überzeugt, richtig gezielt zu haben, aber der Sklavenhändler zuckte nur kurz zusammen, blickte sich um und rief etwas. Seine Kameraden rannten los, um nach dem Schützen zu suchen.
Vor zielte sorgfältig und schoss erneut, doch auch der zweite Schuss erzeugte nur Panik, aber keine erkennbaren Verletzungen. Dann wurde ihm klar, dass die beiden Männer persönliche Körperschilde trugen, nahezu unsichtbare Rüstungen, an denen schnelle Geschosse abprallten. Er konzentrierte sich und schwenkte auf den Mann um, der hinter den anderen zurückgeblieben war. Mit zusammengekniffenen Augen drückte er erneut ab – und traf den muskulösen Sklavenjäger in den Rücken. Der Mann fiel aufs Gesicht. Also waren nicht alle mit Schilden ausgestattet.
Kaum war der dritte Schuss verhallt, sprang Vor auf und rannte zum Sklavenschiff. Die Gefährten des Gefallenen hatten ihn stürzen sehen, und nun riefen sie und deuteten hierhin und dorthin. Im Laufen hob Vor das Gewehr und schoss erneut, diesmal schlechter gezielt. Das Projektil prallte in der Nähe der Außenluke vom metallenen Rumpf ab, und die Sklavenhändler schrien. Vor schoss ein weiteres Mal und traf die offene Luke.
Im Laufe seines Lebens hatte Vor unter verschiedensten Umständen Menschen getötet, normalerweise aus gutem Grund. So sehr im Recht wie jetzt hatte er sich allerdings noch nie gefühlt. Tatsächlich tat ihm der Gornet-Vogel, den er am vorangegangenen Abend erlegt hatte, mehr leid als diese Männer.
Im Grunde waren alle Sklavenhändler Feiglinge. Im Schutz ihrer Schilde eilten die übrigen ins Raumschiff, schlossen die Luke und ließen ihren gestürzten Kameraden zurück. Die großen Düsen des Frachters rülpsten eine Abgaswolke aus, und das letzte der Sklavenhändlerschiffe erhob sich mitsamt seiner Gefangenenfracht vom Boden. Obwohl Vor rannte, so schnell er konnte, erreichte er es nicht rechtzeitig. Er hob das Gewehr und gab noch zwei sinnlose Schüsse auf den Bauch des Schiffs ab, während es über qualmende Felder und Häuser hinweg davonflog.
Er roch den Rauch in der Luft, sah die brennenden Gebäude und wusste, dass ihm, wenn überhaupt, nur wenige seiner Angehörigen geblieben waren. Hatte man sie alle gefangen genommen oder getötet? Auch Mariella? Er wünschte sich nichts sehnlicher, als von Haus zu Haus zu rennen, um irgendjemanden zu finden … aber er musste auch die Gefangen befreien. Er musste herausfinden, wohin die Schiffe unterwegs waren, bevor sie endgültig auf und davon waren.
Vor blieb neben dem Mann stehen, den er angeschossen hatte. Der Sklavenhändler lag mit zuckenden Armen auf dem Boden. Er hatte sich ein gelbes Stück Stoff um den Kopf gebunden, und eine dünne tätowierte Linie zog sich schwarz von seinem linken Ohr bis zu seinem Mundwinkel. Ein Stöhnen und ein dünnes Rinnsal Blut kamen über seine Lippen.
Er lebte noch. Gut. Mit einer solchen Wunde würde er es allerdings nicht mehr lange machen.
»Du erzählst mir jetzt, wo man die Gefangenen hinbringt«, sagte Vor.
Der Mann stöhnte erneut und gurgelte etwas, das nach einem Fluch klang. Für Vor war das keine akzeptable Antwort. Er blickte auf und sah, dass sich das Feuer über die Hausdächer ausbreitete. »Dir bleibt nicht viel Zeit zum Antworten.«
Da der Mann nicht mit ihm kooperieren wollte, wusste Vor, was er zu tun hatte, obwohl er nicht stolz darauf war. Doch der Sklavenhändler stand auf der Liste der Geschöpfe, für die er Mitleid empfand, sehr weit unten. Er zog sein langes Kürschnermesser. »Du wirst es mir sagen.«
Nachdem er seine Informationen hatte und der Mann tot war, rannte Vor an den Nebengebäuden vorbei hinter sein großes Haus und rief nach möglichen Überlebenden. Seine Hände und Arme waren mit Blut beschmiert – teilweise stammte es von dem Gornet-Vogel, den er geschlachtet hatte, und teilweise von dem Sklavenhändler, den er befragt hatte.
Draußen stieß er auf zwei alte Männer, Mariellas Brüder, die ihm jedes Jahr beim Einbringen der Ernte halfen. Beide waren benommen und kamen langsam wieder zu Bewusstsein. Vor vermutete, dass die Schiffe der Sklavenhändler über die Siedlung geflogen waren und die Häuser und Felder mit Betäubungsstrahlen bestrichen hatten, um anschließend einfach jeden mitzunehmen, der jung und kräftig aussah. Mariellas Brüder waren anscheinend durchs Raster gefallen.
Die gesünderen Kandidaten – seine Söhne und Töchter, Enkel und Nachbarn – waren aus ihren Häusern geholt und in die Schiffe verschleppt worden. Viele der Häuser standen in Flammen.
Doch zunächst musste er seine Frau finden. Vor stürmte ins Haupthaus und brüllte: »Mariella!« Zu seiner unbändigen Erleichterung hörte er sie von oben antworten. Sie befand sich im Gästezimmer im ersten Stock, wo sie sich aus einem hohen Giebelfenster lehnte und versuchte, mit einem Feuerlöscher die Flammen auf dem Dach zu bekämpfen. Vorian wurde schwindelig vor Glück, als er ins Zimmer rannte und ihr altes, aber noch immer wunderschönes Gesicht sah – die Züge von tiefen Falten und Sorgen gezeichnet, das Haar wie gesponnenes Silber. Er war so froh, sie wohlbehalten und lebendig vorzufinden, dass er beinahe geweint hätte, aber das Feuer forderte seine Aufmerksamkeit. Er nahm ihr den Feuerlöscher ab und besprühte die Flammen vor dem Fenster. Das Feuer hatte sich an der Dachkante entlang ausgebreitet, aber noch brannte nicht das ganze Haus.
»Ich hatte Angst, dass sie auch dich mitgenommen haben«, sagte Mariella. »Du siehst so jung wie unsere Enkel aus.«
Unter der Löschflüssigkeit erstarben die Flammen flackernd. Er stellte den Feuerlöscher ab, zog seine Frau an sich und drückte sie so fest an sich wie seit einem halben Jahrhundert nicht mehr. »Und ich habe mir Sorgen um dich gemacht.«
»Ich bin viel zu alt, als dass sie sich für mich interessieren würden«, erwiderte Mariella. »Darauf hättest du von selbst kommen können, wenn du kurz nachgedacht hättest.«
»Wenn ich nachgedacht hätte, wäre ich nicht hier gewesen, bevor die Schiffe weg waren. So ist es mir gelungen, einen der Sklavenhändler zu töten.«
»Sie haben fast jeden mitgenommen, der körperliche Arbeit verrichten kann. Ein paar haben sich vielleicht versteckt, und einige hat man einfach getötet, aber wie sollen wir …?« Sie schüttelte den Kopf und blickte auf ihre Hände. »Es ist unmöglich. Sie sind alle fort.«
»Ich hole sie zurück.«
Mariellas Antwort bestand in einem traurigen Lächeln, aber er küsste die vertrauten Lippen, die schon so lange Teil seines Lebens, seiner Familie, seines Zuhauses waren. Sie ähnelte seiner vorherigen Frau, Leronica Tergiet, auf einer anderen Welt, einer Frau, mit der er ebenfalls zusammengeblieben war, die ihm Kinder geboren hatte und alt geworden und gestorben war, während er sich kein bisschen verändert hatte.
»Ich weiß, wohin sie fliegen«, sagte Vor. »Die Schiffe bringen sie zu den Sklavenmärkten auf Poritrin. Der Sklavenhändler hat es mir erzählt.«
Zusammen mit Mariellas Brüdern suchte er die anderen Häuser nach versprengten Überlebenden ab. Sie fanden eine ganze Reihe, mit deren Hilfe sie die sich ausbreitende Feuersbrunst unter Kontrolle brachten, den Verletzten halfen und feststellten, wer fehlte. Man hatte nur sechzig der mehreren Hundert Bewohner des Tals zurückgelassen, und die meisten von ihnen waren entweder alt oder hatten andere Gebrechen. Zehn hatten sich gewehrt und waren getötet worden. Vor warnte die anderen besiedelten Täler auf Kepler, damit sie sich vor Sklavenhändlern in Acht nahmen.
In jener Nacht holte Mariella Fotos von ihren Kindern, deren Familien und den Enkeln hervor und breitete sie auf dem Tisch und auf den Regalen aus. So viele Gesichter, so viele Menschen, die gerettet werden mussten.
Sie fand ihn auf dem nach Rauch riechenden Dachboden ihres Zuhauses, wo er eine Vorratskiste entdeckt hatte. Vor öffnete sie und holte eine gebügelte und zusammengefaltete alte Uniform hervor. Sie war in Scharlachrot und Grün gehalten, den vertrauten Farben der Armee der Menschheit, der ehemaligen Armee des Djihads.
Er hatte die Kiste vor vielen, vielen Jahren verschlossen und verstaut.
»Ich fliege nach Poritrin und hole unsere Leute zurück.« Er hielt das Uniformhemd hoch, strich mit den Fingern über die glatten Ärmel und dachte daran, wie oft diese Uniform schon geflickt worden war, wie viele Blutflecken herausgewaschen worden waren. Er hatte gehofft, nie wieder in die Schlacht ziehen zu müssen. Aber diesmal war es anders.
»Und wenn ich sie gerettet habe, muss ich dafür sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht. Ich werde einen Weg finden, diesen Planeten zu schützen. Das sind die Corrinos mir schuldig.«
4
Es ist leicht zurückzuschauen und anderen die Schuld zu geben, aber viel schwerer, in die Zukunft zu blicken und die Verantwortung für die eigenen Entscheidungen und für das, was einem selbst bevorsteht, zu übernehmen.
Griffin Harkonnen, letzte Depesche von Arrakis
Es war ein harter Winter auf Lankiveil, und die Harkonnens mussten zusehen, wie sie über die Runden kamen. Seit Generationen – seit man Abulurd Harkonnen zur Strafe für seine Taten in der Schlacht von Corrin hierher ins Exil geschickt hatte – fristete die einst mächtige Familie auf dieser Welt ihr Dasein, während ihre einstige Glanzzeit auf Salusa Secundus dem Vergessen anheimfiel.
Und tatsächlich hatten die meisten von ihnen jene Tage vergessen.
Unablässig fiel der Schneeregen und gefror des Nachts zu einer eisigen Schicht. In den Holzhäusern an den Fjordufern mussten die Einheimischen das Eis von ihren Türen abtauen und sie auftreten, nur um sich den kalten Sturmwinden zu stellen. Manchmal blickten sie auf die unruhige See und zum bewölkten Himmel empor und schlossen die Tür wieder, weil es einfach zu gefährlich war, sich aufs Meer hinauszuwagen. Die Pelzwalfänger saßen seit einem Monat im Hafen fest, sodass sie das einzige Handelsgut des Planeten, das im Rest des Imperiums geschätzt wurde, nicht einbringen konnten.
Selbst die kleinen Fischerboote schafften es nur selten in tiefere Gewässer hinaus und brachten meist spärlichen Fang mit nach Hause. Oft mussten die Menschen auf den eingesalzenen Fisch des Vorjahres und getrocknetes Walfleisch zurückgreifen. Im Vergleich mit dem Glanz und den Reichtümern alter Tage waren die Aussichten der Harkonnens düster.
Griffin Harkonnen – der älteste Sohn des von der Landsraad-Liga als Herrscher über Lankiveil eingesetzten Vergyl – verabscheute diesen Planeten, genau wie seine jüngere Schwester Valya. Die beiden hatten eine Abmachung, einen Plan, mit dessen Hilfe sie die Familie aus dem jämmerlichen Dasein befreien wollten, das man ihnen wegen der Fehler ihres Urgroßvaters Abulurd und seines Verrats an Vorian Atreides aufgebürdet hatte. Ihre Eltern und der Rest der Familie teilten ihren Ehrgeiz nicht, aber weil sie ihre Entschlossenheit zu schätzen wussten, gestatten sie es Griffin und Valya, trotz ihrer Jugend ihr Bestes zu versuchen.
Während Valya weit weg bei der Schwesternschaft Fortschritte erringen wollte (sowie Macht und Einfluss für das Haus Harkonnen), blieb Griffin zurück und arbeitete daran, die wirtschaftlichen Mittel der Familie aufzubessern, weiter zu investieren und aus der Isolation herauszutreten. Jeden Tag verbrachte er viele Stunden mit seinen Studien, um tieferen Einblick in die Familiengeschäfte zu gewinnen und den Lebensstandard der Menschen auf diesem Hinterwäldlerplaneten zu erhöhen. Es war nicht gerade eine gemütliche Welt, aber davon wollte er sich nicht entmutigen lassen. Er war ebenso fest entschlossen wie seine Schwester, ihren früheren Einfluss zurückzuerlangen und den Stern des Hauses Harkonnen im Imperium steigen zu sehen. Mit seinem Teil ihrer Abmachung hatte er sich ein ehrgeiziges Projekt vorgenommen, das unter anderem die Verwaltung des Familienvermögens und dessen sinnvolle Investition erforderte, neben der Entwicklung wirtschaftlicher Konzepte, die weit über das bescheidene Ziel hinausgingen, unter schwierigen Witterungsbedingungen zu überleben.
Der dreiundzwanzigjährige Griffin war schlank und sehnig, hatte ein ausgewogenes Gemüt und dachte pragmatisch. Seine Schwester war sprunghafter als er und hatte das Leben auf Lankiveil nicht länger ausgehalten. Der gelassenere Griffin dagegen war wie ein Kapitän, der sein Schiff durch ein Eismeer steuerte und dabei nach freundlicheren Gewässern und nach Sonnenschein irgendwo jenseits der Wolken Ausschau hielt.
Trotz seiner jungen Jahre verfügte Griffin bereits über gute Kenntnisse in Geschichte, Mathematik, Handelslehre und Politik, und er war fest entschlossen, eines Tages ein qualifiziertes und fähiges Oberhaupt dieses Planeten zu sein … um so den Weg für den Wiederaufstieg künftiger Harkonnen-Generationen im Imperium zu bahnen.
Griffin wusste schon jetzt besser über die Feinheiten des Walpelzhandels Bescheid als sein Vater, über Profit- und Verlustraten und imperiale Bestimmungen. Trotz seines ererbten Titels interessierte sich Vergyl Harkonnen schlicht nicht für derlei Dinge und überließ einen Großteil der schweren Arbeit seinem Sohn. Vergyl genügte es, über die Macht eines Stadtbürgermeisters zu verfügen statt über die eines Landsraad-Führers. Er war jedoch ein guter Vater und widmete seinen jüngeren Kindern Danvis und Tula viel Aufmerksamkeit.
Griffin und seine Schwester Valya hatten größere Träume für ihre Familie, auch wenn sie damit allein dastehen mochten. Einmal, bei einem besonders heftigen Übungskampf mit ihrem Bruder auf einem schwankenden Holzfloß draußen im kalten Hafenbecken, hatte Valya die Meinung geäußert, dass sie die einzigen beiden echten Harkonnens auf dem Planeten wären.