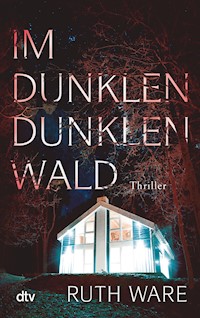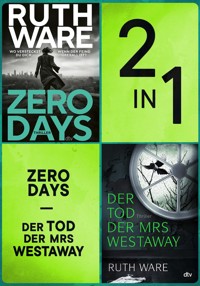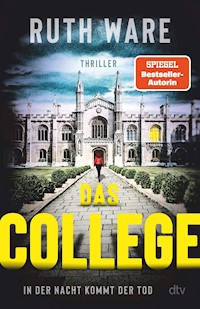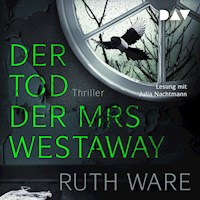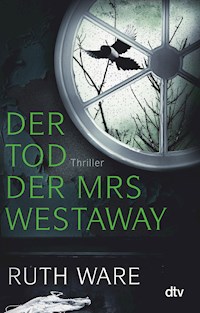
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein dunkles Haus. Ein mysteriöses Testament. Eine gefährliche Familie. Eine junge Frau in einer verzweifelten Notlage macht sich eine Verwechslung zunutze, um eine Erbschaft anzutreten. Doch die Familie, als deren Angehörige sie sich ausgibt, hat einige sehr dunkle Geheimnisse. Ihr Plan wird für Hal zur tödlichen Gefahr. Packend, atmosphärisch, voller Überraschungen und Wendungen, mit einem Hauch von Daphne du Maurier. Abgebrannt, allein und ohne Job – mit gerade mal 22 Jahren ist Harriet Westaway, genannt Hal, am Tiefpunkt ihres Lebens. Da erhält sie überraschend Post von einem Anwalt: Ihre Großmutter soll sie in ihrem Testament bedacht haben. Hal ist sofort klar, dass es sich nur um eine Verwechslung handeln kann. Ihre finanzielle Lage ist allerdings so prekär, dass sie trotzdem nach Cornwall fährt und sich dort als die gesuchte Erbin ausgibt. Eine Entscheidung mit fatalen Folgen. Denn die Familie Westaway hat einige dunkle Geheimnisse. Und Hal bringt nicht nur so manchen wunden Punkt aus der Vergangenheit ans Licht – sie scheucht auch, ohne es zu ahnen, einen Mörder auf. Von Ruth Ware sind bei dtv weitere spannende Thriller auf Deutsch erschienen: »Hinter diesen Türen« »Wie tief ist deine Schuld« »Woman in Cabin 10« »Das College« »Das Chalet« »Zero Days«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über das Buch
Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter ist Hal Westaway ganz auf sich allein gestellt. Da erhält sie überraschend einen Brief von einem Anwalt: Ihre Großmutter habe ihr ein riesiges Herrenhaus vermacht. Der 22-Jährigen ist sofort klar, dass es sich um eine Verwechslung handelt, denn ihre Großmutter ist schon seit zwanzig Jahren tot. Ihre finanzielle Lage ist allerdings so verzweifelt, dass sie trotzdem nach Cornwall fährt und sich dort als die gesuchte Erbin ausgibt. Eine Entscheidung mit fatalen Folgen, hat die alteingesessene Familie Westaway doch einige dunkle Geheimnisse. Hal bringt nicht nur so manchen wunden Punkt aus der Vergangenheit ans Licht – sie gerät auch in Lebensgefahr, denn sie scheucht einen Mörder auf, der sich jahrelang in Sicherheit gewähnt hat …
Von Ruth Ware sind im dtv außerdem erschienen:
Im dunklen, dunklen Wald
Woman in Cabin 10
Wie tief ist deine Schuld
Hinter diesen Türen
Das College
Das Chalet
Zero Days
Ruth Ware
Der Tod der Mrs Westaway
Thriller
Deutsch von Stefanie Ochel
Für meine Mum. Immer.
Die Geschichte beginnt im heutigen Brighton, doch Leserinnen und Lesern, die mit der Stadt vertraut sind, dürfte eine Unstimmigkeit auffallen – der West Pier steht noch. Ich hoffe, dass die Bewohner von Brighton sich über die – wenn auch nur literarische – Wiederbelebung dieses vielgeliebten Wahrzeichens freuen.
Eine für Leid
Zweie für Freud
Drei für ein Mädchen
Vier für ein Knäbchen
Fünfe für Silber
Und sechs für Gold
Sieben für ein Geheimnis
das keiner wissen soll
Die Elstern sind wieder da. Seltsam, wenn ich daran zurückdenke, wie abstoßend ich sie am Anfang fand. Ich weiß noch, wie ich im Taxi vom Bahnhof die Auffahrt hinauffuhr und sie in einer Reihe auf der Gartenmauer saßen und ihr Gefieder putzten.
Als eine von ihnen heute Morgen vor meinem Fenster auf einem mit Raureif überzogenen Zweig hockte, dachte ich daran, was meine Mutter beim Anblick einer einsamen Elster immer gesagt hatte, und ich flüsterte »Guten Morgen, Herr Elster«, um das Unglück fernzuhalten.
Ich zählte sie, während ich mich schlotternd vor Kälte vor dem Fenster anzog. Eine auf der Eibe. Eine zweite auf dem Wetterhahn des Zierpavillons. Eine dritte auf der Mauer des Küchengartens. Drei für ein Mädchen.
War das ein Omen? Ich hielt kurz den Atem an – wünschte, wartete …
Aber halt, hinten auf dem gefrorenen Rasen waren noch mehr. Vier, fünf … sechs … und da drüben hüpfte noch eine über die Steinplatten der Terrasse, pickte an den Eiszapfen, die von den Abdeckungen der Tische und Stühle hingen.
Sieben. Sieben für ein Geheimnis, das keiner wissen soll. Nun, das Geheimnis gibt es, aber ansonsten: weit gefehlt. Man wird zwangsläufig Bescheid wissen, und zwar schon bald. Mir bleibt keine Wahl.
Ich war schon fast angezogen, als ich aus dem Rhododendronbusch ein Rascheln hörte. Im ersten Moment konnte ich den Verursacher nicht sehen, dann plötzlich teilten sich die Zweige, und ein Fuchs schlich lautlos über den blätterbedeckten Rasen, sein rotgoldenes Fell leuchtete inmitten der fahlen Winterfarben.
Am Haus meiner Eltern gab es häufig welche, aber hier in der Gegend trifft man bei Tageslicht fast nie einen an, und kaum einer traut sich, die große Rasenfläche vor dem Haus zu überqueren. Zwar habe ich schon das eine oder andere tote Kaninchen und durchstöberte, kaputte Müllsäcke entdeckt, doch noch nie hat sich tagsüber einer so weit vorgewagt. Dieser hier war entweder sehr mutig oder sehr verzweifelt, wenn er sich am helllichten Tag vor dem Haus blicken ließ. Bei näherem Hinsehen kam mir Letzteres wahrscheinlicher vor, denn er war noch ziemlich jung und schrecklich dürr.
Erst nahmen die Elstern ihn nicht zur Kenntnis, doch dann schien die auf der Terrasse die Gestalt des Räubers zu erkennen, schoss von den eisigen Platten senkrecht in die Luft und krakeelte ihren Alarm heraus, der laut und klar durch den stillen Morgen hallte. Nach dem Warnruf hatte der Fuchs keine Chance mehr, denn schon stoben auch die anderen Vögel der Reihe nach in den Himmel, bis schließlich nur noch einer übrig blieb, der außer Reichweite des Fuchses sicher auf der Eibe hockte. Der Fuchs stahl sich, wie ein Strom aus flüssigem Gold, geduckt über das Gras davon, während die einsame Elster unbehelligt auf dem Zweig zurückblieb und ihren Triumph in alle Welt krächzte.
Eine. Eine für Leid. Doch das ist unmöglich. Kummer und Leid werden mich nie mehr quälen, trotz allem, trotz des Sturms, der im Anzug ist. Während ich hier im Salon sitze und dies alles aufschreibe, kann ich es spüren – mein Geheimnis –, ein Glück, das in mir brennt, ein Glühen so stark, dass ich manchmal glaube, es muss durch meine Haut hindurchscheinen.
Ich werde den Reim ändern. Eine für Glück. Eine für Liebe. Eine für die Zukunft.
1
Das Mädchen stemmte sich gegen den Wind, eine durchweichte Tüte Fish and Chips unter den Arm geklemmt, an der die Sturmböen rupften und drohten, den Inhalt auf der Uferpromenade zu verteilen und den Möwen zum Fraß hinzuwerfen.
Hal hielt den zerknitterten Zettel in ihrer Tasche fest umschlossen und blickte sich immer wieder argwöhnisch nach verdächtigen Gestalten um – doch da war niemand. Jedenfalls war niemand zu sehen.
Es kam selten vor, dass die Strandpromenade so leer war. Aus den Bars und Clubs, die bis spät in die Nacht geöffnet hatten, stolperten normalerweise bis zum Morgengrauen betrunkene Einheimische und Touristen auf den Kieselstrand hinaus. An diesem Abend aber waren selbst die hartgesottensten Partygänger zu Hause geblieben, und so kam es, dass Hal an einem verregneten Dienstag um 21.55 Uhr die Promenade für sich allein hatte und die flackernden Lichter des Piers und die Möwen, die schreiend über den dunklen, unruhigen Wellen des Ärmelkanals kreisten, das einzige Zeichen von Leben waren.
Hals schwarzer Pony wehte ihr in die Augen, ihre Brille war beschlagen, die Lippen rissig von der salzigen Meeresluft. Doch jetzt bog sie von der Promenade ab und hinein in eine der schmalen, von hohen weißen Wohnhäusern gesäumten Straßen, wo der Wind so abrupt abflaute, dass sie ins Straucheln kam und beinahe hinfiel. Der Regen ließ aber nicht nach, ohne den Wind schien er eher noch heftiger niederzuprasseln, als Hal die Marine View Villas erreichte.
Der Name war eine Lüge. Villen gab es hier keine, nur leicht ramponierte Reihenhäuschen, von denen der Putz durch den ständigen Kontakt mit der salzigen Luft abblätterte. Und einen Ausblick gab es auch nicht – weder aufs Meer noch sonst irgendwohin. Vielleicht hatte es ihn einst gegeben, damals, als die Häuser gebaut worden waren. Doch seither waren näher am Wasser höhere, prächtigere Häuser aus dem Boden geschossen, wodurch jeder Ausblick, den man von den Fenstern der Marine View Villas einst gehabt haben mochte, auf Backsteinmauern und Schieferdächer reduziert worden war, sogar von Hals Dachgeschosswohnung aus. Heute bestand der einzige Vorteil ihrer nur über drei schmale, knarrende Treppen erreichbaren Wohnung im dritten Stock darin, dass man über sich kein Getrampel hörte.
Die Nachbarn schienen aber sowieso nicht da zu sein – und zwar schon eine ganze Weile, zumindest nach dem Stapel Werbung im Hausflur zu schließen, über dem die Tür festklemmte. Hal musste fest schieben, bis die Tür mit einem Ruck nachgab und sie in den kalten, dunklen Hausflur stolperte. Sie drückte den Lichtschalter. Doch nichts tat sich. Entweder war die Sicherung raus oder die Birne durchgebrannt.
Im schwachen Lichtschein, der von der Straße hereinkam, raffte sie die Post zusammen und sortierte, so gut es ging, die Briefe an die Nachbarn aus, bevor sie den Weg in ihre Dachgeschosswohnung fortsetzte.
Im Treppenhaus gab es keine Fenster, deshalb musste sie sich nach dem ersten Absatz im Dunkeln vorantasten. Aber Hal kannte diese Treppe in- und auswendig, vom wackligen Brett im Flur bis zum losen Stück Teppichboden auf den letzten Stufen, und so stieg sie erschöpft, aber unbeirrt nach oben, in Gedanken schon beim Essen und in ihrem Bett. Eigentlich hatte sie gar keinen Hunger mehr, aber der Imbiss hatte immerhin 5,50 Pfund gekostet, was in Anbetracht der vielen Rechnungen in ihrer Hand genau 5,50 Pfund waren, die sie nicht einfach verschwenden durfte.
Oben angekommen duckte sie sich, um keine Regentropfen aus dem Oberlicht abzubekommen, und dann, endlich, war sie zu Hause.
Die winzige Wohnung bestand im Prinzip nur aus einem Schlafzimmer, das von einer Art breitem Flur abging, der als Küche, Wohnraum und alles andere zugleich diente. Außerdem war sie ziemlich heruntergekommen, die Farbe an den Wänden blätterte ab, der Teppichboden war abgewetzt, und bei Seewind ächzten und klapperten die Holzfensterrahmen. Doch in Hals einundzwanzig Lebensjahren war dies immer ihr Zuhause gewesen, und ganz gleich, wie sehr sie fror oder wie müde sie war, ihr Herz machte jedes Mal einen kleinen Sprung, wenn sie durch die Tür trat.
In der Tür blieb sie stehen, wischte sich die Salzspritzer von der Brille und polierte sie anschließend am zerschlissenen Stoff ihrer Jeans, bevor sie die Imbisstüte auf dem Couchtisch ablegte.
Sie zitterte vor Kälte, als sie sich vor den Gasofen kniete und am Knauf drehte. Es knackte ein paarmal, bis das Gas zündete, und nach und nach kehrte die Wärme in ihre schmerzenden blauroten Hände zurück. Dann wickelte sie die regenfeuchte Papiertüte auf und atmete den scharfen Essigduft ein, der sich in dem kleinen Raum ausbreitete.
Sie spießte eine schlaffe, noch warme Fritte auf die Gabel und begann damit, die Post durchzusehen: Werbezettel für Lieferdienste wanderten ins Altpapier, die Rechnungen auf einen Stapel. Obwohl die Fritten angenehm salzig und säuerlich schmeckten und der gebackene Fisch sogar noch heiß war, verging ihr beim Anblick des immer weiterwachsenden Stapels von Rechnungen allmählich der Appetit. Sorgen machte ihr nicht nur die Höhe des Stapels, sondern vor allem die Anzahl der mit »Letzte Mahnung« beschrifteten Umschläge darin, weshalb ihr schließlich so mulmig wurde, dass sie das Essen zur Seite schob.
Die Miete hatte Priorität – daran gab es nichts zu rütteln. Auch der Strom stand ganz oben auf der Liste. Ohne Kühlschrank und Licht war das kleine Apartment kaum bewohnbar. Die Gasrechnung … nun, es war November. Ohne Heizung würde es ungemütlich werden – aber sie würde es überleben.
Doch der Brief, bei dem ihr wirklich mulmig wurde, sah anders aus als die offiziellen Mahnungen. Auf dem billigen Umschlag, der anscheinend direkt am Haus eingeworfen worden war, stand mit Kugelschreiber geschrieben: »Harriet Westaway, Dachgeschoss«.
Es gab keine Absenderadresse, doch die brauchte Hal auch gar nicht. Sie wusste, von wem der Brief stammte.
Hal schluckte den Bissen herunter, der ihr im Hals festzustecken schien, und folgte dem unwiderstehlichen Drang, den Kopf in den Sand zu stecken, indem sie den Umschlag ungeöffnet unter den Stapel Rechnungen schob. Sie wünschte sich inständig, sie könnte das ganze Problem jemandem anvertrauen, der älter, weiser und stärker war als sie.
Aber da war niemand. Nicht mehr. Und außerdem steckte in ihrem Innersten ein zäher, sturer Kern Tapferkeit. So zierlich, blass und jung sie auch war – sie war nicht das Kind, für das man sie immer wieder hielt. Schon seit über drei Jahren war sie nicht mehr dieses Kind.
Dieser Kern war es, der sie schließlich den Umschlag wieder hervorziehen und die Lasche aufreißen ließ.
Darin befand sich ein einziges Blatt Papier, auf dem nur drei kurze getippte Sätze standen.
Leider haben wir sie verpast. Wir würden gern mit ihnen über ihre finanziele Situation sprechen. Wir melden uns wieder.
Hals Magen zog sich zusammen, und sie tastete unwillkürlich nach dem Zettel in ihrer Hosentasche, der heute Nachmittag während der Arbeit aufgetaucht war. Die beiden waren identisch, bis auf die Knicke und den Fleck, den sie mit einem Spritzer Tee beim Öffnen des ersten darauf hinterlassen hatte.
Die Botschaft an sich war nichts Neues für Hal. Schon seit Monaten ignorierte sie Anrufe und Textnachrichten mit diesem Inhalt. Es war die Botschaft hinter den Worten, die ihre Hände zittern ließ, als sie die beiden Zettel vorsichtig nebeneinander auf dem Couchtisch ablegte.
Hal war es gewohnt, zwischen den Zeilen zu lesen; ihr war klar, dass das, was jemand nicht sagte, ebenso bedeutsam war wie das, was er sagte. Gewissermaßen war das ja ihr Job. Nur dass hier die unausgesprochenen Worte keiner großen Entschlüsselung bedurften.
Sie lauteten: Wir wissen, wo Sie arbeiten.
Wir wissen, wo Sie wohnen.
Und wir werden zurückkommen.
Beim Rest handelte es sich hauptsächlich um Werbepost, die Hal ins Altpapier warf, bevor sie sich erschöpft auf dem Sofa zurücklehnte. Einen Moment lang stützte sie den Kopf in die Hände und versuchte, nicht an ihren Kontostand zu denken, während sie die Stimme ihrer Mutter im Ohr hatte, als stünde sie hinter ihr und mahnte sie wie damals beim Lernen aufs Abi: Hal, ich weiß, du bist gestresst, aber du musst essen! Du bist zu dünn!
Ich weiß, antwortete sie in Gedanken. So war es immer, wenn sie Sorgen und Stress hatte – als Erstes verlor sie ihren Appetit. Doch sie konnte es sich nicht leisten, krank zu werden, denn wenn sie nicht arbeiten konnte, verdiente sie kein Geld. Und davon ganz abgesehen, konnte sie es sich nicht leisten, eine Mahlzeit zu verschwenden, noch nicht mal eine, die an den Rändern feucht und schon fast kalt war.
Trotz ihrer schmerzenden Kehle gab sie sich einen Ruck und nahm eine weitere Fritte. Da fiel ihr im Altpapierkorb etwas ins Auge. Etwas, was nicht dort sein sollte. Ein weißer, von Hand adressierter Briefumschlag aus hochwertigem Papier, den sie versehentlich mit den Take-away-Flyern aussortiert hatte.
Hastig beugte sie sich vor und angelte den Brief zwischen den alten Zeitungen und Suppendosen hervor.
Miss Harriet Westaway stand darauf. Apartment 3C, Marine View Villas, Brighton. Der Schriftzug war ein bisschen fleckig von Hals fettigen Fingern und dem Verpackungsmüll im Behälter.
Na, zumindest konnte er wohl kaum eine Rechnung sein. Er sah mehr aus wie eine Hochzeitseinladung – auch wenn sie das für unwahrscheinlich hielt. Ihr fiel niemand ein, der in Frage käme.
Sie schob den Daumen unter die Umschlaglasche und riss sie auf.
Es war keine Einladung. Es war ein Brief, verfasst auf schwerem, wertvollem Papier, auf dem oben der Name einer Anwaltskanzlei stand. Für einen Moment schien sich in Hals Magen ein Abgrund aufzutun, als vor ihrem inneren Auge eine ganze Landschaft furchterregender Möglichkeiten vorbeizog. Wollte jemand sie für etwas verklagen, was sie bei einer Sitzung vorausgesagt hatte? Oder ging es etwa – o Gott – um die Wohnung? Ihr Vermieter Mr Khan war schon Mitte siebzig und hatte nach und nach bereits alle anderen Wohnungen im Haus verkauft. Hals jedoch hatte er – hauptsächlich, da war sie sich sicher, aus Mitleid mit ihr und aus Zuneigung zu ihrer Mutter – bislang verschont, aber dieser Aufschub konnte nicht ewig andauern. Eines Tages würde er Geld für ein Pflegeheim brauchen oder der Diabetes würde ihn zur Strecke bringen, und dann würden seine Kinder die Wohnung verkaufen. Auch wenn die Farbe von den feuchten Wänden abblätterte und es jedes Mal, wenn man Föhn und Toaster gleichzeitig benutzen wollte, einen Kurzschluss gab – das hier war ihr Zuhause, das einzige Zuhause, das Hal je gekannt hatte. Und sollte er sie wirklich rauswerfen, standen ihre Chancen, etwas Neues zu finden, zurzeit nicht nur schlecht, sondern waren gleich null.
Oder war es … nein. Der wäre niemals zu einem Anwalt gegangen.
Ihre Finger zitterten, als sie den Brief auffaltete, doch als ihr Blick auf die Adresszeile unter der Unterschrift fiel, stellte sie erleichtert fest, dass die Kanzlei sich nicht in Brighton befand. Es handelte sich um eine Adresse in Penzance, Cornwall.
Also ging es nicht um die Wohnung – Gott sei Dank. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich, so weit entfernt, um eine verärgerte Kundin handelte, war auch verschwindend gering. Ihres Wissens kannte Hal überhaupt niemanden in Penzance.
Sie legte den Brief auf den Tisch, schob sich die Brille auf der Nase zurecht und begann zu lesen.
Sehr geehrte Miss Westaway,
dieses Schreiben erfolgt im Auftrag meiner Klientin, Ihrer Großmutter Hester Mary Westaway mit Wohnsitz Trepassen House in St. Piran.
Mit Bedauern teile ich Ihnen mit, dass Mrs Westaway am 22. November dieses Jahres zu Hause verstorben ist. Ich nehme an, dass dieser Verlust Sie unvorbereitet trifft, und möchte Ihnen auf diesem Wege mein aufrichtiges Beileid aussprechen.
Als Mrs Westaways Anwalt und Nachlassverwalter bin ich damit betraut, die Erben von den weiteren Schritten in Kenntnis zu setzen. Aufgrund des beträchtlichen Umfangs des Nachlasses wird eine gerichtliche Testamentsbestätigung erforderlich sein, im Zuge derer auch die Höhe der anfallenden Erbschaftssteuer bemessen wird. Erst nach Abschluss dieser Vorgänge kann eine Auszahlung an die Erben erfolgen. In der Zwischenzeit jedoch möchte ich Sie bitten, mir beglaubigte Kopien von zwei Dokumenten zum Nachweis Ihrer Identität und Ihrer Adresse zu übersenden (umseitig eine Liste zulässiger Urkunden und Belege), die mir erlauben, die notwendigen Formalitäten in die Wege zu leiten.
Entsprechend den Anweisungen Ihrer verstorbenen Großmutter ist es weiterhin meine Aufgabe, die Hinterbliebenen über die Beisetzung zu informieren. Diese wird am 1. Dezember um 16.00 Uhr in der Kirche von St. Piran stattfinden. Da im Ort selbst nur wenige Unterkünfte zur Verfügung stehen, sind die Familienangehörigen ausdrücklich eingeladen, in Trepassen House zu übernachten.
Falls Sie von diesem Angebot der Unterbringung Gebrauch machen möchten, informieren Sie bitte vorab die Haushälterin Ihrer Großmutter, Mrs Ada Warren, die sich um die Bereitstellung eines Zimmers kümmern wird.
Ich möchte Ihnen hiermit noch einmal meine herzliche Anteilnahme übermitteln und Ihnen außerdem versichern, dass ich in dieser Angelegenheit größte Sorgfalt und Aufmerksamkeit walten lassen werde.
Mit vorzüglicher Hochachtung,
Robert Treswick
Kanzlei Treswick, Nantes & Dean
Penzance
Hal saß wie vom Blitz getroffen da und las den kurzen Brief mehrmals durch, bevor sie sich der Liste zulässiger Identitätsnachweise zuwandte, als würde dadurch irgendetwas klarer.
Erben … beträchtlicher Nachlass … Auf einmal knurrte ihr der Magen, und sie schob sich noch ein Kartoffelstück in den Mund und kaute geistesabwesend darauf herum, während sie versuchte, in den Worten irgendeinen Sinn zu entdecken.
Denn es ergab keinen Sinn. Kein bisschen. Hals Großeltern waren schon seit über zwanzig Jahren tot.
2
Sie wusste nicht, wie lange sie so dagesessen und über den rätselhaften Brief nachgedacht hatte, während ihr Blick immer wieder von dem gefalteten Dokument zur Suchseite auf dem Bildschirm und zurück gewandert war. Doch als sie müde wieder aufblickte und sich streckte, zeigte die Anzeige auf der Mikrowelle fünf vor Mitternacht an, und ihr fiel mit Schrecken ein, dass die Gastherme die ganze Zeit an gewesen war. Sie stand auf und drehte sie aus, lauschte dem Knacken beim Abkühlen, und während sie in Gedanken weitere fünfzig Pence zur Gasrechnung auf dem Stapel addierte, fiel ihr Blick auf das gerahmte Foto auf dem Kaminsims.
Es stand dort fast schon so lange, wie sie denken konnte – zehn Jahre mindestens –, aber als sie es nun in die Hand nahm, betrachtete sie es mit ganz neuen Augen. Es zeigte ein vielleicht neun- oder zehnjähriges Mädchen und eine Frau am Strand von Brighton. Sie standen lachend nebeneinander, die Augen zusammengekniffen gegen den böigen Wind, der ihr langes dunkles Haar zu zwei identischen, albernen Hochfrisuren blies. Die Frau hatte einen Arm um das Mädchen geschlungen, und der Ausdruck der beiden war so voller Freiheit, voller Vertrautheit, dass Hals Herz sich in dem wohlbekannten Schmerz zusammenzog, an den sie sich in den letzten drei Jahren beinahe gewöhnt hatte, doch nachzulassen schien er nie.
Das Mädchen war Hal – und doch war sie es nicht. Sie war nicht dasselbe Mädchen, das jetzt vor dem Kamin stand, das Haar kurz wie ein Junge und Piercings in den Ohren, und unter dessen abgewetztem T-Shirt am Nacken Tattoos hervorlugten.
Das Mädchen auf dem Foto hatte es nicht nötig gehabt, ihre Haut mit Erinnerungen zu zieren, denn alles, was es zu erinnern galt, stand dort neben ihr. Sie trug kein Schwarz, denn sie hatte nichts zu betrauern. Sie lief nicht mit eingezogenem Kopf und hochgeklapptem Kragen nach Hause, denn sie musste sich vor nichts verstecken. Sie hatte es warm, hatte immer genug zu essen, und vor allen Dingen wurde sie geliebt.
Die Fish and Chips waren inzwischen eiskalt. Hal raffte die Reste zusammen und warf sie in den Mülleimer in der Zimmerecke. Ihr Mund war vom Salz ganz trocken geworden, ihre Kehle vor Trauer wie zugeschnürt, und der Gedanke an eine heiße Tasse Tee vor dem Zubettgehen erschien ihr auf einmal sehr verlockend. Sie würde sich einen Tee machen und mit dem Rest des heißen Wassers die Wärmflasche befüllen, die dem Bett wenigstens ein bisschen von seiner klirrenden Kälte nahm und ihr beim Einschlafen half.
Während der Wasserkocher zischte, wühlte Hal im Küchenschrank nach der Teebeutelpackung. Doch fast, als wäre es das, wonach sie unbewusst gesucht hatte, umschlossen ihre Finger plötzlich etwas anderes. Nicht den leichten Karton, sondern eine Glasflasche, noch halbvoll. Sie musste sie nicht herausziehen, um zu wissen, was darin war, doch sie tat es trotzdem, wog die Flasche in ihrer Hand, sodass die Flüssigkeit darin hin- und herschwappte. Wodka.
In letzter Zeit trank sie fast gar nicht mehr – sie mochte die Person nicht, in die sie sich dann verwandelte –, doch jetzt, als ihr Blick wieder auf die Drohbotschaften auf dem Tisch fiel, schraubte sie kurzerhand den Verschluss ab und schenkte sich einen großzügigen Schluck in die Tasse ein, die sie eigentlich für den Tee vorgesehen hatte.
Sie führte die Tasse an die Lippen, atmete den beißenden, leicht benzinartigen Geruch ein, und einen Augenblick spürte sie den Geschmack schon fast in ihrem Mund – das Brennen des Alkohols, gefolgt von diesem kurzen, süchtig machenden Kribbeln. Doch dann schien sich etwas in ihrem Magen zu sträuben, und sie kippte den Wodka in die Spüle, wusch die Tasse aus und machte sich stattdessen Tee.
Als sie mit der Tasse ins Schlafzimmer kam, stellte sie missmutig fest, dass sie die Wärmflasche vergessen hatte. Aber sie war zu erschöpft, um zurückzugehen, und immerhin hatte sie ja den warmen Tee. Hal kuschelte sich ins Bett und nippte daran, während sie auf den grellen Handybildschirm starrte.
Die Google-Bildersuche zeigte eine von Hand nachgefärbte Ansichtskarte, vermutlich aus den 1930er Jahren, auf der ein großes Herrenhaus zu sehen war. Die lange, aus sandfarbenem Stein gebaute Fassade mit Fenstern im georgianischen Stil war von Efeu bedeckt. Aus dem Schieferdach ragten Schornsteine empor, mehr als ein Dutzend, in unterschiedlichen Formen und Größen. Das Gebäude schien in einen Anbau aus rotem Backstein überzugehen, der in einem anderen Stil als das Haupthaus gebaut war. Davor erstreckte sich eine abschüssige Rasenfläche, und quer über das Bild hatte jemand gekritzelt: Vor der Weiterfahrt nach Penzance haben wir noch einen köstlichen Nachmittagstee in Trepassen House eingenommen.
Dasalsowar Trepassen House. Kein bescheidener kleiner Bungalow und auch kein viktorianisches Reihenhäuschen mit protzigem Namen. Sondern ein veritabler Landsitz.
Selbst ein noch so kleiner Anteil an diesem Haus wäre mehr als genug, um ihre Schulden zu tilgen. Er würde ihr ein wenig von der Sicherheit zurückgeben, die sie mit dem Tod ihrer Mutter verloren hatte. Schon ein paar Hundert Pfund würden ihr mehr Luft zum Atmen verschaffen, als sie seit Monaten gehabt hatte.
Die Uhr auf dem Bildschirm zeigte halb eins an, und obwohl Hal wusste, dass sie schlafen sollte, legte sie das Handy nicht weg.
Stattdessen blieb sie im Bett sitzen, suchte und scrollte weiter, und während ihre Brillengläser über dem Dampf der Tasse beschlugen, spürte sie eine seltsame Mischung an Gefühlen in sich aufsteigen, die sie mehr wärmte als der Tee.
Aufregung? Ja.
Angst auch, und nicht zu knapp.
Doch vor allem war da etwas, was sie sich seit Jahren nicht mehr gestattet hatte. Hoffnung.
3
Hal wachte am nächsten Morgen spät auf. Es war schon hell, die Sonne fiel schräg durch die Vorhänge ins Schlafzimmer, und sie blieb eine Weile liegen, spürte Euphorie und Angst zugleich und versuchte, sich daran zu erinnern, woher diese Gefühle kamen.
Die Erkenntnis traf sie wie ein doppelter Schlag in die Magengrube.
Die Angst kam von dem Stapel Rechnungen auf dem Couchtisch – und schlimmer als die Rechnungen waren die getippten, per Hand zugestellten Botschaften.
Die Euphorie aber …
Sie hatte die ganze Nacht damit verbracht, es sich auszureden. Nur weil Hester Westaway dort gelebt hatte, bedeutete das ja noch lange nicht, dass ihr dieses ganze weitläufige Anwesen gehört hatte, das auf der Ansichtskarte zu sehen gewesen war. Heutzutage hatte man doch solche Häuser gar nicht mehr. Die Tatsache, dass sie dort gestorben war, hieß nicht, dass sie die Besitzerin war. Viel wahrscheinlicher war es, dass man das Haus inzwischen zum Seniorenheim umfunktioniert hatte.
Aber die Haushälterin, flüsterte eine Stimme in ihrem Kopf. Und das mit dem Zimmer, das sie für dich bereitstellen wollen. Das würden sie in einem Seniorenheim kaum machen, oder?
»Es spielt keine Rolle«, sagte Hal laut und erschrak im selben Moment über den Klang ihrer eigenen Stimme in der stillen Wohnung.
Sie stand auf, strich sich über ihre zerknitterten Klamotten und setzte die Brille auf. Rückte sie auf der Nase zurecht und warf sich selbst im Spiegel einen strengen Blick zu.
Es spielte keine Rolle, ob Hester Westaway nun ein Zimmer, ein Gebäudeflügel, ein Häuschen auf dem Grundstück oder das gesamte Anwesen gehört hatte. Ganz offensichtlich war hier jemandem ein Irrtum unterlaufen. Das war nicht Hals Großmutter. Das Geld stand jemand anderem zu, und damit war die Sache erledigt.
Morgen würde sie Mr Treswick antworten und genau das erklären.
Heute aber … Hal warf einen Blick auf die Uhr und schüttelte den Kopf. Heute hatte sie kaum Zeit zu duschen. Es war bereits 11.20 Uhr, und sie war sehr spät dran.
Sie stand unter der Dusche, das heiße Wasser prasselte auf sie herunter, als die Stimme sich unter dem Wasserrauschen flüsternd wieder meldete.
Aber was, wenn es stimmt? Sie haben immerhin dich angeschrieben, oder nicht? Sie haben deinen Namen und deine Adresse.
Doch, es stimmte einfach nicht. Hals Großeltern mütterlicherseits, die einzigen, von denen sie wusste, waren schon vor vielen Jahren gestorben, noch vor ihrer Geburt. Außerdem hieß ihre Großmutter nicht Hester, sondern … Marion?
Vielleicht war Marion ja ihr mittlerer Name gewesen. Das machen manche Leute doch, oder? Einen Namen im Alltag benutzen, den anderen für Papierkram. Was, wenn –
Hör auf, ermahnte sich Hal. Lass es einfach. Du weißt, dass es nicht wahr ist. Du willst nur, dass es wahr ist.
Doch die Stimme in ihrem Kopf hörte nicht auf, und hauptsächlich in dem Versuch, sich selbst zu überzeugen, gab Hal schließlich nach, stellte die Dusche aus, schlang sich ein Handtuch um den Körper und ging zurück ins Schlafzimmer. Unter dem Bett stand eine schwere Holzkiste, die sie hervorzog.
In der Kiste befand sich ein Wust von offiziellen Dokumenten – Versicherungsscheine, Mietvertrag, Rechnungen, ihr Reisepass … Hal wühlte sich durch die verschiedenen Schichten wie eine Archäologin auf den Spuren ihrer eigenen Vergangenheit.
Nach der Rundfunkanmeldung und einer alten Reparaturrechnung für einen Rohrbruch ging es tiefer hinab zu einer Schicht, die nur aus Schmerz bestand – die Sterbeurkunde ihrer Mutter, die Kopie ihres Testaments, der Polizeibericht, ihre vergilbte Fahrerlaubnis. Unter alldem lag ein zum Quadrat gefalteter Schleier aus feiner schwarzer, mit Jettperlchen besetzter Gaze.
Mit zugeschnürter Kehle legte Hal ihn beiseite, um die bitteren Erinnerungen schnell hinter sich zu lassen und zu den älteren Dokumenten darunter vorzudringen – Papiere, die ihre Mutter aufbewahrt hatte, sorgfältig geordnet im Gegensatz zu Hals wildem Durcheinander. Es gab einen Umschlag mit Hals Abschlusszeugnissen, ein Programmheft für eine Theateraufführung, in der sie mitgespielt hatte, ein Foto von ihr und einem Exfreund, auf dem sie verlegen in die Kamera blickte.
Und dann endlich ein in der säuberlichen Handschrift ihrer Mutter mit »Wichtig – Geburtsurk.« gekennzeichneter Plastikordner, in dem sich zwei rot-beige, per Hand ausgefüllte Dokumente befanden, die am oberen Rand das aufwendig verzierte Wappen des Vereinigten Königreichs trugen. Beglaubigte Abschrift eines Eintrags im Geburtenregister stand auf der ersten Seite. Zuerst kam Hals Eintrag: Harriet Margarida Westaway, geboren am 15. Mai 1995, Mutter: Margarida Westaway, Beruf: Studentin.
Im Feld für »Vater« stand nichts, ein gerader Strich war hindurchgezogen worden, als sollte verhindert werden, dass jemand hier seine eigenen Annahmen ergänzte.
Und darunter, vergilbter und zerknitterter – Margarida Westaway. Ihre Mutter. Hal ließ den Blick auf die »Eltern«-Spalte gleiten – Vater: William Howard Rainer Westaway, Beruf: Buchhalter, und darunter Mutter: Marion Elizabeth Westaway, geb. Brown. Für sie war kein Beruf angegeben.
Nun, das war’s dann wohl.
Die Gewissheit versetzte ihr einen herben Dämpfer. Ihr war nicht klar gewesen, wie sehr sie sich an diesen Strohhalm geklammert hatte. Doch nun waren ihre zaghaften Träume von Schuldentilgung und finanzieller Sicherheit vor ihren Augen zerplatzt wie ein Luftballon.
Beträchtlicher Nachlass … Erben … Angehörige …
Bliebe immer noch dein Vater, flüsterte die Stimme in ihrem Ohr, während Hal sich anzog. Du hast ja noch eine andere Großmutter. Hal schüttelte verbittert den Kopf. Falls einem das eigene Unbewusste in den Rücken fallen konnte, tat Hals gerade genau das.
Als Kind hatte sie sich jahrelang in Fantasien über ihren Vater ergangen, dachte sich für die Schulkameradinnen immer ausgeklügeltere Geschichten aus, um ihre Ahnungslosigkeit und auch den Zorn auf ihre Mutter zu überspielen, die ihr nie etwas erzählen wollte. Ein Pilot sei er gewesen, der bei einem Absturz ins Meer ums Leben gekommen war. Ein verdeckter Ermittler, der von seinen Vorgesetzten gezwungen worden war, in sein wahres Leben zurückzukehren. Ein Prominenter, dessen Namen sie nicht preisgeben konnte, da die Familie sonst von der Klatschpresse gejagt und das Leben ihres Vaters ruiniert werden würde.
Als die Gerüchte schließlich auch den Lehrern zu Ohren kamen, erzählte es irgendjemand ihrer Mutter, die Hal daraufhin zur Seite nahm und ihr behutsam reinen Wein einschenkte.
Hals Vater war ein One-Night-Stand gewesen – ein Mann, den ihre Mutter in einem Club in Brighton kennengelernt hatte und mit dem sie an diesem Abend zum ersten und letzten Mal schlief. Außer, dass er einen spanischen Akzent hatte, wusste Hals Mutter nichts über ihn.
»Du wusstest noch nicht mal seinen Namen?«, hatte Hal ungläubig gefragt, worauf ihre Mutter sich auf die Lippe gebissen und den Kopf geschüttelt hatte. Ihre Wangen waren puterrot angelaufen, nie hatte Hal sie so beschämt gesehen.
Es tue ihr sehr leid, sagte sie. Sie habe nicht gewollt, dass Hal es auf diese Art erführe, aber sie müsse damit aufhören, diese … hier hatte ihre Mutter innegehalten, da sie zu freundlich war, um es auszusprechen, doch Hal war schon im Alter von sieben Jahren gut darin gewesen, das Verhalten von Menschen zu lesen, scharfsinnig genug, um zu verstehen, was ihre Mutter sich verkniffen hatte. Diese Lügen.
Die Wahrheit lautete nun einmal, ihr Vater war niemand Besonderes. Sie hatte nicht die leiseste Ahnung, wer er war und wo er jetzt lebte, und würde es vermutlich nie erfahren. Wahrscheinlich war er nach Spanien oder Mexiko zurückgegangen oder von wo auch immer er ursprünglich hergekommen war. Eines aber wusste sie mit Sicherheit – er war ganz bestimmt kein Westaway.
Das Ganze war einfach ein Irrtum. An irgendeiner Stelle war etwas durcheinandergebracht worden. Vielleicht gab es in einer anderen Stadt noch eine Harriet Westaway, der das Erbe rechtmäßig zustand. Vielleicht war es wie bei diesen Erbenermittlungsshows im Fernsehen, wo jemand ohne rechtmäßige Erben verstorben war und der ganze Nachlass verfallen würde, wenn man nicht schnell von irgendwoher noch einen entfernten Verwandten ausfindig machen konnte.
Wie auch immer, das Geld gehörte nicht ihr, und sie hatte keinen Anspruch darauf. Die Stimme in ihrem Kopf hatte dem nichts hinzuzufügen.
Eilig steckte Hal die Papiere zurück in die Kiste und schob sie unters Bett, bevor sie sich anzog. Ihre Bürste schien verschwunden, also kämmte sie sich notdürftig mit den Fingern und warf noch einen Kontrollblick in den Spiegel. Ihr Gesicht wirkte noch blasser und verkniffener als sonst, und mit ihren stachelig abstehenden Haaren sah sie aus wie ein Statist aus Oliver Twist. Make-up hätte sicher geholfen, aber das war nicht Hals Stil.
Doch als sie sich den Mantel überzog, der von der Nacht zuvor noch feucht war, meldete sich die Stimme mit einer letzten Bemerkung zu Wort. Du könntest das Geld trotzdem beanspruchen. Wenn irgendwer das durchziehen kann, dann du.
Sei still, sagte Hal innerlich und presste entnervt die Zähne zusammen. Sei. Endlich. Still.
Sie sagte es nicht, weil sie der Stimme nicht glaubte.
Sondern weil die Stimme recht hatte.
Heute ist der erste Advent. Eigentlich sollte dies eine Zeit des Neuanfangs und der Vorfreude auf ein großes Ereignis sein, aber heute Morgen beim Aufwachen war ich stattdessen von einer dumpfen Angst erfüllt.
Seit über einer Woche hatte ich die Karten nicht mehr gelegt. Ich hatte kein Bedürfnis danach, aber heute, als ich in meine Daunendecke gewickelt am Schreibtisch vor dem Fenster saß, hat es mich doch in den Fingern gejuckt, und ich dachte, dass es mir guttun würde. Doch erst, nachdem ich die Karten eine ganze Weile immer wieder neu gemischt, auf unterschiedliche Weise ausgelegt und nichts davon sich richtig angefühlt hatte, begriff ich, was ich zu tun hatte.
In meinem Zimmer gibt es keine Kerzen, also ging ich ins Esszimmer, holte einen der großen Messingkerzenständer und eine Packung Streichhölzer vom Kaminsims. Die Streichhölzer steckte ich in die Tasche, aber der Kerzenständer war zu lang, also schob ich ihn in den Ärmel meiner Strickjacke für den Fall, dass ich auf der Treppe jemandem begegnete.
Oben in meinem Zimmer arrangierte ich alles auf dem Tisch – die Karten, die Kerze, die Streichhölzer und eine leere Teetasse. Ich schmolz das Wachs am Fuß der Kerze ein wenig, um sie in der Tasse zu fixieren, dann zündete ich sie an und schwenkte das Kartendeck dreimal durch die Flamme.
Zum Schluss blies ich die Kerze aus und saß eine Weile still da, während ich aus dem Fenster auf den verschneiten Rasen schaute, die Karten in der Hand. Sie fühlten sich irgendwie anders an. Leichter. Als wären alle Zweifel und schlechten Gefühle weggebrannt. Und ich wusste, was zu tun war.
Nachdem ich die großen Arkana mit der Bildseite nach unten ausgelegt hatte, wählte ich drei Karten aus und legte sie vor mich hin. Vergangenheit. Gegenwart. Zukunft. So viele Fragen tummelten sich in meinem Kopf, doch ich versuchte, mich zu konzentrieren – nicht auf eine Frage, sondern auf die Antwort, die sich in mir entfaltete.
Dann deckte ich die Karten auf.
Die erste, die die Vergangenheit symbolisierte, war die Karte der Liebenden, richtig herum – ich musste lächeln. Auch wenn man im Tarot nicht dem Irrtum erliegen sollte, eine Karte sofort auf die naheliegendste Art zu deuten, fühlte es sich richtig an. In meinem Deck zeigt die Karte ein nacktes Paar, das sich in einem Meer aus Blumen umarmt, die Hand des Mannes liegt auf der Brust der Frau, beide sind in ein glühendes Licht von oben getaucht. Die Karte mag ich sehr – ich ziehe sie nicht nur gern, sondern sehe sie auch gern an –, obwohl man nicht nur positive Begriffe mit ihr assoziiert: Lust, Versuchung, Verwundbarkeit. Hier jedoch, vom Feuer gereinigt, sah ich nur die simpelste aller Deutungen – einen Mann und eine Frau, die sich liebten.
Die nächste Karte, die ich umdrehte, war der Narr – aber in umgekehrter Lage. Das hatte ich nicht erwartet. Neuanfänge, neues Leben, Veränderung – all das, ja. Doch umgekehrt? Naivität. Dummheit. Mangelnde Vorsicht. Ich spürte, wie das Lächeln von meinen Lippen wich, schob die Karte weg und wandte mich eilig der nächsten und wichtigsten zu – der Zukunft.
Auch diese lag verkehrt herum, und mir wurde ein bisschen mulmig, zum ersten Mal bereute ich es fast, die Lesung begonnen zu haben – oder wünschte mir jedenfalls, ich hätte es nicht jetzt, nicht heute getan. So gut, wie ich mein Deck kenne, brauchte ich die Karte nicht zu drehen, um sie zu lesen, trotzdem betrachtete ich das Bild jetzt, da es umgekehrt vor mir lag, mit frischem Blick, als sähe ich es zum ersten Mal. Die Gerechtigkeit. Die Frau auf dem Thron blickte ernst, als sei sie sich ihrer Verantwortung und der Unmöglichkeit der Wahrheitsfindung in einer Welt wie unserer zutiefst bewusst. In der linken Hand hielt sie die Waage und in der rechten ein Schwert, stets bereit, Strafe oder Gnade zuteilwerden zu lassen.
Lange habe ich die Frau auf dem Thron betrachtet und versucht, ihre Botschaft zu verstehen, doch auch jetzt noch, da ich dies schreibe, sehe ich nicht klarer. Ich hatte gehofft, das Niederschreiben würde mir helfen, die Botschaft der Karten zu begreifen, doch stattdessen kommt mir alles nur noch verworrener vor. Unehrlichkeit? Kann das sein? Oder lese ich sie falsch? Ich gehe in Gedanken all die anderen, tieferen, subtileren Bedeutungen durch: die Bereitschaft, sich täuschen zu lassen, eine Warnung vor Schwarz-Weiß-Denken, vor Trugschlüssen – und nichts davon ist besonders beruhigend.
Den ganzen Tag schon denke ich über diese letzte Karte nach – über die Zukunft. Ich wünschte, es gäbe jemanden, mit dem ich darüber sprechen könnte. Aber ich weiß ja, wie Maud über Tarot denkt. »Das ist doch alles Bullshit«, meinte sie, als ich ihr eine Lesung anbot. Schließlich gab sie doch nach, schnaubte aber verächtlich. Ich konnte ihr die Gedanken von der Stirn ablesen, als ich die von ihr gewählten Karten umdrehte und wissen wollte, auf welche Fragen sie Antworten suchte.
»Du bist doch die Hellseherin, warum sagst du’s mir nicht?«, sagte sie und schnippte die Karte mit der Fingerspitze um. Ich schüttelte den Kopf, versuchte aber, mir meinen Ärger nicht anmerken zu lassen, während ich ihr erklärte, dass Tarot kein Partyspiel ist und nichts mit den billigen Tricks in irgendeiner Samstagabendshow zu tun hat – wo x-beliebige Zauberkünstler den Leuten erzählen, wie ihr zweiter Vorname lautet oder was auf ihrer Taschenuhr eingraviert ist. Tarot ist viel größer, tiefer, wirklicher als das.
Nach dieser Lesung hatte ich das Deck gereinigt, weil es mich so aufwühlte, dass sie die Karten nicht nur berührt, sondern es mit Verachtung im Herzen getan hatte. Doch wenn ich jetzt an diesen Tag zurückdenke, wird mir etwas klar. Als Maud die Zukunftskarte umdrehte, sagte ich ihr noch etwas, woran ich mich heute Morgen hätte erinnern sollen – etwas, das mir Trost spendet. Nämlich dies: Die Karten sagen nicht die Zukunft voraus. Sie zeigen uns nur, wie eine bestimmte Situation ausgehen kann, basierend auf den Energien, die wir in die Lesung mit einbringen. An einem anderen Tag, in einer anderen Stimmung und mit anderen Energien könnte dieselbe Frage eine völlig neue Antwort zutage fördern.
Unser Wille ist frei. Die Antworten, die die Karten uns geben, können uns einen neuen Weg einschlagen lassen. Alles, was wir tun müssen, ist, ihre Botschaft zu verstehen.
4
Es war schon fast Mittag, als Hal endlich die Promenade entlangeilte, wobei sie sich gegen den scharfen Wind die Jacke zuhielt. Wie tausend kleine Messer schnitt er ihr in Gesicht und Finger und in die nackte Haut ihrer Knie, dort, wo ihre Jeans gerissen war.
Als sie den Knopf an der Fußgängerampel drückte, spürte sie es wieder, das Flattern in der Magengrube. Euphorie. Angst. Hoffnung …
Nein. Keine Hoffnung. Zur Hoffnung gab es keinen Anlass. Die Dokumente in der Holzkiste hatten ihr ein Ende gesetzt. Würde sie Anspruch auf das Geld erheben, dann wäre das … es schönzureden hatte keinen Zweck. Es wäre Betrug. Schlicht und ergreifend. Eine Straftat.
Wenn irgendwer das durchziehen kann, dann du.
Verführerisch flatterte der Gedanke durch ihren Kopf, als sie die Straße überquerte. Sie wollte ihn abschütteln, ignorieren, doch es fiel ihr schwer. Denn wenn jemand es fertigbringen könnte, in einem fremden Haus aufzukreuzen und zu behaupten, diese Frau, die sie nie getroffen hatte, sei ihre Großmutter gewesen, dann war das Hal.
Hals Spezialität war das Cold Reading, und darin war sie eine der Besten. In ihrer kleinen Bude auf dem West Pier von Brighton sagte sie die Zukunft voraus, legte Tarotkarten und führte spirituelle Sitzungen durch. Doch das Tarot lag ihr am meisten, und die Leute kamen sogar aus Hastings oder London hierher, um sich von ihr die Karten legen zu lassen, viele kamen immer wieder – und berichteten ihren Freunden zu Hause von den Geheimnissen, die Hal erraten hatte, von den Details, die sie doch gar nicht kennen konnte, und den Ereignissen, die sie prophezeit hatte.
Sie bemühte sich, diese Leute nicht für Dummköpfe zu halten – doch genau das waren sie. Nicht so sehr die Touristen, die Mädels bei einem Junggesellinnenabschied, die nur aus Spaß kamen, sodass die Brautjungfern quietschend Fragen nach der Penisgröße des Bräutigams stellen konnten. Dann kreischten sie Ah und Oh, wenn Hal ihre abgedroschenen Phrasen losließ – den Narren für den Neuanfang, die Kaiserin für Weiblichkeit und Fruchtbarkeit, den Teufel für Sexualität, die Liebenden für Leidenschaft und Bindung. Manchmal versteckte sie die für eine bestimmte Voraussage benötigte Karte in der Handfläche und schob sie dann nach vorn, um eine unerwünschte Legung zu verhindern, in der etwa nur Karten der kleinen Arkana oder bestimmte Trumpfkarten wie der Tod oder der Hierophant vorkamen. Doch eigentlich spielte es kaum eine Rolle, welche Karten herauskamen – Hal konnte die Bilder passend machen, konnte sie das sagen lassen, was die Frauen hören wollten, und nach einem kleinen Stirnrunzeln, einem Kopfschütteln hier und da, gerade genug, dass sie gespannt die Luft anhielten, tätschelte sie der zukünftigen Braut stets beruhigend die Hand und teilte ihr das Ergebnis mit (das auch beim inkompatibelsten Paar stets lautete, dass die Zukunft, und sei der Weg dahin noch so steinig, Glück und Liebe bereithielt).
Diese Leute an der Nase herumzuführen, machte Hal nichts aus. Aber die anderen. Die Stammkunden. Die, die wirklich daran glaubten, die jedes Mal mühsam die fünfzehn, zwanzig Pfund zusammenkratzten, um wieder und wieder zu kommen, auf der Suche nach Antworten, die Hal ihnen nicht geben konnte, nicht etwa, weil sie nicht ahnte, was sie hören wollten – sondern weil sie es nicht über sich brachte, sie anzulügen.
Sie waren leichte Beute. Diejenigen, die Termine machten – und dabei ihren richtigen Namen und ihre Telefonnummer angaben, sodass sie sie googeln und auf Facebook aufspüren konnte. Doch selbst diejenigen, die spontan von der Straße hereinkamen, gaben schon auf den ersten Blick so viel von sich preis – gerade Alter und Status konnte Hal meist problemlos erraten; so konnten schicke, aber abgetragene Schuhe auf einen sozialen Abstieg hindeuten oder die nagelneue Designerhandtasche auf den umgekehrten Fall. Auch im Dämmerlicht ihrer kleinen Bude erkannte Hal den weißen Abdruck eines erst vor kurzem abgelegten Eherings oder die zittrigen Hände der Frau, der ihr morgendlicher Drink fehlte.
Manchmal wurde aber auch Hal selbst erst hinterher klar, wie sie etwas erraten hatte – dann war es fast, als hätten die Karten wirklich zu ihr gesprochen.
»Ich sehe eine Enttäuschung in Ihrem Leben«, sagte sie zum Beispiel. »Hat sie vielleicht … mit einem Kind zu tun?«, und schon stiegen der Frau die Tränen in die Augen und die Geschichte sprudelte aus ihr heraus, die Geschichte einer Fehlgeburt, von einem toten Baby, von Unfruchtbarkeit. Später fragte Hal sich dann, woher wusste ich das? Und ihr fiel wieder ein, dass die Frau im Warteraum gesessen und aus dem Fenster geschaut hatte, als Hal sie hereinbat, und dass vor dem Fenster eine Frau mit Baby im Tragetuch und einem Kleinkind mit Zuckerwatte im Mund entlanggegangen war, und der schmerzerfüllte Blick der Kundin hatte Hal alles verraten.
Dann fühlte sie sich schlecht, und manchmal gab sie den Fragenden sogar das Geld zurück mit der Begründung, die Karten hätten sie gewarnt, es würde Unglück bringen, das Geld anzunehmen, auch wenn das wiederum den Eifer mancher Kunden noch verstärkte, sodass sie ganz sicher beim nächsten Mal mit mehr Geldscheinen in der Hand zurückkommen würden.
Meistens jedoch mochte Hal ihren Job. Sie mochte die lärmenden, betrunkenen Junggesellinnenabschiede. Selbst die männlichen Junggesellen, die grölend einen anzüglichen Witz nach dem anderen machten und Hal regelmäßig anboten, ihre Kristallkugeln zu befühlen. Und bei einigen ihrer fragileren Kunden hatte sie das Gefühl, ihnen auf irgendeine Weise wirklich zu helfen – sie sagte ihnen nicht nur das, was sie hören wollten, sondern auch das, was sie wirklich wissen mussten. Dass die Wahrheit nicht am Grund einer Flasche zu finden war. Dass Drogen nicht die Antwort waren. Dass es in Ordnung war, den Mann zu verlassen, der die Blutergüsse zu verantworten hatte, die unter dem Blusenkragen hervorblitzten.
Billiger als eine Therapeutin war sie allemal und dazu weniger skrupellos als manche Kollegen, die den Leuten Flyer durch die Tür schoben, auf denen sie versprachen, unheilbare Krankheiten mit Kristallen zu heilen oder mit verstorbenen Geliebten oder Kindern Kontakt aufnehmen zu können – das Ganze kostete natürlich.
Solche Versprechungen machte Hal nie. Mit dem Geschäft der Séancen, bei dem es allzu offensichtlich nur darum ging, aus der Trauer anderer Profit zu schlagen, wollte sie nichts zu tun haben.
»Die Karten sagen nicht die Zukunft voraus«, schärfte sie den Leuten unermüdlich ein, um sich einerseits gegen die Unvermeidlichkeit von Fehlprognosen abzusichern, andererseits aber auch, weil sie wissen sollten, dass es nun einmal keine eindeutigen Antworten gab. »Sie zeigen uns nur auf, wie die Dinge sich fügen könnten, ausgehend von den Energien, mit denen Sie heute in die Sitzung gekommen sind. Sehen Sie sie als Ratgeber, der helfen kann, Ihre Handlungen zu planen, nicht als Gefängnis.«
Ganz gleich, was sie sagte, die Leute mochten das Tarot, denn es gab ihnen die Illusion von Kräften, die ihr Leben lenkten, einem Puffer gegen die sinnlose Beliebigkeit des Schicksals. Doch sie mochten auch Hal, weil sie so gut in dem war, was sie tat. Sie war gut darin, aus den Bildern, die die Leute vor ihr aufdeckten, eine Geschichte zu spinnen, ihnen mit ihrem Schmerz, ihren Fragen und Hoffnungen zuzuhören, und vor allem war sie gut darin, die Menschen zu lesen.
Sie war immer schüchtern gewesen, hatte vor Fremden nie den Mund aufbekommen, sich unter ihren lärmenden Mitschülern wie ein Fisch auf dem Trockenen gefühlt, doch hatte sie in all den Jahren, in denen sie andere Leute stets aus sicherer Entfernung beobachtet hatte, unbewusst ihren kritischen Blick geschärft und jene Fertigkeiten erworben, die sie eines Tages zu ihrem Handwerk machen würde. Sie hatte den Menschen bei ihrem täglichen Rollenspiel zugesehen, die verräterischen Signale verstehen gelernt, die zeigten, ob jemand nervös war oder hoffnungsvoll oder ob er etwas zu verbergen versuchte. Sie hatte entdeckt, dass die wichtigsten Einsichten oft in dem zu finden waren, was die Leute nicht sagten, und sie lernte, die Geheimnisse zu lesen, die sie offen vor sich hertrugen; in ihrem Verhalten, ihrer Kleidung und in den Schatten, die über ihr Gesicht huschten, wenn sie sich unbeobachtet wähnten.
Anders als die meisten ihrer Kunden glaubte Hal nicht daran, dass die Karten in ihrer Tasche über irgendwelche mystischen Kräfte verfügten, die über Hals eigenes Talent hinausgingen, das aufzudecken, was die Leute sich selbst noch nicht eingestanden hatten.
Und doch: Als sie jetzt den Palace Pier passierte und der Küstenwind ihr den Geruch von Fish and Chips in die Nase trieb, der ihren leeren Magen knurren ließ, kam sie ins Grübeln. Wenn sie daran geglaubt hätte … falls sie daran geglaubt hätte … was hätten die Karten wohl über Trepassen House zu sagen … über die Frau, die nicht ihre Großmutter war … über die Entscheidung, die Hal treffen musste? Sie hatte nicht die leiseste Ahnung.
5
»Morgen, Wonnenschein!«
»Morgen, Reg«, sagte Hal. Sie schob ein Fünfzig-Pence-Stück über den Tresen. »Einen Tee, bitte.«
»Das will ich doch meinen. Saukälte heute, was? Also einmal Rosie …«, murmelte er, wobei er einen Teebeutel in eine angeschlagene Tasse fallen ließ. »Ein … Teechen … für mein Lieblingsmädel.«
Reg kam nicht aus Brighton, sondern aus London und würzte seine Sätze stets mit einer gehörigen Portion Cockney-Slang, was Hal leicht suspekt war. Er war zwar auf jeden Fall ein Cockney – zumindest war er nach eigenen Angaben in Hörweite der Glocken von St. Mary Le Bow auf die Welt gekommen und hatte als Kind die Straßen des East End unsicher gemacht. Doch sein Auftreten hatte etwas Gauklerhaftes, und Hal hatte den Verdacht, dass er seine Rolle vor allem für die Touristen spielte. Ein Cockney-Kumpel zum Pferdestehlen.
Jetzt blickte er auf den Heißwasserspender und runzelte die Stirn.
»Das Teil hat wieder den Geist aufgegeben. Muss ein Wackelkontakt sein. Hast du noch zehn Minuten, Hal?«
»Eigentlich nicht …« Hal blickte auf die Uhr. »Ich hätte schon um zwölf aufmachen müssen.«
»Ach, mach dir keine Sorgen. Ist noch niemand vorbeigekommen, hätt ich ja gesehen. Und Chalky wird dir auch keinen Stress machen, der ist noch gar nicht da. Komm rein und setz dich.«
Er öffnete die Tür und bat Hal in seine Bude. Nach kurzem Zögern trat sie über die Schwelle.
Chalky war Regs Spitzname für Mr White, den Manager des West Pier. Hal war zwar selbstständig und konnte sich ihre Arbeitszeit weitgehend selbst einteilen, doch Mr White sah es gern, wenn die Buden und Stände schon am Vormittag öffneten. Nichts ist so deprimierend wie ein Pier voller heruntergelassener Rollläden, pflegte er zu sagen. Schließlich musste sich der West Pier ohnehin immer etwas mehr anstrengen als sein großer Bruder, der Palace Pier, um die Vergnügungssüchtigen auf die Promenade zu locken, und wenn die Einnahmen sanken, wie sie es im Winter immer taten, war Mr White geneigt, die Pachtbedingungen der leistungsschwächeren Stände neu zu überdenken. Und wenn es eine Sache gab, die Hal sich im Moment nicht erlauben konnte, dann war es, ihre Bude auf dem Pier zu verlieren.
In Regs Imbiss war es warm und vom Grill in der Ecke strömte ein starker Speckgeruch herüber. Regs Warenbestand umfasste in den Wintermonaten Speckbrötchen und Tee, im Sommer Softeis und Cola in Dosen.
»Wird nicht lang dauern«, sagte Reg. »Wie geht’s dir denn, mein Mädel?«
»Ganz gut«, sagte Hal, auch wenn das nicht stimmte. Der Gedanke an die zwei maschinengeschriebenen Zettel auf ihrem Couchtisch bescherte ihr ein flaues Gefühl in der Magengegend, und sie fürchtete fast, beim Aufschließen ihrer Bude einen weiteren vorzufinden. Wenn doch nur … Wäre Mr Treswicks Brief doch nur wirklich für sie bestimmt gewesen.
Der Wasserspender hatte inzwischen Betriebstemperatur erreicht, und Hal sah zu, wie Reg virtuos mit einer Hand Zapfhahn und Kaffeebecher zusammenbrachte, während er mit der anderen Hand auf dem Grill die Scheibe Speck wendete. Irgendwie war es leichter, nur seinen Hinterkopf anzusprechen und nicht sein Gesicht. So musste sie seinen sorgenvollen Blick nicht sehen.
»Na ja, eigentlich …«, fing sie an, zögerte einen Moment und zwang sich dann weiterzusprechen. Doch die Worte überraschten sie selbst. »Eigentlich geht es mir sogar besser als ganz gut. Ich habe gestern einen Brief bekommen und erfahren, dass ich vielleicht ein ungeahntes Vermögen erbe.«
»Dass du was?« Reg drehte sich um, den Becher in der Hand, blankes Staunen im Gesicht. »Was hast du gesagt?«
»Dass ich gestern einen Brief bekommen habe. Von einem Anwalt. In dem stand, dass mir ein ›beträchtlicher Nachlass‹ zusteht.«
»Machst du Witze?«, sagte Reg, die Augenbrauen fast bis zu seinem nicht existenten Haaransatz hochgezogen. Hal schüttelte den Kopf, und als Reg begriff, dass sie es ernst meinte, schüttelte er ebenfalls den Kopf und reichte ihr den Tee.
»Sei vorsichtig, Mädel. Hier treiben viele Betrüger ihr Unwesen. Meine Holde hat neulich auch so einen Brief bekommen, in dem stand, dass sie im venezolanischen Lotto gewonnen hatte oder so ’n Quatsch. Gib denen bloß kein Geld. Nicht, dass ich dir das sagen müsste.« Er zwinkerte ihr zu. »Dir bindet keiner ’nen Koala auf.«
»Ich glaube nicht, dass es eine Masche ist«, sagte Hal wahrheitsgemäß. »Eher ein Irrtum. Die müssen mich mit jemandem verwechselt haben.« Sie nippte an ihrem Tee. Er war brühheiß und bitter, aber er tat gut. Allmählich verzog sich der schaurig-kalte Gedanke an die Drohbriefe auf dem Couchtisch und machte für einen kurzen Moment einer tief vergrabenen Erinnerung Platz – der Erinnerung an das Gefühl, morgens ohne Sorgen über unbezahlte Rechnungen aufzuwachen, ohne darüber nachdenken zu müssen, wie sie die nächste Miete aufbringen sollte, ohne Angst vor dem Klopfen an der Tür. Gott, was würde sie darum geben, dieses Gefühl wiederzubekommen …
Sie merkte, wie etwas sich in ihr verhärtete und eine eiserne Entschlossenheit Besitz von ihr ergriff.
»Na«, sagte Reg schließlich, »wenn irgendwer ’ne Chance verdient hat, dann du, Mädel. Nimm das Geld, das sie dir anbieten, und mach, dass du wegkommst, das wäre mein Rat. Kassier die Kohle und ab durch die Mitte.«
6
»Auf Wiedersehen«, rief Hal den drei beschwipsten jungen Frauen nach, die kreischend und lachend aus der Tür und auf den Pier in Richtung der Bars und Clubs torkelten. »Möge das Schicksal euch gewogen sein«, fügte sie noch hinzu, wie sie es immer tat, doch da waren sie schon außer Hörweite. Hal blickte auf die Uhr, es war schon neun, bald würde der Pier schließen.
Sie war müde, genau genommen völlig erschöpft, und eigentlich hatte sie ein paar Stunden zuvor, als die Zeit nicht vergehen wollte und sich über Stunden keine Besucher auf dem Pier hatten blicken lassen, schon mit dem Gedanken gespielt, aufzugeben, die Leuchtreklame auszuschalten und nach Hause zu gehen. Doch am Ende war sie froh, dass sie geblieben war. Nach einem ganzen Tag fast ohne Kundschaft hatte es gegen 19 Uhr plötzlich einen kleinen Andrang gegeben – zwei Arbeitskolleginnen wollten wissen, was sie gegen die Schikanen ihres Chefs unternehmen könnten, und um acht Uhr folgten die drei jungen Frauen, die einfach ein bisschen Spaß haben wollten. Viel eingenommen hatte sie nicht, doch mit etwas Glück würde es reichen, um die Pachtgebühr für diese Woche zu bezahlen, was in der Nebensaison gar nicht so selbstverständlich war.
Seufzend knipste sie den kleinen Heizlüfter am Boden aus und stand auf, um das Leuchtschild draußen ebenfalls auszuschalten.
Madame Margarida stand darauf in geschnörkelten Buchstaben, und obwohl es eigentlich nicht zu Hal passte, weil man dabei viel eher an jemanden wie Gypsy Rose Lee dachte, hatte sie es bislang nicht über sich gebracht, es auszutauschen.
Spezialistin für TAROT, Wahrsagekunst und Handlesen, stand in kleineren Buchstaben darunter, obwohl das Handlesen Hal eigentlich nicht lag. Vielleicht hatte das mit dem Körperkontakt zu tun, den feuchten fremden Handflächen. Oder mit den fehlenden Requisiten; aller Skepsis zum Trotz mochte sie nämlich die Tarotkarten als physische Objekte sehr – die schönen, liebevoll detailreichen Zeichnungen.
Doch plötzlich, gerade als das Leuchtschild mit einem Klick erlosch, hörte sie ein Pochen an der Scheibe. Sie zuckte zusammen und hielt den Atem an.
»Ich warte schon länger«, ertönte eine einschüchternde Frauenstimme. »Wollen Sie keine Kundschaft?«
Hal spürte, wie ihre Anspannung abflaute, und öffnete seufzend die Tür.
»Verzeihung«, sagte sie in dem ruhigen, professionellen Ton, der sich stets einstellte, wenn sie die Karten in die Hand nahm und in ihre Rolle schlüpfte. Er war etwas tiefer als ihre normale Stimme und drückte genau die richtige Mischung aus Gelassenheit und Ernsthaftigkeit aus, auch wenn es ihr in diesem Moment schwerer fiel, da ihr Herz nach dem plötzlichen Schreck immer noch etwas zu schnell pochte. »Sie hätten gleich klopfen sollen.«
»’ne echte Hellseherin hätte das ja wohl gewusst«, sagte die Frau höhnisch triumphierend, und Hal musste ein weiteres Seufzen unterdrücken. Eine von denen also.
Hal wunderte sich immer wieder, warum ausgerechnet die Skeptiker sich von ihrer Bude so angezogen fühlten. Dabei zwang sie ja niemanden, zu ihr zu kommen. Sie versprach keinem das Blaue vom Himmel. Gab es da nicht wichtigere Leute zu entlarven? Trotzdem kamen sie zu ihr, mit verschränkten Armen und geschürzten Lippen, ließen sich nicht führen und grinsten schadenfroh über jeden kleinen Fehler, obwohl sie doch eigentlich so verzweifelt daran glauben wollten.
Doch sie konnte es sich nicht leisten, eine Kundin fortzuschicken.
»Bitte kommen Sie und setzen Sie sich, es ist kalt heute Abend«, sagte Hal. Die Frau nahm sich einen Stuhl, sagte aber nichts. Sie saß nur da, den bestickten Mantel fest um ihren Körper geschlungen, die rissigen Lippen zusammengepresst, die Augen zu Schlitzen verengt.
Hal setzte sich an den Tisch, zog die Schachtel mit den Tarotkarten hervor und begann mit ihrer altbewährten Einleitung für Neukunden und Laufkundschaft; ein paar dahingeworfene Mutmaßungen, um das Gegenüber mit ihren Kenntnissen zu beeindrucken, eine Prise Wichtigtuerei, das Ganze verwoben mit einem kurzen Abriss der Geschichte des Tarot.
Schon nach wenigen Sätzen wurde sie von der Frau unterbrochen.
»Wie eine Hellseherin sehen Sie nicht gerade aus.«
Dabei musterte sie Hal von oben bis unten, registrierte die abgewetzten Jeans, den dicken dornenförmigen Ohrstecker im rechten Ohr, die Tattoos, die unter ihrem T-Shirt hervorlugten.
»Ich hatte Sie mir in einem langen Kleid vorgestellt und mit so einem Schleier. Wie eine Wahrsagerin eben. Vorne auf dem Schild steht doch ›Madame Margarida‹ – wie eine Madame sehen Sie überhaupt nicht aus. Eher wie ein zwölfjähriger Junge.«
Hal schüttelte nur lächelnd den Kopf, doch die Unterbrechung hatte sie aus dem Konzept gebracht, und als sie ihren Vortrag fortsetzte, musste sie unwillkürlich an den Schleier in der Kiste unter dem Bett denken, die feine schwarze Gaze mit den Jettperlchen am Saum. Plötzlich stolperte sie über die abgegriffenen Phrasen und war froh, als sie zum Ende kam.
Wie immer schloss sie ihren Vortrag mit der Frage: »Also dann, sagen Sie mir doch bitte, was Sie heute zu den Karten geführt hat.«
»Sollten Sie das nicht wissen?«
»Ich spüre eine ganze Menge Fragen in Ihnen«, sagte Hal und bemühte sich, nicht zu ungeduldig zu klingen. »Aber viel Zeit haben wir heute nicht.«
Außerdem will ich nach Hause, dachte sie. Beide schwiegen einen Moment. Der Wind heulte durch die Streben des Piers, und in der Ferne war das Krachen der Wellen zu hören.
»Ich stehe vor einer Entscheidung«, sagte die Frau schließlich, fast widerwillig, als müsste sie sich die Worte mühsam abringen. Unbehaglich rutschte sie auf dem Stuhl hin und her. Die Kerze flackerte.
»Ja«, sagte Hal bedächtig, es sollte keine Frage sein. »Ich spüre, dass Sie an einem Scheideweg stehen, doch die beiden Wege vor Ihnen sind so verschlungen und gewunden, dass Sie ihren Verlauf nicht sehen können. Sie möchten wissen, welchen Weg Sie einschlagen sollen.«
Mit anderen Worten: Sie musste eine Entscheidung treffen. Nicht gerade sehr tiefgründig, aber gemessen daran, wie wenig Material sie zur Verfügung hatte, war mehr nicht drin. Immerhin nickte die Frau grimmig.
»Ich werde jetzt die Karten mischen«, sagte Hal und öffnete die Lackschatulle, in der sie ihr Arbeitsdeck aufbewahrte. Sie mischte die Karten kurz, bevor sie sie in einem langen Bogen auf dem Tisch ausbreitete. »Jetzt rufen Sie sich die Frage ins Gedächtnis, mit der Sie heute zu mir gekommen sind, und deuten Sie auf eine Karte. Berühren Sie sie nicht, sondern zeigen Sie einfach mit dem Finger auf die Karte, die zu Ihnen spricht.«
Der Kiefer der Frau war angespannt, und Hal spürte, dass sie zutiefst aufgewühlt war. Was auch immer sie heute Abend hierhergeführt hatte, es war keine gewöhnliche Frage; sie war gegen ihren Willen gekommen, hatte sich auf etwas eingelassen, woran sie eigentlich nicht glaubte. Unter ihrer zugeknöpften Strickjacke blitzte ein Kreuz auf, als sie sich vorbeugte und ruckartig auf eine Karte deutete, so als vermutete sie eine Falle.
»Die hier?«, sagte Hal, schob die Karte heraus, und die Frau nickte.
Mit dem Bild nach unten legte Hal die Karte in die Mitte des Tischs und warf einen unauffälligen Blick auf die Uhr hinter der Frau. Normalerweise würde sie das Keltische Kreuz legen, aber sie hatte keine Lust, noch eine halbe Stunde länger hier zu sitzen, dafür war ihr zu kalt, außerdem war sie müde und ihr Magen knurrte. Ein Drei-Karten-Orakel war das Äußerste, wozu sie noch imstande war.
»Diese Karte …«, Hal berührte die Karte, die die Frau gewählt hatte, »… steht für die gegenwärtige Situation, das Problem, mit dem Sie heute zu mir gekommen sind. Nun wählen Sie eine weitere.«
Die Frau schnipste mit dem Finger gegen eine andere Karte, die Hal ebenfalls mit dem Gesicht nach unten neben der ersten platzierte.
»Diese Karte repräsentiert das Hindernis, dem Sie sich gegenübersehen. Nun wählen Sie eine letzte.«
Nach kurzem Zögern zeigte die Frau auf die oberste Karte im Deck, am äußersten linken Rand. Das kam nur selten vor, denn normalerweise wählten die Leute eine der mittleren und ihnen am nächsten liegenden in einer gleichmäßigen Legung, während eine kleine Minderheit, die besonders leicht Beeinflussbaren, der im Wort letzte implizit enthaltenen Aufforderung folgten und eine Karte von ganz rechts, von der Unterseite des ursprünglichen Decks wählten.
Die erste Karte war eine ungewöhnliche Wahl, und Hal war überrascht. Ich hätte es wissen müssen, dachte sie. Sie hatte hier eine eigensinnige und widerspenstige Person vor sich, eine, die mit Absicht das Gegenteil von dem tat, von dem sie glaubte, dass man es wollte.
»Diese letzte Karte steht für den Ratschlag, den die Karten Ihnen geben«, sagte Hal.
Als Hal die Karte umdrehte, hörte sie von der anderen Seite des Tisches ein erschrockenes Aufkeuchen, und die Frau schlug sich die Hand vor den Mund, aus dem erstickt ein Name entwich. Die Augen der Frau waren geweitet, ihr Blick gequält und tränenerfüllt, und in diesem Moment wusste Hal Bescheid. Sie wusste, warum die Frau hier war, und sie wusste, was das Bild auf der Karte für die Frau, die ihr gegenübersaß, bedeutete.
Der gutaussehende junge Mann, der mit seinem Bündel Sachen aufbrach, lachte der Sonne entgegen, und nur der Abgrund zu seinen Füßen gab einen Hinweis auf die tiefere, dunkle Bedeutung dieser Karte – Unbesonnenheit, Naivität, Impulsivität.
»Diese Karte heißt Der Narr