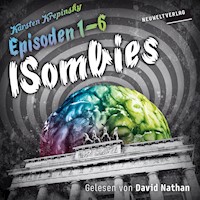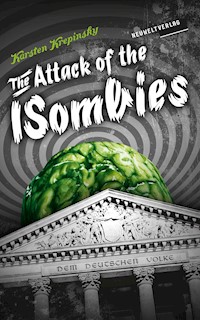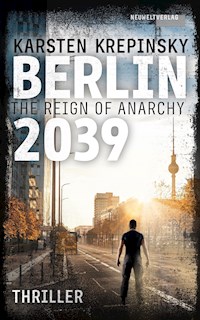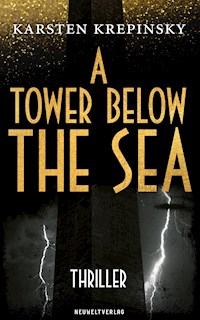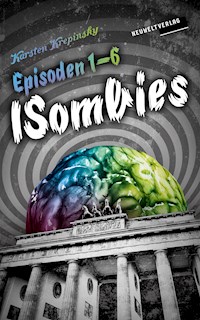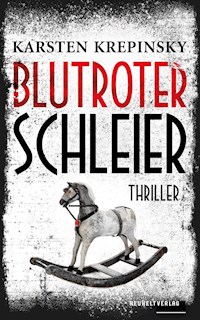2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Berlin 2039 Eine Novelle aus dem Zeitalter der Anarchie. Die Einwohnerzahl hat sich in den letzten zwanzig Jahren verdoppelt. Eine Hölle aus Armut, Verbrechen und Überbevölkerung. Wer es sich leisten kann, lebt in den gut geschützten Gated Communities. Ganze Stadtteile sind von der Polizei längst aufgegeben worden. In diesen gesetzlosen Bezirken werden Pusher eingesetzt, die Gewalt und Unfrieden zwischen den arabischen Clans, türkischen Gangs und tschetschenischen Banden stiften sollen. Jenseits der Legalität sind diese Einzelkämpfer nur ihrem Supervisor vom LKA Rechenschaft schuldig. Dies ist die Geschichte von Pusher Hauke und Supervisor Natasha ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
KARSTEN KREPINSKY
Der Tod nimmt alle mit – Berlin 2039
Zum Buch
Berlin 2039. Die Einwohnerzahl hat sich in den letzten zwanzig Jahren verdoppelt. Eine Hölle aus Armut, Verbrechen und Überbevölkerung. Wer es sich leisten kann, lebt in den gut geschützten Gated Communities. Ganze Stadtteile sind von der Polizei längst aufgegeben worden. In diesen gesetzlosen Bezirken werden Pusher eingesetzt, die Gewalt und Unfrieden zwischen den arabischen Clans, türkischen Gangs und tschetschenischen Banden stiften sollen. Jenseits der Legalität sind diese Einzelkämpfer nur ihrem Supervisor vom Landeskriminalamt Rechenschaft schuldig. Dies ist die Geschichte von Pusher Hauke und Hauptkommissarin Natasha …
IMPRESSUM
KARSTEN KREPINSKY
Der Tod nimmt alle mit – Berlin 2039
(c) 2016 Dr. Karsten Krepinsky
Originalausgabe, August 2016
Alle Rechte vorbehalten
Nachdruck und Vervielfältigung aller Art (auch in Auszügen) nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors
Umschlaggestaltung: Projekt IPK
Veröffentlicht von Dr. Karsten Krepinsky, Berlin
www.nichtdiewelt.de
Für die Freiheit des Geistes
»Wir werden nicht zulassen, dass sich dieses Gesocks weiter wie ein Krebsgeschwür durch Berlin frisst. Ich habe daher die sofortige Abriegelung der verlorenen Stadtgebiete angeordnet …«
Aus der Erklärung des Bundeskanzlers Vasily Schmidt zu den Notstandsgesetzen vom 23. August 2036.
3 Jahre später ...
Prolog
Die Kappe des Toten ist heruntergefallen, der weiße Kaftan blutverschmiert. Zusammengesunken auf einem Stuhl, liegt der Kopf des Erschlagenen auf dem Küchentisch in einer Blutlache. Der Schädel ist zertrümmert, und das Blut sickert aus einer tiefen Wunde heraus. Im Vollbart kleben die Essensreste seines letzten Mahls. Der Mörder wischt den Totschläger am Gewand seines Opfers ab, küsst das Holzkreuz, das er an einem Lederband um den Hals hängen hat, und zieht sich die Kapuze seiner Kutte tiefer ins Gesicht. Eine Erscheinung in zerschundener, erbärmlicher Kleidung. Grau in grau, gewälzt im Schmutz der Straße. Das Gesicht im Halbschatten der Kapuze verborgen, zieht er eine Pokerkarte aus einem Stoffbeutel, den er an einer Kordel befestigt hat, und klemmt sie dem Ermordeten zwischen Zeige- und Mittelfinger. Er setzt sich zu ihm an den Tisch, zieht den Suppenteller zu sich herüber, bricht sich etwas vom Fladenbrot ab, tunkt es in die Suppe ein und isst es. Schlieren von Blut, das aus den geplatzten Adern des Opfers gespritzt ist, vermengen sich mit der Fleischbrühe. Der Mörder nimmt sich das Glas mit schwarzem Tee, trinkt ihn, steht auf, stellt Teller und Glas in die Spüle, verschließt den Ausguss mit dem Stöpsel und dreht das Wasser auf. Dann sieht er ein letztes Mal zum toten Salafisten hinüber, nickt stumm, als begliche er mit der Tat eine Rechnung, und schaltet beim Verlassen der Küche das Licht aus.
1
Die Lemons nennen die Deutschen Kartoffeln oder auch Juden, wenn sie nicht gut gelaunt sind. Und das sind sie fast immer. Vor allem in letzter Zeit, seit F’hain umzäunt ist und Checkpoints ihnen den Zugang zu den Vierteln mit den gut betuchten Bürgern Berlins versperren. Betonpoller und Soldaten mit Sturmgewehren, MG-Nester, geschützt durch Sandsackwälle. Das ist auch für ein testosterongesteuertes Ghettokind ein Hindernis. Die Sperren und Kontrollen erinnern ein wenig ans Heilige Land, wenn ihr wisst, was ich meine. An manchen Stellen wird der Zaun auch schon durch eine Mauer ersetzt. Soll anscheinend etwas für die Ewigkeit werden. Leicht kommt man nicht mehr aus F’hain heraus. Unerreichbar sind für die meisten die Hochhäuser am Alex, die schicken Einkaufszentren am Potsdamer Platz oder die teuren Boutiquen in der Friedrichstraße. Die Zeiten werden nicht besser. Manchmal sehe ich die armen Hunde am Fenster stehen. Ihr kennt sie, die Loser dieser Welt. Mit ihren Träumen von Glück und Wohlstand. Die am Abend, wenn sie sich nicht mehr auf die Straße trauen wegen all der Gewalt, an den undichten Fenstern ihrer Bruchbuden stehen, ihre fahlen Gesichter gegen die Scheiben drücken und sehnsüchtig in die Ferne blicken. Sie atmen dieselbe Luft wie die Globals am Alexanderplatz, sehen zum selben Himmel auf. Doch das Schicksal hat sie auf die falsche Seite gesetzt. Einmal Ghetto, immer Ghetto.
Eine Mauer gab es schon einmal in Berlin – ist schon fünfzig Jahre her. Fast zehn Jahre vor meiner Geburt. Heute denkt niemand mehr daran, denn Bildung ist im Ghetto bedeutungslos. Das einzige geschriebene Wort, das auf den Straßen Gewicht hat, ist der Koran. In weiten Teilen F’hains gilt die Scharia, das Gesetz des Islam. Oder zumindest das, was der Imam dafür hält. Der Koran ist interpretationsfreudig, meine Freunde, das kann ich euch sagen. Selbst die Lemons sind sich da nicht einig. Ohnehin sind sie kein einheitlicher Block, wie sich das die Bonzen am Wannsee immer so vorstellen. Im Gegenteil: Die Türken hassen die Araber, die Kurden hassen die Türken. Alle hassen die Tschetschenen. Und die Araber? Wen interessiert schon, wen die Araber hassen. Woher der Ausdruck Lemon für Moslems stammt, weiß ich außerdem ebenso wenig wie ihr. Vielleicht weil sie immer so griesgrämig dreinschauen, als hätten sie in eine Zitrone gebissen. Versteht mich nicht falsch. Ich mache da keinen Unterschied zwischen den Deutschen und den Lemons. Ich sehe ja auch nicht wie ein Arier aus. Eine Ex-Freundin von mir hat mal gesagt, ich wäre wie ein Universalausländer. Typus Südländer, passend vom Türken bis zum Araber, zumindest den Hellhäutigen unter ihnen. Wahrscheinlich habe ich deshalb auch diesen Job bekommen. Weil ich mit meinen dunklen Haaren und der orientalischen Physiognomie ein bisschen aussehe wie ein Lemon.
Ich will nicht verhehlen, dass ich möglicherweise eine Spur Judenblut in mir habe.Irgendwoher muss der südländische Einschlag ja kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ururgroßmutter dem Charme eines italienischen Wanderarbeiters erlegen war, der Anfang des neunzehnten Jahrhunderts Eisenbahngleise in Deutschland verlegt hat, bleibt eine Wunschvorstellung. Ihr kennt die romantischen Geschichten über die eigene Herkunft. Träume der kleinen Leute, die Müller für ’nen adligen Namen halten. Nein, im Ernst. Es ist bestimmt ’n semitischer Einschlag. Schnödes Judenblut, das in meinen Adern fließt. Aber blaue Augen habe ich schon. Darauf lege ich Wert. Und ganz ohne farbige Kontaktlinsen zu tragen, wie es die Lemons jetzt so häufig tun. Ein paar dieser Komiker färben sich die Haare sogar blond. Hoffen wohl, dass sie dann Karriere machen können. Aber das Ghetto streift man nicht so schnell ab.
Jedenfalls bin ich kein Anhänger von Religionen, müsst ihr wissen. Opium fürs Volk ist das für mich. Und mit der Meinung stehe ich weiß Gott nicht allein da. Das Dope aber, das hab’ ich selbst. Ich arbeite als Pusher für das LKA. Bin für die balance of power im Viertel zuständig. Das Gleichgewicht der Kräfte zwischen den Paten. Dass sich diejenigen, die den Ton angeben, weiterhin bekriegen: der Zar, der Imam, der Babo und der Kaiser. Wird einer zu stark, muss er kleiner gemacht werden, damit die Gewalt nicht aus dem Ghetto herauswächst. Denn der Abschaum soll sich schließlich gegenseitig bekriegen. Das LKA möchte sich die Finger nicht selbst schmutzig machen und setzt deshalb uns Drogendealer ein. Inoffiziell natürlich. Wird ein Pate zu mächtig, haben wir die Aufgabe, durch gezielte Schenkungen die Konkurrenz zu stärken. Wie ihr euch vorstellen könnt, sind Pusher nicht gerade beliebt. Natürlich bleibt es einem Imam nicht verborgen, wenn wir die Konkurrenz beliefern. Aber ihr glaubt gar nicht, wie gut dieses System letztlich dennoch funktioniert. Die Unterweltgrößen sind wie Politiker: Und auch bei denen werden Loyalitäten täglich neu ausgelotet. Ein kostenloser Koffer mit Dope als Freundschaftsangebot heilt so manch aufgerissene Wunde.
Übrigens: Mein Name ist Hauke. Die Nonne im katholischen Waisenhaus, die mich großgezogen hat, fand den Schimmelreiter so toll. Vielleicht kennt ihr die Geschichte um diesen verrückten Deichgrafen ja. Und woher komme ich? Ist das wichtig? Aus ’ner Babyklappe im Urban-Krankenhaus behaupte ich immer. Anonym abgegeben. Herkunft unbekannt. Wahrscheinlich kein Adliger. Und mit Sicherheit nicht Jesus. Wenn ihr mich seht, würdet ihr sicherlich nicht denken, hey, das ist der härteste Bursche in der Hood. Eher im Gegenteil. Gut rasiert und wohlgepflegt, trage ich einen schwarzen Anzug und hab’ des seriösen Eindrucks wegen sogar immer einen Aktenkoffer dabei. Prall gefüllt mit Dope, versteht sich, und im Geheimfach die Uzi zur Verteidigung darf natürlich auch nicht fehlen. Neben der Maschinenpistole trage ich in einem Schulterholster noch eine Glock 17 mit mir herum. Eine der besten Handfeuerwaffen, die ich kenne. Zuverlässig und präzise. 19 Schuss. Eine Spezialität von mir ist, dass im Magazin ein Gummigeschoss oben aufliegt. Darunter befindet sich eine gewöhnliche 9-mm-Patrone, gefolgt von einem Dum-Dum-Geschoss, das beim Aufprall zersplittert und den Körper geradezu aufreißt. Ich nenne das die drei Stufen der Eskalation: Stufe 1 als Warnung, Stufe 2 als unerfreuliche Maßregelung und Stufe 3? Game over Player One. Garantiert keine schöne Sache. Ich bin jetzt aber kein Waffennarr oder so ein Armee-Typ, der seinem Gewehr ’nen Namen gibt. Auch kein Schläger. Meine Nase war noch nie gebrochen. Das ist eine Leistung, kann ich euch sagen.
Die Dinge werden nicht besser. Nicht im Ghetto. Mit Anfang vierzig sieht man alles klarer und macht sich keine Illusionen mehr. Neulich hat mich so ein kleiner Knirps bedroht. Vielleicht acht Jahre oder so. Hielt mir ein Messer in den Schritt und wollte mein Geld haben. Ich sagte ihm, ich hätte nur Dope. Mit fünf Units Koks gab er sich dann zufrieden. Was soll man dazu sagen? Es fällt jedenfalls schwer, seinen Prinzipien treu zu bleiben. Menschlichkeit und so. Zumindest bin ich einer der wenigen Pusher geblieben, die ihren Stoff nicht selbst konsumieren. Gut, ich werfe Psychopharmaka ein – doch das ist ärztlich verordnet. Darauf lege ich Wert. Zudem verzichte ich seit einiger Zeit auf diese Pillen, um wieder ich selbst zu sein. Was das für ein Zeug ist, das ich mir einschmeiße? Ich denke, das geht euch nichts an. So gut kennen wir uns ja noch nicht. Aber hey, das kann ja noch werden. Verfolgt meinen Weg nun oder lasst es bleiben. Mir ist es gleich. Aber eins verspreche ich euch: Ich werde euch nicht belügen. Darauf könnt ihr euch verlassen.
2
Natasha hat sich am Mobile ziemlich beunruhigt angehört. Hab’ ich euch schon von ihr erzählt? Sie ist mein Supervisor beim Landeskriminalamt. Sie stimmt mit mir die Aufträge ab, besorgt mir das Dope und geht die aktuellen Entwicklungen durch. Das LKA hat jetzt sein Büro an der anderen Uferseite. In X’berg. Dort, wo früher das Watergate stand, wenn den Club noch jemand kennt. Elektronische Musik auf zwei Floors, direkt an der Oberbaumbrücke. Eine Ewigkeit ist das her. Vielleicht beobachten die Ermittler des LKA vom neu gebauten gläsernen Hochhaus aus das Ghetto, belauschen mit den Antennen auf dem Dach die Gespräche der Junkies, verfolgen das Schicksal all der Loser in den Straßen oder registrieren gelangweilt den ewigen Streit der ultraorthodoxen Moslems untereinander.
Natasha. Sie ist anders. Etwas Besonderes, das habe ich gleich gespürt. Nicht eine dieser Beauties, die nur gut aussehen. Sie hat dazu noch Köpfchen. Und Charakter. Einfach eine Klassefrau. Gut erzogen ist sie, aus besserem Hause, denke ich. Ich habe sie aber nie danach gefragt. Es ist von Vorteil, wenn man manche Dinge nicht weiß, sondern seiner Fantasie überlässt. Verheiratet ist sie jedenfalls nicht. Oder sie trägt keinen Ehering, wenn sie ins Ghetto fährt. Ab und zu mal hat sie ’nen Freund, hab’ ich bei ihr herausgehört. Nichts Festes.
Ich fahre gerade mit meinem Lincoln Continental über die Frankfurter Allee. Das ist so ein alter Ami-Schlitten, müsst ihr wissen, der mehr als zwanzig Liter auf hundert Kilometer schluckt. Verdammt viel Benzin, werdet ihr jetzt sagen. Who the fuck cares? Wer fährt schon so weit in F’hain? So groß ist das Ghetto schließlich nicht. Es geht einzig und allein darum zu zeigen, wer man ist.
Das RAW-Gelände, wo Natasha mich treffen will, liegt an der Warschauer Straße. Seit letztem Jahr wird die Allee mit den verdorrten Platanen nur noch Warsaw genannt, in Anlehnung an die Ereignisse im Herbst, als ein Tschetschene einen der Biker mit der Kettensäge in zwei Hälften geteilt hat. Eine schlimme Sache – selbst im Ghetto. Das Blut auf dem Asphalt hatten sie mit Sägespäne abgedeckt. Eine Woche lang, bis zum nächsten Regen, konnte man die Spuren der Gewalt sehen. Eigentlich machen Tschetschenen sonst keine halben Sachen – entschuldigt den Wortwitz –, ihre Spezialität ist für gewöhnlich das Häuten ihrer Opfer. Eine Angewohnheit, mitgebracht aus dem Afghanistankrieg in den Achtzigern, den Opa-Tschetschene noch an der Seite der Roten Armee gegen die Mudschahedin gefochten hatte. Als es die Sowjetunion noch gab. Verdammt. Kennt dieses merkwürdige Staatenkonstrukt noch jemand? Wahrscheinlich nur die Kommunisten unter euch. Geschichtsbewusstsein ist für mich jedenfalls wichtig, wie ihr merkt.