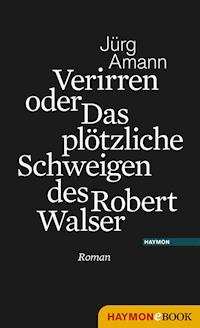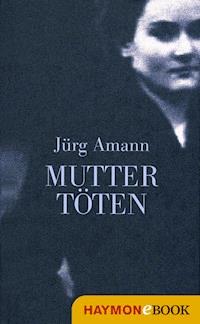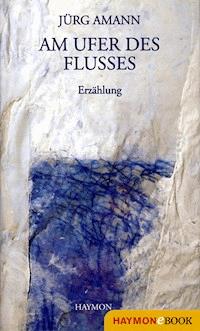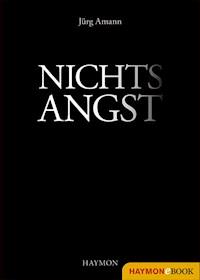Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Die Theaterstücke von Jürg Amann versammelt in einem Band. Das dramatische Gesamtwerk des früh verstorbenen Schweizer Autors Der Tod stirbt - unter diesem programmatischen Titel versammeln sich chronologisch und in Überarbeitung letzter Hand Jürg Amanns sämtliche Theaterstücke. Sie gehören einer scheinbar vergangenen Zeit an, in der ein Theaterstück stets und zuallererst auch ein Stück Literatur war, ein Drama - Komödie oder Tragödie - immer auch ein Lesedrama. Der Mensch und sein Leben im Bühnenmittelpunkt Der Tod und die Liebe - diese großen Themen des Lebens waren es, die das vielseitige literarische Schaffen des Schweizer Autors bestimmten. Seine Romane, Erzählungen und Gedichte zeugen ebenso davon wie seine Theaterstücke. Amann erweist sich darin als leidenschaftlicher Beobachter menschlicher Existenz und macht die Bühne des Lebens zum Schauplatz seiner Stücke. Theaterstücke zum Lesen und (Wieder-)Entdecken Diese Sammlung ist in diesem Sinne in erster Linie als Lesebuch zu verstehen, sowohl für eingefleischte Amann-Leser - eine ganze Werkgruppe ist da neu zu entdecken oder wiederzuentdecken -, als aber auch für solche, die es erst noch werden wollen. *********************************************************************** Pressestimmen: "Mit drei, vier Worten und Sätzen vermag Jürg Amann menschliche Tragödien zu umreißen, unmenschliche Vorgänge aufzuzeigen und zwischenmenschliche Probleme auf den Punkt zu bringen." Tiroler Tageszeitung, Rainer Lepuschitz "Der Schweizer Schriftsteller beeindruckt mit einer konzentrierten klaren Sprache, die vermeintlich alltägliche Begebenheiten in ihrer Außerordentlichkeitvor Augen führt ... Amanns Erzählweise öffnet gekonnt den Blick für die Skurrilität, die unter der Oberfläche des Alltags lauern." bn.bibliotheksnachrichten "Jürg Amann liebt die Camouflage, er hat sie gewissermaßen zu seinem literarischen Erkennungszeichen gemacht. Bald sind es Geschichten, die er sich anverwandelt, bald denkt er sich in Figuren hinein: spielerisch und doch ernst, poetisch ambitioniert und mit Hintersinn beschwert." Neue Zürcher Zeitung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürg Amann
Der Tod stirbt
Die Stücke
Prolog:
Der Tod stirbt
Ein Stück schreiben, in dem der Tod stirbt, das war die Aufgabe, dafür hatte ich sehr viel Geld bekommen, und dem Regisseur, der es dann auf die Bühne bringen sollte, hatte ich es in die Hand versprochen.
Von hinten links sollte der Tod auftreten, aus der Seitengasse, vor der nackten Wand, vor der Brandmauer, die mit nichts abgedeckt gewesen wäre, wir hätten keine Kulissen gebraucht, und von dort nach dem Kaspar fragen, und, weil der Kaspar nicht da wäre, mit einem Schritt nach vorn, mit der Frage des Kaspar, nach uns. Seid ihr alle da?, sollte er fragen, und: Sind auch die von euch da, die nicht da sind? Nicht mehr oder noch nicht. Und dann sollte er auf uns zugehen, auf uns, die wir jetzt dagewesen wären, langsam, Schritt für Schritt, aus der Tiefe des Bühnenraums hervor, über die weite Leere der Bühne, die nach vorne ein wenig abschüssig gewesen wäre, für unser Auge kaum wahrnehmbar, so dass wir die leere Oberfläche besser gesehen hätten, mit ihren Merkpunkten und Merkzeichen, immer wieder innehaltend, immer wieder zögernd, in seinem weissen Kostüm, aus weissem Flanell, das ihm die Grossmutter geschneidert hatte, mit seinem weissen, kantigen Holzkopf, der ihm vom Grossvater geschnitzt und gemalt worden war, auf uns zu, die wir also: Ja! gerufen hätten, ausser natürlich die, die nicht dagewesen wären, noch nicht oder nicht mehr, für diese natürlich mit, über die Mitte der Bühne und dann nach vorn, an die Rampe, auf die Rampe zu, auf uns zu, die wir mit offenen Mündern dasässen, in der Dunkelheit des Zuschauerraums, in Furcht und Schrecken, nur die Notausgänge wären beleuchtet, auf unseren bequemen Sesseln unbequem hin- und herrutschend, ein Bein wäre uns schon eingeschlafen, und auf das Ende warteten, noch bevor alles richtig begonnen hätte, der Kaspar war ja gar nicht gekommen, und die Grossmutter und der Grossvater auch nicht, und auch der Polizist hatte sich dem Tod nicht in den Weg gestellt; aber da stürzte er, denn er wäre jetzt an der Rampe, während wir aufschrien, noch bevor er uns ganz erreicht hätte, mit dem letzten Schritt auf uns zu, vor unseren vor Erwartung weit aufgerissenen Augen, geblendet, im Kegel des Scheinwerferlichts, kopfüber in den Orchestergraben, mit seinem Sturz auf der verwaist dort stehenden Kesselpauke einen Tusch auslösend, und bräche sich das Genick –, während das Licht auf der Bühne aus- und das Licht im Zuschauerraum anginge, und das wäre das Ende.
Die Stücke
Das Fenster
Monodrama
Raum einer Altwohnung. In der Mitte hinten ein offenes Fenster mit Geranien auf dem Sims. Davor, mit der Lehne zum Zimmer, ein Stuhl. Irgendwo ein blinder Spiegel an der Wand, das Bild eines sehr alten Mannes, irgendwo ein altes Grammophon. Von draussen das Bimmeln einer Totenglocke. Mühsam, am Stock, humpelt die Grossmutter auf die Bühne und ans Fenster, murmelt vor sich hin.
Grossmutter: Es läutet wieder. Hörst Du die Glocke, Kind? Komm her, es ist gestorben worden. Bumsfallera und aus. Wer es wohl heute ist? Was? Sprich lauter, Mädchen, du weisst doch, Grossmutter hört etwas schwer. Du weisst es nicht? Aber natürlich weisst du das. So klein bist du doch nicht mehr, hast doch Verstand und Begriff vom lieben Gott bekommen … Was? Dass ich taub bin, weisst du? Ich bin aber nicht taub. Nicht einmal schwerhörig. Wer hat denn das Bimmeln zuerst gehört, du oder ich? Siehst du. Schwerhörig sein und etwas schwer hören ist noch lange nicht dasselbe. Aber das andere weisst du nicht? Du weisst nicht, wer es heute ist? Ist denn die Zeitung nicht gekommen? Die Zeitung muss doch da sein, es hat schon zwölf geschlagen, da muss die Zeitung doch … Da ist sie ja. Komm, bring sie her zu mir. Sei so lieb und bring sie Grossmutter her. Oder schau gleich selber schnell hinein, du bist ja nicht mehr so klein, dass du nicht lesen kannst, Grossmutter hat es dir beigebracht. Ich könnte auch selber, das weisst du, aber lieber wäre es mir schon … Du weisst ja, Grossmutter sieht etwas schlecht, auf kurze Distanz, vor allem auf kurze Distanz. Und dann will ich ja auch sehen, was du kannst. Du musst ja noch etwas werden. Komm, lies mir die Zeitung vor. Seit Jahren liest du mir die Zeitung vor … Was hast du gesagt? Sprich lauter mit deiner Grossmutter, dass sie dich auch recht versteht. Du weisst doch. Man weiss ja sonst gar nicht … Die drittletzte Seite, wie immer die drittletzte Seite, die eingerahmte mit den schönen schwarzen Balken und den grossen Schriften und den Kreuzen. Die ist am leichtesten zu lesen. Lies Kind! Nein, warte, lies noch nicht! Lass mich raten. Lass mich werweissen. Lass mich den Gwunder stillen. Wer wird es heute sein? Ist es … der Kleine, der letzte Woche auf die Welt gekommen ist? Der ist’s gewiss, nicht wahr, er ist’s? Von Müllers der Kleine. Das Häuflein Elend. Das noch gar nicht recht lebendige kleine Nichts. Der arme Wurm. Er ist es nicht? Wer denn? Wer ist denn sonst in jüngster Zeit noch auf die Welt gekommen, hier, in unserem Dorf? Ich kenne sie doch alle. Erzählst du mir vielleicht nicht alles, was geschieht, tagein, tagaus? Strassauf, strassab? Du weisst, dass ich das nicht ertragen kann, wenn du mir die Dinge verschweigst, die in der Welt passieren. Du kennst deine Grossmutter lange genug und weisst genau, dass sie in diesem Punkt empfindlich ist. Überhaupt treibt man mit diesen Dingen keinen Spass. Man muss die Kinder wieder Mores lehren! Ehrfurcht vor dem Alter! Was? Der Michel! Sieh mal einer an. Der Urwuchs! Der Sohn vom Bäcker um die Ecke. Wie nah es manchmal kommt. Wie um einen zu foppen. Man kann nur lachen. So, so, der blonde Michel also. Dacht’ ich mir’s doch: ein junger Toter. Einmal mehr ein junger Toter. Frische Blumen, junge Leichen. Wie das Leben spielt! Durch diese Strasse gehen lauter junge Leichen. Lange, lange ist es her, dass hier ein Alter starb. So lang, dass man sich kaum besinnt. Man vergisst auch alles wieder oder verwechselt es, wenn man älter wird und mit keiner armen Seele mehr darüber sprechen kann. Du bist für solche Dinge noch zu jung, und ausser dir, mein Mädchen, habe ich niemanden mehr. Ja, früher, als man noch unter Leute ging, als dann die Grete noch ab und zu heraufkam, und der Karl. Aber jetzt. Die kommen ja nicht mehr. Die sind schon so lange weggeblieben, wenn ich es mir recht überlege. Selber traut man sich ja auch nicht mehr aus dem Haus, bei all dem, was man hört von dieser Welt und den Gefahren für das Leben, die sie birgt. Es ist ihnen aber doch nichts zugestossen, Kind, nicht wahr? Du bist ihnen doch kürzlich noch begegnet, hast Grüsse von ihnen bestellt, hast erzählt, sie seien munterer denn je. Wie ich. Sie sind nicht krank, nicht wahr? Wer sagt, Leben sei lebensgefährlich, der lügt, man muss eben nur wissen, wie. Es geht ihnen gut, nicht wahr? Ich kann mir’s auch gar nicht anders denken. Sind schliesslich beide alt genug. Sind auch nicht auf den Kopf gefallen. Der Michel, der war jung, mein Trost. Mir ist, ich hätte ihn heut in der Früh noch gesehen, da hat er Brot ausgetragen, wie immer, mit dem grossen Korb am Arm. Bist du auch sicher, mit dem Michel? Na? Na ja, wenn’s in der Zeitung steht. Die lügen nicht.
Sie beugt sich weiter über die Geranien vor, um besser aus dem Fenster zu sehen.
Merkwürdig ist es schon, dass sie ihn jetzt schon begraben. Nun sind sie schon ganz oben. Ich kann sie fast nicht mehr sehen. Jetzt sind sie in den Friedhof eingebogen.
Sie setzt sich auf den Stuhl, Blick aus dem Fenster. Die Totenglocke klingt aus.
Wie schön die Welt jetzt ist! Wie ruhig, wie sanft. Im Herbst sind die Bäume am schönsten. Das Laub löst sich von den Ästen ab, lässt sich vom Wind in die Ferne tragen, ins freie Leben hinaus. Die Blätter färben sich dunkel wie Blut und dunkel wie Erde; die Vögel ziehen nach Süden, an die Wärme; auf dem Feld wird das Getreide reif. Ja, ja, im Herbst fängt das Leben erst richtig an. Leg eine Platte auf. Du weisst schon, welche. Grossmutter will immer dieselbe hören.
Während sie ihr Ohr dem alten Grammophon zuneigt, ertönt von dort mit viel Rauschen und Kratzen eine himmelschreiende Schlagerschnulze über die Schönheit des Alters, der sie lange nachlauscht.
Nicht wahr, die lügen nicht, die Leute, die das schreiben, in der Zeitung, die dürfen doch nicht lügen, Schwarz auf Weiss, sagt man. Wie? Was? Man sagt auch: wie gedruckt, da hast du recht. An was ist er denn gestorben, der Michel? Noch am Morgen, mit den Broten, sah er frisch und kräftig aus. So ist das eben. Es kommt halt, wenn man es am wenigsten erwartet. Die meisten sind noch Kinder. Hm, an was? Man nennt ja heutzutage alles Krebs, was tötet. Ein Krebsübel, der Tod. Altersschwäche wird’s in Wirklichkeit gewesen sein, was sonst, mit seinen fünfzehn Jahren. In dem Alter ist man noch zu schwach zum Leben. Lauter Junge sterben in unserem Dorf daran. Und gehen dann, einer nach dem andern, hier unter meinem Fenster durch den letzten Gang. Wie viele Särge habe ich im Laufe des Lebens gesehen! Und doch noch nicht genug; ihr Holz reicht noch nicht aus, um eine Arche draus zu bauen, für uns, die Überlebenden. Ich schon, ich hätte Platz darin, ich schon. Aber vielleicht überleben ja noch andere. Wollen ewig leben, diese jungen Leute! Aber kaum dass sie den ersten richtigen Kuss bekommen haben, werden sie schwach auf der Brust und schwach in den Knien, straucheln über die eigenen Füsse und husten ihr Blut in den Dreck, aus dem sie sind. Und wollen trotzdem ewig leben! In ihrem Alter! Die Bengel sowieso; die Mädchen auch. Die können kaum das erste Kind abwarten, noch beim Entbinden: aus, aus, gestorben, abgesärbelt! Die kleinen Würmer sollen selber schauen.
Heiseres, höhnisches Lachen.
Nimm auf der anderen Seite mich. Ich bin jetzt 120; vielleicht auch mehr. Das Gröbste habe ich hinter mir. Wer, sagtest du, ist es am Samstag gewesen? Die Lene, nicht? Und vor zwei Wochen war’s die Hilde? Vor drei, war’s da nicht auch ein Michel? Nicht? Schau mich doch an, schau mir doch in die Augen, Kind. Noch bin ich da! Du brauchst dich nicht zu schämen, wenn du etwas vergessen hast. Du bist noch jung, dir geht die Welt noch wie ein Sturm durch den Kopf, da hinein und dort hinaus. Wenn du einmal alt bist, wirst du dich erinnern, an alles. Auch an das, was du jetzt vergessen hast. Da leert sich das Gehirn von den Wirrnissen des Tages, und das Vergangene tritt hervor in immer klareren Konturen. All die Vergangenen und Toten, die einmal bei uns waren. All das Verblichene nimmt wieder Farbe an. Es hat sich überdauert. In diesem Kopf. In diesen Falten, in diesen Rissen sammelt sich das Leben, abgrundtief. In mir, mein Kind. In mir, die ich es lebte. Die ich es immer leben werde, immer. Ich habe überlebt.
Sie schaut sich über die Schulter.
Schau nicht so starr an mir vorbei. Was siehst du hinter meinem Rücken? Denkst noch an Michel, wie? Mach dir nichts draus, er war zu jung. Der Tod hat solche Frätzchen gern, der macht nicht Halt vor einer glatten Haut. Da dringt er leichter durch. Mit einem leisen Hauch reisst er die Hülle ein. In Fetzen küsst er euch. Uns aber schützt das alte, ledrige Geschrumpel, worüber ihr die Witze macht. Lacht nur; wir werden sehen, wer am Ende lacht! Was rege ich mich auf. Es schadet nur. Ihr seid mit eurer Jugend selbst bestraft. Junge Leichen holt sich der, die jungen, schönen Leichen. Das habt ihr dann davon. Die Schönheit rafft euch hin; die Krankheit nistet sich in euren grünen Schnäbeln ein. Wie Eintagsfliegen stirbt in unserem Dorf das junge Volk dahin. Kinder fallen aus sterbenden Müttern heraus und schwupp ins Grab wieder hinein. Sie haben kaum die Zeit, die Augen aufzumachen. Und macht sie einer auf, drückt sie ein anderer ihm wieder zu. Ein Alter, selbstverständlich. Das ist der Lauf der Welt. Darum sind unsere Priester so alt, damit noch jemand da ist, der die jungen Toten segnet und zu Grabe trägt. Das Leben ist nur eine Sache des Alters; mit der Jugend ist es bald einmal aus.
Sie stösst mit dem Stock auf.
Du hörst das natürlich nicht gern. Man hat es nicht gern, wenn man die Wahrheit hört, ich weiss. Es ist nun aber einmal so; ich bin nicht schuld daran. Du siehst ja selbst. Gestern jener, heute dieser Michel, morgen ein anderer. Tagtäglich ziehen sie an uns vorüber. Tief unter uns. Wir bleiben immer übrig. Jetzt wird der Pfarrer fromme Sprüche klopfen, vom Jenseits und vom Weiterleben drüben irgend etwas faseln, das er selbst nicht weiss. Was für ein Trost! Wir leben, hier! Das weiss ich selbst. Auf den kleinen Sarg wirft man jetzt Blumen, vielleicht hat man ihn schon versenkt, die Schollen poltern lustig auf den Deckel. Ja, Mädchen, schlag dir deine Flausen aus dem Kopf. Schau, dass du beizeiten alt wirst, sonst stirbst du mir auch zu früh. Wenn die Grenze erst einmal überschritten ist, ist die Gefahr schon fast vorbei. Dann kannst du nicht mehr sterben, wirst unsterblich sein, wie ich. Was sagst du? Nichts hast du gesagt? Du siehst doch: gut 120, und frisch und munter wie mit hundert! So gut erhalten, dass das Dorf vergessen hat, mir einen Schaukelstuhl zu schenken. Was sagst du? Nicht so alt? Du willst gar nicht so alt werden? Das ist Geschwätz, da spricht das Kind aus dir, du wirst schon sehen.
Schlägt sich knochig gegen den Schädel.
Jetzt redest du so dumm daher, weil du’s nicht besser weisst. Still! Komm her. Komm her zu mir ans Fenster, komm. Ganz nah zu mir heran.
Sie rückt, um Platz zu machen, etwas zur Seite.
Ich rieche schlecht? Das sind die faulen Blätter drunten auf der Strasse. Das ist der Herbst.
Sie streicht sich über den Arm. Sie zittert.
Nein, Kind, du nicht. Du darfst nicht auch noch sterben. Ich habe keinen Menschen ausser dir. Was bin ich ohne dich? Mein Sohn, dein Vater, ist zu früh gestorben. Deine Mutter auch. Sie haben uns verlassen. Es ist das Schicksal von uns alten Menschen, dass wir übrig bleiben. Glaub mir, es ist nicht leicht, zu überleben. Nur du bist mir geblieben; von allen bist nur du geblieben. Wir haben immer zusammengehört, wir zwei, die Greisin und das Kind. Die Greisin und das Kind. Versprich mir, alt zu werden. Du!
Sie ist jetzt fast am Ende, rafft sich nochmals auf.
Siehst du, und unter uns fahren die Särge vorbei, von Ewigkeit zu Ewigkeit, wir kennen keine Zeit. Wir stehen hier am Fenster und schauen auf alles Sterbliche hinunter und winken und lachen und leben. Das wird ein Wirtschaften werden hier oben! Und unten der ewig junge Tod. Was für ein Schauspiel. Zu zweit wird das noch viel, viel schöner sein.
Sich erschöpfend, kurzatmig.
Sieh nur, sie kommen schon zurück. Die Leiche ist versenkt, sie holen schon die nächste. Siehst du sie? Du bist zu klein. Stell dich auf die Zehen. Steck deine Nase durch die Blumen.
Sie selbst fällt langsam auf den Stuhl zurück, der Oberkörper knickt nach vorn, so dass ihr Kopf leicht abgedreht in die Geranien zu liegen kommt.
Alles alte Leute. Winziges Lachen. Die jungen sind gestorben. Die kommen nicht zurück. Grossvater war der letzte Alte, der hier starb. Er muss noch jung gewesen sein. Ich habe seither die Jahre nicht mehr gezählt.
Es läutet an der Tür. Eine kleine Erschütterung geht durch ihren Leib.
Es hat geläutet. Wer? Das Brot? Der Michel ist doch tot.
Sie ist gestorben.
Das Ende von Venedig
Requiem
I
Crescendo
Auf einem Gerüst in der Kuppel von San Marco DER KÜNSTLER, das Ganze malend. Bei ihm DER FREMDE. Tief unten auf dem Steinmosaikboden, bis zum Bauch im Wasser, die beiden Bettler, DER BLINDE und DER STUMME, den Bettelhut vor sich. Über die Schwellen der Kirche läuft Wasser herein.
Der künstler: Das Leben in der Kunst verewigt. Alles schon da, alle Motive hier von Alters her beisammen. Der Lebensbaum, der Turmbau von Babel, die im Wasser ertrinkende Menschheit, das Aussenden der Taube; die Sintflut. Was mit uns heute passiert, man weiss nicht, ist es ein Naturphänomen oder ein Kunstphänomen.
Der fremde: Das plötzliche Steigen des Wassers hat mich zu Ihnen hier herauf getrieben, unter die Kuppel. Aus Rissen in Plätzen, Gassen und Bodenplatten der Kirchen plötzlich hervorgebrochen, wo ich gerade stand, unter den Schuhen hervor, zwischen den Zehen herauf. Nicht nur von Kaimauern her, überall, überall Wasser, das ist unheimlich.
Der künstler: Unheimlich, ich weiss.
Der fremde: Unheimlich. Ich bin ja nicht ganz unvorbereitet in diese Stadt gekommen, auf manches gefasst, sozusagen mit manchem Wasser schon vorher gewaschen, aber jetzt das! Natürlich, man weiss es unterdessen auf der ganzen Welt, Venedig sinkt, das Wasser steigt, es tritt über die Ufer. Aber es tritt eben nicht nur über die Ufer, es tritt über den Boden, wenn man das sagen kann. Über den Boden, auf dem die dort unten noch immer ungerührt und unbelehrbar hocken und für weiss Gott was für ein Leben betteln. Wasser, versteht ihr denn nicht, dort unten, Wasser!
Der künstler: Eine alltägliche Erscheinung, Venedig und das Wasser; wie Venedig und die Tauben; Tag und Nacht.
Der fremde: Aus dem Boden plötzlich das Wasser. Über Plätze strömend, über Schwellen kriechend, in die Häuser fliessend. Die Erdgeschosse sind plötzlich Wassergeschosse. Höher steigen, von Stockwerk zu Stockwerk, muss man, wenn man nicht ertrinken will. Aber auf Dauer kann man ja auch nicht unter dem Himmel leben, wenn unten auf der Erde alles versinkt. Keinen Boden mehr unter den Füssen, verstehen Sie. Der Ast, auf dem man ohnehin schon sass, abgesägt. Die Existenz in der Luft. Und Sie da unten machen mich noch ganz verrückt mit Ihrem Sitzen. So stehen Sie doch wenigstens auf! Kommen Sie doch zu uns herauf, Sie erkälten sich ja! Auf nassen Steinen sitzen ist nicht gesund. Sie haben doch nasse Füsse.
Der künstler: Der eine ist blind.
Der fremde: Blind, blind. Dann soll ihm sein Kumpel sagen, was er sieht, wie es um ihn steht.
Der künstler: Sein Kumpel ist stumm, taubstumm. Der Blinde und der Stumme.
Der fremde: Sie machen mich wahnsinnig.
Der künstler: Zwei durch und durch symbolische Existenzen. In einer durch und durch symbolischen Stadt. Venedig, Atlantis, Orplid.
Der fremde: „Du bist Orplid, mein Land, das ferne leuchtet.“
Der blinde plötzlich: Venedig, Herr, Venedig.
Der fremde: „Vom Meere dampfet dein besonnter Strand den Nebel, so der Götter Wange feuchtet.“
Der blinde: Kein Nebel, nur Scirocco, Südwind, gegen Herbst vor allem.
Der künstler: Selten Nebel.
Der fremde: „Uralte Wasser steigen verjüngt um deine Hüften, Kind.“
Der blinde: Ja, ja, die nassen Füsse.
Der fremde: „Vor deiner Gottheit beugen sich Könige, die deine Wärter sind.“
Der künstler: Wie gesagt, eine alltägliche Erscheinung. Die Erde erwärmt sich, die Gletscher schmelzen, die Flüsse und die Meere steigen, das Land versinkt.
Der fremde: Aber seien Sie doch still, so schnell doch nicht, so schnell ist das noch nie gegangen, so eine Katastrophe lässt sich doch sonst Zeit. Kann das denn sein? Darf das denn sein? Ein Traum. Ein Alptraum; wir müssen doch nur die Augen aufmachen. Nur die Augen aufmachen, Herr Bettler, Sie sind gar nicht blind! Die Welt geht gar nicht unter. Das Wasser steht uns gar nicht am Hals.
Der künstler: Ein Naturereignis, kein Traum. Der Alptraum, ein Naturereignis. Wie die Menschheit auch. Eine sanfte Katastrophe, langsam, mit dem Wellenschlag der Zeit.
Der fremde: Langsam, langsam! Jetzt nicht langsam: schnell! Das plötzliche Bewusstsein davon. Das Bewusstsein verändert doch alles. Auf wie unsicherem Grund man lebt. Wie dicht über dem Abgrund man immer gelebt hat. Dicht unter den Füssen ist ja das Meer. Schon über den Füssen steht euch beiden da unten das Meer. In den Häusern das Meer, in der Kirche das Meer. Im Gottesschiff das Meer. Nicht unter dem Schiff, im Schiff. Die Arche Noah ersoffen. Die Passagiere haben nicht mehr rechtzeitig aussteigen können. Unter der Decke kleben sie jetzt, wo noch etwas Luft geblieben ist zum Atmen. Das Gottesschiff hat ein Leck, durch das dringt der Tod herein, der Wassertod, der Erstickungstod, der Welttod. Gott hat Schiffbruch erlitten mit uns. Die Kirche kein Schiff mehr, sondern ein Grab. Ein Massengrab, ein Wassermassengrab. Wir haben das Steuer schlecht geführt. Alles kehrt sich um. Alles hat sich umgekehrt.
Der künstler: Ein ganz natürlicher Prozess. Schon um die Jahrtausendwende musste, wie Sie vielleicht wissen, der Markusplatz um einen knappen Meter aufgetragen werden. Trotzdem schon 1240 wieder das erste Hochwasser, 1283 das zweite, dann in immer kürzeren Abständen das nächste und das übernächste und so fort.
Der fremde: Man hat irgendwo einen Fehler gemacht.
Der künstler: Kein Fehler, oder das Ganze ein Fehler.
Der fremde: Kann man denn nichts tun?
Der künstler: Sehen. Zusehen.
Der fremde: Ich meine: tun, etwas dagegen tun.
Der künstler: Man hat ein Bild gefunden aus dem 17. Jahrhundert, auf dem eine Dame der gehobenen Gesellschaft mit gehobenen Röcken in hohen Stöckelschuhen über den Markusplatz geht. In Hochwasserstöckelschuhen, verstehen Sie? Man muss sich anpassen. Anpassung, der beste Widerstand.
Der blinde plötzlich lachend: Die gehobene Gesellschaft! Mit gehobenen Röcken! Hochwasserstöckelschuhe!
Der fremde: Was für ein Bild. Was für ein Bild in der Tat, von dem Sie da reden, lächerlich. Lächerlich im Vergleich zu dem Bild, das wir uns sonst von Venedig machen.
Der künstler: Was für ein Bild?
Der fremde: Der Mut, meine Herren, der Mut, den es brauchte, um solche Träume zu bauen. Wenn man weiss, dass mit jedem Stein, den man oben aufsetzt, das Ganze unten um das Doppelte einsinkt! Das waren noch Zeiten, von was für einem Glauben durchdrungen, von was für einem Zukunftsglauben durchdrungen musste man sein, um über Generationen hinweg zum Beispiel an so einer Kirche zu bauen, an so einem Mosaik. Und jetzt!
Der künstler: Und wenn es umgekehrt wäre?
Der fremde: Wie umgekehrt?
Der künstler: Man hätte so lange dafür gebraucht, weil die Überzeugung dazu fehlte.
Der fremde: Aber was sagen Sie denn da? Tizian, verstehen Sie, ein Titan! Wahre Titanen diese Tiziane hier in Venedig! Nicht nur ein Tizian, eine ganze Kolonie von Tizianen. Aber jetzt! Das vor allem ist das Unerträgliche, die Vergeblichkeit. Keine Erinnerung, keine Spur.
Der künstler: Im Gegenteil, alles voll Spuren, alles eine Spur. Wozu wäre ich sonst da? Spuren sichern, verstehen Sie. Sich auf die Spur kommen, um am Ende wieder eine Spur zu hinterlassen.
Der fremde: Eine Spur für wen?
Der künstler: Den Untergang aufzeichnen. Dazu bin ich da. Ich nehme an, dass auch Sie nicht ohne Grund hierhergekommen sind. Ich bin schon lange da. Am Anfang waren viele da. Die Faszination des Endes, der Untergang zieht an. Da, wo bald nichts mehr sein wird, sein. Warum steigen die Menschen mit einer Campingausrüstung auf die Berge, wenn einer ihnen sagt, die Welt geht unter? Um sich zu retten? Nein! Um von der Höhe herunter besser sehen zu können. Dabeisein ist alles, dabei gewesen sein. Die Touristen, alle deshalb hergekommen, um dabei zu sein. Am Sterbebett der Welt gewesen sein. Den Aussatz studieren, die leprösen Mauern auf die Filme bannen, in Wunden wühlen, der Stadt die Hände in die offene Seite legen. Am Ende hat sie dann doch das Grauen gepackt. Als der Tod konkret wurde, sind sie abgereist. Am Ende ist alles sehr rasch gegangen, von Mondwechsel zu Mondwechsel rascher. Immer mehr sind weggeblieben, immer weniger sind gekommen. Die Flut, das Wasser, Venedig wurde eine Geisterstadt.
Der fremde: Ich bin nicht hergekommen, ich bin woanders weggegangen.
Der künstler: Ich habe sie gemalt. Die grünen Algenspuren, die Grünspanspuren, die ständig an den Wänden der Gebäude höher klettern. Den Wasserspiegel, der ihnen unaufhaltsam nachklettert, die Stufen hinauf, Millimeter für Millimeter. Die Stadien des Verfalls festhalten, verstehen Sie?
Der fremde: Aufhalten, nicht festhalten! Aufhalten den Verfall. Die Stelle finden, an der eins ins andere umschlägt, Aufstieg in Niedergang, Kultur in Dekadenz, Schönheit in Krankheit, der Anfang ins Ende. Den Fehler finden. Wie das vermeiden? Wie es noch retten?
Der blinde plötzlich: „Wir sind kein Museum und wollen keines sein, kein Gasthaus, kein preussischblauer Himmel für deutsche Hochzeitspaare!“
Der künstler: Er hat recht. Man kann doch kein Museum daraus machen.
Der fremde: Venedig ist doch ein Museum! Stein auf Stein, Leben auf Leben. Verewigtes Leben in Öl oder al Fresco.
Der künstler: Man ist immer der Sohn eines anderen und der Vater von anderen. Das ist die Kontinuität der Humanität.
Der fremde: Seien Sie doch still!
Der künstler: Aus dem Alten immer das Neue.
Der fremde: Hören Sie auf!
Der blinde plötzlich: Man hat zur Rettung von Venedig eine gewisse Summe bereitgestellt.
Der fremde: Er soll schweigen! Und Sie, hören Sie doch einen Augenblick einmal auf zu pinseln! Ununterbrochen pinseln Sie da vor sich hin. Das ist ja nicht zum Aushalten. Die Welt geht unter, aber Sie, Sie malen, Sie malen das. Sie tun nichts anderes, als das zu malen.
Der künstler: Jawohl, ich male das. Immer wieder und immer genauer, in allen Nuancen, mit all seinen Facetten, das Leben, das Sterben, in allen Stadien, in allen Phasen, um es zu bannen. Auf die Leinwand bannen, aufs Papier bannen, was sonst sollte ich tun?
Der fremde: Aber retten Sie sich doch! Aber retten wir uns doch! Um Himmels willen retten wir Venedig doch!
Der künstler: Es gibt nichts zu retten.
Der fremde: Sie sitzen da und malen das, als ob Sie ein Märchen illustrieren würden, das ich Ihnen erzähle, an das Sie aber nicht glauben. Ich erzähle aber kein Märchen.
Der blinde plötzlich: „Desponsamus te mare, in signum veri perpetuique dominio.“
Der fremde: „Wir vermählen uns dir, Meer, zum Zeichen der wahren und ewigen Herrschaft.“
Der künstler: Ich kann Latein.
Der fremde: Das hat der Doge gerufen, immer am Himmelfahrtstag, und dabei hat er seinen Goldring vom Finger gezogen und ihn ins Wasser geworfen. Ein jährlich besiegelter Bund. Vermählung mit dem Meer, sposalizio del mare. Aus der Not die Tugend. Ursprünglich ja eine Fluchtgeschichte. Attila, die Hunnen, vor den Barbaren eigentlich aufs Meer hinaus geflohen, dann geblieben, mitten im Wasser neuen Boden unter die Füsse gewonnen. Aber Sie wissen das ja. Aus der Flucht ein Triumphzug. Aus der Flucht vom Land aufs Wasser ein Sieg zu Wasser und zu Land. Aus der Barbarenflucht die Weltkultur, die Menschenkultur. Zivilisation, mein Herr, hier hat sie begonnen! Pfahl für Pfahl hier in den Schlamm gerammt. Ein Wald von Pfählen. Darüber Roste aus Holz und aus Teer und aus Erde.
Der künstler: Darauf wir. Auf einem Wald von toten Bäumen wir.
Der fremde: Darauf Sie und ich. Die Krone der Schöpfung: ein Luftzug über ihren Wipfeln. Ein Luftschloss. Diese Paläste überall, diese Synthese der Stile und Kulturen, so etwas hat man auf der ganzen Welt sonst nicht gesehen. Nehmen Sie nur zum Beispiel den Dogenpalast. Was für ein Irrsinn, was für eine Verstiegenheit scheinbar. Gegen alle Vernunft. Gegen alle Regeln der Vernunft auf nichts alles gebaut. Und für die Ewigkeit. Auf ein Nichts das All. Das ist Venedig. Das war Venedig. Die Wirklichkeit der Phantasie. Da gab es keinen Zahn der Zeit.
Der blinde: Le ingiurie del tempo.
Der künstler: So viel Schönheit so verloren! Luftschloss, Wasserschloss, Schlammschloss.
Der fremde: Wasserschloss, Schlammschloss?
Der künstler: Im Schlamm stecken die Stämme. Schlammgedüngt in den Wasserhimmel schlagen sie aus. Unter dem Wasser da, unter uns, ein gespenstischer Wald, unmerklich im Wellenschlag der Gezeiten sich wiegend.
Der blinde: Wellenschlag, Gezeiten, sich wiegend.
Der künstler: Ein Wald, in dem nichts wächst, weil er nicht auf dem richtigen Boden steht. Verpflanzt, entwurzelt, umgetopft. Wälder umtopfen, das können sie, die Menschen. Aus dem Naturwald einen Kunstwald machen, aus Natur Kunst. Der kühnste Pfahlbau der Welt, sagen Sie? In Wirklichkeit ein Pfahlbau auf Kosten der umliegenden Wälder, eine Stadt im Meer auf Kosten des Landes, eine Welt auf Kosten der Welt. „Macht euch die Erde untertan.“ Und wie wir sie uns untertan gemacht haben! Bis zur Erschöpfung. Untertan die Erde durch den Menschen, die Natur durch die Kultur, die Schöpfung durch die Krone der Schöpfung! Aber da unten lebt sie ja noch. Unter unseren Füssen sammelt sie Kräfte, hat sie jetzt zum Gegenschlag ausgeholt. Revolution! Rebellion der entwurzelten Lärchen und Eichen!
Der blinde: Revolution?
Der künstler: Nach tausend Jahren künden sie jetzt ihren Dienst, ihren ihnen von den Menschen künstlich zugewiesenen fremden Dienst, ihren Frondienst kündigen sie jetzt. Die Natur erobert ihr verlorenes Gebiet zurück. Wenn einer etwas glaubt, so wird er vielleicht sagen: Es zürnt ein Gott. Er gibt den Bäumen und er gibt dem Wasser und er gibt den Menschen in der Schöpfung ihren Platz zurück. Er sucht uns heim.
Der blinde: Heimsuchung?
Der künstler: Auf das Wasser bauen, was für ein Irrsinn! Wälder roden auf dem Festland und Wälder pflanzen im Meer, was für ein Wahnsinn! Und dann Felsen auf den Wald, Stein auf Holz, Paläste auf Baumkronen, was für ein babylonischer Blödsinn! Marmor ist schwerer als Holz. Der Mensch hat sich zu viel Gewicht gegeben. Alles auf den Kopf gestellt hat der Mensch, alles auf seinen Kopf. Die verkehrte Welt aus seinem Kopf. Sich mit dem Meer vermählen, was für ein Übermut! Und dann auch noch das Grundwasser abpumpen, das Grundwasser zum Trinkwasser machen! Zum Kühlwasser für die Industrie! Marghera, Mestre. Wo bleibt da der Grund, auf dem alles steht? Und oben der Rauch in den Himmel!
Der fremde: Aber von etwas muss man schliesslich leben, Luft und Liebe reichen nicht. Träumen auch nicht.
Der künstler: Sie haben recht. Man kann sich nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Man sitzt immer auf den Ästen, an denen man sägt.
Der fremde: Betteln auch nicht.
Der künstler: Der Existenzirrsinn. Was unten ist, fehlt oben; was oben ist, fehlt unten. Eine Existenzbedingung auf Kosten der andern. Nie kann man beides haben, den Himmel und die Erde.
Der fremde: Das Leben und den Traum.
Der künstler: Venedig retten, ohne es zu zerstören, eine Unmöglichkeit.
Der fremde: Damit der Bettler leben kann, muss der Bettler betteln. Vor lauter Betteln kommt der Bettler nicht zum Leben. Ein absurder Zirkel.
Der künstler: Es war vorauszusehen, sagt man immer nachher, aber diesmal war es wirklich vorauszusehen.
Der fremde: Aber bei wem bettelt ihr denn? Es ist doch keiner mehr da. Keine Menschenseele mehr. Alles ersoffen. Alles im Wasser ersoffen. Wie auch ihr im Wasser ersaufen werdet, wenn ihr nicht bald jetzt zu uns hier heraufsteigt. Kommen Sie endlich herauf, wir sitzen doch alle im selben Boot!
Der künstler: Laguna viva, Laguna morta, dazwischen das menschliche Leben. Die ganze Stadt ein einziges Symbol. Eine Weltmetapher!
Der fremde: Eine Weltmetapher.
Der blinde plötzlich: Ballons.
Der fremde: Was sagt er?
Der blinde: Rote Ballons.
Der fremde: Was sagen Sie?
Der blinde: An roten Ballons aufhängen.
Der fremde: Was?
Der blinde: Venedig an roten Ballons aufhängen und über dem Wasser schweben lassen. Damit es nicht versinkt.
II
Sostenuto
Vollmondnacht. Draussen. Das Wasser ist weiter gestiegen. Die Menschen haben sich auf die Zypressen gerettet. Jeder auf seinem Baum. Unter ihnen die versunkene Stadt. Fahles Licht auf dem Wasser und streifenweise über das hin, was darunter liegt.
Der künstler: Jetzt haben Sie Ihren Mond. Ihren ganz besonderen Mond. Den ganz besonderen Mond von Venedig. Ein Mond, für den man sogar auf Bäume klettert, damit man ihn besser sehen kann. Solange es über Wasser noch ein paar Bäume gibt. Mondsüchtig sind wir ja geworden in dieser Stadt, weltflüchtig und mondsüchtig. Das reimt sich sogar.
Der fremde: Auf die Bäume zurück muss man sich jetzt wieder flüchten, von denen wir doch einmal heruntergestiegen sind, um Menschen zu sein.
Der blinde wie im Traum: Kommt ihr von einem Stern, der schon zerstört ist, so seht ihr hier nun einen, der eben im Begriff ist, sich zu zerstören.
Der fremde: Was ist das da unten, unter uns?
Der künstler: Die Partisanin von Venedig.
Der fremde: Welche stirbt?
Der künstler: Die schon gestorben ist.
Der fremde: La partigiana che è morta; Garibaldi; Ricardo Wagner; alle untergegangen, alle da unten unter dem Wasser. Die grossen Köpfe sind auch schwere Köpfe. Sie können Welten tragen, aber die Welten ertragen sie nicht.
Der künstler: Nicht nur die Menschen, auch die Werke der Menschen ertrunken, die Spuren gelöscht. Auch der Kunst steht das Wasser jetzt bis zum Hals.
Der fremde: Man kann vor Angst ja nur noch Witze machen.
Der blinde: Die Erde ist ein Wesen, das wie ein grosses Tier am Leitseil um die Sonnenherrin rennt. Ich bin ein Wesen, das wie ein kleines Tier um das grosse Tier herum rennt und sich von ihm gewürgt fühlt. Einer geht um mich herum und fühlt sich von mir gewürgt. Um den geht ein Dritter, um den Dritten ein Vierter. So immer weiter; alles fühlt den Griff am Hals.
Der fremde: Was ist mit ihm?
Der künstler: Der Schock.
Der blinde: Einmal, es ist lange her, da stand ich auf der Zinne des Campanile und schaute auf den Markusplatz hinunter.
Der fremde: Aber er ist blind. Sie sagten, er ist blind. Sie sind doch blind!
Der blinde: Ich sah in das Gewühl der aufgeregten Menschen, die da unten blindlings hin und her schossen. Plötzlich kam ich mir vor wie unter lauter Ameisen der letzte Sonnenanbeter.
Der fremde: Aber Sie haben ja gar nichts gesehen!
Der blinde: Ich dachte, wenn das Zittern der Atome, das Leben der Menschen und der Lauf der Sterne alle die gleiche Geschwindigkeit hätten und alle gleich gross wären, dann müsste das Muster sichtbar werden, nach dem alles, vom Kleinsten bis zum Grössten, ins Unendliche abläuft. Dann noch zu denken, dachte ich, dass die Atome auch in uns zittern, auch durch das Bewusstsein zittern, das sie denkt, und dass ihr Zittern unser Leben ist, unser Zittern ein Teil des Lebens eines Sternes, dessen Zittern zusammen mit dem Zittern anderer Sterne das Leben unseres Sonnensystems, und so immer fort, durch das Ganze, das wir Weltall nennen. Ein einziges unendliches Zittern. Ein System von Angst.
Der fremde: Ein System von Angst.
Der blinde: Viola da Gamba! Seht ihr den Zug der Geister durch die Gassen? Scior Maschera regiert.
Der künstler: Scior Maschera voran, und hinter ihm die ganze Welt in Masken.
Der blinde: Scior Maschera voran.
Der künstler: Ein Umzug, eine Prozession, das Leben zieht vorbei. Hinter immer gleichen Masken. Kein Unterschied von Stand oder Geschlecht oder Alter. Alles verborgen unter immer gleichen weissen Masken.
Der blinde: Scior Maschera!
Der künstler: Natürlich, Scior Maschera, er immer allen voran. In seiner weissen Maske mit der langen, spitzen Nase, in seinem schwarzen, weiten Mantel.
Der blinde: Pulcinella!
Der künstler: Gefolgt von Pulcinella, ja, dem Hanswurst, ganz in Weiss, mit Kegelhut und langer Hakennase.
Der blinde: Arlecchino!
Der künstler: Im bunten Flickenkostüm Arlecchino.
Der blinde: Brighella.
Der künstler: Der tölpelhafte Diener. Und dann Pantalone.
Der blinde: Pantalone!
Der künstler: Alter Geck.
Der blinde: Dagegen Colombina.
Der künstler: Hübsches Weibchen.
Der blinde: Zerbinetta, Smeraldina, die ganze Commedia.
Der künstler: Und ganz zuhinterst wir.
Der blinde: Viola da Gamba. „Niemand kann immer nur lachen.“
Der künstler: Goldoni. Gozzi. Die Großen haben hier gelebt. Claudio Monteverdi. Der Anfang der Oper. Gaspara Stampa, eine Hure, eine Dichterin. Casanova: „Am Morgen eine Messe, am Mittag ein Spiel, am Abend ein Weib.“ Antonio Vivaldi. Eine stolze Stadt. Die Kunst geachtet. Von Karl V heisst es, er habe Tizian beim Malen die Pinsel gereicht. Aretino, Canaletto, Scarpi, Tiepolo, Tintoretto, Veronese, die Grossen lebten hier, die Grossen starben hier.
Der fremde: Richard Wagner.
Der künstler: Der Tristan-Hornklang sei der Ruf der Gondolieri, sagt man. Vorbei, verklungen, ausgespielt. Lautlos fallen jetzt die Engel von den Kirchen. Da unten, unter uns, im Wasser. Caduta d’angeli. Engelschlag wie sonstwo Steinschlag. Gespenstisch. In Schwärmen tote Tauben. Wie Särge treiben leere Gondeln durch verwaiste Gassen. Gondeln, die Stradivari des Sargbaus.
Der fremde: Der Mond! Sehen Sie! Der Mond!
Der künstler: Der ganz besondere Mond von Venedig.
Der fremde: Der Mond verfinstert sich!
Der künstler: Wie oft verdüstert sich der Mond im Leben eines Menschen? Fünfmal? Siebenmal?
Der fremde: Die Tauben, nicht der Mond, die Tauben vor dem Mond! Nicht der Mond verfinstert sich, die Tauben verfinstern den Mond! Die Tauben verlassen die sinkende Stadt! Sie schwärmen aus, um neues Land zu suchen.
Der künstler: Und unten schwarz auf schwarzem Wasser eine Gondel, ganz allein der Friedhofsinsel zu; ein Sarg zu Särgen.
III
Decrescendo
Morgendämmerung auf der Friedhofsinsel San Michele, die von Venedig als einziges übriggeblieben ist. Rücken an Rücken die Überlebenden, gegen das Ende anredend. Der Nebel lichtet sich, ein letzter Tag bricht an.
Der künstler: Festhalten, alles festhalten, an allem sich festhalten. Die Spuren des Endes beschreiben. Das Ende beschreiben.
Die venezianerin: Gern haben, trotz allem das Leben gern haben.
Der fremde: Geschichten vom Ende erzählen, um das Ende fernzuhalten.
Der künstler: Sempre diritto – immer geradeaus, immer der Nase nach hat nach der Legende eine alte Venezianerin den Fremden den Weg in die Lagune gewiesen, direkt in die Untiefen hinein, direkt in den Tod.
Die venezianerin: So die Legende: Als die Barbaren die Venetier auf dem Festland bedrohten, vernahmen diese eine Stimme aus den Wolken, welche sagte, sie sollten den höchsten Turm besteigen und Ausschau halten. Sie taten es und entdeckten weit draussen in der Lagune einen Flecken Land. Dahin flohen sie. Das war der Anfang, so hat es begonnen.
Der künstler: Der Anfang vom Ende.
Die venezianerin: Es haben hier Vögel gebrütet, Leben ausgebrütet, auf Inseln, die von Zeit zu Zeit versanken, aber einmal wieder auftauchten aus der Tiefe, wie am ersten Tag.
Der künstler: Der erste Tag, der jüngste Tag, das Ende aller Tage.
Die venezianerin: Die Legende: Als einmal, heisst es, sechs Fischer vom nächtlichen Fang zurückkehrten, brachten sie aus dem Wasser auch einen Toten mit, den sie ins Vorderschiff gesetzt hatten. Ein Knabe, der den Fischern das Frühstück bereitet hatte, fragte sie, ob sie den fremden Gast nicht auch zu Tisch einladen wollten. Die Fischer nickten und schickten den Knaben, den Fremden zu holen, man müsse ihn aber fest schütteln, denn er schlafe tief. Der Knabe kam zurück und meldete, der Fremde komme gleich; und in der Tat trat der Tote hinter ihm ins Haus und setzte sich an den Tisch – während die Fischer vor Schreck alle tot umsanken. Da packte den Knaben seinerseits die Angst inmitten von sieben Toten, Hals über Kopf verliess er Haus und Insel und ruderte nach Venedig, wo er alles erzählte. Seither hiess die Insel „Haus der sieben Toten“. Bis vor kurzem hat man noch bei Ebbe manchmal den Giebel aus dem Wasser ragen sehen.
Der künstler: Geschichten vom Ende erzählen; gegen das Ende.
Der fremde: Nil nisi divinum stabile est: Nichts als das Göttliche ist ewig! All diese Totenmasken hier rundum in Stein. Wie sie uns anschauen! Contessa Morosini, gestorben 1812, und wann gelebt? Und ihre zarte Hand im harten Stein: ewig. All diese ewig geschlossenen Augen, wie sie uns anblicken! Und hinter den Augen Welten. Hinter diesen für immer geschlossenen Augen für immer versunkene Welten.
Die venezianerin: „Die Schatten wandeln nicht nur in den Hainen, davor die Asphodelenwiese liegt, sie wandeln unter uns und schon in deinen Umarmungen, wenn noch der Traum dich wiegt. Was ist das Fleisch – aus Rosen und aus Dornen, was ist die Brust – aus Falten und aus Samt, und was das Haar, die Achseln, die verworrnen Vertiefungen, der Blick so heiss entflammt: Es trägt das Einst: die früheren Vertrauten, und auch das Einst: wenn du es nicht mehr küsst, hör gar nicht hin, die leisen und die lauten Beteuerungen haben ihre Frist. Und dann November, Einsamkeit, Tristesse, Grab oder Stock, der den Gelähmten trägt – die Himmel segnen nicht, nur die Zypresse, der Trauerbaum, steht gross und unbewegt.“
Der künstler: Vom Ende Geschichten erzählen. Nicht aufhören. All diesen Staub um uns aufsammeln. Blütenstaub machen daraus.
Die venezianerin: Eine Geschichte: Einmal ging der Doge Enrico Dandolo noch spät nachts hinaus, um einen Gang durch seine Stadt zu machen. Da er müde war, setzte er sich bald am Ufer nieder, um dem ruhigen Schlagen der Wellen zuzuhören. Darüber schlief er ein. Als er wieder erwachte, glaubte er, ein halbes Stündchen geschlafen zu haben, und setzte ohne Eile seinen Rundgang fort. Wie er sich aber jetzt von der anderen Seite seinem Palast wieder näherte, kam ihm dieser ganz verändert vor; die Säulen schienen ihm kürzer und der Marmor wie vom Sonnenlicht gebleicht. Auch den Pförtner, der ihm öffnete, hatte er noch nie gesehen. Er fragte ihn, wer er sei und wer ihn eingestellt habe. Der Pförtner machte ein betroffenes Gesicht und fragte, wie er dazu komme, so zu fragen, er selber gehöre ja nicht hierher, und wie er zu seinem Dogengewand komme? Wie?, rief der Doge, ich bin der Doge und bin vor einer Stunde ausgegangen, um einen Gang um meine Stadt zu machen! Da holte der Pförtner aus dem Innern des Palastes seinen Herrn; der trug ein gleiches Gewand. Die beiden Dogen sahen sich an. Noch in der Nacht liess man den Rat sich versammeln und führte ihm den Fremden vor. Keiner kannte ihn. Aber einer erinnerte sich, dass in der Stadt vor langer Zeit einmal ein Doge verlorengegangen sei. Man schaffte die Chronik herbei, blätterte nach, und richtig fand man bei einer alten Jahreszahl den Namen Dandolo. Der Doge hatte tausend Jahre am Ufer geschlafen. Als er das hörte, sank er auf der Stelle um und zerfiel zu Staub und Asche.
Der künstler: Den Staub aufsammeln, die Asche einsammeln, nichts verlorengehen lassen.
Der blinde: Als unsere Väter, erzählte mein Vater, vom Meersturm verschlagen, mit ihrem halb zerborstenen Schiff an einem Vorgebirge anlandeten und nunmehr tiefer im Land sich umschauten, da war auf der Insel nur Wildnis, aber von solcher Schönheit, dass alle sich verwundert hätten. Sechs Tage seien sie herumgezogen, kreuz und quer, bis sich von fern auf einem hellen, klaren See etwas Dunkles gezeigt habe, in der Dämmerung wie ein Gewächs aus Stein, wie eine Blumenkrone anzuschaun. Aber als sie auf der schmalen Landzunge vorrückten, die wie eine Brücke dort hinüber führte, da war es eine ganze Stadt mit gewaltigen Mauern, Zinnen und Türmen. Nichts rührte sich in den Gassen, so dass sie sich fürchteten und draussen blieben über Nacht. Aber am Morgen kam sie ein noch grösseres Grauen an. Es krähten keine Hähne, kein Wagen liess sich hören, kein Bäcker schlug die Läden auf, kein Rauch stieg von den Dächern. Mein Vater sagte gleichnisweise, der Himmel habe über der Stadt gelegen wie eine graue Augenbraue über einem toten Auge. Auch im Innern der Häuser regte sich nichts. Ratten und Mäuse ausgenommen.
Inzwischen ist es über der Lagune ganz hell geworden.
Die venezianerin: Die Sonne! Wirklich, die Sonne! Und wirklich: kein Rauch! Fällt euch denn nichts auf? Seit Jahren nicht mehr; so hell und so klar seit Jahren nicht mehr!
Der fremde: Sie hat recht! Jetzt erst sehe ich das. Sie hat ja wirklich recht. Kein Rauch mehr über Mestre! Klare Luft!
Die venezianerin: Vielleicht ist das die Rettung.
Der fremde: Du meinst?
Die venezianerin: Vielleicht hat man endlich Vernunft angenommen.
Der künstler: Die Industrien von Mestre abgestellt?
Der fremde: Die Weltkremation eingestellt?
Die venezianerin: Vielleicht kann man nochmals von vorn anfangen. Alles vergessen und von vorn anfangen.
Der künstler: Nichts vergessen. An alles sich erinnern.
Die venezianerin: Und von vorn anfangen.
Der fremde: Kennt ihr die Geschichte vom Kaiser von China, der träumte, ein Schmetterling zu sein, und als er am Morgen erwachte, wusste er nicht, ob er der Kaiser von China sei, der geträumt habe, ein Schmetterling zu sein, oder ein Schmetterling, der träume, der Kaiser von China zu sein?
Die Bettler sind abseits zusammengekauert geblieben. Während der Blinde nun spricht, richtet sich der Stumme langsam auf. Am Horizont sieht er etwas, was die anderen noch nicht sehen.
Der blinde: Ulmon, als er das dritte Menschenalter auf Erden lebte, schlug die grosse Schlacht, die ihm dies Eiland machte untertan in allen seinen Grenzen. Und Aan, der schlimme Gott, betörte seinen Sinn, dass er den Himmlischen sich vor der Zeit gleich hielt. Und gleich also hielt ihn sein Volk. Da zürnten sie und hielten Rat und schickten die giftige Seuche her von Mitternacht, austilgend so das menschliche Geschlecht auf ganz Orplid. Dem König aber liessen sie das wüste Land zur Herrschaft und den öden Rest der Jahre, so das Schicksal ihm gesetzt. Und bald ward Ulmon müde, sie zu zählen. Drum ist er jetzo wie ein blinder Mann und siehet nicht, ob Berg auf Berge türmend, ob noch ein winziger Hügel nur die Zeit vor seinen Füssen liegt …
Der Stumme ist starr aufgerichtet, streckt, in die Ferne zeigend, den Arm aus, stösst einen tierischen Schrei aus, der umso fürchterlicher ist, als es der erste Laut ist, den er von sich gibt. Der Blinde hält sich die Ohren zu. Mit seinem geschärften Gehör hört er als erster in der Luft ein Rauschen, das schnell näher kommt. Der Himmel verdunkelt sich.
Der blinde: Die Tauben! Die Tauben kommen zurück! Flügelrauschen in der Luft. Sie haben kein Land mehr gefunden!
Alle: Die Tauben kommen zurück!
Der blinde: Gott sprach: Es werde Nacht; ich nehme die Welt zurück.
Der Traum des Seiltänzers vom freien Fall
I
Im Zirkuswagen
Der Zirkusdirektor sitzt am Schreibtisch und kramt in seinen Zetteln. Herein stürzt, in seinem abgetragenen Flitter, mit tränenroten Augen und verschmierter Schminke, sein Künstler. Von drüben hört man leise die Musik der Zirkuskapelle.
Seiltänzer: Ich kündige. Jetzt kündige ich. Es ist soweit. Nun ist genug Heu unten. Mir reicht’s. Ich habe die Nase voll. Das hat ja alles keinen Sinn. Keinen Sinn hat das ja alles, verstehen Sie? Keinen Sinn!
Direktor: Was ist denn? Was ist denn geschehen? Sie sind doch nicht etwa gefallen?
Seiltänzer: Nie! Nie bin ich gefallen! Eben nicht. In meinem Leben nicht. Noch nie bin ich gefallen.
Direktor: Nehmen Sie Platz. Nehmen Sie doch Platz. So etwas ertrage ich nicht. So etwas erträgt der Direktor nicht, verstehen Sie? Den Anblick seines schlotternden Artisten erträgt Ihr Direktor nicht. Nicht gern. So setzen Sie sich doch. Erleichtern Sie Ihr Herz.
Seiltänzer: Sechsundzwanzig Jahre, Herr Direktor, sechsundzwanzig Jahre, dass ich nun in Ihrem Unternehmen bin. Meine Wiege stand in Ihrem Zelt. Meine Eltern zeugten mich in Ihrem Zelt. In einem Ihrer Wagen brachte meine Mutter mich zur Welt. Auf diese Welt, in diese Welt. Ich habe immer Ihre Luft geatmet. Ihre Luft, verstehen Sie, die Zirkusluft. In dieser Luft, in diesem Zirkus bin ich gross geworden. Mein Handwerk habe ich …
Direktor: Ihr Fusswerk haben Sie …
Seiltänzer: Mein Handwerk, das ein Fusswerk ist, mein Handwerk habe ich in Ihrem Stall gelernt. In Ihrem Stall und von der Pike auf. In Ihrem Sägemehl bin ich herumgekrochen. Ich habe in Ihrem Sägemehl den ersten Schritt gemacht. Die ersten Schritte habe ich in Ihrem Sägemehl getan, in welchem ich anschliessend auch laufen gelernt habe. Am Boden noch sitzend habe ich dem Grossvater auf die Füsse geschaut.
Direktor: Ihr Grossvater, ja, ja.
Seiltänzer: Von unten habe ich zu den Füssen des Grossvaters hinaufgeschaut, wenn sie wie im Traum durch die Luft sich tasteten, in der für meine damals noch unschuldigen Kleinkinderaugen nichts war, worauf man gehen konnte. Gar nichts, überhaupt nichts, verstehen Sie, Herr Direktor?
Direktor: Ja, ja, die Kinder, ihre Kinderaugen.
Seiltänzer: Meine Kinderaugen. Wie habe ich gefuchtelt mit den Ärmchen, damals, ihm entgegen, da, am Himmel oben, Grossvater entgegengefuchtelt, für ihn in die Hände geklatscht, wie verrückt, vor Freude, wenn er wieder unten vor mir auf dem Boden stand. Wenn er mich nach getaner Arbeit in seine starken Arme nahm.
Direktor: Starke Arme, natürlich, Ihr Grossvater.
Seiltänzer: An den Abenden, wenn ich im Wagen lag und aus dem Zelt die Klänge der Kapelle an mein Ohr herüberdrangen, wenn er drüben seinen Auftritt hatte und ich nicht schlafen konnte, hat mir meine Grossmutter von seinem Grossvater erzählt, von seinem Grossvater und wieder von dessen Grossvater, immer weiter zurück, immer weiter hinab.
Direktor: Hinab, hinab.
Seiltänzer: Seiltänzer, alles Seiltänzer, aus lauter Seiltänzern bestand die Welt für mich. Alles, was gewesen war und war: Artisten. Für meine Einbildung war die Welt ein Zirkus, ein einziger grosser, unendlicher Zirkus. Ja, in unserer Familie hat die Kunst Tradition. Mein Vater selbst, wie Sie ja wissen, hat sie auch ausgeübt. Von ihm habe ich alles gelernt, was für den Beruf wichtig war. Von langer Hand hat er mich auf ihn vorbereitet, hat er mir den Sinn geöffnet für seine bodenlose Schönheit, für seinen hohen, abgrundtiefen Stolz. Die grade Haltung, ihm habe ich sie abgeschaut, die zähe Kraft, die nicht zu sehen ist, den unbeugsamen Willen, zum Seil, zum hohen Seil. – Von der Mutter ist das Feuer gekommen, das Feuer für die Profession, die Leidenschaft, die ja, wem sage ich es, zu einem solchen Leben gehört. Obwohl gerade sie den Vater natürlich gebeten hat, auf den Knien, um Gottes willen mich nicht in die Vorstellung mitzunehmen, mich nicht dabei sein zu lassen, wenn … Sie nämlich hat sich vor dem Beruf des Mannes gefürchtet, zu Tode gefürchtet, wie man in diesem Fall wörtlich sagen darf. Und sie hat ja schliesslich auch recht bekommen.
Direktor: Leider. Bis heute tut mir das leid.
Seiltänzer: Aber ganz gegen ihren Willen hat sich ihre Angst auf mich übertragen als nur noch grössere Achtung und Verehrung dessen, was ja doch in unser aller Blut ganz unauslöschlich lebte. – Der Abend kam heran, Herr Direktor, an dem Sie mich bei der Hand nahmen, mit lustigem Gesicht, mich mit ins grosse Zelt hinübernahmen, das für mich ja die Welt war, in dem jeden Abend der Mittelpunkt mein Vater war. Unter den grossen Menschen sass da ich kleiner Mensch, in der vordersten Reihe, steil meinen Blick erhoben, aufwärts, empor zu ihm, der über unseren Köpfen zauberte, hexte, Künstler war. Ich begriff nicht viel, nicht wirklich wusste ich, was da geschah; wie wandelnd durch die Nacht hielt ich die Augen aufgerissen; aber als ich dann im donnernden Applaus um mich herum aus meinem Wachschlaf schreckte, da wusste ich dies Eine: dass ich diesen schmalen Weg auch gehen würde, hoch am Himmel, zwischen nichts und nichts.
Direktor: Den sind Sie ja dann gegangen.
Seiltänzer: Bis heute bin ich ihn gegangen. Jetzt habe ich die Nase voll. Einmal ist genug, und jetzt ist es genug.
Direktor: Nun, nun, mein Lieber. Sind Sie nicht einer der Grössten Ihres Fachs? Aufhören!
Seiltänzer: Ach, erzählen Sie mir nichts! Ich weiss zu gut über meine Situation Bescheid. Früh genug, als ich kaum schon stehen konnte, als ich auf breiten Brettern meine ersten Schritte übte, da schon hat man mir erklärt, worauf es am Ende ankommt. Bevor ein Reiter nicht vom Pferd fiel, ist er kein Reiter! Sie selber, Herr Direktor, und alle Lehrer, die ich hatte, sie haben mir von früh bis spät nur diesen Satz gepredigt.
Direktor: Aber!
Seiltänzer: Nein, nein, ich weiss wohl um die wahre Meisterschaft, ich weiss wahrhaftig um den wahren Gipfel unserer Kunst: Es ist der Fall; der freie Fall. Nur wenn man ihn beherrscht, als einen Kunstschritt unter Schritten, nur dann hat Seiltanz einen Sinn, beherrscht man sich, ist man der Meister seiner selbst. Sonst nicht.
Direktor: Ich verstehe Sie nicht, beim besten Willen nicht.
Seiltänzer: Ich habe es auch lange nicht verstanden. Wie die meisten habe ich lange Zeit dem Irrglauben angehangen, gerade umgekehrt sei es die Kunst, nicht zu fallen. Was für ein Wahn, was für ein Betrug! Nicht fallen ist so leicht. Jeder kann nicht fallen, jeder muss das können. Ich darf das sagen, Herr Direktor, ich bin noch nie gefallen. Wie habe ich jahrelang dem Tag entgegen gefiebert, an dem ich fiel. Entgegen gefiebert, entgegen geharrt! Abend für Abend stieg ich mit klopfendem Herzen unter das Zeltdach, welches mein Himmel war. Heute wird es passieren, dachte ich, jeden Tag. Dann war wieder nichts. Immer war da, wo ich hintrat, das Seil. Das Seil, verstehen Sie? So lang wie ein Leben, so breit wie die Welt. Zu beiden Seiten war ich von hohen Mauern gehalten, so kam es mir vor. Zuerst habe ich dieses Gefühl der Überlegenheit meines Könnens zugeschrieben, bis ich eines Tages die Worte der Lehrer zu begreifen begann. Ich verstand: Ich kann ja nicht anders, es ist dies meine Schwäche. Ich bin im Grunde ein Versager, in Gestalt des Sternes, der am Himmel steht! Ein Wicht, ein Scharlatan, ein Nichts. Die andern, von denen ich hörte, mit denen ich lebte, welche ich traf, gelegentlich, alle hatten sie ihre Stürze, ein jeder in seiner Art. Alle erzählten sie mir davon, haben sie mir ihre Wunden und Narben gezeigt, mir, der ich selber nichts Zählbares vorzuweisen hatte. Ihre Stürze waren ihr Ausweis, den sie auf sich trugen, wo immer sie waren, wohin immer sie gingen.
Direktor: Vieles, was sie erzählen, wird auch Übertreibung sein; Prahlerei, Grosstuerei, Aufschneiderei, Wichtigtuerei; man kennt das.
Seiltänzer: Wenn es so wäre, und ich glaube das auch, so hätte es doch seinen Sinn. Sehen Sie, Herr Direktor, jeder Beruf braucht seine Rechtfertigung. Sie ist die Seele dessen, der ihn ausübt. Und die des Seiltanzes ist eben: der Sturz. Ich habe sie nicht; ich habe sie nicht. Während die staunenden, gläubig-ungläubigen Menschen, welche tief unter mir im Dunkel die Köpfe nach mir recken, mit mir leben, mit mir atmen, Gedeih und Verderben wagen, für die Gefahr, in der ich schwebe, zahlen, Ihnen, Herr Direktor, ihr gutes Geld zahlen, tanze ich leicht unter dem Zeltdach dahin, kann Kapriolen schlagen, Luftsprünge machen, Kopf stehen, was immer Sie wollen; im Grunde kann mir gar nichts passieren, mein Weg ist vorgezeichnet, mit Stricken vorgezeichnet, hinüber, hinüber; und sie halten vergebens den Atem an, vergebens klopfen die Herzen der Menschen bis zum Zerspringen; für nichts und wieder nichts als meine Ohnmacht ernte ich Applaus. Die Schwäche hält mich fest mit tausend Seilen, die in tausend Sternen verankert sind. Und unter den Füssen das eine, an dem mein Leben hängt, an ihm hänge in Wahrheit ich so sehr, dass ich mich kopfüber stürzen könnte, ich käme doch nicht los. Die Füsse oben, mit hängendem Kopf, ich käme noch immer hinüber. Ja, Herr Direktor, man kann gar nicht fallen, kann keinen Fehltritt tun, kann seinen Fuss nicht neben das Seil in die Luft setzen. Immer kommt man hinüber. Immer wird man hinüber kommen, ein Leben lang, ans andere Ende. – Glauben Sie mir, seit ich das weiss, verstehe ich auch, warum unsere Vorgänger niemals ohne Netz gearbeitet haben. Nicht weil sie Angst hatten, sich die Köpfe blutig zu stürzen, im Gegenteil: weil sie zu sicher waren, weil es ihnen Hoffnung gab, es unter sich zu sehen. Nicht den Sturz – welchen Sturz? – zu verhindern, das Netz; nur: die Illusion zu geben, die Illusion sich zu geben vom möglichen Sturz; den Traum, den schönen Traum vom freien Fall. – Nun ja, ich hätte mich vielleicht daran gewöhnt, ich auch, wie andere, als Scharlatan mein Leben zu beenden, den Leuten etwas vorzuspielen, woran ich nicht mehr glaube, wenn ich nicht in der Nacht auf heute eben diesen Traum selber geträumt hätte. – Glauben Sie mir, heute Abend bin ich mit hohlem Kreuz in die Arena gestelzt, beflügelt vom Traum habe ich mich unter die Kuppel gehoben, habe ich, unter dem Aufschrei der Menge, selbstsicher den Fuss neben das Seil gesetzt, schwindelnd vor endlichem Glück! Wieder, verstehen Sie, wieder fiel ich nicht. Wieder bin ich auf dem Seil gesessen. Und was ich auch sonst noch versuchte, ich verfing mich darin, hoffnungslos, rettungslos. Am Ende gab ich es auf. Am Ende war ich wieder einmal drüben. Applaus schlug mir entgegen. Unter lauterem Beifall als je stieg ich entmutigt hinunter; kopfschüttelnd verbeugte ich mich, ein letztes Mal; als ein Gefeierter trat ich ab. – Jetzt bin ich ohne Hoffnung; so stehe ich vor Ihnen. Ich sehe im Beruf den Sinn nicht mehr. Ich gebe auf. Ich will entlassen sein.
Direktor: Hören Sie, seit seinem Bestehen ist der Seiltanz die Attraktion des Unternehmens! Ich verspreche Ihnen das Netz. Der Direktor verspricht seinem Künstler das Netz.
II
Im Eisenbahnabteil
Der Zirkusdirektor sitzt in der Ecke eines geschlossenen Eisenbahnabteils. Ihm gegenüber eine junge Krankenschwester. Über ihm, im Gepäcknetz, schläft der Seiltänzer. Zu beiden spricht der Direktor, abwechslungsweise. Der Zug ist unterwegs.
Direktor: