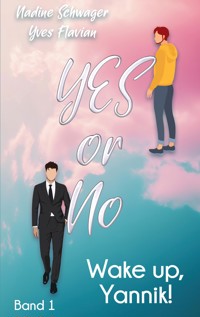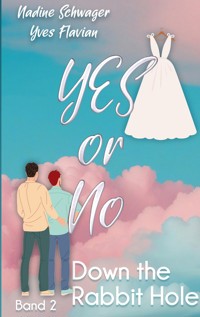Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Tod und seine geliebte Seele
- Sprache: Deutsch
Das Auftauchen des neuen Pflegers Charlie im Lazarett verwirrt Robert kolossal. Abgesehen von dem Gefühl, ihn bereits zu kennen, herrscht eine unerklärliche Anziehung zwischen ihnen. Was Robert nicht weiß: Charlie ist der Tod in menschlicher Gestalt, der Roberts Seele seit ihrem ersten Treffen vor Jahrhunderten liebt. Doch kann ihre Liebe diesmal Bestand haben, mitten im Kriegsgebiet, wo Roberts Leben als Soldat andauernd in Gefahr ist? Erlebe eine herzzerreißende Liebesgeschichte, die über die Grenzen der irdischen Existenz hinausgeht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Trigger- und Contentwarnung
Der Tod holt die Seelen aller Verstorbenen ab, das schließt auch Selbstmörder und ungeborene Kinder ein. Falls du Bedenken hast, dass du das nicht aushalten kannst, lies die Seiten 91-94 bitte mit Bedacht oder überspringe sie. Einen wichtigen Strang der Handlung verpasst du dadurch nicht.
DANKE!
Tausend Dank an meine hochgeschätzten Testleser Rena, Rea, Gökhan, C.Noxx, @_claudienchen_29 und Olli.
Ein ganz besonders herzliches Dankeschön möchte ich dir aussprechen, Eve, für das wunderbare Cover, deine unbezahlbare Hilfe in allen Lebenslagen und dein stets offenes Ohr. Ohne dich... na, du weißt ja. <3
Nur wenige wissen, dass der Tod einst eine Frau hatte.
Jahrhunderte war es nun her, doch er dachte immer noch an sie. Jeden Tag. Besonders, wenn er zu Fuß ging. Wie jetzt.
Er ging nicht oft zu Fuß, meist, weil dafür keine Zeit blieb. Obwohl es wunderbar war, in einem Wald im Zwielicht unterwegs zu sein. Alle Farben waren für den heutigen Tag schon zwischen den Bäumen verschwunden und ihre Stämme streckten die Äste mahnend von sich, als wollten sie ihn aufhalten, seinen Weg fortzusetzen. Aber er ging unbeirrt weiter.
Wenige Schritte entfernt sah er die Rücklichter des Autos leuchten, das vor Kurzem erst diesen Unfall gehabt hatte. Den Unfall, an dessen Ende er stand.
Unausweichlich.
Langsam trat er an den Wagen heran, dessen Frontscheinwerfer durch den Aufprall am Baum zerbrochen und erloschen waren. Vorsichtig blickte er durch die zersplitterte Beifahrerscheibe.
Hinter dem Lenkrad saß eine Frau. Rotbraunes Haar bis zu den Schultern, einen dünnen Mantel darüber, sehr viel mehr konnte er nicht erkennen. Sie atmete schwer, was nach diesem Unfall nicht verwunderlich war. Sie war mit viel zu hoher Geschwindigkeit aus der Kurve auf der Landstraße geflogen und hatte eine Schneise durch den Wald gebrochen. Bis dieser Baum hier sie gestoppt hatte. Sie musste sich unglaublich erschrocken haben.
Doch der Baum hatte es nicht gut mit ihr gemeint und einen seiner tiefhängenden Äste durch die Windschutzscheibe gebohrt. Direkt in den Bauch der Frau. Blut lief aus der Wunde und durchnässte ihren Pullover und ihre Hose. Noch immer hatte sie fürchterliche Angst.
„Miss?“, fragte Tod nun sacht und legte seine Hand an die Beifahrertür.
Sie blickte ruckartig auf, ohne ihre Hände von dem Ast zu nehmen, den sie umklammert hielt, als wäre er ihr Rettungsring.
„Gott sei Dank, Sie haben mich gefunden“, krächzte sie mit wenig Luft in den Lungen.
Tod lächelte beruhigend.
„Ich habe bereits einen Notruf abgesetzt. Bald wird jemand kommen, um Sie dort herauszuholen“, sagte er.
Das war gelogen. Er hatte niemanden angerufen, weil niemand kommen würde, um diese Frau zu retten. Man würde sie erst Tage später finden, weil das Auto nirgends von außen sichtbare Spuren hinterlassen hatte.
Aber er wollte ihr die Angst nehmen. Sie sollte Hoffnung haben.
„Ich danke Ihnen! Ich danke Ihnen tausendmal!“, schluchzte sie.
„Haben Sie Schmerzen?“, wollte Tod wissen und tat so, als wäre er der Waldarbeiter, nach dem er aussah. Vorsichtig öffnete er die Beifahrertür und stieg zu ihr hinein.
„Nein, gar nicht. Aber ich friere“, gab sie zitternd zurück.
Kurzerhand schlüpfte Tod aus der Fleecejacke, die er trug, um sie über die Frau zu breiten, soweit es der Ast zuließ.
„Ich weiß nicht, wie das passieren konnte! Ich wollte doch nur nach Hause und zu meinen Mädchen ... Die Große hatte heute ihre erste Tanzstunde, wissen Sie ...“, begann sie mühsam zu erzählen.
Tod kannte das bereits. Sterbende Menschen hatten den Wunsch, alles über sich preiszugeben, bevor es zu Ende ging. Dazu reichte die Zeit nur meistens nicht mehr.
„Sicher hat es ihr sehr gefallen“, antwortete er und löste ganz sacht ihre Hand von dem Ast, um sie in seiner zu halten. Sie zitterte und sie war kalt, doch die Frau blickte ihn erstaunt an.
„Wir warten gemeinsam, bis Sie hier herauskommen, Kate“, schlug er vor und sie nickte. Dann verstärkte sich ihr Druck auf seine Hand mit einem Mal. Nun war er ihr Anker.
„Erzählen Sie mir mehr von Ihren Mädchen“, bat er, so dass sogar ein dünnes Lächeln über ihre Züge huschte, während das Leben flüssig und rot aus ihr pulsierte.
„Die Große ist fünf, die Kleine zwei. Sie sind beide so blond wie ihr Vater. Und sie sind kleine Engel.“
„Das müssen sie sein bei so einer tapferen Mutter“, warf Tod sanft ein.
„Ich werde sie doch wiedersehen, oder?“
Mit großen Augen blickte Kate ihn an, die zu spüren schien, dass es zu Ende ging. Tod sah die Anzeige im Armaturenbrett: 07:36 Uhr am Abend.
Eine Minute noch.
„Natürlich sehen Sie Ihre kleinen Engel wieder“, beruhigte er Kate deshalb. „Irgendwann sehen wir uns alle wieder. Zwangsläufig.“
Kate schluckte schwer.
„Es wird niemand kommen, oder?“, fragte sie dann mit brechender Stimme und Tod schüttelte bedauernd den Kopf.
„Nein, nur ich bin hier. Aber ich bleibe bei dir, damit du nicht allein sein musst.“
Sie wusste, wer er war. Das wussten die meisten, wenn es zu Ende ging. Egal, in welcher Gestalt er auftauchte. Sie spürten es, denn niemals war ihre Verbindung zu ihm stärker als in diesem einen Moment.
Kate nickte und ihr Atem wurde schwerer. Angestrengt umklammerte sie seine Hand und Tod hielt sie ganz fest.
„Schließ die Augen, Kate, und denke an deine Mädchen. Ihnen wird es gut gehen, noch sehr, sehr lange. Das verspreche ich dir.“
„Woher weißt du das?“, fragte sie weinend.
Er lächelte traurig.
„Vertrau mir. Ich weiß es einfach.“
„Wirst du mich hinüber geleiten?“ Kates Stimme brach.
„Ja, ich bringe dich dorthin. Hab keine Angst. Du bist nicht allein.“
Sie holte tief Luft und schloss die Augen. Wahrscheinlich dachte sie wirklich an ihre Mädchen. Die Minutenanzeige sprang um. Kate atmete aus. Dann erschlaffte der Druck ihrer Hand.
Tod machte mit seiner freien Hand vor ihrem Gesicht eine kleine Geste, die er schon Milliarden Mal gemacht hatte. Eine winzige, blau leuchtende Kugel schwebte aus ihrem Mund und Tod nahm sie behutsam entgegen.
„Ich behalte dich noch eine Weile bei mir, bis du dich aufgewärmt hast“, sagte er sanft, ehe er die Seele in seiner eigenen Brust verschwinden ließ.
Sie fror noch immer furchtbar, aber er würde mit guten Gedanken versuchen, ihre Angst zu vertreiben, damit sie wieder rot und warm wurde. Das machte er oft, denn viele fürchteten sich vor dem Sterben. Dass sie sich nicht vor dem Tod fürchten mussten, zeigte er ihnen meist ausreichend. Er wollte ja niemandem etwas Böses, dies hier war nun mal seine Aufgabe.
Er stieg aus dem Auto und ging drei knirschende Schritte über das gefallene Laub durch den dunklen Wald, in dem nur die Rücklichter des Autos Licht spendeten. Es wurde Zeit. Viele andere Seelen warteten darauf, abgeholt zu werden.
Einen Augenblick später verschwand er lautlos.
Robert schob eine Zwölf-Stunden-Schicht am Tor des Lazaretts. Heute war es ruhig. Er hatte gegen Mittag eine Wagenladung neuer Krankenschwestern und Ärzte überprüft und hereingelassen, seitdem hatte er lediglich seine Zeit abgeleistet, ohne dass irgendetwas passiert war.
Müde ging er schließlich zu seinem Zelt, in dem er für diesen Einsatz hauste.
Er hatte verdammtes Glück gehabt, dass er nicht für den Fronteinsatz abkommandiert worden war. Die Stationierung in einem Lazarett war wesentlich ungefährlicher, allerdings auch langweiliger. Aber seine Familie war froh darum und er auch, seitdem er hautnah miterlebte, wie die Verletzten hier eingeliefert wurden. Mit Schussverletzungen, abgerissenen Gliedmaßen von Minen oder Bomben, zerfetzt von Granatsplittern ...
Er war sogar sehr froh, dass er dieses Lazarett bewachen durfte. Die Wachmannschaft war erstaunlich klein, sie waren gerade einmal dreißig Soldaten. Doch niemand rechnete ernsthaft damit, dass sie angegriffen werden würden. Sie waren weit weg von der umkämpften Frontlinie und behandelten sowohl Freund als auch Feind in der langgezogenen Halle, die die Heeresführung akquiriert hatte. Diese und ein Nebengebäude hatten leer gestanden, bevor sie gekommen waren. Außerdem war der Platz recht gut durch die umliegenden Berge und Hügel geschützt. Vereinzelt gab es sogar Grünzeug.
Eine einzige Straße führte zum Lazarett und die war weder asphaltiert noch ausgeschildert. Würde nicht ab und an ein Rettungshubschrauber auf dem Gelände landen, wären sie wahrscheinlich völlig unauffindbar gewesen.
In dem einzigen befestigten Nebengebäude hatten sie ihre Kantine aufgebaut. Soldaten, Schwestern, Ärzte und wer sonst noch hier beschäftigt war, wohnten ringsum in Zelten.
Robert wollte gerade in seines abbiegen, da rief sein Kumpel Alex: „Hey Bobby! Bob! Hast du schon gesehen? Wir haben eine männliche Krankenschwester bekommen!“
„Was?“ Robert runzelte die Stirn, bevor er in sein Zelt trat. Alex folgte ihm auf dem Fuße.
Vor Erleichterung und Müdigkeit stöhnend legte Bob sein Maschinengewehr ab und rollte die verspannten Schultern.
„Komm mit rüber! Bevor wir zum Essen gehen, musst du dir den mal anschauen!“, feixte sein Kumpel.
Robert seufzte tief. Wenn Alex so grinste, war er sowieso chancenlos. Dann hatte sein Kumpel sich nämlich irgendetwas in den Kopf gesetzt, von dem er eh nicht abrückte. Deshalb konnte er auch gleich zustimmen.
Er kannte Alex einfach viel zu lange und viel zu gut. Sie waren in derselben Siedlung aufgewachsen, waren Nachbarn gewesen, seitdem sie denken konnten. Und als sie sich dann nach dem Schulabschluss für die Streitkräfte gemeldet hatten, waren sie zusammen zur Grundausbildung gegangen. Bald wurde dieser Einsatz hier anberaumt ...
Tja, auch da steckte das Schicksal sie in dieselbe Kompanie und schließlich gemeinsam in dieses Lazarett. Ihre Wege waren schlichtweg untrennbar miteinander verbunden. Und Robert fand das gut, schließlich liebte er Alex wie einen Bruder. Einen anstrengenden, lauten Bruder, aber einen Bruder.
„Was ist an dem denn so toll?“, hakte Robert erschöpft nach, während er sich aus seiner schusssicheren Weste schälte.
„Bobby, lass das Ding an!“, intervenierte Alex allerdings sofort und legte ihm die Hand auf die Brust, von der er die Weste eben ziehen wollte.
„Das Ding ist schwer, ich kann kaum noch atmen. Nur ein paar Minuten“, meinte er, aber sein Kumpel schüttelte energisch den Kopf.
„Nichts da! Wir sind hier im Kriegsgebiet. Du trägst das Ding, wie wir anderen auch, rund um die Uhr“, befahl er unbeugsam, so dass Robert seufzte und nachgab. Er wusste, dass er recht hatte, aber dieses fürchterliche Ding war so schwer!
„Also los, lass uns den Homo ansehen!“, freute Alex sich und zerrte Robert am Ärmel hinter sich her.
„Homo?“, hakte Robert stirnrunzelnd nach, der seinem Freund aus dem Zelt folgte.
„Die harten Kerle beim Militär“, dachte er augenrollend. Alles, was anders war oder nicht übertrieben männlich, wurde als homosexuell abgestempelt.
Alex schlug den Weg zur großen Halle ein, die in zwei Hälften aufgeteilt war: In der einen wurde operiert und in der anderen wurden die Patienten gepflegt, bis sie in ein richtiges Krankenhaus verlegt werden konnten.
„Der hält den ganzen Tag schon Händchen. Das ist echt irre! Als ob der denkt, dass wir das nicht sehen könnten!“ Alex lachte schadenfroh, ehe er die Halle durch die große Eingangstür betrat.
An den Wänden standen überall Schränke, vollgestopft mit Medikamenten und medizinischem Zubehör. Dazwischen lagen bereits unzählige Verletzte in einfachen Metallbetten. Es roch unangenehm, nach Krankheit und Schmerzen, weshalb Robert äußerst ungern hierher kam. Aber manchmal ließ es sich eben nicht vermeiden.
„Da, schau“, griente Alex auch schon.
Außer ihnen standen noch zwei weitere Soldaten an der Tür, die sich in genau demselben hämischen Ton über den neuen Pfleger lustig machten. Knapp hinter ihnen musterten auch ein paar Krankenschwestern den Neuen.
Der saß mit dem Rücken zu ihnen an dem Bett eines Soldaten und sprach leise mit ihm. Mit der Rechten hielt er die Hand des Verletzten, mit der anderen strich er ihm sacht durch das Haar. Robert konnte hören, wie der Verwundete röchelnd Antwort gab.
Für ihn klang das gar nicht gut, aber der Pfleger ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Sein Ton war sanft, genauso wie es seine Gesten, denn der Verwundete sah nicht so aus, als würde er ablehnen, was der Pfleger da tat. Ganz im Gegenteil.
Der Pfleger sah von hinten selbst aus wie ein Soldat. Er hatte breite Schultern und muskulöse Arme, wenn er auch nicht allzu groß war. Er war auf keinen Fall größer als Robert mit seinen eins achtzig. Der Pfleger trug sein kurzes, schwarzes Haar in einem militärischen Haarschnitt wie sie alle.
Alex' Worten nach hätte er sich etwas ganz anderes vorgestellt, was ihn hier erwartete. Kurz überlegte er, was eigentlich genau, tat es dann aber mit einem Schulterzucken ab. Er war zu müde, um heute noch darüber nachzudenken.
„Und, was soll das beweisen?“, fragte er deshalb nur trocken, so dass Alex die Stirn runzelte.
„Bist du blind, oder was? Der streichelt 'nem Kerl die Haare und hält seine Hand! Wenn der nicht vom anderen Ufer ist, weiß ich auch nicht!“, erwiderte er ungläubig.
„Hier sind ... wie viele Verletzte drin? Vierzig? Fünfzig? Er nimmt sich eben Zeit. Ich glaube, dass das dem Mann guttut“, antwortete Robert ernst.
„Ja, genau.“ Alex rollte mit den Augen. „Ich will nicht gestreichelt werden, wenn's bei mir mal so weit ist, verstanden?! Von niemandem!“
„Wie können die uns nur so einen schicken!“, regte der andere Soldat vor ihnen sich auf und wandte sich verständnislos seufzend um. Er hielt kurz inne, als er Alex und Robert sah, dann meinte er: „Oder? So 'ne Tunte brauchen wir hier nicht.“
„Dein Wort in Gottes Ohr, Davey.“ Alex nickte und auch der andere Soldat wandte sich um.
„Wenn ich verwundet werde, jagt mir gleich 'ne Kugel in den Kopf, ehe mir so was hier blüht.“
Er nickte zu dem Pfleger, der mittlerweile nicht mehr redete, nur noch streichelte.
Robert aber schüttelte desinteressiert den Kopf.
„Können wir jetzt gehen? Ich hab Hunger.“
„Bobby interessiert das gar nicht. Du hast wohl nichts gegen Typen, die dich streicheln wollen?“, griente derselbe Soldat, doch Alex boxte dem gegen die Schulter und drohte: „Bobby ist nicht so einer! Also halt lieber die Fresse, ehe ich sie dir ...“
Robert hatte absolut keine Lust darauf, jetzt auch noch eine Schlägerei verhindern zu müssen. Er wollte doch nur essen und schlafen! Und diese Idioten hier machten aus einem zugewandten Pfleger gleich wieder …
Ein langgezogener Piepton unterbrach seine Gedanken. Alle vier sahen sich um, während die beiden Schwestern sofort zu dem Bett des Pflegers eilten.
Er schloss gerade mit der linken Hand die Augen des verstorbenen Patienten.
„Wir müssen ihn reanimieren!“, rief eine der Schwestern, während der Pfleger sich erhob.
„Ihr könnt es versuchen, aber er wollte gehen“, sagte er und drehte sich um, als würde eine lebensrettende Maßnahme ihn nichts mehr angehen. Die Schwestern begannen mit der Herzdruckmassage und der Beatmung, aber der Pfleger, den Robert nun von vorne sah, ging zum nächsten Bett hinüber.
Sein Anblick traf Robert wie ein Faustschlag. Er hatte sofort das Gefühl, diesen Mann zu kennen, obwohl er sich sicher war, ihn noch niemals zuvor gesehen zu haben. Aber irgendetwas war in seinem Gesicht, das Robert bekannt vorkam. Erinnerte er ihn nur an jemanden? Aber selbst das fiel ihm nicht ein. Zumindest vermittelte ihm diese diffuse Ähnlichkeit das Gefühl, dass er ihm vertrauen konnte.
Robert blinzelte verwirrt. So etwas durfte er doch nicht einfach annehmen! Er kannte diesen Kerl überhaupt nicht!
Doch genau der schien seine Gedanken hören zu können, denn er blickte im selben Moment auf und sah Robert direkt in die Augen.
Auch in ihnen lag irgendetwas Vertrautes, das Robert nicht einordnen konnte. Aber er hatte das unbedingte Gefühl, dass dieser Mann ... ja, was? Dass er ein Freund war? Ein guter Mensch? Jemand, der ihm nichts Böses wollte?
Seine Gedanken und vor allem seine Gefühle verwirrten ihn. Etwas Ähnliches war ihm zuvor noch nie passiert!
Der Pfleger sah ihm seine Verwirrung offensichtlich an, denn er lächelte dünn, ehe er sich seinem nächsten Patienten zuwandte.
Die Schwestern hinter ihm reanimierten den verstorbenen Soldaten noch immer. Hastigen Schrittes lief nun auch ein Arzt hinzu. Er gab Befehle, verlangte Medikamente und verabreichte Spritzen, aber nichts half. Die Nulllinie auf dem Monitor blieb. Schließlich gaben sie es auf.
„Du hättest uns ruhig helfen können!“, giftete eine der Schwestern den Pfleger an, der völlig ruhig antwortete: „Er sagte mir, dass er gehen will. Ich halte nichts davon, jemandem diesen Wunsch abzuschlagen.“
„Er hätte noch viele Jahre glücklich leben können, wenn ...“, fuhr die Schwester auf, aber der Pfleger unterbrach sie gelassen: „Das hätte er nicht. Er wäre ein Pflegefall gewesen, der niemals wieder laufen oder auch nur selbstständig essen hätte können. Dieses Leben wollte er nicht führen.“
„Schön, dass du das alles so genau weißt! Wir haben die Aufgabe ...“
„Es ist nicht meine Aufgabe, mich mit dir zu streiten“, sagte der Pfleger schlicht. „Ich hole mir einen Kaffee.“
Damit trat er nonchalant an der Schwester vorbei und ging in Richtung Ausgang.
„Darf ich bitte vorbei?“, fragte er die Soldaten freundlich, die noch immer nah bei der Tür standen und sie versperrten.
„Einen wie dich sehen wir lieber von hinten“, grinste Davey breit und trat zur Seite.
„Ja, für 'ne Schwuchtel haben wir hier keine Verwendung.“ Dessen Kumpel nickte und machte ebenso Platz.