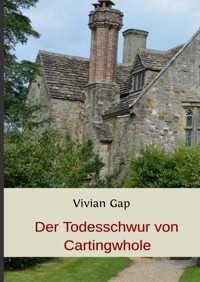
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
England 1927. In einem Vorort von London, wird der Pater der Gemeinde Cartingwhole heimtückisch ermordet im Pfarrhaus aufgefunden. Scotland Yards Chief Inspector Duncan übernimmt den Fall. Die Ermittlungen gestalten sich kompliziert. Jeder im Ort hat ein Geheimnis. Die Dorfgemeinschaft entpuppt sich als ein mörderischer Hexenkessel aus Gier, Neid und unerwiderten Gefühlen. Als zwei weitere Morde geschehen, beginnt für Duncan ein Wettrennen gegen die tickende Uhr! Besonderheiten: In dem Roman werden systematisch nach psychologischem Verständnis die verschiedenen Charaktere der Figuren herausgearbeitet. Fundiert medizinisch- naturwissenschaftliche Fakten tragen zur Untermauerung der Ereignisse und Aufklärung der Verbrechen bei.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 519
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vivian Gap
Der Todesschwur von Cartingwhole
Ein Duncan Kriminalroman
Vivian Gap
Der Todesschwur von Cartingwhole
Kriminalroman
Impressum
Texte: © 2023 Copyright by Vivian Gap
Umschlag:© 2023 Copyright by Vivian Gap
Verantwortlich
für den Inhalt:Vivian Gap
Bismarckallee 17
79098 Freiburg i.Br.
Druck:epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Dieser Roman ist all denen gewidmet,
die ich im Herzen trage
Tod im Pfarrhaus
I.
Rund eine Stunde Fahrzeit von London entfernt, liegt der verschlafene Ort Cartingwhole. Ein typisch, altenglisches Dorf, wie es viele gibt, mit schlichten Häusern und gepflegten Vorgärten. Jeder kennt jeden, und alles Fremde wird beäugt. Wie üblich bilden eine Kirche und ein Pub oder ein Restaurant das Zentrum des Ortes, an welchem sich die Dorfbewohner zu Festen oder alltags zusammenfinden können.
Es war einer dieser heißen Tage im Sommer des Jahres 1927, da sich in dem idyllischen Cartingwhole etwas Absonderliches ereignete. Aus dem Pfarrhaus war die lautstarke Stimme einer jungen, trotzigen und äußerst aufgebrachten Frau bis auf die Straße hinaus zu hören: »Nein, Pater, niemals! … Ich lasse mich nicht davon abbringen! … Nur über meine Leiche!«
Kurz darauf ertönte das laute Zuschlagen einer Tür, gefolgt von einer spannungsvollen Stille.
Nur wenige Minuten später verließ der langjährige Pater der Gemeinde überhastet die Pfarrei, um sich auf einer Bank im hintersten Winkel des Pfarrgartens den ungestümen Launen seiner Haushälterin Agatha Collins zu entziehen. Für ihn war vollkommen unverständlich, weshalb das gutgemeinte Gespräch derart eskaliert war. Kreidebleich vor Erschöpfung nahm er Platz. Seine Hände zitterten vor Aufregung, als er sich den Schweiß von der Stirn tupfte. In seinem Kopf herrschte das reinste Gedankenchaos.
Pater Antonius begleitete die Gemeinde von Cartingwhole seit vielen Jahren und verkörperte die ideale Vorstellung von einem Gemeindeseelsorger. Jeder schätzte den Sechzigjährigen als einen geduldigen, liebevollen und äußerst besonnenen Menschen. Ein treuer Diener der Kirche, dem es stets gelang, die Formalismen der Institution mit der praktizierten Menschlichkeit zu verbinden. Selbst sein äußeres Erscheinungsbild hatte sich dem Klischee eines Priesters vollumfänglich angepasst. Er war ein großer Freund ausgezeichneten Essens und vollmundigen Weines, was sich in seiner Figur unverkennbar widerspiegelte. Wenn er lachte, was er oft und gerne tat, wackelte der Bauch, und seine kleinen, verschmitzten Augen sprühten voller Lebendigkeit. Auf der Nase trug er ein schlichtes, silbriges Brillengestell mit runden Gläsern, welches die vollmondähnliche Form seines Gesichtes zusätzlich betonte.
Das leise Rauschen der Blätter im Wind beruhigte ihn. Langsam fand er zur inneren Ruhe zurück. Erschöpft und in sich gekehrt murmelte er flüsternd vor sich hin: »Oh, Herr, was soll ich bloß machen? Wenn ich doch nur ...« Er brach ab und schüttelte verzweifelt den Kopf.
Mit Wehmut erinnerte er sich an den Tag vor fast acht Jahren, als Agatha zu ihm in die Pfarrei gekommen war. Mit gerade erst Zwanzig, war sie nach dem frühen Tod ihrer Eltern vollkommen auf sich alleine gestellt gewesen. Eine Freundin hatte sie ermutigt, sich im bischöflichen Ordinariat für eine Stelle als Hauswirtschafterin zu bewerben – am besten auf dem Land, wo es familiärer
zugehe. Sie überzeugte bei Ihrer Vorstellung in der Kirchenbehörde mit ihrem tadellosen Benehmen und der festen Verankerung im christlichen Glauben, weshalb sie schon kurz darauf Pater Antonius als Haushaltshilfe zugeteilt wurde. Nach wenigen Wochen der Einarbeitung kümmerte sie sich nicht nur um dessen Haushalt, sondern unterstützte ihn ebenso beherzt bei der Gemeindearbeit.
Agatha Collins war eine durchaus bezaubernde Frau von zierlicher Gestalt. Ihr schmales Gesicht hatte einen sanften Ausdruck. Sie liebte es, sich dezent zu schminken. Die dunkelbraunen Haare fielen in leichten Wellen auf ihre Schultern hinab und verliehen ihr etwas Lebendiges. Pater Antonius schätze vor allem ihre temperamentvolle Wesensart. Mal war sie, wie ein junges Mädchen, erfrischend impulsiv, dann wieder fürsorglich und verständnisvoll, wie eine reife Frau.
Doch in letzter Zeit hatte sie sich verändert. Seit einigen Wochen wirkte sie zunehmend fahrig und unkonzentriert. Er war überzeugt, dass sie etwas seelisch belastete. In seinen Augen gab es nur zwei Lebensumstände, die ein solches Verhalten begründen konnten: Die Sorge um einen nahestehenden Menschen oder eine heimliche Liebesbeziehung. Vor allem Letzteres erschien ihm am wahrscheinlichsten. Er befürchtete eine unehrenhafte Affäre mit einem verheirateten Mann, der nicht nur ihr Herz, sondern auch ihren Verstand voll im Griff hatte.
Allein der Gedanke an ein solches Szenario löste in ihm eine große Unruhe aus. Da seine Bedenken zu einem handfesten Streit geführt hatten, beschloss er, sich zurückzunehmen und einen geeigneteren Moment für ein Gespräch abzuwarten.
II.
Tags darauf hatte sich offensichtlich der Sturm der Gemüter gelegt. Zumindest benahm sich Agatha, als habe die gestrige Unterredung einen plötzlichen Sinneswandel bei ihr bewirkt. Verlässlich wie ein Uhrwerk kam sie ihren Pflichten mit gewohnter Sorgfalt nach und war bestens gelaunt.
Pater Antonius beobachtete ihr Verhalten mit Argwohn. Seine Lebenserfahrung mahnte ihn, nicht vorschnell von einer positiven Wendung auszugehen. Und als sie ihn darüber in Kenntnis setzte, dass sie am nächsten Tag außerplanmäßig nach London fahren müsse, verstärkte dies sein Misstrauen. Um jedoch einen erneuten Disput zu vermeiden, beschränkte er sich auf ein kurzes, zustimmendes Nicken und verschwand wortlos in seinem Arbeitszimmer. Es wartete die Ausarbeitung einer Festpredigt auf ihn, für die er unbedingten Seelenfrieden benötigte.
Am folgenden Morgen verließ Agatha ohne sich zu verabschieden zeitig das Haus und begab sich direkt zum Bahnhof von Cartingwhole, um von dort aus den Frühzug in Richtung London zu nehmen.
Der Frühstückstisch war gedeckt und eine Kanne mit Tee stand auf dem Ofen.
Kurz nachdem die Haustür hinter Agatha ins Schloss gefallen war, kam Pater Antonius die Treppe hinunter. Vom Flurfenster aus sah er ihr mit besorgter Miene nach. Dann begab er sich in die Küche und schenkte sich eine Tasse Tee ein. Appetit hatte er keinen. Er genoss die gegenwärtige Stille, und nutzte die Gelegenheit, sich ungestört der Tageszeitung zu widmen. Als er damit fertig war, begab er sich in sein Arbeitszimmer und begann mit der Arbeit an seiner Predigt. Doch er kam nicht recht voran. Immer wieder schweiften seine Gedanken ab.
Urplötzlich wurde er durch ein heftiges Klingeln an der Haustür hochgeschreckt. Er zuckte zusammen. »Herr im Himmel, was ist jetzt schon wieder los?«, stöhnte er verärgert und begab sich widerwillig an die Tür.
Er öffnete diese einen Spalt breit und sah missgelaunt hindurch. Vor ihm stand Peter Franklin, der Postbote des Ortes. Er streckte ihm freudestrahlend ein kleines, in braunem Packpapier eingewickeltes Päckchen entgegen. »Guten Morgen, Hochwürden!«, sagte er hochmotiviert. »Sie haben eine Postsendung!«
Mit seinen feuerroten, zerzausten Haaren wirkte er wie ein großer Lausbub. Der junge Mann war mit Leib und Seele Briefträger. Für ihn war es das Schönste, den Menschen ihre Pakete und Briefe zuzustellen, auf die sie so sehnsüchtig warteten.
Da Pater Antonius ganz und gar nicht begeistert reagierte, verkündete Peter mit gewichtiger Stimme: »Das ist eine Postsendung aus London für Sie, Hochwürden! Keine Ahnung, von wem es ist. Vom bischöflichen Ordinariat kommt es jedenfalls nicht.« Vergebens hoffte er auf eine positive Reaktion des Paters.
Dieser sah Peter verdutzt an. Brummig erwiderte er: »Morgen, Peter! Was ist das? Ist das wirklich für mich? Hm, ich erwarte überhaupt keine Postsendung.«
Der junge Postbote war irritiert. Sicherheitshalber überprüfte er die Angabe auf dem Adressfeld. »Aber hier steht Ihr Name drauf. Es gibt nicht den geringsten Zweifel, das Paket ist für Sie.« Er deutete mit seinem Zeigefinger auf die Anschrift.
Pater Antonius öffnete die Tür komplett und warf einen Blick auf das Päckchen. »Tatsächlich. Na, dann wird es so sein«, stellte er verwundert fest und legte nachdenklich seine Stirn in Falten.
»Der Absender wünscht zudem, dass ich mir den ordnungsgemäßen Empfang von Ihnen quittieren lasse. Das wird nur bei wichtigen Postsendungen geordert, oder wenn etwas ganz Besonderes darin ist«, fügte er gewichtig hinzu.
»Was? Eine Empfangsbestätigung? Das wird ja immer seltsamer«, murmelte der Pater vor sich hin und zog die Augenbrauen zusammen, bis sich eine tiefe Furche auf der Stirn bildete. Dann setzte er hinzu: »Sag mal, Peter, du weißt sicher nicht, wer es aufgegeben hat, hm? Du bist doch sonst nicht auf den Kopf gefallen.« In seinem Tonfall lag etwas Misstrauisches.
Peter Franklin blieb gelassen, zuckte gleichgültig mit den Achseln und antwortete: »Es tut mir leid, Hochwürden, aber ich kann Ihnen diese Frage ehrlich nicht beantworten.« Plötzlich wurde er verlegen und sprach: »Auf dem Postamt ist ein kleines Malheur geschehen. Beim Abstempeln ist versehentlich ein Tintenfleck auf dem Adressfeld gelandet. Jetzt ist der Absender nicht mehr lesbar.« Er sah betreten zu Boden. Dann setzte er optimistisch mit Nachdruck hinzu: »Aber der Poststempel sagt mir, dass es aus London kommt - ganz gewiss!«
»So, so. Tja, spätestens nach dem Öffnen werde ich es genau wissen«, erwiderte der Pater und warf einen ungeduldigen Blick auf die Kirchturmuhr. »Entschuldige, Peter, es ist schon spät, und ich muss dringend eine Festrede zu Papier bringen. Also, wo soll ich unterschreiben?«, drängelte er.
Peter Franklin reichte ihm zügig das Formular samt Stift zur Unterschrift, und der Pater quittierte. Sobald der Priester das Päckchen in den Händen hielt, prüfte er neugierig dessen Gewicht. Es war federleicht. Nicht einmal ein vorsichtiges Schütteln ließ Rückschlüsse auf den Inhalt zu.
Versunken drehte er sich um und wollte gerade die Tür schließen, als der junge Postbote ihm aufgeregt zurief: »Halt, warten Sie, Hochwürden! Das war nicht alles! Hier ist noch ein Brief für Mrs. Collins, Sir.«
Der Pater hielt inne, sah ihn entgeistert an und nahm den Umschlag wortlos entgegen. Dabei entging ihm nicht, dass der junge Mann etwas auf dem Herzen zu haben schien. Entrüstet fragte er ihn: »Was ist jetzt noch?«
»Na ja, dieses Päckchen. Beabsichtigen Sie denn gar nicht nachzusehen, was darin ist? Ich ... ich finde Überraschungen so wahnsinnig aufregend«, sagte er zaghaft. Seine Wangen glühten vor Erregung.
Der ansonsten so freundliche Priester reagierte ungehalten und wies ihn scharf zurecht: »Peter, zum Donnerwetter noch mal, du sollst nicht immer so vorwitzig sein. Neugierde ist eine Todsünde! Merk dir das gefälligst!«
Der Junge zuckte vor Schreck zusammen und sah den Pater mit großen Augen an. »Oh je, jetzt habe ich Sie verärgert, Hochwürden«, gab er kleinlaut bei.
Der Pater schimpfte sich lauthals in Rage: »Warum mischt du dich immer in alles ein? Du solltest dich schämen!«
Der junge Mann wurde mit zunehmender Schelte verschämter. Noch nie zuvor hatte er den Priester derart aufgebracht erlebt. Verschreckt sagte er: »Verzeihung, ich wollte Sie nicht verärgern, Sir. Ich sollte jetzt besser gehen. Tut mir leid! Also, bis morgen, Hochwürden!« Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte er sich um und rannte los, während ihm der Geistliche hinterherrief: »Vergiss nicht, am Sonntag ist Beichte! Du hast mindestens einen triftigen Grund, in die Kirche zu kommen!«
Kaum war Peter Franklin aus dem Blickfeld des Paters entschwunden, erschrak der Pater über sich selbst, ihn derart schroff behandelt zu haben. Er konnte nicht fassen, was gerade geschehen war. Seine Nerven waren mit ihm durchgegangen. Schuld daran war allein Agathas uneinsichtiges Verhalten.
Reumütig schloss er die Haustür. Er nahm sich fest vor, sich am nächsten Tag bei Peter zu entschuldigen. Betroffen begab er sich samt Päckchen und Briefpost wieder in Richtung Arbeitszimmer.
Neugierig beäugte er den an Agatha adressierten Briefumschlag und suchte nach verräterischen Hinweisen auf einen heimlichen Verehrer. Sein Misstrauen wuchs, als ihm auffiel, dass kein Absender darauf angegeben war. Es kam überhaupt äußerst selten vor, dass Agatha Post erhielt. Die Familienangehörigen waren alle verstorben und ihre Freundinnen zogen fast immer ein persönliches Treffen vor. Die heutige, junge Generation hatte üblicherweise kein Interesse mehr am Briefeschreiben.
Er stockte und kratzte sich nachdenklich am Hinterkopf. Einen Augenblick lang hatte er das unbestimmte Gefühl, dass sich die Handschriften auf Brief und Päckchen sehr stark ähnelten. Sogar der blaue Tintenfarbton stimmte überein. Den Kopf schüttelnd, jammerte er vor sich hin: »Herr, gib mir Kraft, meine Sinne zu sortieren! Jetzt leide ich schon an Wahnvorstellungen! Wo soll das noch hinführen?«
Langsamen Schrittes ging er weiter den Flur entlang. Als er den Eingang zur Küche passierte, entschloss er sich kurzerhand, Agathas Post gut sichtbar vor dem Brotkasten zu platzieren. Dort würde sie ihn sofort nach ihrer Rückkehr finden. Beim Hinausgehen stibitzte er sich noch schnell ein Stück Schokolade aus dem Vorratsschrank und marschierte gelassen an die Arbeit zurück.
Wieder in der Schreibstube angekommen, legte er das Päckchen sorgsam auf einen der vielen Papierstapel ab, welche seinen Schreibtisch bedeckten. Dann ließ er sich mit einem tiefen Seufzer auf dem Schreibtischstuhl nieder. Grübelnd rieb er sich die Stirn und drehte sich langsam mit dem Stuhl hin und her. Noch nie zuvor war es ihm so schwer gefallen, eine Rede zu verfassen. Ständig schweiften seine Gedanken ab. Und dann war da noch das Päckchen! Immer wieder geriet es in sein Blickfeld. Unaufhaltsam fragte er sich, von wem es stammte und was darin sein konnte. Seine Neugierde wuchs stetig. Endlich gab er seinem Wissensdrang nach und beschloss, es umgehend zu öffnen. Immerhin galt es, eine eventuell leicht verderbliche Ware vor dem Verfall zu beschützen. Ohne weitere Verzögerung schritt Pater Antonius zur Tat.
Seine Augen glänzten vor Aufregung, als er das Päckchen an sich nahm und in gespannter Erwartung den Knoten der Paketschnur löste. Sorgsam schlug er das Packpapier auseinander, und eine kleine, schlichte Pappschachtel mit einer cremefarbenen Karte obenauf kam zum Vorschein. Auf dem Schriftstück stand mit Schreibmaschine geschrieben:
Verehrter Pater Antonius,
auf meiner letzten Orientreise erwarb ich in Muskat einen Weihrauch von allerbester Qualität. Als Dank für Ihre uneigennützige Hilfe und segensreiche Unterstützung meines Projektes liegt es mir am Herzen, Ihnen diese Kostprobe als Präsent zu überreichen. Mir ist bekannt, dass Sie ein besonderer Kenner der Materie sind. Ich bin davon überzeugt, dass Sie nie zuvor etwas Vergleichbares gerochen haben. Genießen Sie den erlesenen Duft!
Hochachtungsvoll, ein dankbarer Freund
Pater Antonius war begeistert, aber im gleichen Atemzug auch verwundert. Er hatte noch immer keine Vorstellung, um wen es sich bei dem dankbaren Freund handelte. Schließlich gab es nicht viele Personen, die von seiner Vorliebe für das edle Harz Kenntnis besaßen, geschweige denn je den Orient bereist hatten.
Nach einigen Minuten quälender Grübelei machte er eine flapsige Handbewegung und sagte beruhigend zu sich selbst: »Ach, was soll´s, es wird sich schon klären, wem ich das Geschenk zu verdanken habe.« Behutsam hob er den Deckel der Schachtel an und spähte hinein. Zum Vorschein kam eine kleine, schlichte Metalldose mit einem Kugelknauf auf dem Verschluss. Er nahm das Behältnis und schüttelte es sanft. Als ein dumpfes Klappern erklang, strahlte er über das ganze Gesicht. Das musste der Weihrauch sein. Sofort öffnete er die Dose und sah auf zwei haselnussgroße, zart rosa schimmernde Weihrauchklumpen, die auf einem Stückchen weinrotem Samtstoff lagen. Ein betörender Duft stieg ihm in die Nase. Schwelgend sagte er zu sich selbst: »Donnerwetter, welch ein Aroma! Einfach himmlisch! Ich muss es ausprobieren, bevor Agatha nach Hause kommt.«
Flink zog er ein tönernes Weihrauchgefäß aus der oberen Schublade seines Schreibtisches hervor, suchte zwischen den Zetteln und Stiften nach der Kohle und einer Schachtel Zündhölzer. »Das wird meinen gestressten Geist inspirieren! Halleluja!«, rief er aus und sah dankbar zum Marienbild hin, welches in einem kleinen Bilderrahmen auf seinem Sekretär stand.
Er befüllte das Tongefäß liebevoll mit einem Stück gepresster Holzkohle und zündete es sofort an. Um das Glühen der Kohle zu beschleunigen, blies er mit gespitzten Lippen etwas Luft hinein. Als Kenner guten Weihrauchs war ihm bekannt, dass nur bei einer hohen Temperatur das Harz bestmöglich verbrennen würde. Daher wartete er den optimalen Zeitpunkt ab, bevor er den ersten Harzklumpen behutsam auf die Glut legte. Endlich war es so weit. Binnen weniger Sekunden entwickelten sich seichte, tanzende Nebelschwaden, die immer mehr den Raum eroberten. Durch Fächeln sorgte er für eine noch intensivere Rauchentwicklung. Bald war das ganze Zimmer eine einzige Nebelwolke.
Entspannt lehnte er sich in seinen Stuhl zurück und schwelgte: »Ah, das ist himmlisch! Phänomenal!« Tatsächlich hatte er bis zum heutigen Tag noch nie zuvor etwas Vergleichbares gerochen. Vollkommen betört legte er alsbald das zweite Stück Harz nach und atmete tief ein. Er schloss er die Augen und gab sich vollends dem Genuss hin. Bis urplötzlich ihm der Rauch die Luft abschnürte. Ihm wurde speiübel. Panisch richtete er sich auf. Ein heftiger Würgereiz setzte ein. Unter Aufbietung aller Kräfte griff er sich an den Kragen und versuchte, diesen zu lösen, was ihm aber nicht gelang. Sämtliche Muskeln, auch die seiner Hände, verkrampften sich, und ein qualvoller Schmerz durchströmte seinen Körper. Verzweifelt schnappte er nach Luft. Dann sackte sein Leib mit einem finalen Zucken leblos in sich zusammen, derweil die gespenstisch tanzenden Rauchschwaden ihn fortwährend weiter einhüllten. Es war totenstill im Raum.
III.
Etwa zur gleichen Zeit hatte Agatha ihre gesamten Einkäufe in der Londoner Großstadt erfolgreich getätigt. Sie sah zufrieden auf die Uhr und strahlte. Bis zum geplanten Treffen mit ihrer Freundin war noch genügend Zeit, sich eine Kurzfilmvorstellung im Kinematographen anzusehen. Sie schwärmte für romantische Liebesfilme mit Happy End und nutzte jede Gelegenheit, die sich ihr bot.
In einem kleinen, heruntergekommenen Kino in der Nähe vom Piccadilly Circus wurden bevorzugt rührselige Melodramen und kitschige Liebesgeschichten vorgeführt. Die hier gezeigten Filme waren entweder hundsmiserabel oder hoffnungslos veraltet. Doch Agatha störte das nicht. Hauptsache, der Eintritt war für ihr Portemonnaie erschwinglich.
Im Entree des Kinos kaufte sie sich eine Eintrittskarte und betrat den abgedunkelten Vorführraum. Hier lief seit einer halben Stunde der Streifen Verliebt in einen Major. Da um diese Tageszeit üblicherweise nur eine Handvoll Besucher die Vorstellungen besuchte, waren die meisten Sitzplätze frei. Um kein Aufsehen zu erregen, wählte sie kurz entschlossen einen Platz in der vorletzten Reihe. Von hier aus hatte sie eine geeignete Sicht auf die Leinwand.
Bereits nach wenigen Minuten war sie komplett in die Filmwelt eingetaucht. Sie war so vertieft, dass sie nicht einmal bemerkte, wie ein weiterer Besucher nach ihr den Kinosaal betrat, sich auf einen Platz schräg hinter sie setzte und von dort aus ihre Person ungestört beobachte.
Als die Filmvorstellung nach einer guten dreiviertel Stunde beendet war, herrschte unter den Kinobesuchern eine allseits gemächliche Aufbruchsstimmung, mit Ausnahme des zuletzt hinzugekommenen Gastes. Dieser drängelte sich wie ein Schatten hastig an Agatha vorbei und stürmte auf den Ausgang zu, was bei einigen Kinogängern zu lautstarken Beschwerden führte.
Agatha nahm davon nur wenig Notiz. In Ihren Gedanken träumte sie von einer Liebesromanze, in der sie die Hauptrolle spielte. Erst als sie jemand von der Seite anrempelte, wurde sie von der Realität des Alltags wieder eingeholt. Enttäuscht murmelte sie: »Warum ist es im wirklichen Leben nicht so wie im Film?« Wehmütig verließ sie das Kino und wünschte sich in die idyllische Filmwelt zurück.
Als sie vom dunklen Vorführraum ins Freie trat, wurden ihre Augen von dem grellen Sonnenlicht geblendet. Schützend hob sie die Hand an die Stirn und blinzelte. Schemenhaft erkannte sie, wie der Drängler aus dem Kinosaal eiligst hinter der nächsten Hausecke verschwand. Entrüstet schüttelte Agatha den Kopf und sah auf ihre Uhr. Es war kurz vor 16 Uhr. Jetzt musste sie sich sputen, wenn sie ihre beste Freundin nicht warten lassen wollte. Die beiden hatten sich seit einigen Wochen nicht mehr gesehen, und es würde eine Menge Gesprächsstoff geben.
Das Teehaus des Botanischen Gartens war für ihr illustres Treffen genau die passende Umgebung. Im Sommer gehörte die Anlage zu den beliebtesten Ausflugszielen der Londoner Bevölkerung. Zwischen Palmen und exotischen Pflanzen fühlte man sich gleichsam auf einer Insel in der Südsee. Nach einem ausgiebigen Flanieren durch die weitläufigen Parkanlagen nahmen die Besucher hier gerne eine Erfrischung ein. Auf diese Weise entwickelte sich das Lokal zu einem gesellschaftlichen Treffpunkt aller Schichten. Ziel war es, zu sehen und gesehen zu werden – ein wahrer Jahrmarkt der Eitelkeiten.
Betty Edmonds, Agathas langjährige Freundin, war pünktlich im Teehaus eingetroffen. Mit ihrer liebreizend-koketten Art hatte sie mühelos einen kleinen Tisch direkt neben dem Pianospieler erobert. In solchen Situationen setzte sie für gewöhnlich ihre Weiblichkeit raffiniert in Szene, und kein Mann konnte sich ihrer gespielten Hilflosigkeit entziehen. Ihre langen, fülligen, roten Haare fielen ihr wie ein Wasserfall bis zu den Schulterblättern hinab. Sie hatte strahlend grüne Augen und eine kurvige, aber nicht zu üppige Figur. Für den heutigen Tag hatte sie, dem Anlass entsprechend, ein figurbetontes, rosafarbenes Kleid ausgewählt, welches die neidvollen Blicke der anderen Damen auf sich zog.
Als Agatha wenig später im Teehaus eintraf, waren sämtliche Tische längst bis auf den hintersten Platz belegt. Aufgeregt hielt sie in der Menschenmenge nach Betty Ausschau und hoffte inständig, nicht die letzte Gelegenheit für einen Sitzplatz verpasst zu haben. Endlich entdeckte sie inmitten des Getümmels ihre Freundin, die direkt neben dem Pianospieler einen Platz ergattert hatte. Freudestrahlend lief sie auf sie zu und rief ihr entgegen: »Hallo, Betty, hier bin ich!« Sie fuchtelte überschwänglich mit ihren Armen in der Luft, um auf sich aufmerksam zu machen. Als ihre Freundin sie erkannte, sprang sie freudig auf und winkte Agatha zu sich heran. Es folgte eine herzliche Umarmung.
»Mensch, Betty, wie schön, dich endlich wiederzusehen! Sag mal, wie schaffst du es nur, jedes Mal den besten Platz zu organisieren?«, fragte sie mit ehrlicher Bewunderung.
Betty Edmonds zuckte gleichgültig mit den Schultern, setzte ein selbstbewusstes Lächeln auf und erwiderte neckisch: »Na, Schätzchen, hat Hochwürden dich wahrhaftig gehen lassen? Komm, nimm Platz und erzähl mir den neusten Tratsch vom Land!«, forderte Betty ihre beste Freundin ungestüm auf. »Du weißt doch, ich liebe Skandale!«
Agatha lachte kurz auf und machte eine flapsige Handbewegung. Sie mochte die unkonventionelle Art ihrer Freundin. Betty konnte mitunter zwar sehr direkt sein, aber ihr Herz trug sie am rechten Fleck. »Ach, du! Du machst dich schon wieder über mich lustig! Warum tust du das?«, sagte sie tadelnd und gab vor, ein klein wenig beleidigt zu sein. »Auf dem Land zu wohnen, hat durchaus auch seine positiven Seiten. Trotzdem habe ich nie behauptet, dass ich dort den Rest meines Lebens verbringen will.«
Betty antwortete mit einem ironischen Unterton: »Hört, hört, du scheinst endlich zur Vernunft zu kommen. Das klingt ja vielversprechend! Steckt da vielleicht ein Mann dahinter, von dem ich noch nichts weiß? Ich bin ganz Ohr!« Sie strich sich eine widerspenstige Haarlocke aus dem Gesicht und sah ihre Freundin erwartungsvoll an.
Agatha lächelte verlegen und ein flüchtiges Rot huschte über ihre Wangen. In diesem Augenblick bedauerte sie zutiefst, nicht so selbstbewusst zu sein wie Betty. Agatha liebte sie wie eine Schwester und sie wusste, dass sie sich stets auf ihren Rat verlassen konnte. Daher überwand sie ihre Schüchternheit und berichtete ihrer Freundin über alles und jeden. Und Betty tat es ihr gleich. Es war für beide ein herrlicher, unbeschwerter Nachmittag. Sie waren derart in ihre Unterhaltung vertieft, dass sie nicht bemerkten, wie schnell die Zeit verging.
Erst als Agatha zufällig auf ihre Armbanduhr blickte, realisierte sie erschrocken, dass schon knapp zwei Stunden vergangen waren. Entsetzt rief sie aus: »Um Himmels willen, ich muss sofort los, sonst verpasse ich noch den letzten Zug nach Cartingwhole. Das wäre eine Katastrophe!« Hastig suchte sie ihre Einkaufstaschen zusammen, derweil ihre Freundin sie skeptisch beobachtete. Sie verstand Agathas hektischen Aufbruch nicht.
»Was ist los? Wieso hast du es bloß so eilig, in das verschlafene Nest zurückzukommen?«, fragte Betty mit deutlichem Unverständnis.
Agatha unterbrach ihre Aktivität und sah sie tadelnd an. »Ich habe Pater Antonius versprochen, ihm bei den Vorbereitungen für die Abendmesse zu helfen. Du weißt doch, dass ich meine Versprechen zu halten pflege.«
Betty stöhnte kurz auf und verdrehte genervt die Augen. »Kannst du nicht einmal eine Ausnahme machen? Ich denke, dass die Dorfbewohner, im Gegensatz zu den Städtern, immer so nett und verständnisvoll miteinander umgehen. Glaub mir, Liebes, die werden das bestimmt verstehen, wenn du ausnahmsweise mal nicht pünktlich bist«, versuchte sie ihre Freundin zu überzeugen.
Agatha ignorierte den Einwand ihrer Freundin und suchte krampfhaft in einer der Taschen nach ihrer Bahnfahrkarte. Betty mochte nach außen hin ein liebenswertes, herzlich wirkendes Geschöpf sein, aber wer sie genauer kannte, wusste, dass sie mitnichten weltfremd war.
»Also, was ist? Bleib doch noch ein Weilchen«, quengelte Betty und sah sie erwartungsvoll an.
Agatha zögerte einen Moment. Dann sagte sie mit vorwurfsvoller Stimme: »Ich kann nicht bleiben ... nicht heute.« Nach einer kurzen Pause stellte sie fest: » Man merkt, dass du nie in einem Dorf gelebt hast! Du hast ja keine Ahnung. Ich glaube, dass es auf dem Land oft weniger friedlich zugeht als in der Stadt.«
Ihre Freundin sah sie fragend an. Ihr war nicht klar, was Agatha damit zum Ausdruck bringen wollte. Schließlich sagte sie enttäuscht: »Ist in Ordnung, Schätzchen! Du wirst schon wissen, was das Richtige ist. Du musst mir nichts erklären.«
Agathas Gesichtszüge entspannten sich. Mit einem Lächeln im Gesicht schnappte sie sich ihre Handtasche und hielt nach der Bedienung Ausschau. Als sie diese im Getümmel erspähte, gab sie ihr ein eindeutiges Handzeichen, dass sie zu zahlen wünschte. Doch das Servierfräulein ignorierte sie geflissentlich und lief immerzu in die entgegengesetzte Richtung. Die Zeit drängte und Agatha sprach: »Ach, Betty, würde es dir sehr viel ausmachen, meine Rechnung heute zu übernehmen? Bis ich in diesem Trubel bezahlt habe, ist der Zug längst abgefahren.« Ihr unschuldig, fragender Blick machte jede Form der Ablehnung unmöglich. Betty nickte zustimmend, hob gelassen ihre rechte Hand zu einer gönnerhaften Geste und sprach: »So soll es geschehen! Geh mit Gottes Segen, mein Kind! Aber das nächste Mal bist du dran mit Bezahlen!«
Agatha lachte kurz laut auf, erhob sich und verkündete gutgelaunt: »Du bist ein Schatz! Vielen Dank!« Dann stürmte sie schnurstracks in Richtung Ausgang und verließ eilig das Lokal.
»Hey, ruf mich an, wenn du wieder in London bist!«, rief Betty ihr in letzter Sekunde hinterher. Im Gegensatz zu Agatha drängte sie es nicht, nach Hause zu kommen, denn es gab niemanden, der auf sie wartete. Verträumt lauschte sie den Klavierklängen und blieb noch eine ganze Weile dort sitzen.
Indessen begab sich Agatha schnellen Schrittes zur Bahnstation, die nur wenige Gehminuten vom Teehaus entfernt lag. In ihrer Eile bemerkte sie nicht, wie eine dunkle, hagere Gestalt ihr mit etwas Abstand folgte.
In der Bahnhofshalle herrschte ein emsiger Hochbetrieb. Um diese Uhrzeit verteilten sich Pendler und Reisende auf den diversen Bahnsteigen. Der Regionalzug nach Cartingwhole stand schon abfahrtbereit auf dem hintersten Gleis des Bahnhofs. Die Lokomotive hatte just begonnen, sich dampfend warm zulaufen. Mit einem kurzen Sprint erreichte sie den Zug gerade noch rechtzeitig und bestieg den letzten Waggon im Laufschritt. Es folgte ein schriller Pfiff, die Tür klappte mit einem Schlag zu, und der Zug setzte sich behäbig, schnaubend in Bewegung. Dichte Dampfmassen füllten die Bahnhofshalle.
Erleichtert, dass alles geklappt hatte, blieb Agatha im hintersten Abteil sitzen und betrachtete entspannt die langsam vorbeiziehende Silhouette.
Als der Zug fast vollständig aus dem Bahnhofsgebäude herausgefahren war, nahm sie aus dem Augenwinkel urplötzlich die Umrisse einer dunklen Gestalt wahr, die sich aus dem Schatten löste und vom Bahnsteig aus dem abfahrenden Zug hinterher sah. Im letzten Moment trafen sich für den Bruchteil einer Sekunde ihre Blicke. Dann verhinderten die dichten Dampfschwaden der Lokomotive ein Erkennen der Person, und Agatha überkam ein unbehagliches Gefühl.
IV.
Pünktlich um 18:30 Uhr erreichte der Regionalzug den Bahnhof von Cartingwhole. Die Bahnstation war windig und menschenleer. Reisende verirrten sich allgemein selten an diesen Ort. Selbst das Bahnpersonal war nur an wenigen Tagen in der Woche zu sehen.
Eine seltsame innere Unruhe trieb Agatha an, einen Schritt zuzulegen. Sie musste sich beeilen, wenn sie rechtzeitig vor Messebeginn in der Pfarrei sein wollte. Kein Mensch war weit und breit zu sehen.
An der Gartenpforte angekommen, nahm sie einen intensiven, fast beißenden Geruch nach Weihrauch wahr, der eindeutig aus dem Pfarrhaus kam. Eine bedrückende Stille lag über dem Haus, und Agatha überkam ein Gefühl der Angst.
Wenige Meter vor dem Hauseingang suchte sie aufgeregt in Ihrer Handtasche nach dem Hausschlüssel. Endlich hatte sie ihn gefunden. Hastig öffnete sie die Haustür und rief schon während des Eintretens laut nach Pater Antonius, um ihm ihr Ankommen mitzuteilen. Doch niemand antwortete. Obwohl sie tief im Innern nichts Gutes ahnte, redete sie sich ein, dass der Pfarrer nicht mehr mit ihrem Erscheinen gerechnet habe und ohne sie zur Kirche gegangen sei. In diesem Augenblick bedauerte sie zutiefst, ihn in den letzten Tagen so respektlos behandelt zu haben. Sie stutzte. Warum hatte sie mit einem Mal derartige Gedanken im Kopf?
Vorsichtig lief sie den Flur entlang. Dichter Rauch kam ihr entgegen und sie musste fürchterlich husten. Hastig öffnete sie die Flurfenster. Die Rauchschwaden breiteten sich unaufhaltsam im ganzen Haus aus. Sie zog ein Taschentuch aus ihrer Handtasche und hielt es sich vor Mund und Nase. Dann lief sie weiter zum Arbeitszimmer. In ihrem Kopf pochte ein intensiver Kopfschmerz. Ihr wurde schwindelig. Doch irgendetwas trieb sie an, weiterzugehen.
Um ihre Angst zu beherrschen, führte sie laute Selbstgespräche: »Das ist ja unerträglich! Wie oft habe ich ihm schon versucht klar zu machen, dass Weihrauch in die Kirche und nicht in den häuslichen Gebrauch gehört!« Während sie vor sich hin schimpfte, hoffte sie inständig auf ein promptes Dementi des Paters, aber niemand antwortete. An der Tür zu seinem Büro angekommen, blieb sie kurz stehen und lauschte. Es war gespenstisch still.
Angsterfüllt klopfte sie an und öffnete die Tür einen Spaltbreit: »Hochwürden? … Pater Antonius, ich bin es, Agatha!«, rief sie zaghaft in den Raum hinein, doch sie erhielt keine Antwort. Mutig trat sie ein. »Hallo, Hochwürden, sind Sie da? Sie bekommen ja eine Rauchvergiftung!«
Der dichte Qualm behinderte ihr die Sicht und stellte ihr fast die Luft zum Atmen ab. Zielstrebig steuerte sie auf die Fenster zu und riss diese sperrangelweit auf. Langsam zogen die Schwaden nach draußen ab. Erleichtert streckte sie den Kopf durch die Fensteröffnung - erst einmal tief Luft holen. Dann drehte sie sich um. Dabei traf Ihr Blick auf den Priester, der mit geschlossenen Augen an seinem Schreibtisch saß und zu schlafen schien.
Ihre ureigenste Empfindung ignorierend, schritt sie langsam auf ihn zu und berührte sacht seinen Unterarm. »Pater Antonius? Bitte, wachen Sie auf!«, flehte sie ihn an, aber der Pfarrer reagierte nicht. Daraufhin rüttelte sie intensiver an seiner Schulter. »So hören Sie doch, Hochwürden, Sie müssen sich für die Abendmesse vorbereiten!«, forderte sie ihn energisch auf, obwohl sie tief in ihrem Inneren erahnte, dass etwas Schreckliches geschehen war.
Wieder legte sie die Hand auf seine Schulter. Mit einem Mal geriet der Oberkörper des Paters aus dem Gleichgewicht und kippte bedrohlich auf sie zu. Zeitgleich glitt sein Arm leblos von der Unterarmlehne herab und blieb mit schlaffer, erkalteter Hand hängen. Sie wich erschrocken zurück und stieß einen lauten Schrei aus. Entsetzt starrte sie in das leichenblasse Gesicht des toten Geistlichen.
Panisch und Tränen überströmt stürmte sie fluchtartig aus dem Haus, hinaus auf die Straße, weg von diesem grauenhaften Ort.
V.
Die Kirchturmglocken läuteten zum Gebet. Die Mehrheit der Dorfbewohner strömte pflichtbewusst zur allabendlichen Andacht herbei. Jeder hoffte, einen der bevorzugten Sitzplätze in der ersten Reihe zu ergattern. Nur eine kleine Gruppe von drei Männern hatte es ganz und gar nicht eilig. Sie warteten auf dem Vorplatz der Kirche auf Pater Antonius, um noch vor dem Gottesdienst etwas Wichtiges mit ihm zu besprechen. Eine dringliche Angelegenheit, die keinen Aufschub duldete.
Einer von ihnen war Sir Anthony Farewell, der Gutsbesitzer von Cartingwhole Manor und inoffizieller Patriarch des Ortes, der mehr durch seine impulsive Art als seine Attraktivität auf sich aufmerksam machte. Bei ihm standen Mr. Mason, sein Gutsverwalter, und Mr. Hollister, der Koch des hiesigen Restaurants Red Lion.
Mr. Mason war Ende vierzig und von muskulöser, hochgewachsener Statur. Sein rückwärts gebürstetes, dunkles Haar, die hohe Stirn und ein Ansatz von Gemeinratsecken ließen ihn tiefgründig und besonnen wirken. Seine äußere Erscheinung fand beim weiblichen Geschlecht großen Anklang. Ganz im Gegensatz zu Mr. Hollister, der mit seinen Mitte vierzig kurzgliedrig und gedrungen wirkte. Sichtbar übergewichtig, trug er seinen alten Sonntagsanzug mit weit offenstehendem Jackett, da die prominente Wölbung seines Bauches ein Schließen unmöglich machte. Seine runde Kopfform endete in einem ausgeprägten Doppelkinn, welches er unter einem gestutzten, dunklen Vollbart zu kaschieren versuchte.
Sir Anthony Farewell war soeben dabei, die beiden anderen in seine eigene Form des Gebetes zu nehmen, als er die heranstürmende, in Tränen aufgelöste Agatha Collins bemerkte. Er brach mitten im Satz ab, trat instinktiv einen Schritt zur Seite und fing die hysterische Frau mit seinen Armen ab. Wie einen durchgebrannten Gaul hielt er sie fest umklammert und redete auf sie ein: »Ho, hiergeblieben! Jetzt beruhigen Sie sich! Was ist denn in Sie gefahren? Sie benehmen sich ja, als wäre der Leibhaftige hinter Ihnen her!« Er musterte sie besorgt und erkannte, dass die junge Frau offensichtlich unter Schock stand. Sie zitterte am ganzen Körper, und ihr abwesender Blick war ins Nichts gerichtet.
Die Männer sahen sich irritiert an. Sir Anthony schüttelte die junge Frau behutsam, bis sie endlich zu sich kam. Sie starrte ihn furchterfüllt an.
»Agatha, jetzt reden Sie schon!«, forderte der Gutsherr sie eindringlich auf. Geduld gehörte eindeutig nicht zu seinen Stärken. Mr. Mason erkannte den Ernst der Lage und gab sich fürsorglich. Er zog sein Jackett aus und legte es der bibbernden Frau um die Schultern. Dann fragte er mit einfühlsamer Stimme: »Mrs. Collins, hören Sie mich? Reden Sie! Was ist passiert?«
Sie drehte ihm langsam den Kopf zu und sah ihn wortlos an. Der Schreck über das Erlebte saß so tief, dass es ihr die Sprache verschlagen hatte. Nun trat Mr. Hollister in Aktion. Gentlemanlike zog einen mit Cognac gefüllten Flachmann aus der Innentasche seiner Jacke hervor und bot ihn der bibbernden Frau an. »Hier, ich hab´ was Stärkendes für Sie. Trinken Sie, das wird Ihnen gut tun«, sagte er höflich und sah sie aufmunternd an.
Mr. Mason schüttelte fassungslos den Kopf.
»Was ist?«, reagierte Mr. Hollister unwirsch. »Ich bin Koch. Das gehört sozusagen zu meiner Grundausstattung.«
Sir Anthony stöhnte laut, aber der Koch blieb hartnäckig. Unverdrossen reichte er Agatha seinen Flachmann, die vertrauensvoll einen kräftigen Schluck von dem hochprozentigen Gebräu zu sich nahm. Der Alkohol floss brennend ihre Kehle hinab und löste einen heftigen Hustenreiz aus. Der Koch klopfte ihr behutsam auf den Rücken, bis der Husten sich legte und sagte generös: »Ja, Mädchen, so ist es richtig! Das putzt den Rachen und beruhigt die Nerven! Sie werden sich gleich viel wohler fühlen!«
Sir Anthony schob Mr. Hollister genervt mit einer Hand zur Seite und fauchte: »Lassen Sie endlich mal die Frau zu Wort kommen!« Dann wandte er sich Agatha zu und sprach mit eindringlichem Ton: »Also, jetzt reden Sie schon. Was ist geschehen?«
Der Cognac zeigte Wirkung und sie gewann langsam ihre Fassung wieder. Unter heftigem Schluchzen schilderte sie den Männern, was sie im Pfarrhaus erlebt hatte und schloss mit den Worten: »Sir, es ist so schrecklich! Pater Antonius ist tot … und … und ich bin an allem schuld!« Dann begann sie bitterlich zu weinen.
Die drei Männer sahen sich ratlos an. Keiner von ihnen wusste, mit einer übersensiblen Frau richtig umzugehen. Schließlich ergriff Sir Anthony die Initiative und verkündete mit dominanter Stimme: »Es gibt nur eine Möglichkeit, meine Herren, wir werden uns selbst einen Überblick verschaffen. Möglicherweise ist es noch nicht zu spät! Mr. Mason, Mr. Hollister, kommen Sie, die Zeit drängt!« Er hielt inne, grübelte und setzte überlegt fort: »Agatha, Sie bleiben besser hier und begeben sich zu den anderen in die Kirche. Dort sind Sie sicher. Ihre Verfassung ist zu labil, um uns in die Pfarrei zu begleiten. Überlassen Sie das uns Männern und entspannen sich ein wenig.« Sein Gesicht drückte Entschlossenheit aus.
Sie nickte gehorsam und suchte in ihrer Tasche nach einem Taschentuch, mit dem sie die Tränen abwischte.
Mr. Mason stimmte Sir Anthony einvernehmlich zu und machte Anstalten, Mrs. Collins zur Kirche zu geleiten. Doch unverhofft drängte sich Mr. Hollister auf, diesen Part übernehmen zu wollen. Auffällig nervös setzte er alles daran, die anderen nicht ins Pfarrhaus begleiten zu müssen.
Sir Anthony, der den Koch für einen ausgemachten Schwächling hielt, packte diesen energisch am Arm und fuhr ihn herrisch an: »Mr. Hollister, die junge Dame wird den Weg in die Kirche auch ohne Sie finden. Das gilt auch für Sie, Mr. Mason! Verstanden?« Sein Blick war in diesem Augenblick derart durchdringend, dass Mrs. Collins ein kalter Schauer über den Rücken lief.
Niemand traute sich, dagegen aufzubegehren.
Zufrieden über die angeordnete Einigkeit, ließ er den Arm des Kochs endlich los, nicht ohne vorher nochmals bewusst zugedrückt zu haben. Es war seine Art, die Dinge klarzustellen. Mr. Hollister rieb sich am Oberarm und schwieg.
Gerade als sie zum Pfarrhaus aufbrechen wollten, wurde das Kirchenportal von innen geöffnet, und eine ansprechende, zierliche, junge Frau mit langem, blondem Haar trat ins Freie heraus. Es war die Ehefrau des Gutsbesitzers, Lady Josephine Farewell. Nichtsahnend rief sie ihrem Mann mit vorwurfsvollem Ton entgegen: »Anthony, was ist los? Wo bleibt ihr denn? Hast du Pater Antonius gesehen? Er sollte schon längst da sein!« Da ihr Gemahl nicht darauf antwortete, fuhr sie unleidig fort: »Anthony, bist du taub? Hättest du die Güte, dich darum zu kümmern?« Der Gutsherr ignorierte die Nörgeleien seiner Ehefrau und kehrte ihr demonstrativ den Rücken zu.
Lady Josephine war irritiert. Verstört sagte sie: »Anthony, ich will sofort wissen, was hier los ist?«
Agatha setzte sich lethargisch in Bewegung und schritt langsam auf Lady Josephine zu. Als sie unmittelbar vor ihr stand, sah sie Agathas verweinte Augen und befürchtete das Schlimmste. Sie wusste nur zu gut, dass Ihr Ehemann bisweilen unberechenbar sein konnte. Wenn er die Kontrolle über seine Gefühle verlor, war grundsätzlich alles möglich. Zornig sah sie zu ihm hinüber und wartete auf eine Erklärung.
Als ginge das Ganze Sir Anthony nichts an, sah er nach hinten über die Schulter und drehte sich langsam zu ihr um. Dann erwiderte er mit aufgesetzter Höflichkeit: »Josephine, Darling, irgendwann wirst du es ja doch erfahren. Es hat sich etwas Schicksalhaftes ereignet. Pater Antonius, er …« Er brach den Satz bewusst ab, um die Dramatik der Ereignisse zu steigern.
Lady Josephines Augen weiteten sich vor Schreck. Sie wurde kreidebleich. Besorgt fragte sie: »Was ist mit Pater Antonius? Warum quälst du mich so?« Sir Anthony genoss seine Überlegenheit und zelebrierte das nervenzerreißende Schweigen, bis Mr. Mason dem erniedrigenden Szenario ein jähes Ende setzte. Mit wenigen Worten erklärte er: »Mylady, Agatha fand Pater Antonius tot in seinem Arbeitszimmer vor. Wir wollten soeben zum Pfarrhaus hinübergehen und nach dem Rechten sehen.«
Lady Josephine drohte in Ohnmacht zu fallen. Mr. Mason bereitete sich vor, sie aufzufangen, aber die Gutsherrin stützte sich gerade noch rechtzeitig ab. Mr. Hollister streckte ihr seinen inzwischen deutlich geleerten Flachmann entgegen, was diese jedoch mit einer dankenden Handbewegung ablehnte.
Es herrschte unter den Anwesenden eine betretene Stille.
Nach längerem Schweigen fragte Lady Josephine überfordert: »Oh Gott, was sollen wir jetzt tun? Wir können doch nicht hier herumstehen und nichts tun!« Sie sah jeden in der Runde konsterniert an.
Sir Anthony erwies sich abermals als ungehobelter Klotz und bemerkte abfällig: »Was wir tun sollen?« Er grinste sie provokant an und setzte überheblich hinzu: » Ich bitte dich, Darling, nichts! Werd´ bloß nicht hysterisch! Das ist der Lauf der Dinge, meine Liebe! Jeder stirbt einmal. Auch Pfarrer sind nicht unsterblich und haben ein Recht darauf, Engel zu werden.« Seine taktlose Äußerung löste eine fassungslose Bestürzung bei den anderen aus. Diesmal war er eindeutig zu weit gegangen.
Als der Gutsherr um sich herum die verärgerten Gesichter registrierte, ruderte er sofort zurück und sagte mit ungewohnt versöhnlicher Stimme: »Schon gut, ich hab´ es nicht so gemeint. Hey, jetzt kriegt euch mal wieder ein. Das Ganze ist eben nichts für die schwachen Nerven des weiblichen Geschlechts. Es ist, wie es ist. Ihr Frauen neigt grundsätzlich zu einer übersteigerten Gefühlsduselei. Stimmt doch, Schatz, oder?«
Mr. Mason hätte in diesem Augenblick am liebsten seinem Vorgesetzten einen kräftigen Faustschlag versetzt. Die nötige Kraft dazu hatte er. Doch er wusste sich zu beherrschen und hielt seine Gefühle unter Kontrolle. Mitleidig sah er zu Lady Josephine, die ihrerseits ihren Ehemann charakterstark ansah und eisern schwieg.
Da die Gutsherrin sich verbal nicht zur Wehr setzte, verkündete Sir Anthony despotisch mit scharfem Befehlston: »Also, Herzblatt, ich erwarte von dir, dass du dich umgehend mit Mrs. Collins auf das Anwesen begibst. Ich regele inzwischen die notwendigen Begebenheiten vor Ort und komme später nach. Und lass dir nicht einfallen, irgendwo herumzustreichen!«
Sie nickte gehorsam und erwiderte leise: »Natürlich, ganz wie du meinst, Darling.« Ohne den Hauch eines Widerspruchs nahm sie Agatha fürsorglich bei der Hand und ging mit ihr in Richtung Parkplatz.
Sir Anthony sah ihnen beunruhigt hinterher. Er misstraute dem ungewohnten Frieden. Dann befahl er seinem Gutsverwalter, den Dorfbewohnern mitzuteilen, dass die Abendmesse heute nicht stattfinden könne, da der Pater unpässlich sei. »Die Allgemeinheit muss ja nicht gleich wissen, dass er tot ist«, bemerkte er lapidar und setzte ein anmaßendes Grinsen auf.
Mr. Mason hasste den ruppigen Umgangston seines Arbeitgebers. Da kam es ihm nur recht, dass er sich auftragsgemäß entfernen durfte. Im Laufschritt steuerte er auf das Kirchenportal zu. Als er auf gleicher Höhe mit den Frauen angekommen war, verlangsamte er das Tempo und schloss sich ihnen an, woraufhin Sir Anthony bissig seiner Gattin hinterherrief: »Ach, Darling, bitte halte Mr. Mason nicht unnötig auf. Ich brauche ihn im Pfarrhaus. Das Trösten muss er auf später verschieben!«
Agatha Collins sah Lady Josephine verwundert von der Seite an. Aber ihre Begleiterin reagierte nicht auf den spöttischen Zuruf ihres Ehemannes und schritt mit regungsloser Miene unbeirrt voran. Der Koch schmunzelte. Endlich hatte nicht er, sondern ein anderer den Zorn Sir Anthonys zu spüren bekommen.
Der Gutsherr war außer sich vor Wut. Er fühlte sich von seiner Gemahlin verspottet und gedemütigt. Unfähig, sein aufgewühltes Temperament unter Kontrolle zu halten, entlud er seinen Groll auf Mr. Hollister und schnauzte ihn lautstark an: »Was gibt es da zu grinsen, hm? Sind Sie so dämlich oder tun Sie nur so?« Der Koch zuckte erschrocken zusammen und duckte sich instinktiv, derweil Sir Anthony ihn fortwährend verbal attackierte: »Los, Mann, beweisen Sie mir, dass Sie ein echter Kerl sind! Wir gehen jetzt zum Pfarrhaus hinüber! Oder beabsichtigen Sie, den ganzen Tag hier herumzustehen? Wird´s bald?«
Das Gesicht des dicklichen Mannes wurde aschfahl. Die bloße Vorstellung, dem toten Pater gegenüberzutreten, erfüllte ihn mit großem Unbehagen. Er hatte jetzt schon weiche Knie. Hinzu kam, dass seine letzte Beichte geraume Zeit zurücklag und ihn ein schlechtes Gewissen plagte. Auf der anderen Seite duldete Sir Anthony keine Widerworte. Unfähig, sich der Situation couragiert entgegenzustellen, folgte er widerwillig Sir Anthonys Aufforderung und trottete ihm mit etwas Abstand hinterher. Dabei wiederholte er in seinem Geiste einen einzigen Gedanken immer und immer wieder: »Eines Tages bringe ich ihn um!«
VI.
Mr. Hollister hoffte inständig, dass der Gutsverwalter sich baldigst wieder zu ihnen gesellen möge, denn es ängstigte ihn, allein mit Sir Anthony das Haus betreten zu müssen.
Sie passierten gerade die Gartenpforte zur Pfarrei, als sich Mr. Mason im sportlichen Lauftempo näherte und ihnen anschloss. Sir Anthony hatte sich glücklicherweise wieder beruhigt und gab sich normal. Alle drei tauschten ernste Blicke untereinander aus, bevor sie mit einem mulmigen Gefühl auf das Haus zuschritten.
Der Anblick war gespenstisch. Sämtliche Fenster samt Haustür standen sperrangelweit offen. Es war unheimlich anzusehen, wie aus den Öffnungen diffuse Nebelschwaden nach draußen drangen. Überallhin verströmte sich ein intensiver Weihrauchduft.
Zögernd bewegten sich die Männer auf den Hauseingang zu. Keiner wagte zu sprechen, denn jeder rechnete mit dem Schlimmsten. Mr. Mason durchbrach als erster das Schweigen und sagte angeekelt, während er hastig ein zerknülltes Taschentuch aus der Hosentasche zog und es vor Mund und Nase hielt: »Mein Gott, was für ein bestialischer Gestank! Das ist ja widerwärtig! Das raubt einem schier die Luft zum Atmen!«
Mr. Hollister tat es ihm gleich und flüsterte gehemmt: »Sicher ist Pater Antonius in dem Qualm erstickt.« Sir Anthony und Mr. Mason sahen ihn vorwurfsvoll an, und der Koch fügte erklärend hinzu: »Was starren Sie mich so merkwürdig an? Würde Sie das bei diesem Rauch etwa wundern?«
Der Gutsherr erwiderte mit scharfer, aber dennoch gedämpfter Stimme: »Zum Kuckuck noch mal, Hollister, werden Sie jetzt nicht kindisch! Das sind doch Spinnereien, was Sie da faseln! Reißen Sie sich zusammen, Mann!« Der Koch errötete und richtete seinen Blick wie ein Kind, das Schelte bekommen hatte, verlegen zu Boden. Der Gutsherr stieß ihn unsanft zur Seite und bahnte sich seinen Weg an ihm vorbei in das Haus. Damit bemühte er sich, nach außen hin als Herr der Lage dazustehen, obwohl er gleichwohl ein hohes Maß an Furcht empfand.
Mr. Mason, der erstaunlich resolut wirkte, folgte seinem Dienstherrn, und Mr. Hollister bildete wie üblich das Schlusslicht. Da jedem von ihnen die Räumlichkeiten bestens bekannt waren, nahmen sie den direkten Weg zum vermeintlichen Ort des Geschehens.
Vor der Tür zum Büro blieben sie kurz stehen und lauschten. Dann stieß Sir Anthony die angelehnte Tür vorsichtig auf. Die Türangel quietschte, und ein unvermittelter Luftzug bewirkte an einer anderen Stelle im Haus das unvorhergesehene Zuschlagen eines offenen Fensters. Der laute Knall ließ alle vor Schreck zusammenzucken.
Sir Anthony stöhnte entnervt und betrat allen voran das Arbeitszimmer. Urplötzlich blieb er stehen und starrte zum Schreibtisch hin. Kurz darauf verschlug es auch seinen Begleitern den Atem, als sie den regungslosen Körper des Pfarrers erblickten.
Die Leiche des Paters hing mit wachsbleichem Gesicht leblos über der Armlehne seines Stuhles und drohte jeden Moment herunterzurutschen. Direkt vor ihm stand auf dem Schreibtisch ein Weihrauchgefäß, aus welchem unermüdlich seichte Nebeldämpfe emporstiegen, die den Raum in ein gespenstisches Licht tauchten.
Sir Anthony trat vorsichtig an den Toten heran und musterte ihn aus der Nähe. Nach längerem Betrachten tönte er wenig respektierlich: »Tja, alter Knabe, das war´s hier auf Erden! Irgendwann muss jeder gehen. «Dann wandte er sich an seine Begleiter und sprach: »Ich finde seinen Abgang ein bisschen trivial, wenn ich ehrlich bin. Das entspricht so gar nicht seinem Charakter.«
Mr. Mason hatte genug von dem Geschwätz seines Dienstherrn und wies ihn empört zurecht: »Bitte? Was sind Sie nur für ein Mensch? Sie haben wirklich keine Achtung vor den Toten.« Er schüttelte entsetzt den Kopf und zeigte ihm die kalte Schulter.
Sir Anthony lachte kurz verächtlich auf. »Hört, hört, ein wahrer Kämpfer für Recht und Ordnung! Wollen Sie mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe, Mason? Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram!« Er sah ihn mit blitzenden Augen an.
»Mir missfällt Ihr anmaßendes und pietätloses Benehmen!«, erwiderte der Gutsverwalter und baute sich demonstrativ in voller Größe vor seinem Vorgesetzten auf. Die Gemüter fingen erneut an, sich zu erhitzen.
Mr. Hollister ging vorsichtshalber in Deckung, denn er rechnete jeden Augenblick mit einer handfesten Gegenwehr Sir Anthonys. Der Gutsherr positionierte sich indessen mit geballten Fäusten vor seinem Widersacher, um ihn gegebenenfalls mit einem Fausthieb aus dem Ring zu schlagen. Er hatte ohnehin noch eine Rechnung mit ihm offen, denn schon mehrfach hatte sein Gutsverwalter ihm vorgehalten, eiskalt und berechnend zu sein. Natürlich hätte er ihn für diese Äußerung auf der Stelle aus seinen Diensten entlassen können, aber bedauerlicherweise war er auf ihn angewiesen – das wusste Mr. Mason für seine Belange auszunutzen.
Die beiden starrten sich mit unbarmherzigen Mienen an. Die Nerven aller waren zum Zerreißen gespannt.
Der Koch suchte nervös nach einer schnellen Lösung, mit der er die verfahrene Situation deeskalieren konnte. Er kam zu dem Schluss, dass es am besten war, wenn er auf das eigentliche Geschehen aufmerksam machte und bemerkte mit zaghafter Stimme: »Äh, Verzeihung, meine Herren, wäre es nicht besser, jetzt die Polizei zu informieren? Ich denke, irgendwer sollte den Vorfall melden.«
Aber niemand schenkte ihm Beachtung. Immer noch herrschte zwischen den beiden Männern ein imaginäres Duell, bis Sir Anthony mit bedrohlicher Stimme und einem zornigen Gesichtsausdruck ausrief: »Sie mögen mit Ihrer Art an anderer Stelle Erfolg haben, aber nicht bei mir. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, der Hausherr von Cartingwhole Manor bin immer noch ich!«
Mr. Hollister räusperte sich demonstrativ, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, und sagte: »Unterrichten wir den Bischof über das Geschehene, oder macht das die Polizei? Die Gemeinde benötigt schleunigst einen Ersatz für Pater Antonius. Ich habe keine Lust, für eine Sonntagsmesse ins Nachbardorf zu rennen.« Seine triviale Wortmeldung zeigte Wirkung. Beide Kontrahenten sahen ihn irritiert an.
Sir Anthony rief verdutzt: »Bitte was? … Wen wollen Sie informieren … den Bischof? Ja, sind Sie noch bei Trost?«
»Aber, ich meinte ja nur …«, ruderte Mr. Hollister kleinlaut zurück, derweil der Gutsherr fassungslos den Kopf schüttelte. Mr. Mason holte tief Luft und erwiderte: »Na, Ihre Sorgen möchte ich haben! Der Pater ist tot, und Sie denken ausschließlich an Ihre persönliche Bequemlichkeit! Das ist doch nicht zu fassen!«
Mr. Hollister zuckte verlegen mit den Achseln. »Ich wollte doch nur …«
»Schluss damit!«, zischte Sir Anthony herrisch. »Dies ist nicht der geeignete Moment für derartige Diskussionen. Jetzt hören Sie beide mir mal aufmerksam zu und tun gefälligst, was ich Ihnen sage. Sie, Mason, teilen der Gemeinde mit, dass ich morgen um zehn Uhr in der Kirche eine offizielle Versammlung abhalten werde. Und Sie, Hollister, kehren schnellstens an den heimischen Herd zurück, da können Sie wenigstens keinen Unfug anrichten. Mann, Sie verlieren einfach zu schnell die Nerven!«
Der Koch trat ans Fenster und schmollte. Nur ein leises Zucken seines rechten Auges verriet, dass er innerlich vor Wut kochte. Zum wiederholten Male hatte Sir Anthony ihn bis ins Mark getroffen. Er schwor sich, dass der Tag der Revanche nicht mehr allzu weit in der Ferne liegen würde.
Während Mr. Hollister in Gedanken seine Rachepläne ausschmückte, bemerkte Mr. Mason: »Und was gedenken Sie in der Zwischenzeit zu tun, Sir?« Es lag der Hauch Zynismus in seiner Stimme.
Der Gutsherr sah ihn grimmig von der Seite an. »Na, was schon, ich werde höchst selbst den Vorfall bei Scotland Yard melden. Was dachten Sie denn?«
Mr. Mason nickte zufrieden und ging auf den Koch zu, der gedankenversunken am offenen Fenster stand. Er legte freundschaftlich seine Hand auf dessen Schulter und sprach: »Kommen Sie, Mr. Hollister, wir gehen. Draußen ist die Luft ohnehin viel besser.« Der Koch zuckte kurz zusammen und nickte. Dann bekreuzigte er sich vor dem toten Pater und verließ gemeinsam mit Mr. Mason den Raum. Dabei ließ er es sich nicht nehmen, dem Gutsherrn einen eiskalten Blick zuzuwerfen.
Sir Anthony grinste geringschätzig und rief den beiden hinterher: »Ach, Mason, sehen Sie zu, dass er keine Dummheiten macht! Sie wissen schon!«
Der Gutsverwalter drehte sich auf der Türschwelle um, lächelte vielsagend und sprach: »Das wird er nicht, Sir, es sei denn …«
»Verziehen Sie sich!«, schnauzte ihn Sir Anthony wütend an und richtete den gestreckten Zeigefinger auf ihn, »Ich warne Sie, legen Sie sich nicht mit mir an!« Sein Kopf war hochrot, und aus den Augen blitzte der blanke Zorn.
Mr. Mason lachte unvorhergesehen kurz und bitter auf. »Ist das eine Drohung? Das würde ich mir an Ihrer Stelle sehr gut überlegen.«
»Verschwinden Sie! … Aber sofort!«
»Mit Vergnügen!«, antwortete der Gutsverwalter prompt, drehte sich um und verließ mit einem zufriedenen Gefühl das Pfarrhaus. Draußen wartete Mr. Hollister auf ihn. Beide tauschten einen vielsagenden Blick aus, bevor jeder seiner Wege ging.
VII.
Sir Anthony hatte alles vom Fenster aus beobachtet und ärgerte sich über Mr. Masons Unverfrorenheit und Mr. Hollisters Untauglichkeit. Er fühlte sich von ihnen ungerecht behandelt.
Als beide nicht mehr zu sehen waren, ließ er sich grübelnd auf dem Sessel vor dem Fenster nieder. Jetzt hätte er einen Drink gebrauchen können. Minutenlang hing er seinen Gedanken nach und starrte unentwegt auf den Toten, währenddem er nervös mit seinen Fingern auf die Armlehne trommelte. Dann erhob er sich, ging auf Schreibtisch zu und griff entschlossen zum Telefon. Nachdem er sich lässig auf die Tischkante gesetzt hatte, zog er den Apparat zu sich hin, nahm den Hörer ab und wählte das Amt. Die Leitung war miserabel. Erst nach mehrmaligem Drücken auf die Gabel hatte er Glück. Aufgebracht rief er in die Muschel: »Fräulein? Hören Sie mich? Hallo? … Vermittlung, ich brauche eine Verbindung zu Scotland Yard … Ja, aber natürlich ist es wichtig. Wie bitte? ... Was ich will? ... Ich habe einen Toten zu melden!« Es entstand eine kurze Pause, bevor er endlich mit Scotland Yard verbunden war. Nachdem er ordnungsgemäß die Ereignisse einem Polizeibeamten geschildert hatte, folgte zum Schluss die übliche Belehrung, nichts anzufassen oder zu verändern, bis jemand vom Yard vor Ort sei. Außerdem solle er sich für die Polizei zur Verfügung halten und den Ort vorerst nicht verlassen.
»Ja doch«, raunzte Sir Anthony unfreundlich in den Telefonhörer. Er hasste es, von Wichtigtuern belehrt zu werden. Seine Geduld war am Ende. »Hören Sie, Constable, ich bin kein Trottel. Ich weiß selbst, was zu tun ist. Sagen Sie mir lieber, ob es lange dauern wird, bis jemand kommt?« Während der Polizist weiter auf ihn einredete, wickelte er angespannt die Telefonschnur um seinen Zeigefinger und schaltete auf Durchzug. Nachdem er zum Schluss seine Personalien angegeben hatte, war das Gespräch endlich beendet und Sir Anthony knallte wütend den Hörer auf die Gabel. »Ich Rindvieh, warum bin ausgerechnet ich hiergeblieben?«, schimpfte er mit sich selbst.
Verärgert schubste er den Apparat zurück an seinen Platz. Dabei kam ein Stapel abgelegter Briefe in Bewegung. Sir Anthony erkannte, dass es sich um Schriftstücke vom bischöflichen Ordinariat handelte. Mit einem Mal vollzog sich in ihm ein unerwarteter Sinneswandel. Wieso nicht die Gelegenheit nutzen und sich hier ganz nebenbei etwas umsehen? Sicher gab es allerlei Interessantes zu entdecken. Bislang hatte er immer einen guten Riecher für die Geheimnisse anderer Menschen gehabt.
Voller Neugier nahm er den Schreibtisch des Paters etwas genauer unter die Lupe. Dabei weckte das sorgfältig zusammengelegte Packpapier mit der Dankeskarte sein besonderes Interesse. Ungeniert hob er die Karte auf und las sie. Das Geschreibsel amüsierte ihn. Mit verächtlicher Stimme brummelte er vor sich hin: »Du liebe Güte, was für ein wichtigtuerisches Gefasel … ein dankbarer Freund. Mumpitz!« Mit einer abwertenden Geste warf er lässig die Karte zurück auf den Stapel und stöberte weiter. Am liebsten hätte er sich zusätzlich den Inhalt der Schubladen angesehen, aber die Gegenwart des Toten hielt ihn letztlich davon ab.
Enttäuscht, nichts Skandalöses gefunden zu haben, stellte er sich mit verschränkten Armen vor den Leichnam, sah ihn vorwurfsvoll an und sprach: »Warum nur, alter Knabe, konnten Sie nicht, wie jeder anständige Bürger, in einem Krankenhaus sterben?« Er hielt inne, als ob er eine Antwort erwartete und setzte hinzu: »Ihretwegen muss ich jetzt stundenlang hier ausharren und auf die Ordnungshüter warten! Ein schöner Schlamassel ist das!«
Er betrachtete das Angesicht des Verstorbenen. Irgendetwas störte ihn. Er beugte sich langsam zu dessen Gesicht vor und wich sofort erschrocken wieder zurück. Die Gesichtszüge des Toten waren auf seltsame Weise verzerrt, als würde der Pater jeden Moment die Augen aufreißen. Sir Anthony lief ein eiskalter Schauer über den Rücken. Fluchtartig drängte es ihn nach draußen. Sein Herz pochte vor Aufregung und sein Schädel hämmerte. Er bekam es mit der Angst zu tun. Ihm war plötzlich schwindelig. Schwankend stürmte er den Flur entlang ins Freie. Immer wieder suchte er an den Wänden Halt, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
Endlich stand er im Freien. Die Hände auf den Oberschenkeln abgestützt, pumpte er seine Lungen mit Sauerstoff voll. Nach einer Reihe von tiefen Atemzügen erholte er sich langsam und ließ sich erschöpft auf der Bank vor dem Haus nieder. Was war soeben geschehen? Er hatte plötzlich das unbestimmte Gefühl, dass hier etwas nicht stimmte. Entkräftet schlief er über seinen Gedanken ein.
Die Ermittlungen laufen an
I.
In der Zwischenzeit war die eingegangene Meldung an den Polizeipräsidenten weitergeleitet worden, der seinerseits Chief Inspector Duncan kontaktierte und ihn aufforderte, sich unverzüglich der Klärung dieses Falles anzunehmen. Immerhin handelte es sich bei dem Toten um eine Person des öffentlichen Lebens. Eine spekulative Debatte in der Presse galt es tunlichst zu vermeiden, und bedurfte der Aufklärung durch einen der fähigsten Männer von Scotland Yard.
Der Polizeipräsident schätzte Duncans verschwiegene und präzise Arbeitsweise. Trotz seines jungen Alters hatte er ein ausgezeichnetes Gespür für kriminalistische Handlungen entwickelt und war ein Ausnahmetalent, wenn es darum ging, Intuition und Deduktion gleichermaßen einzusetzen. Die hohe Zahl aufgeklärter Verbrechen war ein eindeutiger Beleg für seine Befähigung. Es gab nur ein Thema, welchem Duncan reserviert und mit äußerstem Misstrauen gegenübertrat: Das weibliche Geschlecht – zum Bedauern vieler angesehener Londoner Familien, die ihn nur allzu gerne als Schwiegersohn gesehen hätten. Kurzum, er war ein Mann mit präzisem Verstand und sah darüber hinaus unverschämt attraktiv aus. Groß, soldatisch, mit sanften, dunkelbraunen, tiefgründigen Augen und einer geradlinigen, uneitlen Art.
Der Polizeipräfekt überreichte dem Inspector kurz gefasst das eingegangene Meldeprotokoll und ließ ihn wissen, dass er eine schnelle Klärung erwartete. Duncan nickte, fühlte jedoch, dass sich hinter den Ereignissen mehr verbarg, als es zum jetzigen Zeitpunkt den Anschein hatte. Insgeheim hoffte er auf einen herausragenden Fall, der seinen Denkapparat überdurchschnittlich forderte.
Wenige Minuten später verließ Duncan das Büro des Polizeipräsidenten. In seinem Kopf lief sein Geist auf Hochtouren. Er beschloss, zunächst Sergeant Jack Adcock zusammen mit Dr. Dylan Bennet, einem erfahrenen Gerichtsmediziner, nach Cartingwhole zu schicken. Auf diese Weise konnte der junge Polizeibeamte seine eigenen kriminalistischen Fähigkeiten weiterentwickeln, und er hatte dadurch genügend Zeit, um hiesige Recherchen durchzuführen.
Dr. Bennet genoss das uneingeschränkte Vertrauen Duncans. Zwischen ihm und dem Arzt bestand eine langjährige, vertrauensvolle Freundschaft. Gemeinsam hatten sie unzählige Verbrechen aufgedeckt und jedes Mal ein perfektes Ermittlerteam abgegeben. Daher wusste er, dass dieser ein wachsames Auge auf den unerfahrenen Kollegen haben würde.
Auch wenn Sergeant Adcock noch viel zu lernen hatte, so verfügte er doch bereits über die notwendigen detektivischen Kenntnisse, ein Kapitalverbrechen enttarnen zu können. Ehrgeizig und höchst motiviert versuchte er, seinem Vorgesetzten nachzueifern – und heute sollte er die Gelegenheit dazu bekommen.
II.
Sobald Duncan Sergeant Adcock entsprechend instruiert hatte, fuhren der junge Polizeibeamte und Dr. Bennet nach Cartingwhole. Sie brauchten eine ganze Weile, bis sie das Londoner Verkehrschaos hinter sich gelassen hatten. Der Weg über die Landstraße dauerte eine knappe Stunde. Endlich angekommen, erreichten sie nach kurzem Suchen die Pfarrei und stellten den Wagen am Straßenrand ab.
Sir Anthony saß bei ihrem Eintreffen schlafend auf der Bank vor dem Pfarrhaus. Erst das Zuschlagen der Wagentüren, führte zu einem abrupten Ende seines Nickerchens. Müde blinzelnd sah er im Gegenlicht der Abendsonne zwei Personen direkt auf sich zukommen. Schützend hob er die Hand vor Augen. Die Männer waren ihm fremd und sahen überhaupt nicht nach Polizeibeamten aus.
»Guten Abend, Sir! Wir möchten zur Pfarrei. Sind wir hier richtig?«, erkundigte sich der Sergeant höflich, derweil er nähertrat und sich orientierend umsah. Sir Anthony nickte, erhob sich und fragte missmutig: »Sind Sie von Scotland Yard?«
»Ja, so ist es«, bestätigte Adcock, kramte aus seiner Tasche die Dienstmarke hervor und hielt sie ihm vors Gesicht. »Ich bin Sergeant Adcock und dies ist mein Begleiter Dr. Bennet aus der Gerichtsmedizin. Wir sind hier, um einen Todesfall abzuklären. Haben Sie im Yard angerufen?«
Der Gerichtsarzt stand stillschweigend daneben und beobachtete das Geschehen.
Sir Anthony war außer sich vor Erregung. Was für eine bodenlose Unverschämtheit, ihm einen gewöhnlichen Sergeanten zur Klärung der Sachlage vorbeizuschicken. Nur mit Mühe gelang es ihm, nicht ausfallend zu werden. Um sich Respekt zu verschaffen, setzte er alles daran, die beiden Beamten über die Bedeutung seiner Person aufzuklären. »Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Ich bin Sir Anthony Farewell, der Gutsherr von Cartingwhole Manor und Ortsvorsteher. Meine Zeit ist kostbar, denn ich habe eine Vielzahl anderer Verpflichtungen, denen ich nachzukommen habe. Wissen Sie eigentlich, wie lange ich hier schon auf Ihr Erscheinen warte?«, polterte er ungebremst los. »Ein toter Seelsorger auf dem Land ist für Scotland Yard scheinbar nicht imposant genug, ansonsten hätte man wohl kaum eine Hilfsmannschaft geschickt!«
Die Beamten sahen ihn fassungslos an. Mit einem derartigen Gefühlsausbruch hatten sie wahrlich nicht gerechnet. Adcock kniff angespannt die Augen zusammen und erwiderte mit scharfer Stimme: »Mäßigen Sie sich, Sir!«
Doch der Gutsherr setzte mit gewohnt vorwurfsvollem Ton fort: »Hören Sie, erledigen Sie endlich Ihre Arbeit, damit ich nach Hause fahren kann!«
Dr. Bennet stand kurz davor, helfend einzugreifen, als Adcock ihm zuvorkam und erklärte: »Sir, ich verstehe Ihren Unmut. Chief Inspector Duncan bittet Sie, hier auf ihn zu warten. Bis zu seinem Eintreffen müssen Sie daher mit uns Vorlieb nehmen.«
Der Gerichtsmediziner bewunderte den jungen Kollegen, der äußerlich so gelassen wirkte. Er hätte sich in solch einer Situation mit Sicherheit zu einer schroffen Erwiderung hinreißen lassen.
Als der Gutsherr erneut ansetzte, die beiden auf das Heftigste zu beschimpfen, fuhr Dr. Bennet ihm scharf ins Wort: »Was Sie wünschen, Sir, ist bestenfalls von untergeordneter Bedeutung. Ihre Meinung ist hier nicht von Belang!«
Sir Anthonys Gesicht verfärbte sich purpurrot, und seine Augen blitzten gefährlich auf. Cholerisch schnauzte er zurück: »So lasse ich nicht mit mir umgehen! Ich habe in meinem Freundeskreis einflussreiche Herren aus Politik und Juristerei! Ich …«
Der Sergeant machte eine beschwichtigende Handgeste und unterbrach den Wortschwall des Gutsherrn: »Ausgezeichnet, Sir! Ein Mann in Ihrer Position verfügt mit Sicherheit über einen Gutsverwalter und weitere Angestellte, die in Ihrer Abwesenheit diverse Aufgaben für Sie übernehmen können?«





























