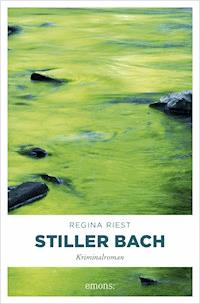Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ermittlungen auf schwäbische Art: raffiniert, spannend, liebenswert. Am Schreckensee in Oberschwaben taucht eine Moorleiche auf. Forscher wittern einen sensationellen Fund aus der frühsteinzeitlichen Siedlungsgeschichte des Sees – bis die Untersuchung der Leiche einen ganz anderen Schluss nahelegt und die Kriminalpolizei auf den Plan ruft. Doch das Graben in der Vergangenheit kann gefährlicher sein als gedacht, und bald bekommt es das Team um Kriminalhauptkommissar Maibach auch mit ganz aktuellen Todesfällen zu tun ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Regina Riest, Jahrgang 1967, studierte Anglistik und Romanistik und ist Gymnasiallehrerin für Englisch und Französisch. Sie lebt mit ihrer Familie in der Region Bodensee-Oberschwaben.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Ebru Sidar/Arcangel.com
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Dr. Marion Heister
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-922-8
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für meine Elternin Liebe und Dankbarkeit
Prolog
Achim hatte Kopfschmerzen. Obwohl – Kopfschmerzen war vielleicht nicht der richtige Ausdruck; eher so etwas wie Kopfdröhnen, falls es das überhaupt gab. Ein Schädelbrummen, das nicht nur hinter der Stirn, an den Schläfen und in den Ohren zu Hause war, sondern sich auch zunehmend im Rest seines Körpers ausbreitete. Konnte man eigentlich Kopfweh im Magen haben? Irgendwie schon, fand er, aber gleichzeitig kam ihm die Vorstellung ziemlich lächerlich vor.
»Ey, Alter, was grinste denn so?«, brüllte ihm von links ein anderer Partygast ins Ohr.
Ein Vampir mit weit überstehenden Eckzähnen; beim Anblick seiner blutrot geschminkten Mundwinkel drehte sich etwas in Achims Magen.
»Geile Party, gell?«, brüllte der Vampir noch eine Stufe lauter.
Achim zuckte zusammen. Sein linkes Ohr hatte jetzt definitiv Magenschmerzen. Oder doch Kopfweh? Oh Gott, war ihm schlecht – er musste dringend mal an die frische Luft.
»Bin gleich wieder da«, nuschelte er in Richtung des Vampirs, der sich aber schon wieder mehr für seine Bloody Mary als für Achim interessierte.
Achim kämpfte sich durch das Gedränge bis zur Hüttentür durch und schlüpfte hinaus auf den Bootssteg. Kalte Nachtluft empfing ihn. Er atmete tief durch und blieb an die Hüttenwand gelehnt stehen, bis sich seine Augen an das fahle Mondlicht gewöhnt hatten, das die Bäume am Ufer des Sees mit einem matten Silberglanz überzog.
In seinem Kopf dröhnte es immer noch, obwohl die Musik und das Stimmengewirr aus der Hütte nur gedämpft nach außen drangen. Seine Beine fühlten sich unangenehm wackelig an. Er musste sich einen Moment setzen und darauf hoffen, dass dieses Schwindelgefühl nachließ, das ihn nun überfiel. Hatte er denn wirklich so viel getrunken? Er versuchte nachzurechnen, gab den Versuch aber sofort wieder auf, als eine neue Welle der Übelkeit durch seinen Körper schwappte. Stöhnend ließ er sich auf den schmalen Holzsteg sinken, der vom Eingang der Hütte hinüber zum Ufer führte.
Was für eine Schnapsidee! Grusel und Fusel am Schreckensee. Schon als Flo ihn eingeladen hatte, hatte er gewusst, dass das nicht sein Ding war. Mit Halloween hatte er noch nie etwas am Hut gehabt, und dann auch noch eine Kostümparty mitten in der Pampa! In einer viel zu kleinen Hütte, zu der nicht mal ein richtiger Fahrweg führte. Das ganze Zeug mussten sie zu Fuß herschleppen; für die Musik brauchten sie ein Notstromaggregat, und eine gescheite Heizung gab es auch nicht.
Am liebsten hätte er Nein gesagt. Aber Flo war schließlich sein bester Freund, und Flo hatte sich nicht von seiner Idee abbringen lassen. Schreckensee – Mann, schon allein der Name ist doch irre, hatte er gesagt. Wir kriegen den Hüttenschlüssel von meinem Onkel, und dann sind wir total ungestört, da können wir so richtig abfeiern, ohne dass wir irgendjemandem auf die Nerven fallen. Damit hatte er allerdings recht. Nachbarn gab es hier keine, und die nächste Ortschaft war bestimmt meilenweit entfernt.
Achim fröstelte. Auf den Holzbohlen des Stegs war es unangenehm kalt und feucht. Seine Übelkeit hatte etwas nachgelassen, dafür merkte er jetzt, dass er dringend mal eine Toilette brauchte. Die es bei dieser Hütte natürlich auch nicht gab. Flo hatte nur grinsend gemeint, das sei doch alles kein Problem, dafür gebe es doch genügend Büsche.
Stöhnend rappelte Achim sich auf und wankte über den leicht abschüssigen Holzsteg zum Ufer hinüber. Die Bohlen waren rutschig, er musste sich konzentrieren, um nicht den Halt zu verlieren. Es war schon nach Mitternacht, und der leichte Nebel, der die Landschaft einhüllte, begann auf dem kalten Boden zu gefrieren.
Auf dem Weg zum nächsten Gebüsch nestelte Achim an seinem Gürtel herum. Er musste jetzt wirklich dringend, aber auch der Reißverschluss rutschte ihm immer wieder durch die klammen Finger. Scheiße, das Ding musste doch irgendwie aufgehen! Er konnte nachher doch nicht mit nasser Hose … Verzweifelt packte er mit beiden Händen zu. Der Hosenladen gab mit einem lauten Ratsch nach. Endlich konnte er … Doch drüben öffnete sich plötzlich die Hüttentür, und helles Licht fiel ans Ufer. Das fehlte noch! Er taumelte aus dem Lichtkegel, wobei ihm die Hose hinunterrutschte bis unter die Knie. Zwei Mumien traten laut lachend aus der Hütte und blieben auf dem Steg stehen.
In Gedanken verfluchte Achim sein Kostüm. Die strahlend weißen Knochen, die er sich auf seine schwarzen Jeans und seinen Kapuzenpullover gemalt hatte, waren auch außerhalb des Lichtkegels noch gut zu erkennen. Er musste wohl oder übel noch ein Stück den Trampelpfad am Ufer entlanggehen, bevor er sich ungestört erleichtern konnte. Mit der einen Hand zog er sich die Hose wieder hoch und hielt sie fest umklammert, die andere streckte er in die zunehmende Dunkelheit aus, auf der Suche nach etwaigen Hindernissen auf dem Weg. Die Silhouetten der Mumien vor der Hüttentür verschwanden hinter einem dichten Vorhang aus Schilf. Sicherheitshalber tastete sich Achim noch ein Stück weiter Richtung Uferpfad, bis er sich vollkommen unbeobachtet fühlte, und dann konnte er endlich seinem Bedürfnis freien Lauf lassen.
Ah, das war besser! Achim richtete sich auf. Um ihn herum herrschte wohltuende Ruhe. Vom Trubel der Party war nichts mehr zu hören; die beiden Mumien mussten die Tür wieder hinter sich geschlossen haben, denn auch der Lichtschein von vorhin war verschwunden. Der Umriss der Hütte ließ sich nur noch vage erahnen, ein etwas dunklerer, eckiger Schatten vor dem Silbergrau der Wasserfläche. Es wurde Zeit zurückzugehen.
Achim fummelte an seinem Reißverschluss herum. Verdammt, warum ging da denn nichts? Seine gefühllosen Finger bekamen das Ding keinen Millimeter nach oben. Er beugte sich so weit nach vorn, wie er es sich trotz Schwindelgefühls zutraute, ohne aus den Latschen zu kippen. Aber er sah nichts – was nicht nur an seinem Alkoholpegel lag, sondern auch daran, dass das fahle Mondlicht, das die Landschaft bisher noch einigermaßen erhellt hatte, immer mehr verblasste. Dichte Wolken hatten sich vor den Mond geschoben, und alles um ihn versank in konturlosem Dunkel. Nur die Wasseroberfläche des Schreckensees war hinter dem Schilf noch als ein silberner Spiegel zu erahnen.
Vielleicht würde die Helligkeit ausreichen, wenn er noch ein paar Meter weiterging? Dort tat sich eine Lücke im Schilf auf, und man hatte direkten Zugang zum Wasser. Eine Hand an der widerspenstigen Hose, eine Hand nach vorn gestreckt, setzte sich Achim wieder in Bewegung, bis er die gewünschte Stelle erreichte. Ob es am gefrorenen Boden lag oder an einem neuerlichen Schwindelanfall, ob er über eine Wurzel gestolpert war oder sich in seiner Hose verheddert hatte – im Nachhinein konnte Achim nicht erklären, wie es passiert war. Fest stand nur, dass er plötzlich den festen Boden unter den Füßen verlor und mit einem weithin hörbaren Platschen vom Uferpfad in den See rutschte.
Der Kälteschock nahm ihm den Atem, und er brauchte einen Moment, bis er wieder genug Luft in den Lungen hatte, um einen kräftigen Fluch auszustoßen. Das Wasser war zwar nicht besonders tief, aber Achims Schwung hatte ausgereicht, um ihm die Beine wegzuziehen und ihn mit dem Po im Uferschlamm landen zu lassen. Nun saß er bis fast zur Brust in der morastigen Brühe. Das eisige Wasser sorgte immerhin dafür, dass er sich mit einem Schlag so nüchtern fühlte, als hätte er den ganzen Abend nur Mineralwasser getrunken. Auch Übelkeit und Schwindel waren verschwunden.
Achim fluchte nochmals und versuchte aufzustehen. Das war gar nicht so einfach, die Oberschenkel und der Po steckten tiefer als gedacht im Schlamm fest, und er musste sich mit beiden Händen abstützen, um auf die Füße zu kommen. Endlich stand er mit triefnassen Klamotten kniehoch im Wasser. Angeekelt wischte er seine mit Schlamm überzogenen Hände an den nassen Oberschenkeln ab. Seine Füße steckten so tief im sumpfigen Untergrund, dass ihm der eisige Matsch von oben in die Turnschuhe quoll. Beim Versuch, den linken Fuß zu heben und sich mit einem großen Schritt zum Ufer hin umzudrehen, löste sich der Fuß mit einem schmatzenden Geräusch aus dem Schuh. Scheiße. Die Nikes hatte Achim sich erst vor zwei Wochen gekauft.
Er tastete an der Stelle herum, wo der Schuh stecken geblieben war, aber er bekam ihn nicht zwischen die klammen Finger. Egal. Die Schuhe waren wahrscheinlich sowieso nicht mehr sauber zu kriegen, da kam es auch nicht darauf an, ob einer im See blieb. Schlimmer war, dass mittlerweile der strumpfsockige Fuß noch viel tiefer abgesackt war und bis halb zur Wade im Schlamm steckte. In Achim stieg die Wut hoch. Das durfte doch echt nicht wahr sein! Verdammte Party, verdammte Kälte, verdammter Scheißtümpel! Er zog den anderen Fuß mit Gewalt hoch – der Schuh blieb dran –, drehte sich Richtung Ufer und japste erschrocken, als er beim Absetzen eine Stelle im Untergrund traf, die ihm so gut wie keinen Widerstand entgegensetzte und ihn bis weit übers Knie einsinken ließ.
Die Wut wich einem Anflug von Panik, und er war kurz davor, um Hilfe zu rufen. Doch ein neuer Gedanke hielt ihn davon ab: Das hier war so ziemlich das Peinlichste, was ihm hatte passieren können. Nicht auszudenken, wenn ihn die anderen Partygäste so sehen würden. Nein, sagte er sich. Kein Grund zum Durchdrehen. Du steckst im Scheiß-Schreckensee im Scheißschlamm fest, und das ist scheißpeinlich. Mehr aber auch nicht. Der Uferweg ist keine anderthalb Meter weit weg. Du musst dich nur Stück für Stück durch den Schlamm schieben, bis der Untergrund fester wird. So schwer kann das doch nicht sein. In der Ruhe liegt die Kraft.
Dieser Spruch, den er als Kind oft genug von seinem Großvater gehört hatte, beruhigte ihn, und er begann, seine Füße ganz vorsichtig Richtung Ufer zu drücken. Es ging tatsächlich etwas voran, allerdings auch mit jedem Zentimeter vorwärts gefühlte fünf Zentimeter abwärts. Der Schlamm reichte ihm bald bis zum Oberschenkel, das Wasser bis über die Hüfte. Die Kälte machte seine Beine gefühllos, er zitterte am ganzen Körper.
Wenn es nur etwas gäbe, an dem er sich festhalten könnte! Warum hatte er sich auch für seinen Sturz ausgerechnet eine Stelle ohne Uferbewuchs aussuchen müssen? Verzweifelt ruderte er mit den Armen uferwärts durch die trübe Brühe. Vielleicht wuchs ja etwas unter Wasser? Da war nichts. Mühsam schob er die Füße ein Stück weiter vor, tastete wieder, schob, tastete und sank weitere Zentimeter tiefer in den Matsch, der längst den Namen Sumpf verdient hatte. Beim nächsten Tasten meinte er, mit der Fingerspitze an etwas Hartes zu stoßen. Eine Baumwurzel, die bis in den See reichte? Er schob mit den Füßen nach, so gut er konnte, und endlich bekam er etwas zu fassen, das sich anfühlte wie ein dickes Stück Holz mit sehr rauer Rinde. Vorsichtig umschloss er es mit einer Hand und zog daran.
Es funktionierte! Er hatte etwas gefunden, das ihm genug Widerstand bot, um seinen Körper in Richtung Ufer zu ziehen. Achim atmete auf. Jetzt würde er es aus eigener Kraft schaffen, ohne um Hilfe rufen zu müssen.
Unendlich langsam, aber stetig arbeitete er sich mit Hilfe der Baumwurzel nach vorn. Ganz so stabil schien sie nicht zu sein – immer wieder hatte er das Gefühl, das Holz lockere sich und bewege sich aus dem schlammigen Untergrund auf ihn zu. Dann ließ er es für einen kurzen Moment los, bis es sich stabilisiert hatte, und zog sich danach nur noch behutsamer weiter voran. Endlich war es so weit: Mit dem nächsten beherzten Schritt würde er es ans feste Ufer schaffen. Achim legte seine ganze Kraft nochmals in seine Arme und zerrte an der lockeren Wurzel. Etwas gab nach und tauchte an der Oberfläche auf, aber er ließ rechtzeitig los und wuchtete sich an Land. Geschafft!
Vollkommen erledigt ließ sich Achim auf den Uferpfad sinken. Hinter ihm hob sich, deutlich sichtbar vor dem nun wieder im Mondlicht glänzenden See, ein Stück Holz aus dem Wasser. Achim blieb einen Moment erschöpft sitzen und betrachtete es versonnen: das Holz, das ihn gerettet hatte. Es war wohl doch keine Wurzel, eher ein armdicker Ast. An seinem Ende waren sogar kleine Verzweigungen zu sehen, die Fingern ähnelten. Fast schien es so, als winkte ihm da eine hölzerne Hand zum Abschied aus dem See freundlich zu. Kurios – was die Natur für seltsame Gebilde zustande brachte! Vielleicht sollte er den Ast einfach mitnehmen, als Andenken; und um bei seiner Rückkehr in die Hütte etwas vorzeigen zu können, das von der Peinlichkeit seiner nassen und schlammverschmierten Klamotten ablenken würde. Er könnte die Hüttentür öffnen, den Ast vor sich ausgestreckt, und einen auf Gruselgespenst machen.
Kurz entschlossen stand er auf, packte den Ast mit beiden Händen und zog ihn zu sich her. Nur mühsam gelang es ihm, ihn zu bewegen – und als er endlich nachgab, sah Achim auch, warum: Es war kein einzelner Ast, sondern er ging in etwas Größeres, Unförmiges über, etwas, das vielleicht ein Baumstamm hätte sein können, wäre da nicht das kopfförmige Ende gewesen, das sich nun ebenfalls aus dem Wasser erhob. Einen kurzen Moment starrte Achim auf das Gebilde, das er da in den Händen hielt, dann ließ er los und begann, ganz entgegen seiner ursprünglichen Absicht, hemmungslos zu schreien.
EINS
Genüsslich rekelte sich Karl Maibach, Erster Kriminalhauptkommissar, in seinem Bett. Mit einem kurzen Blick auf den Wecker hatte er soeben festgestellt, dass es schon neun Uhr war; er hatte volle zehn Stunden durchgeschlafen, was in den letzten Monaten bestimmt nicht öfter als ein- oder zweimal vorgekommen war. Und schon gar nicht an einem Freitag. Gelobt seien die kirchlichen Feiertage! Auch wenn er ansonsten zu religiösen Dingen ein eher distanziertes Verhältnis hatte, hielt Maibach das Kirchenjahr für eine durchaus gelungene Erfindung. Nur weil zufällig der erste November war, wurde ein ganz normaler Wochentag zu Allerheiligen und ein ganz normales Wochenende zum langen Wochenende, an dem er endlich einmal, ohne Urlaub nehmen zu müssen, drei Tage am Stück freihatte.
Schade nur, dass das Wetter eher trüb und kalt war. Er hatte eigentlich auf eine Verlängerung des goldenen Oktobers gehofft und sich für heute Nachmittag zum Feiertagsspaziergang mit Ursula verabredet. Seit sie getrennt lebten, war es seltsamerweise zum echten Highlight geworden, wenn sie gelegentlich am Wochenende gemeinsam durch die Natur streiften. Früher hatte er Ursulas Ausflugssucht verflucht und sich sehnlichst gewünscht, sie würde ihn einfach auf der Wohnzimmercouch in Ruhe lassen. Heute, auf einer anderen Couch in einem anderen Wohnzimmer, wollte sich die Gemütlichkeit einfach nicht mehr richtig einstellen, und er ertappte sich immer öfter bei dem Gedanken, dass das mit der Trennung vielleicht doch keine so gute Idee gewesen war …
Maibach schlug die Decke zurück und begab sich in die Küche. Beim Blick in den gut gefüllten Kühlschrank huschte ein zufriedenes Lächeln über sein Gesicht. Mittlerweile hatte er seinen Ein-Personen-Haushalt doch richtig gut im Griff! Einem ausgiebigen Brunch stand nichts im Wege. Während das Teewasser kochte, schlug er zwei Eier in die Pfanne und legte vier Scheiben Speck dazu. Es duftete verführerisch; auch seine Kochkünste hatten sich in letzter Zeit deutlich verbessert. Als das Brot aus dem Toaster schnellte, trug er sein opulentes Mahl ins Wohnzimmer und beschloss, sich beim Frühstück der Beseitigung des Zeitungsstapels zu widmen, der sich während der Woche angesammelt hatte. Im Lokalteil vom Dienstag wurde über aufsehenerregende Funde in den Tiefen des Bodensees berichtet – von Fliegerbomben über aufgebrochene Zigarettenautomaten bis zum untergegangenen Schaufelraddampfer. Ein Kollege von der Wasserschutzpolizei bezifferte die Anzahl der Leichen, die sich unentdeckt in Europas drittgrößtem Binnengewässer befanden, auf mindestens neunundneunzig, wobei von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden müsse.
Maibach blätterte rasch weiter. Auch wenn der Artikel ihn interessierte, passte er nicht ganz zu einem gemütlichen Frühstück. Mit Wasserleichen hatte seine Ermittlungsgruppe zum Glück bisher wenig zu tun gehabt. Zwar hatten sie vor zwei Jahren einen Fall bearbeitet, bei dem im Stillen Bach in der Nähe von Weingarten ein unbekannter Toter gefunden worden war, aber die Leiche hatte damals noch nicht allzu lange im Wasser gelegen, sodass ihnen der Anblick einer »echten« Wasserleiche erspart geblieben war. Maibach hoffte inständig, dass das auch weiterhin so blieb. Er fand den Anblick toter Menschen, mit dem ihn sein Beruf konfrontierte, schon schlimm genug, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie tot waren – meistens durch das Verschulden ihrer Mitmenschen, was die Sache noch unerträglicher machte. Er würde sich, egal nach wie vielen Dienstjahren, wohl nie daran gewöhnen, was Menschen anderen Menschen alles antun konnten. Um Abscheu zu empfinden, brauchte es keine zusätzlichen ekligen Details wie Wasserleichen mit aufgedunsenen …
Maibach konnte gerade noch verhindern, dass ihm die Teetasse aus den Händen glitt, so sehr war er beim plötzlichen Schrillen seines Telefons zusammengezuckt. Nach dem dritten Klingeln war er am Apparat.
»Maibach?«
Er hatte fast erwartet, Ursulas Stimme zu hören, die aus irgendwelchen Gründen den nachmittäglichen Spaziergang absagen wollte. Stattdessen klang ein sonorer Bass aus dem Hörer.
»Hallo, Charlie. Sorry, dass ich dich am Feiertag anrufe. Aber ich hab da vielleicht was für dich.«
»Shitty!« Sosehr Maibach seinen Freund und Kollegen Thomas Schitterer vom Ravensburger Kriminaldauerdienst mochte – ein Anruf an Allerheiligen verhieß nichts Gutes. »Was gibt’s denn Dringendes?«
Am anderen Ende hörte man ein Räuspern. »Tja, wie gesagt. Wir sind gerade im Einsatz, und so wie ich das einschätze, könnte der Fall nach dem Wochenende bei dir landen. Da wollte ich dich lieber kurz informieren – nicht dass du dich nachher wieder beklagst, dass du die Sache nicht vor Ort anschauen konntest.«
Maibach gab ein kurzes Grunzen von sich. Tatsächlich hatte er erst neulich eine kleine Meinungsverschiedenheit mit dem KDD gehabt – nicht mit Shitty persönlich, aber offensichtlich funktionierte die Kommunikation innerhalb der Abteilung ganz gut. Und das hatte er jetzt davon; einen Anruf am Feiertag.
Thomas Schitterer, der das Grunzen anscheinend als Aufforderung verstanden hatte, fuhr fort. »Wir haben hier eine Leiche, deren Alter wir überhaupt nicht einschätzen können. Der Rechtsmediziner will sich erst äußern, wenn er sie auf dem Seziertisch hat. Und jetzt ist die Frage, ob er sie gleich mitnehmen kann oder ob wir sie für dich noch vor Ort lassen sollen. Falls du kommen und gucken willst. Trotz Feiertag.«
»Was soll das heißen, ihr könnt das Alter nicht einschätzen? Und warum ziert sich die Claudi so? Irgendwas wird sie doch inoffiziell sagen können, sie weiß doch, dass wir sie nicht drauf festnageln, falls sie sich geirrt hat. Außerdem irrt sie sich nie. Sag ihr einen schönen Gruß von mir, sie ist die Beste.«
Thomas Schitterer lachte. »Mach ich gern, wenn ich sie das nächste Mal sehe. Aber sie hat Urlaub übers lange Wochenende. Und ihr Vertreter macht mir, unter uns gesagt, keinen so wahnsinnig kompetenten Eindruck.«
Maibach stöhnte. Auch das noch. »Kompetenz hin oder her. Aber den Unterschied zwischen einem Teenager und einem Tattergreis wird er doch grob einordnen können, oder? Außerdem – warum ist dir die Altersbestimmung vor Ort denn so wichtig?«
Thomas Schitterer zögerte einen Moment, und Maibach hätte schwören können, dass er hörte, wie der Kollege die Augen verdrehte. »Nein, das hast du falsch verstanden. Ich meinte nicht das Alter der Leiche, als sie starb. Ich meinte, wie lange sie da schon liegt.«
»Na, das könnte die Claudi aber mit Sicherheit eingrenzen. Sag ihrem Vertreter, er muss sich ja nicht auf eine halbe Stunde festlegen. Eine grobe Schätzung tut’s fürs Erste.«
Die Pause war diesmal noch länger. »Ähm. Es geht nicht um eine halbe Stunde oder Stunde, Charlie. Eher um Jahre. Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht sogar. Ich bin hier mitten in der Pampa, an der Blitzenreuter Seenplatte. Genauer gesagt am Schreckensee. Kennst du den? Nomen est omen, würde ich fast sagen – wir haben hier nämlich eine Moorleiche.«
Es war kurz vor vierzehn Uhr, als Maibach und Ursula die Haltebucht am Waldrand erreichten. Ursula quetschte ihren Kleinwagen ungeniert halb ins Gebüsch neben das Fahrzeug der Spurensicherung. Nach Shittys Anruf hatte Maibach eigentlich ihren Spaziergang absagen wollen, aber als er Ursula den Grund dafür erklärte, hatte sie voller Begeisterung ausgerufen: »Aber nein, Charlie! Ich hol dich nach dem Mittagessen ab, wie besprochen, und dann fahren wir einfach zum Schreckensee anstatt ins Wurzacher Ried!« Dann hatte sie aufgelegt, und Maibach kannte seine Frau gut genug, um zu wissen, dass es zwecklos war, noch mal anzurufen. Also hatte er es bleiben lassen und stattdessen Thomas Schitterer gebeten, den Abtransport der Moorleiche auf den späten Nachmittag zu verschieben.
Ursula zog den Reißverschluss ihrer Outdoorjacke hoch und angelte ihre Nordic-Walking-Stöcke aus dem Kofferraum. »Puh, kalt heute! Willst du dir keine Mütze aufsetzen, Charlie?«
Maibach schüttelte den Kopf. Eigentlich nicht als Antwort auf ihre Frage, sondern in stummer Verzweiflung über die Tatsache, dass sie auch nach über zwei Jahren der Trennung immer noch meinte, ihn bemuttern zu müssen, sobald sie ihn unter die Augen bekam. Er schlug seinen Jackenkragen hoch und knallte den Kofferraumdeckel etwas heftiger zu als nötig. »So, dann wollen wir mal. Wie gesagt: Du kannst mich gern begleiten bis runter zur Schutzhütte. Aber den Fundort schau ich mir alleine an. Das dauert keine zehn Minuten. Danach drehen wir eine Runde Richtung Buchsee, was meinst du?«
Anstatt einer Antwort marschierte Ursula einfach los. Wie immer legte sie dabei ein flottes Tempo vor, und Maibach hatte Mühe, ihr auf dem abschüssigen Weg zu folgen. Der Waldboden war mit Herbstlaub in allen Schattierungen von Ockergelb bis Dunkelbraun bedeckt, das auf dem feuchten Untergrund einen rutschigen Teppich bildete. Dass vor ihnen schon die Mitarbeiter von KDD, Spurensicherung und Rechtsmedizin mit ihrer ganzen Ausrüstung den Hang hinuntergetrampelt waren, machte die Sache nicht einfacher, und Maibach war froh, als er unten ankam, ohne auf dem Hosenboden gelandet zu sein.
Ursula hatte sich schon in die Lektüre einer Infotafel in Ufernähe vertieft. Als sie ihn hörte, drehte sie sich um und sagte: »Die Tafeln gab es noch nicht, als wir das letzte Mal hier waren. Interessant! Weißt du, warum der Schreckensee Schreckensee heißt?«
»Noch nicht. Aber ich nehme an, gleich werde ich es erfahren.«
»Der Volksmund behauptet anscheinend, das komme von den Fischen, die’s hier gibt. Riesige Hechte, auch Schröck genannt, die hier früher Angst und Schröcken verbreiteten.«
»Angst und Schröcken, soso … Na, dann wissen wir das jetzt auch«, gab Maibach unbeeindruckt zurück.
Ursulas Faszination für heimatkundliches Wissen hatte er immer schon nur begrenzt geteilt. Er sah sich um. Direkt vor ihm stand eine hölzerne Schutzhütte auf Stelzen im Wasser. Entfernt erinnerte sie ihn an die Pfahlbauten am Bodensee, nur war sie erkennbar neueren Datums. Er ging über den hölzernen Steg. Eigentlich war es mehr eine Art offener Beobachtungsstand für Naturliebhaber; im Inneren waren ein paar ausgebleichte Fotografien an die Wand gepinnt. Mühsam entzifferte er die Bildunterschriften – Hufeisenazurjungfer, Kleines Granatauge, Vierfleck. Anscheinend gab es außer Hechten auch eine beeindruckende Vielfalt von Libellen hier zu bestaunen. Na ja, von irgendwas mussten sich die Fische ja auch ernähren … Er trat an eine der Sichtscharten in der vorderen Hüttenwand und spähte hindurch. In der absolut stillen Wasserfläche spiegelte sich malerisch der Wald am gegenüberliegenden Ufer. Alles war von einem leichten Nebelschleier überzogen. Wäre der Tag nicht so trüb gewesen, könnte man mit diesem Panorama bestimmt den Wettbewerb für das idyllischste Kalenderfoto des Jahres gewinnen.
Maibach ging über den leicht schlüpfrigen, feuchten Holzsteg zurück ans Ufer, wo Ursula mittlerweile vor einer weiteren Infotafel stand.
»UNESCO-Welterbestätte Schreckensee!«, verkündete sie. »Auf der Halbinsel da drüben gab es Ausgrabungen wegen einer frühsteinzeitlichen Dorfanlage.«
Bevor sie ihm noch die ganze Tafel vorlesen würde, wandte Maibach sich ungeduldig um. Wo waren seine Kollegen? Von polizeilicher Aktivität war weit und breit nichts zu sehen.
Als hätte sie seine Gedanken gelesen, fragte Ursula: »Die Moorleiche ist in der Nähe einer Schutzhütte gefunden worden, hast du gesagt? Also hier ist alles ruhig. Dann gehen wir mal weiter nach links, da kommt ja noch eine größere Hütte. Weißt du noch, wie wir da mal dran vorbeigewandert sind, als es so heiß war?«
Eine Antwort erwartete sie offenbar nicht von ihm. In zügigem Tempo ging sie voraus, und Maibach blieb nichts anderes übrig, als ihr auf dem schmalen und unebenen Pfad zu folgen. Ursula mit ihrem phänomenalen Orientierungssinn hatte natürlich mal wieder recht; nach kurzer Zeit kam eine größere Schutzhütte in Sicht, und Maibach entdeckte schon von Weitem die Stelle, an der sich die Moorleiche befinden musste. Ein Stück des Seeufers war mit gestreiftem Flatterband abgesperrt, hinter dem sich Thomas Schitterer mit einem jüngeren Mann unterhielt, während ein weiterer Kollege gerade dabei war, etwas am Boden Liegendes zu fotografieren.
Als Schitterer die beiden bemerkte, duckte er sich unter dem Absperrband hindurch und kam auf sie zu. Er warf Maibach einen fragenden Blick zu, den dieser geflissentlich ignorierte, dann breitete er die Arme aus.
»Hallo, Ursel! Ich wusste gar nicht, dass du mitkommst! Schön, dich mal wiederzusehen.«
Ursula erwiderte die Umarmung. »Ja, ist lange her … Charlie und ich wollten heute sowieso wandern gehen. Und der Fund einer Moorleiche ist ja schon ein außergewöhnliches Ereignis, also dachten wir …«
»Dachtest du«, fiel Maibach ihr ins Wort. »Ich habe dir gesagt, dass das meine Angelegenheit ist. Also – ich hab jetzt ein paar Minuten hier zu tun. Geh ruhig schon mal weiter, ich hol dich dann ein.«
Etwas in seinem Tonfall schien Ursula klarzumachen, dass er es ernst meinte. Sie hob die Hand zum Abschied, presste ein kurzes »Na dann« heraus und marschierte davon, allerdings nicht, ohne vorher noch einen ausgedehnten Blick über Thomas Schitterers Schulter zu riskieren.
Maibach seufzte. »Du musst entschuldigen. Ich wollte allein kommen, aber du weißt ja, wie das ist.«
Thomas Schitterer nickte. »Hab’s nicht vergessen. Sag mal, es geht mich ja eigentlich nichts an, aber: Seid ihr wieder zusammen? Ich dachte, die Scheidung läuft?«
Einen Moment überlegte Maibach, ob er die Frage einfach ignorieren sollte. Shitty hatte recht – es ging ihn nichts an. Dann entschied er sich doch zu einer Antwort. »Weder – noch. Wir sind nicht zusammen, aber die Scheidung läuft auch noch nicht. Und manchmal gehen wir halt gemeinsam wandern. So. Und jetzt sag mal, was haben wir hier? Moorleiche hatte ich bisher noch keine. Wie ist die denn aufgetaucht?«
Während Thomas Schitterer ihm einen Überblick über den bisherigen Einsatz gab, stieg Maibach über das Flatterband. Mit einem Kopfnicken begrüßte er Sepp Birkenmaier von der Spurensicherung, der kurz die Hand hob, dann aber gleich wieder hinter dem Objektiv seiner Kamera verschwand.
Der jüngere Mann, mit dem Thomas Schitterer sich vorhin unterhalten hatte, kam auf ihn zu. »Sie sind Hauptkommissar Maibach, nehme ich an? Darf ich mich vorstellen? Dr. Horvath, Forensische Medizin.«
»Angenehm. Maibach. Frau Dr. Mönch hat Urlaub, höre ich?« Sehr zu meinem Bedauern, hätte Maibach am liebsten hinzugefügt. Mit Claudia Mönch verband ihn eine langjährige freundschaftliche Zusammenarbeit. Auf ihren Sachverstand und ihre Erfahrung konnte man sich hundertprozentig verlassen. Ihr Kollege hingegen sah aus, als käme er direkt von der Uni.
Der junge Mediziner runzelte die Stirn. »Ja, Frau Dr. Mönch ist übers Wochenende nicht im Dienst. Aber dafür bin ja ich da. Also, wenn Sie mal schauen möchten …«
Er drehte sich um und ging auf das am Boden liegende Etwas zu; Maibach folgte ihm. Der Anblick, der sich ihm bot, hatte etwas Unwirkliches. In seinen fünfunddreißig Dienstjahren hatte er wahrlich schon einige Leichen in Augenschein nehmen müssen, aber diese hier hatte auf den ersten Blick keinerlei Ähnlichkeit mit ihnen. Die lederartige Haut war dunkelbraun gefärbt und sah wie Baumrinde aus; kein Wunder, dass der Finder der Leiche, wie Shitty berichtet hatte, zuerst gedacht hatte, er habe es mit einer Wurzel oder einem Ast zu tun. Die herbeigerufene Funkstreife hatte zunächst an einen Scherz mit einer für Halloween zurechtgemachten Schaufensterpuppe geglaubt. Auch diese Einschätzung konnte Maibach nachvollziehen; insbesondere das Gesicht des vor ihm liegenden Körpers verblüffte ihn. Die Gesichtszüge waren klar zu erkennen, von den geschlossenen Augenlidern über die recht breite Nase bis zum Mund mit seinen etwas verkniffen wirkenden Lippen. Selbst die Falten auf der gerunzelten Stirn waren so deutlich, als hätte ein Bildhauer – oder eben ein Schaufensterpuppendesigner – sich mit ihrer lebensechten Ausgestaltung ganz besondere Mühe gegeben.
Maibach richtete sich auf. »Sind wir ganz sicher, dass wir es nicht mit einer Puppe zu tun haben?«
»Na hör mal«, erwiderte Thomas Schitterer in vorwurfsvollem Ton. »Glaubst du, ich lass den ganzen Zirkus hier anrollen, wenn es daran noch irgendwelche Zweifel gibt?«
»Nein, nein, natürlich nicht«, beeilte sich Maibach zu versichern. »Aber du musst doch zugeben, dass der Anblick eher ungewöhnlich ist.«
»Der Körper weist ein für Moorleichen durchaus typisches Erscheinungsbild auf«, meldete sich nun der Rechtsmediziner zu Wort, dessen Anwesenheit Maibach für einen Moment ganz vergessen hatte. »Offensichtlich lag er über einen längeren Zeitraum unter Sauerstoffabschluss im Wasser oder im sumpfigen Untergrund. Das hat zur Folge, dass die normalen Zersetzungsprozesse nicht stattgefunden haben und die Leiche sozusagen konserviert wurde.« Er strahlte Maibach an. »Ein sehr interessanter Fall. Ich muss sagen, es hat sich gelohnt, dieses Wochenende Vertretungsdienst zu machen.«
»Freut mich zu hören. Ein längerer Liegezeitraum, sagen Sie? Wie lang ungefähr?«
Dr. Horvath zuckte mit den Schultern. »Wie ich Ihrem Kollegen schon sagte: Das lässt sich momentan kaum eingrenzen. Es kann sich um ein paar Jahre handeln, aber genauso gut um Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte. Soviel ich weiß, hat man schon Moorleichen gefunden, die mehrere tausend Jahre alt waren. Einzelheiten dazu müsste ich aber erst noch recherchieren.«
»Mit anderen Worten – wir könnten es sowohl mit einem einigermaßen aktuellen als auch mit einem vorsintflutlichen Leichnam zu tun haben?«
»Vorsintflutlich wohl eher nicht. Steinzeitlich vielleicht schon«, gab der Mediziner zurück. »Alles Nähere nach der Obduktion. Aber auch da würde ich mir mal keine allzu großen Hoffnungen machen. Vermutlich müssen wir zur genaueren Datierung noch weitere Experten hinzuziehen.«
»Nun gut. Tun Sie Ihr Bestes«, erwiderte Maibach ungehalten; das versprach eine längere Angelegenheit zu werden. »Sie geben uns bitte Bescheid, sobald Sie abschätzen können, ob es für uns etwas zu ermitteln gibt. Und grüßen Sie Ihre Chefin von mir.«
Ursula hatte die Wartezeit für ein kleines Schwätzchen genutzt, stellte Maibach fest, als er auf den Wanderweg zum Buchsee einbog. Sie war so in ihr Gespräch mit einer Wanderin etwa gleichen Alters vertieft, dass sie Maibach erst bemerkte, als dieser schon fast vor ihnen stand.
»Ah, da ist er ja«, stellte sie mit einem Kopfnicken in seine Richtung fest. »Wenn man vom Teufel spricht …«
»Hallo.« Die Frau neben ihr wandte sich um. Sie trug eine Outdoorjacke wie Ursula, dazu feste Stiefel und eine ziemlich verdreckte Cargohose mit ausgebeulten Taschen. Neben sich hatte sie einen sperrig wirkenden Rucksack abgestellt. Sie schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. »Ich habe schon gehört, Sie sind bei der Polizei. Hier ist heute ja richtig was los!«
Maibach nickte ihr nur kurz zu. Er war nicht in Stimmung für Small Talk; das war sowieso eher Ursulas Bereich. Außerdem hasste er es, wenn Ursula vor anderen Leuten mit seinem Beruf angab.
»Können wir dann?«, fragte er in Ursulas Richtung und schickte sich an weiterzugehen.
»Einen Moment noch. Frau Dr. Tiefenbronner war gerade dabei, mir etwas über ihre Ausgrabungen zu erzählen. Sie arbeitet beim Landesdenkmalamt. Und stell dir vor: Eure Moorleiche könnte ein Bewohner der steinzeitlichen Siedlung hier gewesen sein!«
»Ja, das ist gut möglich«, bestätigte die Dame mit einem Kopfnicken in Richtung Schreckensee. »Ihre Frau hat mir gerade von dem Fund erzählt. Ich hatte mich schon gewundert … Wissen Sie, ich bin mit meinem Team zurzeit drüben auf der Halbinsel beschäftigt. Wir werten die Grabungen rund um die Pfahlbau-Fundstelle aus. Und die ganze Aktivität da am Ufer seit heute Vormittag – wir dachten erst, es hätte einen Badeunfall oder so was gegeben. Aber bei der Kälte?« Wie um ihre Worte zu unterstreichen, zog sie den Reißverschluss ihrer Jacke etwas höher. »Ich wollte gerade hingehen und fragen, ob wir behilflich sein können.«
»Danke, das wird nicht nötig sein«, gab Maibach kurz angebunden zurück. Von wegen behilflich sein, dachte er. Neugierig trifft die Sache wohl eher. »Die Kollegen haben alles im Griff.«
»Selbstverständlich. Aber nun, da ich gehört habe, dass es um eine Moorleiche geht … Das fällt ja sozusagen in mein Fachgebiet. Ich denke, ich sollte Ihren Kollegen auf jeden Fall meine Unterstützung anbieten. Wissen Sie, wir haben im Zusammenhang mit den Ausgrabungen auf der Halbinsel schon einige bedeutende Funde von der Jungsteinzeit bis zur Frühbronzezeit gemacht. Teile der Pfahlbauten, Reste von Alltagsgegenständen, sogar Tierknochen. Wenn jetzt noch menschliche Überreste dazukommen, dann könnte uns das in die Lage versetzen, die Siedlungsgeschichte dieser Gegend völlig neu zu bewerten …«
»Ich denke, dafür ist es noch zu früh. Zunächst wird unser Rechtsmediziner die Leiche eingehend untersuchen. Aber danke für Ihr Angebot; geben Sie mir doch am besten Ihre Kontaktdaten, wir melden uns dann bei Bedarf.«
»Wie Sie meinen.« Frau Dr. Tiefenbronner gab sich keine Mühe, die Enttäuschung in ihrer Stimme zu verbergen. »Hier ist meine Karte.«
Maibach nahm die Visitenkarte und steckte sie in seine Jackentasche. Hoffentlich hatte er der Dame deutlich genug klargemacht, dass ihre Mitarbeit momentan nicht nötig war. Er wünschte ihr noch einen angenehmen Tag und marschierte in so schwungvollem Tempo davon, dass es Ursula erst nach einigen hundert Metern gelang, ihn einzuholen.
ZWEI
Margarethe Schneider ließ ihre Trüffelpraline ganz langsam auf der Zunge zergehen; so war der Genuss am größten. Auf Genussmaximierung verstand sie sich mittlerweile ganz gut. Es blieb einem ja auch nichts anderes übrig, als aus jeder noch so winzigen Gelegenheit das Beste herauszuholen, wenn man in diesem Irrenhaus nicht selbst meschugge werden wollte.
Draußen auf dem Gang waren Schritte zu hören. Gleich würde Schwester Heike sie wie jeden Montagmorgen zur »Geselligen Runde« abholen. Schnell verstaute Margarethe die Pralinenschachtel ganz hinten in der obersten Kommodenschublade unter einem Stapel sorgfältig gefalteter Unterhosen. Dort war sie hoffentlich sicher, denn an die Kommodenschublade war bisher noch niemand vom Pflegepersonal gegangen. Die frische Wäsche brachten Margarethes Sohn und ihre Schwiegertochter bei ihren wöchentlichen Besuchen mit, überließen das Einräumen aber Margarethe selbst. Wenigstens sie begriffen, dass ein Umzug ins Seniorenheim nicht bedeutete, dass man seine Selbstständigkeit komplett an der Pforte abgeben musste.
Rechtzeitig vor dem Klopfen an der Tür saß Margarethe wieder in ihrem Sessel. Wie immer betrat Schwester Heike, ohne abzuwarten, das Zimmer. Warum klopfte sie überhaupt?
»Herein«, sagte Margarethe, als Heike ihr ein beschwingtes »Guten Morgen, Frau Schneider!« entgegenrief. »Na, bereit für die Gesellige Runde?«
»Wenn’s sein muss«, knurrte Margarethe und erhob sich aus ihrem Sessel.
»Ach, nun seien Sie doch nicht so grummelig«, erwiderte Heike und reichte ihr die Hand. »Möchten Sie den Rollator nehmen, oder versuchen wir’s mal wieder ohne?«
»Wir versuchen gar nichts. Ich nehme den Gehstock.« Margarethe griff nach ihrem Stock und ging durch die Tür. Schwester Heike stieß einen ihrer demonstrativen kleinen Seufzer aus und folgte ihr.
Als sie den Gemeinschaftsraum erreichten, waren die meisten anderen Bewohner des ersten Stocks schon versammelt. Margarethe steuerte auf einen freien Platz neben Frau Fischer zu. Die war so stocktaub, dass man nicht befürchten musste, viel Konversation mit ihr machen zu müssen. Frau Fischer nickte ihr freundlich zu. Margarethe nickte zurück, lehnte den Stock an die Rückenlehne und ließ sich auf den Stuhl sinken.
»So, guten Morgen allerseits!« Schwester Heike lächelte in die Runde. »Schön, dass wieder so viele von Ihnen gekommen sind! Wie immer beginnen wir unsere Gesellige Runde am Wochenanfang mit einem kleinen Lied. Wer hat einen Wunsch?«
»Hoch auf dem gelben Wagen!«, rief Oskar Sailer, der gegenüber von Frau Fischer im Stuhlkreis saß, und strahlte Schwester Heike an.
Margarethe fühlte sich für einen Moment in ihre Kindheit zurückversetzt. Oskar kannte sie schon ihr Leben lang. Er war der beste Freund ihres kleinen Bruders gewesen, und dieses erwartungsvolle Strahlen hatte er schon als Vierjähriger gehabt – nur dass es damals ihr gegolten hatte, der Achtjährigen, wenn sie ihm und den anderen kleinen Jungs in ihrem improvisierten Kasperletheater auf dem Heuboden eine Vorstellung gegeben hatte. Und auch viel später, als sie schon mit Paul verlobt war, hatte der halbstarke Oskar – »Teenager« würde man das heute wohl nennen – ihr noch hinterhergestrahlt, wenn sie ihm im Dorf begegnet war. Wahrscheinlich war er damals heimlich in sie verliebt gewesen. Wie ihr Leben wohl verlaufen wäre, wenn sie nicht Paul geheiratet hätte? Wenn sie noch ein paar Jahre gewartet hätte und dann Oskar …
Die ersten Takte von »Hoch auf dem gelben Wagen« holten sie in die Gegenwart zurück. Oskar sang aus Leibeskräften mit. Margarethe wurde es wehmütig ums Herz; seit Jahren war Oskar praktisch nicht mehr vernünftig ansprechbar, lebte in seiner eigenen verschlossenen dementen Welt – aber wenn gesungen wurde, kannte er jedes Lied mit noch so vielen Strophen auswendig. Ja, mit dem menschlichen Gehirn war es schon eine seltsame Sache. Überhaupt – das Alter. Manchen erwischte es körperlich, wie sie selbst, und dann verzweifelte man an seiner Unbeweglichkeit, während der Geist doch noch so vieles gern bewegt hätte. Oder man versank in geistiger Umnachtung, wie Oskar, und hatte nichts davon, dass der Körper noch fit geblieben war. Welcher der beiden Zustände war wohl der erträglichere? Keiner der beiden, das war ja das Schlimme. Altern an sich war das Grundübel, egal, in welcher Form es einen erwischte.
Mittlerweile war der Gesang beendet, und Schwester Heike holte eine Zeitung hervor. »Heute will ich Ihnen als Erstes einen Artikel aus der Zeitung vorlesen, den ich heute Morgen entdeckt habe. Viele von Ihnen sind ja hier in der Gegend aufgewachsen – da interessiert Sie das bestimmt. Kennen Sie alle den Schreckensee?«
Frau Fischer beugte sich zu Margarethe herüber. »Was hat sie gesagt?«
»Sie liest uns einen Artikel über den Schreckensee vor«, flüsterte Margarethe zurück.
»Der Schneckensee?« Frau Fischer schaute fragend zu Schwester Heike. »Wo liegt denn der?«
»Schreckensee, nicht Schneckensee, Frau Fischer«, antwortete Schwester Heike in übertriebener Lautstärke. »Das ist einer der Seen hinter Blitzenreute. Buchsee, Vorsee, Häcklerweiher, Schreckensee … Aber Sie kommen ja ursprünglich nicht aus dieser Gegend, nicht wahr?«
Frau Fischer schüttelte den Kopf.
»Also, für alle, denen es auch so geht wie Frau Fischer: Am Schreckensee wurden in den letzten Jahren immer wieder archäologische Ausgrabungen durchgeführt. Am kommenden Wochenende soll es dort eine Ausstellung zum Thema Pfahlbausiedlungen geben. Und heute Morgen kam dazu ein Artikel in der Zeitung. Ein Foto war auch dabei.«
Schwester Heike hielt die Zeitung in die Höhe und ging einmal langsam an allen im Stuhlkreis vorbei. Margarethe erkannte das Panorama sofort. Idyllisch spiegelte sich der Wald im ruhigen Wasser, überstrahlt von einem hellblauen, wolkenlosen Himmel. So hatte der Schreckensee schon zu ihrer Jugend ausgesehen; manche Dinge änderten sich wohl doch nie. Ein Glück.
Auch Oskar schien das Bild wiederzuerkennen. Als Schwester Heike an ihm vorbeiging, richtete er sich in seinem Stuhl auf und blickte ganz konzentriert auf die Zeitung. Dann schaute er in Margarethes Richtung, und für einen Moment trafen sich ihre Blicke. Kurz meinte Margarethe sogar, er wolle ihr etwas mitteilen. Doch dann senkte er den Blick und sank wieder in sich zusammen, während Schwester Heike an ihrem Platz mit dem Vorlesen begann.
»Archäologen bieten Einblicke in Besiedlungsgeschichte der Schreckensee-Halbinsel.«
Solange Schwester Heike den Artikel vorlas, ließ Margarethe ihre Blicke durch die Runde schweifen. Oskar hatte sich in seinem Stuhl zurückgelehnt und die Augen geschlossen. Ob er zuhörte oder schon wieder in seiner eigenen Welt versunken war, ließ sich schwer beurteilen. Herr Maier neben ihm schien durchaus interessiert, genauso wie die meisten der anderen Anwesenden. Manche sahen fast so andächtig aus, als verfolgten sie eine Predigt im Gottesdienst. Auch Frau Fischer hing mit den Augen an Schwester Heikes Lippen, wobei Margarethe allerdings bezweifelte, dass sie dadurch mehr von dem Vorgelesenen mitbekam.
»So, das waren die Informationen zur Ausstellung am kommenden Wochenende«, verkündete Schwester Heike. »Vielleicht hat ja der ein oder andere von Ihnen Interesse. Sie wird wie gesagt am Wanderparkplatz beim Häcklerweiher aufgebaut und kann somit auch gut mit dem Auto erreicht werden. Das wäre doch ein schönes Ziel für einen Sonntagsausflug mit Ihren Besuchern.«
Sie hielt inne und räusperte sich. »Jetzt lese ich Ihnen aber noch den zweiten Teil des Artikels vor. Überschrift: ›Sensationeller Fund an Allerheiligen – Moorleiche gibt Wissenschaftlern Rätsel auf‹.«
Schwester Heike strahlte ihre Zuhörer an. »Und hier wird’s richtig spannend. Hören Sie zu: ›Wie die Schwäbische Zeitung am Wochenende erfahren hat, wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag im Uferbereich des Schreckensees eine Moorleiche gefunden. Wissenschaftler vermuten einen Zusammenhang mit der als UNESCO-Welterbestätte eingestuften Pfahlbausiedlung auf der Schreckensee-Halbinsel, die erstmals im Jahr 1921 von dem Biberacher Zahnarzt und Archäologen Heinrich Forschner entdeckt wurde. ›Dieser Fund einer außerordentlich gut erhaltenen Moorleiche könnte sich als eine der wichtigsten Entdeckungen im Zusammenhang unserer Ausgrabungen am Schreckensee herausstellen‹, sagt Frau Dr. Elke Tiefenbronner vom Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg. ›Sobald die ersten rechtsmedizinischen Untersuchungen abgeschlossen sind, werden wir weitere Experten verschiedener Fachrichtungen hinzuziehen. Dazu stehen wir in engem Kontakt mit den regionalen Polizeibehörden, die momentan noch für die Moorleiche zuständig sind.‹«
Schwester Heike unterbrach ihren Vortrag und schaute in die Runde. »Finden Sie das nicht auch unglaublich spannend? Eine Moorleiche? Gleich hier um die Ecke? So was gibt’s doch sonst nur im Krimi!«
Vom Platz neben Margarethe meldete sich Frau Fischer zu Wort. »Jaja, die sind gefährlich. Bei uns zu Hause, in der Lüneburger Heide, da gab’s auch Moorteiche. Wenn man da spazieren ging und in die Nähe der Teiche geriet, musste man sich vorsehen, sonst konnte man versinken. Als Kinder haben unsere Eltern uns immer davor gewarnt …«
Schwester Heike grinste. »Sehr interessant, Frau Fischer. Aber ich sagte Moorleiche, nicht Moorteiche! Und davon handelt auch der Rest des Artikels. Also, wo waren wir? Genau, hier … ›Wie Frau Dr. Tiefenbronner weiter ausführt, sind Funde von gut erhaltenen Leichen in Moorgebieten in Europa durchaus keine Seltenheit. ›Im Moor können Leichen ohne Verwesungserscheinungen über lange Zeiträume hinweg konserviert werden‹, erklärt sie. ›So verändert sich zwar möglicherweise die Farbe und Textur der Haut, aber dennoch bleibt der oder die Tote auch nach sehr langer Liegezeit noch in seiner oder ihrer Individualität erkennbar. Ein wahrlich aufrüttelndes Erlebnis, einem Menschen ins Antlitz zu blicken, der vielleicht Jahrhunderte oder gar Jahrtausende vor uns hier gelebt hat.‹ Nähere Erkenntnisse über die im Schreckensee entdeckte Leiche liegen bisher zwar noch nicht vor; das Landesamt für Denkmalpflege erhofft sich aber von den zukünftigen wissenschaftlichen Untersuchungen weitreichende Erkenntnisse über die Besiedlungsgeschichte der Halbinsel seit der Jungsteinzeit.‹«
Als Schwester Heike den Artikel beiseitelegte, begann ein allgemeines Gemurmel zwischen den versammelten Bewohnern.
Frau Fischer wandte sich an Margarethe und flüsterte weithin hörbar: »Ist denn der Schneckensee auch ein Moorteich?«, und Margarethe legte sich gerade eine passende Antwort zurecht, als auf der anderen Seite des Stuhlkreises Oskar lautstark seinen Stuhl nach hinten schob und wortlos davonstapfte. Die Prostata, vermutete Margarethe, als er zur Besuchertoilette gleich neben dem Gemeinschaftsraum abbog. Ganz so fit war Oskars Körper wohl also doch nicht mehr.
***
Schon lange vor der morgendlichen Teambesprechung, die routinemäßig um acht Uhr stattfinden würde, saß Maibach an seinem Schreibtisch. Das lange Wochenende hatte ihm gutgetan, er fühlte sich ausgeruht und entspannt. Nachdem er heute deutlich vor dem Weckerklingeln aufgewacht war, hatte er beschlossen, die Ruhe am frühen Montagmorgen zu nutzen und eine Frühschicht im Büro einzulegen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Die Poststapel rechts und links der Schreibunterlage waren verschwunden, die Ablagekörbe für ein- und ausgehende Dokumente überschaubar sortiert, und sogar den überquellenden Papierkorb hatte er gerade zur Altpapiertonne im Hof gebracht.
Zufrieden schenkte er sich eine Tasse Earl Grey ein und schlug die mitgebrachte Zeitung auf. Doch er kam nicht weit – sein Telefon klingelte, und ein Blick auf das Display kündigte »Shitty KDDRV« an.
»Morgen, Shitty! Was gibt’s denn schon so früh?«
»Hallo, Charlie. Gut, dass ich dich erreiche! Hab’s zuerst bei dir zu Hause probiert, aber du warst schon weg.«
»Ich weiß. Ich bin ja hier. Haha.«
»Witzbold. Aber Spaß beiseite – hast du schon Zeitung gelesen?«
»Wollte ich gerade machen, aber dann hat mich ein Kollege am Telefon davon abgehalten.«
»Na, dann schlag mal den Lokalteil auf Seite siebzehn auf.«
Maibach legte das Telefon weg und blätterte. Auf der angegebenen Seite strahlte ihm ein Panorama des Schreckensees bei schönstem Sommerwetter entgegen. Schnell überflog er die Überschriften der beiden Artikel auf der Seite.
»Ach du Scheiße.«
»Du hast es erfasst. Sag mal, hast du irgendwelche Informationen ans Landesdenkmalamt weitergegeben?«
»Was? Ich? Natürlich nicht!«
»Hätte mich auch gewundert. Dann muss das dieser junge Rechtsmediziner gewesen sein. Der hat sich ja so über die Moorleiche gefreut.«
Maibach fing an zu schwitzen. »Ähm, du – ist, nachdem ich weg war, noch so eine Wanderin vorbeigekommen? Mit verdreckter Cargohose?«
Am anderen Ende war es kurz still, während Thomas Schitterer nachdachte. »Ja, stimmt. Die wollte Fotos machen, aber ich hab sie gleich angeraunzt und weggeschickt. Wenn ich arbeite, kann ich keine Schaulustigen gebrauchen.«
Maibach schluckte. »Die hatte was mit den Ausgrabungen auf der Halbinsel zu tun. Ich bin ihr auch begegnet. Also, das heißt, Ursula war ihr schon begegnet, als ich dazukam …«
»Oh je. Lass mich raten. Ursel hat geplaudert, oder? Aber wie kommt es dann, dass sie in dem Artikel behauptet – warte mal, ich les dir’s vor – ›… stehen wir in engem Kontakt mit den regionalen Polizeibehörden, die momentan noch für die Moorleiche zuständig sind.‹ Wen meint sie denn da? Wenn weder du noch ich ihr irgendwelche Infos gegeben haben. Außer uns war doch noch gar keiner mit dem Fall befasst.«
Maibach stöhnte. »Oh nein. Sie ist mir total auf die Nerven gegangen, wollte unbedingt ihre Mitarbeit anbieten. Da hab ich mir halt ihre Karte geben lassen und gesagt, bei Bedarf würden wir uns melden …«
»Na prima. Das hat sie wohl etwas überinterpretiert, oder?«
»Offensichtlich.« Maibach überlegte. »Was steht denn sonst noch in dem Artikel drin?«
»Na ja, Spekulationen eben. Frühsteinzeitliche Besiedlungsgeschichte und so weiter. Ich denke, wir warten mal ab, was die Rechtsmedizin liefert. Vielleicht stimmt es ja, und wir brauchen ihre Mitarbeit noch. Oder übergeben ihr die Untersuchung tatsächlich ganz.«
Nachdem sie das Gespräch beendet hatten, las Maibach den ganzen Artikel sorgfältig durch. Seine gute Laune war verflogen; hoffentlich hatte Shitty recht, und die Leiche fiel tatsächlich in die Zuständigkeit der Archäologen. Ansonsten würde es ihn einige Mühe kosten, seinem Chef das Zustandekommen dieser Meldung zu erklären.
***
Zum Mittagessen gab es Hackbraten mit Karottengemüse und Kartoffelbrei. Angewidert stocherte Margarethe in ihrem Gemüse herum. Die Karotten waren so zerkocht, dass man sie durch bloßes Berühren mit der Gabel zu Mus zerquetschen konnte. Genau das tat Oskar am Nebentisch gerade mit Hingabe; dann machte er das Gleiche mit dem Hackbraten und vermischte zu guter Letzt alle drei Breie zu einer mittelbraunen Pampe, über deren Aussehen und Konsistenz Margarethe lieber nicht weiter nachdenken wollte. Sie wandte den Blick ab und konzentrierte sich wieder auf ihren eigenen Teller.
»Mmh. Die Karotten sind heute wieder so zart«, lobte Herr Maier, der ihr gegenübersaß.
»Hart?«, fragte Frau Fischer neben ihm. »Finden Sie? Also mir sind sie viel zu weich. Gemüse sollte bissfest sein.«
Herr Maier grinste nur und schob sich eine weitere Gabel Karotten in den Mund.
Am Nebentisch wühlte Oskar immer noch durch die Pampe auf seinem Teller. Das anhaltende Scharren des Löffels auf Porzellan ging Margarethe zunehmend auf die Nerven.
»Aber Herr Sailer, was machen Sie denn da?«, fragte Schwester Heike, die gerade am Tisch vorbeiging. »Sie essen ja gar nichts. Jetzt nehmen Sie doch mal einen Löffel voll.«
Oskar hob den Kopf. »Schlamm, alles nur Schlamm …«
Schwester Heike seufzte. »Ach, Herr Sailer. Das Essen war so hübsch angerichtet. Den Schlamm haben Sie selber draus gemacht. Kommen Sie, ich helfe Ihnen mal.« Sie ergriff Oskars Hand und lud behutsam eine Ladung Brei auf den Löffel.
»Nein! Nicht graben!« Oskars Kreischen ließ alle Köpfe an den umliegenden Tischen nach oben schnellen. »Der Schlamm muss bleiben!«
Er befreite seine Hand aus Schwester Heikes Griff; der Löffel voller Brei klatschte auf die Tischdecke, und bevor Schwester Heike reagieren konnte, stieß Oskar seinen Teller so heftig zur Seite, dass er mit lautem Klirren auf dem Boden aufschlug und die braune Pampe sich großflächig zwischen den Nachbartischen verteilte. Dann stürmte er aus dem Speisesaal, interessiert verfolgt von zwanzig Augenpaaren.
»Was hat er denn heute wieder?« Schwester Heike sah Oskar kopfschüttelnd nach. »Vorsicht, Frau Schneider. Da ist Kartoffelbrei an Ihrem Schuh.« Sie nahm eine Papierserviette vom Servierwagen und wischte an Margarethes linkem Schuh herum, bevor sie in Richtung Küche verschwand, um Putzzeug zu holen.
Mühsam erhob sich Margarethe von ihrem Stuhl. Der Fleck auf dem hellen Leder musste sofort gründlich entfernt werden, sonst war der Schuh für alle Zeiten ruiniert. Sie nahm ihren Gehstock und ging langsam den Gang entlang. Auf dem Weg passierte sie Oskars Zimmer; die Tür stand halb offen, und Margarethe sah ihn auf seinem Bett sitzen, den Kopf in die Hände gestützt, den Oberkörper hin- und herwiegend. Fast sah es so aus, als ob er weinte. Margarethe blieb an der Tür stehen, unschlüssig, ob sie weitergehen oder anklopfen sollte. Oskar tat ihr leid; er war immer so ein netter Kerl gewesen, es war schlimm mit anzusehen, wie er immer mehr unter seiner Demenz litt. Es musste furchtbar sein, wenn man sich in der Welt, die einen umgab, nicht mehr zurechtfand …
Margarethe hatte gerade beschlossen, sich nicht bemerkbar zu machen, als Oskar den Kopf hob und sie im Türrahmen stehen sah. Bei ihrem Anblick schluchzte er laut auf, und Margarethe sah, dass sein Gesicht tatsächlich tränenüberströmt war. Sie versuchte ein beruhigendes Lächeln.
»Margarethe!« Oskars Stimme hatte etwas Flehendes, und er sah sie mit großen, verweinten Augen an.
Margarethe konnte nicht anders. Sie betrat das Zimmer, setzte sich zu ihm aufs Bett und legte ihm tröstend eine Hand auf die Schulter.
»Na, na«, sagte sie. »Oskar. Alles gut. Musst doch nicht weinen.« Ein seltsam vertrautes Gefühl überkam sie, fast so etwas wie ein Déjà-vu. Bestimmt hatte sie Ähnliches auch schon als Kind zu ihm gesagt, wenn er sich beim Spielen mal das Knie aufgeschlagen hatte.
Oskar drehte sich zu ihr und vergrub sein Gesicht an ihrer Brust. Sie wusste nicht recht, wie sie reagieren sollte, aber schließlich blieb sie einfach ruhig sitzen und wartete ab. Irgendwann würde er sich schon beruhigen. Sie streichelte seine Schulter, gab ab und zu ein paar besänftigende Laute von sich. Der Stoff ihrer Bluse fühlte sich feucht an; sie würde nachher nicht nur ihre Schuhe wechseln müssen.
Als habe er ihre Gedanken gelesen, wandte Oskar sich auf einmal von ihr ab und richtete seinen Blick auf den Boden. »Schlamm! Alles voller Schlamm! Und die Schuhe!« Er begann wieder laut zu weinen.
»Das ist doch nicht so schlimm, Oskar.« Margarethe kramte in ihrer Handtasche nach einem Taschentuch und hielt es ihm hin.
Oskar griff nach dem Tuch und schnäuzte sich. »Es tut mir so leid, Margarethe. Du musst mir verzeihen. Ich wollte das doch nicht.«
»Das weiß ich doch.« Margarethe klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter. »Mach dir keine Gedanken, Oskar. Das geht wieder weg. Kein Grund zur Sorge.«
»Nie wieder geht das weg! Nie wieder! Das bleibt ein Leben lang!« Oskars Weinen wurde wieder lauter.
Ratlos blieb Margarethe sitzen und versuchte vergebens, ihn zu beruhigen, aber Oskar schien untröstlich. Zu Margarethes unendlicher Erleichterung erklangen nach einiger Zeit Schritte auf dem Flur, und Schwester Heike steckte den Kopf durch die Tür.
»Ach, hier sind Sie, Frau Schneider! Ich hab mich schon gewundert, wo Sie bleiben – Ihr Essen wird doch ganz kalt!«
Margarethe zuckte hilflos mit den Schultern. »Ich wusste nicht, was ich tun soll. Oskar hört einfach nicht auf zu weinen …«
Schwester Heike kam mit resoluten Bewegungen ins Zimmer und beugte sich zu Oskar hinunter.
»So, Herr Sailer! Jetzt beruhigen wir uns mal.«
Sie fuchtelte mit einer Hand in Margarethes Richtung und machte eine rasche Kopfbewegung zur Tür hin. Margarethe verstand. Dankbar stand sie auf, tätschelte Oskar noch einmal freundschaftlich an der Schulter und verließ das Zimmer. Schwester Heikes Beruhigungsversuche schienen allerdings auch keinen großen Erfolg zu haben: Oskars flehentliche Rufe »Margarethe! Verzeih mir!« verfolgten sie noch, bis sie ihre eigene Zimmertür endlich hinter sich geschlossen hatte. Lieber Gott, dachte sie und sank auf ihren Sessel. Lass mich bitte sterben, bevor ich so den Verstand verliere.
***
Die Morgenbesprechung war vorbei, und die meisten Mitarbeiter aus Maibachs Ermittlungsgruppe bei der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen hatten die Dienststelle verlassen. Rüdiger Wille und Stefan Loderer mussten am späten Vormittag in einem Gerichtsverfahren in Ravensburg aussagen, und Katrin Gerber hatte sich mit Jens Kleinschmidt auf den Weg zu einer Zeugenbefragung gemacht. Nur Ulrike Müller saß an ihrem Computer und bearbeitete diverse Dokumente.
Den Fund der Moorleiche hatte Maibach in der Teambesprechung nur kurz gestreift. Er hatte zwar von seinem Ausflug zum Schreckensee berichtet, die Begegnung mit der Archäologin aber vorerst unerwähnt gelassen. Nun saß er in seinem Büro und grübelte vor sich hin. Die Ungewissheit darüber, wie die Ermittlung in diesem Fall weitergehen würde – oder ob es überhaupt eine polizeiliche Ermittlung geben würde –, ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Ob der junge Rechtsmediziner schon etwas herausgefunden hatte? Maibach fuhr seinen Computer hoch, aber es war keine diesbezügliche Nachricht eingegangen.
Kurz entschlossen griff Maibach zum Telefon und wählte die Nummer der Rechtsmedizin.
»Hier Mönch. Wer stört?«
Maibach musste grinsen. »Hallo, Claudi! Das ist ja schön, dass ich dich persönlich erwische. Maibach hier.«
»Weiß ich doch, Novemberpfütze. Hab deinen Namen auf dem Display. Glaubst du, ich hätte mich sonst so bescheuert gemeldet?«
»Na, dir trau ich alles zu«, erwiderte Maibach lachend. Es war wie immer verblüffend, wie schnell sich seine Laune besserte, wenn er nur Claudis Stimme hörte; die saisonal wechselnden Wortspiele mit seinem Namen verzieh er ihr da gern.
»So. Das ist ja schön zu hören.« Am anderen Ende der Leitung raschelte Papier. »Wollte mich sowieso demnächst bei dir melden. Warte mal, wo hab ich’s denn?« Das Geraschel wurde lauter. »Ja. Also. Ich nehme an, es geht um die Moorleiche?«
»Ja, genau. Mich interessiert natürlich in erster Linie, ob ihr die Liegedauer schon etwas näher eingrenzen könnt – also ob das ein Fall für uns oder eher für die Archäologen ist. Dein junger Kollege war ziemlich begeistert über den Fund – hat er sich die Leiche schon angeschaut?«
Claudia Mönch schnaubte. »Mein junger Kollege, ja. Wenn er am Fundort etwas weniger begeistert gewesen wäre und dafür etwas genauer hingeschaut hätte, müsstest du mir diese Frage gar nicht stellen.«
»Ach?« Maibach war verwirrt. »Soll das heißen, ihr habt schon ein eindeutiges Ergebnis? Ich dachte, bei Moorleichen wäre die Altersbestimmung so schwierig?«
»Wie man’s nimmt. Eine Eingrenzung aufs Jahr genau kann ich dir tatsächlich nicht liefern. Aber dass es ein Fall für dich und nicht für die Archäologen ist, das steht eindeutig fest.«
»Was?« Maibachs Adrenalinpegel stieg merklich. »Bist du sicher?«
»Klar bin ich sicher, Herbstnebelchen. Und willst du auch wissen, warum?«
Maibach lächelte vor sich hin. Typisch Claudi. An der entscheidenden Stelle machte sie gern eine Kunstpause und wartete auf seine gespannte Nachfrage. Kein Problem, den Gefallen konnte er ihr tun.
»Klar. Warum?«
»Aufgrund der vermutlichen Todesursache.« Pause.
Heute übertrieb sie es aber. Maibach rollte mit den Augen. »Und? Die wäre?«
»Lungensteckschuss. Kaliber 7,65 Millimeter. Und das war in der Steinzeit eher selten.«
»Okay …« Maibach schluckte.
Das Gespräch mit Kriminaloberrat Meißner, das er nun würde führen müssen, würde nicht besonders angenehm werden. Er konnte sich schon lebhaft vorstellen, wie sein Chef auf diese Entwicklung reagieren würde, insbesondere wenn er den Zeitungsartikel mit den Äußerungen der Mitarbeiterin des Landesamts für Denkmalpflege gelesen hatte.
»Bist du noch dran?« Claudia Mönchs Stimme riss ihn aus seinen Grübeleien.
»Natürlich bin ich noch dran.« Er überlegte. »Kriminaloberrat Meißner wird bestimmt sofort eine Ermittlungsgruppe zu dem Fall einrichten. Hast du noch mehr Verwertbares für mich?«
Claudia Mönch schnaubte erneut. »Woran denkst du da genau? Soll ich dir vielleicht gleich Adresse und Telefonnummer deiner Leiche durchgeben? Also ehrlich, Maibach. Ein bisschen Ermittlungsarbeit müsst ihr schon noch selber erledigen.«
Auch wieder typisch Claudi. Maibach kannte niemanden, der so schnell eingeschnappt war wie sie, wenn sie das Gefühl hatte, dass man ihre Arbeit nicht angemessen würdigte. Zum Glück wusste er, wie er sie wieder besänftigen konnte.
»Das tun wir ja auch, keine Sorge. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du uns so schnell auf die richtige Spur geführt hast. Ich meinte doch nur – vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet. Welche Möglichkeiten hast du, um uns bei der weiteren Identifizierung zu helfen?«
Am anderen Ende der Leitung war es kurz still; wahrscheinlich überlegte Claudi, wie viel Wissenschaft er vertragen würde. Erfahrungsgemäß nicht allzu viel, aber das hatte sie noch nie abgeschreckt. Er hörte sie tief Luft holen.
»Also – eine rein visuelle Identifizierung ist natürlich in so einem Fall deutlich erschwert. Du hast ja selber gesehen, dass Haut- und Haarfarbe durch die Huminsäuren im Moormilieu grundlegend modifiziert werden können. Mit anderen Worten, ich würde zunächst nicht davon ausgehen, dass deine Leiche, als sie noch lebte, dunkelbraune Haut und rote Haare hatte.«
»Rote Haare? Ist mir gar nicht aufgefallen.«
»Als du sie gesehen hast, war sie ja auch noch voller Schlamm. Aber wie gesagt, die Farbe hat sowieso nichts zu bedeuten.«
Maibach wartete ab. Wie er Claudi kannte, war sie sicher noch nicht am Ende ihrer Ausführungen angelangt. Er hatte recht.
»Wir werden natürlich in den nächsten Tagen noch weitere Untersuchungen durchführen. Röntgen, Computertomogramm, odontologische Untersuchung … Wenn du also irgendwann mal eine Idee hast, um wen es sich handeln könnte, können wir dessen Zahnstatus mit unseren Ergebnissen abgleichen.«
Er wagte eine weitere Nachfrage. »Kannst du die Liegezeit im Moor noch irgendwie eingrenzen? Ich meine, abseits der Tatsache, dass es zum Todeszeitpunkt schon Schusswaffen gegeben haben muss?«
»Schwierig. Nach oben im Prinzip keine Grenze. Aber ein Minimum von ungefähr fünf Jahren ist anzunehmen. So lange dauert es, nach allem, was ich über derartige Fälle gelesen habe, wohl mindestens, bis die typische Moorleichenmorphologie sich entwickelt.«
Das war doch zumindest ein halbwegs hilfreicher Ansatz. Sie würden sich also um Vermisstenfälle kümmern müssen, die schon fünf oder mehr Jahre zurücklagen. Maibach machte sich eine Notiz und hörte noch einige Minuten geduldig zu, während Claudia Mönch ihm mit wachsender Begeisterung und abnehmender Verständlichkeit detailliert ihr weiteres Vorgehen schilderte. Als er sich am Ende des Telefonats nochmals ausdrücklich bei ihr bedankte, konnte er sicher sein, dass er die kleine Unstimmigkeit von vorhin wieder gänzlich aus der Welt geschafft hatte.
»Was haben Sie sich denn dabei nur gedacht?« Mit hochrotem Kopf erhob sich Kriminaloberrat Meißner von seinem Schreibtischstuhl. »Gar nichts wahrscheinlich, wie üblich!«
Da sein Chef die ohnehin nur rhetorisch gemeinte Frage schon selbst beantwortet hatte, zog Maibach es vor, stumm sitzen zu bleiben und das Wortgewitter weiterhin reglos über sich ergehen zu lassen.
»Unbefugte Außenstehende mit halb garen Informationen zu einer laufenden Ermittlung zu versorgen! Fehlinformationen, die dann postwendend in der Zeitung landen! Ich muss Ihnen wohl nicht sagen, wie hochgradig unprofessionell ein solches Verhalten ist!«
Maibach schwieg. Dass er keine Informationen weitergegeben, sondern lediglich eine Visitenkarte eingesteckt hatte, hatte er bereits mehrfach betont. Doch Meißner hatte offensichtlich beschlossen, diesen Einwand zu ignorieren.
»Wie stehen wir denn da? Die Außenwirkung eines derartigen Fehlers ist nicht zu unterschätzen. Das muss umgehend richtiggestellt werden. Wir brauchen sofort eine Gegendarstellung. Frau Mechtersheimer!«
Obwohl die Tür zum Vorzimmer geschlossen gewesen war, tauchte die Sekretärin in Sekundenschnelle im Büro auf. Zu ihrem guten Gehör konnte man ihr nur gratulieren.
»Frau Mechtersheimer, ich brauche dringend einen Gesprächstermin mit der Lokalredaktion der Schwäbischen Zeitung. Persönlich, wenn es geht. Am besten noch im Lauf des Vormittags.«
»Also des könnt schwierig werden. Es ist ja schon zehn Uhr durch …«
»Umso dringender hängen Sie sich jetzt ans Telefon!!!« Meißners Gesichtsfarbe wurde noch eine Stufe dunkler.