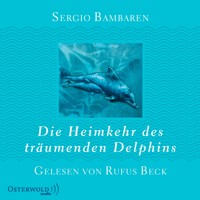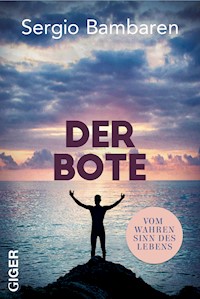8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paola und Martin: für beide ist es die große Liebe, nichts wird je ihr Glück zerstören. In der Nähe eines verwunschenen Leuchtturms finden sie den vollkommenen Platz, wo sie ihre Träume leben werden. Doch erst die Weisheit des alten Leuchtturmwärters zeigt ihnen, dass es mehr braucht als Gefühle und Leidenschaft … Eine ergreifend schöne Geschichte vom Autor des Welterfolgs »Der träumende Delphin«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Paola,
die im wahren Licht steht
Übersetzung aus dem Englischen von Gaby Wurster
Mit 10 farbigen Illustrationen von Heinke Both
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
13. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95750-2
Deutschsprachige Ausgabe: © 2002 Piper Verlag GmbH, München Englischer Originaltitel: »The Guardian of the Light. Tales of a Lighthouse Love« Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagabbildung: Heinke Both Reproduktion der Abbildungen: Lorenz & Zeller, Inning a. A. Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Alles hat seine Zeit. Auch die Liebe.
Und das Gefühl für das, was man fühlen sollte.
Elvira
Wer nichts riskiert, setzt alles aufs Spiel.
Vorbemerkung des Autors
Nie werde ich vergessen, wie ich zum erstenmal einen Leuchtturm sah.
Ich war damals ein Kind von fünf oder sechs Jahren und machte große Augen vor Ehrfurcht. Dieser Wächter am Rande der Klippen, der Schiffe und erschöpfte Matrosen sicher durch tückische Gewässer führte, sprach sofort mein Herz an. Wie konnte ein einzelnes Licht für so viele Menschen von so großer Bedeutung sein? Wie konnten so viele Menschen diesem Licht und jenen vertrauen, die darüber wachten?
Wenn ich heute, als Erwachsener, Leuchttürme betrachte, verstehe ich, warum mich diese wundervollen Warntürme stets so fasziniert haben. Ich bin tief beeindruckt von dem gleißenden Lichtstrahl und dem Zweck, den er erfüllt: Schiffe und ihre Besatzungen zu leiten. Bei Regen und Sturm, bei Nebel und Dunst – das Licht ist immer da, hinter der Glaslinse und der Glaswand, die das Licht bündeln und weit hinaustragen.
Trotzdem strahlt das Licht erst dann heller, wenn es die gläserne Wand durchbrochen hat.
Solche Wände stellt das Leben auch vor uns auf.
Gläserne Wände. Sie sind überall. Wir können sie nicht sehen, aber wir wissen, daß sie da sind. Sie machen den Weg zu unserer Bestimmung noch steiniger, noch schmerzlicher. Könnten wir die einengenden Grenzen überschreiten, würden wir im helleren Licht stehen und alles ganz klar sehen, dann würden wir die Wahrheit erkennen, wie sie wirklich ist: nackt und wunderbar.
Leichter gesagt als getan.
Und doch gibt es die gläsernen Wände nur in unseren Köpfen und in unseren Herzen.
Indem die Welt immer mehr zusammenwächst und erfundene Grenzen durch die Globalisierung an Bedeutung verlieren, können wir merken, daß der beste Weg, unser wundervolles Abenteuer Leben zu genießen, Ehrlichkeit mit uns selbst ist. Wir können es schaffen, wir selbst zu sein, unseren Überzeugungen zu vertrauen und sie mit anderen zu teilen; wir können das Leben, das wir uns erträumten, ans Licht bringen. Und uns von den Ketten befreien, die wir einzig und allein in unseren Köpfen und in unseren Herzen tragen.
Wir können wie Leuchttürme sein, deren Strahl die gläserne Wand durchdringt und zur Wahrheit führt.
Santiago
Geschäftsreisen muß man machen, auch wenn sie öde sind. Um die nötigen Auslandskontakte herzustellen und ein Geschäft zum Laufen zu bringen, muß man eben reisen.
Mein Ziel war Santiago de Chile, eine moderne, geschäftige Stadt am Fuße der Anden. Ich lebte damals in Lima, wo ich mich einige Monate zuvor niedergelassen hatte. Geboren bin ich in Sydney, dort wurde ich zum passionierten Surfer, und nach dem weit entfernten Peru war ich ausgewandert, weil ich gehört hatte, daß dort die tollsten Wellen an die Küste schlagen.
Der Hauptgrund für den Umzug war jedoch mein Wunsch, meinem Leben einen Sinn zu geben, ich wollte Menschen helfen, die im Erreichen ihrer Ziele nicht soviel Glück hatten wie ich. Nachdem ich so viele Geschichten gehört hatte über Armut und Not und den Überlebenskampf gegen alle Widrigkeiten, wollte ich wissen, wie Menschen in einem unterentwickelten Land leben. Ich war Anfang Vierzig, finanziell unabhängig, und ich hatte den Traum, anderen zu helfen, indem ich das berufliche Können anwandte und weitergab, das ich mir in zwanzig Jahren im Bereich Marketing und Verkauf von Lebensmitteln angeeignet hatte. Ich wollte eine Firma gründen, wo unterprivilegierte Menschen neue Fähigkeiten erwerben könnten und so die Möglichkeit hätten, für sich und ihre Familie eine vielversprechende Zukunft aufzubauen. Mit den Gewinnen der Firma wollte ich Schulen für Bedürftige bauen, wo sie einen guten Start ins Leben bekommen sollten.
Wenn es in diesem wundervollen, fremden Land, dem Land der Inka, eine gute Dünung gab, surfte ich regelmäßig nach der Arbeit, wie ich es als Kind an den fernen Stränden von Oz getan hatte. Immer noch gleite ich begeistert über Wellenkämme; das schenkt mir ein einzigartiges Gefühl, das Gefühl, lebendig zu sein, ewig zu leben, in guten wie in schlechten Zeiten.
Doch es war mir unangenehm, an einem Ort zum Surfen zu gehen, wo mich so viel Armut umgab. Ich fand es nicht fair. Ich war in einem hochentwickelten Land geboren und konnte den Gedanken nicht ertragen, ein bequemes Leben zu haben, wo es so viel Hunger gab, so viel Not. Mit der Zeit gewöhnt man sich an alles, und viele Menschen in Dritte-Welt-Ländern schenken Kindern, die um ein paar Münzen oder eine Brotrinde betteln und auf der Straße verhungern, überhaupt keine Beachtung mehr. In solchen Gesellschaften ist es normal, daß Arm und Reich nebeneinander leben. Ich konnte es jedoch nicht mit ansehen, ich wollte etwas dagegen tun. Der einzige Schatz im Herzen der Armen ist die Hoffnung, daß ihnen irgendwann einmal jemand die Chance gibt, ihre Lebensqualität zu verbessern. Anstatt also auf die Abgeklärten zu hören, die mir sagten: »Das Problem ist zu groß, du kannst nichts ausrichten«, sagte ich mir: »Lebe deinen Traum, Martin, schaffe etwas aus dem Nichts, hilf denen, die nicht soviel Glück hatten wie du selbst. Und wenn es schwierig wird, laß dich immer von deinem Traum leiten.«
Und so kam ich nach Santiago de Chile, um Geschäftskontakte zu knüpfen, die ich für die Verwirklichung meines Traums brauchte.
In Lima hatte ich eine kleine Firma gegründet; ich importierte Käse und Wein aus Australien, wo es hervorragenden Wein und ausgezeichnete Milchprodukte gibt. Um nun mein Käsesortiment mit chilenischen Produkten zu erweitern, reiste ich nach Santiago.
Doch auf Geschäftsreisen langweilt man sich manchmal und fühlt sich schrecklich allein.
Nachdem ich alle Termine wahrgenommen hatte, hatte ich vor dem Rückflug nach Lima noch einen freien Abend. In Santiago war es schon Sommer, die Tage waren heiß und schwül, die Abende jedoch angenehm kühl.
Ich war hundert Kilometer im Landesinneren und fühlte mich wie immer verloren, wenn ich so weit vom Meer entfernt war. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, ging ich zu Fuß in ein Stadtviertel, das mir der Hotelangestellte empfohlen hatte; dort gebe es Restaurants, Bars und Cafés, wo ich bei einem Glas ausgezeichneten chilenischen Weins das Treiben beobachten könnte.
So kam ich in die Calle Suecia, eine Straße voller Lokale, wo die Einheimischen sich nach der Arbeit treffen.
Ich schlenderte eine Weile herum und setzte mich schließlich auf die Terrasse eines ruhigen, aber ansprechenden Cafés.
»Was darf’s sein, Señor?« fragte der Kellner freundlich.
»Ein Glas chilenischen Rotwein. Können Sie mir etwas empfehlen?«
»Oh, wir haben einen vorzüglichen Caliterra Cabernet Sauvignon von 1998, an Körper reich, kräftiges Bukett. Dazu würde am besten eine Käseplatte passen.«
»Hervorragend!«
»Sehr wohl, Señor.«
Kaum fünf Minuten später kam der Kellner mit einer kleinen Auswahl einheimischer Käsesorten und einer Flasche Wein wieder. Behutsam zog er den Korken, ließ den Wein einen Augenblick atmen und schenkte ein. »Es gibt keine bessere Gesellschaft als ein gutes Glas Wein. Zum Wohl!«
»Das ist wahr. Danke.«
Und tatsächlich, der Wein war kraftvoll: kirschrot, Eichennote, intensives Bukett, langer Abgang.
»Eine ausgezeichnete Empfehlung«, sagte ich zum Kellner.
»Danke, Señor.«
Ich saß eine gute halbe Stunde in der wohltuend frischen Luft und dachte, wie sehr ich Käse und Wein doch liebte.
Ich trank aus und bat um die Rechnung. Ich wollte ins Hotel zurückspazieren, früh zu Bett gehen und am nächsten Morgen mein Flugzeug nehmen.
»Kaufen Sie meine Rose, Señor!«
»Wie bitte?«
»Kaufen Sie meine Rose, Señor, es ist meine letzte. Wenn ich sie verkauft habe, darf ich nach Hause gehen.«
Ich blickte das kleine Mädchen an. Sie war nicht älter als fünf oder sechs, ihre Kleider waren zerrissen, sie sah schmutzig und hungrig aus und hatte für ein paar Pesos wohl den ganzen Tag in glühender Hitze und im kalten Abendwind gearbeitet, um ihre Familie zu unterstützen. Wie immer wollte ich zuerst sagen: »Nein, danke«, doch dann wurde mir klar, daß man die Welt nicht mit Worten, sondern nur mit Taten besser macht. Wenn ich also anderen helfen wollte, wie ich es mir vorgenommen hatte, gab es kein Nein mehr, vor allem nicht für ein Mädchen dieses Alters, das eigentlich in die Schule gehen oder mit Freunden spielen sollte. Sie hatte eine schlechte Ausgangsposition im Leben, aber immerhin bettelte sie nicht, sondern arbeitete.
»Gut, ich nehme die Rose.«
»Gracias, Señor.« Ihre Augen strahlten, und sie lächelte, wie nur Kinder lächeln können.
»Wieviel?«
»Mil Pesos, Señor.«
Ich gab ihr das Geld. »Und jetzt geh nach Hause.«
»Wem soll ich sie geben?«
»Wie bitte?«
»Die Rose, Señor. Wem soll ich sie geben?«
»Ich weiß nicht.«
Am Nebentisch saßen vier junge Damen, Chileninnen, wie ich hörte, denn sie sprachen, wie es nur die Menschen dieses wundervollen Landes tun – sie sprachen nicht, sie sangen.
»Gib sie einer Dame am Nebentisch. Aber sag nicht, von wem sie ist.«
»In Ordnung, Señor.«
Das Mädchen tat, wie geheißen. Ich sah nicht, wem sie die Rose gab, ich dachte nur an den Rückweg zum Hotel.
Die Rose
Die vier Damen waren allem Anschein nach alte Freundinnen, die sich nach einem harten Arbeitstag entspannten.
»Señorita?«
»Ja?« sagte eine der vier.
»Die Rose ist für Sie, Señorita.« Das Mädchen gab ihr die Blume.
»Danke. Von wem?«
»Das darf ich nicht sagen.«
»Warum nicht?«
»Der Señor will es nicht.«
»Hm. Gut. Dann geh jetzt nach Hause, es ist spät. Danke noch mal.«
Ich hatte mittlerweile bezahlt und stand auf.
»Señor?« Noch einmal das kleine Mädchen.
»Bist du immer noch da? Du solltest längst zu Hause sein, du hast sicherlich einen weiten Weg und …«
»Señor, die Damen am Nebentisch lassen fragen, ob Sie ihnen Gesellschaft leisten wollen.«
»Was?«
Zwei von ihnen winkten herüber.
»Ich habe dir doch gesagt, daß du nicht verraten sollst, von wem die Rose ist!«
Aber nun war es raus. Schüchtern, wie ich bin, und mit zitternden Knien ging ich zu ihrem Tisch.
»Bitte, setzen Sie sich doch!« sagte eine mit der melodischen Aussprache der Chilenen.
»Danke, ich bin Martin.«
»Maria Soledad, Maria Pia, Maria Loreto und Maria Paola – ob Sie es glauben oder nicht, so heißen wir.«
»Die vier Marien?«
»Ja!«
Wir lachten.
Maria Paola sagte: »Danke für die schöne Rose.«
»Welche Rose?«
»Die Sie mir schicken ließen.«
Ich sah mich um, und das Mädchen rannte lachend weg.
»Sie hat es Ihnen gesagt!«
»Nun, ja. Aber es war nicht einfach, es aus ihr herauszubekommen. Als ich sie fragte, von wem die Rose sei, sagte sie, das dürfe sie nicht verraten. Doch nach einer Minute kam sie wieder zurück. ›Was ist?‹ fragte ich. ›Señorita‹, sagte sie, ›ich habe den ganzen Tag gearbeitet und habe immer noch eine Rose übrig, wenn ich sie verkauft habe, kann ich nach Hause gehen. Bitte, kaufen Sie die Rose, und dann sage ich Ihnen auch, von wem die andere Rose ist …‹«
Paola
So trat Paola in mein Leben. Dafür danke ich dem armen, unschuldigen, aber schlauen Kind.
Die Zeit verging schnell an jenem Abend. Wir unterhielten uns bestens, die vier Chileninnen waren eine wundervolle Gesellschaft, wir hatten viel Spaß miteinander. Wir tranken ein zweites Glas und schließlich ein drittes.
Mein Vorsatz, früh zu Bett zu gehen, verflüchtigte sich, aber ich dachte: Egal, ich kann ja im Flugzeug schlafen.
Während des Gesprächs merkte ich, daß Paola mich so ansah, wie auch ich sie ansah. Als wären die drei anderen gar nicht mehr da, hatte ich nur noch Augen für sie. Und ich spürte, daß es ihr genauso erging.
Doch die Zeit ist unerbittlich. Die Stunden vergingen, am nächsten Tag müßte ein jeder wieder seiner Arbeit nachgehen, auch ich. Und ich durfte mein Flugzeug nicht verpassen.
Die vier Marien verabschiedeten sich von mir nach lateinamerikanischer Sitte mit einem Kuß auf die Wange, und ich dankte ihnen für den schönen Abend. Paola war die letzte.
»Kann ich Sie wiedersehen?« fragte ich.
»Wie bitte?«
»Kann ich Sie wiedersehen?«
»Ich … ich muß meine Freundinnen nach Hause fahren. Morgen ist Mittwoch, ich muß früh aufstehen …«
»Ich meine, kann ich Sie heute nacht wiedersehen?«
Sie lächelte. »Mal sehen …«
»Großartig! Ich warte hier.«
Sie ging, und ich dachte: Sie kommt nicht wieder. Wir kennen einander ja kaum. Sie wohnt in Santiago, ich in Lima. Ich fliege morgen zurück, sie geht in ihr Leben zurück.
Es war lächerlich. Aber so lächerlich viele Dinge auch erscheinen mögen, die Welt ist voller Wunder für diejenigen, die auf ihr Herz hören. Also wartete ich. Und wartete. Und wartete. Schließlich zahlte ich und …
»Martin?«
Ich drehte mich um. Da war sie. Langsam kam sie auf mich zu und holte tief Luft. Ich stand auf und küßte sie zärtlich auf die Wange.
»Ich dachte, Sie würden nicht zurückkommen.«
»Der Duft haftet dem an, der eine Rose bekommt«, sagte sie.
»Danke.«
Wir setzten uns, tranken noch ein Glas und erzählten uns gegenseitig unser Leben. Für den Rest der Nacht zählten nur noch Paolas strahlende, lebhafte Augen.
Sie war einunddreißig und arbeitete seit ihrem Studium in einem Architekturbüro in Santiago. Sie war diese Arbeit leid und brauchte eine Veränderung. Und sie wollte von zu Hause ausziehen, denn sie lebte immer noch bei ihren Eltern im »Nest«. Sie hatte das Gefühl, es sei an der Zeit, flügge zu werden und ihr eigenes Leben zu beginnen. Doch zu allem Unglück hatte ihr Vater vor einigen Jahren einen Herzinfarkt, die Mutter vor kurzem einen Schlaganfall erlitten, und Paola fühlte sich verpflichtet, bei ihnen zu bleiben und sich um sie zu kümmern.
Und sie erzählte mir auch, daß sie in drei Tagen Geburtstag hätte. So gaben wir uns an jenem Abend gegenseitig ein Versprechen. Auf einer Serviette verfaßte ich ein paar Worte, unterschrieb und gab sie ihr. Sie lächelte und unterschrieb auch. Und als wir uns verabschiedeten, bauschte der kühle Wind von Santiago die Serviette, auf der geschrieben stand:
Paola, ich verspreche, daß ich zu Deinem Geburtstag nach Santiago komme.
Ich warte auf Dich. Versprochen, Martin.
Schicksal
Beim Aufwachen konnte ich nur an eines denken: Ich mußte Paola wiedersehen, bevor ich nach Lima zurückflog.
Ich rief die Nummer an, die Paola mir am Abend gegeben hatte. Es läutete viermal, dann hörte ich eine verschlafene Stimme: »Ja?«
»Hallo, Paola.«
»Hallo, Martin.«
»War es schön für dich gestern abend?«
»Mehr als das, es war phantastisch! Ich habe mich schon lange nicht mehr so gut mit jemandem verstanden.«
»Ich auch nicht.« Trotz des Telefons fühlte ich mich ihr so nahe wie am Abend zuvor. Ich hielt eine Sekunde inne, holte tief Luft und fragte: »Was hast du heute vor?«
»Ich will dich sehen.«
Ich war sprachlos. Plötzlich fühlte ich mich wie fünfzehn!
»Ich rufe dich in fünf Minuten wieder an.«
»Ich warte«, sagte sie.
Die Wege des Lebens sind manchmal unergründlich. Ich weiß nicht, warum, aber in jenem Moment, als Paola sagte: »Ich will dich sehen«, klangen diese vier Wörter so selbstverständlich, so richtig, so herzlich, daß ich wußte: Sie ist es. Sie ist diejenige, die ich so lange gesucht hatte.
Ich rief bei LAN-Chile an.
»Guten Morgen, was kann ich für Sie tun?«
»Ich hatte eine Reservierung für 11.30 Uhr nach Lima. Kann ich umbuchen und die Abendmaschine nehmen?«
»Ich fürchte fast, das geht nicht mehr, Sir.«
»Bitte versuchen Sie es! Wissen Sie, ich habe gestern abend die Liebe meines Lebens getroffen, und ich habe ihr versprochen, daß wir den Tag zusammen verbringen.«
Die Dame am anderen Ende der Leitung lachte. Sie fragte nach meinem Namen und der Flugnummer. »Warten Sie bitte, Señor.«
Ich wartete und dachte: Es ist schon seltsam. Wenn die Abendmaschine ausgebucht ist, muß ich Paola verlassen und werde sie vielleicht nie mehr wiedersehen. Aber wenn ich noch einen Platz bekomme, haben wir einen wundervollen Tag vor uns, und das ist vielleicht der Beginn einer wundervollen Liebe.
Schicksal. Was heißt das? Ein bißchen Glück, ein bißchen Vertrauen? Eine starke Hand, die irgendwo im Himmel eine Entscheidung für uns trifft?
»Sie haben Glück, Sir«, meldete sich die Dame wieder. »Wir haben noch einen Platz in der Abendmaschine, es ist der letzte.«
»Ich nehme ihn!«
»Geht in Ordnung, Sir.«
»Vielen Dank.«
»Keine Ursache, Sir. Haben Sie einen schönen Tag in Santiago!«
»Bestimmt!«
»Sir?«
»Ja?«
»Hoffentlich ist es auch die Liebe Ihres Lebens.«
»Das hoffe ich auch! Viele Menschen suchen ihr Leben lang ihre Herzensliebe und finden sie nicht.«
»Wenn Sie an das Schicksal glauben, Sir, muß ich Ihnen etwas sagen: Als ich die Passagierliste der Abendmaschine checkte, war alles belegt. Und gerade als ich Ihnen das sagen wollte, rief jemand an und hat storniert.«
Ich brachte keinen Ton heraus.
»Sir? Sir?«
Glück? Vertrauen? Die starke Hand Gottes?
Ich werde es wohl nie erfahren, ich weiß nur, daß es Wunder gibt und daß die Wege des Lebens manchmal unergründlich sind, aber wundervoll.
Ich rief Paola an und sagte ihr, daß ich umgebucht hätte und wir den Tag zusammen verbringen könnten.
Ich duschte, zog frische Jeans an, ein braunes Hemd und braune Lederschuhe, ich kämmte mich und ging hinunter in den Speisesaal, dessen Fenster auf den Hotelparkplatz hinausgingen. Aus einer kleinen bemalten Tasse trank ich schwarzen Kaffee und wartete auf Paola. Auch andere Hotelgäste saßen schon beim Frühstück. Der Tag war klar und strahlend blau, kein Wölkchen trübte den Himmel.
Ich las die Lokalzeitung, da hörte ich einen Wagen kommen. Es war Paola. Das Adrenalin schoß durch meinen ganzen Körper.
Sie stieg aus, schloß den Wagen ab und betrat den Speisesaal. Sie lächelte, als sie mich sah. Ich lächelte auch.
»Hallo.«
»Hallo.« Ich stand auf und küßte sie. Ich sah, daß sie Gänsehaut bekam.
Sie war sehr groß, ihr langes braunes Haar glänzte wie Gold in der Morgensonne Santiagos. Sie war atemberaubend schön, aber am schönsten waren ihre Augen. Wer in diese Augen blickte, schaute den Himmel!
»Hast du gut geschlafen?« fragte ich.
»Ja, auch wenn es eine kurze Nacht war.«
»Wohin gehen wir?«
»Magst du moderne Kunst?«
»O ja.«
Ende der Leseprobe