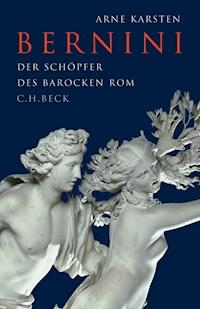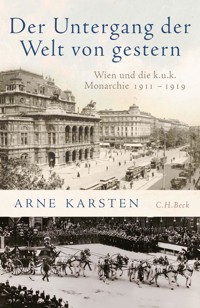
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Die "Welt von gestern", die mit dem Ersten Weltkrieg unterging, war voller innerer Widersprüche und äußerer Spannungen und erschien doch im Rückblick als verlorenes Paradies. Die Sieger dieser Geschichte sind oft genannt und gehört worden. Doch was war mit den Verlierern, und welches künftige Unheil war in der neuen Welt schon im Keim angelegt? Arne Karsten erzählt in seinem glänzend geschriebenen Buch eine andere Geschichte des großen Epochenumbruchs jenseits der hohen Politik.
Da ist zum Beispiel Stephanie Bachrach, die jugendliche Freundin Arthur Schnitzlers und geistsprühende Tochter eines jüdischen Börsenmaklers in Wien. Nach Bankrott und Selbstmord des Vaters tritt die einstige Millionenerbin im Krieg als Krankenschwester in den Spitaldienst ein und nimmt sich 1917 das Leben - wie soviele junge Frauen ihrer Generation, denen ihre vertraute Welt weggebrochen war. Ihr Schicksal hat Schnitzler mit sensibler Aufmerksamkeit verfolgt, wie er überhaupt ein brillanter Beobachter der gesellschaftlichen Krisen dieser Epoche war. Neben diesen beiden lässt Arne Karsten eine Fülle anderer Zeugen auftreten - Diplomaten, Militärs, Politiker, Künstler der späten k. u. k. Monarchie – und webt so das dichte Bild einer schillernden Epoche, die nicht nur in Wien, sondern in ganz Europa das bürgerliche Zeitalter zu Grabe trug.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Arne Karsten
Der Untergang der Welt von gestern
Wien und die k. u. k. Monarchie 1911–1919
C.H.Beck
Zum Buch
Die «Welt von gestern», die mit dem Ersten Weltkrieg unterging, war voller innerer Widersprüche und äußerer Spannungen und erschien doch im Rückblick als verlorenes Paradies. Die Sieger dieser Geschichte sind oft genannt und gehört worden. Doch was war mit den Verlierern, und welches künftige Unheil war in der neuen Welt schon im Keim angelegt? Arne Karsten erzählt in seinem glänzend geschriebenen Buch eine andere Geschichte des großen Epochenumbruchs.
Da ist zum Beispiel Stephanie Bachrach, die jugendliche Freundin Arthur Schnitzlers und geistsprühende Tochter eines jüdischen Börsenmaklers in Wien. Nach Bankrott und Selbstmord des Vaters tritt die einstige Millionenerbin im Krieg als Krankenschwester in den Spitaldienst ein und nimmt sich 1917 das Leben – wie so viele junge Frauen ihrer Generation, denen ihre vertraute Welt weggebrochen war. Ihr Schicksal hat Schnitzler mit sensibler Aufmerksamkeit verfolgt, wie er überhaupt ein brillanter Beobachter der gesellschaftlichen Krisen dieser Epoche war. Neben diesen beiden lässt Arne Karsten eine Fülle anderer Zeugen zu Wort kommen – Diplomaten, Militärs, Politiker und Künstler der späten k. u. k. Monarchie – und webt so das dichte Bild einer schillernden Epoche, die nicht nur in Wien, sondern in ganz Europa das bürgerliche Zeitalter zu Grabe trug.
Über den Autor
Arne Karsten ist Historiker und Kunsthistoriker und lehrt am Historischen Seminar der Bergischen Universität Wuppertal. Bei C. H.Beck liegen von ihm vor: «Bernini. Der Schöpfer des barocken Rom» (32017), «Kleine Geschichte Venedigs» (2008) und «Geschichte Venedigs» (2012).
Inhalt
Prolog
1. Kapitel: Im Wien der späten Kaiserzeit – Die höhere Tochter
Das Wien des Julius Bachrach
Familie Schnitzler
Die lieben Kollegen
Österreich von innen
Die Unerlösten
2. Kapitel: Balkanwirren und die Folgen – Ein armes Mädel
Italien stellt den Zünder scharf
«Es hat sich ja allerlei ereignet»
Venedig
Die Welt des alten Kaisers
Vom deutschen Wesen
3. Kapitel: Der Weltenbrand – Krankenschwester im Krieg
Ein Attentat und seine Vorgeschichte
Die England-Chiffre
«Sehr Krieg ist der Krieg hier!»
Die Armee des Franz Conrad von Hötzendorf
Gedanken im Kriege
4. Kapitel: Dem Ende entgegen – Zerrüttung
Propaganda
Österreichs eigentlichster Krieg
Die Welt des jungen Kaisers
«Ich halt’s nicht mehr lange aus»
Victor Zuckerkandls Krieg
5. Kapitel: Spiegelungen und Nachklänge
Abgesang auf eine Großmacht
Versailles und Wien
Kritik und Selbstkritik
Die Stimmen der Verlierer
Fräulein Else und ihre Schwestern
Nachwort und Dank
Anhang
Anmerkungen
Prolog
1. Kapitel:Im Wien der späten Kaiserzeit – Die höhere Tochter
2. Kapitel:Balkanwirren und die Folgen – Ein armes Mädel
3. Kapitel:Der Weltenbrand – Krankenschwester im Krieg
4. Kapitel:Dem Ende entgegen – Zerrüttung
5. Kapitel:Spiegelungen und Nachklänge
Bibliographie
I. Quellen
Unpublizierte Quellen
Publizierte literarische Quellen
Publizierte historische Quellen
II. Literatur
Bildnachweis
Personenregister
Prolog
Jede Nation spottet über die andere. Und alle haben recht.
Arthur Schopenhauer
Man steht im Leben immer wieder vor der Wahl, es sich selbst leicht und den anderen schwer zu machen – oder umgekehrt. Aber hat man denn eine Wahl?
Arthur Schnitzler
Am Silvestertag des Jahres 1918 notierte Arthur Schnitzler nach einem Spaziergang mit seiner Ehefrau: «Mit Olga um den Park herum. Erinnerung an das Paradies vor dem Krieg».[1] Derselbe Schriftsteller hatte kaum ein Jahr zuvor darüber sinniert, dass und warum er der wohl meistbeschimpfte Autor deutscher Sprache seit Erfindung der Druckerpresse sei. Zeit seines Lebens war Schnitzlers Verhältnis zu Gesellschaft und Politik zwiespältig, blieben seine Werke in höchstem Maße umstritten. Zwei seiner Dramen wurden von der Zensurbehörde der k. u. k. Monarchie mit Aufführungsverbot belegt. Und nun schien ihm diese Welt schlichtweg als «Paradies» – eine Wendung, die im ersten Moment schwer verständlich erscheint.
Um sie nachvollziehen zu können, soll im Folgenden Arthur Schnitzlers Sicht auf die gesellschaftliche und politische Entwicklung in den Jahren zwischen 1911 und 1919 rekonstruiert werden. Seit jeher gilt gerade dieser Autor als einer der sensibelsten und psychologisch hellsichtigsten Diagnostiker der spätbürgerlichen «Welt von gestern»[2] mit all ihren Brüchen, Ambivalenzen und Widersprüchen. Sein Blick auf das Ende dieser Epoche im Ersten Weltkrieg und die daran anschließende Revolutionsphase ist hingegen, so weit ich sehe, auf deutlich weniger Interesse gestoßen. Das mag damit zusammenhängen, dass Schnitzler sich zu politischen Themen niemals explizit in der Öffentlichkeit geäußert hat. Dennoch lässt sich seine Einschätzung der politischen Entwicklung recht präzise beschreiben, wenn man zum einen seine Tagebücher und Briefe, zum anderen seine Werke aus der entsprechenden Blickrichtung liest. Sie bilden die Basis dieses Buches.
Bei der Lektüre von Schnitzlers Tagebüchern in der genannten Epoche springt sehr bald der Name einer jungen Frau ins Auge, die der Dichter erst im Frühjahr 1911 kennengelernt hatte und die in seinen Notizen in kürzester Zeit eine Prominenz erlangte, die einzig von seiner Ehefrau Olga übertroffen wird. Stephanie Bachrach, so ihr Name, war 23, als sie den damals 49-jährigen, bereits berühmten Schriftsteller kennenlernte. In den folgenden Jahren begleitete Schnitzler den dramatischen Lebensweg der Tochter eines jüdischen Bankiers mit Aufmerksamkeit und väterlicher Sorge, während umgekehrt der von ihr bald «Vater» genannte Schnitzler sich zum zentralen Bezugspunkt und Mentor, augenblicksweise auch mehr, für die junge Dame aus gutem Hause entwickelte. Die Struktur des Buches folgt dem Lebensweg der Stephanie Bachrach, in dem es drei tiefgreifende Einschnitte gab und der mit ihrem frühen Tod im Mai 1917 endete. Da sich von ihr nur zwei Briefe und einige Postkarten an Schnitzler erhalten haben,[3] wird es darum gehen, die Biographie eines Menschen fast ausschließlich über die Außenperspektive, die Reaktionen und Wirkungen, die er in der Wahrnehmung anderer hervorbrachte, zu rekonstruieren.[4] Die Stimme der Protagonistin selbst wird nur an ganz wenigen Stellen, dann freilich klar und charakteristisch, vernehmbar. Ihr Schicksal, in vielerlei Hinsicht emblematisch für die Zeit, in der es sich erfüllte, tritt dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, mit einiger Anschaulichkeit hervor.
Das Verhältnis eines berühmten Schriftstellers zu einer ganz unberühmten, wenngleich ihre Umwelt faszinierenden jungen Frau bildet also den äußeren Rahmen der folgenden Darstellung. Innerhalb dieses Rahmens gilt es, die Welt zu schildern, in der sich dieses Verhältnis entwickeln konnte: die Zeit der späten «Kaiserlich und königlichen Monarchie», des altehrwürdigen Habsburgerreichs, das unter einer Vielzahl innerer und äußerer Probleme litt und dennoch einen kulturellen Glanz ausstrahlte, der bis heute nicht verblasst ist. Es war ein eigenartiger Staat. Der angesehene Wiener Staatsrechtler Edmund Bernatzik pflegte seine Vorlesungen mit den Worten zu beginnen: «Ja, ich soll Ihnen Österreichisches Staatsrecht vortragen. Ja, weiß ich denn, was Österreich ist? Die ‹Neue Freie Presse› freilich, die weiß es genau.»[5] Und in Schnitzlers erstem, stark autobiographisch getöntem Roman «Der Weg ins Freie» heißt es über die Figur des «Hofrat Wilt»: «Für ihn aber bedeutete Österreich ein unendlich kompliziertes Instrument, das nur ein Meister richtig behandeln könnte und das nur deshalb so oft übel klänge, weil jeder Stümper seine Kunst daran versuche. ‹Sie werden so lange darauf herumschlagen›, sagte er traurig, ‹bis alle Saiten zerspringen und der Kasten dazu.›»[6] Am Ende zersprangen nicht nur «Saiten und Kasten», es zersprang eine ganze Welt, eben die des bürgerlichen Europa.
Wie sich dieser Untergang der «Welt von gestern» in Weltkrieg und Revolution in den Augen jener abspielte, die ihn nicht als notwendiges Übel auf dem Weg in eine strahlende Zukunft wahrnahmen, sondern als Ergebnis von Zerstörungs- und Auflösungsprozessen, lassen auch andere literarische Zeugnisse der Zeit erkennen, im Rückblick beispielsweise Robert Musils «Mann ohne Eigenschaften», dessen ebenso poetische wie analytische Sicht auf die untergegangene Donaumonarchie immer wieder zur Sprache kommen wird. Vor allem aber sind es Werke und Briefe Thomas Manns, die so etwas wie ein Komplementärstück zu Schnitzlers Sicht der Dinge bilden. Die beiden Schriftsteller kannten sich persönlich seit 1908 und schätzten einander in höchstem Maße, ohne im engeren Sinne befreundet gewesen zu sein. Thomas Mann schrieb einmal während des Ersten Weltkriegs, mit deutlichem Bezug auf Arthur Schnitzler: «In Wien sagte mir vor Jahren ein kluger Jude: ‹Was Ihren Sachen Würde und Liebenswürdigkeit verleiht, ist, daß Sie, indem Sie sie hingeben, zu sagen scheinen: ‹Besser kann ich es auf keinen Fall machen.›»[7] Eine Beobachtung, die Thomas Mann offensichtlich für ebenso zutreffend wie erfreulich hielt. Wie hoch die Anerkennung tatsächlich zu veranschlagen ist, die aus diesem Satz spricht, verrät ein Aphorismus Schnitzlers über eine seiner Ansicht nach zentrale Voraussetzung jeder bedeutenden künstlerischen Leistung: «Über das Ausmaß seines Talentes wird uns ein gewandter Autor zuweilen zu betrügen imstande sein, nie jedoch über den Grad des Interesses, das er selbst seinem Problem und seinen Gestalten entgegengebracht hat.»[8] Überhaupt äußerte sich Schnitzler, wenn auch nicht öffentlich – das tat er nie –, so doch privat über alle größeren Werke Manns mit uneingeschränkter Anerkennung, ja Bewunderung.[9]
Einig waren sich die beiden Schriftsteller nicht nur in der Einschätzung vieler gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen, sondern auch in der außerordentlichen Wertschätzung für das Werk Friedrich Nietzsches, den «Erzieher unserer Generation», wie ihn Musil, hochgreifend und dennoch kaum übertreibend, einmal genannt hat.[10] Nietzsches folgenreiche Erkenntnis vom «Tod Gottes», hinter welcher Formel sich ja vor allem die Einsicht in die Relativität der christlichen Morallehre und das daraus resultierende Ende ihrer gesellschaftlichen Verbindlichkeit verbarg, hat im Werk beider Schriftsteller vielfältigen Nachhall gefunden; ebenso die Skepsis des Philosophen gegenüber den Auswirkungen des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts. Beiden war der frisch-fromm-fröhliche Optimismus zutiefst suspekt, wie ihn beispielsweise der Naturwissenschaftler Werner von Siemens kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts bei einer Rede in Berlin äußerte: «Und so, meine Herren, wollen wir uns nicht irre machen lassen in unserem Glauben, daß unsere Forschungs- und Erfindungstätigkeit die Menschen höheren Kulturstufen zuführt, sie veredelt und idealen Bestrebungen zugänglich macht, daß das hereinbrechende naturwissenschaftliche Zeitalter ihre Lebensnot, ihr Siechtum mindern, ihren Lebensgenuß erhöhen, sie besser, glücklicher und mit ihrem Geschick zufriedener machen wird. Und wenn wir auch nicht immer den Weg klar erkennen können, der zu diesen besseren Zuständen führt, so wollen wir doch an unserer Überzeugung festhalten, daß das Licht der Wahrheit, die wir erforschen, nicht auf Irrwege führen, und daß die Machtfülle, die es der Menschheit zuführt, sie nicht erniedrigen kann, sondern sie auf eine höhere Stufe des Daseins führen muß.»[11] Gegenüber solchen hochtönenden Zukunftsvisionen standen sowohl Schnitzler als auch Thomas Mann den Ahnungen Nietzsches näher, wie er sie etwa in «Menschliches, Allzumenschliches» über die «Abendröthe der Kunst» zum Ausdruck gebracht hatte: «Wie man sich im Alter der Jugend erinnert und Gedächtnisfeste feiert, so steht bald die Menschheit zur Kunst im Verhältnis einer rührenden Erinnerung an die Freuden der Jugend. (…) Das Beste an uns ist vielleicht aus Empfindungen früherer Zeiten vererbt, zu denen wir jetzt auf unmittelbarem Wege kaum mehr kommen können; die Sonne ist schon untergegangen, aber der Himmel unseres Lebens glüht und leuchtet noch von ihr her, ob wir sie schon nicht mehr sehen.»[12]
Beides, Fortschrittsoptimismus und Zukunftsängste prägten wohl in keiner Stadt Europas die Atmosphäre in so eigenartig spannungsreicher Durchdringung wie gerade in Wien, der «Haupt- und Residenzstadt» der k. u. k. Monarchie. Das wird deutlich beim Blick auf die intensive kulturelle, aber auch wissenschaftliche Produktivität in den Jahrzehnten um 1900,[13] die Wien geradezu als «Laboratorium der Moderne» erscheinen lässt. Es wird aber auch deutlich, wenn man die Aufzeichnungen und Tagebücher führender Persönlichkeiten der österreichischen Gesellschaft und Politik dieser Zeit liest. Auch sie sollen im Folgenden zu Wort kommen, ebenso Memoiren und Erinnerungen, wie diejenigen des Diplomaten Heinrich Graf Lützow, des Generals Moritz von Auffenberg, des Bankiers Rudolf Sieghart, des Professors Josef Redlich oder des Schriftstellers Raoul Auernheimer,[14] um nur jene Werke zu nennen, denen für das in diesem Buch gezeichnete Bild vom Untergang der Welt von gestern besondere Bedeutung zukommt. Denn um Schnitzlers Sicht der Dinge und die Rolle Stephanie Bachrachs darin zu verstehen, wird es nötig sein, seine Bemerkungen und Beobachtungen immer wieder in größere Kontexte einzuordnen, Kontexte, die weit über des Autors Wiener Lebensrahmen hinausführen. Dabei werden allgemeine gesellschaftliche, politische, später auch militärische Ereignisse und Entwicklungen in ganz Europa in den Blick geraten.
Bei ihrer Betrachtung sollen auch und gerade die Stimmen der historischen Verlierer zu Wort kommen. Sie sind, wie wir sehen werden, in den meisten Fällen ebenso weit von nostalgischer Verklärung entfernt wie von pedantischer Selbstrechtfertigung. Natürlich sind sie subjektiv, wie es nun einmal jede individuelle Erinnerung an die Vergangenheit unvermeidlicherweise ist. Dessen ungeachtet gestatten sie, zumal wenn man sie miteinander abgleicht, die Rekonstruktion von Wahrnehmungen und Geschichtsdeutungen, die auch in den Arbeiten und autobiographischen Schriften Arthur Schnitzlers immer wieder anzutreffen sind. Dadurch besteht die Aussicht, Schnitzlers umfangreiches autobiographisches und literarisches Werk als Mittel historischer Erkenntnis fruchtbar zu machen; ein Werk, über das der Schriftsteller selbst, kurz vor Ende des Weltkriegs in alten Tagbüchern aus den 1890er Jahren blätternd, melancholisch bemerkte: «Es ist mein brennender Wunsch, daß sie nicht verloren gehen. Ist das Eitelkeit? – Auch, gewiß. Aber irgendwie auch ein Gefühl der Verpflichtung. Und als könnte es mich von der quälenden innern Einsamkeit befreien, wenn ich – jenseits des Grabes Freunde wüßte.»[15]
1. Kapitel:
Im Wien der späten Kaiserzeit – Die höhere Tochter
Das Wien des Julius Bachrach
Am 11. März 1911 notierte Arthur Schnitzler in seinem Tagebuch: «Wassermann mit Fräulein Bachrach». Die junge Dame, die ihm von seinem Freund und Schriftstellerkollegen Jakob Wassermann vorgestellt wurde, war die Tochter eines Börsenmaklers namens Julius Bachrach, dessen Karriere in vielerlei Hinsicht idealtypisch verlief und deswegen im historischen Rückblick aufschlussreich ist. Geboren am 17. August 1849 im mährischen Provinznest Trebitsch (Třebíč), kam er aus einer jüdischen Familie, die Ende des 17. Jahrhunderts nach Ungarn eingewandert war.[1] Es waren bescheidene Verhältnisse, aus denen er stammte, doch dank seines ausgeprägten Geschäftssinns gelang ihm ein rascher Aufstieg zu Wohlstand, dann zu Reichtum. Schon 1871, im Alter von gerade einmal 22 Jahren, wurde er als Geschäftsführer einer Holzhandlung im ungarischen Groß-Kanisza geführt.[2] Wenig später übersiedelte er in die prosperierende Haupt- und Residenzstadt Wien. Als Angestellter bei der Wiener Wechselstuben-Aktiengesellschaft fand er Zugang zu den führenden Finanzkreisen und freundete sich mit Theodor von Taussig an, der bis zu seinem Tod im Spätherbst 1909 einer der einflussreichsten Bankiers der Habsburgermonarchie war und es zum Gouverneur der wichtigen Bodencreditbank sowie zur Erhebung in den Adelsstand brachte.[3]
In der rapide wachsenden «Haupt- und Residenzstadt» Wien entstanden während der letzten Jahrzehnte der Habsburgermonarchie zahlreiche neue Stadtteile. Einer der exklusivsten war das «Cottage-Viertel» im Stadtteil Döbling (XIX. Bezirk). Hier, in der repräsentativen Hasenauerstraße, wohnte Stephanie Bachrach, als sie im Frühjahr 1911 Arthur Schnitzler kennenlernte.
Ganz so strahlend verlief die Karriere des Julius Bachrach zwar nicht, doch rangierte er im Jahre 1910 auf der Liste der knapp tausend reichsten Wiener mit einem Jahreseinkommen von mehr als 100.000 Kronen auf Platz 856.[4] In welche Regionen es der jüdische Sozialaufsteiger damit geschafft hatte, wird anschaulich, wenn man sich vor Augen hält, dass das höchste Gehalt eines Staatsdieners in der Habsburgermonarchie, nämlich dasjenige eines österreichischen Ministerpräsidenten, vergleichsweise bescheidene 24.000 Kronen jährlich ausmachte.[5] Dem Einkommen entsprechend befanden sich Wohn- und Geschäftssitz Bachrachs am Ende seines Lebens in der Hasenauerstraße 42, im vornehmen XIX. Bezirk Wiens (Döbling). Auch die Freizeitgestaltung erfolgte, wenn nicht standes-, so doch aufstiegsgemäß. Die Kurlisten im mondänen Bad Ischl, wo kein Geringerer als Kaiser Franz Joseph höchstselbst Jahr für Jahr seinen Sommerurlaub verbrachte, erwähnen 1878 die Anwesenheit des Herrn «Julius Bachrach, Kaufmann, Wien». Ein knappes Jahrzehnt später heißt es dann: «Julius Bachrach, Kaufmann, mit Gattin, Familie, Gesellschafterin Caroline Leitner und Dienerschaft, aus Wien.»
Wie die Ischler Kurliste des Sommers 1887 verrät, hatte Bachrach zu diesem Zeitpunkt geheiratet. Seine Frau Eugenie Leitner entstammte einer Beamtenfamilie, über die Arthur Schnitzlers Tagebuch später einmal vermerken sollte: «Adel, herabgekommen, aber geistig verfeinert».[6] Robert Musil schildert in seinem «Mann ohne Eigenschaften» die familiären und gesellschaftlichen Verhältnisse eines jüdischen Bankiers namens Leo Fischel, die denjenigen des Julius Bachrach so auffallend ähneln, dass man sie geradezu als lebensweltliches Vorbild für die Romanfigur reklamieren möchte; handelt es sich doch auch bei Leo Fischel um einen Emporkömmling, der es zwar zu beträchtlichem Reichtum, aber nicht zu einer wirklich konsolidierten Gesellschaftsposition bringt, was sich nicht zuletzt darin äußert, dass er (genau wie Bachrach) im «operativen Geschäft» als Börsenmakler tätig[7] bleibt und den schmückenden Titel eines Bankdirektors nur nominell führt. Seine Frau, Klementine geheißen, entstammt hingegen einer «alten Beamtenfamilie (…). Sie hatte vor vierundzwanzig Jahren Leo aus zwei Gründen geheiratet: erstens weil hohe Beamtenfamilien manchmal mehr Kinder als Vermögen besitzen, zweitens aber auch aus Romantik, weil ihr im Gegensatz zu der peinlich sparsamen Begrenztheit ihres Elternhauses das Bankwesen als ein freigeistiger, zeitgemäßer Beruf erschienen war und ein gebildeter Mensch im neunzehnten Jahrhundert den Wert eines anderen Menschen nicht danach beurteilte, ob er Jude oder Katholik sei. Ja, wie es damals war, empfand sie nahezu etwas besonders Gebildetes dabei, sich über das naive antisemitische Vorurteil des gewöhnlichen Volks hinwegzusetzen.»[8] In den frühen 1880er Jahren, als Eugenie Leitner und Julius Bachrach heirateten und bald zwei Töchter bekamen, schien die gesellschaftliche Wirksamkeit des altüberkommenen religiösen Antisemitismus im Abklingen begriffen. Es hätte einiger Hellsichtigkeit bedurft, um vorherzusehen, dass er schon sehr bald durch die neue, aggressivere und noch weitaus unheilvollere Form des rassischen Antisemitismus ersetzt werden würde.
Die Welt, in die Stephanie Bachrach am 22. Mai 1887 hineingeboren wurde, sie schien, wenn nicht rundum in Ordnung – wann wäre die Welt das schon je gewesen? –, so doch zugleich privilegiert und ambitioniert, wirtschaftlich gesichert und gesellschaftlich perspektivreich. Und die Eltern taten das Mögliche, um diese Perspektiven noch zu verbessern. Ebenso wie ihre um zwei Jahre ältere Schwester Annemarie, genannt Mimi, genoss Stephanie Bachrach eine Schul- und Allgemeinbildung nicht nur, wie sie sich für eine «höhere Tochter» um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert gehörte, sondern wie sie sich moderner, ja modischer kaum denken ließ. Nach der Grundschulzeit wurde sie auf ein englisches Internat geschickt, was ebenso teuer wie chic war.[9] Englische Schulen galten in Österreich damals als führend. So ist es kein Zufall, wenn in Schnitzlers 1912 uraufgeführtem Drama «Das weite Land» die beiden Protagonisten Genia und Friedrich Hofreiter ihre soziale Position und Ambition nicht zuletzt dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie ihr Kind auf den Namen «Percy» taufen und an einer englischen Schule erziehen lassen.
In welchem Maße Julius und Eugenie Bachrach bei der Erziehung ihrer jüngeren Tochter mit der Zeit zu gehen entschlossen waren, zeigte sich dann erneut nach dem Ende der Schulzeit, als sie ihr ein Studium des Traumfachs aller «höheren Töchter», Kunstgeschichte, in den Niederlanden und Italien ermöglichten.[10] Auch das war natürlich teuer, vor allem aber entschieden fortschrittlich insofern, als das Frauenstudium in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg zwar grundsätzlich möglich, aber noch keineswegs zur Normalität geworden war. Weitaus selbstverständlicher nimmt sich dagegen die exzellente literarische und vor allem musikalische Ausbildung des jungen Mädchens aus. Stephanie Bachrach brachte es auf der Geige immerhin so weit, dass sie in den Jahren ihrer Bekanntschaft mit Arthur Schnitzler eine gefragte Musizierpartnerin ihres väterlichen Freundes wurde,[11] was angesichts des hohen Niveaus, auf dem die Hausmusik im Hause Schnitzler gepflegt wurde, aufschlussreich genug ist. Auch ihre literarische Bildung war umfassend. Als eines Tages die unvorhergesehene Notwendigkeit eintrat, sich nach einem Gelderwerb umzusehen, bestand eine Idee darin, sie solle eine Anthologie mit den «Inhaltsangaben der schönsten Romane der Weltliteratur mit Auszug der schönsten Stellen verfassen».[12]
Aus dieser Idee wurde nichts, wie sich überhaupt herausstellen sollte, dass die so gut durchdachte und teuer bezahlte Bildung des Fräulein Stephi für ein praktisches Berufsleben nicht recht taugte. Dafür war sie allerdings auch nicht gedacht gewesen, denn sie diente nicht einer Verbesserung der Perspektiven auf dem Arbeits-, sondern jener auf dem Heiratsmarkt. Die Idee einer Berufstätigkeit der Frau war der «guten Gesellschaft» im bürgerlichen Zeitalter fremd, die Rolle als Hausfrau und Mutter schien selbstverständlich. Nicht, dass diese Rolle mit derjenigen eines «Heimchens am Herd», mit der spätere Zeiten sie in polemischer Absicht gerne gleichsetzten, tatsächlich identisch gewesen wäre. Möglichkeiten zur Ausgestaltung einer eigenen gesellschaftlichen Rolle bestanden für die Damen der Kreise, in denen Julius Bachrach auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn verkehrte, durchaus. Am eindrücklichsten vermutlich in Gestalt der Salonière, als Mittelpunkt eines Kreises von Intellektuellen, Gelehrten und Künstlern, der von Geist und Ausstrahlung der Gastgeberin zusammengehalten wurde.
Im Wien des 19. Jahrhunderts hatte es eine ganze Reihe solcher Salons gegeben,[13] und Stephanie Bachrach verkehrte in einem der glänzendsten Salons, den die Stadt am Vorabend des Ersten Weltkriegs zu bieten hatte. Berta Zuckerkandl, Gattin des renommierten Medizinprofessors Emil Zuckerkandl und nach dessen Titel nur «die Hofrätin» genannt, interessierte sich im Gegensatz zu ihrem ganz der Wissenschaft verschriebenen Ehemann in höchstem Maße für die gesellschaftliche Seite des Kulturlebens und legte ein allgemein anerkanntes Geschick darin an den Tag, Künstler und Wissenschaftler in ihrem Salon zusammenzuführen. Als Tochter des Presse-Zaren Moriz Szeps, Inhaber der vielgelesenen liberalen «Wiener Allgemeinen Zeitung», verfügte Berta Zuckerkandl über beste Verbindungen zu den Wiener Intellektuellenkreisen und durch ihre Schwester, die den Bruder des französischen Politikers Georges Clemenceau geheiratet hatte, zudem über ausgezeichnete Kontakte zum französischen Kulturleben.[14] In ihren Erinnerungen erzählt Berta Zuckerkandl vom Besuch des französischen Bildhauers Auguste Rodin in Wien, wo sie ihn mit einigen Künstlerkollegen bekannt machte, darunter dem Maler Gustav Klimt, der zu den ständigen Gästen des Salon Zuckerkandl zählte. Bei einem Ausflug zum Heurigen nach Grinzing machte sich Rodins Begeisterung in geradezu euphorischen Äußerungen Luft, und mündete schließlich in der Frage, was das bloß sei, diese einzigartig intensive und dabei heitere, kunstträchtige Atmosphäre? «Ich übersetzte Rodins Worte. Klimt neigte seinen schönen Petrus-Kopf und sagte nur ein Wort: ‹Österreich!›»[15]
Aus dem geistig anregenden Klima des Salons Zuckerkandl, der so etwas wie die «Herzkammer der Wiener Moderne» darstellte,[16] gingen vielfältige Impulse für das Wechselspiel zwischen Kunst und Wissenschaft hervor, unter anderem eine populärwissenschaftliche Vortragsreihe über «Biologie und Anatomie», gehalten von Professor Emil Zuckerkandl, arrangiert jedoch von Gustav Klimt.[17] Umgekehrt machte Zuckerkandl Gustav Klimt mit Darwins Evolutionstheorie und ihrer Weiterentwicklung in den Theorien des deutschen Biologen Ernst Haeckel bekannt, beides folgenreich für die späten Arbeiten des Malers.[18] Doch nicht nur Innovationen, auch Ehen brachte das gesellige Beisammensein im Hause Zuckerkandl mitunter hervor: Hier lernte der damals schon weltberühmte (und in Wien höchst umstrittene) Direktor der Wiener Hofoper Gustav Mahler die Stieftochter des Malers Carl Moll kennen, Alma mit Namen; eine gefeierte Schönheit, die dann nach der Heirat mit Mahler ihrerseits zu einem Mittelpunkt des Wiener Gesellschaftslebens wurde.
Auch Arthur Schnitzler zählte zu den regelmäßigen Gästen der Zuckerkandls, kannte den Hofrat aus der eigenen Studienzeit und war eng mit dessen jüngerem Bruder Otto befreundet, den er bei gemeinsam besuchten Lehrveranstaltungen im Medizinstudium kennengelernt hatte und der es dann als Urologe zu Professur und internationaler wissenschaftlicher Anerkennung bringen sollte.[19] Schnitzlers Verhältnis zur Hofrätin selbst war mitunter hakelig, obwohl sie im Jahre 1909 sein Drama «Der junge Medardus» ins Französische übersetzt hatte.[20] Voller Bewunderung hingegen stand der Dichter Gustav Mahler und vor allem Gustav Klimt gegenüber, den er wiederholt besuchte und sich dabei mit dem Maler über Quellen und Erfahrungen künstlerischer Produktivität unterhielt.[21] Geteilt wurde diese Bewunderung von Stephanie Bachrach, die Schnitzler von einem Besuch im Atelier des Malers mit «begeisterter Rührung» berichtete.[22] Das Interesse der jugendlichen Bankierstochter für die bildenden Künste galt darüber hinaus in besonderem Maße modernen, vom technischen Fortschritt hervorgebrachten Kunstformen wie dem Kino und zumal der Photographie.[23] Nimmt man hinzu, dass Stephanie Bachrach diese umfassende kulturell-intellektuelle Bildung durch Begeisterung für seinerzeit so modische sportliche Betätigungen wie Hochalpinismus und Tennisspiel ergänzte, so wird verständlich, warum sich die geistsprühende Tochter des aus so bescheidenen Verhältnissen stammenden Julius Bachrach zum Schwarm der Wiener Literatenkreise entwickelte. Ihr schien eine glänzende Zukunft bevorzustehen.
Zu ihren zahlreichen Bewunderern gehörte auch jener Jakob Wassermann, der sie im Frühjahr 1911 mit Arthur Schnitzler bekannt gemacht hatte. Wassermann zählte ebenfalls zur Gruppe der jüdischen Sozialaufsteiger, auch wenn er, anders als Julius Bachrach, aus dem Fränkischen über München in die Donaumetropole gelangt war. Die Hauptstadt eines Reiches von über 50 Millionen Einwohnern bot um die Jahrhundertwende begabten jungen Leuten exzellente Aufstiegsmöglichkeiten. Entsprechend groß war ihre Anziehungskraft, mit der Folge eines rasanten Bevölkerungswachstums. Hatte Wien um 1800 rund 230.000 Einwohner gezählt, so waren daraus 1870 bereits 600.000, am Vorabend des Ersten Weltkriegs über zwei Millionen geworden.[24]
Das daraus resultierende intensive Wettbewerbsklima brachte allerdings auch eine Vielzahl von Verlierern hervor, vor allem aus den Kreisen des Alt-Wiener Handwerks und des Kleinbürgertums, die der doppelten Herausforderung durch industrialisierte Produktionsmethoden und intensivierte Konkurrenz nicht gewachsen waren. Ihr Bedürfnis nach einfachen Erklärungen und einem politischen Sprachrohr erkannte und kultivierte ein Mann, der das Wien der Jahrhundertwende wie kein anderer verkörperte: Dr. Karl Lueger. Als Sohn eines einfachen Unteroffiziers war auch er ein Sozialaufsteiger, Gründer und Führer der Christlichsozialen Partei und von 1897 bis zu seinem Tod 1910 Bürgermeister von Wien. Luegers Erfolgsrezept hat Arthur Schnitzlers Schriftstellerkollege Felix Salten 1909 hellsichtig analysiert und glänzend auf den Punkt gebracht: «Allein er nimmt auch die Verzagtheit von den Wienern. Man hat sie bisher gescholten. Er lobt sie. Man hat Respekt von ihnen verlangt. Er entbindet sie jeglichen Respektes. Man hat ihnen gesagt, nur die Gebildeten sollen regieren. Er zeigt, wie schlecht die Gebildeten das Regieren verstehen. Er, ein Gebildeter, ein Doktor, ein Advokat, zerfetzt die Ärzte, zerreißt die Advokaten, beschimpft die Professoren, verspottet die Wissenschaft; er gibt alles preis, was die Menge einschüchtert und beengt, er schleudert es hin, trampelt darauf herum, und die Schuster, die Schneider, die Kutscher, die Gemüsekrämer, die Budiker jauchzen, rasen, glauben das Zeitalter sei angebrochen, das da verheißen ward mit den Worten: selig sind die Armen im Geiste. Er bestätigt die Wiener Unterschicht in allen ihren Eigenschaften, in ihrer geistigen Bedürfnislosigkeit, in ihrem Mißtrauen gegen Bildung, (…) in ihrer übermütigen Selbstgefälligkeit; und sie rasen, sie rasen vor Wonne, wenn er zu ihnen spricht.»[25]
Nach vergeblichen Versuchen im Rahmen der traditionellen liberalen Partei politische Karriere zu machen, hatte Lueger die Möglichkeiten erkannt, die das seit 1885 auf die sogenannten 5-Gulden-Männer (deren Steuerbeitrag im Jahr lediglich fünf Gulden betrug) ausgedehnte Wahlrecht eröffnete.[26] Der Bankier Rudolf Sieghart, auch er ein jüdischer Sozialaufsteiger, der sich sein Studium mit Nachhilfestunden verdient hatte und es dann als Nachfolger Theodor von Taussigs zum Direktor der Bodencreditbank brachte, urteilte im Rückblick seiner Lebenserinnerungen prägnant: «Das Problem der mit einem Male wahlberechtigten Kleinbürger: Wen sollten sie wählen? Die Sozialisten vertraten die Arbeiter, die Liberalen das arrivierte Bürgertum. Gerade den wirtschaftlich und sozial so arg bedrängten, so dringend nach einem ideologischen Halt in ihrem hoffnungsarmen Abwehrkampf suchenden Kleinhandwerkern und Gewerbetreibenden fehlte ein leicht verständliches Orientierungsangebot. Die Ausweitung des Wahlrechts schuf eine gigantische Versorgungslücke in der Parteienlandschaft. Und in diese Lücke stieß Karl Lueger.»[27]
Die einfachen Leute gierten nach einfachen Antworten. Lueger bot sie ihnen. Und die zweifellos folgenreichste dieser Antworten auf die Frage nach den Gründen für die Misere vieler Wiener Handwerker und Kleinbürger war: Die Juden sind schuld.
Lueger selbst war im Übrigen durchaus kein Antisemit. Der Bankier Alexander von Spitzmüller gestand einmal Lueger seine Verwunderung darüber ein, dass dieser «trotz seiner grundsätzlichen antisemitischen Einstellung in praktischen Fragen des öffentlichen Lebens so gut mit Juden zusammenarbeitete. Der Bürgermeister antwortete mir hierauf mit staunenswerter Offenheit: ‹Ja, wissen S’, der Antisemitismus is a sehr gutes Agitationsmittel, um in der Politik hinaufzukommen; wenn man aber einmal oben ist, kann man ihn nimmer brauchen, denn dös is a Pöbelsport.›»[28] Kaiser Franz Joseph sah den Aufstieg Luegers und seiner Christlichsozialen Partei aufgrund ihrer populistischen Parolen und des daraus resultierenden Verfalls der politischen Umgangskultur mit Unbehagen und verweigerte im Jahre 1896 entgegen den Wahlergebnissen zweimal die Ernennung Luegers zum Wiener Bürgermeister, ehe er sich nach einem dritten Wahlgang dann widerwillig dem Volkswillen beugte.
In den folgenden Jahren arbeitete Lueger, wie selbst seine politischen Gegner immer wieder zugaben,[29] mit nimmermüdem Eifer, großem Geschick und persönlicher Integrität am Ausbau der von ihm geliebten Heimatstadt.[30] Nach seinem Tod gestand ihm der Sozialdemokrat Friedrich Austerlitz in einem Artikel der «Wiener Arbeiterzeitung» am 11. März 1910 große Kraft und leidenschaftlichen Willen zum politischen Erfolg zu, wies aber auch auf die fatalen Folgen von Luegers bedenklich, oder eben: bedenkenlos modernen Methoden hin, indem er «die fruchtbaren Gedanken der Demokratie durch skrupellose Polemik ersetzt. (…) Die Rohheit des Tones, die vor den giftigsten Verleumdungen des Gegners nicht zurückschreckt; ein gehässiger Terrorismus, der aus der politischen Gegnerschaft einen Krieg bis zur völligen Vernichtung machen möchte», sei von Lueger mit «Virtuosität ausgebildet» worden. Und das machte Schule. Unter den vielen Menschen, die damals nach Wien kamen, die mächtig prosperierende Weltstadt bestaunten, aufgrund der großen Konkurrenz und beschränkter eigener Begabung scheiterten, an den Rand der Gesellschaft gespült wurden, sich einen Reim auf dieses Scheitern zu machen versuchten und dabei gebannt die antisemitischen Parolen des Dr. Karl Lueger aufsogen, gehörte auch ein junger Mann namens Adolf Hitler.[31]
Familie Schnitzler
In welchem Maße der von der Christlichsozialen Partei instrumentalisierte Antisemitismus zu dem Zeitpunkt, da Stephanie Bachrach in das Gesichtsfeld Arthur Schnitzlers trat, die gesellschaftliche Atmosphäre Wiens belastet, ja vergiftet hatte, zeigen nicht zuletzt die Reaktionen auf Schnitzlers ersten, 1908 erschienenen, Roman mit dem Titel «Der Weg ins Freie». Die stark autobiographisch getönte Handlung wurde zur stillen Erbitterung des Verfassers in den Kritiken überwiegend als Stellungnahme zur «Judenfrage» interpretiert;[32] was die Bedeutung des Werkes in der Tat verkürzt. Und wenn seine jüdischen Wurzeln für den Agnostiker Schnitzler zeit seines Lebens ein Thema blieben, so nicht aus persönlichen, sondern aus gesellschaftlichen Gründen.
In seiner zu Lebzeiten unveröffentlichten Autobiographie «Jugend in Wien» berichtet Schnitzler von der Herkunft seiner Familie. Der Vater, Johann Schnitzler, war 1835 im ungarischen Groß-Kanisza geboren worden, jener Stadt, in welcher der jugendliche Julius Bachrach seine ersten kaufmännischen Erfolge feierte. Johann Schnitzler wählte jedoch nicht den wirtschaftlichen, sondern den wissenschaftlichen Weg nach oben. Er studierte Medizin, zunächst in Budapest, dann in Wien, spezialisierte sich auf Laryngologie, erwarb sich als Fachmann auf diesem Gebiet internationales Renommee und war Mitbegründer der Wiener «Poliklinik», einer medizinischen Institution, die als «Elisabethinum» im wohl bekanntesten Drama seines Sohnes, «Professor Bernhardi», zu literarischem Ruhm gelangen sollte.
Arthur Schnitzlers Großvater mütterlicherseits, Philipp Markbreiter, entstammte als Nachkomme eines Wiener Hofjuweliers dem Bürgertum. «Doktor der Medizin und Philosophie, war [er] in früheren Jahren ein sehr gesuchter praktischer Arzt gewesen, überdies in seinen Mußestunden ein vortrefflicher Pianist, und hätte es nach Bildung und Begabung in jeder Hinsicht weiter bringen können, wäre er nicht der Leidenschaft des Spiels von Jahr zu Jahr rettungsloser anheimgefallen.»[33] Beide Leidenschaften, diejenige für die Musik allgemein und das Klavier im Besonderen wie auch diejenige für das Glücksspiel, legte auch sein Enkel an den Tag, wie denn überhaupt dessen Verbindungen zur mütterlichen Wiener Verwandtschaft ungleich enger waren als zu derjenigen des Vaters und dessen Heimatort, wo ein «längerer oder gar dauernder Aufenthalt» ihn sich «wie ein Fremder, wenn nicht gar wie ein Verbannter» hätten fühlen lassen.[34]
Aus der Ehe Johann Schnitzlers mit Luise Markbreiter gingen drei Kinder hervor. Der Erstgeborene, Arthur (geb. 1862), trat zunächst in des Vaters Fußstapfen, studierte Medizin, wurde 1885 von der Wiener medizinischen Fakultät promoviert und arbeitete danach als Assistent des Vaters; doch schob sich immer stärker sein eigentliches, das schriftstellerische Interesse in den Vordergrund. Sein jüngerer Bruder Julius, 1865 geboren, absolvierte hingegen die medizinische Karriere mit Bravour und galt später wie der Vater als Koryphäe seines Fachs; schließlich 1867 die Tochter Gisela, die durch ihre Heirat mit Markus Hajek einen weiteren hochambitionierten Mediziner in die Familie brachte. Wie auf Hajeks Werdegang und Verhältnis zu seinem Schwiegervater Johann Schnitzler scheint eine Beobachtung des Schriftstellers Joseph Roth gemünzt, der selber in eine jüdische Gemeinde Galiziens hineingeboren wurde: «Es ist eine oft übersehene Tatsache, daß auch Juden antisemitische Instinkte haben können. Man will nicht durch einen Fremden, der eben aus Lodz gekommen ist, an den eigenen Großvater erinnert werden, der aus Posen oder Kattowitz stammt. Es ist die ignoble, aber verständliche Haltung eines gefährdeten Kleinbürgers, der eben im Begriff ist, die recht steile Leiter zur Terrasse der Großbourgeoisie mit Freiluft und Fernaussicht zu erklimmen. Beim Anblick eines Vetters aus Lodz kann man leicht die Balance verlieren und abstürzen.»[35] Die Gefahr, die Balance zu verlieren, bestand bei Johann Schnitzler nicht so leicht, auch nicht beim Anblick seines Schwiegersohns in spe, aber der fehlende gesellschaftliche Schliff des jungen Mannes, der mit nur einer Generation Verzögerung aus der ungarischen Provinz in die prosperierende Hauptstadt gekommen war, irritierte ihn doch derart, dass er der Heirat seiner Tochter mit dem jungen Hajek trotz dessen unübersehbaren Talents eine Weile energisch widerstrebte.
Die sozialen Aufstiegschancen, welche die Donaumonarchie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bot, führten dazu, dass diejenigen, die diese Chancen zu nutzen verstanden, zu den treuesten Anhängern des österreichischen Staatsgedankens und der ihn repräsentierenden Habsburger-Dynastie zählten. Man interessierte sich demonstrativ nicht für Politik. Friedrich Engel-Jánosi, Nachkomme von Vorfahren, die wie die Schnitzlers und Bachrachs aus der ungarischen Provinz nach Wien gekommen waren, erinnerte sich beim Rückblick auf seine Jugend nicht daran, dass er seinen Vater jemals über Politik sprechen gehört habe. «An ihre Stelle war bei ihm die Loyalität getreten. Wiederholt hörten wir von ihm den Satz: ‹Wenn eine Verordnung verlangte, daß jeder Österreicher schwarzgelbe Strümpfe zu tragen habe, so würde ich noch heute mit schwarzgelben Strümpfen auf die Straße gehen.›»[36] Ganz ähnlich sah die Einstellung im Hause Schnitzler aus, und die Abneigung gegen den politischen Meinungsstreit, gegen Parteiengezänk und Proporz-Schacher stellt eine der zentralen Kontinuitätslinien im Denken und Werk Arthur Schnitzlers dar. In seinem Roman «Der Weg ins Freie» lässt er einen der Protagonisten nach einem Ausflug in die politische Betätigung angewidert feststellen: «Ich kehre zur Bakteriologie zurück. Es ist eine reinlichere Beschäftigung als die Politik.»[37] Bereits zehn Jahre vor dem Erscheinen des Romans hatte Schnitzler in seinem Tagebuch notiert: «Ich werde mir nie die Politik einreden lassen. Sie ist das niedrigste und hat mit dem Wesen des Menschen am wenigsten zu tun. (…) Gerade was sie uns einreden will, dass sie für die Massen wichtig ist, ist falsch (…). Wofür ich mich interessire, fängt jenseits dieser Dinge an. Wenn der politische Schwindel überflüssig und die Menschheit nicht mehr hungrig ist, wird man sich ausschließlich dafür interessiren – aber dafür – solange die Welt steht: ‹Kunst›.»[38] Die Kunst als Ersatzreligion des bürgerlichen Zeitalters – das ist natürlich reiner Nietzsche, über den Schnitzler im Tagebuch einmal fast vergötternd vermerkte: «Nietzsche! Bei keinem hab ich noch so tief empfunden, daß es etwas gibt, was ich nicht werden kann.»[39] Wie es angesichts seines ausgeprägten Kunstinteresses nicht ausbleiben konnte, wurde Italien schon früh zum bevorzugten Reiseziel Arthur Schnitzlers und blieb es zeit seines Lebens.
Durch seine Begeisterung für künstlerische Produktivität als Lebenssinn geriet der junge Mann in Konflikt mit dem Vater. Gewiss nicht politische Meinung, aber auch nicht unsolide Schöngeisterei, sondern allein fachlich-sachliches Können machen die Persönlichkeit aus, so ließe sich die Sicht der Dinge im Hause Schnitzler zusammenfassen. Aus dem ausgeprägten Leistungsethos, das Johann Schnitzler seinen Kindern vorlebte und dafür ihren tiefen Respekt erntete, resultierten für seinen ältesten Sohn verstörende Probleme. Denn die traditionelle, scheinbar vorgeschriebene Karriere in den Bahnen, die der Vater eingeschlagen und so glücklich verfolgt hatte, befriedigte ihn nicht. Zwar absolvierte er das Medizinstudium erfolgreich, leistete 1885 seinen Militärdienst im Wiener Garnisonsspital und erwarb den Rang eines Oberarztes der Reserve, aber sein eigentliches Interesse galt nun einmal der Literatur. Erste eigene schriftstellerische Versuche riefen jedoch beim Vater nicht nur keine Begeisterung hervor, sondern wurden als unsolide Hungerleider-Phantasien missbilligt und letztlich als Versuch gedeutet, sich den kategorischen Forderungen des bürgerlichen Leistungsethos zu entziehen.
Dieses Spannungsverhältnis zu seinem familiären Umfeld hat Arthur Schnitzler sein Leben lang belastet und angespornt. Nach dem Tod des Vaters am 2. Mai 1893 übertrug sich die Konfliktkonstellation auf den medizinisch erfolgreichen, glänzend situierten und gesellschaftlich anerkannten Bruder Julius. In einer seiner psychologisch komplexesten, wenn auch nicht künstlerisch gelungensten Erzählungen, «Flucht in die Finsternis», hat er die Beziehung des hypochondrisch sensiblen Künstlers zu seinem bürgerlich-soignierten Bruder mit all ihren pathologischen Reflexen und einem tragischen Ausgang – der Protagonist tötet im Wahn erst den Bruder, dann sich selbst – verarbeitet.
Als er diese Novelle 1917 schrieb, hatte Schnitzler einen langen und steinigen Weg zu Anerkennung, gar Ruhm hinter sich, wie seine Tagebucheinträge erkennen lassen. Immer wieder finden sich dort Verzweiflungsausbrüche wie derjenige vom 6. Mai 1888. Damals hatte der knapp Sechsundzwanzigjährige notiert: «Aus mir wird nichts! Ich bin muthlos, energielos, ohne Initiative und wahrscheinlich schließlich auch ohne das wahre Talent.» Das gespannte Verhältnis zum bürgerlichen Lebensumfeld mit seiner demonstrativen Tüchtigkeit und Pflichterfüllung wurde noch verstärkt durch die zahlreichen Affären des jugendlichen Arthur Schnitzler, seine Unwilligkeit oder Unfähigkeit sich dauerhaft zu binden und wenigstens in dieser Hinsicht den bürgerlichen Ordnungssinn zu befriedigen.
Erst die Beziehung zu Olga Gussmann, die er im Sommer 1899 kennengelernt hatte, erwies sich als dauerhaft, zumal aus ihr 1902 ein Sohn, Heinrich, hervorging. Zwar blieben die Bindungsängste, wie ein beinahe psychoanalytischer Tagebucheintrag am 19. Februar 1902 offenbart: «Mein ganzer tiefer Egoismus widerstrebt der Nöthigung, Opfer zu bringen, sich Opfer aufzuerlegen; und meine Sentimentalität bringt mich in Lebensverhältnisse, wo dies alles nothwendig wird. Auch hier Disharmonie, der Kampf zwischen direct entgegengesetzten Lebensanschauungen, der mein Wesen charakterisirt und mich zu einer ewigen inneren Unruhe verdammt. Revolutionär ohne Muth, Abenteuerlustiger ohne die Fähigkeit, Unbequemlichkeit zu ertragen – Egoist ohne Rücksichtslosigkeit – und endlich ein Künstler ohne Fleiss – ein Selbsterkenner ohne Tendenz zur Besserung – ein Verächter des allgemeinen Urtheils mit der kleinlichsten Empfindlichkeit – so einer ist dazu geboren, alles zu bereuen, was er angefangen – denn er setzt nie sich selber ein, und es gibt kein Glücksgefühl ohne diese Entschlossenheit.» Dennoch rang sich Schnitzler schließlich die Einwilligung in die Ehe ab, die am 26. August 1903 geschlossen wurde. Es folgten vergleichsweise ruhige Jahre, in denen 1909 die Tochter Lilly zur Welt kam.
Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Arthur Schnitzler unter den führenden Schriftstellern seiner Zeit etabliert.[40] Seine Dramen wurden auf allen Bühnen des deutschen Sprachraums gespielt, seine Erzählungen erwiesen sich durchweg als buchhändlerische Erfolge. Schnitzlers Bücher erschienen in jenem Verlag, den Samuel Fischer 1886 in Berlin gegründet und in der Folgezeit zum womöglich angesehensten Literaturverlag der Epoche gemacht hatte. Zu den Autoren des Fischer-Verlags zählten Gerhart Hauptmann, Hermann Hesse und Thomas Mann. 1908 hatte Schnitzler den begehrten Grillparzer-Preis erhalten. Im selben Jahr war sein erster Roman «Der Weg ins Freie» zunächst als Fortsetzungsgeschichte in Fischers «Neuer Rundschau», kurz darauf dann als Buch erschienen.
Schnitzler litt zwar darunter, dass seine Arbeiten von einer oberflächlich-unsensiblen und mehr noch von der antisemitisch-hasserfüllten Kritik als amoralisch, leichtfertig und letztlich belanglos verunglimpft wurden und äußerte nach den Rezensionen zur Uraufführung seines Dramas «Fink und Fliederbusch» im Dezember 1917 den Verdacht: «Daß ich – schon durch das ewige Gekläff des Antisemitengesindels – seit der Erfindung der Buchdruckerkunst, der am meisten beschimpfte Dichter deutscher Sprache bin, halte ich für zweifellos.»[41] Der Mediziner Emil Zuckerkandl versuchte die komplexen Hintergründe dieses Sachverhalts zu fassen: «Ich kannte Schnitzler schon, als er ein ganz junger Arzt war. Jedes laute Hervortreten, jede Polemik ist ihm ein Greuel, und doch gibt es kaum einen Künstler, der so verfolgt wird, von dessen Affären soviel die Rede ist. Es scheint, als ob er von Anfang an das Klein- und Großbürgertum besonders gereizt hätte. (…) Schnitzler teilt die Tragik, die uns alle mehr oder weniger betrifft. Er liebt seine Heimat fanatisch und weiß doch, daß sie Gefahr läuft, an ihrer Lässigkeit, Unklarheit und Schwäche zugrunde zu gehen.»[42]
Auf der anderen Seite standen jedoch die Anerkennung und das wachsende Interesse für einen Schriftsteller, der wie kaum ein anderer ein sensibles Gespür entwickelt hatte für die psychologischen Abgründe und moralischen Widersprüche einer Gesellschaft, der unter dem Eindruck rasanter technischer und wissenschaftlicher Innovationen die überkommenen Normensysteme abhanden kamen. Als der junge Münchener Romanist Victor Klemperer im Jahre 1910 an einem Essay über die wichtigsten Vertreter der jüdischen Wiener Literatur arbeitete, besuchte er auch Schnitzler und zeigte sich beindruckt von einem Mann, «dem alle fanatische Enge fehlte. Im ersten Augenblick freilich störte mich sein Aussehen. In all seinen Werken ein gütiger Skeptiker, auf allen Bildern ein schlanker Weltmann, hatte er faktisch die Physiognomie eines brutalen, wahrscheinlich zum Jähzorn neigenden Menschen: Die blaugrünen Augen blickten kalt, die Stirn unter dem zum Scheitel verklebten rötlichen Haar schien niedrig, der rötliche Vollbart und die untersetzte Gestalt gaben ihm eine plumpe Gedrungenheit. Seltsamerweise waren es gerade die abweisend kühlen Empfangsworte, die mich für ihn einnahmen. ‹Weshalb wollen Sie zu mir?› fragte er.» Ob auch er, Klemperer, in ihm lediglich den «Dichter der süßen Mädel» und der leichten Wiener Erotik sähe? «Als ich ihm wahrheitsgetreu antwortete, daß ich hinter all seiner Erotik immer das Ringen mit dem Todesgedanken spürte, war er gewonnen. Er ging stark aus sich heraus, und jener erste Eindruck der Härte oder gar Brutalität schwand vollkommen. Er erzählte von einer Änderung in seiner Schaffensart. Anfangs sei er von Problemstellungen ausgegangen. Was geschieht in dem oder jenem Fall? Jetzt seien ihm Charaktere Beginn und Mittelpunkt jeder dichterischen Arbeit.»[43]
Im Frühjahr 1910 hatte Arthur Schnitzler die Villa in der Sternwartestraße 71 für die beträchtliche Summe von 95.000 Kronen gekauft. Im Sommer desselben Jahres zog er mit seiner Frau Olga und den Kindern Heinrich (Heini) und Lilly dort ein. In den folgenden Jahren entwickelte sich das Haus zu einem gesellschaftlichen Mittelpunkt der Wiener Künstler- und Intellektuellenkreise.
Victor Klemperer besuchte seinen Interviewpartner in dessen Haus in der Sternwartestraße 71, das die Schnitzlers im Juli 1910 bezogen hatten.[44] Es lag im sogenannten «Cottage-Viertel» im XIX. Wiener Bezirk, einer erst vor kurzem entstandenen Neubau-Siedlung exklusiven Charakters, deren Bewohner durchweg dem arrivierten Bürgertum angehörten. In Schnitzlers unmittelbarer Nachbarschaft wohnte unter anderem der renommierte Graphiker und Fotograf Professor Ferdinand Schmutzer, die prächtige Villa des Bankiers Julius Bachrach in der Hasenauerstraße lag ebenfalls nur einen Steinwurf entfernt. Im Cottage-Viertel lebte schließlich auch ein Mann, der in diesen Jahren die wohl folgenreichste medizinisch-wissenschaftliche Revolution des 20. Jahrhunderts vorbereitete: Sigmund Freud. Aus Gründen, über die er später in einem Brief an Arthur Schnitzler sich selbst und dem Adressaten Rechenschaft ablegte, zählte er nicht zu den Besuchern des an sich so gastfreien Hauses in der Sternwartestraße. Aus Anlass von Schnitzlers 60. Geburtstag schrieb der Begründer der Psychoanalyse im Mai 1922 seinem Nachbarn: «Ich will Ihnen (…) ein Geständnis ablegen, welches Sie gütigst aus Rücksicht auf mich für sich behalten (…) wollen. Ich habe mich mit der Frage gequält, warum ich eigentlich in all diesen Jahren nie den Versuch gemacht habe, Ihren Verkehr aufzusuchen. (…) Ich meine, ich habe Sie gemieden aus einer Art Doppelgängerscheu. Ihr Determinismus wie Ihre Skepsis (…), Ihr Ergriffensein von den Wahrheiten des Unterbewußten, von der Triebnatur des Menschen (…) das Haften Ihrer Gedanken an der Polarität von Lieben und Sterben, das alles berührte mich mit einer unheimlichen Vertrautheit. (…) So habe ich den Eindruck gewonnen, daß Sie durch Ihre Intuition – eigentlich aber infolge feinster Selbstwahrnehmung – alles das wissen, was ich in mühseliger Arbeit an anderen Menschen aufgedeckt habe. Ja, ich glaube, im Grund ihres Wesens sind sie ein psychologischer Tiefenforscher.»[45]
Während Freud den Kontakt mit Schnitzler mied, sah man die mit dem Dichter und seiner Frau befreundeten führenden Schriftsteller Wiens regelmäßig in der Sternwartestraße ein und aus gehen. Und eben, nach der ersten Begegnung im März 1911 mit rasch zunehmender Häufigkeit, das witzig-charmante Fräulein Bachrach. Über die Atmosphäre der dortigen Abendgesellschaften berichtete Berta Zuckerkandl in ihren Erinnerungen: «Oft lud Schnitzler die Intimen ein, sein neues Werk kennenzulernen. Eine sehr reizende junge Frau pflegte aber regelmäßig während der Lektüre einzuschlafen. Einmal jedoch geschah es, daß sie wach blieb. Triumphierend ruft Schnitzler: ‹Heute sind sie einmal nicht eingeschlafen!› – ‹Ja›, antwortete sie, ‹ich habe so starke Zahnschmerzen, daß ich nicht schlafen konnte.› Niemand lachte so stürmisch wie Schnitzler.»[46] Wir werden gleich sehen, warum es sich bei dieser jungen Frau kaum um Stephanie Bachrach gehandelt haben dürfte.
Die lieben Kollegen
Am 14. Oktober 1911 wurde Schnitzlers Drama «Das weite Land» an neun deutschsprachigen Bühnen gleichzeitig uraufgeführt – ein einzigartiger Triumph. Der Autor zeigte sich mit Inszenierung und Erfolg der Wiener Burgtheaterpremiere zufrieden und vermerkte im Tagebuch: «Die Reaktionen des Publikums: 1. Akt zuwartend, 2. mäßig, eher gut, 3. fast etwas steigend, 4. schlug mächtig ein, 5. wirkte tief. Nach Hause im Auto (…). Bei uns Buffet. Es kamen Julius, Helene, Frau Bachrach mit Mimi und Steffi, Wassermanns, Kaufmann und Schwester, Richard und Paula [Beer-Hofmann], Schmidts, Saltens; Max Leitner (Bruder der Frau B[achrach]). (…) Man blieb bis nach eins.»
Die kleine Premierenfeier vereinte fast all jene Wiener Schriftsteller-Kollegen, die Schnitzler als ranggleich akzeptierte, seit er mit ihnen zwei Jahrzehnte zuvor, am Beginn der 1890er Jahre, als Stammgäste des Café Griensteidl (berühmt geworden als «Café Größenwahn») den Kreis jener überaus ambitionierten Nachwuchsschriftsteller gebildet hatte, der dann schon bald als «Jung-Wien» Literaturgeschichte schreiben sollte: Felix Salten, Richard Beer-Hofmann, Jakob Wassermann. Nur der jüngste und zum Zeitpunkt der Premierenfeier vielleicht renommierteste unter ihnen fehlte: Hugo von Hofmannsthal. Dass Stephanie Bachrach, deren Bekanntschaft Schnitzler ja gerade einmal ein halbes Jahr zuvor gemacht hatte, bei dieser Feier in kleinem Kreis nebst Mutter, Schwester und Onkel präsent war, bestätigt, was auch andere Tagebucheinträge verraten: dass sie sehr schnell zu einer wichtigen Bezugsperson des Dichters avanciert war. Schon im Juni hatte sie «Das weite Land» gelesen,[47] und am 17. November, einen Monat nach der Uraufführung, notierte Schnitzler: «Stephi vor Tisch, etwas stolz, daß man sie als Erna gut getroffen findet. (Das Stück war längst fertig, als wir sie kennen lernten.)»
Erna ist die heimliche Hauptfigur des Dramas (Schnitzlers Schwägerin Helene hielt sie für ein «Miststück»). In einer Welt, deren brüchige Werte und Konventionen sie scharf durchschaut und geistreich bespöttelt, sucht sie, Nietzsches Lebensphilosophie folgend, dem Dasein Sinn durch die Intensität des Abenteuers zu verleihen. Ihrem Verehrer, dem braven Doktor Mauer, hält sie auf dessen Lob der Sicherheit entgegen: «Nur weiß ich nicht recht, ob dieses Gefühl der Sicherheit etwas so besonders Wünschenswertes bedeutet. Wenigstens für mich. Wenn ich ganz aufrichtig sein soll, Doktor Mauer, mir ist manchmal, als hätt’ ich vom Dasein auch noch anderes zu erwarten oder zu fordern als Sicherheit – und Frieden. Besseres oder Schlimmeres – ich weiß nicht recht.»[48] Und nach der Rückkehr von einer lebensgefährlichen Bergtour schwärmt sie im dritten Akt des Dramas gegenüber dem Direktor des Hotels am Völser Weiher, wo die Szene spielt:
«Erna: Es war die schönste Stunde, Herr von Aigner, die ich je erlebt habe.