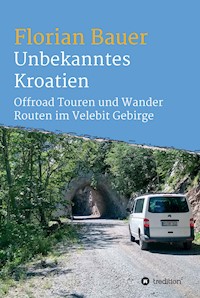21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Alle Unternehmen wollen die Kaufentscheidungen von Kunden zu ihren Gunsten beeinflussen. Umso erstaunlicher ist es, dass dem konkreten Ablauf des Entscheidungsprozesses beim Kunden, dem Kaufakt selbst, kaum Aufmerksamkeit geschenkt wird – meist wird einfach ein rationaler Konsument unterstellt. Die Ergebnisse der Behavioural Economics zeigen jedoch völlig unzweifelhaft , dass Menschen nicht vernünftig entscheiden. Es wird Zeit, dass diese Erkenntnisse in den Unternehmen profitabel angewendet werden. Die Autoren verdeutlichen hier anschaulich, wie die Erkenntnisse der Behavioural Economics auf Unternehmen übertragen werden können. Sie entwickeln ein psychologisches Modell der Kaufentscheidung, das auch unvernünftiges menschliches Verhalten umfasst und damit vorhersagbar macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
[email protected]
3. Auflage 2021
© 2014 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Türkenstraße 89 80799 München Tel.: 089 651285-0 Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Desirée Šimeg, Stadtbergen
Umschlaggestaltung: Maria Wittek, unter Verwendung von iStockphoto.com
Satz und E-Book: Grafikstudio Foerster, Belgern
ISBN Print 978-3-86881-524-5
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86414-624-4
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86414-625-1
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Inhalt
Titel
Impressum
Inhalt
1. Klassische Entscheidungsforschung und der Homo oeconomicus
1.1 Der Homo oeconomicus als Leitbild im Unternehmen
Über Sinn und Unsinn des Homo oeconomicus
Die Mythen des rationalen Entscheidens
1.2 Der Homo oeconomicus als Leitbild der Forschung
Der Geburtsfehler der Entscheidungsforschung
Die Fragmentierung des Kunden in der Forschung
2. Behavioral Economics im Unternehmen
2.1 Wichtige Erkenntnisse der Behavioral Economics
Motivationale Effekte
Kognitive Effekte
Verhaltensbezogene Effekte
Über die allgemeine Unlust, Entscheidungen zu treffen
Das »Meta-Modell«: System 1 und System 2
2.2 Systematische Übertragung von Behavioral Economics auf Unternehmen
Direkte Übertragung: Der Glücksritter-Ansatz
Abstrahierende Übertragung: Die Psycho-Logik von Entscheidungen
Extrahierende Übertragung: Das empirische Forschungsmodell
3. Der Weg zu einem psychologischen Modell der Kaufentscheidung
3.1 Die Toolbox im Überblick
3.2 Prozessperspektive: Die Module der Toolbox
Image
Motivation
Interesse
Wissen
Bewertung
Kaufverhalten
3.3 Segment-Perspektive: Die GRIPS-Typologie
Der Schnäppchenjäger
Der Verlustaversive
Der Preisbereite
Der Gewohnheitskäufer
Der Gleichgültige
Einordnung und Benchmarks zur GRIPS-Typologie
3.4 Exkurs: Kaufentscheidungen im B2B-Bereich
4. Die konkrete Umsetzung im Unternehmen
4.1 Praxisbeispiel Preis: Paradoxe Preisgestaltung
Preisvergleich: Nutzen oder Schaden für den Reiseanbieter?
GRIPS-Typen und ihre Preismotive
Der Reisepreisvergleich und seine Folgen
4.2 Praxisbeispiel Preis: Preisgestaltung bei Abonnements
Der Leser aus Verlagssicht
Wie verhalten sich Leser bei der Kaufentscheidung?
Experimentelles Design: Marktforschung rückwärts
Prognose: Mögliches Verhalten der Leser nach einer Preiserhöhung
Entscheidungsfindung im Verlag
Unsere Empfehlung: Preiserhöhung statt Preissenkung!
4.3 Praxisbeispiel Produkt: Angebotsoptimierung
Kunden denken nicht wie Suchmaschinen
MOPS – die motivorientierte persönliche Suche
4.4 Praxisbeispiel Marke: ROI-Optimierung des Marketingmix
Entscheidungsprozess für einen Mobilfunkanbieter aus Kundensicht
Anforderungen an Methode und Design des Tools
Was beeinflusst die Entscheidung für den Anbieterwechsel?
4.5 Praxisbeispiel Marke: Markenrepositionierung
Konzentration auf die tatsächlichen Kundenbedürfnisse mit GRIPS
Veränderte Kundenansprache in der Werbung
4.6 Praxisbeispiel Vertrieb: GRIPS-Typen im Callcenter und im Shop
Workshop: Kundengespräche mit GRIPS
Sinnvoller Einsatz von Gutschriften im Kundengespräch
Auch Mitarbeiter sind GRIPS-Typen
Danksagung
Über die Autoren
Literaturverzeichnis
1. Klassische Entscheidungsforschung und der Homo oeconomicus
Die Kaufentscheidung von Kunden ist der Dreh- und Angelpunkt unternehmerischen Handelns. Interessant ist dabei vor allem, wie die Kaufentscheidung real abläuft – und nicht wie man sich den Ablauf idealisiert vorstellen kann. In erster Anerkennung der tatsächlichen Komplexität alltäglicher Kaufentscheidungen wurde vor einigen Jahren der Begriff der »Aufmerksamkeitsökonomie« geprägt, wonach Unternehmen in erster Linie um die Aufmerksamkeit ihrer Kunden in einer zunehmend informationsüberfluteten Umwelt kämpfen müssen. Das ist sicher richtig, greift aber durch diesen exklusiven Fokus auf einen Aspekt zu kurz – denn Aufmerksamkeit allein bringt keinen Umsatz. Sie ist bestenfalls eine notwendige Bedingung dafür.
Unternehmen müssen ihr Handeln als kontinuierlichen Versuch verstehen, nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern vielmehr das Entscheidungsverhalten ihrer Kunden in ihrem Sinne zu beeinflussen. Die Kaufentscheidung der Kunden steht also im Zentrum jeder Marketingstrategie. Insofern sollten wir eher von einer Entscheidungsökonomie reden, denn schließlich überlebt jedes Unternehmen nur deshalb, weil sich eine hinreichend große Anzahl von Personen für den Kauf eines seiner Produkte entscheidet. Die Mechanismen dieser Entscheidungsökonomie zu erklären und sie zu differenzieren von den häufig in Unternehmen vorherrschenden idealtypischen Vorstellungen über den Ablauf realer Kaufentscheidungen, ist Ziel dieses Buchs.
Die meisten Unternehmen wissen nur sehr wenig über die konkreten Inhalte und den realen Ablauf des Kaufentscheidungsprozesses ihrer Kunden. Oftmals wissen sie weder wie lange er dauert noch welche Kriterien zu welchem Zeitpunkt die wichtigste Rolle spielen. In den allermeisten Fällen wird dabei auch übersehen, dass Entscheidungen oft von mehr als einer Person oder mit verteilten Rollen (Entscheider, Bezahler, Nutzer et cetera) getroffen werden. Vom ursprünglichen »Trigger« über den »Entscheidungsfunnel« bis hin zur eigentlichen Abwägung verschiedener Kriterien ersetzen plausibel erscheinende Annahmen häufig empirisch fundiertes Wissen. Und allzu oft wird die Dynamik einer Entscheidung – sei es eine individuelle oder eine Gruppenentscheidung – sträflich ignoriert. So gehen die meisten Unternehmen wie selbstverständlich davon aus, dass Preissenkungen oder Rabatte zu einem höheren Umsatz führen. Oder sie unterstellen regelmäßig, dass ein Produkt mit mehr Produkt-Features einem Produkt mit weniger Features bei gleichem Preis überlegen ist – obwohl oft genau das Gegenteil der Fall ist. Sie nehmen implizit an, dass der Kunde die Produktpreise der Konkurrenz im Blick hat und dass diese für seine Kaufentscheidung relevant sind. Dieser interne Tunnelblick auf den Preis als primäres Differenzierungsmerkmal wird selten hinterfragt, obwohl er die Rolle des Preises im Entscheidungsprozess des Kunden oft genug völlig unangemessen widerspiegelt.
Wie kann das sein? Man sollte meinen, dass auf Unternehmensseite sehr viel Zeit und Energie investiert wird, um den Entscheidungsprozess des Kunden und die jeweiligen Einflussfaktoren bei jedem Schritt im Detail zu verstehen und diesen dann entsprechend besser beeinflussen zu können. Das ist jedoch nicht der Fall. Dafür gibt es im Kern zwei Gründe:
1.Projektion der eigenen Expertise auf den Kunden. Die meisten Entscheider im Unternehmen gehen davon aus, dass sie den Entscheidungsprozess ihrer Kunden intuitiv gut genug kennen. Hinterfragt man das, stellt man fest, dass sich viele Entscheider den Kunden als sehr rational vorstellen; als jemanden, der die Anbieter, Produkte und Preise so gut kennt wie sie selbst. Sie stellen sich ihre Kunden also als Homo oeconomicus vor und zwar häufig ohne dass ihnen diese Annahme selbst bewusst ist. Im Gegenteil, spricht man mit genau diesen Entscheidern über ihr eigenes Kaufverhalten in anderen Branchen, geben sie bereitwillig zu, wie schlecht sie informiert seien und wie unvernünftig viele ihrer Kaufentscheidungen seien. Diese Unvernunft gestehen sie ihren eigenen Kunden jedoch nicht zu. Das ist schade, denn hinter diesen vorhersagbar suboptimalen Kaufentscheidungen schlummern ungeahnte Potenziale – doch um sie zu erkennen, muss man sich vom Homo oeconomicus verabschieden. Dies trifft übrigens nicht nur auf die individuell handelnden Personen im Unternehmen zu, sondern diese allzu rationalistische Perspektive auf den Kunden beschreibt ein Problem, das für die Sichtweise der Kunden durch Unternehmen insgesamt gilt.2.Rationalistische Forschungsmethoden. Wenn man intern den eigenen Annahmen nicht mehr glaubt oder unsicher ist, welche Präferenzen Kunden beispielsweise bezüglich eines neuen Produkts haben, wird die Marktforschung bemüht. Eigentlich eine vernünftige Idee, sollte man meinen, aber in der Tat gerät man damit häufig vom Regen in die Traufe: Die empirischen Entscheidungsforschungsmethoden sind nämlich exakt dem gleichen Kundenbild verschrieben wie der interne Entscheider und das Marketing allgemein. Sie analysieren Entscheidungsverhalten unter der Annahme, dass Kunden immer bewusst, bestens informiert und rational entscheiden. Sie unterstellen in der Art der Befragung und in ihrer Analyse perfekt informierte Kunden mit stabilen Präferenzen, ganz so wie man es von einem Homo oeconomicus erwarten würde. Wenn Methoden aber blind gegen reales Entscheidungsverhalten sind, werden in den Ergebnissen zwangsläufig wertvolle Potenziale übersehen und das rationale Bild vom Kunden, das per se vorherrscht, wird auch durch empirische Ergebnisse nicht korrigiert, weil die zugrunde liegenden Methoden ebenfalls vom Homo oeconomicus infiziert sind. Die empirische Forschung verliert so ihre dringend notwendige Funktion eines Korrektivs.1.1 Der Homo oeconomicus als Leitbild im Unternehmen
Über Sinn und Unsinn des Homo oeconomicus
Hinter dem Unverständnis für real ablaufende Entscheidungsprozesse steckt also das Phantom des Homo oeconomicus. Der Glaube an ihn verstellt den Blick auf den echten Kunden. In diesem Sinne steckt hinter vielen desaströsen Preiskriegen nicht der Kunde, sondern vielmehr dieses Phantom, das viele Entscheider im Hinterkopf haben, wenn sie strategische Entscheidungen treffen.
Die Plausibilität dieses Kundenbilds ist der Grund dafür, dass es hartnäckig jeden Gegenbeweis überdauert. Denn die empirische Forschung hat mittlerweile tausendfach bewiesen, dass diese Vorstellung falsch ist. So können beispielsweise Produkte mit weniger Funktionen attraktiver wirken als Produkte, die mehr bieten oder einen größeren Nutzen versprechen. Dies widerspricht dem Entscheidungsverhalten eines Homo oeconomicus, der möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld erhalten möchte. Im Extremfall verhalten sich reale Kunden sogar völlig gegensätzlich: Sie bewerten manchmal ein Produkt, das »zu gut« ausgestattet ist, als zu teuer – obwohl es das im Vergleich zur Konkurrenz vielleicht gar nicht ist. Das liegt daran, dass sie hier leicht das Gefühl haben, für Leistungen bezahlen zu müssen, die sie gar nicht benötigen. Ein Produkt mit »weniger drin« kann sich also trotz ähnlich hohem Preis besser verkaufen, als eines mit mehr Leistung.
Der Grund hierfür ist, dass Menschen eine Kaufentscheidung nicht mit Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis bewerten, wie es vielleicht rational wäre, sondern mit Blick auf das Preis-Nutzungs-Verhältnis. Eine Kaufentscheidung ist also dann richtig, wenn man möglichst viel dessen, was man bezahlt hat, auch nutzt. In diesem Fall ist »mehr« nicht automatisch besser, sondern das punktgenaue Treffen der Bedürfnisse ist entscheidend.
Was die Annahme des Homo oeconomicus so gefährlich macht, ist, dass sie in der Regel nicht ausgesprochen wird. Den meisten Entscheidern im Unternehmen ist gar nicht bewusst, dass sie eine Produkt-, Marketing- oder Vertriebsentscheidung auf Basis dieser Annahme getroffen haben. Daher wird diese auch nicht hinterfragt oder gar empirisch analysiert. Und wenn doch, dann tappen die meisten Forschungsinstrumente in die gleiche Annahmenfalle (siehe Kapitel 1.2).
Das Tückische ist, dass die Annahme des Homo oeconomicus bei manchen Produkten auf einen Teil der Kunden tatsächlich zutrifft und die Entscheider im Unternehmen dadurch unbewusst in ihren Vermutungen bestätigt werden. Oder noch schlimmer: Man kann Kunden teilweise sogar zu rationalen Entscheidern »erziehen«. Denn wenn Anbieter Rabatte säen, werden sie irgendwann Schnäppchenjäger ernten – und zwar mit all den negativen Konsequenzen, die damit einhergehen, dass Kunden sich nur noch am Preis orientieren. Nicht selten beschweren sich die Unternehmen dann über das Verhalten ihrer Kunden, obwohl sie es zum Teil selbst provoziert haben. Nicht selten werden zum Beispiel Autokäufern proaktiv Rabatte angeboten, ohne dass sie selbst danach gefragt hätten. Was löst ein derartiges Verkäuferverhalten beim Kunden aus? Es macht auch dem letzten Kunden klar, dass er über den Tisch gezogen wird, wenn er ein Auto ohne Rabattverhandlung einfach zum Listenpreis kauft. Es kann kaum den Kunden angelastet werden, wenn die Intensität der Rabattverhandlungen daraufhin zunimmt.
Das ganze Dilemma nimmt weiter Fahrt auf, wenn man sich vergegenwärtigt, dass über 80 Prozent der Vertriebsmitarbeiter in Märkten mit intensivem Preiskampf der Meinung sind, dass die Konkurrenten mit dem Preiskampf angefangen hätten und man selbst sei eben dann gezwungen gewesen, darauf zu reagieren. Dieses Ergebnis ist etwa so logisch wie das empirische Ergebnis, dass 93 Prozent aller Autofahrer der Meinung sind, sie würden besser fahren als der Durchschnitt aller Autofahrer (Svenson 1981). Im weiteren Verlauf werden wir mit dem österreichischen Mobilfunkmarkt und dem Berliner Zeitungsmarkt zwei Märkte analysieren, die zeigen, wie zerstörerisch solche Effekte mittelfristig sein können.
Die Annahme, Kunden würden sich wie ein Homo oeconomicus verhalten, ist also manchmal richtig, oft aber auch nur eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Vor allem die empirische Entscheidungsforschung der letzten Jahrzehnte hat immer wieder gezeigt, dass in sehr vielen Branchen der überwiegende Anteil der Kunden systematisch anders entscheidet als ein rationaler Entscheider. Bevor wir auf diese Ergebnisse und die vorhersagbare Systematik dieses suboptimalen Entscheidungsverhaltens eingehen und aufzeigen, wie sich diese Erkenntnis in der Unternehmensführung und im strategischen Marketing konkret nutzen lässt, werden wir zunächst das Entscheidungsmodell des Homo oeconomicus näher betrachten, um darauf aufbauend die Unterschiede zum realen Entscheidungsverhalten klarer herausarbeiten zu können.
Die Mythen des rationalen Entscheidens
Mr. Spock wäre ein hervorragender Homo oeconomicus
Mythos 1: Vollständige Information
Der Homo oeconomicus verfügt über vollständige Marktinformationen.
Mythos 2: Nutzenmaximierung
Der Homo oeconomicus vergleicht auf Basis stabiler Präferenzen den Nutzen verfügbarer Optionen und trifft so eine rein rationale, emotionslose und ausschließlich eigennützige Entscheidung.
Mythos 3: Minimaler Mitteleinsatz
Der Homo oeconomicus will sein Ziel mit minimalem Aufwand erreichen.
Das von vielen Entscheidern dem Kunden implizit unterstellte Entscheidungsmuster des Homo oeconomicus ist ein vereinfachtes Menschenbild, das davon ausgeht, dass der Mensch stets überlegt handelt. Ein bestimmtes Ziel soll mit minimalem Aufwand erreicht werden beziehungsweise bei vorgegebenem Aufwand soll ein möglichst attraktives Ziel erreicht werden (minimaler Mitteleinsatz). Der Homo oeconomicus ist durch das Streben nach größtmöglichem Nutzen (Nutzenmaximierung), die vollständige Kenntnis seiner wirtschaftlichen Entscheidungsmöglichkeiten und deren Folgen sowie die vollkommene Information über alle Märkte und Eigenschaften sämtlicher Güter (vollständige Markttransparenz) charakterisiert. Dieser modellhafte und idealtypische Entscheider handelt stets absolut rational und kennt dabei kein Zögern oder Zaudern, keine Unsicherheit oder wechselhafte Stimmungen. Der Homo oeconomicus kennt den Wert jeder existenten Option genau und trifft seine Entscheidung auf Basis eines Nutzenvergleichs vor dem Hintergrund völlig stabiler Präferenzen. Dabei optimiert er ausschließlich seinen eigenen Nutzen.
Im Kern wird der Homo oeconomicus also durch diese Grundannahmen beschrieben, auf die wir nachfolgend genauer eingehen wollen. Dabei wird deutlich werden, dass das Modell des Homo oeconomicus als Grundannahme für bestimmte volkswirtschaftliche Modelle sinnvoll sein mag, insbesondere wenn es um die Modellierung optimaler Märkte geht. Zur Beschreibung des individuellen Entscheidungsprozesses realer Kunden ist es jedoch völlig ungeeignet.
Mythos 1: Vollständige Information
Mit der Annahme der vollständigen Information wird unterstellt, dass der Kunde zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung lückenlose Informationen über sämtliche Entscheidungsalternativen und deren Konsequenzen und somit vollständige Markttransparenz hat. Wie er diese vollständige Information im realen Leben erlangen soll, bleibt jedoch offen. Gerade in der heutigen Zeit mit einer zum Teil unüberschaubaren Vielfalt von Produkten, die oft auch noch im Monatstakt durch Produktinnovationen ersetzt werden, ist der Aufwand zur Beschaffung vollständiger Information nicht zu unterschätzen. Wer beispielsweise einen neuen Fotoapparat kaufen will, müsste sich zunächst von allen Anbietern Informationen über alle zur Verfügung stehenden Modelle inklusive aller Features beschaffen. In der Realität dürfte der Versuch schon allein deshalb scheitern, weil während des Zeitraums der Informationsbeschaffung, der einige Wochen in Anspruch nehmen dürfte, schon wieder neue Modelle auf den Markt gekommen und andere verschwunden sind und sich die Preise der Modelle mehrfach geändert haben.
Sollte es ein Kunde tatsächlich geschafft haben, all diese Informationen zu beschaffen, steht er dann vor der nicht minder herausfordernden Aufgabe, diese Informationen zu systematisieren, um dann eine rationale Entscheidung treffen zu können. Gemäß den Annahmen des Homo oeconomicus kann der Kunde aber auf Basis seiner persönlichen Nutzenfunktion problemlos aus der schier unüberschaubaren Vielfalt von Kameras das für ihn optimale Gerät auswählen. Die Entscheidung fällt ihm leicht, weil er einem bestimmten Produkt auf Basis seiner konstituierenden Produkteigenschaften einen klaren individuellen Maximalpreis zuweisen kann, den er zu zahlen bereit ist. In der Realität wären die meisten Menschen bereits komplett überfordert, wenn man ihnen eine Übersicht aller Modelle und Features vorlegen würde, mit der Bitte, sich auf dieser Basis für ein bestimmtes Modell zu entscheiden – geschweige denn alle Informationen selbst zu beschaffen und zu systematisieren. Und die Annahme, dass Menschen bestimmten Produkten oder ihren Eigenschaften einen klaren Wert und damit individuellen Maximalpreis zuordnen können, ist bar jeder psychologischen Realität, aber dennoch Kern des Annahmengebäudes um den Homo oeconomicus herum.
Auch hat die empirische Erforschung von realen Entscheidungsprozessen beim Kauf eines Fotoapparats gezeigt, dass nur die allerwenigsten Menschen sich tatsächlich vollständige Informationen beschaffen und auf dieser Basis entscheiden, wenn sie eine Kamera oder irgendein anderes Produkt kaufen. Menschen folgen in ihren Entscheidungen stattdessen eher Daumenregeln, die sich in der Vergangenheit als ausreichend sinnvoll erwiesen haben und einfach angewandt werden können. Diese Daumenregeln können beispielsweise auch das paradoxe Ergebnis erklären, dass eine größere Auswahl an Optionen dazu führt, dass weniger Menschen sich zu einer Kaufentscheidung durchringen können (siehe »Paradox of Choice«, Kapitel 2.1). Diese Heuristiken zu extrahieren und deren Trigger und Treiber zu analysieren, ist das eigentliche Ziel der Entscheidungsforschung. Im Laufe dieses Buchs werden wir auf diesen Aspekt wiederholt zu sprechen kommen, denn die Liste relevanter Entscheidungsheuristiken ist kürzer, als man vielleicht befürchten könnte, und letztlich sind sie der Schlüssel zu einer besseren Marketingstrategie.
Aber zurück zum Homo oeconomicus: Vollends absurd wird die Annahme vollständiger Information schließlich, wenn man sich klarmacht, dass eine rationale Entscheidung zwischen verschiedenen Optionen dem Homo oeconomicus notwendigerweise auch hellseherische Fähigkeiten abverlangt. Wenn sich ein Kunde auf Basis einer reinen Nutzenabwägung beispielsweise zwischen verschiedenen Automodellen entscheiden soll und hierfür die Kosten der geplanten sechsjährigen Nutzung des Autos berechnen will, dann muss er für eine korrekte Berechnung nicht nur die Zinsentwicklung, die Inflationsrate und die Reparaturen der nächsten sechs Jahre kennen, sondern auch den in sechs Jahren zu erzielenden Wiederverkaufswert aller zur Auswahl stehenden Automodelle.
Bei einer Vielzahl von Produkten, wie beispielsweise Lebensmitteln, lässt sich die Information darüber, ob man das Produkt mag, nur erlangen, indem man es zumindest einmal probiert. Erst dann kann der Kunde objektiv entscheiden, ob er diese oder eine andere Schokolade bevorzugt. Bei der heutigen Anzahl von Süßigkeiten und den ständig neu auf den Markt kommenden Produkten in diesem Bereich ist es für einen Kunden kaum möglich, auch nur bei diesem einen Produkt den Marktüberblick zu behalten. Noch schwieriger wird es, wenn ein Produkt gekauft wird, das im Idealfall gar nicht zum Einsatz kommt, wie beispielsweise eine Versicherung. Das Image des Anbieters bestimmt hier die Entscheidung für eine bestimmte Versicherung weit mehr als beispielsweise die tatsächliche Schadensabwicklung, die der Großteil der Kunden nie erleben wird, weil es gar nicht zum Versicherungsfall kommt.
Schon diese wenigen Beispiele zeigen, dass die Annahme vollständiger Information keine sinnvolle Grundlage für die Abbildung von real stattfindenden Entscheidungsprozessen sein kann. Dennoch gehen viele Unternehmen wie selbstverständlich davon aus, dass der Kunde die Preise und Features ihres Produkts und der Wettbewerbsprodukte mindestens genauso gut kennt wie die Mitarbeiter des Unternehmens selbst, die sich den ganzen Tag ausschließlich mit diesem Produkt beschäftigen.
Mythos 2: Nutzenmaximierung
Die Annahme der Nutzenmaximierung unterstellt, dass jeder Kunde zu jedem Zeitpunkt jedem Produkt für sich persönlich einen genau definierten Nutzen zuordnen kann und daher genau weiß, wie hoch seine persönliche Zahlungsbereitschaft für dieses Produkt maximal ist. Eng verwoben mit dieser Annahme sind darüber hinaus noch zwei weitere Aspekte: Erstens wird unterstellt, dass Menschen stabile Präferenzen haben, also ein bestimmtes Produkt immer gleich attraktiv ist, egal in welchem Kontext es angeboten wird. Zweitens wird unterstellt, dass die Nutzenmaximierung nur das eigene Wohl im Sinne hat und rein egoistisch getrieben ist. Motive wie Altruismus haben keinen Platz, sofern sie nicht in Wahrheit auf die eigene Selbsterhöhung abzielen. Empirische Untersuchungen zeigen jedoch, dass weder Produktattraktivität noch Zahlungsbereitschaft stabil sind, sondern stark von den jeweiligen Umständen abhängen.
Der Nutzen und damit die Zahlungsbereitschaft hängen zudem nicht nur von der eigenen Verfassung ab, sondern werden auch stark durch rein externe Aspekte bestimmt. Ein kleines Gedankenspiel soll dies verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, Sie liegen im Urlaub entspannt unter einem Sonnenschirm am Strand und lesen ein Buch. Nach einiger Zeit bekommen Sie Lust auf ein Bier. An diesem Strand gibt es zwei Möglichkeiten, Bier zu kaufen: entweder die nahegelegene Poolbar eines Fünf-Sterne-Hotels oder, in ungefähr gleicher Entfernung, einen Strandkiosk. Beide verkaufen das gleiche Bier, allerdings zu unterschiedlichen Preisen.
In einem Experiment von Kahneman, Knetsch und Thaler (1986) wurde untersucht, wie hoch die Zahlungsbereitschaft für dieses Bier ist. Ist den Probanden der Preis für das Bier im Grunde egal? Oder ist der Preis für das Bier davon abhängig, wo sie es holen? Wie viel würden sie für ein Bier vom Strandkiosk zahlen? Und was wären sie bereit für ein Bier aus der Poolbar auszugeben? Das Ergebnis des Experiments war, dass die Befragten für ein Bier am Strandkiosk etwa 1,50 Dollar zu zahlen bereit gewesen wären, an der Poolbar jedoch 2,65 Dollar, also über 75 Prozent mehr. Auch wenn die absoluten Preise für Bier heute natürlich deutlich höher wären als in diesem Experiment aus den 80er-Jahren, hat sich am menschlichen Verhalten nichts geändert: Die meisten Menschen haben eine höhere Zahlungsbereitschaft, wenn das Bier aus einem Luxushotel kommt, als wenn es vom Strandkiosk kommt. Da es sich jedoch um das gleiche Bier handelt, für den Kunden also genau der gleiche Nutzen entsteht, sollte nach dem Modell des Homo oeconomicus auch seine Zahlungsbereitschaft genau gleich sein. Wenn er also bereit ist, für ein Bier aus dem Luxushotel einen bestimmten Preis zu zahlen, dann dürfte ihn dieser Preis auch beim Strandkiosk nicht stören.
Die Annahme eines individuellen Maximalpreises ist zwar auf den ersten Blick plausibel, aber ein Konstrukt ohne psychologische Realität. Wie wir im Folgenden an einer Vielzahl von Beispielen sehen werden, ist die Zahlungsbereitschaft vor allem vom Kontext der Entscheidung abhängig und kann auch bei ein und derselben Person von Situation zu Situation stark variieren.
Mythos 3: Minimaler Mitteleinsatz
Die Annahme des minimalen Mitteleinsatzes unterstellt, dass der Kunde für ein bestimmtes Produkt möglichst wenig Geld zahlen will oder für einen gegebenen Preis möglichst viel von dem Produkt erhalten will. Gleichzeitig wird implizit unterstellt, dass der Kunde den Preis für das Produkt kennt und dieser Preis für ihn von Bedeutung ist. Empirische Forschungen zur Attraktivitätsbewertung von Angeboten zeigen aber, dass Menschen keineswegs entscheiden, indem sie die Teilnutzen der einzelnen Produktmerkmale einfach aggregieren. Sehr häufig lässt sich die Gesamtattraktivität eines Produkts viel besser mit einem Durchschnittsmodell simulieren: Mit jedem weiteren Feature des Mobilfunkangebots, das der Kunde aber nicht wirklich dringend braucht (= unterdurchschnittliche Attraktivität) sinkt der durchschnittliche Nutzen des Angebots.
So haben wir in eigenen Experimenten zeigen können, dass von bestimmten Kundensegmenten ein bestimmter Handytarif zu einem bestimmten Preis attraktiver bewertet wird, wenn er keine pauschalen Auslandsfreiminuten beinhaltet. Hier war also weniger Leistung zum gleichen Preis attraktiver, weil die besagten Kundensegmente diesem Feature wenig Attraktivität zuschrieben. Die durchschnittliche Attraktivität aller enthaltenen Merkmale sank dadurch. Wenn ein Kunde also schon weiß, dass er in der Regel nicht ins Ausland telefonieren will, dann bewertet er ein Angebot mit Auslandsfreiminuten schlechter als das gleiche Angebot ohne Auslandsfreiminuten. Ein klassischer Homo oeconomicus würde aber bei gleichem Preis immer ein Angebot mit mehr Leistung bevorzugen. Die durchschnittliche Attraktivität wäre ihm völlig gleichgültig. Für den realen Kunden ist es jedoch unattraktiv, Leistung zu erhalten, die er nicht nutzt, weil er die Attraktivität – anders als der Homo oeconomicus – nicht nach Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern nach Preis-Nutzungs-Verhältnis bewertet (und Auslandsfreiminuten nutzt nun einmal nicht jeder). Schließlich gehen die meisten Menschen stillschweigend davon aus, dass man für alle erhaltenen Optionen in der einen oder anderen Form bezahlen muss, egal ob man sie nun nutzt oder nicht. Und für etwas implizit zu zahlen, was man nicht nutzen kann oder will, kommt bei den allermeisten Kunden nicht gut an.
Wichtig ist, dass nicht notwendigerweise in jeder Entscheidungssituation alle Annahmen des Homo oeconomicus falsch sind. Manchmal können einige zutreffen. Doch die bisherigen Beispiele zeigen bereits, dass die Annahmen keineswegs für jede Entscheidungssituation und alle Entscheider richtig sind. Deshalb hilft einem Unternehmen, das die Entscheidungen seiner Kunden beeinflussen will, nur eines: die Annahmen nicht einfach fraglos zu akzeptieren, sondern sie für jeden Einzelfall empirisch zu prüfen. Erst dann kann man die Entscheidungssituation der Kunden wirklich verstehen, was wiederum die Grundlage für die Beeinflussung von Entscheidungen bildet.
1.2 Der Homo oeconomicus als Leitbild der Forschung
Der Geburtsfehler der Entscheidungsforschung
Normalerweise werden falsche Annahmen in relativ kurzer Zeit durch die empirische Forschung aufgedeckt und durch angemessenere Annahmen ersetzt. Leider liegt auch den klassischen Forschungsansätzen zum Entscheidungsverhalten unbewusst die Hypothese des Homo oeconomicus zugrunde, was eine empirische Aufdeckung der falschen Annahmen quasi unmöglich macht. Die Entscheidungsforschung kann ihre Funktion als Korrektiv plausibler Modelle und Ideen demnach nicht wahrnehmen.
Damit kommen wir zu einem grundlegenden Aspekt dieses klassischen Entscheidungsmodells, der bei dessen Entwicklung völlig klar war, aber offensichtlich in der Zwischenzeit in Vergessenheit geraten ist: Der Homo oeconomicus war niemals als deskriptives Modell gedacht. Es wurde ursprünglich als vereinfachtes Menschenbild für die Volkswirtschaft entwickelt, das sich gut in wenige mathematische Formeln packen ließ und mit dem man normativ richtiges Entscheidungsverhalten in Märkten modellieren konnte. Es ging also darum zu definieren, wie ideales Entscheidungsverhalten aussieht und was in Märkten passieren würde, wenn sich alle Marktteilnehmer entsprechend verhalten würden.
Der Homo oeconomicus ist also ein theoretisches Konstrukt, das nie dafür gedacht war, reale Entscheidungsprozesse von realen Menschen abzubilden. Und doch hat er sich in unseren Köpfen festgesetzt und ist omnipräsent. Dabei können die wenigsten Menschen mit dem wissenschaftlichen Begriff »Homo oeconomicus« etwas anfangen oder kennen ihn überhaupt. Aber die zugrunde liegenden Prinzipien erscheinen uns intuitiv richtig, denn ein bisschen schmeicheln sie uns. Wahrscheinlich ist der Glaube an den Homo oeconomicus deshalb so populär und ungebrochen, weil wir uns selbst gerne so sehen würden: als rationale und unbestechliche Entscheider, die den vollen Überblick haben und immer das Beste für sich herausholen. Wir finden es schwierig, uns selbst einzugestehen, dass wir vielleicht auch Entscheidungen treffen, die objektiv betrachtet falsch sind. Wir hören nicht gerne, dass wir überhaupt keinen Durchblick haben oder dass wir eine suboptimale Entscheidung getroffen haben – und dies auch zukünftig in regelmäßiger, stabiler und damit vorhersagbarer Weise tun werden.
Der Übergang von einem ursprünglich bewusst normativ formulierten Entscheidungsmodell (also einer Beschreibung, wie man sich verhalten sollte) zu der Annahme, dass dies auch als deskriptives Modell taugen könnte (also einer Beschreibung, wie Menschen tatsächlich entscheiden), verlief schleichend und weitgehend unreflektiert. Dies betrifft nicht nur die Ebene der Entscheidungstheorie, sondern fand parallel auch auf methodischer Ebene statt. Der Mythos des Homo oeconomicus wird aus zwei Gründen am Leben erhalten: weil die Entscheider in den Unternehmen dieses Modell seit Studientagen in ihren Köpfen haben und weil die klassischen Marktforschungsmethoden auf den exakt gleichen Annahmen aufbauen – und zwar ebenso implizit und ebenso selten hinterfragt.
Dieses schleichende Verwechseln von normativ und deskriptiv auf theoretischer wie methodischer Ebene könnte man als den großen Geburtsfehler der Entscheidungsforschung ansehen. Es handelt sich um eine bis heute erhaltene konzeptionelle Unschärfe, ohne die in Theorie und Praxis viele gravierende Fehler vermieden worden wären. Praxisbeispiel 2 in Kapitel 4.2 illustriert erstens sehr eindrücklich, wie der fest verankerte, aber nie empirisch hinterfragte Glaube an ein bestimmtes Kundenbild eine ganze Branche über Jahrzehnte um Margenpotenziale gebracht hat. Zweitens zeigt es, wie diametral sich der tatsächliche Kunde in Wahrnehmung und Entscheidungsverhalten von dem intern gepflegten Kundenbild unterscheidet. Und drittens wird klar, wie durch ein valideres Kundenbild Ergebnissprünge erreicht werden können, die man kaum für möglich halten würde.
Dass diese grundlegende Modellfrage (normativ versus deskriptiv) sträflich vernachlässigt wurde, zeigt auch die umgekehrte Überlegung, also das konsequente Weiterdenken des rationalen Entscheidungsmodells in Bezug auf dessen Marketingimplikationen: Wenn dieses Menschenbild auch nur im Entferntesten der Realität entspräche, wäre nämlich vieles von dem, was wir als Marketing kennen, völlig sinnlos und würde sich in noch viel stärkerem Maße auf reines Preismarketing reduzieren, als wir es ohnehin schon in einigen Branchen beobachten können. So würde Mythos 1, die vollständige Information, Marketing jenseits reiner Informationsbereitstellung überflüssig machen, da der Kunde über vollständige Information verfügt und es daher sinnlos wäre, ihm die USPs des eigenen Produkts in den schönsten Farben auszumalen. Ein rationaler Entscheider wäre dafür kaum zugänglich. Gemäß Mythos 2, der Nutzenmaximierung, wäre zudem jeder Versuch der Einflussnahme auf die Entscheidung des Kunden, beispielsweise durch Werbung, von vornherein zum Scheitern verurteilt, da der Kunde eine rein rationale Entscheidung aufgrund seiner persönlichen situationsunabhängigen Präferenzen trifft. Dem Unternehmen bliebe demnach gemäß Mythos 3 nur noch die Möglichkeit, dem Kunden zu helfen, sein Ziel mit minimalem Aufwand zu erreichen. Im Falle eines Produktverkaufs also lediglich die Option, den Vertrieb – also Verfügbarkeit und Barrierefreiheit des Kaufs – zu optimieren oder die Preise zu senken beziehungsweise Rabatte zu gewähren.
Die Annahme impliziert, dass Kunden wie Unternehmen das gleiche Motiv verfolgen – nur mit umgedrehten Vorzeichen: Der eine versucht, möglichst viel zu bekommen, der andere dagegen, möglichst wenig zu bezahlen. Der gesamte Entscheidungsprozess reduziert sich auf den Preis und wäre ein klassisches Nullsummenspiel: Es ginge lediglich darum, einen möglichst optimalen Kompromiss zwischen der Preisbereitschaft der Kunden und der Preisforderung des Unternehmens zu finden. Die »Nullsummen-Hypothese« scheint im ersten Moment einleuchtend. Sofern sie zutrifft, genügt eine reine Messung der Preisbereitschaft als Grundlage der Marketingstrategie. Ist sie aber falsch, kann die Preisoptimierung anhand dieser Methoden teure Konsequenzen für den Anbieter haben: Unterscheiden sich nämlich Kunden auch hinsichtlich ihrer Motive, gehen durch eine reine Messung der Preisbereitschaft wichtige Informationen verloren. Die unvermeidliche Konsequenz ist verschenkter Gewinn, weil die optimale Strategie auf Basis dieser eindimensionalen Analyse nicht gefunden werden kann. Wie wir im Folgenden sehen werden, ist auch Mythos 3 in der Regel nicht korrekt, sodass durch Preissenkungen und Rabatte oft genug das Gegenteil erreicht wird.