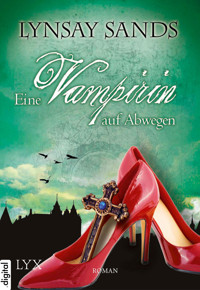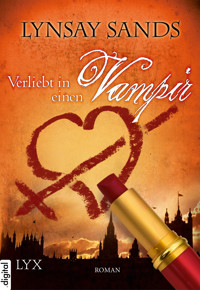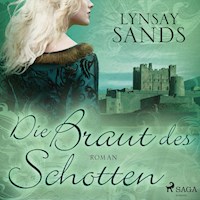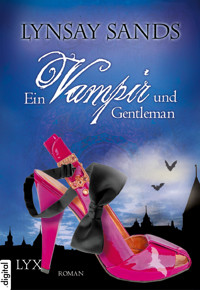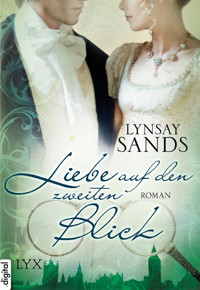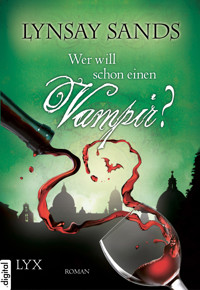9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Argeneau
- Sprache: Deutsch
Eine Serie so unsterblich wie ihre Vampire!
Stephanie McGill wurde gegen ihren Willen in eine Unsterbliche verwandelt. Da sie immerzu die Gedanken der Menschen um sich herum hören kann, führt sie ein zurückgezogenes Leben auf dem Land. Doch dann zieht Thorne nebenan ein. Er ist ebenfalls einzigartig - das Ergebnis eines genetischen Experiments. Bei Stephanie kann er endlich er selbst sein, und schon bald entstehen zarte Gefühle zwischen den beiden. Aber um ihr gemeinsames Glück zu finden, müssen sie sich einer Bedrohung aus Thornes Vergangenheit stellen - denn der wahnsinnige Wissenschaftler, der ihn erschaffen hat, ist nun auch hinter Stephanie her.
"Macht euch bereit für ein Abenteuer voller Romantik, Gefühl und Spannung." ADDICTED TO ROMANCE
Band 34 der erfolgreichen Vampirserie um die liebenswerte ARGENEAU-Familie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Die Autorin
Die Romane von Lynsay Sands bei LYX
Impressum
LYNSAY SANDS
Der Vampir gehört zu mir
Roman
Ins Deutsche übertragen von Ralph Sander
Zu diesem Buch
Stephanie McGill wurde als Teenager gegen ihren Willen in eine Unsterbliche verwandelt. Ihre Fähigkeiten sind selbst für eine ihrer Art außergewöhnlich. Sie kann die Gedanken aller Menschen hören – was für sie jedoch eine ständige Qual ist. Mit der Hilfe der Argeneaus ist es ihr gelungen, einen Weg zu finden, damit klarzukommen, und sie führt nun ein zurückgezogenes Leben mitten auf dem Land. Doch dann zieht Thorne im Nachbarhaus ein. Er ist ebenfalls einzigartig – das Ergebnis eines genetischen Experiments, das ihm Flügel verliehen hat. Und noch etwas ist anders an ihm – Stephanie kann seine Gedanken nicht wahrnehmen, und in seiner Nähe verstummt die Kakofonie der Stimmen in ihrem Kopf! Zudem verspürt sie von der ersten Berührung an eine besondere Verbindung zu ihm. Schon bald entstehen zarte Gefühle zwischen ihnen, und bei Stephanie kann Thorne zum ersten Mal seit Langem einfach er selbst sein. Aber um ihr gemeinsames Glück zu finden, müssen sie sich einer Bedrohung aus Thornes Vergangenheit stellen – denn der wahnsinnige Wissenschaftler, der ihn erschaffen hat, ist nun auch hinter Stephanie her.
Prolog
»Wie viele sind es?«
Diese Frage von Lucian Argeneau veranlasste Stephanie, die Augen aufzumachen. Sie hatte sie zugekniffen, um sich ganz auf die zahlreichen Stimmen zu konzentrieren, die in ihrem Kopf widerhallten. Nun drehte sie sich aber zu Lucian und der Gruppe Abtrünnigenjäger um, die alle auf ihre Antwort warteten. Es war kurz vor Sonnenaufgang an einem warmen Herbstmorgen, die Sonne sandte ihre orangefarbenen und zinnoberroten Strahlen aus, um dem Nachthimmel ihr Herannahen anzukündigen. Doch in dem Hain aus Ahornbäumen, in dem sie sich versammelt hatten, war es immer noch stockfinster. Dennoch hatte Stephanie keine Mühe, die zwölf Leute zu erkennen, die vor ihr standen. Und genauso deutlich sah sie jenseits der Bäume den etwas heruntergekommenen Bungalow im Siebzigerjahre-Stil sowie den überwucherten Garten.
Die Vorzüge der Nachtsicht, dachte Stephanie grimmig und biss die Zähne zusammen, während sie versuchte, den Strom aus Gedanken und Erinnerungen auszublenden, der von den Männern und Frauen um sie herum auf sie einstürmte, aber auch von den Leuten in diesem Haus und von so ziemlich jedem, der sich in einem Radius von einer Meile aufhielt. Dabei war sie sich nicht mal sicher, ob eine Meile die Grenze war. Es war durchaus denkbar, dass die Gedanken und Erinnerungen von Leuten stammten, die zwei oder zehn oder noch mehr Meilen entfernt waren. Es waren so viele Stimmen in ihrem Kopf …
»Stephanie. Wie viele?«, wiederholte Lucian und klang jetzt ungeduldig.
»Im Haus sind zweiunddreißig Abtrünnige«, antwortete sie ruhig, ohne sich von der Gereiztheit des mürrischen Mannes einschüchtern zu lassen. »Und noch ein weiterer irgendwo hinter dem Haus.«
»Hinter dem Haus? Auf dem Hof dahinter oder wo?«, erkundigte sich Mirabeau und kam zu ihr.
Stephanie betrachtete die große Frau, deren Haarspitzen fuchsiarot waren, und schüttelte den Kopf. »Nein, weiter entfernt. Hinter dem Wald am anderen Ende des Hofs.«
»Vermutlich nur ein Nachbar in der nächsten Straße«, meinte Lucian beiläufig und wandte sich ab, um den anderen seine Befehle zu geben.
Stephanie warf ihm einen finsteren Blick zu, während er mit dem Rücken zu ihr stand, wartete aber dennoch ab, bis er fertig war, ehe sie sagte: »Ich glaube nicht, dass es nur ein Nachbar ist, Lucian. Das Gefühl, das ich bei dieser Person habe …«
»Deine Gefühle sind nicht wichtig. Wer immer es auch ist, wir haben es mit niemandem zu tun, der uns jetzt Sorgen machen müsste«, unterbrach Lucian sie. »Um ihn werden wir uns kümmern, wenn wir das Nest ausgehoben haben.«
»Aber …«, wollte Stephanie protestieren, doch er schnitt ihr abermals das Wort ab.
»Du bleibst hier, bis wir mit dem Haus fertig sind.«
Stephanie drehte sich dorthin um, wo eben noch Mirabeau gestanden hatte, um sie um Unterstützung zu bitten, auf Lucian einzuwirken, damit der ihr zuhörte. Doch die andere Frau war verschwunden. Sie war bereits in die Dunkelheit zwischen den Bäumen eingetaucht, um an dem Punkt in Stellung zu gehen, wo sie sich aufhalten sollte, ehe die Gruppe sich dem Haus näherte.
Alle waren sie nun weg, wie Stephanie feststellen musste, als sie sich wieder dorthin umdrehte, wo vor wenigen Sekunden Lucian gestanden hatte. Sie war jetzt ganz allein im Wald.
Stephanie riss aufgebracht schnaubend die Hände in die Höhe und stemmte dann die Fäuste in die Hüften, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Trotz der Dunkelheit und der vielen Bäume konnte sie etliche Jäger entdecken, die sich durch den Wald rund um das Haus bewegten, um ihre Positionen einzunehmen. Da sie schon seit Jahren mit ihnen zusammenarbeitete, wusste sie, wie das ablief. Im Wesentlichen umstellten sie ein Anwesen, dann rückten sie auf ein Signal von Lucian hin vor, als würde sich ein Netz um das Haus schließen. Jeder Einzelne von ihnen hatte seine eigenen Anweisungen. Einige bewachten Fenster oder Schiebetüren, während andere durch die Vorder- und die Hintertür nach drinnen stürmten. Sinn der Sache war der, dass niemandem die Flucht gelingen sollte, sobald der Einsatz begonnen hatte.
Stephanie beobachtete zwar, wie die Jäger sich dem Anwesen näherten, doch mit ihren Gedanken war sie ganz woanders. Sie konnte wieder diese eine Stimme hören, die jenseits des Waldes hinter dem Haus ihren Ursprung hatte. Der, dem diese Stimme gehörte, reagierte auf eine Art Warnton und betrat einen kleinen Raum, um einen Blick auf die …
»Kameras!« Stephanie brüllte die Warnung in der Sekunde, als ihr klar wurde, dass der Unbekannte einen Blick auf die Überwachungsmonitore warf. Sie selbst konnte nirgends Kameras entdecken, doch sie wusste, dass sie dort waren.
Zum Glück war Lucian in der Lage, sie zu sehen, oder zumindest vertraute er ihrer Warnung, denn im gleichen Moment brüllte er einen Befehl. Aus dem langsamen Vorrücken würde gleich darauf ein deutlich schnellerer Angriff.
Stephanie sah zu, wie Lucian mit den Vollstreckern Decker und Bricker durch die Vordertür ins Gebäude eindrang. Aus dem Haus drangen weder Entsetzensschreie noch Geräusche, die auf ausbrechendes Chaos hindeuteten. Die Abtrünnigen dort drinnen schliefen entweder bereits, oder aber sie waren um diese Uhrzeit im Begriff, sich schlafen zu legen. Das war auch der Grund, warum solche Einsätze bei Anbruch der Dämmerung erfolgten, da man dann das gesamte Nest ausheben konnte und nicht etwa ein paar Abtrünnige verpasste, die während der Nacht unterwegs waren.
Außerdem war es immer leichter, wenn man sie überrumpelte, überlegte sie, dann schloss sie die Augen und konzentrierte sich wieder ganz auf diese einzelne Stimme. Von den Kameras hatte sie gewusst, weil der Unbekannte auf den Monitoren gesehen hatte, wie sich die Vollstrecker dem Haus näherten. Er war nicht bloß ein Nachbar. Er hatte irgendetwas mit diesem Haus zu tun. Dieses Gefühl hatte sie schon zuvor gehabt, doch da war sie sich nicht sicher gewesen, welche Verbindung zwischen ihm und den Leuten in diesem Haus hier bestand. Nun versuchte sie die Gedanken dieser Person nach einer Antwort darauf zu durchforsten.
Stephanie bahnte sich einen Weg durch die Vielzahl an Stimmen in ihrem Kopf, bis sie die gesuchte wiedergefunden hatte. Das Individuum befand sich jetzt in einer Art kontrollierter Panik, falls es so etwas überhaupt gab. Die Gedanken dieses Unbekannten schienen sich zu überschlagen, doch er hatte für den Fall einer solchen Attacke vorgesorgt. Er wusste genau, was er zu tun hatte, und genau das tat er nun auch. Er nahm die Dinge an sich, die ihm wichtig waren, und machte sich bereit, die Flucht zu ergreifen. Er würde sich woanders niederlassen müssen. Das war zwar lästig, aber es kam nicht überraschend. Es war immer gut, wenn man über seine Feinde Bescheid wusste, und er hatte Pläne bereitliegen. Dazu gehörten …
»Bomben!«, schrie Stephanie und riss die Augen auf, um loszulaufen. Sie rannte in Richtung des Hauses und brüllte aus Leibeskräften: »Bomben! Raus da! Alles raus da! Raus, raus, raus!«
Sie entdeckte Mirabeau vor einem der seitlichen Fenster, Tiny stand vor dem Fenster daneben. Für einen winzigen Moment verspürte sie Erleichterung, da die beiden und alle anderen, die nicht nach drinnen gegangen waren, nun zögerlich zurückwichen. Diese Erleichterung hielt jedoch nicht lange vor. Denn drei Männer waren zur Vordertür reingegangen, drei weitere zweifellos durch die Hintertür. Vor allem aber dachte sie an Decker, ihren Schwager, der einer der drei war, die die vordere Haustür benutzt hatten. Wenn ihm etwas zustoßen sollte, dann wäre ihre Schwester Dani …
Ein erleichterter Seufzer kam ihr über die Lippen, als sie Decker aus dem Haus kommen sah, dicht gefolgt von Bricker. Ihr Schwager sah sie verständnislos und fragend an. Es war klar, dass sie im Haus ihre Warnung gehört hatten, sie schienen sich aber im Unklaren zu sein, was sie davon halten sollten.
Stephanie wollte ihm und allen anderen zurufen, dass das Haus jeden Moment in die Luft fliegen würde, doch dazu reichte die Zeit nicht mehr. So wie von einem Blitz unmittelbar vor einem Donnerschlag wurde sie von der Druckwelle erfasst. Stephanie erlebte in dem Moment einen fast körperlichen Schlag, wie es ihr noch nie zuvor in ihrem Leben widerfahren war. Vermutlich fühlte es sich ganz ähnlich an, wenn man von einem Güterzug in voller Fahrt erfasst wurde.
Da es eine Wand aus Luft war, von der sie erfasst und nach hinten geschleudert wurde, empfand sie es als ein bisschen verwirrend, dass auf einmal kein Sauerstoff für ihre Lungen mehr vorhanden war. Aber Stephanie blieb keine Zeit, darüber nachzudenken, denn sie wirbelte durch die Luft, noch bevor sie die Detonation der Bomben hörte.
Rücklings landete sie auf dem überwucherten Gras und starrte einen Moment einfach in den heller werdenden Nachthimmel, ehe sie sich wieder in der Lage fühlte, sich zu bewegen. Dann aber riss Stephanie sich zusammen und zwang sich aufzustehen. Nur beiläufig nahm sie wahr, dass sie leicht hin und her schwankte, als sie sich auf das konzentrierte, was sie von der Umgebung des Hauses ausmachen konnte. Die meisten Vollstrecker, die sie sehen konnte, schienen nur leicht verletzt zu sein. Sie hörte Stöhnen und Schmerzenslaute von denen, die Knochenbrüche oder Kopfwunden erlitten hatten, aber diejenigen, die auf den Beinen waren und nach den Verletzten sahen, waren zahlenmäßig mehr als die, die zu Boden gegangen waren.
Mirabeau und Tiny gehörten zu jenen, die unterwegs waren, um anderen zu helfen. Sie konnte Decker erkennen, der sich über Lucian gebeugt hingekauert hatte. Offenbar war es dem Chef des nordamerikanischen Rats der Unsterblichen und inoffiziellen Anführer der Vollstrecker nicht mehr gelungen, vor der Explosion das Haus zu verlassen. Anscheinend hatte er sich aber noch in der Nähe der Tür aufgehalten, sodass er von der Druckwelle nach draußen geschleudert worden war. Da Rauch von ihm aufstieg, musste er wohl zumindest für einen Augenblick Feuer gefangen haben. Das legte den Verdacht nahe, dass es sich um Brandbomben gehandelt haben musste.
Stephanie wartete, bis sie sah, dass Lucian sich rührte. Erst dann richtete sie ihren Blick wieder auf den Wald hinter dem Haus. Diesmal musste sie nicht lange suchen, bis sie die Gedanken des einzelnen Mannes wiedergefunden hatte. Während sie Schmerzen und Wut von den Vollstreckern rund um das Gebäude und Panik und Entsetzen von den im Haus eingeschlossenen Abtrünnigen wahrnahm, strahlte er Ruhe aus. Sein Blick klebte förmlich an den Monitoren, seine Überlegungen kreisten um die Frage, wieso sie von den Bomben gewusst hatte.
Ihr Verstand arbeitete noch nicht wieder hundertprozentig, nachdem sie durch die Luft gewirbelt worden war, dennoch rannte Stephanie los, um zum rückwärtigen Ende des Grundstücks zu gelangen. Ihr einziger Gedanke war, diesen Bastard zu fassen zu bekommen, bevor der die Flucht ergreifen konnte.
Hier hinter dem Haus standen die Bäume viel dichter als auf der Vorderseite, doch es gab einen Trampelpfad, der gerade breit genug war, damit sich eine einzelne Person ihren Weg zwischen den Bäumen hindurch bahnen konnte. Stephanie folgte diesem Pfad so schnell, wie es ihrem Körper möglich war. Für sie war das viel müheloser als für jeden Sterblichen, so mühelos, dass sie ein wenig vor Erstaunen erschrak, als sie auf einmal aus dem Wald herauskam und sich auf einer Lichtung wiederfand, auf der noch ein Haus stand.
Die Fläche ringsum war in keiner besseren Verfassung als beim ersten Baum. Was sich wohl früher als wunderschön gepflegter Rasen präsentiert hatte, war jetzt mit hüfthohem Gras und Unkraut überwuchert. Stephanie wurde langsamer, als sie sich dem Haus näherte. Während sie auf die Haustür zuging, wanderte ihr Blick zu dem Lichtschein, der durch die Fenster des verfallenen zweistöckigen Gebäudes im viktorianischen Stil nach draußen drang. Die Tür war aus massivem dunklem Holz und ohne ein Fenster, durch das man nach drinnen schauen konnte. Sie wollte eben nach dem Türgriff fassen, als die chaotischen Gedanken an die eben miterlebten Szenen gerade weit genug abebbten, um das wahrnehmen zu können, was der Mann im Haus soeben dachte. Er wusste, dass sie da war. Er wartete bereits auf sie.
Stephanie ließ den Türgriff los und wich ein paar Schritte zurück. Dabei fasste sie hinter sich nach der Waffe, die im Hosenbund ihrer Jeans steckte. Geladen war sie mit Pfeilen, die mit einem Medikament gefüllt waren, das speziell für die Jagd auf Abtrünnige entwickelt worden war. Dieses Mittel war das einzige, das jeden Abtrünnigen mit absoluter Gewissheit zu Boden schicken konnte.
»Steph?«
Ruckartig drehte sie sich um und sah völlig verdutzt, dass Mirabeau zwischen den Bäumen aufgetaucht war und nun auf sie zugelaufen kam. Die Tatsache, dass sie den Schauplatz der Explosion verlassen hatte, ohne sich um die Verletzten zu kümmern, war nicht unbemerkt geblieben. Gleiches galt für den Umstand, dass sie nun ihre Pistole gezogen hatte.
Mirabeau sah überrascht und zugleich sorgenvoll drein, als ihr Blick auf die Waffe fiel. Was auch völlig verständlich war, wie Stephanie einräumen musste. Für gewöhnlich überließ sie es den anderen, die Abtrünnigen in Gewahrsam zu nehmen, denn sie war bei diesen Jagden normalerweise nur dabei, um den anderen zu sagen, mit wie vielen Abtrünnigen sie es zu tun hatten und wo die sich aufhielten. Außerdem half sie anschließend bei der Befragung mit und fischte aus dem Verstand der Abtrünnigen die von Lucian gesuchten Antworten auf die gleiche Weise heraus, wie man ein einzelnes Katzenhaar von einem Wollpullover entfernte. Aber trotz ihres jahrelangen Trainings an der Seite der Vollstrecker musste sie beim eigentlichen Zugriff stets in der zweiten Reihe bleiben.
»Was m…« Mirabeau hatte die halbe Strecke zwischen Waldrand und Haus zurückgelegt, als sie zu ihrer Frage ansetzte. Mehr als das eine Wort bekam die junge Frau jedoch nicht heraus, als ihr Blick plötzlich von Stephanie wegwanderte. Sie riss die Augen weit auf – und gleich darauf verlor sie den Halt und fiel ins hohe Gras.
Instinktiv wollte Stephanie der anderen Frau zu Hilfe eilen, wirbelte aber schon in der nächsten Sekunde herum und sah in Richtung Haus. Die Tür war nun geöffnet, ein Mann stand dort, ein großer, blonder und attraktiver Mann. In seiner Hand hielt er eine Pistole, mit der er auf sie zielte. Gerade als ihr klar wurde, dass es eine Waffe war, wie sie von den Vollstreckern benutzt wurde und wie sie selbst sie jetzt auch in der Hand hielt, drückte er ab. Sie verspürte einen stechenden Schmerz in der Brust und sah nach unten auf einen Pfeil, der sich dicht neben ihrer linken Brust und gleich über dem Herz in ihren Körper gebohrt hatte. Eine warme Welle durchflutete sie, und dann erschlaffte auf einmal jeder Muskel in ihrem Leib. Stephanie verlor weder das Bewusstsein noch ihre Empfindungen, und wenn sie es gekonnt hätte, wäre sie zusammengezuckt, als sie vornüberkippte und mit dem Kopf so hart auf dem festgetretenen Boden aufprallte, dass der noch einmal zurückfederte.
Schließlich blieb sie mit geschlossenen Augen, aber hellwachem Verstand auf der Seite liegen. Sie hörte Bewegungen und versuchte die Augen zu öffnen, was ihr jedoch aus irgendeinem Grund nicht möglich war. Sie konnte nichts anderes tun, als den Geräuschen zu lauschen, die er verursachte, als er sich ihr näherte. Er musste sich neben ihr hingehockt oder sich über sie gebeugt haben, auf jeden Fall konnte sie seine Hand auf ihrer Schulter spüren. Dann drehte er sie auf den Rücken.
»Du wusstest über die Bomben Bescheid. Wie konnte das sein?«, murmelte ihr Angreifer, während er ihr die Pistole aus der erschlafften Hand nahm und an ihrer Kleidung zog, wohl um sie nach weiteren Waffen zu durchsuchen. »Und woher wusstest du, dass hier noch ein Haus ist? Und dass ich mich darin aufgehalten habe?«
Stephanie versuchte gar nicht erst zu antworten, und sie nahm auch nicht an, dass er das von ihr erwartete. Vermutlich führte er nur Selbstgespräche und wusste womöglich gar nicht, dass sie noch bei Bewusstsein war. Das hätte sie auch gar nicht sein sollen, umso unerklärlicher, warum es dann doch der Fall war. Nicht nur die Waffe, auch der Pfeil war genau das, was Vollstrecker bei der Jagd benutzten, und deshalb hätte der Pfeil sie auch bewusstlos machen sollen. Aber sie war nach wie vor bei Bewusstsein, und in den Fingern und den Zehen bemerkte sie ein Kribbeln, was darauf hindeutete, dass die Wirkung des Betäubungsmittels bereits wieder nachließ. Das kam für sie völlig überraschend.
»Steph.«
Sie erschrak so sehr darüber, ihren Namen aus seinem Mund zu hören, dass sie unwillkürlich die Augen aufriss. Die Tatsache, dass sie dazu in der Lage war, lenkte sie einen Moment lang ab, weshalb sie vergaß, was er gesagt hatte.
»So hat sie dich genannt: Steph.«
Sie sah zu ihm und stellte fest, dass er gar nicht sie betrachtete, sondern Mirabeau. Noch während ihr das bewusst wurde, kehrte sein Blick zu ihr zurück. Verdutzt riss er die Augen auf, als ihm klar wurde, dass sie wach war.
»Du solltest nicht wach sein«, sagte er und klang völlig verwundert. »Die Dosis in diesem Pfeil sollte jeden Unsterblichen für mindestens zwanzig Minuten außer Gefecht setzen.«
Stephanie wollte ihm sagen, er solle sich zum Teufel scheren, doch im Gegensatz zu ihren Augen wollte ihr Mund noch nicht wieder funktionieren. Sie konnte den Unterkiefer nicht bewegen, und die Zunge hing nutzlos im Mund herum.
Plötzlich beugte er sich über sie, schob zwei Finger in ihren Mund und drückte hinter ihren Fangzähnen gegen den Gaumen. Angewidert und wütend versuchte sie ihn zu beißen, aber natürlich gehorchte ihr Mund ihr noch immer nicht.
»Du hast dieses Metallische in deinen Augen, ganz so wie die Unsterblichen, aber du hast keine Fangzähne«, redete er leise vor sich hin und nahm die Finger aus ihrem Mund, während er sie fasziniert musterte. »Und wenn das Betäubungsmittel so schnell seine Wirkung verliert, dann hast du eine noch bessere Konstitution als eine Unsterbliche. Was bist du bloß?«
Da sie ihm weder einen Schlag ins Gesicht verpassen noch ihm die Augen auskratzen konnte, was sie zu gern getan hätte, blieb ihr nichts anderes übrig, als ihn wütend anzustarren.
»Das ist wirklich faszinierend. Vielleicht sollte ich dich mitnehmen«, sagte er nachdenklich und drehte sich zum Haus um, als überlege er, wie er dieses Vorhaben am besten umsetzen konnte.
»Beau? Steph?«
Instinktiv versuchte Stephanie den Kopf in die Richtung zu drehen, aus der der Ruf ertönt war, doch anders als ihre Augenlider wollten ihre Halsmuskeln noch nicht so wie sie.
»Verdammt«, knurrte ihr Angreifer, der sich nun frustriert anhörte.
Sie sah zu ihm und stellte fest, dass er mit finsterer Miene in die Richtung sah, aus der der Ruf gekommen war. Schließlich schüttelte er den Kopf und richtete sich auf. »Sieht ganz so aus, als müsste ich dich hier zurücklassen. Aber ich hoffe doch sehr, dass wir uns wiedersehen werden, Steph, wer auch immer du bist. Ich hätte dich gern vor mir auf meinem Tisch, um herauszufinden, wie es in dir aussieht.«
Ein frostiges, genüssliches Lächeln zeichnete sich bei diesem Gedanken auf seinem Gesicht ab, dann drehte er sich um, ging ohne große Eile zurück zum Haus und schloss die Tür hinter sich.
Stephanie starrte die massive Eichentür an und fürchtete, sie könnte noch einmal aufgehen und er würde sie doch noch holen kommen. Zwar hatte sie zunächst mit Zorn und Abscheu auf den Mann reagiert, doch bei der Leere in seinen Augen und seinem Lächeln, als er davon sprach, dass er sie gern vor sich auf seinem Tisch haben wollte, um herauszufinden, wie es in ihr aussah, waren diese ersten Gefühlsregungen sofort vergessen. Stattdessen hatte sie das Gefühl, als würde ihr vor Angst das Blut in den Adern gefrieren. Sie war maßlos erleichtert, als sie einen Fluch hörte, der viel näher klang als der vorangegangene Ruf. Dann geriet Tiny in ihr Blickfeld, der zur reglos daliegenden Mirabeau eilte.
»Was zum Teufel ist mit den beiden geschehen?«
Stephanie erkannte Deckers Stimme, und dann sah sie ihn auch schon, wie er zu ihr gelaufen kam.
»Steph? Was ist passiert?«, fragte Decker besorgt, als er sich neben ihr hinkniete und sah, dass sie die Augen offen hatte. Offensichtlich beunruhigte es ihn, dass sie nicht reagierte. Er wollte nach ihr fassen, zögerte dann aber. In seinem Verstand las sie die Sorge, dass er nicht wusste, welcher Art ihre Verletzungen waren, und er nichts tun wollte, was es für sie nur noch schlimmer machte.
»Bei Mirabeau steckt ein Pfeil im Hals«, schimpfte Tiny, der sich äußerst wütend anhörte.
»Ein Pfeil?« Decker sah verwundert zu dem anderen Mann. »Was denn für ein Pfeil?«
»Einer von unseren, würde ich sagen«, antwortete der Hüne. Dann sah sie, wie er den Pfeil aus Mirabeaus Hals zog, ihn sich kurz genauer ansah und zur Seite warf. Dann betrachtete Tiny seine Lebensgefährtin und wandte sich schließlich Stephanie und Decker zu. »Steph muss auch getroffen worden sein. Such nach dem Pfeil.«
Decker drehte sich wieder zu Stephanie um, und sie konnte sehen, wie er sie von oben bis unten betrachtete, ehe er den Blick über die unmittelbare Umgebung schweifen ließ. Plötzlich fluchte er und griff nach etwas, das neben ihr im Gras liegen musste. Noch bevor er den Fund hochhielt, um ihn genauer in Augenschein zu nehmen, wusste sie, dass er den Pfeil entdeckt hatte. Er musste sich gelöst haben, als sie vornübergefallen war.
»Verdammt, das ist ja einer von unseren«, knurrte Decker, ehe er ihn in seine Tasche steckte. Er warf einen Blick in Richtung Haus, betrachtete aufmerksam Tür und Fenster, ehe er sich wieder auf Stephanie konzentrierte. Seine Miene war sorgenvoll, während er ihre Augen musterte. Sie musste keine Gedanken lesen können, um zu wissen, dass er besorgt war, weil er sich fragte, wieso sie in der Lage war, die Augen aufzumachen, und was das bedeuten mochte.
»Sie hat ja die Augen auf!«
Stephanie schaute über Deckers Schulter hinweg, als sie den verwunderten Ausruf hörte. Dann entdeckte sie Tiny, der Mirabeau auf seine Arme genommen hatte und zu ihnen gekommen war.
»Ja«, bestätigte Decker missmutig. »Aber sie scheint sich weder bewegen noch etwas sagen zu können.«
»Die Wirkung des Pfeils muss bei ihr wohl nachlassen«, meinte Tiny, der erleichtert klang. Er stand da und sah sie über Mirabeaus schlaffen Körper hinweg an, den er in seinen Armen an sich gedrückt hielt. »Das bedeutet, dass Beau auch bald wieder aufwachen wird.«
Decker antwortete mit einem Brummlaut, der wohl Zustimmung signalisieren sollte, doch danach zu urteilen, wie er sie ansah, hatte Stephanie das Gefühl, dass er das eigentlich nicht glaubte. Allerdings konnte sie ihm das auch nicht verübeln. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass mehr als fünf oder sechs Minuten vergangen sein konnten, seit sie von diesem Pfeil getroffen worden war. Und ganz sicher war es noch keine zwanzig Minuten her, dass die Bomben hochgegangen waren und sie zu diesem Haus gerannt war. Aber Tiny, der seine bewusstlose Lebensgefährtin an sich gedrückt hielt, war viel zu aufgewühlt, um sich darüber Gedanken zu machen. Sie dagegen war nicht Deckers Lebensgefährtin, weshalb dieser nicht so außer sich war wie Tiny. Natürlich konnte sie seine Gedanken hören, und sie wusste, er machte sich Sorgen um sie. Aber das wäre ihr sogar dann klar gewesen, wenn sie nicht gewusst hätte, was in seinem Kopf vor sich ging.
Formal war Decker lediglich ihr Schwager, doch in den letzten fast dreizehn Jahren, seit er sie und Dani aus den Fängen von Leonius Livius befreit hatte – jenem abtrünnigen Schlitzer, der sie beide gewandelt hatte –, war er für Stephanie längst so etwas wie ein echter Bruder geworden, aber auch ein guter Freund und manchmal sogar eine Art Vaterfigur. Aber das war alles nicht vergleichbar damit, für jemanden der Lebensgefährte zu sein, und deshalb konnte Decker in diesem Moment weitaus klarer denken als Tiny.
»Bring Beau zu den Autos und schick mir so viele Vollstrecker rüber, wie verfügbar sind, um das Haus auf den Kopf zu stellen«, sagte Decker plötzlich.
Tiny zögerte und sah besorgt zum Haus. »Mir gefällt der Gedanke nicht, dich hier allein zurückzulassen, wenn da jemand ist, der mit einer Betäubungspistole herumläuft. Wäre es außerdem nicht klüger, wenn wir uns das Haus sofort vornehmen? Was ist, wenn wir das Haus später durchsuchen und derjenige, der auf Stephanie und Beau geschossen hat, bis dahin verschwunden ist?«
»Und was ist, wenn der Angreifer aus dem Haus entkommt, sobald wir reingehen und es durchsuchen, und in der Zwischenzeit unsere Frauen enthauptet? Oder was ist, wenn auf uns auch noch geschossen wird und wir dann enthauptet werden, weil keiner von den anderen rechtzeitig auf die Idee kommt, nach uns zu suchen?«, gab Decker zurück, richtete sich auf und drehte sich wieder zum Haus um. Seine Betäubungspistole hielt er schussbereit in der Hand. »Geh schon, beeil dich. Ich passe auf Stephanie auf und behalte das Haus im Auge, bis Hilfe eintrifft.«
Tiny machte sich gar nicht erst die Mühe, darauf etwas zu erwidern. Deckers Warnung, sie alle könnten betäubt und enthauptet werden, hatte gereicht, um den Mann zur Eile anzutreiben. Stephanie sah ihm hinterher, bis er aus ihrem Blickfeld verschwunden war, dann konzentrierte sie sich wieder auf Decker. Das Kribbeln hatte sich in den letzten Minuten von den Fingern und Zehen bis in die Unterarme und Unterschenkel ausgebreitet. Auch ihr Kiefer und die Zungenspitzen kribbelten mittlerweile. Sie versuchte die Finger zu bewegen und stellte fest, dass es ihr wieder möglich war. Gleiches galt für die Zehen. Sprechen konnte sie zwar noch immer nicht, aber dazu würde sie bald wieder in der Lage sein.
»Kannst du blinzeln?«
Stephanie sah wieder zu Decker und machte die Augen betont langsam zu und wieder auf.
Der Anblick veranlasste ihn zu einem ernsten Nicken, doch ehe er seine nächste Frage stellte, betrachtete er erst noch einmal argwöhnisch das Haus. »Hast du gesehen, wer auf dich geschossen hat? Blinzle einmal für Ja und zweimal für Nein.«
Stephanie blinzelte einmal.
»War es ein Vollstrecker?«, wollte er dann wissen.
Die Frage überraschte sie nicht. Sie und Mirabeau waren von Betäubungspfeilen getroffen worden, die von Vollstreckern benutzt wurden, und der Mann hatte die Pistole eines Vollstreckers benutzt. Es war kein Wunder, dass sich Decker Sorgen machte, ob sie es womöglich mit einem Abtrünnigen zu tun hatten, der selbst ein Vollstrecker war. Stephanie wunderte sich auch nicht über seine Erleichterung, als sie zweimal blinzelte, um seine Frage zu verneinen. Doch diese Erleichterung war nur von kurzer Dauer, denn er begann sich zu fragen, wie es einem Abtrünnigen gelungen sein sollte, in den Besitz einer solchen Betäubungspistole zu gelangen. Zwar las sie diese Sorge in seinen Gedanken, doch er ging darauf nicht weiter ein, sondern fragte weiter: »Hast du den Schützen erkennen können?«
Stephanie zögerte. Erkannt hatte sie den Mann zwar nicht, doch seine Gedanken hatten ihr verraten, wer er war. Das ließ sich aber nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten.
»Ist es mehr als nur einer?«, wollte Decker wissen, als ihm ihre Antwort zu lange dauerte. Kaum hatte er ihr zweimaliges Blinzeln gesehen, schnellte sein sorgenvoller Blick auch schon wieder zum Haus hinüber. Sie wünschte, sie könnte ihm sagen, dass es keinen Grund für diese Wachsamkeit gab. Der Mann hatte sich längst aus dem Staub gemacht. Seine Gedanken wurden schwächer und schwächer, je weiter er sich entfernte. Er war zu Fuß unterwegs und folgte einem Pfad durch den Wald auf der anderen Seite des Hauses. Auf diesem Weg gelangte er zu einem Fahrzeug, das dort eigens für einen solchen Anlass versteckt worden war.
»Also eine Person«, murmelte Decker, dann sah er sie erneut an, um zu fragen: »Mann oder Frau?«
Das veranlasste sie dazu, die Augenbrauen hochzuziehen, was Überraschung bei ihr auslöste. Das Betäubungsmittel verlor offenbar schnell an Wirkung, wenn sie zu dieser Mimik wieder in der Lage war. Sie war sich ziemlich sicher, dass ihr das noch nicht möglich gewesen war, als Decker hier aufgetaucht war.
Ihm wurde klar, welchen Fehler er gemacht hatte, denn diese Frage konnte sie nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. »Ein Mann?«, fragte er erneut.
Stephanie blinzelte einmal, doch ihre Aufmerksamkeit war jetzt vor allem auf ihren Mund gerichtet. Ihre Zunge kribbelte jetzt wie verrückt, so als hätte sie eine Spritze für eine Zahnbehandlung erhalten, deren Wirkung nun nachließ. Auch der Unterkiefer und das restliche Gesicht hatten zu kribbeln begonnen. Als sie versuchte, die Zunge zu bewegen, stellte sie erstaunt fest, dass sie dazu in der Lage war. Auch ihr Unterkiefer gehorchte ihr nun wieder.
Decker beobachtete erneut das Haus, drehte aber in diesem Moment den Kopf zu ihr um. »Hat dieser Kerl …«
»Dressler«, brachte Stephanie heraus, auch wenn dieser Name eher schleppend und etwas atemlos über ihre Lippen kam.
Decker musste sie dennoch verstanden haben, denn er sah sie voller Entsetzen an. In diesem Augenblick verriet die Geräuschkulisse, dass Leute durch den Wald stürmten. Die anderen Vollstrecker waren auf dem Weg hierher. Schade nur, dass sie zu spät kamen.
1
Sieben Monate später
»Was ist los? Wo bist du hin?«
Stephanie wandte sich von der Glasfront ab, als sie Danis Frage hörte. Nachdenklich betrachtete sie den Computer am anderen Ende der Küche. Sie hatte sich Danis Schilderung der Ereignisse in ihrem Leben seit dem letzten Gespräch vor einer Woche angehört, als ihr auf einmal bewusst geworden war, dass sie nur eine einzige Stimme vernahm, nämlich die von Dani. Und die ertönte aus dem Lautsprecher, und nicht einfach in ihrem Kopf. Die anderen Stimmen, die sich für gewöhnlich dort tummelten, waren verstummt.
Sie war so daran gewöhnt, die Stimmen von allen Leuten in einem Umkreis von einer Meile zu hören, dass die plötzliche Stille sie förmlich aus dem Gleichgewicht brachte. Schockiert und verwirrt war sie aufgestanden und hatte den Erfassungsbereich der Kamera verlassen, um sich stattdessen ans Fenster zu stellen und nach draußen zu sehen, so als könnte das die Stimmen wieder ertönen lassen oder zumindest ihr Fehlen erklären.
»Steph? Wo bist du? Ist alles in Ordnung?«
Es war Danis sorgenvoller Tonfall, der sie aus ihrer Reglosigkeit befreite. Schnell kehrte sie in die Küche zurück und begab sich an das andere Ende der Kücheninsel, nahm auf dem Weg dorthin aber noch einen Dosenöffner und eine Dose Lachs mit. »Bin schon da. Ich musste nur was holen.« Vor dem Laptop blieb sie stehen, zwang sich zu einem Lächeln und erklärte: »Ich habe nur das Abendessen für Felix geholt.«
Dani erwiderte das Lächeln nicht, sondern bedachte sie mit einem finsteren Blick. »Lieber Himmel, Steph, immer wenn wir einen Videochat machen, schwirrst du wie ein Schmetterling durch die Gegend«, beklagte sich die blonde Frau, während sich Stephanie auf den Barhocker setzte, den sie nur Minuten zuvor verlassen hatte. »Ich sehe mehr von der Wand hinter dir als dich, wenn ich mit dir chatte.«
»Ich kann nichts dafür, wenn du ausgerechnet dann anrufst, wenn es für Felix und Trixie Zeit fürs Abendessen wird«, gab Stephanie in sanftem Tonfall zurück. »Außerdem kann ich ohne Weiteres mit dir reden und gleichzeitig den Lachs für Felix zubereiten.«
»Wie bereitest du Lachs aus der Konservendose zu?«
»Indem ich die Gräten heraushole«, erklärte sie, während ihr Blick zur Fensterfront im Muskoka-Zimmer zurückwanderte und sie sich fragte, warum sie keine Stimmen mehr hören konnte. Lag es an ihr? Stimmte mit ihr etwas nicht? Oder hatte es ein Gasleck oder etwas Ähnliches gegeben, und alle waren evakuiert worden oder ums Leben gekommen?
»Warum denn das?«, fragte Dani verwundert.
»Warum denn was?«, gab Stephanie zurück und zwang sich dazu, ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Monitor des Laptops zu richten.
»Warum holst du die Gräten raus?«, wollte Dani unüberhörbar ungehalten wissen.
»Oh. Weil er sich daran verschlucken könnte. Und angeblich können die Gräten zerbrechen und zu Verletzungen in der Speiseröhre und im Magen führen«, erklärte sie, während sie überlegte, ob sie Dani etwas vom plötzlichen Verstummen der Stimmen in ihrem Kopf sagen sollte.
»Du weißt aber schon, dass es so was wie Katzenfutter gibt, nicht wahr? Das gibt es auch in Dosen und wird speziell für Katzen produziert. Es kostet deutlich weniger als richtiger Lachs, und Gräten musst du auch nicht mehr herauspulen.«
»Ja, ja«, erwiderte Stephanie gedankenverloren und beschloss, die Sache mit der Stille in ihrem Kopf für sich zu behalten. Zumindest so lange, bis sie dahintergekommen war, was der Grund dafür war und was es für sie bedeuten mochte. Schließlich war es nicht das erste Mal, dass so etwas passierte, und beim letzten Mal war die Erklärung denkbar einfach gewesen. Jemand am anderen Ende des County hatte zu seinem fünfundsiebzigsten Geburtstag eine Party veranstaltet und das ganze Dorf eingeladen. Tatsächlich waren absolut alle hingegangen, sodass in ihrem Kopf eine Stunde lang völlige Ruhe geherrscht hatte. Etwas Ähnliches konnte sich jetzt wiederholt haben, und sie wollte nicht, dass Dani sich unnötig Sorgen um sie machte.
Sie konzentrierte sich wieder auf den Computer, bemerkte den Gesichtsausdruck ihrer Schwester und verzog den Mund. Sie wusste, Danis Bemerkung über Katzenfutter war nur sarkastisch gewesen. Dennoch erwiderte sie: »Katzenfutter stinkt. Ich würde so was nicht essen.«
»Das will ich auch nicht hoffen, schließlich bist du keine Katze«, sagte Dani und zog sie dann auf: »Du bist bloß eine Katzenlady.«
»Katzenladies haben haufenweise Katzen, ich habe nur eine. Und ich habe einen Hund. Also bin ich keine Katzenlady«, stellte Stephanie klar. Während sie die Dose öffnete, wanderte ihr Blick zurück zur Fensterfront. Vom Haus aus konnte sie die Straße nicht überblicken, aber es war auch keine Rauchwolke oder irgendetwas anderes zu sehen, was für die Sterblichen ringsum Anlass gewesen sein könnte, die Flucht zu ergreifen.
»Na ja, du hast zwar jetzt noch nicht haufenweise Katzen im Haus, aber du wohnst ja auch erst seit einem Jahr allein, und die eine Katze, die du hast, verwöhnst du so, wie es eine Katzenlady tun würde«, stellte Dani klar und murmelte vor sich hin: »Lieber Himmel, Lachs!«
»Felix bekommt nicht nur Lachs von mir«, verteidigte sich Stephanie und zwang sich, ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Unterhaltung zu richten und sich so normal wie möglich zu verhalten. »Lachs gibt es nur am Samstag. Das ist so wie der Pizza-Freitag, den wir immer hatten.«
»Ah, ja«, sagte Dani wenig überzeugt. »Und was bekommt der Kater an den anderen Tagen von dir?«, wollte sie wissen.
»Zum Frühstück Rührei, Hüttenkäse und Gemüse, mittags Thunfischbällchen und zum Abendessen einen speziellen Eintopf«, antwortete Stephanie in einem geistesabwesenden Tonfall, da ihr Blick zum Fenster zurückkehrte.
»Ist das dein Ernst? Eier und Eintopf? Das kochst du für diesen Kater?«
Der schrille Tonfall in Danis Stimme bohrte sich in Stephanies Ohr, sodass sie ihren Blick wieder auf den Monitor richtete. Angesichts der verständnislosen Miene ihrer Schwester konnte sie nur die Augen verdrehen. »Viele Leute kochen für ihre Katzen, Dani. Und auch für ihre Hunde.«
»Ach, komm schon«, stöhnte Dani. »Erzähl mir bloß nicht, dass du auch noch für diese Boxerhündin kochst, die du als deine Seelenverwandte bezeichnest!«
Stephanie schaute achselzuckend zu Trixie, die sich vor ihrem Hocker auf den Boden gelegt hatte. Mit einem Fuß strich sie ihr über das dunkle Fell am Rücken und erwiderte: »Okay, ich erzähl’s dir nicht.«
»Oh mein Gott, das tust du tatsächlich!«, rief Dani entsetzt.
»Beim Kochen kann ich entspannen«, sagte Stephanie unbekümmert. »Außerdem bin ich davon überzeugt, dass du für dein Haustier auch kochen würdest, wenn du eines hättest.«
»Schätzchen, ich koche ja nicht mal für Decker«, gab Dani seufzend zurück.
»Aber bestimmt nur, weil du keine Zeit dafür hast, seit du wieder arbeiten gehst«, hielt Stephanie dagegen. Sie beugte sich zur Seite, um den Schrank unter der Kücheninsel zu öffnen, und holte eine Suppenschüssel und einen kleinen Teller heraus. Beides stellte sie auf die Kücheninsel, während sie sich wieder aufrecht hinsetzte. »Ärzte sind vielbeschäftigte Menschen.«
»Oh ja, und wie. Genau das ist es. Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich nicht kochen kann«, sagte Dani in betrübtem Tonfall.
Unwillkürlich musste Stephanie grinsen, als sie die weinerliche Klage ihrer Schwester hörte. Sie nickte zustimmend, während sie die Flüssigkeit aus der Dose in die Schüssel laufen ließ, um dann die Lachsstücke auf den Teller zu kippen. »Stimmt, du kannst ja nicht mal einen Kakao heißmachen, ohne den Wasserkessel zu ruinieren.«
»Ich war neun, als das passiert ist«, konterte Dani. »Um Himmels willen, du warst ja nicht mal auf der Welt, als ich das angestellt habe, und trotzdem bekomme ich das selbst von dir immer wieder aufgetischt. Ich glaube, das ist bei jedem Familientreffen Thema gewesen.«
»Ja, aber wir sind nicht bei unserer Familie, und das heißt, dass wir diese Geschichte nicht mehr zusammen mit all den anderen Anekdoten über die Ausrutscher unserer Geschwister zu hören bekommen«, machte Stephanie klar. »Außerdem bin ich mir sicher, dass du heute weißt, dass man für einen heißen Kakao keinen Wasserkessel mit Milch füllt. Also wird dir das auch nicht noch einmal passieren. Und ich werde es mit der Zeit vergessen … so in hundert Jahren«, zog sie ihre Schwester auf. Dabei musste sie sich zwingen, nicht zum Fenster zu sehen, sondern sich mit dem Lachs zu befassen, der noch in der Form auf dem Teller lag, in der sie ihn aus der Dose gestülpt hatte, und die Gräten herauszupicken. Das war der einzige Grund, weshalb sie nicht besser aufpasste, was sie sagte. Und es war auch der Grund dafür, dass sie einen Moment lang brauchte, ehe ihr auffiel, dass Dani schwieg. Als diese Erkenntnis es schaffte, Stephanies Aufmerksamkeit zu erringen, hob sie den Kopf und stellte fest, dass ihre Schwester sie besorgt ansah. Sie zog die Augenbrauen hoch und fragte: »Was ist?«
Dani zögerte, schließlich fragte sie in ernstem Tonfall: »Ist mit dir alles in Ordnung?«
Stephanie seufzte, da sie genau wusste, was ihre Schwester meinte. Sie hatte es nicht gut aufgenommen, als ihr Leben vor fast dreizehn Jahren komplett auf den Kopf gestellt worden war und man ihr offenbart hatte, dass sie sich von ihrer Familie würde trennen müssen. Zugegeben, zu der Zeit war sie gerade mal vierzehn gewesen. Na ja, eigentlich fünfzehn, aber sie hatte gerade erst Geburtstag gefeiert, als ihr Leben aus den Fugen geraten war, weshalb sie zuweilen meinte, erst vierzehn gewesen zu sein, wenn sie daran zurückdachte. Aber egal, ob nun vierzehn oder fünfzehn, Stephanie war so oder so nicht bereit gewesen, ihre Eltern und all ihre Geschwister zu verlieren. Ihre Familie war groß und der Zusammenhalt sehr stark gewesen, was sie zu einem glücklichen Mädchen gemacht hatte. Daher war es für sie umso schwerer gewesen, das alles aufzugeben.
»Mir geht es gut«, antwortete sie schließlich. Da Danis Miene unverändert besorgt blieb, versicherte sie ihr: »Ja, wirklich. Es geht mir gut. Ich liebe mein neues Zuhause, und es gefällt mir, allein zu leben. Es ist hier wunderschön und ruhig. Hier gibt es alles, was ich brauche. Und was mir fehlt, bestelle ich online und lasse es mir liefern. Es ist einfach toll hier.«
»Und die Stimmen in deinem Kopf? Und die Kopfschmerzen?«, wollte Dani wissen.
»Schon viel besser«, sagte sie, und das war zur Abwechslung mal nicht gelogen. Zumindest war es so lange nicht gelogen, wie sich das Verschwinden der Stimmen in ihrem Kopf nicht als etwas Schlimmes entpuppen würde. Aber letztlich war es auch völlig egal. Sie belog regelmäßig ihre Schwester und jeden anderen, der sich nach ihrem Befinden erkundigte. Würde sie es nicht tun, dann wären alle in Sorge um sie, und das war etwas, was sie nicht wollte. Außerdem waren die »Stimmen in ihrem Kopf«, wie Dani sie bezeichnet hatte, hier draußen mitten im Nichts ohnehin zahlenmäßig deutlich reduziert. Somit traten auch ihre Kopfschmerzen nicht so oft auf, und wenn, dann waren sie nicht ganz so schlimm.
»Gott sei Dank«, hauchte Dani, biss sich dann aber auf die Lippe und fragte: »Aber mit dir ist wirklich alles in Ordnung? Ich meine, du fühlst dich da draußen mitten auf dem platten Land nicht einsam?«
»Wie sollte ich mich hier einsam fühlen? Ich habe Felix und Trixie bei mir. Du meldest dich jeden Samstagmorgen zum Online-Chat. Elvi macht das Gleiche am Sonntag, und meistens sind Victor, Mabel und DJ mit von der Partie. Für den Rest der Woche folgen dann Tiny und Mirabeau, Dree und Harper, Sherry und Basil. Und sogar Marguerite lässt es sich nicht nehmen, sich bei mir zum Online-Chat zu melden. Ehrlich gesagt verbringe ich damit inzwischen so viel Zeit, dass ich allmählich Probleme mit meinen Abgabeterminen bekomme. Einsamkeit ist ganz sicher nicht das Problem«, versicherte sie ihr. Diesmal musste sie aufrichtig lächeln, als sie über die Menschen nachdachte, die praktisch zu ihrer Familie geworden waren.
Tiny McGraw und seine Ehefrau Mirabeau, oder kurz Beau, wie Stephanie sie nannte, hatten sich beide als Eskorte und letztlich als ihre Bodyguards betätigt, als sie sie zu ihrem neuen Zuhause in Port Henry begleitet hatten, nachdem vor fast dreizehn Jahren ihr altes Leben ein abruptes Ende genommen hatte. Nur wenig später waren die beiden für sie zu einer Art älterem Bruder mit Beschützerinstinkt und einer großen Schwester geworden, die alle herumkommandierte. Von da an bis zu dem Tag, an dem sie hierhergezogen war, hatte sie in der Kleinstadt bei Victor und dessen Frau Elvi gelebt, die für sie schon bald zu Ersatzeltern geworden waren. Deren beste Freunde Mabel und DJ waren für Stephanie so etwas wie Tante und Onkel gewesen. Vor dreizehn Jahren hatte sie zwar ihre leibliche Familie verloren, doch in diesen Menschen hatte sie schnell eine neue Familie gefunden. Für jeden von ihnen war es selbstverständlich, sich einmal in der Woche nach ihr zu erkundigen und alles zu tun, was in ihrer Macht stand, um ihr zu helfen.
»Ja, es ist die reinste Hölle, wenn man so beliebt ist«, sagte Dani, die sich in einem Maß entspannt hatte, dass sie wieder in der Lage war, Stephanie hochzunehmen.
Die streckte ihrer Schwester die Zunge raus und wechselte kurzerhand das Thema: »Und? Wie gefällt dir deine Hausarztpraxis?«
»Großartig«, beteuerte Dani und fügte dann leise lachend hinzu: »Richtig gut.«
»Wirklich?«, fragte Stephanie, um sie zum Weiterreden zu animieren. Dani hatte lange und hart dafür gearbeitet, um sich auf Gynäkologie zu spezialisieren, und sie war außer sich gewesen, als ihr Leben aus den Fugen geraten war und sie alles hatte aufgeben müssen, um gemeinsam mit Decker nach dem Angriff unterzutauchen. Den meisten hätte es sicher gefallen, ein paar Jahre lang mit der Liebe ihres Lebens um die Welt zu reisen. Doch Stephanie vermutete, dass das Ganze kein Vergnügen war, wenn man dabei von einem gestörten Irren gejagt wurde.
Diese Angelegenheit hatte aber schon vor einer Weile geregelt werden können, sodass Dani den Beruf wieder hatte aufnehmen können, der ihr so viel bedeutet hatte. Vor Kurzem jedoch war Dani zu dem Schluss gekommen, dass es Zeit wurde für eine Veränderung. Und so waren sie und Decker nach Port Henry umgezogen, wo sie eine Praxis als Ärztin für Allgemeinmedizin eröffnet hatte.
Stephanie empfand das schon als ein bisschen ironisch, denn sie selbst hatte bis vor etwas mehr als einem Jahr noch selbst in Port Henry gewohnt, ehe sie dieses Haus hier gebaut hatte, in das sie dann umgezogen war. Allerdings lag ihr neues Zuhause nur gut fünfundvierzig Autominuten südwestlich von Port Henry entfernt, womit sie beide deutlich näher beieinander wohnten als vor Stephanies Umzug, als Dani noch in Toronto gelebt hatte.
»Eine Praxis für Allgemeinmedizin ist viel interessanter als die Gynäkologie«, sagte Dani und holte Stephanie aus ihren Gedanken.
Die zog die Augenbrauen hoch und fragte: »Weil du jetzt nicht nur Frauen behandelst, sondern auch Männer und Kinder?«
»Das auch. Aber auch die Bandbreite an medizinischen Themen, mit denen ich konfrontiert werde, ist viel größer. Das geht vom eingewachsenen Zehennagel bis zu Pusteln am Hintern«, sagte Dani und musste lachen. »Da fällt mir etwas ein, was heute passiert ist. Also eigentlich gestern, denn wir haben ja jetzt schon frühen Morgen.«
»Erzähl«, forderte Stephanie sie auf, während sie den von allen Gräten befreiten Lachs vom Teller in die Schüssel schob, in der sich die Flüssigkeit aus der Dose befand. Teller und Schüssel stellte sie dann zur Seite.
»Na ja, ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass ich jetzt in einer Kleinstadt arbeite und nicht mehr in der Großstadt. Auf jeden Fall kommt es mir so vor, als wären die Patienten hier viel freundlicher und gesprächiger.«
»Oder es hat damit zu tun, dass keine Patientin ein Schwätzchen mit einer Ärztin halten will, deren Kopf zwischen ihren Beinen steckt, um ihre Gebärmutter zu untersuchen«, meinte Stephanie flapsig.
»Ja, das ist auch möglich«, sagte Dani und wirkte ein wenig überrascht, so als wäre ihr dieser Gedanke noch nie gekommen.
Kopfschüttelnd redete Stephanie weiter: »Egal, erzähl lieber weiter.«
»Richtig. Also, es gibt da eine Patientin im mittleren Alter, eine wirklich reizende Frau. Sie kam letzte Woche in die Praxis, weil sie ein Problem mit Hämorrhoiden hat. Also unterhalte ich mich mit ihr und gebe ihr dann einen Untersuchungskittel. Ich sage ihr, dass sie sich umziehen und sich bäuchlings auf die Behandlungsliege legen und es sich bequem machen soll. Ich würde dann gleich zu ihr kommen. Aber sie nimmt den Kittel schnaubend an sich und sagt: »›Doc, ich trage zwei Verkehrskegel mit mir herum, die sich Brüste nennen. Versuchen Sie mal, auf dem Bauch zu liegen und es sich dabei bequem zu machen.‹«
Stephanie sah sie mit großen Augen an, begann zu lachen und schüttelte erneut den Kopf. »Ich wünschte, ich hätte das Problem.«
»Von wegen«, wiegelte Dani sofort ab. »Auf die Rückenschmerzen kannst du gut verzichten.«
»Die Nanos würden dafür sorgen, dass wir gar keine Rückenschmerzen bekommen, Schwesterchen«, konterte sie.
»Okay, kann sein …« Dani zuckte hilflos mit den Schultern.
»Aber es ist lieb von dir, das zu sagen, damit ich mich besser fühle«, sagte Stephanie und sah nach unten auf ihre fast platten Brüste unter dem locker sitzenden, langärmeligen graublauen Pulli, den sie an diesem Morgen trug. In Sachen Brüste war sie etwas zu kurz gekommen, und ganz so platt war sie eigentlich auch nicht, aber ihre B-Körbchen wirkten neben Danis Oberweite schon verschwindend klein. Auch in Sachen Hüften hatte sie nicht viel vorzuweisen, ganz im Gegensatz zu ihrer älteren Schwester. Neben dem kurvigen Körper ihrer Schwester wirkte sie wie ein schmaler, hochgeschossener Teenager. Als sie noch jünger gewesen war, hatte sie das enorm gestört, vor allem dann, wenn die Leute zu ihnen sagten, sie beide würden sich ja so ähnlich sehen. Tatsächlich galt das nur für ihre Gesichter und die Haare. Beide waren sie blond, beide trugen sie die Haare lang. Ihre ovalen Gesichter wiesen makellos gerade, kleine Nasen und volle, breite Lippen auf. Und sie hatten beide auffallend große Augen, wobei die von Stephanie silbrig-grün und von Dani silbrig-blau waren.
Als sie noch jünger gewesen war, hatte sich Stephanie immer auf den Tag gefreut, an dem sie auch solche Kurven bekommen würde wie ihre Schwester … aber das Warten darauf hatte sie vor langer Zeit aufgegeben.
»Kein Problem«, sagte Dani unbekümmert. »Aber wenn ich so richtig dafür hätte sorgen wollen, dass du dich besser fühlst, dann hätte ich darauf hingewiesen, dass du die Figur eines Models hast und tragen kannst, was du willst, weil dir alles gut steht. Während ich in der falschen Kleidung fett aussehe, auch wenn ich weiß, dass ich das nicht bin. Allerdings«, fügte sie sarkastisch an, »ist das für mein eigenes Selbstwertgefühl nicht gerade erbaulich, darum werde ich darauf nicht zu sprechen kommen.«
Stephanie musste grinsen, als sie das hörte. Dann aber versteifte sie sich und sah zum Überwachungsmonitor, da mehrere helle Warntöne erklangen.
»Was ist los?«, fragte Dani, der Stephanies Reaktion nicht entgangen war.
»Der Alarm für die Zufahrt wurde ausgelöst«, murmelte Stephanie, stand auf und ging zum anderen Ende der Küche, um aus dem Fenster im angrenzenden Muskoka-Zimmer – einer Art Wintergarten – einen Blick nach draußen zu werfen. Es war kurz nach sechs am Morgen, und da es Ende Mai war, hatte die Sonne vor einer halben Stunde begonnen, sich über den Horizont zu erheben. Doch obwohl der Himmel heller geworden war, half ihr das nicht weiter. Noch vor zwei Wochen hätte sie um diese Zeit zwischen den kahlen Ästen der Bäume hindurch den Bereich der Grundstückszufahrt sehen können. Jetzt dagegen standen alle Bäume und Büsche auf dem Anwesen in voller Blüte. Und da Nachtsicht nichts mit Röntgenblick zu tun hatte, konnte sie beim besten Willen nichts sehen.
Etwas Warmes drückte sich gegen ihr Bein. Als sie nach unten sah, entdeckte sie Trixie, die ihr gefolgt war. Die Verärgerung über die versperrte Sicht war im gleichen Moment vergessen, als sie die Hündin liebevoll tätschelte, während sie ihr schwarz-weiß-beiges Gesicht betrachtete. Dann nahm sie sie mit zum Überwachungsmonitor in der Küche, der acht kleine Bilder zeigte.
Nur beiläufig nahm sie wahr, dass die Hündin zu ihrem Platz vor dem Hocker zurückgekehrt war, als sie vor dem Monitor stehen geblieben war. Ihre Aufmerksamkeit galt vor allem der Maus, mit der sie das Bild vergrößerte, das das Tor an der Einfahrt zum Grundstück zeigte.
Das gesamte sechzehn Hektar große Areal mit zwei Häusern und einem acht Hektar großen Teich zwischen ihnen war von einem über zwei Meter hohen, schwarzen Metallzaun umgeben. Lediglich die Einfahrt bestand aus einem schwarz lackierten Metalltor, das elektrisch betrieben und per Fernbedienung bewegt wurde. Außerdem ließ es sich auch öffnen, wenn man an der Tastatur am Tor einen Sicherheitscode eingab. Da sie es versäumt hatte, zuerst aus einem der nach vorne gehenden Fenster zu sehen, hatte sie nun verpasst, wer auf das Grundstück gekommen war. Ein Fahrzeug war noch nirgends zu entdecken, und das Tor schloss sich gerade wieder.
Stephanie schaltete zügig von einer Kamera zur nächsten und stoppte, als sie auf einem der Bilder eine Bewegung ausmachte. Es war die Kamera, die die Garagentore am Haus von Drina und Harper auf der anderen Seite des Grundstücks erfasste. Das Tor der Garage, die Drina üblicherweise benutzte, stand ein Stück weit offen. Nein, bei genauerem Hinsehen konnte sie feststellen, dass das Tor zu drei Vierteln geschlossen war und noch weiter nach unten fuhr. Sie konnte gerade noch einen Teil des Motorrads sehen, ein Paar Bikerstiefel und den Saum von etwas, das nach einem langen Mantel aussah. Dann hatte sich das Tor schon wieder geschlossen.
»Ich glaube, jemand hat soeben sein Motorrad in die Garage von Drina und Harper gefahren«, sagte sie beunruhigt und schaltete zu den acht Kamerabildern zurück. Da keines von ihnen noch etwas Interessantes zeigte, wandte sie sich ab und wirkte unentschlossen, was sie nun tun sollte. Sollte sie herausfinden, wer der Unbekannte war? Sollte sie Drina anrufen und fragen, ob sie jemanden erwartete? Oder sollte sie …?
»Ach, Mist, ja. Das ist Thorne«, rief Dani und riss Stephanie aus ihren Gedanken.
Stephanie kehrte zur Kücheninsel zurück und setzte sich wieder auf den Hocker, wobei sie in erster Linie darauf achtete, dass sie nicht versehentlich Trixie trat.
Nachdem sie Platz genommen hatte, grübelte sie über den Namen Thorne nach. Aus unerfindlichen Gründen kam er ihr vage vertraut vor, doch sie wusste nicht, wo ihr der Name schon einmal untergekommen war.
»Tut mir leid«, sagte Dani. »Drina wollte dich anrufen, aber ich habe ihr gesagt, dass ich dich darauf ansprechen würde, weil wir samstags üblicherweise unseren Chat abhalten.« Dann verzog sie den Mund und fuhr fort: »Ich schätze, darauf hätte ich dich gleich als Erstes ansprechen sollen. Allerdings dachte ich auch, dass er frühestens in einer Stunde hier auftaucht.«
»Okaaaay«, erwiderte Stephanie gedehnt. »Jetzt reden wir aber drüber, und dann kannst du mir auch gleich verraten, warum Thorne bei Drina und Harper ist.«
»Weil er für eine Weile ein Dach über dem Kopf braucht«, sagte Dani ein wenig betreten und fügte beim Anblick von Stephanies versteinerter Miene hastig hinzu: »Wenn es für dich ein Problem ist, dass er bei ihnen im Haus ist, dann werden wir natürlich etwas anderes für ihn arrangieren.«
Stephanie hatte die Augenbrauen bereits hochgezogen, als sie hörte, dass überhaupt in Erwägung gezogen worden war, jemanden hier im Haus von Drina und Harper mitten im Nichts einzuquartieren. Das Paar hatte noch niemals irgendwen bei sich wohnen lassen, wenn sie nicht selbst daheim waren. Und die wenigen Male, bei denen sie überhaupt jemandem eine Übernachtung erlaubt hatten, ließen sich an den Fingern einer Hand abzählen. Genau genommen brauchte man dafür nur zwei Finger. Einmal hatten Elvi und Victor da übernachtet, das andere Mal waren es Tiny und Beau gewesen. Harper und Drina, die für Stephanie nach Elvi und Victor ein zweites Paar Adoptiveltern darstellten, verstanden sich darauf, sich »keine Leute aufzuhalsen«, wie Drina es einmal ausgedrückt hatte. Das machte diesen plötzlichen Sinneswandel umso auffälliger.
»Aber ich hoffe sehr, dass das für dich kein Problem darstellen wird«, fügte Dani an, deren Stimme nach Entschuldigung und dringender Bitte zugleich klang.
Stephanie vermutete, dass ihre Augenbrauen nicht noch weiter nach oben wandern konnten. Aber es waren dieser flehende Tonfall ihrer Schwester und der dazugehörige Gesichtsausdruck, der sie so ungläubig reagieren ließ. Es war nicht zu übersehen, dass es für Dani aus irgendeinem Grund sehr wichtig war, diesen Thorne bei Drina und Harper wohnen zu lassen. Sie selbst konnte keine Erklärung dafür finden, also fragte sie: »Und warum ist das für dich so wichtig?«
»Weil ich wirklich nicht weiß, wo er perfekter untergebracht sein könnte als da, solange er sich in Kanada aufhält«, räumte sie ein und klang niedergeschlagen. »Decker und ich sind alle Möglichkeiten durchgegangen. Überall da, wo Menschen sind, kann er nicht hin. Dann wäre Thorne gezwungen, die ganzen Wochen oder Monate im Haus zu verbringen, solange er hier ist. Für seine geistige Verfassung wäre das gar nicht gut, und es wäre auch nicht fair ihm gegenüber. Er muss weit weg von anderen Menschen sein, damit er das Haus verlassen kann, ohne fürchten zu müssen, dass ihn jemand sieht. Damit blieben uns nicht viele Möglichkeiten zur Auswahl«, betonte sie. »Ich will sagen, Decker und ich hatten sogar überlegt, ein Haus zu kaufen, aber es stand nichts zum Verkauf, das in puncto Sicherheit, Abgeschiedenheit und Schönheit mit euren Häusern hätte mithalten können. Jedenfalls kein bezugsfertiges Haus. Hätten wir mehr Zeit gehabt, dann hätten wir vielleicht ein Haus bauen können. Aber so …« Hilflos schüttelte sie den Kopf. »Ich wollte nur …«
»Ist schon gut«, unterbrach Stephanie sie geduldig, da sie das Gefühl bekam, dass ihre Schwester noch endlos lange so weiterreden würde, ohne auf das eigentliche Thema zu sprechen zu kommen. »Ich habe begriffen, dass das für dich wichtig ist. Warum sagst du mir nicht einfach, wer Thorne ist und warum er hier in Kanada einen abgeschiedenen, ruhigen Ort braucht. Dass er nicht von hier ist, das ist schon mal offensichtlich.«
»Oh.« Dani legte die Stirn in Falten und zögerte kurz. Als sie endlich zum Reden ansetzte, wirkte es so, als würde sie nur widerwillig antworten und dabei ihre Worte sehr überlegt wählen. »Thorne stammt von Dresslers Insel.«
Abrupt setzte sich Stephanie auf ihrem Hocker kerzengerade hin. »Dressler? Der verrückte Wissenschaftler, der unsere Leute entführt und sie Experimenten ausgesetzt hat? Die Insel dieses Dressler?«, fragte sie voller Sorge, ohne jedoch ihre eigene Begegnung mit dem Mann sieben Monate zuvor zu erwähnen. Dani war völlig ausgerastet, als sie davon erfahren hatte, was geschehen war. Dass Decker nur knapp einer Explosion entkommen und dass auf Stephanie geschossen worden war, hatte sie in einen Zustand blanken Entsetzens versetzt. Stephanie und Decker hatten Wochen gebraucht, um sie wieder zu besänftigen. Sie hatten es nicht gewagt, ihr die Identität des Mannes zu verraten, und das hatte sie auch jetzt noch nicht vor. Es gab keinen Grund, sie jetzt schon wieder in Aufregung zu versetzen.
»Ja«, antwortete Dani leise.
Stephanie biss sich auf die Lippe, da sie wusste, dass es ihrer Schwester nicht gefallen würde, über dieses Thema zu reden. Sowohl Dani als auch Decker hatten zu dem Team gehört, das nach Venezuela gereist war, um bei der Suche nach Dressler und den Unsterblichen zu helfen, die er entführt hatte, um an ihnen Experimente vorzunehmen. Dani war mitgekommen, um jede erdenkliche medizinische Unterstützung zu leisten, während Decker mit den anderen Jägern auf die Suche nach Dr. Dresslers geheimem Labor gegangen war. Doch bei der Jagd auf ihn war schnell einiges schiefgegangen, und etliche Mitglieder der Suchteams waren in Gefangenschaft geraten – darunter auch Decker.
Stephanie wusste, ihre Schwester hatte das Entsetzen und die Verlustangst noch immer nicht ganz verarbeitet, von der sie heimgesucht worden war, als Decker auf einmal als vermisst gegolten hatte. Das bedeutete für Stephanie, dass sie behutsam vorgehen musste. Sie überlegte noch, in welche Richtung sie die Unterhaltung wohl am besten lenken sollte, da sagte Dani von sich aus: »Thorne war eines von Dresslers genetischen Experimenten.«
»Verstehe«, flüsterte Stephanie und rief sich ins Gedächtnis, was sie über diese Experimente gehört hatte. Bevor Dressler von der Existenz von Unsterblichen gewusst und seine Interessen darauf gerichtet hatte, diese Menschen zu entführen und mit genmanipulierten Nanos zu quälen, die ihre Wirte in Vampire verwandelten, war er damit beschäftigt gewesen, sich rücksichtslos auf dem Gebiet der Genetik auszutoben. Jahrzehnte hatte er damit verbracht, die DNA der verschiedensten Tiere in menschliche Eier oder Föten einzupflanzen. Ob es das eine oder das andere war, wusste Stephanie nicht so genau, da sie sich nie die Mühe gemacht hatte, sich mit der Wissenschaft hinter dem zu befassen, womit er sich beschäftigte. Die Resultate waren jedenfalls neue Versionen alter mythologischer Kreaturen wie Meerjungfrauen und Zentauren. Das warf die Frage auf, welche Mischung dieser Thorne darstellte. Es musste etwas deutlich Sichtbares sein, wenn sie ihn irgendwo einquartieren mussten, wo ihn niemand sehen konnte.
»Er möchte, dass ihm die Flügel abgenommen werden«, sagte Dani in diesem Moment.
Stephanie nahm den Kopf ein wenig nach hinten und riss die Augen auf, als ihr der Name mit einem Mal etwas sagte. »Thorne war doch der, der ans Festland geflogen ist und Lucian und euch alle zur Insel geführt hat. Er hat euch geholfen, Decker und die anderen zu retten.«
»Richtig«, murmelte Dani und ließ die Schultern sinken. »Ich glaube, ohne ihn hätten wir die Insel nicht gefunden und somit Decker und die anderen auch nicht befreien können. Sie wären jetzt noch immer Dresslers grausamen Experimenten ausgesetzt.«
Stephanie nickte und verstand Dani jetzt besser. Die hatte das Gefühl, dass sie Thorne etwas schuldig war, und Stephanie konnte dem nur zustimmen. Sie alle waren Thorne eine ganze Menge schuldig, und das nicht nur, weil Decker gerettet werden konnte. Schließlich war er nicht der einzige Unsterbliche, der bei der Suche nach Dressler in Gefangenschaft geraten war. Vielen war es so ergangen, doch für Stephanie waren neben ihrem Schwager Decker vor allem Victor Argeneau und Mirabeau La Roche von Bedeutung gewesen. Beide waren für sie heute Teil ihrer Familie, zudem war Beau für Stephanie eine Art Mentorin gewesen, als die begonnen hatte, mit den Vollstreckern auf die Jagd nach Abtrünnigen zu gehen, die gegen die Gesetze verstießen. So hatte es auch Beaus Kollegin Eshe Argeneau gemacht, die ebenfalls zu denen gehört hatte, die Dressler in seine Gewalt hatte bringen können.
»Natürlich kann Thorne bleiben. Er hat uns geholfen, und jetzt helfen wir ihm«, sagte Stephanie nachdrücklich. Ihr entging nicht die plötzliche Erleichterung, die sich auf dem Gesicht ihrer Schwester abzeichnete. »Du hast gesagt, er möchte sich die Flügel abnehmen lassen?«
»Ja, er will ein normales Leben führen können«, erklärte Dani. »Mit diesen Flügeln kann er die Insel nicht verlassen und irgendwo leben, wo andere Menschen sind. Wenn ihn jemand sehen würde …«
»Dann wird er den Rest seines Lebens in einem Geheimlabor der Regierung verbringen, wo man alle möglichen Experimente an ihm durchführen wird«, folgerte Stephanie mit ernster Miene.
»Zweifellos«, stimmte Dani ihr zu.
Stephanie nickte. »Und? Werdet ihr denn in der Lage sein, ihm die Flügel zu amputieren?«