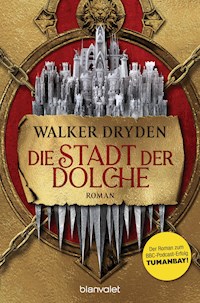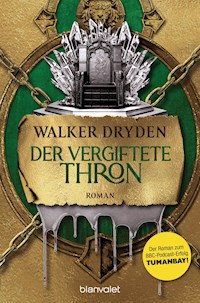
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Tumanbay-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die Fortsetzung der fesselnden Tumanbay-Saga, basierend auf dem preisgekrönten BBC-Podcast.
Willkommen in Tumanbay, einst der Sitz eines mächtigen Sultans – jetzt liegt die Stadt in Ketten. Denn der Herrscher über Tumanbay ist tot, sein gefürchtetes Heer wurde vernichtet. Nun regiert eine Frau die prächtigste Stadt der Welt, die geheimnisumwitterte Königin Maya. Doch wo ist die grausame Feldherrin, und warum zeigt sich Maya den Unterworfenen nicht? Während sich die mächtigsten Männer der Stadt vor dem fanatischen Maya-Kult in Sicherheit bringen, regt sich auch Widerstand. Denn der Thron von Tumanbay ist kein Machtsitz, er gleicht eher einem Todesurteil ...
Alle Bänder der Tumanbay-Saga:
1. Die Stadt der Dolche
2. Der vergiftete Thron
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 637
Ähnliche
Buch
Willkommen in Tumanbay, einst der Sitz eines mächtigen Sultans – jetzt liegt die Stadt in Ketten. Denn der Herrscher über Tumanbay ist tot, sein gefürchtetes Heer wurde vernichtet. Nun regiert eine Frau die prächtigste Stadt der Welt, die geheimnisumwitterte Königin Maya. Doch wo ist die grausame Feldherrin, und warum zeigt sich Maya den Unterworfenen nicht? Während sich die mächtigsten Männer der Stadt vor dem fanatischen Maya-Kult in Sicherheit bringen, regt sich auch Widerstand. Denn der Thron von Tumanbay ist kein Machtsitz, er gleicht eher einem Todesurteil …
Autoren
Walker Dryden ist das Pseudonym für das Autorenduo Mike Walker und John Scott Dryden. In den letzten Jahren haben die beiden zusammengearbeitet, um die Welt von Tumanbay zum Leben zu erwecken.
John Scott Dryden ist ein preisgekrönter Autor und Regisseur. Er schuf die populäre Podcast-Serie Passenger List und hat viele Hörspielserien für die BBC geschrieben und inszeniert.
Mike Walker hat Serien über die Caesars, Plantagenets, Stuarts und Romanows für die BBC geschrieben sowie eine Reihe von Stücken sowie einen Thriller.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlagund www.facebook.com/blanvalet.
Walker Dryden
DER VERGIFTETETHRON
ROMAN
Deutsch von Urban Hofstetter
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »The Poison Throne« bei Orion, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © John Dryden and Mike Walker 2021
Based on the BBC Radio 4 radio series Tumanbay
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2022 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Catherine Beck
Umschlaggestaltung: Anke Koopmann | Designomicon
Umschlagmotive: Shutterstock.com (Kostsov; Lia Koltyrina; Picsfive; T Studio; Dim Dimich; mexrix)
BL · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27454-2V001
www.blanvalet.de
MWFür Isolde & AugustineJSDFür meine Mutter Josephine, die uns zu vielen Abenteuern mitgenommen hat, und für meinen Vater Bill, wegen seiner unkonventionellen Weisheit.
»Im Laufe seiner Audienz fragte mich der Sultan: ›Hast du je einen Stein gesehen, der vom Himmel fiel?‹ Ich erwiderte: ›Nein, und ich habe auch noch nie von einem gehört.‹ ›Nun‹, sagte er, ›vor unserer Stadt ist einer vom Himmel gefallen.‹ Er ließ den Stein von ein paar Männern hereintragen. Er war groß und glitzerte schwarz. Ich schätzte sein Gewicht auf einen Zentner. Der Sultan ließ vier Steinmetze kommen, die auf sein Kommando hin viermal gleichzeitig mit Eisenhämmern auf den Brocken einschlugen, doch zu meiner Verblüffung hinterließen sie keine Spuren auf seiner Oberfläche. Er befahl, den Stein wieder an seinen Aufbewahrungsort zurückzubringen.«
Ibn Batuta, Reisender, 1304 – 1369
»Die Seele nimmt die Farbe ihrer Gedanken an.«
Mark Aurel, römischer Kaiser und Stoiker, 121 – 180
Dramatis Personae
Maya: die mysteriöse Führerin eines brutalen Regimes, das das Reich erobert hat.
Effendi Rot: Regent von Tumanbay und Mayas Vertreter in der Stadt.
Barakat: der Inquisitor. Ein Priester, der von Maya beauftragt wurde, die Ketzer und Ungläubigen aufzuspüren.
Madu: der nominelle Sultan von Tumanbay und Neffe des ermordeten Sultans al-Ghuri.
Dorin: ein Arzt und Leiter des alten und verehrten Medizinischen Instituts der Stadt.
Gregor: ehemaliger Meisterspion und Kommandeur der aufgelösten Palastwache.
Cadali: ehemaliger Großwesir des Sultans. Wie Gregor hat er dem neuen Regime die Treue geschworen.
General Qulan: ehemaliger Kommandeur der Streitkräfte von Tumanbay und Gregors Adoptivbruder.
Manel: Qulans jugendliche Tochter.
Pushkarmi: Manels Mutter und Qulans Ehefrau.
Ibn Bai: ein Sklavenhändler und Sammler antiker Schriften.
Himmel: Ibn Bais Tochter. Sie erwartet ein Kind von:
Akiba: Prinz eines eroberten Landes und ehemaliger Sklave.
Alkin: eine Gelehrte, Ärztin und Reisende.
Der Hafiz: eine einflussreiche religiöse Symbolfigur in Tumanbay.
Bello: ein Priester und der persönliche Gehilfe des Hafiz.
Sarah: eine Spionin, die als Sklavin nach Tumanbay kam und Maya dabei half, die Stadt zu erobern. Sie ist die Frau von Effendi Rot.
Daniel: ein General in Mayas Armee, der ursprünglich als Sklave und Sarahs angeblicher Bruder nach Tumanbay kam.
Prolog
Ein gewöhnlicher Mann, vielleicht etwas kleiner als die meisten. Er trug einen unauffälligen braunen Kaftan, dazu Sandalen, die alles andere als neu waren, und hinkte merklich beim Gehen. Auf seinem Gesicht lag ein leises Lächeln, als ginge ihm gerade eine angenehme Erinnerung durch den Kopf. Hinter ihm Soldaten, bewaffnet und in Rüstung. Auf den ersten Blick war nicht zu erkennen, ob sie den kleinen Mann eskortierten oder abführten. Erst als er einen Moment lang an einer Kreuzung stehen blieb und die Soldaten Haltung annahmen, wurde klar, dass er ihr Befehlshaber war. Nachdem er erst in die eine, dann in die andere Richtung geblickt hatte, zog er ein Pergament aus dem Ärmel und studierte es. Schließlich hielt er, gefolgt von seiner sechsköpfigen Eskorte, auf die eleganten Häuser des Bulpassviertels zu. Während sie die Straße entlangliefen, machten die Passanten und Händler vor ihnen eilig den Weg frei und ließen sich erst wieder blicken, sobald die kleine Gruppe vorübergezogen war.
Sie waren so sehr auf ihr Ziel konzentriert, dass sie ihren Verfolger nicht bemerkten. Möglicherweise war es ein Bettler oder ein Ladenbesitzer, der wegen Wucherei mit Mayas Ordnungshütern in Konflikt geraten war. Er hielt sich bewusst ein ganzes Stück hinter ihnen und verbarg das Gesicht unter einer Kapuze.
Nach einer Weile blieb der kleine Mann vor einem imposanten Haus stehen und betätigte den verzierten Türklopfer, der den Eigentümer des Gebäudes als Olivenimporteur auswies.
Die Tür ging einen Spalt auf, und eine Dienerin lugte heraus.
»Friede sei mit dir«, grüßte der Mann sie freundlich.
»Und mit dir, Effendi.«
»Es tut mir leid, dass ich so spät am Nachmittag noch störe, aber ist dein Herr zu Hause?«
»Er ruht sich aus. Ich kann …«
Der kleine Mann hob eine Hand. »Lass ihn nur. Ich möchte mit dem Kind sprechen, das hier wohnt.«
Die Dienerin riss die Augen auf.
»Keine Sorge, es geht nur um eine Kleinigkeit.« Als er einen Schritt auf die Tür zu machte, öffnete die Dienerin sie unwillkürlich ganz, und er trat mit zwei seiner Männer ein. Die übrigen blieben auf der Straße zurück.
Anstatt zu ruhen, stand der Hausherr hinter der Tür, wo er offenbar dem Wortwechsel gelauscht hatte. »Ihr wollt mit meinem Sohn sprechen? Er betet gerade.«
Der kleine Mann verschränkte die Hände vor der schmalen Brust. »Gut, dann warte ich, wenn es recht ist. Entschuldige bitte meine Eskorte. Ich bin zu Fuß vom Palast hergekommen, und heutzutage … Nun ja, ich fürchte, es muss sein.« Er lächelte entschuldigend und drehte sich zu der Frau um, die nun den Raum betrat.
»Wo hast du nur deinen Kopf?«, schimpfte sie ihren Gemahl. »Du kannst einen frommen Mann doch nicht stehen lassen und ihm keine Erfrischungen anbieten.« Sie kniete sich hin und berührte die Füße ihres Gasts. »Es ist eine Ehre, dich in unserem Haus zu haben, Heiligkeit. Willst du etwas essen oder trinken? Du musst …«
»Wir brauchen nichts«, erwiderte er und berührte ihren Kopf. »Schwester, bitte mach dir … Aaaah.« Ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus, als er den Jungen bemerkte, der durch die Tür auf der anderen Seite des Zimmers lugte. »Das muss euer Sohn sein. Komm, Kind, du musst keine Angst haben.«
Der Junge schob sich zögernd durch den Türspalt. Sein Vater eilte zu ihm und führte ihn an der Schulter in den Raum.
Der kleine Mann nahm auf einer Sitzbank Platz und klopfte auf das Kissen neben ihm. »Komm, setz dich zu mir. Wir müssen uns unterhalten.«
»Setz dich zu dem Heiligen Vater, Malik«, sagte die Mutter und verließ den Raum.
Der Junge sah zu den Soldaten, die an der Wand standen.
»Ach, mach dir wegen denen keine Gedanken, Malik«, sagte Barakat. »Man lässt mich nur aus dem Palast, wenn ich sie mitnehme. Kannst du dir das vorstellen?« Er gluckste.
Über das Gesicht des Jungen huschte ein Lächeln, während er Platz nahm.
»Sehr schön. Sag mal, wie gefällt es dir in der Schule?«
»Ganz gut …«, murmelte der Junge schüchtern.
»Ah, du hast Glück. Ich hatte nicht so eine gute Ausbildung wie du. Erzähl mir von deinem Lehrer.«
Stille senkte sich über den Raum. Nur das Ticken einer Uhr war zu hören, eine jener modernen Apparaturen, die von jenseits des Mittelmeers importiert wurden. Sie waren bei den Kaufleuten sehr beliebt, doch der Vater sah aus, als wünschte er sich, er hätte dieses Ding nie entdeckt oder könnte es jetzt einfach aus dem Zimmer werfen.
»Wie nennst du ihn?«
»Meister Odot.«
»Meister Odot. Gut, gut … Und lehrt dich Meister Odot die Heilige Schrift? Erklärt er dir, dass sich ein junger Mann an Gottes Gesetze halten muss?«
»Ja.«
Barakat neigte den Kopf zur Seite und betrachtete das Kind mit zusammengekniffenen Augen. »Ich habe gehört, dass er auch andere Dinge sagt.«
Der Junge errötete. Er sah zu seinem Vater hinüber, der ihm aufmunternd zunickte. »Erzähl dem Heiligen Vater alles, Malik. Du hast nichts zu verbergen.«
Seine Mutter kehrte in den Raum zurück, gefolgt von einem Diener, der ein Tablett voller Erfrischungen trug. »Nun denn, Heiligkeit, bitte beleidigt uns nicht, indem Ihr unsere Gastfreundschaft ausschlagt. Es ist heiß und …«
»Nein«, fuhr Barakat sie an.
»Aber Ihr müsst doch …«
»Ich habe Nein gesagt!« Er winkte sie weg, ohne den Blick von dem Jungen zu wenden. »Stell dich neben deinen Gemahl«, befahl er. »Und schick den Diener fort.«
Sie sah ihren Mann beunruhigt an und nickte dem Diener zu, der daraufhin den Raum verließ.
»Du wirkst besorgt, Malik«, sagte Barakat. Nun klang seine Stimme wieder freundlich. »Aber das ist nicht nötig. Weißt du, was uns stark macht? Mit stark meine ich, dass wir keine Angst davor haben, was uns zustoßen könnte.«
Der Junge schüttelte den Kopf.
»Nein? Die Wahrheit macht uns stark. Gott hat sie uns geschenkt. Deswegen bin ich, Barakat, dafür bekannt, dass ich nie lüge. Niemals. Das ist meine Stärke. Das kann auch deine Stärke sein. Verstehst du mich?« Er machte eine Pause. Offensichtlich wartete er auf eine Antwort. Schließlich nickte der Junge.
»Wir haben unseren Sohn dazu erzogen, immer die Wahrheit zu sagen, Heiligkeit«, warf der Vater ein. »Nicht wahr, Malik? Sei nicht so verstockt … sag es ihm.«
»Mir ist zu Ohren gekommen«, sagte Barakat an die Eltern gewandt, »dass es in der Schule eures Sohns einen Ketzer gibt.« Seine Worte klangen fast bedauernd.
»Ich schwöre, dass wir beide nichts davon wissen«, platzte die Mutter heraus.
»Natürlich. Woher auch? Ihr seid nicht dazu ausgebildet, die Wahrheit zu erkennen. Wenn ihr eure Kinder an die Schule schickt, erwartet ihr, dass die Lehrer ihnen den rechten Pfad weisen. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Nicht jeder ist das, was er zu sein scheint.«
»Wollt Ihr damit sagen, dass der Lehrer unseres Sohns …?«
Barakat nickte traurig. »Er war zu Besuch.«
»Wie bitte?«
»In diesem Haus.«
»Ähm, Malik ist nicht mitgekommen … bei den Rezitationen. Wir haben seinen Lehrer für die Nachhilfe bezahlt …«
»Natürlich, ich verstehe.« Barakat nahm die Hand des Kindes in seine. »Wenn nur alle Eltern so gewissenhaft wären. Dann hätte ich in Tumanbay keine Arbeit.«
»Wenn unser Kind irgendetwas falsch gemacht hat«, rief die Frau aufgebracht, »dann sag es uns, und wir verpassen ihm eine Tracht Prügel!«
Barakat drehte sich zu dem Jungen um, den er nach wie vor an der Hand festhielt. »Heute waren Soldaten in deiner Schule und haben nach deinem Lehrer gesucht. Wo war er?«
Der Junge presste das Kinn auf die Brust und kniff die Augen zusammen, als versuchte er, die ganze Welt auszusperren.
»Hat ihm jemand verraten, dass die Soldaten kommen würden?« Er drückte dem Jungen beruhigend die Hand. »Du kannst es mir sagen, Malik. Ich weiß es bereits. Ich weiß alles. Du musst es mir nur noch sagen, damit ich erkenne, dass du ein guter Junge bist. Du weißt, wohin Meister Odot gegangen ist, nicht wahr?«
»Nein, das ist nicht … Woher soll er das wissen?«, jammerte seine Mutter.
Barakat beugte sich dicht zu dem Jungen und flüsterte: »Ich gebe dir eine Chance, dich selbst zu retten, Malik«, flüsterte er. »Wir wissen bereits alles.«
»Er ist doch noch ein Kind«, stieß die Mutter unter Tränen hervor.
»Jedes Kind, jeder Lehrer an jeder Schule, jede einzelne Seele ist uns wichtig, besonders wenn sie noch so jung ist wie deine.«
Malik begann zu schluchzen. Er atmete schwer, und seine Schultern zuckten.
»Du bist aufgeregt. Das ist ganz natürlich. Du versuchst, dich vor Gott zu verstecken, aber das schafft niemand. Er blickt durch meine Augen. Du weißt, wie du dich retten kannst. Ich frage dich also noch einmal: Wo ist dein Meister?«
Mit einem Mal schien sich der Junge zu beruhigen. Ohne ein Wort zu sagen, hob er den Kopf, schlug die Augen auf und sah Barakat ins Gesicht. Dann hob er den Arm und deutete auf die Tür, durch die er eingetreten war.
Barakat nickte. Die Soldaten liefen aus dem Raum.
»Nein«, sagte seine Mutter. »Er ist verwirrt. Ihr bringt ihn ganz durcheinander.« Sie klammerte sich an den Arm ihres Gemahls, als würde sie sonst zusammenbrechen.
Barakat ließ die Hand des Jungen los und stand langsam auf. Es war deutlich zu hören, wie die Soldaten das Nachbarzimmer durchstöberten. Sie kippten Möbel um und rissen Schränke auf …
Einen Moment später kehrten sie zurück. »Nichts, Eure Heiligkeit.«
Die Eltern stießen den angehaltenen Atem aus.
Barakat deutete auf die Haustür, einer seiner Männer öffnete sie. Die Soldaten, die auf der Straße gewartet hatten, traten zusammen mit einem Mann ein, der einen Lehrerkaftan trug und sich heftig in ihrem Griff wand. Er flehte um Gnade und stieß einen unartikulierten Angstschrei aus.
»Er ist hinten aus einem Fenster geklettert, Eure Heiligkeit. Genau wie Ihr es vorausgesagt habt.«
Die Mutter lief zu ihrem Sohn.
Barakat sah einen Moment lang gleichgültig zu, wie sie ihn umarmte und ihm mit den Fingern durch die Haare fuhr. »Nehmt die Eltern auch mit«, sagte er schließlich.
Drei Soldaten waren nötig, um die Mutter von ihrem Kind zu trennen. Der Vater starrte unterdessen wie betäubt die Uhr an, als wäre sie für ihr Unglück verantwortlich.
»Und das Kind?«, fragte einer der Soldaten.
»Lasst ihn hier. Er hat sich gerettet.« Barakat nahm noch einmal kurz wie ein freundlicher Onkel neben Malik Platz. »Siehst du? Gott passt auf – er passt auf uns alle auf. Und die Wahrheit befreit dich.« Dann erhob er sich und humpelte gemeinsam mit seinen Männern und den Gefangenen in die Nachmittagssonne hinaus.
Hinter dem knorrigen alten Feigenbaum auf der anderen Straßenseite beobachtete Gregors verhüllte Gestalt die traurige Prozession. Maya war nach Tumanbay gekommen, und der Inquisitor Barakat war ihr Werkzeug. Dieser schmächtige Mann personifizierte ihre Macht. Zum ersten Mal seit seiner Kindheit verspürte Gregor Angst.
»Die Wahrheit kann dich befreien«, murmelte er. »Vielleicht wird Barakats Wahrheit mich aber auch vernichten …«
TEIL 1
Weit weg von hier steht eine Stadt …
Meine Eltern haben oft über sie gesprochen, als hätte sie schon immer existiert und als würde es sie ewig geben …
Ich hatte diesen reichsten und mächtigsten Ort der Welt auf Gemälden gesehen und Geschichten über ihn gelesen. Er war das Zentrum von allem. Diese Stadt zog aus allen Winkeln des Reichs und von jenseits seiner Grenzen Menschen an, die nach Reichtum und Macht gierten … oder in manchen Fällen nach noch mehr Reichtum und noch mehr Macht. Sie wurden von ihrer Schönheit geblendet …
Und dann fiel ein Schatten namens Maya auf das Reich und zersetzte es von innen. Ihre Gefolgsleute waren loyale Fanatiker, die mit ihrer Härte und Strenge jeden Widerstand, jede abweichende Meinung, jede Freude und jede Hoffnung im Keim erstickten. Manche hielten Maya für die Witwe eines unbedeutenden Provinzgouverneurs, die eine göttliche Eingebung gehabt habe. Andere schworen, sie sei die Hand und das Schwert des Lehrers und gekommen, um die Sünder zu bestrafen. Wieder andere behaupteten, sie sei eine Illusion oder dass ihr Geist in hundert, möglicherweise tausend oder gar hunderttausend Menschen stecke.
Doch eines stand fest: Maya hatte Tumanbay fest im Griff und saugte der Stadt wie eine Spinne langsam, aber sicher alles Leben aus …
KAPITEL 1Die Leichen
Gabreel ließ die Peitsche zwischen den Ohren seines alten Pferds schnalzen. Das Biest schüttelte den Kopf, ignorierte Gabreel ansonsten jedoch. Es schien zu wissen, dass er nicht wirklich zuschlagen wollte, da es sonst sicher umkippen und sterben würde. Und was täte er dann? Ein Kurier ohne Pferd, um seinen Karren zu ziehen. Das wäre wirklich ein Witz, so wie die Stadt Tumanbay, überlegte er. Allerdings ohne eine Miene zu verziehen, denn heutzutage konnte ein Mann schon allein wegen seiner Gedanken in Schwierigkeiten geraten.
Das Pferd furzte dröhnend.
»Dieses Tier hat wahrhaftig den Arsch des Teufels«, rief Gabreel dem Torwächter zu, der ihnen entgegenblickte.
Der Mann zeigte nicht einmal einen Anflug von Heiterkeit. Stattdessen streckte er die Hand aus und sagte: »Papiere.«
Gabreel befand sich in einer Zwickmühle: Sollte er die übliche Bestechungssumme zwischen den Passierschein und die Händlerlizenz stecken, oder nicht? Er kannte diesen Wächter nicht, und der Kerl verstand, was das furzende Pferd anging, offensichtlich keinen Spaß. Früher hätte seine Flatulenz mindestens für ein Lächeln gesorgt, doch mittlerweile wurde nicht mehr gelächelt …
»Hier, Exzellenz.« Ein bisschen Schmeichelei konnte nie schaden. »Ich habe eine spezielle Lieferung für die Universität.«
Der Wächter nahm die Dokumente entgegen und betrachtete sie mit der übertriebenen Sorgfalt eines Menschen, der kaum lesen konnte. Im Inneren der Stadt würde es noch weitere und gründlichere Überprüfungen geben, da Mayas Polizei die einzelnen Viertel mit Kontrollpunkten abriegelte.
»Die Universität?«, fragte der Wächter.
»Das ist richtig, mein Freund. Für einen Arzt, der dort arbeitet. Ein wichtiger Mann, der beim Inquisitor persönlich in hohem Ansehen steht.« Gabreel wusste zwar nicht, ob das stimmte, doch es erschien ihm wahrscheinlich. Er beschloss, etwas zu riskieren: »Ich sehe, dass du hier am Tor eine wichtige Arbeit verrichtest. Darf ich dir als Zeichen meiner Anerkennung …?«
»Wir arbeiten nur zum Ruhm Gottes«, entgegnete der Wächter und nahm geschickt die kleine Silbermünze aus Gabreels Hand, während er ihm die Ausweispapiere zurückreichte. »Du darfst passieren.«
Die große Hauptdurchgangsstraße war leerer, als er sie je gesehen hatte. Vor Jahren hatte Gabreel sie einmal um Mitternacht befahren müssen, und damals war sie voller gewesen als jetzt. Natürlich herrschte Verkehr: Kamelkarawanen und von Maultieren gezogene Karren, ein paar davon beladen, allerdings nur leicht, und niemand schien es besonders eilig zu haben. Es gab auch ein paar Fußgänger, die kreuz und quer unterwegs waren, und auch sie schienen beschäftigt zu sein. Aber das Ganze erinnerte Gabreel an die Bienenstöcke seines Vetters Attar, wenn eine Königin krank oder tot war und die Arbeiterbienen und Drohnen wie immer herumsummten … doch bei genauerer Betrachtung war gar nichts wie immer. Keine von ihnen hatte eine dringende Aufgabe zu erledigen, und sie taten bloß das, was sie immer machten, weil es sonst nichts zu tun gab. Genau das sah Gabreel auch jetzt, während er ein Viertel nach dem anderen durchquerte. Wobei er jedes Mal seinen Passierschein einem der schwarz gekleideten Funktionäre zeigte, die ihn sehr genau inspizierten. Denen bot er natürlich kein Schmiergeld an.
An vielen Straßenecken waren Galgen errichtet worden. Von den meisten hingen Leichen, alte und neue, und jeder dieser traurigen Kadaver war mit dem Verbrechen beschriftet, wegen dem er aufgeknüpft worden war. Gabreel las ein paar von ihnen, während die Toten an ihren Stricken schwangen und der Wind ihre Kaftane und die gekritzelten Zettel aufwehte. Er hat falsche Maßangaben gemacht. Er hat seine Kunden betrogen. Sie hat das Auge der Heiligkeit beleidigt. Er hat mit seinem Atem gesündigt – bedeutete das, dass dieser Mann Wein oder noch Schlimmeres getrunken hatte? Gabreel beschloss, während dieses Aufenthalts in der Stadt nüchtern zu bleiben. Er bezweifelte ohnehin, dass seine alten Stammlokale in dieser gesäuberten neuen Welt noch existierten. Sein Mund hat das Ohr beleidigt. Dieser Zettel war am Körper eines Kindes befestigt. Gabreel durchlief ein Schauer. Was konnte ein Kindermund sich zuschulden kommen lassen, das mehr als einen strengen Tadel oder einen Schlag auf den Hinterkopf rechtfertigte?
Soldatentrupps, oft nicht mehr als fanatische Freiwillige, deren Uniform lediglich aus einem schwarzen Kopftuch bestand, gingen in den Straßen auf und ab. Sie hielten scheinbar aufs Geratewohl Leute an und unterzogen sie einer Befragung. Er war sehr froh, dass seine Papiere über jeden Verdacht erhaben waren, auch wenn er sich nicht sicher sein konnte, ob so etwas in Tumanbay überhaupt noch möglich war. Diese Frage würde er sich allerdings für später aufheben – wenn er wieder zu Hause war, weit weg von dieser verpesteten Stadt. Er hatte beschlossen, dass dies seine letzte Lieferung sein würde. Außer natürlich, der Doktor bot ihm … wie viel? Ja, fragte er sich, wie viel Gold benötigte ein Mann, der am Galgen baumelte?
»Du da. Bleib stehen.« Ein Schwarzer Wächter trat aus dem Schatten, einer von Mayas Elitesoldaten, die für den Schutz des Palasts verantwortlich waren. Seine Kleidung war abgerissen und schmutzig. Nur das schwarze Tuch um seinen Kopf wirkte neu. Ebenso das Schwert, das er in der Hand hielt.
»Exzellenz.« Gabreel hielt sein schnaubendes Pferd an und stieg vom Wagen. Seine Papiere waren zwar in Ordnung. Dennoch konnte es nie schaden, bescheiden und respektvoll aufzutreten.
»Wohin willst du? Was hast du vor?«
Gabreel leierte erneut alles herunter. War es das zehnte oder zwölfte Mal, seit er das Stadttor durchquert hatte? Wenn es in diesem Tempo weiterging, würde er niemals fertig werden.
Der Wächter wedelte mit den Dokumenten. »Hier steht nicht, was du dabeihast. Dieses Schreiben besagt nur, dass du zwei Kisten transportieren darfst. Wo sind diese Kisten?«
Gabreel ging um den Wagen herum, auf dem die mit einer Plane bedeckten Kisten weithin sichtbar auf der Ladefläche festgezurrt waren.
»Lass mal sehen.«
»Der Doktor …«
»Der geht mich nichts an. Du allerdings schon. Lass mich einen Blick hineinwerfen. Und mach schnell.«
»Natürlich, Effendi.« Gabreel sprang auf den Wagen, löste die Schnüre und schlug die Plane zurück. Er klopfte auf die Deckel. Hier und da sickerte Feuchtigkeit durch die Ritzen. »Hier, siehst du? Zwei Kisten, die dringend in die Universität müssen.«
»Und was befindet sich in deinen Kisten, Kurier?«
»Exzellenz?«
»Beantworte meine Frage.«
»Leichen, Exzellenz. Frische. Sie sind in Eis gepackt, aber wie du sehen kannst, schmilzt es bereits. Die Zeit wird knapp.«
Vielleicht fragte sich der Wächter, was zwei weitere Tote in einer Stadt zu suchen hatten, in der es bereits so viele gab. Doch was immer ihm durch den Kopf ging, etwas ließ ihn stutzen. Er betrachtete die Dokumente ein weiteres Mal, und diesmal blieb sein Blick an dem Zeichen ganz am Ende hängen, direkt neben dem offiziellen Wachssiegel. Es war das Insigne des Inquisitors. Schließlich sagte er: »Also gut, mach dich auf den Weg. Verliere keine Zeit. Na los!«
Schweigend deckte Gabreel die Kisten wieder zu und kehrte eilig zu seinem Sitz zurück. Während er die Zügel schnalzen ließ und losfuhr, betete er darum, dass das Pferd nicht wieder furzen und die Nase der Heiligkeit beleidigen würde. Vermutlich war mittlerweile auch das ein Vergehen, das mit dem Strang bestraft wurde.
KAPITEL 2Gregor
Im Palast war es still.
Wie in den Straßen war auch hier etwas los: Diener gingen von Raum zu Raum, Würdenträger und Kämmerer erledigten die wenigen Aufgaben, die ihnen noch geblieben waren. Doch das unablässige Treiben, das an diesem Ort geherrscht hatte, der Strom an Aktivitäten, der Tag und Nacht wie Blut durch dieses Gebäude pulsiert war, die zigtausend Dinge, die getan werden mussten, um das große Reich von Tumanbay am Laufen zu halten – all das gab es nicht mehr.
Doch das Leben ging auf neue Weise weiter, und im Saal der Tausend Säulen – der seiner edlen Kacheln und Goldreliefs beraubt worden war – saß an einem schlichten Tisch, wo zuvor Sultan al-Ghuris prunkvoller Thron gestanden hatte, Effendi Rot. Er regierte die Stadt im Namen seiner Herrin. Gerade hielt er seine morgendliche Ratssitzung ab. Die Seidenvorhänge waren verschwunden, die mit Mondsicheln verzierten Bodenfliesen waren herausgebrochen und entfernt worden, die prächtig anzusehende Garde hatte Schwarzen Wächtern weichen müssen.
Ein Geistlicher im schwarzen Kaftan beugte sich über ein aufgeschlagenes Buch und hielt darin in der Schreibweise seines Ordens alles fest, was gesagt wurde, sodass nichts abgestritten werden konnte, sollte es sich später als verräterisch oder – schlimmer noch – ketzerisch erweisen.
Es war ein heißer Morgen. Sonnenlicht flutete durch die hohen Fenster herein, aus denen im Augenblick auf knarzenden Holzgerüsten stehende Arbeiter die Buntglasscheiben entfernten. Doch hier drinnen erschien es Gregor so kalt wie in einer Leichenhalle. Und in Leichenhallen kannte er sich mittlerweile sehr gut aus. Er stand auf der Seite des Tisches, an der Rot saß, und blickte den Inquisitor Barakat an. Eine kleine Gruppe Palastbeamter wartete darauf, im Bedarfsfall hinzuzutreten. Sie hatten alle die Seiten gewechselt, um zu überleben. So wie Gregor. Er wurde zwar noch immer als Kommandeur bezeichnet, aber das bedeutete gar nichts, da es keine Palastwache mehr gab, die er befehligen konnte. Mittlerweile fungierte er nur noch als Mittelsmann für das neue Regime. Wenn er seine Position behalten wollte, musste er unbedingten Gehorsam leisten. Er wusste, dass das kein sehr würdevolles Verhalten war, doch andererseits: Was hatte seinem Bruder Qulan dessen Prinzipientreue eingebracht?
Im Moment sprach Barakat. »… die Häuser im alten Schlachthofviertel«, sagte er gerade. »Ich glaube, es hieß früher Fleischgasse oder so ähnlich.«
»Und was gibt es dort für ein Problem, Inquisitor?«, fragte Rot.
»Häresie. Wir glauben, dass da Ketzer aus der Stadt Unterschlupf finden. Die Menschen dort sind noch nie sonderlich gefügig gewesen. Die vorherige Regierung hat sie verabscheut und wie Diebe und Verbrecher behandelt.«
Rot fing Gregors Blick auf. »Stimmt das, Kommandeur?«
»Der Inquisitor hat wie immer recht, Exzellenz. Früher haben sich die Obrigkeiten nur selten dorthin getraut, und nie ohne eine Eskorte. Es heißt, die ursprünglichen Siedler seien Reisende gewesen, die …«
Barakat schnitt ihm das Wort ab: »Erspare uns die Geschichtsstunde. Hast du denn immer noch nicht begriffen, dass die Geschichte tot ist? Wir schaffen die Zukunft. Das ist unsere Aufgabe.« Seine Stimme troff vor Verachtung.
»Zurück zu diesem Problem«, sagte Rot. »Falls sich tatsächlich Ketzer dort befinden, was schlagt Ihr dann vor?«
»Hausdurchsuchungen haben sich als nicht besonders effektiv erwiesen. In diesem Punkt irrt der Kommandeur nicht.«
»Was schlagt Ihr also vor?«
»Brennt das Viertel nieder«, erwiderte Barakat völlig emotionslos, was die Aussage umso schockierender erscheinen ließ.
»Das wäre aber bedauerlich«, sagte Rot.
»Häresie ist eine Plage, Exzellenz, die sich rasch zur Rebellion auswächst. Diese Leute, diese Rebellen brennen unsere Tempel nieder. Sie vergiften unsere Brunnen und ermorden Würdenträger. Ihre Ideen werden in dieser Barackensiedlung gären und sich weiter ausbreiten. Das Problem muss gelöst werden, bevor es noch schlimmer wird.«
»Wenn wir das machen, werden auch einige Menschen sterben, die keine Ketzer sind.«
»Dann werden diejenigen in den paradiesischen Gärten wandeln, während die anderen bis in alle Ewigkeit brennen.«
Rot sah auf die Karte und wedelte mit der Hand. »Ich werde darüber nachdenken und beten.«
»Trotzdem …« Barakat ließ das Wort in der Luft hängen. Rot hob eine Augenbraue. Er war der einzige Mensch in der Stadt, der den Inquisitor nicht zu fürchten schien und sich nicht seinem Willen unterwarf. Der einzige freie Mensch, dachte Gregor.
»Der Magistrat wird einen entsprechenden Befehl erlassen müssen.« Rot war kein Narr und wusste genau, dass ein weiser Eroberer die Ordnung am besten mit dem bereits vorhandenen System aufrechterhält. »Würdest du das, wenn nötig, arrangieren, Gregor?«
»Das werde ich, Exzellenz.« Die Frage war eigentlich unnötig. Gregor tat, was man ihm sagte.
»Und unser Sultan muss natürlich auch zustimmen.«
Die Funktionäre grinsten verstohlen. Sultan Madu der Glorreiche, der Adoptivsohn des alten Sultans al-Ghuri, war ein Strohmann, der die Einwohner von Tumanbay davon überzeugen sollte, dass alles ganz normal war, während die Stadt um sie herum auseinandergerissen wurde.
»Wie auch immer«, sagte Rot. »Wollt Ihr wirklich ein ganzes Stadtviertel niederbrennen?«
»Ich habe Maya in Maduk, Asyra, Saldan und in anderen Ländern gedient.«
»Keiner dieser Orte ist mit Tumanbay vergleichbar. Maduk ist eine kleine Wüstenstadt.«
Gregor wusste, dass er einem Machtkampf zwischen zwei ehrgeizigen Männern beiwohnte, die, soweit er es beurteilen konnte, nichts füreinander übrighatten.
Barakat legte den Kopf schief. »Es ist eine Festung, in der der Widerstand wie eine Krankheit neu aufgeflammt wäre, wenn er nicht – dank mir – unter Kontrolle gebracht worden wäre. Eine Eroberung ist nur der Anfang, mein lieber Regent. Jede Armee, sofern sie nur groß genug ist, kann ein Dorf, eine Stadt oder ein Reich einnehmen, aber um sie zu halten …« Er streckte die Hand aus und krümmte die Finger, als hielte er in ihnen tatsächlich ein winziges unsichtbares Reich. »… benötigt man keine Soldaten oder Sklaven, sondern die Seelen der Eroberten.« Er schloss die Hand, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. Waffen brachten gar nichts. Stattdessen kam es auf die richtige Geisteshaltung an. »Und das ist der Grund, weshalb Ihr mich braucht, Effendi Rot.«
Rot stand auf, schob den Stuhl zurück und verneigte sich. Dann sagte er ganz ruhig: »In dieser Stadt werden keine Viertel niedergebrannt. Nicht solange ich der Regent von Tumanbay bin. Ich danke euch allen für eure Zeit. Hiermit ist die Sitzung beendet.«
Die Schreibfeder des Geistlichen kratzte über das Pergament, während er rasch die letzten Worte notierte. Er verstreute weißen Sand auf dem Text, um die Tinte zu trocknen, blies ihn einen Moment später wieder weg und schlug das Buch zu.
Barakat verbeugte sich ebenfalls und erwiderte: »Wie Ihr wünscht, mein Gebieter.« Sie warteten ab, bis Rot den Raum verlassen hatte. Dann sagte Barakat: »Komm mit, Gregor.«
Dem blieb gar nichts anderes übrig, als dem Inquisitor zu folgen, der trotz seines lahmen Beins den Korridor entlangeilte. Gregor musste einen Zahn zulegen, um mit ihm Schritt halten zu können. Wohin gingen sie? Welche Aufgabe hatte Barakat für ihn?
»Ah, Heiligkeit!« Cadali, der ehemalige Großwesir und derzeitige Oberschleimer im Dienste Barakats, trat auf sie zu. »Ist es ein günstiger Zeitpunkt, Eure Heiligkeit?« Er stand da, als wäre er nicht über alle Maßen fett, sondern ein dünner Mann, der nur sehr wenig Platz in Anspruch nahm.
»Günstig für was?«
»Ich wollte Euch bloß darüber informieren, dass ich Maya, unserer Herrin und Lichtgestalt, eine weitere Fuhre mit Schätzen aus dem Palast geschickt habe.« Es gab keinen Winkel im Palast, den Cadali nicht kannte – keinen versteckten Lagerraum, keinen unbemerkten Korridor, keinen vergessenen Keller, keinen Wandteppich in einer unbeleuchteten Ecke und keine übersehene Geldschatulle im Dienstzimmer eines Würdenträgers. Daher war er von unschätzbarem Wert für die neuen Herren der Stadt, die mit diesen jahrhundertealten Preziosen weitere Kreuzzüge finanzieren wollten. Dennoch umwehte ihn stets ein ängstlicher Geruch.
Barakat nickte.
»Ich hoffe, Ihr seid … mit meiner Arbeit zufrieden, Eure Heiligkeit?« Cadali verbeugte sich so tief, dass sogar Gregor beeindruckt war.
Barakat dagegen nicht. »Zufrieden? Ich bin im Haus Gottes lediglich ein Diener. Wir stehen alle ihm und nur ihm allein Rede und Antwort.«
»Ähm, nun, ja«, murmelte Cadali. »Ja, ich wollte Euch nur wissen lassen … Euch nur auf dem … Friede sei mit Euch.«
»Und mit dir«, sagte Barakat und ging rasch weiter.
»Ich bin so froh, dass Ihr hier seid«, rief Cadali ihm hinterher.
»Cadali, du bist wirklich der Sultan unter allen Arschkriechern«, sagte Gregor.
Cadali sah ihn mit ängstlich zusammengekniffenen Augen an. »Ich muss mit dir sprechen, Gregor.«
»Worüber?«
»Nicht hier und nicht jetzt. Später.« Damit verschwand er, und Gregor hastete wieder hinter seinem Gebieter her.
»Was ist deine Meinung, Gregor?«
»Über Cadali, Eure Heiligkeit?«
Barakat hielt abrupt an, drehte sich um und blickte zu Gregor auf. »Cadali ist unwichtig, und das weißt du ganz genau. Ich spreche vom Regenten. Was sollte er deiner Meinung nach in diesem Fall tun?«
»Ich … würde auf den Rat von Mayas Inquisitor hören.« Manchmal schockierte Gregor sogar sich selbst, aber er hielt alles für erlaubt, was seinem Überleben diente. Tot würde er nichts mehr ausrichten können. Hätte doch bloß Qulan auch so gedacht, dann könnten sie jetzt vielleicht beide …
Barakat marschierte in seiner windschiefen Haltung weiter.
Gregor schloss zu ihm auf und sagte: »Alternativ würde ich sie mit Spionen unterwandern.«
»Und woher wüsstest du, dass du denen vertrauen kannst?«
»Ich würde ihnen sagen, dass ich weitere Spione auf sie angesetzt habe. Und außerdem würden sie für eine Sache eintreten, der sie sich voll und ganz verschrieben haben.«
»Den wahren Glauben?«
Gregor hätte ihm sagen können, dass es keine Rolle spielte, um was genau es sich handelte, solange die Spione nur daran glaubten. Jeder Traum, jede noch so vage Hoffnung würde ausreichen.
»Ganz genau, Eure Heiligkeit. Findet die wahren Gläubigen, die im Dienst für Maya alles riskieren würden.«
Sie betraten Barakats Verwaltungsbereich, der im ehemaligen Spiegelsaal untergebracht war. Die Wände waren mittlerweile kahl, das schöne Kristall und Glas verkauft, die kunstvollen Rahmen in den Küchenöfen verfeuert. An mehreren Tischen saßen Schreiber und notierten in dicken Kladden, was Geistliche mit staubbedeckten Kaftanen ihnen berichteten. Sie waren den ganzen Tag draußen unterwegs und sammelten Informationen.
Ein leitender Schreiber eilte mit einem aufgeschlagenen Buch herbei und hielt es dem Inquisitor hin. »Das sind die Haushaltsvorstände des Händlerviertels, Eure Heiligkeit. Wie Ihr befohlen habt.«
»Ich befehle nicht, mein Freund. Gott betraut uns mit dieser Aufgabe. Wir gehorchen ihm nur. Jeder, egal, ob Mann, Frau, Kind, Hund oder Bettler, muss in Tumanbay erfasst werden.«
»In der Tat, Eure Heiligkeit. Wir gehen von den alten Steuerlisten aus und bringen sie auf den aktuellen Stand.«
»Und was ist mit dem Schlachthofviertel?«
»Dort gibt es Bereiche, zu denen wir bislang noch keinen Zugang haben«, erwiderte der Schreiber.
»Siehst du, Gregor, das ist das Problem. Was nicht erfasst ist, bleibt unbekannt. Ich glaube, du kannst mir bei dieser Sache helfen.« Er nickte dem Schreiber zu, der daraufhin an seinen Platz zurückkehrte.
»Ich werde persönlich Nachforschungen anstellen, Eure Heiligkeit«, sagte Gregor.
»Natürlich wirst du das tun. Ach, bevor ich’s vergesse: Sultan Madu …«
Gregor ließ sich nicht täuschen – der Inquisitor vergaß nie etwas.
»Ja, er war krank.«
»Jemand versorgt ihn mit Opiaten. Dem Regenten ist das egal. Er findet es sogar gut, wenn der Sultan vor sich hin vegetiert, aber ich würde gern wissen, wer dafür verantwortlich ist. Finde es für mich heraus.«
KAPITEL 3Dorin
Die Leichen waren abgeladen und in die Universität geschafft worden. Dorin war wie üblich ungeduldig gewesen, aber das war Gabreel nur recht, da er nicht länger als nötig in dieser verdammten Stadt bleiben wollte. Als er wieder auf seinen Wagen gestiegen war, sagte er: »Vielen Dank, Effendi Doktor. Ich fürchte, das war meine letzte Fuhre.«
»Gibt es keinen Nachschub mehr?«
»Nein, es ist nur so, dass …«
»Dann lass dir von Hasaan die Passier- und Erlaubnisscheine für das nächste Mal geben.«
»Es sind diese Schwarzen Wächter. Sie …«
»… müssen dich nicht kümmern. Man wird dich nicht aufhalten. Und dein Lohn wird erhöht. Hier, ich gebe ihn dir im Voraus.«
Nun hatte Gabreel noch mehr Gold und wusste, wie viel nötig gewesen war, um ihn zu einer weiteren riskanten Fahrt zu überreden. Er schnalzte mit der Zunge, und das alte Pferd zog den Wagen aus dem Hof und in die Stadt zurück.
Dorin blickte ihnen nach und lief dann rasch ins Gebäude. Ein Seminar wartete auf ihn, zu dem er nicht zu spät kommen wollte. Maya oder ihr Regent Rot hielten es für ihre heilige Pflicht, den Armen eine kostenlose Gesundheitsversorgung zukommen zu lassen. Daher waren die Krankenhäuser noch in Betrieb, genau wie die Medizinische Fakultät an der Universität. Dorin war vom einfachen Referendar zu ihrem Leiter befördert worden, nachdem sein alter Vorgesetzter wegen Ketzerei denunziert und verhaftet worden war. Auf keinen Fall wollte er aus mangelndem Eifer das Wohlwollen des neuen Regimes und seine Position darin gefährden.
Er nahm ein Skalpell aus dem ledergefütterten Etui, das auf der Platte neben dem ersten Leichnam lag, und bereitete sich auf den ersten Einschnitt vor. Dabei wandte er sich an seine studentischen Zuhörer, die auf erhöhten Bänken saßen und ihm bei der Arbeit zusahen. »Wie ihr seht, setze ich knapp oberhalb des Brustbeins zum Schnitt an. Die Körperflüssigkeiten sind in die hinteren Organe abgeflossen, und …«
Er verstummte, als ein paar Studenten entsetzt nach Luft schnappten. Eine großgewachsene Frau mittleren Alters hatte den Raum betretenen. Sie trug einen Umhang und Turban aus fließender Seide, hatte dunkle Augen und einen selbstsicheren Gang. Die Zuhörer begannen zu flüstern. Das musste diese Gestalt sein, von der sie gehört hatten: Alkin, eine Ärztin, wenn es so etwas überhaupt gab, die zu allen Bereichen der Universität Zugang zu haben schien.
Ohne Dorins Einladung abzuwarten, gesellte sie sich zu ihm und stellte sich neben die Leiche.
Widerwillig winkte Dorin den Studenten. »Geht und schreibt eure gestrigen Notizen ins Reine. Wir machen hier gleich wieder weiter.«
Sie verließen eilig den Raum.
»Was machst du hier, Doktor?«, fragte er.
»Ich sehe zu, Doktor. Und ich habe eine Frage.«
»Ich muss eine Obduktion durchführen.«
»Trotzdem habe ich eine Frage.«
»Und zwar?«, gab Dorin ungeduldig zurück.
»Dies hier ist die dritte frische Lieferung in ebenso vielen Wochen.«
»Und?«
»Gibt es in Tumanbay nicht genug Tote, die du …«
»Du stellst zu viele Fragen, Doktor.«
»Gehört das nicht zu unseren ärztlichen Aufgaben?«
»Damit hast du deine eigene Frage beantwortet«, sagte Dorin.
»Ach wirklich?«
Dorin trat vom Tisch weg und verschränkte die Hände hinter dem Rücken, wie er es immer tat, wenn er vor Publikum sprach.
Alkin lächelte über seine Eitelkeit.
»Denk doch darüber nach, um Gottes willen. Jeder weiß, dass Tumanbay ein Sündenpfuhl ist. Und die Sünde manifestiert sich in Form von Erkrankungen. Daher müssen die Bewohner der Stadt, zumindest ein Großteil der Sünder, krank sein. Tatsächlich ist die Sünde so endemisch, dass man sagen könnte, sie leiden an einer Krankheit der Seele.«
»Du willst doch nicht etwa …« Weiter kam Alkin nicht, da Dorin einfach weitersprach.
»Aus irgendeinem Grund hat der Regent dir Zutritt zur gesamten Universität gewährt, Doktor Alkin. Das gefällt mir zwar nicht, aber ich muss es akzeptieren. Gleichzeitig erwarte ich jedoch, dass du auf meine Stellung hier Rücksicht nimmst. Ich werde es nicht hinnehmen, dass du mich vor meinen Studenten unterbrichst, ganz gleich, wer dein Mentor ist. Wenn du zusehen möchtest, dann nur in respektvollem Schweigen. Ist das klar?«
Alkin neigte wortlos den Kopf.
»Also gut. Dann tu mir bitte den Gefallen und ruf die Studenten wieder herein, damit wir weitermachen können.«
Alkin nickte erneut. »Ich will dich nicht zum Feind haben, Doktor, und ich rate dir, auch mich nicht wie eine Feindin zu behandeln. Heute werde ich mich dir fügen.« Sie verließ den Raum und kehrte kurz darauf wieder zurück, gefolgt von den Studenten, die die Situation eindeutig missbilligten.
Die Obduktion war bereits in vollem Gange, als der Inquisitor und Gregor den Raum betraten.
Dorin machte gerade einen Einschnitt in die Brusthöhle. Er führte ihn zu Ende und trat einen Schritt zurück. »Ah, Eure Heiligkeit. Wie kann ich Euch behilflich sein?«
»Mach bitte weiter. Wir werden dir zusehen.« Barakat nickte der großen Frau zu. »Doktor Alkin.«
»Eure Heiligkeit«, murmelte sie.
Während Dorin mit seiner Arbeit fortfuhr, wobei er jeden Schritt der Prozedur erläuterte, zog Barakat Gregor zum Rand des Raums und sagte leise: »Ich selbst verstehe die heiligen Wissenschaften zwar nicht, aber ich glaube, dass sie uns viele unserer Fragen beantworten können.«
Gregor hatte den Inquisitor bislang nicht für einen Förderer der Wissenschaft gehalten. Hatte er ihn etwa falsch eingeschätzt? »Die Medizin kann vielen Menschen helfen, Eure Heiligkeit.«
Barakat schien ihm gar nicht zuzuhören. »Die Seele zum Beispiel«, fuhr er fort.
»Die Seele?«
Dorin zog derweil die Eingeweide des Leichnams zur Seite und sagte: »Nun dringen wir in die Geheimkammern des Körpers vor …« Die Studenten beugten sich vor.
Barakat sagte: »Wenn wir herausfinden, wo im Körper die Seele sitzt, können wir die Sünde möglicherweise direkt an der Lebensquelle heilen.«
»Die Organe, die ihr hier vor euch seht«, dozierte Dorin derweil weiter, »werden in den alten Büchern beschrieben. Sie enthalten die Körpersäfte …«
»Die Sünde ist eine Erkrankung der Seele«, sagte Barakat, »die sich häufig in körperlichen Gebrechen äußert. Denk nur an die Verkrüppelten, die Gelähmten und Leprakranken. Wenn wir die Seele behandeln können, werden wir auch diese Leiden heilen, verstehst du?«
Ich verstehe, dachte Gregor, dass ich mich in Gesellschaft eines Wahnsinnigen befinde. Laut erwiderte er: »Natürlich, Inquisitor, das klingt einleuchtend.«
»Wir studieren am Objekt«, sagte Dorin. »Dann vergleichen wir unsere Beobachtungen mit der Weisheit der alten Texte und heiligen Schriften und ziehen daraus unsere eigenen Schlussfolgerungen.«
Zum ersten Mal, seit Gregor den Inquisitor kannte, bemerkte er hinter seiner kontrollierten Fassade so etwas wie Aufregung.
»Daher vergleichen wir die Körper bekannter Sünder, also der Bürger von Tumanbay, mit Leichnamen, wie der Doktor gerade einen untersucht. Sie stammen aus ländlichen Gemeinden, die nicht mit der Verderbtheit der Stadt in Berührung kommen. Wir wollen die Unterschiede zwischen ihnen ergründen und hoffen, so den Sitz der Seele zu entdecken …« Barakat erhob die Stimme: »Stimmt’s, Doktor? Wir wollen herausfinden, wo die menschliche Seele sitzt.«
Dorin blickte auf. Er kam Gregor wie ein Mann vor, der sich auf einem schmalen Pfad durch Treibsand zu tasten versuchte. »Ja, ganz richtig. Das ist unsere Hoffnung.«
Gregor fing Alkins Blick auf, die das Geschehen von der anderen Seite des Raums verfolgte und nicht erkennen ließ, was sie dachte. Wieso sie sich völlig frei bewegen durfte, war ihm ein Rätsel. Früher hätte er sie in seinen Keller mitgenommen und all seine Fragen beantworten lassen, doch unter den gegebenen Umständen war sie für ihn undurchschaubar.
Barakat ging zum Untersuchungstisch. »Natürlich«, sagte er an den Raum gewandt, »können wir nicht sicher sein, dass die angelieferten Leichname wirklich rein sind. Woher stammt dieser hier?«
Ehe Dorin antworten konnte, ergriff Alkin das Wort: »Aus einem Dorf in der Nähe der Sümpfe.«
»Dort haben wir all unsere Exemplare her«, fügte Dorin hinzu, dem deutlich anzumerken war, was er von dieser Frau hielt.
Barakat ignorierte ihn und drehte sich zu Gregor um. »Doktor Alkin ist eine Reisende aus dem Osten. Sie ist sehr klug. Ich habe sie in Asyra entdeckt. Sie saß da fest, bis Maya die Stadt befreit hat.«
»Ich wäre dort wahrscheinlich gestorben, wurde aber, wie der Inquisitor sagt, durch das Schwert Gottes in Mayas Hand gerettet. Seither konnte ich den einen oder anderen kleinen Beitrag zu ihrer heiligen Mission leisten.«
»Wichtige Beiträge«, sagte Barakat. »Deswegen möchte ich, dass sie unseren renommiertesten Arzt bei seinen Forschungen unterstützt.«
Dorin wurde noch blasser als der Leichnam auf dem Tisch. Darauf war er offensichtlich nicht gefasst gewesen. »Inquisitor, ich kann Euch versichern, dass ich keine …« Er verstummte, als Barakat den Zeigefinger der rechten Hand hob.
Der Inquisitor sagte nichts, er lächelte bloß. Es war kein angenehmes Lächeln.
Dorin schluckte nervös und drehte sich zu seinem Publikum um. »Ich glaube, für heute sind wir hier fertig.«
Die Studenten verließen den Raum und begannen, noch ehe sie durch die Tür waren, aufgeregt miteinander zu flüstern.
Dorin griff indessen nach dem Begräbnistuch, um den Leichnam damit zuzudecken.
Doch Alkin hielt ihn davon ab. »Warte, Doktor.« Sie nahm sein Skalpell und schob damit einen Muskel zur Seite. »Sieh nur, hier bei den Lungenflügeln. Da ist eine Läsion.«
»Ja, die ist mir auch aufgefallen. Solche Verletzungen sind in ländlichen Gegenden ziemlich weit verbreitet. Sie werden vom Getreidestaub verursacht.«
»Vielleicht«, sagte Alkin. »Vielleicht aber auch nicht.«
Barakat beugte sich ebenfalls vor. »Was ist das? Kann es … die Seele sein? Hat Doktor Dorin sie gefunden?«
»Nein, ich glaube nicht, dass das die Seele ist. Aber sicher kann ich es erst sagen, wenn ich den anderen Leichnam untersuche.«
Dorin hielt sich eine Linse vors Auge und inspizierte damit die Wunde. Er und Alkin mochten sich nicht, aber sie waren beide Experten auf ihrem Gebiet. Zögernd sagte er: »Ja, wir müssen uns das ansehen. Darf ich …?« Er nahm Alkin die Klinge aus der Hand und schnitt damit rasch die Lunge auf. »Hier sind weitere Läsionen.« Die beiden sahen sich an.
»Was ist das?«, verlangte Barakat zu wissen.
Dorin trat einen Schritt zurück und überließ es seiner Kollegin, die schlechten Neuigkeiten zu verkünden.
»Wo diese Toten herstammen, grassiert eine Krankheit. Ich kenne die Symptome.«
Dorin nickte. »Es ist eine sehr ansteckende Krankheit. Ich fürchte, wenn wir nichts dagegen unternehmen, wird sie sich bis nach Tumanbay ausbreiten.«
KAPITEL 4Cadali
Im großen Hof, in dem al-Ghuris Statuen aus der alten Welt gestanden hatten, gab es keine Skulpturen mehr. Ein Großteil der Sammlung war weggeschafft und verkauft worden. Zuvor hatten die Schwarzen Wächter jedoch die gotteslästerlichsten Exponate zerschlagen. Die Trümmer lagen nach wie vor zwischen all dem anderen Schutt auf dem Boden verstreut.
Cadali bückte sich und hob ein Gipsstück auf. Als er es umdrehte, blickte er in ein kunstvoll geschnitztes Auge. Es war mandelförmig und trotz seines desolaten Zustands noch immer bezaubernd. Vielleicht hatte es zu der Statue gehört, die Shajah, die Frau des alten Sultans, darstellte, die von Mayas Leuten ermordet worden war. Cadali ließ es in den restlichen Schotter zurückfallen.
Von oben, wo Arbeiter den ersten der großen Kronleuchter demontierten, rieselte Staub herab. Insgesamt waren es zehn, und jeder enthielt Fassungen für tausend Kerzen, die nach Einbruch der Dunkelheit die Galerie erhellt hatten.
Cadali dachte daran, wie der Raum im Kerzenlicht ausgesehen hatte. Wie es gewesen war, sich unter die Höflinge, Botschafter und Besucher aus aller Welt zu mischen und der Musik zu lauschen, die oft eigens für diese Abende komponiert worden war. Er erinnerte sich an den Anblick der Tänzer, die sich durch einen feinen Nebel aus Parfüm bewegten. Bei diesen Anlässen hatte sich Tumanbay von seiner schönsten Seite präsentiert.
Und jetzt … dies hier.
»Cadali … Cadali …« Eine wehleidige, doch zugleich schmeichelnde Stimme. Madu betrat den Raum. Er sah aus wie ein Verbrecher und nicht wie der Sultan von Tumanbay. Mit gierigem Blick bahnte er sich einen Weg durch den Schutt und zog Cadali am Ärmel. »Hast du es?«
»Hier, Majestät.« Cadali reichte ihm ein kleines, in Silberpapier gewickeltes Päckchen.
Madu nahm es entgegen wie ein ordinärer Händler, der Schmiergeld einstrich. So tief war er gesunken. Cadali hatte den Jungen nie sonderlich gemocht. Sein ungehöriges Benehmen und seine nicht standesgemäßen Beziehungen hatten ihm schon immer missfallen. Doch wenigstens war Madu sich früher seiner Stellung bewusst gewesen und hatte bis zum Verschwinden seines geliebten Daniel ein gewisses Maß an Würde gewahrt. In seiner Position als Schattensultan war er dagegen bloß noch ein drogensüchtiges Wrack.
»Ist es Maguilla?«
»Ja, das allerbeste.«
Der Sultan klappte eine Ecke des Päckchens auf und schüttete sich etwas von dem Pulver auf den Handrücken. »Lass es mich versuchen …« Er schniefte es lange und tief ein.
»Majestät«, sagte Cadali, »nicht hier, ich bitte Euch. Macht das doch in Euren Räumen.«
Madu lächelte. In sein Gesicht trat ein friedlicher Ausdruck. »Es ist mir egal. Es kümmert mich nicht, was sie mit mir machen.« Er ließ das Päckchen unter seinem Kaftan verschwinden.
»Nein, aber es könnte mich in Schwierigkeiten bringen. Und wo bekommt Ihr dann Euer Maguilla her. Das ist Euch doch nicht egal, oder?«
»Jaja, ich werde …«
Hinter ihnen fiel ein Holzstock zu Boden. Das Klappern hallte von den Wänden wider. Schritte knirschten im Steinstaub. Mit einer bösen Vorahnung wirbelte Cadali herum und sah sich … Gregor gegenüber. Er stieß den Atem aus. Der Anführer der Palastwache war zwar nicht mehr tödlich, aber er konnte ihm noch immer gefährlich werden.
»Kommandeur, was führt dich hierher? Solltest du nicht … irgendetwas inspizieren?«
»Ich wollte nur sichergehen, dass Seine Majestät sich wieder besser fühlt. Er hat die morgendliche Sitzung des Regenten verpasst.«
Cadali hörte deutlich die unausgesprochenen Worte: Zu der du nicht eingeladen warst.
»Danke der Nachfrage, Gregor«, erwiderte Madu. »Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigt. Ich muss mich … um etwas kümmern.« Damit eilte er davon.
Cadali und Gregor sahen ihm nach. Von oben ertönte ein weiterer Ruf. In einem Netz aus Tauen und einer gewaltigen Staubkaskade sank der Kronleuchter herab. Die beiden Männer wichen zur Wand zurück.
»Ein Reich zu zerlegen ist keine einfache Aufgabe«, sagte Gregor.
Cadali ging nicht auf die Bemerkung ein. »Was willst du, Gregor?«
Der ehemalige Meisterspion vergewisserte sich, dass niemand in Hörweite war, und sagte dann leise: »Du musst damit aufhören. Ich meine die Drogen. Sie beobachten dich. Das wird kein gutes Ende nehmen. Nimm diesen Rat als mein Geschenk an dich.«
»Und wie so viele deiner Geschenke ist auch dieses vergiftet.«
»Inwiefern?«
»Ich bitte dich, Gregor, behandle mich nicht wie einen Idioten. Ja, der Inquisitor will herausfinden, wer Madu mit Drogen versorgt. Oh, überrascht es dich, dass ich das weiß?«
»Eigentlich nicht. Sprich weiter.«
»Gleichzeitig möchte Effendi Rot, dass Madu als Symbolfigur funktioniert. Und dafür braucht er die Drogen.«
In der Mitte des Saals sank derweil knarzend und ächzend der Kronleuchter weiter herab. Aus diesem Blickwinkel wurde deutlich, wie riesig er war. Solange er noch unter der Decke gehangen hatte, dachte Cadali, hatte er luftig und leicht gewirkt, doch nun sah er sperrig und unförmig aus.
»Es … es ist ein Albtraum«, sagte er. »Sie wollen alles erfassen, jedes kleinste Detail. Was es im Palast gibt, wer was tut, wo sie es tun, wie lange es dauert … Alles muss aufgeschrieben werden. Und wenn alles aufgeschrieben ist, was dann? Werden wir dann …« Er musste damit aufhören. Aus irgendeinem Grund hatte ihm der Anblick des herabsinkenden Kronleuchters dieses Geständnis entlockt. Er war ein Narr, Gregor so viel Macht über sich zu geben, und trotzdem wollte er mit ihm sprechen … ihn um Rat fragen. War es total idiotisch von ihm, seinen Feind um Hilfe zu bitten?
»Du musst dich selbst unersetzlich machen«, sagte Gregor.
»Wie?«
»Indem du ihnen nicht alles erzählst. Halte Informationen zurück.«
»Für dich ist das leicht. Du bist ein Mann der Tat und kennst dich mit all diesen körperlichen Dingen aus. Dem Töten und dem Foltern …«
»Nun, man könnte sagen, dass ich auf diesem Gebiet inzwischen meine Meister gefunden habe.« Gregor lachte trocken.
»Das ist nicht lustig.«
Arbeiter schoben einen eisenbeschlagenen Wagen in den Raum, auf den der Kronleuchter geladen werden sollte. Die Räder knirschten laut, und Cadali nutzte den Lärm, um Gregor rasch ein weiteres Geständnis zu machen: »Ich habe eine Gemäldesammlung. Seltene Miniaturporträts aus der Vilantia-Schule. Sie sind schön, perfekt, realistisch …« Ein Schluchzen entrang sich seiner Kehle, und er bekam feuchte Augen. »Wenn irgendwer sie entdeckt … Wir wissen beide, was dann passiert.«
»Wieso hast du mir das erzählt?«, fragte Gregor wütend. »Wieso ziehst du mich da mit rein? Schmeiß sie weg, verbrenne sie, werde sie los.« Hatte Gregor etwa Angst? Bei ihm wusste man nie, an was man war, aber in letzter Zeit war er nicht mehr der Alte.
»Ich kann nicht. Verstehst du das nicht? Sie sind so … schön. Wenn sie der Welt verloren gehen …«
Gregor brachte ihn mit einer zornigen Geste zum Schweigen. »Erzähl mir doch nicht, dass dir etwas an der Welt oder an irgendetwas anderem außer dir selbst liegt, Cadali. Sag mir die Wahrheit, oder ich gehe.«
»Ja, die Wahrheit.« Cadali wusste nicht, was er sonst tun sollte. Gregor konnte ihn ohne Weiteres anschwärzen. »Wenn ich abhauen muss, brauche ich etwas, um meine Flucht zu bezahlen. Die Schmuggler, den Kapitän des Schiffs.«
»Aha, das klingt schon glaubwürdiger.«
Einer der Arbeiter schimpfte auf seine Kameraden ein, während sie versuchten, den Kronleuchter vorsichtig auf dem Wagen abzusetzen – ein monotoner, nicht endender Strom an Beleidigungen. Das schien Cadali eine gute Untermalung für diese trostlose Szene zu sein. »Ich will sie verkaufen, zu einem günstigen Preis. Aber alle Kunsthändler haben entweder die Stadt verlassen oder sind hingerichtet worden.«
»Du willst also meinen Rat?«
»Du kennst doch jeden und überhaupt die ganze Stadt wie deine Westentasche, Gregor.«
»Ich nehme an, das meinst du als Kompliment.«
Cadali nickte nachdrücklich. »Natürlich. Du weißt, ich respektiere seit jeher deine … Hilf mir, bitte. Ich flehe dich an.«
»Verbrenne sie.«
»Ich kann nicht«, jammerte Cadali. Er brauchte das Geld. Alles andere hatte er Maya gegeben. Damals war ihm das klug erschienen. »Sie sind meine Versicherung. Jeder muss sich auf eine mögliche Flucht vorbereiten. Auch du. Ist dir das denn nicht klar, Gregor?«
Hinter ihnen brach die Schimpftirade plötzlich ab. Beide Männer drehten sich um.
Der Schutt bereitete dem Inquisitor keine Probleme. Er schien fast darüber hinwegzugleiten – quer durch den Raum, an den Arbeitern vorbei, bis zu dem Anbau, in dem die beiden standen. Cadali fühlte, wie ihm der Schweiß auf der Stirn ausbrach und an seiner Nase herabrann …
»Ah, Gregor, da bist du ja.«
Gregor verbeugte sich.
»Ich habe eine Nachricht von Regent Rot. Er will, dass du deinen Bruder besuchst.«
Cadali glaubte, seinen Ohren nicht trauen zu können. War das wieder eines von Barakats Spielen?
»Anscheinend braucht der Regent ihn«, sagte Barakat und zuckte die Achseln. »Das ist eine Chance für dich. Verschwende sie nicht.« Mit diesen Worten machte er sich auf den Rückweg, doch dann drehte er sich noch einmal zu Cadali um. »Worüber habt ihr gerade gesprochen?«
Der ehemalige Großwesir öffnete den Mund, um zu antworten, brachte aber keinen Ton heraus. Ein Schweißtropfen perlte ihm von der Nasenspitze und fiel auf seine Notizen. »Über nichts«, presste er angestrengt hervor.
»Aber ihr habt miteinander geredet«, sagte der Inquisitor. »Dabei kann es doch nicht um nichts gegangen sein. Kein Mensch spricht über nichts. Das ergibt keinen Sinn. Hm?«
Hinter ihnen ertönte ein Ruf: »Macht ihn los! Macht ihn los, aber ganz vorsichtig.« Danach hörten sie die Taue knarzen, als der Flaschenzug wieder nach oben befördert wurde.
»D-die Kronleuchter«, stammelte Cadali. »Wir … wir sprachen darüber, wie man sie … sicher transportiert … wie, äh … sobald sie alle abgehängt sind, versteht Ihr?« Ein Schweißfilm bedeckte sein Gesicht.
»Reich mir deine Hände«, sagte Barakat. Als Cadali sich nicht bewegte, ergriff er sie selbst. Seine Hände sahen im Vergleich zu Cadalis pummeligen Fingern ganz dünn und knochig aus. »Sie zittern. Wieso?«
Cadali spürte, wie seine Lippen bebten. Er war kurzatmig und völlig sprachlos.
»Du kannst es mir sagen, Cadali. Und wenn du willst, dass es unter uns bleibt, dann erzähle ich es nicht weiter. Wir können auch Gregor wegschicken, wenn du das möchtest. Jeder weiß, dass ich niemals lüge. Die Wahrheit befreit dich, stimmt’s, Gregor?«
»Ja, Inquisitor.«
»Ja, Gregor. Also, worüber habt ihr gesprochen, Cadali?«
Mit einer Anstrengung, die ihm fast die Seele zerriss, sagte Cadali: »Ich fürchte, dass ich nicht so gut dienen kann, wie ich es gern möchte. Sosehr ich es auch versuche, ich scheitere ständig. Es gibt immer wieder etwas Neues, das ich tun könnte, aber ich habe nie genug Zeit dafür. Ich will aus tiefstem Herzen dienen, aber ich versage.«
Ein paar Arbeiter rollten den beladenen Wagen aus der Kammer. Die übrigen schoben unterdessen das Gerüst zum nächsten Kronleuchter. Der Lärm übertönte fast Barakats Antwort. »Bete und faste und diene ihr immer fleißig. Nur Gott ist perfekt.« Damit klopfte er Cadali auf die Schulter und ging davon.
»Siehst du, Gregor, keiner ist sicher. Er hat uns zu verstehen gegeben, uns beiden, dass das Schwert jederzeit auf jeden herabsausen kann.«
»Wenn du die Nerven behältst …«
»Ich hätte verurteilt werden können, weil meine Hände zittern … Wir leben von geliehener Zeit. Der Feind steht vor der Tür, und wir sprechen nicht mal seine Sprache. Wie können wir da je wieder sicher sein? Wenn es hart auf hart kommt, brauche ich eine Fluchtmöglichkeit.«
Danach verfielen die beiden Männer in Schweigen und hörten den Arbeitern zu, die wieder zu fluchen begonnen hatten, nachdem der Inquisitor verschwunden war. Wie um zu beweisen, dass sie echte Handwerker aus Tumanbay waren.
Schließlich nickte Gregor, als hätte er einen Entschluss gefasst. »In der Stadt gibt es einen Sklavenhändler. Er hat seltene Bücher, Schriftrollen und solche Dinge gesammelt. Ich kann dir natürlich nicht garantieren, dass er dir helfen wird. Sein Name ist Ibn Bai. Da du die Melderegister hast, wirst du ihn wahrscheinlich finden können. Aber ich sage es noch einmal, Cadali: An deiner Stelle würde ich sie verbrennen.«
Einen Moment lang war Cadali danach, seinen alten Feind zu umarmen, doch das hätte Gregor bestimmt missfallen. »Vielen Dank, Gregor, du weißt, dass du dich immer auf mich verlassen kannst.«
»Das bezweifle ich, Cadali. Du weißt ja, was man über Katzen und Hunde sagt: Ein Hund erinnert sich an einen einzigen freundlichen Moment sieben Jahre lang, eine Katze braucht dagegen nur einen Augenblick, um sieben Jahre voller Freundlichkeit zu vergessen. Du warst schon immer eine Katze. Und ich werde abstreiten, dass wir diese Unterhaltung geführt haben.« Gregor drehte sich um und ging davon.
Während Cadali ihm nachblickte, überlegte er, ob es ihm möglicherweise mehr einbringen würde, den Ex-Meisterspion zu verraten, als seine Hilfe anzunehmen.
KAPITEL 5Ibn Bai
Die heißeste Stunde des Nachmittags; Staub hing reglos in der windstillen Luft. Die am Hafen vertäuten Kamele waren genauso apathisch wie ihre Besitzer, da es im einst so geschäftigen Hafen von Tumanbay kaum noch Arbeit gab. Keine einlaufenden ausländischen Schiffe, keine Fracht, die von schwitzenden halb nackten Männern abgeladen oder mit Hebezeug in wartende Lastkähne gehievt wurde. Heutzutage fuhren auch nur noch wenige Fischkutter aufs Meer hinaus. Seit Maya die Stadt übernommen hatte, fand kaum noch Handel stand. Die wenigen Schiffe, die noch beladen wurden, krochen voll Beutegut aus dem Palast an der Küste entlang bis in ihr Heimatland hinauf.
In einem schattigen Büro spielten zwei Schreiber auf einem kunstvoll verzierten Brett Tabruk. Die weißen, roten, grünen und schwarzen Spielsteine waren über das Schlachtfeld mit seinen stilisierten blauen Wellen verteilt. Es war vollkommen still, während die Spieler sich auf ihre Züge konzentrierten, mit dem sie das Schicksal, die Winde und ihren Gegner zu lenken und ihre eigene Strategie durchzusetzen versuchten.
Es klopfte an der Tür. Ein Schatten fiel auf das Tabruk-Brett. Die beiden Männer blickten nervös auf …
»Oh, entschuldigt bitte die Störung. Ich suche nach dem Expedienten.«
Die Spieler wagten wieder, Atem zu holen. Unerwartete Besucher verhießen dieser Tage nur selten etwas Gutes. Doch dieser Mann wirkte recht freundlich. Er war dünn und etwas blass. Seine Kleidung sah teuer aus. Wahrscheinlich ein Kaufmann, und damit genauso beschäftigungslos wie sie beide.
»Wer bist du?« Der ältere der beiden Männer erhob sich. Er überragte den Besucher deutlich.
Sein Kollege ging derweil zur anderen Seite des Raums und nahm einen Knüppel, der dort an der Wand lehnte.
»Ich heiße Ibn Bai und bin Sklavenhändler. Ich habe in diesem Hafen viele Sklaven importiert … früher.«
»Ich bin der Expedient. Was willst du? Ich bezweifle, dass du demnächst eine Lieferung bekommst. Zumindest hoffe ich das für dich.«
Ibn Bai schüttelte grinsend den Kopf. »Keine Lieferung. Erwartest du mich denn nicht?«
Eine Stille setzte ein, die lediglich von den knarzenden Bodendielen durchbrochen wurde, als der Mann mit dem Knüppel zu ihnen herüberkam.
»Ich suche nach dem Iblis«, sagte Ibn Bai schließlich.
Der große Schreiber nickte, während sein Kollege einen Schritt zurücktrat. »Komm mit mir, Händler«, sagte er und verschwand durch eine Tür, die ins Gebäudeinnere führte.
Ibn Bai fragte sich, ob er ihm folgen sollte. Schließlich wusste er überhaupt nichts über den Mann. Vielleicht würde er ihn berauben oder umbringen … Andererseits hatte er viel für den Kontakt bezahlt. Und konnte er überhaupt umkehren und an dem Mann mit dem Knüppel vorbei wieder aus dem Gebäude hinausgehen? Ibn Bai trat achselzuckend ebenfalls durch die Tür und nahm auf einem Kissen Platz.
»Wer hat dir vom Iblis erzählt?«
»Der Händler Mitra. Er ist ein alter Freund. Er sagte, du würdest mich erwarten.«
»Er hat zu viel geredet.« Die Miene des Schreibers war ausdruckslos. Ibn Bai war geübt darin, in Gesichtern zu lesen, doch in diesem konnte er nichts erkennen. Das Schweigen zog sich erneut in die Länge, bis der Schreiber unvermittelt aufstand und zu einem Schrank hinüberging. Er zog eine dicke Kladde heraus und schlug sie auf. »Ihr seid zu dritt?«
»Du bist der Iblis, stimmt’s?«
»Ich bin der Mann, der euch aus dieser Stadt rausbringen kann. Mehr musst du nicht wissen. Ihr seid zu dritt?«
»Ja, meine Tochter, sie erwartet ein Kind …«
Der Iblis winkte ab, als spielte das alles keine Rolle. »Zu dritt. Heute Nacht.«
»Das ist genau der Punkt«, sagte Ibn Bai. »Deswegen bin ich gekommen. Ich muss unsere Abfahrt verschieben. Der Mann meiner Tochter ist verschwunden, und sie will nicht ohne ihn aufbrechen.«
»Unmöglich.« Der Iblis war offensichtlich nicht sehr redselig.
»Ich habe bereits bezahlt. Es fährt doch bestimmt noch ein anderes Boot …«