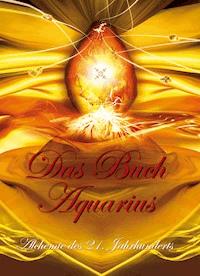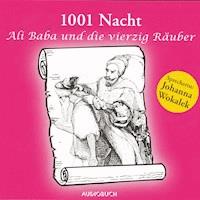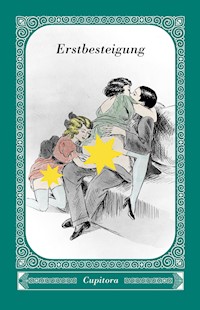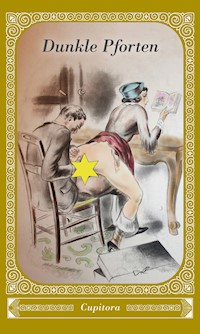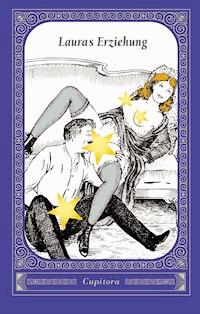Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kult (Schätze der Unterhaltungsliteratur)
- Sprache: Deutsch
"SÂR DUBNOTAL Nr. 2 enthält zwei Geschichten: Der verhängnisvolle Brunnen Eine reiche Familie schickt ihren Jungen zur Großmutter aufs Land. Doch schon bald wird das Kind vermisst. Der Vater beauftragt Sâr Dubnotal und dessen Gefährten mit der Suche. Das tragische Medium Das Medium Rhoda Rooks greift auf offener Straße einen ihr scheinbar fremden Amerikaner an mit der Absicht, ihn zu töten. Sâr Dubnotal versucht, den Vorfall um das Medium zu klären."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
IN DIESER REIHE BISHER ERSCHIENEN
DER VERHÄNGNISVOLLE BRUNNEN
SÂR DUBNOTAL NO. 02
KULT ROMANE
BUCH 19
ANONYM
Übersetzt vonGERD FRANK
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2023 BLITZ-Verlag
Hurster Straße 2a, 51570 Windeck
Redaktion: Jörg Kaegelmann, Gerd Frank
Titelbild: Mario Heyer
Logo und Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Satz: Torsten Kohlwey
Alle Rechte vorbehalten.
www.Blitz-Verlag.de
ISBN: 978-3-7579-5645-5
1019v1
VORWORT
Die Sâr Dubnotal Geschichten wurden anonym veröffentlicht. Einige Literaturwissenschaftler glauben, dass sie von Norbert Sévestre (ein sehr produktiver Autor populärer Abenteuer-Reihen) geschrieben wurden, von denen viele ähnliche phantastische Elemente beinhalteten, obwohl das nie bewiesen worden ist.
INHALT
Der verhängnisvolle Brunnen
Epilog
Das tragische Medium
Epilog
DER VERHÄNGNISVOLLE BRUNNEN
Eine tragische Vision
An jenem Nachmittag fühlte sich Frau Bajour auf ganz unerklärliche Weise traurig. Schwermütige Gedanken bedrückten sie und vergeblich versuchte sie, dagegen anzukämpfen, vor allem aber die außergewöhnlichen Ängste, die ihr Herz beengten, loszuwerden.
Solchen Krisen (meist schwarzen Humors) war Madeleine Bajour recht häufig ausgesetzt. Nun finden sich ja die verschiedensten Neurosen unter den Angehörigen aller Gesellschaftsklassen – vielleicht sogar noch häufiger unter den Reichen als unter den Armen.
Aber während Madeleine manchmal ganze Tage weinend zubrachte, und zwar ohne ersichtlichen Grund, verfügte sie im Grunde über all das, was man brauchte, um glücklich zu sein. Ihr Mann bekleidete in Paris eine achtbare und einträgliche Stelle, er war stellvertretender Bürochef im Ministerium für Öffentliche Arbeiten (also vor allem im Hoch- und Tiefbau) und dieser Posten war Gold wert: Er ließ ihm nämlich reichlich Freizeit, die er voll und ganz seiner Madeleine widmete.
Herr Bajour war ein einfacher Mensch, gefühlvoll und zärtlich, der seine Frau verehrte und alles Mögliche tat, um sie fröhlich zu stimmen, denn davon hingen ihr Befinden und ihr Zustand ab. Mit geradezu engelhafter Geduld ertrug er die Launen seiner Frau und tadelte sie nie, denn er wusste, dass sie im Grunde viel mehr zu bedauern als zu tadeln war.
Wenn er abends das Ministerium verließ, beeilte er sich, heimzukommen, um seine Frau mit irgendwelchen Einfällen zu zerstreuen. So führte er sie auf die Promenade, ins Theater oder ging mit ihr in ein Konzert. Von seinen eigenen Sorgen ließ er sich nicht beirren, er war gleichbleibend fröhlich und ließ belastende neurotische Gedanken gar nicht erst an sich heran. Madeleine, die sich während seiner Abwesenheit zu Tode langweilte, erwartete ihn abends mit Ungeduld. Er war für sie das, was die Sonne für die Pflanzen ist: Er wärmte sie mit der zarten Flamme seiner Liebe, belebte und tröstete sie ...
Wenn ich die beiden nicht hätte, ihn und Philibert, dachte Madeleine des Öfteren, wäre mir das Leben unerträglich und ich würde vor Verzweiflung sterben!
Philibert war der kleine Sohn der Bajours. Er war fünf Jahre alt und stellte ein weiteres, wichtiges Bindeglied zwischen den Eheleuten dar. Unglücklicherweise hatte das Kind keine sehr kräftige Konstitution. Von der Mutter hatte er ein sogenanntes lymphatisches Temperament geerbt, wogegen weder Sirup, noch Universalpillen (die oft auf der vierten Seite bestimmter Zeitungen empfohlen werden) halfen, denn er litt unter der ungesunden und schlechten Großstadtluft. Seit etwa zwei Jahren hatten die Bajours daher beschlossen, den Jungen zu Madeleines Mutter, Frau Renaudin, aufs Land zu bringen; sie lebte in Beaufort-sur-Yvette, einem malerischen kleinen Ort in der Gegend von Seine-et-Oise, an der Strecke von Paris nach Rennes, nur ein paar Meilen von Rambouillet entfernt.
Diese Trennung war Madeleine sehr schwergefallen. Aber sie hatte begriffen, dass es für Philiberts Gesundheit, um nicht zu sagen für sein Leben, unglaublich wichtig war, und so hatte sie ihre egoistischen Wünsche schließlich zurückgestellt und der Entscheidung zugestimmt.
Frau Renaudin, die Witwe war, erhielt zweimal im Jahr Besuch von ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn, und während dieser Zeit wurde das Kind mit Geschenken und Zärtlichkeiten geradezu überhäuft. Aber ansonsten musste Madeleine auf ihr Kind verzichten, weil sie mit ihrem Mann nicht öfter kommen konnte. Die Zeit der Trennung wurde ihr meist entschieden zu lang, zumal sie auch an häuslichen Arbeiten keinen Gefallen fand. Weder dem Häkeln noch dem Nähen noch der Teppichweberei, keiner der tausenderlei unterschiedlichsten Beschäftigungen, die den Bedürfnissen anderer tüchtiger Hausfrauen entsprachen, konnte sie etwas abgewinnen.
Auch an Lektüre fand sie keinen Gefallen, lediglich für die Musik hatte sie gelegentlich etwas übrig. Wie viele kränkliche und schwermütige Naturen empfand auch Frau Bajour hierzu eine Art Seelenverwandtschaft. Neben der Liebe zu Mann und Kind sowie zu ihrer Mutter hatte Madeleine nur noch Gefallen an ihrem Klavier.
Ihr Repertoire bestand allerdings im Wesentlichen aus traurigen oder verworrenen Variationen, die ihrem Gedankengang entsprachen. Schumann und Chopin zählten zu ihren erklärten Favoriten. Ihrem Mann wäre es natürlich weitaus lieber gewesen, wenn sie etwas weniger triste, vor allem weniger deprimierende Musik bevorzugt hätte, aber sie widersetzte sich diesbezüglich allen seinen Bitten. Und wenn es doch einmal vorkam, dass sie einige Zeit lang vorsichtig davon abließ, kehrte sie unfreiwillig immer wieder zu ihren Lieblingskomponisten zurück.
An jenem Nachmittag gab sie sich gerade wieder einmal einem Chopinstück hin, während sie wie immer ungeduldig die Rückkehr ihres Mannes erwartete.
Es hatte gerade vier Uhr geschlagen und Herr Bajour würde gegen halb sechs Uhr vom Büro nach Hause kommen; die junge Frau hatte sich an ihr Klavier gesetzt, um sich ein bisschen die Wartezeit zu verkürzen.
Sie saß vor einem prächtigen Erard-Flügel, einem Geschenk ihres Mannes, und ließ gewandt ihre Finger über die Tasten aus Ebenholz gleiten. Hier war sie in ihrem Element, vor allem, weil die Noten des schwermütigen Andante-Stückes zu dem Schweigen des Salons passten; ihr Blick spiegelte gleichzeitig tiefen Kunstgenuss wider.
Dabei interpretierte sie das Stück nicht nur, sondern erlebte es geradezu. Und ihr Geist schien von den Wellen der Harmonie, welche dem Instrument entströmten, buchstäblich mitgerissen zu werden.
Sie hatte wohl eine halbe Stunde als Pianistin verbracht und schickte sich soeben an, die berühmte Träumerei Schumanns zu spielen, als sie einen plötzlichen Schwächeanfall bekam. Es sah so aus, als ob es dunkel vor ihren Augen würde.
Ein Nebelschleier bildete sich vor ihr und verbarg Tasten und Partitur vor ihrem Blick. War dieser Nebel womöglich die Folge eines Schwindelanfalls? Anfangs glaubte Madeleine das, dann rieb sie sich die Augen und wollte aufstehen, um der Blendung dadurch Herr zu werden.
Doch seltsam: Eine ihrem Willen überlegene Kraft hielt sie an ihrem Hocker wie festgenagelt. Als sie ihre Augen wieder geöffnet hatte, entrang sich, angesichts dessen, was sie erblickte, ein Schrei des Entsetzens.
Die Wand des Salons, an der das Klavier stand, schien im Boden zu versinken und gab dadurch den Blick in das nebenanliegende Zimmer frei. Dort befand sich jetzt lediglich ein riesiger freier Raum, den Madeleine übrigens schon oft gesehen hatte und den sie auf den ersten Blick wiedererkannte.
Es war eine Landschaft der Île-de-France, eine flache und öde Landschaft, ganz in der Nähe von Beaufort-sur-Yvette und an der Grenze zur großen Strecke entlang dem östlichen Rand des Forstes von Rambouillet.
Beaufort war auf einem Hügel errichtet worden, aber seine letzten Häuser lagen verstreut in der Ebene. Ganz in der Nähe einer verlassenen Hütte, welche am äußersten Ende des Dorfes lag, befand sich ein alter Brunnen, der seit Langem nicht mehr genutzt wurde. Der war unter den Leuten zum Gegenstand abergläubischer Geschichten geworden und viele außergewöhnliche und schreckliche Unglücksfälle, die sich in dieser Gegend zugetragen hatten, hatten ihm im Laufe der Zeit den Beinamen Der verhängnisvolle Brunnen eingebracht.
Zuletzt war dort ein Landarbeiter verschwunden, der einem Mädchen zu Hilfe hatte eilen wollen. Später hatte sich ein Lastenträger dort hinabgestürzt, um den unerträglichen Schmerzen zu entgehen, die ihm ein Krebsleiden bereitete, und eine Frau, die von ihrem Mann verlassen worden war, hatte gleichfalls nicht gezögert, ihrem Leben auf dieselbe tragische Weise ein Ende zu setzen.
Der üble Ruf, den der verhängnisvolle Brunnen alsbald erworben hatte, bewirkte, dass die in seiner Nachbarschaft wohnenden Menschen unbedingt vermieden, ihn zu nutzen, und alle anderen warnten, sich ihm überhaupt nur zu nähern.
Sei es nun, dass Madeleine durch einen Schwindelanfall, eine Sinnestäuschung oder durch sonst einen unerklärlichen Vorfall von ihrem Salon aus Zeugin einer schrecklichen Szene geworden war, jedenfalls lief sie plötzlich an das besagte Dorfende von Beaufort-sur-Yvette, wo sie sehen musste, dass sich in der Nähe des Brunnens ein unheimlich aussehender Mensch, ein Vagabund oder Landstreicher, befand, der den kleinen Philibert eng umschlungen hielt. Das Kind sträubte sich mit Händen und Füßen und schrie laut nach seiner Mutter.
Gelähmt vor Entsetzen sah die junge Frau, wie der Mann sich dann über den Brunnenrand beugte und andeutete, das Kind in die Tiefe zu werfen.
„Mama! Mama!“, schrie und weinte der arme Kleine. Frau Bajour stieß gleichfalls einen gellenden Schrei aus. Ein Ohnmachtsanfall bewirkte, dass sie zu Boden fiel, wo sie bewegungslos, wie erstarrt und leichenblass, liegen blieb. All ihre Sinne waren wie betäubt.
* * *
„Ach, Monsieur! Da sind Sie ja endlich, Monsieur! Gott sei Dank!“
„Was ist denn los, Brigitte?“, fragte Herr Bajour, der – vom Büro zurückgekehrt – seine Haushälterin total aufgelöst vorfand.
„Ihrer Frau gehts ganz schlecht, Monsieur! Sie war im Salon, beim Klavierspielen, und ist dann wohl plötzlich in Ohnmacht gefallen – ich habe da gerade in der Küche gearbeitet. Als ich ein dumpfes Geräusch vom Salon her hörte, hatte ich gleich das Gefühl, dass da was Schlimmes passiert sein musste. Ich sprang gleich hinüber und da sah ich die gnädige Frau, wie sie wie leblos auf dem Teppich lag ...“
„Sie ist doch nicht tot?“, stammelte Herr Bajour.
„Nein, Monsieur. Gottlob ist sie wieder zu sich gekommen. Sie ist in ihrem Zimmer. Ich habe sie zu Bett gebracht und wäre auch gleich zum Arzt gelaufen, aber ich hatte Angst, sie allein zu lassen. Aber ob sie noch in Gefahr ist oder nicht ...“
Herr Bajour hörte schon gar nicht mehr, was die Haushälterin sagte, sondern rannte sofort in das Schlafzimmer, wo die Kranke ruhte.
Madeleine war in der Tat wieder zu sich gekommen, aber die wächserne Bleiche ihres Gesichtes und die ängstlichen Blicke, die sie auf ihren Mann warf, waren nicht gerade geeignet, ihn zu beruhigen. Deshalb überwand ihr Mann seine Besorgnis, und da er nicht wollte, dass Madeleine bemerkte, was in ihm vorging, gab er sich bewusst entspannt, als er sie fragte: „Nun, Liebling? Gibt es etwas Besonderes? Fühlst du dich nicht wohl?“
Überrascht, gleichzeitig aber auch zutiefst beunruhigt, hörte er, wie die junge Frau, deren Kopf unter einem Berg von Kopfkissen begraben war, schluchzend hervorstieß: „Ach, Georges! Mein Georges! Etwas ganz Schreckliches ist passiert, ist uns zugestoßen. Wenn du nur wüsstest!“
„Wie? Was ist denn los?“, stammelte Herr Bajour, der die fiebernde Hand seiner Frau in der seinen hielt und sie unentwegt sanft streichelte.
„Philibert ...“
„Philibert?“, wiederholte der Beamte und fühlte, wie ihn mit einem Mal Angst befiel.
„Philibert ist tot, Georges!“, schluchzte die Unglückliche. „Tot! Ertrunken im verhängnisvollen Brunnen von Beaufort-sur-Yvette!“
Nach dieser schrecklichen Enthüllung stand auch Herr Bajour kurz davor, in Ohnmacht zu fallen. Philibert ertrunken! Sein einziger Sohn tot!
„Oh, weh!“, schluchzte er. „Gott dürfte solche Dinge nicht geschehen lassen! Wir hatten doch nur dieses eine Kind! Und das dann so zu verlieren, auf diese entsetzliche Weise! Nein! Nein! Das ist doch ganz unmöglich! Du redest im Fieber, du musst dich täuschen, Madeleine, Philibert ist nicht tot ...“
Der arme Vater sagte das, weil er es einfach nicht glauben konnte. Er klammerte sich an die Hoffnung, seine Frau könnte eventuell im Delirium gesprochen haben. Schließlich hatte ja auch die Haushälterin Brigitte bei seiner Rückkehr nichts von diesem schrecklichen Unglück gesagt.
Wie und von wem wollte seine Frau von dem Unglück überhaupt erfahren haben? Je mehr er darüber nachdachte, umso sicherer glaubte Herr Bajour schließlich, die Erklärung gefunden zu haben: Madeleine musste einen Albtraum gehabt haben und er hatte viel zu schnell daran geglaubt.
„Mein Liebes, Liebling!“, rief der arme Mann. „Beruhige dich! Ich bin doch bei dir ... Und Philibert lebt, lebt ganz bestimmt. Weshalb um Himmels willen glaubst du, dass er tot sein könnte? Es ist doch niemand hier gewesen während meiner Abwesenheit?“
Die Kranke, die noch immer von konvulsivischem Schluchzen geschüttelt wurde, stammelte unter großer Pein: „Das stimmt zwar, Georges, es war niemand hier, aber ...“
Herr Bajour atmete schwer. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr, Madeleine war offenbar nicht mehr recht bei Sinnen; der Albtraum, der sie buchstäblich niedergestreckt hatte, musste sie um den Verstand gebracht haben ...
„Was aber?“, wiederholte er mit dieser nachsichtigen Stimme, mit der man zu Kranken und Kindern spricht.
„Ich kann mich nicht getäuscht haben, Georges, denn ich war ja selbst dabei, als das passiert ist. Es waren das Entsetzen und der schreckliche Schmerz, die dazu geführt haben, dass ich das Bewusstsein verloren habe.“
Da er wusste, dass es keinen Sinn machte, Fieberkranken zu widersprechen, verzog Herr Bajour bei diesen Worten seiner Frau keine Miene, denn er war überzeugt davon, dass Madeleine tatsächlich phantasierte und dass all diese Klagen über das Unglück, das seinen Sohn getroffen haben sollte, unbegründet war.
„Beruhige dich doch! Sammle dich, mein Liebling!“, sagte er wiederholt zu der Kranken. „Du hast einen ganz großen Schrecken bekommen, das gebe ich zu, aber das ist vorbei – jetzt aber, das versichere ich dir, ist unser Kind bei deiner Mutter und damit bei bester Gesundheit. Und dass sie nicht darauf geachtet haben könnte, dass er zu dem Brunnen läuft ...“
Madeleine schüttelte traurig den Kopf. „Ich weiß“, sagte sie, „dass du mich für verrückt hältst, stimmt’s? Du glaubst, dass ich den Verstand verloren habe! Ach, aber so ist es nicht, mein Lieber!“ Ein Strom heißer Tränen lief ihr über das Gesicht.
„Nein, ich bin nicht verrückt!“, wiederholte sie. „Ich bin vollständig bei Sinnen, das versichere ich dir, und ich erinnere mich an die kleinste Einzelheit des Dramas. Ich saß am Klavier, Georges. Plötzlich hatte ich ganz deutlich vor Augen, wie sich unser unglücklicher kleiner Philibert in der Gewalt eines Mannes befand, der ihn in die Nähe des Brunnens zerrte, um ihn hineinzuwerfen. Ja, ich habe diese Szene ganz deutlich gesehen, Georges, ich habe gesehen, wie sie sich vor mir abspielte, und unglücklicherweise konnte ich nicht eingreifen ... Der Mörder, den ich unter allen möglichen Leuten erkennen würde, falls ich ihn eines Tages wiedersehen würde, konnte den Widerstand unseres Kindes leicht brechen. Er hat ihn in den Brunnen geworfen, das sage ich dir, und ich hätte gewiss kein solches Entsetzen verspürt, wenn ich mich geirrt hätte ... Das war ein Hinweis des Himmels, Georges, ein Hinweis von ganz oben! In diesem Augenblick – das soll mir erklären, wer es kann! – war ich nicht mehr hier in meinem Salon, nein, ich war tatsächlich draußen in Beaufort-sur-Yvette. Und das nicht etwa nur in Gedanken, nein, sondern höchstpersönlich. Ich bin Zeugin des entsetzlichsten Dramas geworden, das eine Mutter überhaupt erleben kann. Deshalb wird mir auch niemand die Überzeugung nehmen können, mein armer Georges, dass ich meinen Sohn verloren habe ...“
Längere Zeit saß Herr Bajour schweigend neben seiner Frau. Er traute sich nicht, irgendeine Bemerkung zu machen, wollte ihr aber vor allem Zeit lassen, sich zu entspannen. Sie sollte Abstand gewinnen von dem schrecklichen Albtraum, der sich erstaunlicherweise in minutiösen und erstaunlichen Einzelheiten bei ihr festgesetzt hatte. Sie hatte ja sogar den Mörder genau beschrieben, dessen unheimliches Aussehen an einen zerlumpten, heruntergekommenen Vagabunden denken ließ.
„Woher kam dieser Mensch?“, stöhnte sie. „Wer war er? Wie ist es ihm gelungen, meine Mutter vom Aufpassen abzulenken und sich Philiberts zu bemächtigen, ohne dass sie das mitkriegte? Das ist mir völlig unerklärlich, Georges. Aber das, was ich weiß, ach, das genügt: Er hat meinen Sohn ertränkt. Philibert hat seine kleinen Ärmchen aus Angst und Hoffnungslosigkeit verdreht. Er rief mich flehentlich um Hilfe an, mich, seine Mama, und ich habe ihn ganz deutlich röcheln gehört.“
„Meine liebe Frau“, sagte endlich Herr Bajour bestimmt, „ich glaube, ich kann mir jetzt ein genaues Bild von dem ganzen Vorgang machen. Du leidest grundlos, das versichere ich dir. Nein, du bist nicht verrückt, bestimmt nicht. Und auch wenn ich das einen Augenblick lang befürchtet hatte, dann bin ich mir glücklicherweise jetzt sicher, dass du nicht an Demenz erkrankt bist. Aber, meine Liebe, du bist einer Halluzination zum Opfer gefallen, die dir vorgegaukelt hat, dass all dies in Wirklichkeit passiert sein soll. Dieses Phänomen ist nicht gerade neu und auch bei anderen Menschen haben sich dieselben Effekte eingestellt wie bei dir. Ich könnte dir sofort von einem Fall erzählen, der einem meiner Freunde passiert ist, er war nahezu identisch.“
„Ist das denn möglich?“, rief Madeleine, die ihm aufmerksam zugehört hatte und inzwischen anfing, an ihr selbst zu zweifeln, wobei sie wieder Hoffnung schöpfte. „Kann eine einfache Halluzination eine solche Ähnlichkeit zu realistischen Vorgängen bewirken?“
„Halluzinationen haben ihre Ursache in einer außergewöhnlichen Überreizung der Nerven und gaukeln dir immer die Wirklichkeit vor, mein Liebling. Der Freund, von dem ich vorhin gesprochen habe, hatte eine, die ihm seinen Vater auf dem Sterbebett zeigte. Überzeugt davon, dass dieses Unglück unmittelbar bevorstünde, fuhr er sofort zu ihm nach Hause und – traf ihn bei bester Gesundheit an. Du siehst also, meine Liebe, dass man auf diese Phänomene leicht hereinfallen kann. Das Einzige, was mich beunruhigt, ist, dass du in letzter Zeit immer unruhiger und reizbarer geworden bist. Deine Nerven sind krank, Madeleine, und wir sollten darüber nachdenken, was wir dagegen tun können.“
Die junge Frau seufzte tief. „Vielleicht hast du mit all dem recht, mein Lieber“, murmelte sie. „Ich gebe zu, dass es um mein Nervenkostüm nicht zum Besten bestellt ist, und ich habe nur den einen Wunsch, wieder gesund zu werden. Das ändert aber nichts daran“, fügte sie mit leiser Stimme hinzu, wie wenn sie mit sich selbst spräche, „das ändert nichts daran, dass ich jetzt nur halb beruhigt bin, denn das Ganze ist doch reichlich bizarr!“
„Das genügt aber nicht!“, sagte Herr Bajour energisch. „Du musst dich vollkommen beruhigen, mein Liebling.“
„Ich frage besser nicht“, antwortete die junge Frau. „Ich bitte dich nur um einen kleinen Gefallen, mein Georges.“
„Ich tue dir jeden Gefallen, den du nur willst, Madeleine.“
„Danke“, sagte die Kranke mit Wärme. „Ich weiß, dass du mich niemals zurückweist, und ich habe das vielleicht manchmal ausgenützt. Dieses Mal aber werde ich vernünftig sein und das, worum ich dich bitten werde, wird dir bestimmt nicht übertrieben vorkommen.“
„Worum handelt es sich denn?“, erkundigte sich ihr Mann.
„Falls du mir die Freude machst und meine letzten Befürchtungen beseitigen möchtest, dann schicke bitte meiner Mutter sofort ein Telegramm und frag sie darin nach Neuigkeiten über Philibert.“
„Hast du sonst keinen Wunsch, um glücklich zu sein?“, fragte Georges Bajour lächelnd. „In diesem Fall bitte ich Brigitte, inzwischen bei dir zu bleiben, und laufe gleich zur Post.“
„Ja, geh gleich los, Georges“, sagte Madeleine. „Die beruhigende Antwort meiner Mutter würde mir eine riesige Freude bereiten.“
Herr Bajour rief die Haushälterin und schickte sich an, zu gehen. Als er über den Gang schritt, läutete es an der Tür.
„Bleiben Sie bitte bei Madame, Brigitte!“, sagte er. „Ich öffne selbst.“ Herr Bajour dachte, dass der Besucher entweder ein Nachbar oder ein Lieferant sei. Als er aber die blaue Mütze eines Telegrammboten erkannte, durchzuckte ihn ein leichter Schreck und er fühlte ein merkwürdiges Unbehagen.
Etwas beunruhigt, wie man es des Öfteren beim Erhalt einer unerwarteten Depesche ist, entließ der Hausherr den Telegrammboten und riss eilig den Umschlag auf.
„Es war ein Nachbar, der sich in der Tür geirrt hat, Brigitte!“, rief er geistesgegenwärtig. „Sie brauchen sich nicht herzubemühen, er ist schon wieder fort.“
Gleichzeitig überflog er aufgeregt den Inhalt des Telegramms, das – wie der geneigte Leser vermuten wird – von Frau Renaudin, Madeleines Mutter, aufgegeben worden war und las:
„Beaufort-sur-Yvette, am 21sten, um 6 Uhr abends.
Philibert seit Mittag sehr krank. Falls Georges gleich kommen kann, soll er das tun. Madeleines Anwesenheit nicht erforderlich.“
Herr Bajour, auf dessen Stirn sich Sorgenfalten gebildet hatten, beeilte sich, die Depesche in seiner Tasche verschwinden zu lassen.
„Das ist aber wirklich ein außergewöhnlicher Zufall“, dachte er. „Zweifellos war in der Halluzination, die meine Frau erlebt hat, nicht Philibert als Kranker zu sehen, sondern er wurde ihr in Todesgefahr vorgestellt, das ist wahrscheinlicher. Hat sie tatsächlich irgendeinen geheimnisvollen Hinweis aus dem Jenseits erhalten?“
Nachdem er sich diese Frage gestellt hatte, sah Herr Bajour keinen Anlass mehr, auf das Postamt zu gehen, und so begab er sich so schnell wie möglich in das Vorzimmer zum Boudoir seiner Frau. Spontan hatte er den Entschluss gefasst, Madeleine das Telegramm nicht zu zeigen, um sie nicht aufs Neue zu beunruhigen, andererseits erschien es ihm als ungemein wichtig, der dringenden Einladung von Frau Renaudin unverzüglich Folge zu leisten. Nach einigen Minuten erschien Brigitte und erinnerte ihn an den Auftrag seiner Frau: „Madame wird schon ungeduldig“, murmelte das Mädchen. „Sie will wissen, warum Sie noch nicht weggegangen sind?“
Da entschloss sich Georges Bajour, seine Frau persönlich aufzusuchen.
„Nun?“, fragte die Kranke sogleich. „Was ist nun mit dem Telegramm, das du meiner Mutter senden wolltest?“
„Mein Liebling“, sagte ihr Mann in aller Ruhe, „ich habe gerade gedacht, dass Philiberts Großmutter sich doch sehr wundern könnte, wenn sie von uns so ganz unverhofft ein Telegramm bekäme – du weißt, dass sie unser Kind wie ihren Augapfel hütet. Es wird ihr nicht gefallen, wenn wir ihr so zeigen, dass wir ihrer aufopferungsvollen Hingabe misstrauen, indem wir uns auf diese Weise nach unserem Kleinen erkundigen.“
„Das ist mir ziemlich gleich, wie sie darüber denkt“, unterbrach ihn da Madeleine lebhaft. „Ich kann ganz einfach nicht mehr länger mit dieser Ungewissheit leben. Koste es, was es wolle, ich will endlich wissen, woran ich bin.“
„Was das betrifft, so bin ich ganz deiner Ansicht, mein Liebling“, bemerkte Herr Bajour sanft. „Da wir aber ansonsten unterschiedliche Meinungen haben, kann es nicht schaden, sich grundsätzlich um Nachrichten zu bemühen.“
Die junge Frau zeigte sich überrascht. „Was willst du denn tun?“, wollte sie wissen.
„Madeleine, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich lieber selbst in Beaufort-sur-Yvette nach dem Rechten sehen. Die Entfernung ist so gering, dass ich – wenn ich fahre – fast ebenso schnell sein werde, wie wenn wir ein Telegramm senden. Schau, jetzt ist es halb sieben Uhr abends, was bedeutet, dass wir vor morgen Vormittag keine Rückantwort bekämen. Wenn ich dagegen den Zug sieben Uhr zwölf nehme, der am Bahnhof von Montparnasse abfährt, werde ich schon gegen halb neun Uhr in Beaufort sein. Falls ich dann diesen Abend nicht mehr zurückkehren sollte, werde ich dafür sicher morgen früh wieder da sein.“
Er hatte diesen Vorschlag in einem derart natürlichen Ton vorgebracht, dass Madeleine nicht argwöhnisch wurde, sondern sich überzeugen ließ. Sie freute sich sogar darüber und war spontan einverstanden. „Fahr, mein Lieber! Fahr ruhig!“, rief sie. „Das ist mir auch lieber. Du wirst spätestens morgen zurückkommen. Nütze die Gelegenheit, die gute Luft auf dem Land wird auch dir guttun und neue Kräfte verleihen, vorausgesetzt, dass dort alles in Ordnung ist, wie ich hoffe. Wirst du keine Probleme mit deinem Ministerium bekommen?“
Georges Bajour war auf diese Frage gefasst gewesen. Er antwortete leichthin: „Nein, ich muss meinem Dienstleiter nur ein Telegramm schicken. Ich werde ihm mitteilen, dass mich eine Familienangelegenheit zwingt, sofort nach Beaufort zu reisen. Da ich mit meiner Arbeit auf dem Laufenden bin, wird er akzeptieren.“
Damit verabschiedete er sich von seiner Frau und begab sich direkt zum Bahnhof von Montparnasse, um den Zug um sieben Uhr zwölf nicht zu verpassen.
Sâr Dubnotal greift ein
In seiner Eigenschaft als stellvertretender Bürochef im Ministerium für Öffentliche Arbeiten verfügte Herr Bajour über einen unbegrenzten Freifahrtschein, der ihm ermöglichte, die Erste Klasse gratis zu benutzen. Er quartierte sich im Schlafwagen ein und wartete ungeduldig auf den Pfiff, der die Abfahrt des Zuges ankündigen sollte. Herrn Bajour genau gegenüber hatten zwei Fremde, die offensichtlich Ausländer waren, ihre Plätze eingenommen.
Der Ministerialbeamte hatte sie höflich gegrüßt. Nicht minder höflich hatten die beiden auf sein Ziehen des Hutes reagiert und dieser Austausch von Höflichkeiten hatte das Eis zwischen ihnen rasch schmelzen lassen. So vertieften sich die Männer, kaum dass der Zug Paris verlassen hatte, in ein angeregtes Gespräch.
Einer der beiden Ausländer war Sâr Dubnotal, der andere dessen Lieblingsschüler Rudolf. Die beiden Psychagogen waren wegen eines wichtigen Auftrages in die Hauptstadt gerufen worden, den sie – wie immer – zur vollsten Zufriedenheit erledigt hatten. Nun wollten sie nach Trez-Hir in der Bretagne zurückkehren, wo sie Urlaub machten. Der Zufall hatte es so gewollt, dass sie den gleichen Zug bestiegen hatten, in dem nun auch Herr Bajour saß.
Der Zug war mit zehn Minuten Verspätung losgefahren, was Sâr Dubnotal veranlasste, sich über die französische Eisenbahngesellschaft zu wundern, die so oft nicht im Einklang mit dem Fahrplan stand.