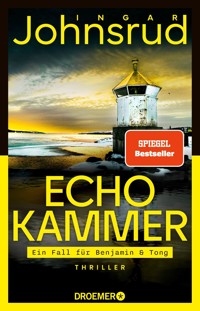9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Fredrik Beier
- Sprache: Deutsch
Zwei Mordopfer, ein schockierender Politskandal und eine überraschende Verbindung zu seinem Vater – Fredrik Beiers letzter Fall wird zu seinem persönlichsten.
Oslo, Norwegen: Ein Mitarbeiter des norwegischen Verteidigungsministeriums und seine Freundin werden ermordet in einer Autowaschanlage gefunden. Das Wort »Verräter« wurde auf den Wagen geschmiert. Wenige Tage später verschwindet eine Reporterin spurlos. Sie hatte nicht nur in der Vergangenheit des Toten gewühlt, sie suchte auch nach Informationen über Hauptkommissar Fredrik Beiers verstorbenen Vater. Als während der Ermittlungen immer mehr Verbindungen zu Fredriks Leben und seiner Vergangenheit auftauchen, muss er sich fragen, wem er noch trauen kann. Sogar seine Partnerin Kafa Iqbal scheint etwas vor ihm zu verbergen. Der Politskandal, dem er schließlich auf die Spur kommt, hat so ungeahnte Ausmaße, dass er alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 751
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Oslo, Norwegen: Ein Mitarbeiter des norwegischen Verteidigungsministeriums und seine Freundin werden ermordet in einer Autowaschanlage gefunden. Das Wort »Verräter« wurde auf den Wagen geschmiert. Wenige Tage später verschwindet eine Reporterin spurlos. Sie hatte nicht nur in der Vergangenheit des Toten gewühlt, sie suchte auch nach Informationen über Hauptkommissar Fredrik Beiers verstorbenen Vater. Als während der Ermittlungen immer mehr Verbindungen zu Fredriks Leben und seiner Vergangenheit auftauchen, muss er sich fragen, wem er noch trauen kann. Sogar seine Partnerin Kafa Iqbal scheint etwas vor ihm zu verbergen. Der Politskandal, dem er schließlich auf die Spur kommt, hat so ungeahnte Ausmaße, dass er alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt …
Autor
Ingar Johnsrud, Jahrgang 1974, wuchs in Holmestrand auf. Er studierte Film- und Medienwissenschaften und arbeitete fünfzehn Jahre als Journalist bei einem der größten norwegischen Medienunternehmen. Sein erster Thriller, »Der Hirte«, wurde als bestes Krimidebüt für den Maurits Hansen Prisen nominiert und eroberte international die Bestsellerlisten.
Von Ingar Johnsrud bereits erschienen
Der Hirte · Der Bote · Der Verräter
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Ingar Johnsrud
Der Verräter
Thriller
Deutsch von Daniela Stilzebach
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Korset« bei Aschehoug & Co., Oslo.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Dieses Buch ist auch als E-Book erhältlich.
Copyright der Originalausgabe © Ingar Johnsrud 2018
Published by agreement with Salomonsson Agency
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2019 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Bernd Stratthaus
Umschlaggestaltung: © www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Andrea Pistolesi/The Image Bank/Getty Images;
www.buerosued.de
WR · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-18697-5V002
www.blanvalet.de
»Das Gute geht häufig einen spurlosen Weg, das Böse zieht immer Folgen nach sich.«
Knut Hamsun, Segen der Erde (1917)
Teil 1
1
Die Kerze weinte eine einsame Träne, der Pfarrer faltete die Hände und betete. Er sprach das Gebet leise und nur für sich. Dennoch kamen die Worte zu schnell. Sie folgten dem Takt seines Herzens. Er löste die krummen Finger voneinander und öffnete die Augen.
In dem länglichen Fenster hoch oben in der Wand sah er sein flackerndes Spiegelbild. Draußen war es dunkel, und er nahm eine leichte Melodie wahr. Die sanfte Berührung des Schnees auf der Scheibe.
Eine schwere Flocke hatte sich auf das Glas gelegt, direkt auf den Widerschein der Kerzenflamme. Die Wärme von innen ließ den Schnee schmelzen, sodass die Flamme mehr als ein rötlich-gelber Punkt auf der Scheibe war. Der Widerschein breitete sich wie konzentrische Kreise in einem stillen Gewässer aus, verlieh dem Boden, dem Kreuz und der Bibel eine warme Färbung. Als er schließlich auch seine kniende Gestalt umrahmte, wusste er, dass der Schnee kein Schnee war, sondern dass der Herr zu ihm sprach.
Der Neuschnee machte diese Nacht zwischen Weihnachten und Neujahr so weiß und rein. Der Pfarrer dachte an die Unschuld, die in einer Weihnachtsnacht vor so langer Zeit geboren worden war und den armen Seelen der Welt einen neuen Weg eröffnet hatte. Damit bekam alles um ihn herum einen Sinn: die Eisenstangen vor dem Fenster, die Stahlpritsche mit der dünnen Matratze entlang der Backsteinwand, die Kellerdecke mit ihren Unebenheiten und Flecken, bei denen er sich oft vorstellte, es wären Wolken, und die schwere Tür mit der Luke, zu der er sich hinunterbeugen musste, um hindurchsehen zu können.
Alles hatte eine Bedeutung und alles sprach zu ihm mit klarer Stimme. Er schloss die Augen, faltete erneut die Hände und betete. Langsam dieses Mal. Selbstsicher.
Er hörte den Schließbolzen, und dann stand der Wachmann im Raum, ein großer, hohlwangiger Kerl. Er hieß Richard, und trotz des Gefälles in Stellung und Rang kamen sie gut miteinander aus. Es kam vor, dass Richard, nachdem er den Arm des Pfarrers am Bettgestell festgekettet hatte, sich zu ihm setzte, und dann redeten sie. Bevor ihm das Leben übel mitgespielt hatte, war der Wachmann Sportler gewesen. Er kehrte oft zu diesem einen Augenblick zurück, fingerte an dem Ring herum, den er an einer Kette um den Hals trug und fragte den Pfarrer, ob sich für so etwas Vergebung finde. Dann entspannten sich die Lippen des Pfarrers. Sein Blick wurde milde, und er reckte das Kinn.
»Selbstverständlich findet sich Vergebung«, pflegte er zu sagen. »Demjenigen, der glaubt, wird alles vergeben.«
Allerdings war es nicht das Gerede des Wachmanns, das den Pfarrer interessierte, sondern sein Schweigen. Richard konnte stundenlang zuhören, während der Pfarrer erzählte: von den Heuschreckenschwärmen, die Gott auf das ägyptische Volk losgelassen hatte; von der Sintflut, die die Erde von Misswirtschaft und Untauglichkeit gereinigt hatte; von den Spaniern, die nach Amerika gekommen und eine Krankheit mitgebracht hatten – die Pocken, die innerhalb weniger Jahre das mächtige Aztekenreich ausgelöscht und fast einen ganzen Kontinent zerstört hatten, um der Christenheit den Weg freizumachen.
»Nichts düngt den Boden des Glaubens mehr als quälende Schreie und Blut. Deshalb halten sie mich hier fest«, sagte der Pfarrer.
»Eine Bibel, eine Kerze, zwei Streichhölzer, ein kleiner Teller, ein Glas, eine Kaffeetasse, ein Buttermesser …« Der Wachmann hob den Kopf. »Das Kreuz?«
»Das Kreuz?«, entgegnete der Pfarrer. »Ich habe heute kein Kreuz für das Gebet bekommen.«
Richard studierte das Blatt Papier in seiner Hand. Anschließend betrachtete er erneut die Gegenstände, die zwischen ihnen auf dem Boden lagen. Er runzelte die Stirn. »Ich hatte gehofft, wir hätten das hinter uns.«
Nachdem er das Bett überprüft, unter der Matratze und unter der Decke nachgesehen, nachdem er mit der Taschenlampe den Fensterrahmen, den elektrischen Heizkörper sowie den Spülkasten abgeleuchtet hatte, drehte er sich zu ihm um.
»Es tut mir leid. Sie kennen die Vorschriften.«
»Ich habe heute wirklich kein Kreuz bekommen.«
Der Wachmann legte den Kopf schief und wartete.
Langsam zog der Pfarrer das weite Hemd aus, schüttelte es demonstrativ aus und schleuderte es dann von sich. Anschließend ließ er die Hose zu Boden fallen. Ihre Blicke trafen sich, bevor der Wachmann entmutigt seufzte und den Schritt des Pfarrers in Augenschein nahm. Die Daumen glitten hinter den Gummibund der Unterhose. Als er nackt war, hob der Pfarrer erst den schlaffen Penis und anschließend die Hoden an.
»Drehen Sie sich um und gehen Sie in die Hocke.«
»Ich bin ein Mann Gottes. Glauben Sie, ich hätte mir das Symbol seiner Göttlichkeit in den Hintern geschoben?«
Richard schnaubte ungeduldig und vollzog mit dem Zeigefinger eine rotierende Bewegung. Als sich der Pfarrer aus der demütigenden Position erhoben hatte, drehte er sich wieder um und streckte die Arme, sodass seine Fingerspitzen die Decke berührten. Dann streckte er die Zehen, die zur Fußsohle hin eingerollt waren, spürte, dass sich löste, was dort festgekrallt war, und ließ den Fuß einige Zentimeter nach hinten gleiten.
»Sehen Sie? Kein Kreuz.«
»Was ist das da?« Der Wachmann beugte sich nach vorn. Betrachtete mit zusammengekniffenen Augen die Holzsplitter, die nun direkt vor den Füßen des Pfarrers lagen.
Wenn der Mensch nur hinsehen würde, fände sich Gott überall, wusste der Pfarrer. In dem Wind, der in den Baumkronen spielte; in den Larven, die einen toten Vogel verzehrten. Gott fand sich im modernen Erbgut des Virus sowie in der Art und Weise, wie der Herr dem Menschen erlaubt, es zu manipulieren. Gott war auch Zeit, Gletscher, die schmolzen, Steine, die zu Sand zermahlen wurden, und Beton, der barst und zu Staub wurde. Wie es bei dem Beton an der Decke über dem Pfarrer der Fall war. Dort hatte er einen Spalt gekratzt, bis in ihn das lange Ende eines angespitzten Kreuzes passte. Dem Pfarrer war es nicht gelungen, das Kreuz vollständig zu verbergen, aber das spielte keine Rolle. Denn wer betrachtet schon die Details einer Kellerdecke, die er schon so viele Male gesehen hat? Wachmann Richard jedenfalls nicht.
Der Pfarrer riss das Kreuz los. Richard schaffte es gerade noch den Kopf zu heben, gerade noch den Arm hochzuziehen, um sich zu schützen. Die Spitze traf die ausgestreckte Hand des Wachmanns, gleichzeitig packte ihn der nackte Mann am Kragen und zog ihn zu sich heran. Die hoch aufgeschossene Gestalt torkelte und schrie vor Schmerzen, als sie fiel. Mit den Knien presste der Pfarrer die Luft aus ihm heraus, packte ihn an den Haaren und zerrte seinen Kopf nach hinten. Dann schlug er das magere Gesicht gegen den Boden. Das Geräusch aufplatzender Haut und nachgebenden Knorpels war zu hören. Während der Körper unter ihm unkontrolliert zuckte, bildete die Blutlache auf dem Beton eine Art Heiligenschein.
Der Pfarrer fand den Punkt, nach dem er gesucht hatte. Dort zwischen den oberen Nackenwirbeln platzierte er die vor Blut triefende Spitze des Kreuzes. Erst wollte er sein Körpergewicht zum Einsatz bringen, dann aber zögerte er, hob den Kopf, erkannte in der Fensterscheibe den Widerschein dieser barbarischen Szene. Weiße Schneeflocken klebten an der Scheibe, es ähnelte einer unberührten Leinwand. Einem neuen Leben. Einer neuen Chance.
»Danke, Herr«, murmelte er.
2
Acht Wochen später
Als der liebe Gott dem Menschen die Trostlosigkeit zeigen wollte, schuf er den schneefreien Februar in Oslo.
Ein Stein hatte sich unter seiner Schuhsohle verkeilt, als Polizeihauptkommissar Fredrik Beier den Mittelaltersaal von Schloss Akershus betrat. Geräuschvoll machte er sich auf den Holzdielen bemerkbar.
Die Festtafel war für zweiundsiebzig Personen gedeckt. Viele der Gäste hatten bereits Platz genommen, unter Porträts von Feldmarschällen und verstorbenen Monarchen. Sein Namensvetter, der dänische König Frederik IV., glotzte arrogant vom Rücken eines sich aufbäumenden Pferdes herab. Weiter vorn entdeckte er Kafa Iqbals dunklen Lockenkopf und musste feststellen, dass die zur Uniform gehörende Mütze die Kollegin besser kleidete als ihn. Fredrik erinnerte sich nicht daran, wann er die Galauniform der Polizei zum letzten Mal getragen hatte, oder die zur Ausstattung gehörenden stumpfen Schuhe, vermutete jedoch, dass es anlässlich einer Beerdigung war.
Er erkannte den Minister und weitere hochrangige Leute aus dem Justizministerium, die Chefs des Polizeidirektorats, Polizeipräsident Trond Anton Neme sowie den geschniegelten Leiter des Dezernats für Gewaltverbrechen, Polizeidirektor Sebastian Koss. Kafa hatte einen Stuhl hervorgezogen, und Fredrik begriff, dass sie seine Tischnachbarin sein würde.
»Das ist ja ein höllischer Lärm, Beier. Versuchst du, dich durch das Fundament zu graben?«
Die Stimme gehörte einem kräftigen Kerl mit rundem grauweißem Gesicht und struppigen Haaren, die unter der Mütze hervorlugten und der ihm am Tisch direkt gegenübersaß.
»Franke«, sagte Fredrik und nickte kurz. »Ich dachte, du wärst heute Abend für den Abwasch eingeteilt?«
Franke Nore lachte dunkel und klopfte seiner Tischnachbarin, einem schmächtigen Spatz aus dem Ministerium, etwas zu heftig auf den Arm.
»Dreißig Jahre in Uniform«, sagte er, mit einem vielsagenden Blick auf den Orden an seiner Brust. »Sie müssen wissen, Fräulein, als ich in der Abteilung anfing, dachten wir ein Computervirus wäre eine Geschlechtskrankheit. Und die Diskette das Symptom.« Er lachte aus vollem Hals und reckte sich nach dem Begrüßungsdrink. »Ich habe gesehen, wie aus Laufburschen Mafiabosse wurden, Finanzjongleure mit Golduhr und Kokainbart, die als aidskranke Heroinwracks endeten.« Seine Hand zitterte leicht, als er das Glas an die Lippen setzte.
»Sie hatten sicher eine lange und interessante Karriere«, erwiderte die Frau. »Aber jetzt gehen Sie vermutlich bald in Rente?«
»Ja, das hoffen die Schweine«, antwortete Franke und legte den Arm auf ihre Stuhllehne.
»Sie wird um Jahre gealtert sein, bevor der Abend vorbei ist«, flüsterte Kafa. Fredrik grinste und löste den Kieselstein mit der Silbergabel aus der Schuhsohle.
Beinahe vier Jahre waren inzwischen seit der ersten Begegnung der beiden Ermittler vergangen. Kafa war Expertin für religiösen Fundamentalismus bei der Sicherheitspolizei gewesen und hatte ihn bei den Ermittlungen zu dem Massaker an einer christlichen Sekte unterstützt. Später hatte sie sich beim Dezernat für Gewaltverbrechen, Fredriks Abteilung, beworben, wo sie seither arbeitete. Das war der Grund, warum sie hier saßen, im Romerikssaal der Festung. Vor gut einem Jahr hatten Fredrik und Kafa einen Terroranschlag auf den Ministerpräsidenten des Landes, Simon Riebe, abgewendet. Heute Abend hatten Riebe und die Regierung als Dank zum Abendessen eingeladen. Erscheinen war Pflicht. Da Wahljahr war, hatte der Ministerpräsident außerdem dafür gesorgt, dass eine erkleckliche Anzahl an Wirtschaftsbossen, Politikern und Journalisten anwesend war.
Als Riebe den Saal betrat, verebbten die Gespräche allmählich. Er nutzte die Tür am unteren Ende des Saals und nahm sich auf seinem Weg ausreichend Zeit. Wer keinen Händedruck abbekam, dem wurde entweder ein keckes Zwinkern oder wenigstens ein Kopfnicken zuteil, abhängig davon, ob der Ministerpräsident den Betreffenden als einen Sympathisanten oder einen potenziellen Störfaktor betrachtete. Auf halbem Wege hielt Riebe inne. Der Mann, der sich erhob und seine Hand ergriff, war allen bekannt: der Chef der Arbeiterpartei, Trym Dahl. Fredrik stellte fest, wie ähnlich sich die beiden Männer waren, der Ministerpräsident und der Oppositionsführer: beide Ende Fünfzig, leicht ergraut und mit hagerem Gesicht, so wie man sie auf Fotos von Marathonläufern sieht, die ein Stück hinter der Dreißig-Kilometer-Grenze an Herzinfarkt sterben. Sie trugen dunkle, schmal geschnittene Anzüge. Riebes Krawatte war privatisierungsblau, Dahls in Arbeiterblut getaucht.
»Hauptkommissar«, nickte Riebe Fredrik zu, als er an ihnen vorbeiging und Kafa die Hand entgegenstreckte. »Und Iqbal, wenn mir das Erinnerungsvermögen keinen Streich spielt? Ist mit Ihrer Tochter alles in Ordnung?«
Kafa schüttelte verwundert den Kopf. »Der Name stimmt, aber ich habe keine Tochter«, sagte sie schnell. Der Ministerpräsident sah auf. »Entschuldigen Sie. Zu viele Gesichter, wissen Sie. Auf jeden Fall möchte ich mich bei Ihnen für Ihren Einsatz fürs Vaterland bedanken. Heute Abend sind wir hier, um Sie zu feiern.« Er schlug die Hacken zusammen, positionierte sich hinter der hohen Lehne des Stuhls am Ende des Tisches und wartete darauf, dass im Saal vollständig Ruhe einkehrte.
Nach dem Hauptgang fand Fredrik endlich Gelegenheit, sich aus dem Staub zu machen. Im Fackelschein tanzten die Schatten über den Hof der Festung, während der Paraffingeruch in der Nase stach. Die steinernen Wände verstärkten das Geräusch seiner Schritte, und er hielt erst an, als er die Brücke über den Wallgraben außerhalb der Festungsmauer überquert hatte. Er legte den Kopf in den Nacken und lauschte dem Singen einer Schnur, die gegen einen Fahnenmast peitschte. Der Himmel war dunkel, der Mond, wie mit einem Fettstift hinter die Wolkendecke gemalt, zeigte sich lediglich als schlanke Silhouette. Dicke Flocken landeten auf seinen Wangen und legten sich ihm auf die Brillengläser. Erbarmte sich der Schnee endlich dieser Stadt?
Auf der Holzbrücke hinter ihm war der Klang hoher Absätze zu vernehmen.
»Fredrik Beier?«
Er senkte das Kinn und drehte sich um. Die Frau, die ihm die Hand entgegenstreckte, hatte ein schmales, hübsches Gesicht. Die blonden Haare reichten ihr bis über die Schultern, und er wusste, dass er sie schon einmal gesehen hatte.
»Ja?«
»Ich habe gesehen, dass Sie zu den Ehrengästen gehören und gehofft, Sie hier zu treffen.« Ihre Hand war knochig, wie die einer alten Frau, auch wenn sie wohl kaum die Dreißig überschritten hatte. »Benedikte Stoltz«, sagte sie und schob den Unterkiefer beharrlich nach vorn.
Jetzt wusste Fredrik, woher er sie kannte. Benedikte Stoltz war Reporterin bei TV 2. Er hatte sie in einer Dokumentation über Korruption in der Entwicklungshilfe gesehen. Sie hatte einen riesigen Aufruhr zur Folge gehabt.
»Ich weiß, wer Sie sind«, sagte er. »Ich bin jedoch nicht befugt, mit Journalisten zu sprechen.«
»Es heißt, Sie sind ein ehrlicher Bulle.«
Fredrik war groß gewachsen, fast eins neunzig, jedoch brauchte er den Nacken nicht zu beugen, um ihr in die Augen zu sehen. »Sind Sie deshalb hier? Um nach ehrlichen Leuten zu suchen?« Er lachte trocken. »Sie wissen, dass der Saal dort drinnen bis zum Bersten mit Politikern gefüllt ist?«
Sie lachte nicht. »Sie sind der Sohn von Ken Beier, richtig?«
Fredrik neigte den Kopf zur Seite. Was war das hier? Sein Vater war vor über zwanzig Jahren gestorben. Ein Bürokrat, der sein Leben hinter einem Schreibtisch verbracht hatte.
»Ihr Vater hat für die Amerikaner gearbeitet, wenn ich mich nicht irre? Bei der Botschaft?«
»Ja?«
»Ich arbeite an einer Aufstellung. Es geht um ein Militärprojekt, eine Kooperation zwischen norwegischen und amerikanischen Behörden während des Kalten Krieges. In diesem Zusammenhang ist der Name Ihres Vaters aufgetaucht. Ich versuche zu verstehen, worin seine Arbeit bestanden hat.«
Fredrik lächelte höflich und gab ihr ein Zeichen, dass er zur Feier zurückmüsse. Ein kühler Luftzug begleitete sie entlang der Wände der überdachten Toreinfahrt.
»Sorry, ich weiß nicht, was mein Vater genau getrieben hat, aber glauben Sie mir, er war kein spannender Typ. Ich vermute, Sie jagen den falschen Ken Beier.«
»Vielleicht«, entgegnete die Journalistin. »Vielleicht. Sagt Ihnen der Name Ravnli etwas?«
»Nein.«
Auf der Schlosstreppe standen drei Männer im Anzug und rauchten. Sie mussten das Geräusch ihrer Schritte gehört haben, zumal einer von ihnen, ein dicker Kerl mittleren Alters mit hervortretenden Augen und geröteten Wangen, in ihre Richtung starrte. Dann ballte er die Faust und reckte seinen fetten Mittelfinger in die Höhe.
»Scheiße«, sagte Fredrik. »Hat der Drecksack mir gerade den Finger gezeigt?«
»Die Geste hat vermutlich mir gegolten«, beruhigte ihn Benedikte trocken. »Wir hatten vorhin eine kleine Meinungsverschiedenheit.«
»Eine Meinungsverschiedenheit?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Einfach eine Diskussion. Wissen Sie, wer das ist?«
»Nein«, sagte Fredrik.
»Henry Falck, stellvertretender Direktor der Unternehmensberatung Faarmand-Bernier. Er arbeitet an einem Projekt für die Behörden, aber keiner rückt damit heraus, worum es sich dabei handelt. Das ganze Projekt unterliegt strengster Geheimhaltung. Gerüchten zufolge bahnt sich ein Skandal an.«
»Und Sie sind hier um … ein bisschen zu spionieren. Ich dachte, Sie wollten mit mir sprechen?«
»Ich wollte Sie nicht eifersüchtig machen. Veranstaltungen, bei denen sich so viel Macht an einem Ort ballt, sind gut für diejenigen, die herausfinden wollen, was sich hinter verschlossenen Türen abspielt. Aber Sie verstehen sicher, dass er nicht mit mir sprechen will.«
»Hinter verschlossenen Türen.« Fredrik schnaubte. »Viel Erfolg. Was meinen Vater betrifft, sollten Sie meiner Meinung nach Ihre Quellen noch einmal checken. Ich muss wieder rein. Zur Ziehung der Kuchenlotterie.«
Als er schon im Gehen begriffen war, zog sie eine Visitenkarte aus der Tasche, kritzelte eine Telefonnummer auf die Rückseite und bat ihn, sie anzurufen, falls er seine Meinung doch noch ändern sollte. »Niemand muss erfahren, dass wir miteinander gesprochen haben.«
»Keine Sorge«, antwortete Fredrik. »Ich werde nicht anrufen.«
Es war schon spät, als die Bartür hinter ihm ins Schloss fiel und den Zigarettenrauch von draußen mit nach drinnen beförderte. Fredrik torkelte, bis er das Geländer fand. Von irgendwo dort oben ertönten Lester Youngs sanfte Saxofonklänge, vermischt mit Gelächter, Geplauder und dem Geruch von Stearin.
Er hatte nach dem Festessen eigentlich nach Hause gehen wollen, doch die Schneeflocken, die sich jetzt über die Stadt legten und deren Sünden bedeckten, hatten etwas Hoffnungsvolles an sich gehabt. Deshalb hatte der Gedanke, die Tür zur dunklen Wohnung aufzuschließen, sich auszuziehen, sich trostlos einen runterzuholen und sich anschließend seinem alten Albtraum zu ergeben, auf der Rückbank des Taxis plötzlich unerträglich gewirkt. Fredrik hatte mit der Faust gegen die Kopfstütze geklopft und den Fahrer gebeten, ihn zur Grønlandsleiret zu fahren. Er wusste, dass es dort Medizin gegen sein Leiden gab. Sie kam sowohl im Glas als auch auf zwei Beinen daher.
Dem Kalender zufolge war es Mittwoch, in der Jazzbar Paris H war jedoch Wochenende. Fredrik steuerte auf eine Lücke zwischen Designerbrillen und wohlfrisierten Bärten an der Theke zu. Auf sonderbare Weise machten die Leute Platz, während Barkeeper Pierre ihm zuzwinkerte und breit grinste.
»Bist du dienstlich hier?«
»Was meinst du?«
Pierre machte einen Schritt zur Seite, sodass Fredrik sich im Barspiegel sehen konnte.
»Ach, verdammt«, stöhnte er. Die Mütze saß schief, während die Goldtressen auf der Uniformschulter funkelten. Der Orden mit Lorbeerzweig, den der Ministerpräsident einige Stunden zuvor an seine Brust geheftet hatte, baumelte über den Trinkgläsern.
»Kostümball«, murmelte er nur. »Ist es einem Schwerstarbeiter möglich, hier etwas zu trinken zu bekommen?«
»Scotch?«
»Für Whisky ist es zu spät, Pierre. Gib mir einen Drink. Irgendwas Saures und Farbloses.«
Fredrik drehte sich um und stützte die Ellenbogen auf die Theke. In Vasen auf barocken Sockeln waren Blätterarrangements drapiert, was dem Ort ein Dreißigerjahre-Flair verlieh. Die Jazzplakate stammten aus den Fünfzigern, und Fredrik selbst stammte aus den Sechzigern. Soweit er es beurteilen konnte, waren das die einzigen Museumsgegenstände hier. Herrgott, wie verflucht jung alle inzwischen waren.
»Pierre?«
Der Parfümgeruch kroch Fredrik in die Nase. Süßlich, Vanille und Zimt. Er zuckte leicht zusammen. Früher hatte er mal eine Frau gekannt, die so gerochen hat, die Stimme gehörte jedoch einer anderen. Sie war rostig. Rau.
»Er hat keine Ahnung, wie ich wirklich heiße«, hörte er den Barkeeper antworten. »Er glaubt auch, Paris H hätte was mit Frankreich zu tun.«
Die Frau reichte Fredrik nur bis zur Brust. Die dunkelroten lockigen Haare fielen ihr über die Schultern. Sie trug ein bürograues Kostüm, wobei der BH durch die Bluse hindurchschien.
»Fredrik«, sagte Fredrik und streckte ihr eine Hand entgegen.
Die Lippen waren Ton in Ton mit den Haaren geschminkt, und sie betrachtete ihn mit meerblauen Augen. Nicht ganz sein Typ, aber dann war da dieses Lächeln. Spielerisch und verführerisch. Animalisch.
»Angenehm, Officer«, sagte sie und nahm seine Hand. Sie trug glatte Lederhandschuhe.
Der Barkeeper schob einen nach Kiefer duftenden Drink über die Theke.
»Für die Dame auch einen, Pierre«, sagte Fredrik, ohne den Blick von ihr zu wenden. Sie presste die Zungenspitze gegen die Oberlippe, öffnete ihr Portemonnaie und reichte dem Barkeeper ein paar Scheine.
»Heute Abend nicht, mein Freund«, sagte sie, zwinkerte ihm zu und verschwand.
3
Mit einem Knall landete die Stahlkiste mit der Fakirausrüstung auf dem Asphalt. Leonard Rudi ging in die Hocke und presste die schmerzende Handfläche in den Neuschnee. Unter der brennend roten Haut sammelte sich bereits Flüssigkeit an. Morgen würde ihm die Blase wie eine Nacktschnecke in der Hand liegen, und es würde höllisch wehtun.
»Tut mir leid«, sagte Leonard. »Ich brauche eine Pause. Ich muss hier irgendwas draufschmieren. Weißt du, ob irgendwo noch eine Apotheke offen hat?« Er starrte das Mädchen an, das er seit dem Vormittag kannte. Tora. Breitbeinig hatte sie an der Landstraße in Maridalen gestanden, zwischen den Wäldern und Feldern, zehn Autominuten nördlich der Stadt. Der Chef hatte gefragt, ob er im Auto Platz für sie habe. Auch wenn Leonard ihre kleine Hand mit seiner umschließen konnte, war ihr Händedruck fest und selbstsicher. Zusammen mit einer Truppe anderer Gaukler hatten sie während der Premiere eines mäßigen Abenteuerfilms im Colosseum Kino für Unterhaltung gesorgt.
Jetzt befanden sie sich auf dem Heimweg, es schneite, und der Wind pfiff, trotzdem trug sie nichts weiter als ein Paar offene Dr. Martens und die stramm sitzende Latzhose aus Leder, in der sie aufgetreten war. Ihre kleinen Brüste schauten über dem Latz hervor, während das Piercing in der Drosselgrube im Kontrast zu ihrer blassen Haut funkelte. Die Rastazöpfe hatte sie zusammengebunden, und er vermutete, das raue Äußere ließ sie älter wirken, als sie in Wirklichkeit war.
Tora sah ihn streng an. Vermutlich war sie der Ansicht, dass Kälte und Schmerz ignoriert werden müssten. Früher einmal war Leonard der gleichen Meinung gewesen, aber selbst zwei Meter große Freaks mit Gesichtstattoo und Wikinger-Schopf wurden sanfter, sobald der Bart ergraute.
»Was ist passiert?«, fragte sie, als sie die lange Kiste mit Fackeln, Schwertern und Lampenöl wieder gemeinsam trugen.
»Die Feuerschale ist umgekippt. Ich muss Ölreste an der Hand gehabt haben, denn als ich sie aufrichten wollte, hat die Hand zu brennen angefangen.«
»Es sah zumindest verdammt cool aus«, sagte sie. »Ich glaube, diese Promifritzen waren beeindruckt. Am Jernbanetorget gibt es eine Apotheke. Die schließen nie. Wenn du da vorbeifährst, kann ich kurz reinspringen und was besorgen.«
Als sie auf dem Parkplatz ankamen, waren die anderen Gaukler bereits aufgebrochen. Nur der Chef war noch da. Er machte keinerlei Anstalten, ihnen zu helfen, als sie die Kiste auf die Rückbank von Leonards altem Volvo 244 hievten.
»Frierst du nicht, mein Mädchen?«, fragte er Tora und schnalzte mit dem Gummi, das das Bündel mit Fünfhundert-Kronen-Scheinen zusammenhielt. »Soll ich dich ein bisschen wärmen?«
Sie hustete einen Batzen Schleim nach oben und platzierte ihn direkt vor seinen Füßen.
»Feuerschlucker frieren vielleicht nicht«, sagte er tonlos und reichte jedem von ihnen fünf Scheine. »Du kriegst noch einen, wenn du den hier runterklappst.« Er zeigte auf den Latz ihrer Hose.
»Ich bin keine Feuerschluckerin. Ich spucke Feuer«, entgegnete Tora, rollte die Scheine zusammen und schob sie sich in den Stiefelschaft. »Wie ein Drache. Vielleicht werde ich dir irgendwann deine Fotzenschweinsaugen rausbrennen.« Sie wackelte mit ihren Brüsten.
Den Chef schien die Beleidigung nicht weiter zu beeindrucken. »Gute Arbeit heute Abend«, sagte er zu Leonard. »Mach was wegen deiner Hand, dann ruf ich beim nächsten Job wieder an.«
»Wo wohnst du?«, fragte Leonard, als Tora mit einer Aloe-Vera-Creme für ihn aus der Apotheke zurückkam.
»Oben im Wald.« Tora wühlte in dem Rucksack, den sie die ganze Zeit mit sich herumgetragen hatte. Er bestand aus rosa Plüsch, hatte Schnurhaare, niedliche Augen und spitze Ohren. Sie legte eine Packung Zigaretten zwischen ihre Oberschenkel und zog sich dann einen Kapuzenpulli über den Kopf.
»Nicht weit entfernt von wo du mich heute Morgen aufgelesen hast. Und du?«
»Auch da in der Nähe«, entgegnete er. »In Maridalen. Auf einem alten Gehöft.«
Sie streckte sich nach dem Hebel aus, um die Fensterscheibe herunterzukurbeln.
»Der funktioniert nicht«, sagte er. »Rauch einfach im Auto.«
»Hast du keine Angst vor Krebs?«
»Ich hatte den ganzen Abend lang den Mund voll Lampenöl. Ich glaube nicht, dass die Zigarette da noch viel ausmacht.«
Sie lachte, heiter und unbeschwert. »Wohnst du alleine? Warum hab ich dich denn noch nie vorher gesehen? Es wohnen ja nicht so unglaublich viele Leute da oben.«
»Ich wohne mit meiner Tochter zusammen. Wir sind erst vor Kurzem von Brighton hierher gezogen. Aus Südengland. Ich hatte das Gefühl, nach Hause zu kommen. Margaret hasst es.«
Tora zündete sich eine Zigarette an und betrachtete die glühende Spitze. »Es ist verflucht kalt«, sagte sie.
»Mir ist das Auto aufgebrochen worden. Als der Dieb das Radio rausgerissen hat, muss er die Elektronik geschrottet haben. Die Heizung funktioniert nicht mehr.«
Sie nahm einen tiefen Zug, blies ein paar kräftige Rauchringe in die Luft und räusperte sich. »Überhaupt, meine ich. In diesem Land ist es verflucht kalt. Vor allem im Tal. Ich kann gut verstehen, dass deine Tochter es hasst. Brighton, das ist richtig krass, oder? Unmengen biodynamisches Gras und so was. Veganläden und Shit?«
»Genau«, antwortete er. »Ein Kumpel von mir hatte so einen Laden. Er kannte eine Bande, die Bauernhöfe überfallen und Hühner geklaut hat, damit die in Freiheit leben konnten. Aber die Hühner haben natürlich nicht kapiert, dass sie keine Eier mehr zu legen brauchten. Also fing er an Omeletts zu servieren. Vegane Omeletts von befreiten Hühnern nannte er sie. Verkauften sich wie geschnitten Brot.«
»Nice«, sagte Tora und lehnte den Kopf gegen die Scheibe. »Du weißt schon, dass im Tal eine Unmenge an Leuten ermordet worden sind, oder? Irgendein Motherfucker ist mit einem Maschinengewehr Amok gelaufen und hat verrückte Christen abgeknallt.«
Leonard lachte. »Nein. Das wusste ich nicht. Warum hat er das getan?«
Sie streckte die Zunge heraus und formte sie zu einem U. Dann drückte sie die Zigarette darauf aus und schluckte, bevor sie die Kippe wieder in die Verpackung schob.
»Ich weiß nicht, warum er das getan hat. Allerdings, hätte ich ein Maschinengewehr und wäre ein Motherfucker und würde draußen im Wald eine Bande kranker Christen treffen, dann würde ich vielleicht dasselbe machen. Mein Bruder fährt dort Ski. Aber nur wenn es hell ist. Da spukt es, sagt er.«
Leonard lachte erneut. »Vielleicht hat eins der Gespenster ja mein Radio geklaut.«
»Ja. Oder vielleicht ein kranker Motherfucker mit einem Maschinengewehr«, schlug Tora vor.
Sie wohnte auf einem der großen Bauernhöfe in der Talsohle. Als Leonard auf dem Hof anhielt, ging die Haustür auf, und im Scheinwerferlicht tauchte eine blinzelnde Frau auf. Tora winkte ihr zu.
»Meine Mutter«, sagte sie nur, lehnte sich zu ihm rüber und umarmte ihn. »Sie geht nicht ins Bett, bevor ich nicht zu Hause bin. Danke fürs Fahren, Wikinger. Nimm dich vor Gespenstern in Acht.«
Die Flocken fielen dichter, als Leonard auf den Feldweg einbog, der zu dem kleinen roten Holzhaus führte. Dort angelangt, stellte er den Motor ab und blieb im Auto sitzen. Unten in der Stadt war alles nur matschig und dunkel, aber hier, ein paar Autominuten entfernt, lagen noch die Reste vom letzten Schneefall. Die Bäume waren wie mit einem doppelten Pinsel gemalt, oben weiß und darunter dunkelgrün, die gebeugten Schultern der Fichten ließen ihn an seine Tochter denken. Auch sie drückte der Winter nieder.
Für Margaret war es sicher nicht so einfach, mit ihrem Vater hier draußen zu leben. Schließlich kam sie aus einer quirligen Küstenstadt, mit London und dem Kontinent nur eine Zugstunde entfernt. Sie war inzwischen zwölf, zu drei Fünfteln noch ein Kind, zu zwei Fünfteln erwachsen. Leonard hatte immer Norwegisch mit ihr gesprochen, sodass sie wie eine Einheimische klang. Aber das Land war ihr fremd, und ihr Körper war ihr fremd geworden. In der Schule war sie bereits mit einem Jungen aneinandergeraten, der sich über ihren Hintern geäußert hatte. Nachdem er sich beim Hacken eines halben Klafters Holz abreagiert hatte, hatte Leonard wie ein verantwortungsbewusster Vater gehandelt. Er hatte die Mutter des Jungen angerufen und die Familie zum Essen eingeladen.
Im Eingangsbereich vernahm er das Knistern des Kamins und erahnte den Geruch von verbrannter Milch.
»Margaret! Du hast morgen Schule. Du solltest längst schlafen. Und was hab ich dir bezüglich des Feuers gesagt, wenn ich nicht da bin? Kannst du nicht einfach die Öfen benutzen, die ich gekauft habe? Die sind nicht einfach nur Deko.«
Die Dielen im Wohnzimmer knackten, und die alte Holztür schwang auf. Da stand sie. Die Haare, dieses Mal grün-weiß, standen in alle Richtungen ab, während der schräge Pony eins ihrer Augen bedeckte. Mit dem anderen blinzelte sie, als hätte sie schon geschlafen. Sein alter Strickpulli reichte ihr bis zu den nackten Knien. In ihren Armen lag Dolly, die Katze.
»Ich soll dich von Mama grüßen«, sagte sie.
»Ach so? Was hat sie denn gesagt?«
»Dass sie uns liebt.«
»Dann ist alles so, wie es sein soll.«
»Sie sagt, wir sind weit weg. Dass sie sich wünscht, wir wären nicht gefahren.«
Es brannte im Zwerchfell.
»Margaret«, sagte er geduldig. »Es ist schön, dass du mit Mama sprichst. Aber sie ist tot, das weißt du doch? Ich glaube, Mama ist froh, dass wir beide hier wohnen. Dass wir einander haben.«
Margaret setzte die Katze auf den Boden, ging einen Schritt auf ihn zu und schlang die Arme um seine Taille. »Ich habe Brei für den Kobold rausgestellt«, sagte sie, und er strich ihr mit seiner tätowierten Hand über den Kopf.
»Du musst dir die Haare waschen«, antwortete er. »Und bist du nicht ein bisschen zu groß, um den Kobold zu füttern? Außerdem glaube ich, dass er zum Nordpol zurückgefahren ist. Mehr als vier Wochen Urlaub nach Weihnachten bekommt er nicht. Der Kobold ist ein bedauernswerter Arbeitnehmer, genau wie ich.«
»Den Brei isst er aber immer noch«, sagte sie.
»Das sind die Rehe«, erwiderte er. »Bestenfalls. Oder Mäuse. Um die loszuwerden, werden wir den ganzen Sommer brauchen.«
Sie entzog sich ihm. »Kann ich dich nicht zur Arbeit begleiten? Alleine hier ist es so stinklangweilig. Warum kannst du mir nicht das Feuerspucken beibringen?«
»Weil das keine Arbeit für ein Mädchen ist.« Er dachte an den Kerl mit den Fünfhundert-Kronen-Scheinen. »Du sollst in die Schule gehen«, sagte er, »und ein bisschen cleverer werden als dein alter Vater.«
Nachdem er ihr einen Gutenachtkuss gegeben hatte, schaltete er das Licht im Wohnzimmer aus. Die Feuerzungen im Kamin wurden in der Fensterscheibe zu Teufelszungen. Er legte die verletzte Handfläche gegen das kalte Glas, betrachtete die herabfallenden Schneeflocken und zwischen den Holzstämmen hindurch den Nachbarhof. Dort unten auf Solro wohnte niemand mehr. Dennoch glaubte er, in einem der Fenster der Holzvilla ein schwaches, glänzendes Licht zu sehen.
4
Der stellvertretende Direktor Henry Falck glaubte nicht an Zufälle, er glaubte nicht an Gott, und er glaubte definitiv nicht an Mitleid. Daher war er zu dem Schluss gekommen, dass es im Leben darum ging, sich zu entscheiden, wohin man wollte, und anschließend alles Erforderliche zu tun, um dorthin zu gelangen. Der Kampf des Lebens bestand darin, sich an die Spitze der Pyramide zu arbeiten. So viel wie möglich mitzunehmen, so viele wie möglich zu vögeln und so wenig wie möglich zu teilen.
Daran war nichts falsch. Jedes Tier, jede Pflanze, jeder Pilz, jedes Virus und jede Bakterie könnten bestätigen, dass dies der ausschließliche Zweck des Lebens war. Blühen und sich vermehren. Den Erbstoff von einer Generation zur nächsten weitertragen und verbessern. Das Problem war nur, dass das einzige Geschöpf, dass diese Wahrheit mit Worten ausdrücken konnte, derzeit von der kruden Brutalität des Lebens beleidigt und niedergemacht wurde.
Henry Falck hatte auch eine Formel für das, was ihn betrübte: Schmutz an der Kleidung, Erektionsstörungen und Demütigung waren drei der Hauptursachen.
Vielleicht blieb der stellvertretende Direktor von Faarmand-Bernier, der renommiertesten Unternehmensberatung des Landes, deshalb einen Augenblick lang grübelnd sitzen, während die Elektronik die Frontscheibe des Tesla vom Schnee befreite.
Ein paar Stunden zuvor war Falck derart verärgert gewesen, dass er im Hof des Schlosses Akershus einen Mülleimer umgetreten hatte. Irgendein Idiot hatte einen halb vollen Joghurtbecher weggeschmissen, und der Inhalt hatte sich auf Falcks maßgeschneiderte Hose ergossen. Der Anlass des Wutanfalls war die Konfrontation mit einer Frau. Sie hatte behauptet, für TV 2 zu arbeiten, und sie nannte sich Benedikte Stoltz.
Sie war hübsch, weshalb sie überhaupt ins Gespräch gekommen waren. Schlank, beinahe dünn, wie Falck es mochte – nicht nur aufgrund des physischen Vorteils, den ihm das offensichtlich verschaffte, sondern auch weil ein spindeldürrer Körper in der Regel ein spindeldürres Selbstbild beherbergte. Er fühlte sich wohl in der Gesellschaft nervöser Menschen und hatte deshalb seine Deckung fallen gelassen. Dann hatte sie plötzlich ihr wahres Gesicht gezeigt und ihn vor seinen Klienten lächerlich gemacht. Sie hatte dagestanden und Details aus einem Bericht verlangt, von dessen Existenz nur wenige wussten, und sie hatte sich eingeschmeichelt, um mehr zu erfahren. Die anderen Herren hatten gelacht, wohl wissend, dass Diskretion die Ware war, für die man bei Faarmand-Bernier am besten bezahlen ließ. Das war eine Demütigung, die nicht einmal der private After-Dinner-Cognac mit dem Ministerpräsidenten aufwiegen konnte. Nein, der hatte es sogar schlimmer gemacht, denn er hatte sich beim Ministerpräsidenten über den Vorfall beklagt, er konnte nichts dafür, es musste einfach aus ihm heraus. Riebe hatte ihm eine Hand auf die Schulter gelegt und wiehernd gelacht: »Henry. Die Frauen waren schon immer deine Schwäche.«
In der Regel liebte er dieses technologische Wunder von einem Fahrzeug. Als er es jetzt jedoch startete, hätte er sich gewünscht, stattdessen vom Gebrüll des Achtzylinders im Jaguar begrüßt zu werden, der unter der Wohnung auf Tjuvholmen parkte; nicht vom Summen einer trägen Nähmaschine.
Schmutzige Kleidung und Demütigung – zwei von drei an einem Tag mussten reichen. Er fummelte die kleine Tüte aus dem Getränkehalter, fischte eine der hellblauen rhombusförmigen Pillen heraus und spülte sie mit einem Schluck aus der Champagnerflasche herunter, die er im Auto liegen hatte. Auf dem Smartphone überprüfte er die Reservierung: Der VIP-Tisch im Nachtklub am Solli plass wartete bereits auf ihn.
Während er durch die Straßen der Stadt fuhr, öffnete er das Fenster und ließ die Brise seine Stirn kühlen, während Michael Bublés »Ave Maria« seine Seele kühlte. Der fruchtige Rauch der E-Zigarette vermischte sich mit den Schneeflocken. Er parkte unter einer Straßenlaterne in der Odins gate in Frogner und versuchte, sich nicht darüber zu ärgern, dass sie seine Anrufe nicht entgegennahm. Stattdessen watschelte er zum Wohnhaus und suchte auf dem Klingelschild nach ihrem Namen. B. Wagner. Er hielt den Klingelknopf gedrückt, während er langsam bis fünfzehn zählte. Als er wieder losließ, war sie da.
»Was ist los?«
»Hier unten stehen ein Tesla Model S P90D Ludicrous, eine Flasche Krug, Jahrgang 1990 und ein steifer Schwanz und warten auf dich«, entgegnete er. »Wir wollen in den Nachtklub.«
»Ach … Haha. Henry.« Beatas Tonlage veränderte sich. »Sitz nicht im Auto rum und warte. Komm lieber hoch. Ich bin gerade fertig mit Duschen. Wenn du möchtest, kannst du mir beim Anziehen zusehen?« Beata wusste, dass er nicht Nein sagen würde und wartete die Antwort nicht ab. Der Summer ertönte.
Nach zwei Treppenstufen zögerte er. Sie hatte ganz sicher irgendwas zu trinken da, einen billigen Cava oder so was. Heute war aber ein Abend für echte Ware. Er machte kehrt, um den Champagner zu holen. Als er dann wieder an der Haustür herumhantierte, wurde er auf die Gestalt neben seinem Auto aufmerksam. Durch das Türglas sah er, wie sie gebeugt auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs stand, während sie mit der Hand weit ausholte.
Henry Falck riss die Tür auf. »Was zum Teufel machst du da?«
Es musste sich um einen Mann handeln, denn der Körperbau war kräftig und breitschultrig, das Gesicht unter der Kapuze des Pullovers war allerdings nicht mehr als ein dunkler Schatten. Henry eilte über die Straße, während der Mann davonlief. Als Henry den Tesla passierte, sah er, dass Farbe über den teuren Lack lief. Dieser Dreckskerl hatte sein Auto beschmiert. Das bedrückende Gefühl von Demütigung kochte erneut in ihm hoch. Henry lief so schnell er konnte, sein Körper sprudelte über vor Adrenalin, Wut und gekränkter Männlichkeit. Vor ihm rannte die Gestalt unter den kahlen Ästen an den Lattenzäunen der Villen im westlichen Teil der Hauptstadt vorbei, bevor sie im Frognerveien die Straßenbahnschienen überquerte.
»Verdammt«, tobte Henry, als in der Dunkelheit eine Straßenbahn an ihm vorbeidonnerte und er den Flüchtenden aus den Augen verlor. Als die Straßenbahn vorbeigefahren war, hatte er bereits einen riesigen Vorsprung, Falck konnte ihn nur noch sehen, wenn er eine Straßenlaterne passierte. Er nahm erneut die Verfolgung auf. Die Weste spannte über seinem kräftigen Bauch, und die Nähte im Schritt hinderten ihn daran, größere Schritte zu machen. Er rannte noch einen Häuserblock weiter, an der Kreuzung blieb er dann aber keuchend stehen. Während ihm das Herz gegen das Brustbein hämmerte, platzierte er die Hände auf den Knien. War der Drecksack geradeaus weiter- oder den Gimleveien hinuntergelaufen? Oder vielleicht hinauf? Der Schnee fiel jetzt wieder dichter, die Sicht wurde schlechter, und Henry sah ein, dass das so oder so keine Rolle spielte. Als er sich das letzte Mal im Bad auf die Waage gestellt hatte, hatte sich der Zeiger vom grünen in den gelben und schließlich in den roten Bereich gedreht, bevor er bei einhundertvierundzwanzig Kilo stehen geblieben war. Er japste nach Luft und wusste, dass er verloren hatte. Diese Runde. Aber der Kerl würde es ihm büßen. Verdammt, das würde er. Henry würde einen verfluchten Privatdetektiv auf die Sache ansetzen, jedes verfluchte Foto von jeder verfluchten Überwachungskamera in der Gegend beschaffen und dann … verfluchter Drecksack!
Als er das letzte Stück zum Auto zurückwatschelte, sah er, dass Beata unter der Straßenlaterne stand und die Beifahrertür des Tesla in Augenschein nahm. Ihr großer, schlanker Körper war in eines der schwarzen Versace-Kleider gehüllt, die er ihr geschenkt hatte. Der Kragen des Kleides lag wie ein Hundehalsband eng um ihre Kehle. Der Pelzmantel bedeckte ihre Schultern. Ein Grinsen umspielte ihren Mund, das jedoch verschwand, als sie seinen Gesichtsausdruck sah.
»Henry? Was ist denn passiert?«
Abrupt riss er die Arme nach oben.
»Was bedeutet das hier?« Beata las vor, was auf die Autotür geschmiert worden war. »Verräter?« Die Spange, die ihre dunklen Haare am hübschen Kopf zusammenhielt, funkelte. Dann fing sie an zu lachen. »Ach, Henry, nimm es nicht so schwer. Das sind nur Pöbeleien.« Mit ihrer Lederstiefelette tippte sie die Spitze seines Schuhs an. »Lass uns fahren.«
»Ich fahre doch verdammt noch mal nicht mit diesem verfluchten Graffiti an der Tür bei einem der exklusivsten Nachtklubs der Stadt vor!«
»Sagtest du nicht, du hättest eine Flasche Krug? Das ist Farbe, kein Sprühlack. Wenn wir uns beeilen, kriegen wir sie noch ab. Unten in Vika gibt es eine durchgehend geöffnete Waschanlage. Hast du schon mal in einer Autowaschanlage gevögelt?«
5
Leonard Rudi schreckte aus dem Schlaf hoch. Als er sich hingelegt hatte, war das Wohnzimmer mollig warm gewesen, jetzt glomm der Kamin nur noch, und ein eisiger Hauch zog durch die Holzwände.
Als er sich nach oben schob, spürte er in der Handfläche einen brennenden Schmerz. Es war, wie er befürchtet hatte: Trotz der Aloe-Vera-Creme hatte sich die Brandwunde beträchtlich verschlimmert, und unter der Schwellung pochte es. Leonard nahm die Streichhölzer von der Fensterbank. Während er die Spitze einer Nadel zum Glühen brachte, sah er hinaus in die Winternacht. Es schneite noch immer. Wie spät war es? Drei, vielleicht vier Uhr morgens? Mit einer schnellen Bewegung stach er die Blase auf. Nachdem er die helle Flüssigkeit herausgepresst hatte, blieb eine tote, weiße Hautschicht zurück. Er wollte gerade nach dem Verbandszeug greifen, als er es sah, an der Wand des Nachbarhofs: ein gelb flackerndes Licht.
Hier draußen im Wald, mitten in der Nacht. War der Dieb seines Autoradios etwa zurückgekehrt? Leonard ließ das Wohnhaus nicht aus den Augen, während er sich die Binde um die Hand wickelte. Aber das Licht sah er nicht mehr. Vielleicht war es doch nichts gewesen? Er wollte es schon dabei belassen, als ein dumpfer Knall jeglichen Zweifel ausräumte: Dort unten war jemand.
Er stapfte in den Flur hinaus, warf einen Blick auf die Schrotflinte, die über der Haustür hing – eine Hinterlassenschaft des älteren Ehepaars, das zuvor in dem Haus gewohnt hatte. Nein. Ich bin auf dem Land. In Norwegen, dachte er. Draußen schneite und stürmte es.
Im Herbst war Leonard aufrecht den Pfad entlang gegangen, der unter den Fichten hindurch zur Rückseite des Hauses auf Solro führte, aber jetzt, wo der Schnee auf den Ästen lastete, musste er sich bücken. Vor ihm kreuzte eine frische Hasenspur den Weg, ansonsten waren keinerlei Anzeichen von Leben zu sehen.
Von der Rückseite der Villa aus hielt sich Leonard eng an der Hauswand und bog um die Ecke. Direkt vor ihm lag ein abschüssiger Garten. Aus dem Schnee schauten die nackten Stämme von Obstbäumen hervor. Rechts befand sich die Scheune, und vor der Brücke zur Scheune zeichneten sich im Schnee ein paar tiefe Fußstapfen ab. Sie führten zum Eingang. Das Scheunentor war nur angelehnt, und ein stabiles Brett schien losgetreten worden zu sein. Vorsichtig bewegte er sich entlang des Waldrands. Hörte er von drinnen etwa Schritte? Den Lärm einer Person, die sich durch Gartengeräte und Maschinen hindurchwühlte?
Leonard gehörte nicht zu der nervösen Sorte Mensch, trotzdem wurde seine Stirn klamm, und er ballte die Faust, bis die Brandwunde schmerzte. Mit festen Schritten stapfte er hinauf und schob das Scheunentor auf.
»Hallo! Ist da wer? Hallo!«
Ruhig blieb er stehen, bis er die Umgebung erkennen konnte: Die Beine von über Sofas, Kommoden und Garderobenschränke verteilten Stühlen ragten wie Speere in die Luft. Es roch nach geöltem Holz und verfaulenden Möbeln. An den Wänden standen Regale voller Werkzeug, Farbeimern und Plastikkanistern. Der Wind pfiff bis unter den Dachfirst, einige Petroleumlampen klirrten, und es quietschte in den Scharnieren, als das Scheunentor langsam wieder zufiel.
War es ein Einbrecher, dann hatte er vermutlich entsetzliche Angst. Was, wenn der Kerl in Panik geriet? Mit einem Hammer oder einer Axt oder was auch immer sich hier finden mochte auf ihn einschlug? Vielleicht hatte er ein Messer dabei? Leonard hatte Männer gesehen, fast genauso groß wie er, die nach einem Streit mit mit kleinen Messern bewaffneten Rotznasen im Leichenschauhaus gelandet waren. Erwischte man die richtigen Stellen, spielte der Größenunterschied keine Rolle mehr.
Er war nicht hierhergekommen, um zu sterben. Er wollte nur Bescheid geben, dass der Wald Augen hatte. »Ich weiß, dass du hier bist«, brüllte er. Er machte ein paar Schritte vorwärts.
Als Fakir wusste Leonard besser als die meisten, dass der Wille den Instinkt in die Knie zwingen konnte – wie damals, als er sich dazu gezwungen hatte, den ersten Schritt über glühende Kohlen zu machen. Der Reflex, der einem den Magen umdreht, wenn das Schwert durch den Rachen gleitet. Der Wille erforderte jedoch, vorbereitet zu sein. Unvorbereitet gewann immer der Instinkt die Oberhand.
Deshalb konnte er sich nicht davon abhalten herumzuschnellen, als es an der Wand hinter ihm knallte. Leonard erkannte den Fehler, als er den zu Boden fallenden Hammer sah, als er hörte, wie ein Tisch beiseitegeschoben wurde und sich Schritte über die Bodendielen näherten.
Der kräftige Stoß in den Rücken schleuderte ihn mit rudernden Armen nach vorn, dann folgte ein weiterer Stoß, und er fiel der Länge nach hin. Bevor er es schaffte sich umzudrehen, traf ihn ein Knie schwer zwischen den Schulterblättern. Ihm blieb die Luft weg. Schützend warf Leonard die Hände über den Kopf, kniff die Augen zusammen und wartete auf den nächsten Schlag. Stattdessen aber ließ der Druck auf die Wirbelsäule nach, und er hörte, wie das Scheunentor zur Seite geschoben wurde.
Einen Augenblick lang blieb er einfach liegen. Die Angst verursachte ihm ein Pfeifen in den Ohren, das Herz pumpte und dröhnte, und er begriff, was gerade geschehen war. Das Arschloch war geflohen. Wütend stemmte er die geballten Fäuste auf den Boden und richtete sich auf.
Auf dem Pfad zur Hauptstraße entfernte sich eine Gestalt. Leonard stürzte hinterher. Seine Stiefel sanken tief in den Schnee ein, er war nicht mehr in der Lage schnell zu laufen, allerdings musste es dem Eindringling genauso gehen. Seine Muskeln schwollen an, er starrte nach vorn, der Pfad war schmal und schlängelte sich zwischen den Bäumen hindurch, erstreckte sich jedoch nicht weiter als über ein paar hundert Meter, bevor er in die Hauptstraße mündete. Als er sich um die letzte Kurve quälte, hörte er das Knallen einer Autotür, Sekunden später brummte ein Motor.
Das Auto stand auf dem frei geschippten Platz bei den Briefkästen. Obwohl ihn die kräftigen Scheinwerfer blendeten, stürmte Leonard vorwärts. Er erreichte den Parkplatz in dem Moment, als das Fahrzeug in einem Bogen zurücksetzte. Der Fahrer bremste scharf, legte ruppig den Gang ein und schlitterte über die eisbedeckte Hauptstraße, bevor die Reifen griffen. Das Fahrzeug entfernte sich mit rasanter Geschwindigkeit.
»Verflucht!«, stöhnte Leonard und starrte den roten Rücklichtern hinterher. »Verfluchte Scheiße!«
Erst als er wieder Luft bekam, bemerkte er, dass dort, wo das Auto gestanden hatte, etwas im Schnee lag. Die Kopfbedeckung war schwarz, und das Abzeichen auf der Mütze zeigte ein goldenes Emblem mit dem Reichslöwen auf rotem Hintergrund. Es war eine Polizeimütze.
6
Die Tür zur Autowaschanlage polterte, und Dampf drang nach draußen, der nach künstlichen Fruchtaromen und Seife stank. Beata Wagner rutschte auf dem Ledersitz nach vorn, hob den Hintern an und suchte mit den Fingern unter dem Kleid nach dem Rand ihres Slips. Sie warf Henry einen Blick zu. Er stand am Bezahlautomaten und hatte sich noch immer nicht nennenswert beruhigt. Es schien, als würde die Wut nur etwas anderes überlagern. Eine tiefere Form von Wut. Einen Zorn, der eine Schwäche, eine Kränkung berührte – Beata wusste, welche Triebe das in ihm weckte.
Sie hatte es geahnt, als sie sich ins Auto gesetzt hatte, und die Bestätigung erhalten, als er sich unmittelbar über die Mittelkonsole gelehnt, sie mit der kurzen, fleischigen Hand an der Kehle gepackt und zu sich gezerrt und ihr seine Zunge in den Hals gesteckt hatte. Sie hatte die geplatzten Äderchen in seinen Augen bemerkt, was bedeutete, dass er entweder zu viel Viagra oder zu wenig Herzmedikamente genommen hatte.
Eigentlich sollte ich Angst haben, dachte sie. Oder zumindest nervös sein.
Aber das war sie nicht.
Vielmehr zitterte sie. Denn in Beata Wagner gab es einen Raum, den sie das schwarze Zimmer nannte. Die Tür zu ihm hatte sie irgendwann als Teenager gefunden. Lange war das Zimmer ihr bestgehütetes Geheimnis gewesen, eine Quelle der Scham, die sie mit niemandem geteilt hatte. Später war sie an Orte gereist, die für Mädchen wie sie nicht gedacht waren, hatte Nächte erlebt, die zu Tagen wurden: Ecstasy und Brunst in Kellern unter namenlosen Klubs in Rotterdam, Marseille und Hamburg; durch Psilocybin hervorgerufene Psychosen mit asiatischen Geschäftsmännern im Luxushotel in Abu Dhabi; Whiskysuff mit peruanischen Gefängniswärtern des Lurigancho-Gefängnisses in einer Bar in Lima.
Dieses Leben war lange her. Die Tür zu diesem Zimmer ließ sich jedoch nicht mehr schließen – und das wollte sie auch nicht, denn sie schämte sich nicht mehr. Es war ein Zimmer für Männer wie Henry Falck. Sie ließ Henry und seinesgleichen nicht wegen der Geschenke an sich heran. Es ging nicht um physischen Kontakt, um eine Begegnung in der Einsamkeit. Es ging um Macht. Um Rohheit, um Unterwerfung, um Instinkt und Begierde. Henry sprach gern über Biologie und darüber, dass der Mensch die wichtigste Lehre der Evolution nicht verstehe. In dem dunklen Zimmer gab es keine Menschlichkeit. Nur Biologie.
Das Auto schaukelte, als Henry auf den Sitz plumpste. Sie reichte ihm die Flasche Krug, und als er begriff, was sie über die Öffnung gebunden hatte, loderte es in seinen Augen. Er trank begierig, ließ die kostbaren Tropfen durch die Spitze laufen, bevor er die Flasche auf den Boden warf, den Gürtel öffnete, den Hosenschlitz aufzog und in die Waschanlage hineinfuhr.
Beata feixte in Richtung der Überwachungskamera in der Ecke der Halle, bevor sie sich breitbeinig über ihm platzierte. Er war steif und gehörte zu jenen, die seiner Körpergröße entsprechend ausgestattet waren. Vielleicht war das der Grund, warum sie seine Anfragen immer wieder beantwortete.
»Diese verfluchte Schweinerei wird sich nicht abwaschen lassen«, sagte er, während sie spürte, wie sich seine Daumen in ihre Pobacken gruben.
»Henry …«
»Die verfluchte Farbe ist bereits getrocknet. Verdammt.«
»Henry …«, wiederholte sie, hob die Arme und versuchte im Nacken den Verschluss des Kleides zu öffnen. Dabei nahm sie unter dem Parfüm ihren eigenen Schweißgeruch wahr. Sie zog das Oberteil herunter und ließ ihn saugen.
Dort, ja. Seine Stirn glühte, und am Haaransatz machten sich zähe Schweißperlen breit. Die Maschinerie, die das Auto in Schaum und Wachs hüllte, jagte Erschütterungen durch das Fahrzeug, der Griff um ihren Hintern wurde fester, und die Dorschaugen traten ihm deutlich aus dem Schädel hervor. Herrgott, kam er etwa schon?
»Verflucht …«, stotterte er, schob sie nach hinten und drehte den Kopf zur Seite.
»Henry?«
»Da ist der Teufel!«
Brutal stieß er sie mit dem Ellenbogen zur Seite, sodass sie mit dem Rücken auf dem Beifahrersitz landete. Wovon redete er da? Sie schob sich nach oben und sah Henry dabei zu, wie er die Tür aufriss.
Der Mann hatte einen Armeestiefel auf der Motorhaube platziert. Seine Hände steckten in einer geräumigen Bauchtasche, und auch wenn Beata unter der großen Kapuze nur die Kinnpartie sah, hätte sie schwören können, dass er grinste. Henry zerrte die Tür auf und wurde von den Düsen mit einer Dusche aus Seife und Wasser empfangen. Er spuckte, räusperte sich und stürzte nach draußen, hielt mit einer Hand die Hose fest, während er mit der anderen seinen Schwanz an Ort und Stelle schob und nach dem Reißverschluss suchte.
»Du wirst es ganz entsetzlich bereuen, hierhergekommen zu sein«, brüllte er. »Ich werde die Schweinerei mit deiner Fresse abwaschen!«
Während er schrie, sah Beata, wie die kräftigen Waschbürsten hinter dem Mann im Kapuzenpullover zu rotieren begannen. Schaum und Wasser landeten auf der Frontscheibe, aber der Kerl rührte sich nicht, nahm lediglich den Stiefel von der Motorhaube und wandte sich Henry zu.
Endlich bekam der die Hose zu. Dann beugte er sich ins Auto und tastete nach dem Hals der Champagnerflasche. Für einen Moment begegnete er Beatas Blick. »Henry … nicht …« Seine Augen leuchteten rot. Sie verstummte.
Es gab drei Bürsten: zwei, um die Seiten des Wagens zu waschen und eine zur Reinigung von Motorhaube, Frontscheibe, Dach und Heck. Die Maschinerie setzte sich in Bewegung, und Henry sprang, um zu dem Mann zu gelangen, bevor die rotierenden Peitschen ihn daran hinderten. Keiner von beiden schien einen Gedanken daran verschwendet zu haben, was passieren würde, wenn die Bürsten über sie hinwegfegten. Die Halle war von Maschinengetöse und Dampf erfüllt, und Beata beobachtete erwartungsvoll, furchtsam und fasziniert das Geschehen. Der Kapuzenmann hatte einen Schritt nach hinten gemacht, und erst als Henry an den Frontscheinwerfern vorbeigetaumelt war, wurde ihr bewusst, wie groß er war. Der Mann überragte den stellvertretenden Direktor um mindestens zwei Köpfe.
Anschließend begriff sie, dass das Ganze hier kein Spiel war.
Das lag nicht daran, dass er seine Identität verbarg, auch nicht, dass er jetzt die Hand aus der Tasche zog und sie sah, was er darin versteckt hatte. Nein, etwas anderes brachte sie zu dieser Erkenntnis: die Art, wie er sich bewegte, vielleicht, die starre, maschinenartige Haltung, als würde er einfach einem Programm folgen. Auf einmal wurde ihr klar, dass an diesem Abend, nachdem Henry sie abgeholt hatte, nichts zufällig geschehen war. Der Mann, der dort vor dem Auto stand, der Mann, der jetzt die Pistole hob, war kein Rowdy, kein Sprayer oder Randalierer. Was auch immer er dort trieb, er übte dabei seinen Beruf aus.
Der scharfe Knall übertönte den Lärm der Waschanlage. Sie sah Henrys Gesicht. Schockiert und fassungslos. Die Flasche klirrte, als sie auf dem Betonboden landete. Beata sah, dass er sich beide Hände vor den Schritt hielt, während er sich langsam nach vorn beugte, umfiel und vor dem Auto verschwand.
»Nein, nein, nein, nein, nein«, rief sie – wollte sie überleben, musste sie nun handeln. Beata sprang auf den Fahrersitz. Grapschte nach der geöffneten Tür, bekam den Griff zu fassen und erhaschte dabei einen flüchtigen Blick auf das Wasser unter dem Auto: Blut hatte den Seifenschaum rosa gefärbt. Sie glaubte, einen weiteren Schuss zu hören, denn sie sah nichts, sie dachte nur nach, überlegte, wie zur Hölle man einen verdammten Tesla startete. Der Schlüssel musste sich doch irgendwo im Inneren des Wagens befinden … Stimmte das, oder hatte Henry ihn in der Tasche? Ein Pedal musste betätigt werden, sie zog die Beine nach, stampfte damit auf, trat ein Pedal nach dem anderen durch, trat auf alle gleichzeitig, suchte auf dem Armaturenbrett nach einem Knopf, einem Schalter … Nichts.
Nichts. In diesem Moment wurde die Hintertür aufgerissen, und ein Schatten landete schwerfällig auf der Rückbank. Sie drehte sich um und starrte in den Lauf der Pistole. Aus der Mündung stieg ein dünner Streifen Rauch auf, und es roch süßlich nach Schießpulver. Der Mann knallte die Tür zu, und dann saßen sie da: der Schatten unter der Kapuze, die Waffe und Beata Wagner. Die Bürsten erreichten das Auto. Ihr Herz, das wie das eines aufgescheuchten Hasen gerast war, drosselte urplötzlich das Tempo. Erneut gelang es ihr, Luft zu holen. Beata drehte ihm den Nacken zu, beugte sich nach vorn und spürte das kalte Lenkrad an ihren Brüsten.
»Ich weiß, warum Sie hier sind«, sagte sie.
7
Benedikte Stoltz wachte nicht gleich beim ersten Läuten ihres Handys auf, als jedoch der Schlummerton erklang, drehte sie sich auf den Rücken und öffnete die Augen einen Spaltbreit. Das Licht der Straßenlaternen verlieh der Holzdecke gelbe Nuancen, und die TV 2-Journalistin vernahm, wie die Winterbrise mit den Zweigen der Rieseneiche vor dem Schlafzimmerfenster spielte. Sie streckte sich und stellte fest, dass sie allein im Bett lag.
Nachdem sie als Reporterin aufgehört hatte, schaltete Benedikte das Telefon nachts in der Regel aus. Sie hatte einen leichten Schlaf, und wurde sie dabei gestört, konnte sie selten wieder einschlafen. Gestern Abend jedoch, nachdem sie sich aus dem Kleid geschält hatte, das sie bei der Veranstaltung im Schloss getragen hatte, war sie mit dem Telefon in der Hand stehen geblieben. Eine Vermutung hatte sich in ihr breitgemacht. Also hatte sie es ans Ladegerät angeschlossen und es auf den Nachttisch gelegt.
Benedikte stand auf. Der Schnee fiel dichter. Hier oben in Fagerborg war das Treiben der Stadt nur mehr ein Rauschen. Die Spiegelung aller Lichter und Laternen der Hauptstadt in den Wolken sowie die golden schimmernde Deckenverkleidung waren nunmehr die einzigen Erinnerungen daran, dass sie hier unter hunderttausend Anderen wohnte. Wie spät war es eigentlich? Sie schnappte sich das Telefon. Bald fünf. Anschließend las sie die Nachricht. »Endlich«, murmelte sie. Dann erschauderte sie leicht unter dem Seidenschlafanzug, schrieb den Namen auf einen Block und löschte die Nachricht.
Im Korridor war das Licht gedämpft, und im Obergeschoss war es dunkel, dunkel auch im Badezimmer und dunkel in der Küche. Sie befüllte den Filter der Espressokanne und stellte sie dann auf die Herdplatte, bevor sie die antike Wohnzimmertür öffnete.
Victoria saß vor den Rundbogenfenstern am Schreibtisch. Aus der Anlage erklang Elvis Costellos bitterliche Stimme, und das einzige Licht im Zimmer war – abgesehen von den drei Bildschirmen – der gedimmte Schein des Kronleuchters.
»Ich komme bald ins Bett, Liebe«, sagte Victoria, ohne sie anzusehen. »Hast du auf mich gewartet?«
Benedikte antwortete nicht, betrachtete lediglich die langen silbergrauen Haare, die Victoria zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte. Ihr Nacken leuchtete im Glanz der Bildschirme in einem unschuldigen Weiß.
Der Boden knirschte, als sie barfuß über den weichen Ghom-Teppich stapfte, Benedikte legte die Hände auf ihre Schultern. Ließ die Finger über den Angorapulli gleiten, bevor sie sich nach vorn beugte und sie in die Nackenbeuge küsste.
»Es ist fast Morgen, meine Liebe. Die von TV 2 haben mich gerade kontaktiert und mich gefragt, ob ich die Frühschicht übernehmen kann.«
Victoria drehte den Stuhl halb um, sodass sich ihre Blicke begegneten. »Haben die denn niemand anderen, den sie belästigen können?«
Benedikte strich ihr über die Stirn und fuhr mit einem Nagel an einer der schmalen Falten entlang.
»Doch«, antwortete sie und lächelte. »Viele. Aber nur ich bin dumm genug zu reagieren, wenn sie morgens um fünf anrufen.«
8
Ölfarbe, Staub und Tabak; dunkle Wolken hinter schneeweißen Bergrücken; von mäandrierenden Bachläufen in Streifen zerschnittene Abhänge; einige verrottete Bäume, und am Himmel eine einzelne Lücke, die den Sonnenschein durchließ. Und direkt unterhalb der Sonne stand eine schwarz angemalte Gestalt, breitbeinig und die Arme so verdreht, als würde sie am Kreuz hängen. Das Gesicht zum Himmel gerichtet, die Augen weit aufgerissen und eine klaffende Leere dort, wo sich eigentlich Mund und Nase hätten befinden müssen. Nur fauchender Atem, auf eine Art, die die feinen Grenzen zwischen Fantasie, Traum und Wirklichkeit verschwimmen ließ. Der Mörder.
»Sie wirken abwesend. Ist das eine Nebenwirkung der Antidepressiva?«
Die Stimme lockte ihn von der Szene weg, die er gerade heraufbeschworen hatte. Fredrik Beier suchte auf dem niedrigen Sofa nach einer besseren Sitzposition für sich.
»Ich nehme die Pillen nicht mehr. Der Gedanke, dass ich deprimiert bin, deprimiert mich.«
Das Lachen des Betriebspsychologen klang freudlos.
»Ich habe gestern an einer Veranstaltung im Schloss Akershus teilgenommen«, fuhr Fredrik fort. »Anschließend musste ich mich etwas abreagieren. Es ist spät geworden.«
»Ich verstehe«, sagte der Psychologe und hämmerte seinen aufgedunsenen Zeigefinger viel zu fest gegen das Display seines Tablets.
»Schreiben Sie alles, was ich sage, auf?« Fredrik streckte die Hand nach dem Becher mit dem Pulverkaffee aus und pustete in die warme Flüssigkeit, woraufhin die rechteckige Brille beschlug.
»Ich habe Sie nach Ihrem Vater gefragt«, sagte der Psychologe. »Danach sind Sie ganz still geworden. Haben Sie an etwas Spezielles gedacht?«
Fredrik wartete, bis er wieder etwas sehen konnte. Wie üblich kippelte der übergewichtige Polizeipsychologe auf einem abgenutzten Bürostuhl, der jedes Mal einen kreischenden Laut von sich gab, wenn er das Gewicht zwischen den Pobacken verlagerte.
»Es ist seltsam, dass Sie diese Frage gestellt haben.«
»Ach so?«
»Ich bin gestern einer Journalistin begegnet. Sie hat behauptet, mein Vater hätte eine Verbindung zu einer Sache, an der sie arbeitet.«
Als er am Morgen in der Dusche gestanden hatte, war Fredrik das Gespräch wieder eingefallen. Anschließend war er nicht in der Lage gewesen, den Gedanken daran abzuschütteln. Während er von seiner Wohnung in der Sorgenfrigata in Majorstua durch das Schneegestöber zum Polizeipräsidium in Grønland gelaufen war, hatte er eingesehen, dass er nicht mehr wusste, wie sein Vater ausgesehen hatte. Er erinnerte sich zwar an das Gefühl, im selben Raum wie er zu sein, an die Atmosphäre, die er erzeugt hatte, seine Züge jedoch waren ausgelöscht. War das der Grund, warum die Erinnerungen an den Vater und den Mörder miteinander verschmolzen?
»Alles, was ich noch von meinen Eltern habe, passt in einen Safe. Er ist vor über zwanzig Jahren gestorben, und als ich klein war, war er nicht sonderlich oft da. Er hat für die Amerikaner gearbeitet, nicht in der Botschaft, sondern in einem angemieteten Büro.«
Fredrik runzelte die Stirn, um sich besser zu erinnern.
»Wenn ich versuche, ihn mir vorzustellen, sehe ich stattdessen das Gemälde, das über seinem Schreibtisch hing. Eine Berglandschaft. Sie verschwimmt mit einem meiner Träume. Oder … einem Albtraum. Ein Albtraum von einem Mann, den ich mal gejagt habe. Einen Mörder. Den bösesten Menschen, der mir je begegnet ist.«
»Warum assoziieren Sie Ihrer Ansicht nach diese Vorstellungen miteinander«, fragte der Psychologe.