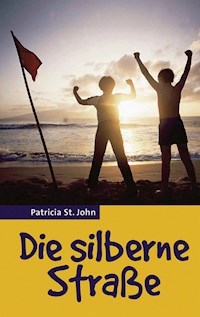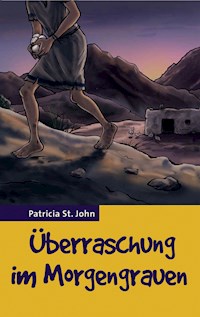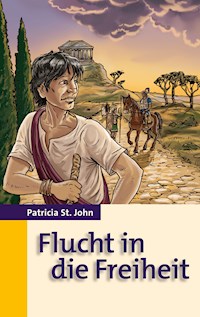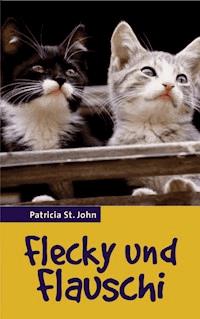Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibellesebund
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eliane, das egoistische, verwöhnte Mädchen aus der Stadt, kommt als Pflegetochter in eine Pfarrfamilie. Dort erlebt sie mit ihren neuen Freunden viele Abenteuer: den Einbruch in das Haus mit dem verschlossenen Garten, die Zeltferien am abgelegenen Baggersee … Mit der Zeit merkt Eliane, dass in der Bibel steht, wie sie glücklich werden kann. Und sie will Freude, ungetrübte Freude! Zu diesem Buch gibt es Quizfragen in Antolin. Antolin ist ein Online-Portal zur Leseförderung von Klasse 1 bis 10. Die Schüler lesen ein Buch und können dann unter antolin.de Quizfragen zum Buchinhalt beantworten. Richtige Antworten werden mit Lesepunkten belohnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patricia St. John
Der verschlossene Garten
Impressum
Originaltitel: »Rainbow Garden«
erschienen bei: Scripture Union (Bibellesebund), London)
© 1960 by Patricia St. John
Deutsch von Elisabeth Aebi
© 1986 der deutschsprachigen Ausgabe
© 2018 der eBook-Ausgabe
Bibellesebund Verlag, Marienheide
https://shop.bibellesebund.de/
Cover: Georg Design, Münster
ISBN 978-3-95568-321-4
Hinweise des Verlags
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf - auch teilweise - nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des Textes kommen.
Noch mehr eBooks des Bibellesebundes finden Sie auf
www.ebooks.bibellesebund.de
Inhalt
Titel
Impressum
Der Kloß im Hals
Der erste Tag
Eine Vorahnung
Unter dem Schnee
Der fremde Mann
Das offene Fenster
Die Regenbogen-Muschel
Im Buchenwald
Leben im Licht!
Weiße Kleider
Der lebendige Garten
Bist du gut?
Der unvergessliche Geburtstag
Die unerwartete Begegnung
Vor der Tür
Das Zeltlager am See
Barbaras Tag
Im Nebel
Die Rettung
Der richtige Weg?
Der Kloß im Hals
Der Zug ratterte im gleichmäßig eintönigen Takt. Die Landschaft Mittelenglands raste am Fenster vorbei. Die Luft im Wagen war warm und dick und mit den verschiedensten Gerüchen der vielen anderen Reisenden durchsetzt.
Meine Mutter hatte mich einer Dame anbefohlen, die von London nach Irland fuhr. Aber ich war nicht gerade ein liebenswürdiges Kind – nach der scheußlichen Verabschiedungszeremonie von vorhin erst recht nicht – und schenkte ihr keine Aufmerksamkeit, sodass auch sie mich bald nicht mehr beachtete.
Ich kuschelte mich in die Ecke meiner Sitzbank und las in meinen Comic-Heften, die mir meine Mutter kurz vor der Abfahrt auf dem Bahnhof am Kiosk gekauft hatte. Von Zeit zu Zeit steckte ich mir ein Gummibärchen in den Mund und schaute zum Fenster hinaus. Kilometerweit konnte ich nichts als nasse, gelbliche Felder und kahle, dunkle Hecken und Bäume erblicken, hinter denen die Ferne sich im Nebel verlor. Alles sah so kalt und schmutzig, einsam und hässlich aus, dass ich es bald satt hatte hinauszuschauen.
Stattdessen gingen meine Gedanken spazieren. Erst vor drei Tagen hatte mich meine Mutter vor die Tatsache gestellt, dass ich zum Schulbeginn nach den Winterferien aufs Land fahren müsse. Sie hätte eine interessante Arbeit im Ausland erhalten und könne sich so einen lang ersehnten Wunsch erfüllen. Leider könne sie mich nicht mitnehmen.
Meine Mutter war dabei gewesen, meine Haare zu frisieren, als sie mir diese Neuigkeit an den Kopf geworfen hatte. Noch jetzt konnte ich meinen verdutzten Gesichtsausdruck im Frisierspiegel sehen. Mit einem Lächeln im Gesicht versuchte sie mir zu erklären, dass sie eine nette Familie für mich gefunden hätte: Eine frühere Schulfreundin würde mich liebend gern in ihre Familie aufnehmen. Sie hätte selber sechs Kinder. Janet wäre nur ein paar Monate jünger als ich. Mit ihr zusammen könnte ich die Schule besuchen.
Die Gedanken an diese letzten drei Tage schwirrten mir durch den Kopf, während die Räder der Eisenbahn gleichmäßig stampften. In meinem Hals saß ein dicker Kloß. Würde ich – verwöhnt als Einzelkind, eitel und meist sehr egoistisch, wie mir Frau Moody, unsere Haushälterin, oft gesagt hatte – würde ich es je aushalten bei einer Familie? Würde ich die Stadt London, mein schön eingerichtetes Zimmer und Frau Moody nicht schrecklich vermissen? Könnte ich je wieder glücklich werden?
Die Landschaft veränderte sich kaum. Hässlich und einsam sah sie aus – genauso, wie ich mich fühlte. Es gab aber kein Zurück mehr. So fügte ich mich in mein Schicksal, kuschelte mich noch tiefer in die Ecke meiner Sitzbank und schlief fest ein.
Hätte mich die gute Dame nicht geweckt, ich hätte den Zeitpunkt des Aussteigens glatt verschlafen. So aber stolperte ich mit meinem großen Koffer aus dem Wagen und blieb abwartend, noch ganz schläfrig und verwirrt, auf dem Bahnsteig stehen. Der Zug fuhr sofort weiter. Das Erste, was mir hier – nach der Großstadt London – auffiel, war die Stille: kein Verkehr, kein Getrampel von tausend Füßen – nur das gedämpfte Rauschen des Meeres jenseits der Bahnhofshalle und das weiche Rieseln von Wellen über Kieselsteine. Ich schnupperte. Die Luft roch salzig und frisch.
In diesem Augenblick sah ich eine Frau auf mich zueilen, so schnell, wie drei kleine Kinder, die an ihren Händen und an ihrem Mantel hingen, es ihr erlaubten. Sie hatten am anderen Ende des Bahnsteigs gewartet. Ich nahm an, dass das die Mortons sein müssten. Ich ging ihnen nicht entgegen, sondern blieb ruhig bei meinem Koffer stehen. Dann streckte ich meine behandschuhte Hand aus und sagte in dem kühlen, unverbindlichen Gesellschaftston meiner Mutter, mit dem sie Leute begrüßte, die ihr unsympathisch waren: »Guten Tag, Frau Morton!«
Sie war sichtlich überrascht, und im trüben Licht jenes Februarnachmittags wechselten wir stumm einen abwägenden Blick. Dann huschte eine Bewegung über ihr Gesicht, die ich nicht zu deuten wusste: Wollte sie lachen oder weinen? Jedenfalls schob sie meine Hand beiseite, küsste mich sanft auf beide Wangen und sagte: »Wie schön, dass du zu uns kommst, Eliane! Wir sind alle ganz aufgeregt. Peter und Janet sind traurig, dass sie nicht rechtzeitig aus der Schule heimkommen konnten, um dich abzuholen. Aber Johnny, Rosmarie und Robert sind hier, und die anderen erwarten dich zu Hause. Komm, das Taxi steht bereit.«
Johnny, Rosmarie und Robert schienen ebenso wenig wie ich zu wissen, was wir voneinander halten sollten. Ich nahm an, sie erwarteten ein Wort oder einen Kuss von mir. Aber ich hatte keine Ahnung vom Umgang mit kleinen Kindern. In ihren wollenen Kappen, dicken Mänteln und festen Stiefeln sahen sie fast ebenso breit wie lang aus.
Als wir das Taxi erreichten, kugelten sie alle drei auf den Rücksitz und begannen unter einer Decke miteinander zu tuscheln. Ich saß vorn neben Frau Morton, antwortete »Ja« oder »Nein« auf ihre Fragen und fühlte mich schrecklich schüchtern und elend.
Wir ließen die kleine Stadt hinter uns. Die Gegend, durch die wir fuhren, war die trübseligste Gegend, die ich je gesehen hatte. Es herrschte ein kaltes, dunstiges Zwielicht, und Bäume und Hügel blieben unsichtbar. Ich konnte nichts erkennen außer nassen Straßen und eine trostlos eintönige Landschaft. Und nirgends eine Menschenseele! Was in aller Welt konnte man hier den ganzen Tag treiben?
Ich hörte nicht mehr, was Frau Morton sagte, und starrte aus dem Fenster. Die Kleinen streckten wie Häschen ständig die Köpfe unter der Decke hervor, kicherten und verschwanden wieder. Ich glaube, es war ihre Art, Annäherungsversuche zu machen, aber ich achtete nicht darauf.
Auf einmal rief Johnny: »Da ist unser Haus!« Er stieß mich ziemlich unsanft in den Rücken und zeigte nach vorn.
Ich folgte, plötzlich gespannt, mit den Blicken seinem Zeigefinger.
Wir waren zwischen Baumreihen dahingefahren; jetzt fuhren wir wieder auf offener Straße. Dort am Abhang leuchteten uns die hellen Fenster eines Hauses entgegen. Es waren die einzigen Lichter in jener Richtung, denn das Haus stand abseits vom Dorf, und sie schienen Wärme und herzlichen Empfang zu verheißen. Ich warf einen scheuen Blick auf Frau Morton.
Sie lächelte mir zu. »Willkommen im Pfarrhaus, Eliane, hier sind wir zu Hause!«
Als das Taxi durch das Gartentor fuhr, öffnete sich die .Haustür, und zwei stämmige Kinder samt einem gewaltigen Schäferhund stürzten uns unter Hallogebrüll und Gebell entgegen. Ich verabscheute laute Kinder und schreckte zurück. Aber sie schienen es nicht zu merken. Sie tanzten wie wild um ihre Mutter herum, und als ich schließlich doch ausstieg, sprang der Hund an mir hoch, legte mir die Vorderpfoten auf die Schultern und versuchte, mir das Gesicht zu lecken. Die Kinder jauchzten vor Vergnügen, denn gerade das hatten sie ihm anscheinend beigebracht. Ich aber meinte, er wolle mich beißen, und schrie vor Entsetzen laut auf.
Frau Morton hatte mich im Nu befreit und beruhigte die aufgeregte Gesellschaft.
»Er will dich nur begrüßen, Eliane«, erklärte Janet. »Er kann dir auch die Hand schütteln. Streck die Hand aus, dann streckt er dir die Pfote entgegen. Er ist ein sehr höflicher Hund.«
Aber ich fand ihn grässlich und wich immer weiter zurück. Die Kinder waren höchst erstaunt. Sie konnten nicht begreifen, dass jemand sich vor Nero fürchtete. Ich bemerkte, wie Janet und Peter einen belustigten Blick austauschten, während wir irgendwie allesamt den Gartenweg hinaufgingen und durch die Haustür ins Haus gelangten. Es war klar: Ich hatte einen schlechten Anfang gemacht.
Janet nahm einen neuen Anlauf, mich willkommen zu heißen, und sagte freundlich: »Du schläfst bei mir. Ich will dir das Zimmer zeigen und dir beim Auspacken helfen.«
Damit führte sie mich die Treppe hinauf, und Peter kam mit dem Koffer hinterher. Sie öffnete die Tür zu einem kleinen Schlafzimmer, in dem zwei Betten nebeneinander standen.
Es gefiel mir nicht, und ich gab mir auch keine Mühe, dies zu verbergen. In London hatte ich ein eigenes Zimmer bewohnt mit elektrischer Heizung, einem dicken Teppich, einem kleinen Büchergestell aus Eichenholz, einem bequemen Sessel und einem Spielzeugschrank – alles für mich ganz allein. Dies hier war, so fand ich, ein schäbiges, kaltes, kleines Zimmer. Ich sah nicht die vielen Willkommenszeichen, die die Kinder liebevoll darin angebracht hatten: die Hyazinthenknospe auf der Kommode, Rosmaries liebsten Teddybär auf meinem Bett, Peters Lieblingsbild, ein Schlachtschiff, das an der Wand über meinem Kissen klebte, und das winzige Moosgärtchen, das in einem Blechdeckel auf meinem Stuhl lag.
Janet beobachtete mich gespannt, aber ich zeigte nicht die kleinste Regung einer Freude, und der erwartungsvolle Ausdruck auf ihrem Gesicht erlosch. Schüchtern wies sie auf mein Bett und meine Schubladen und sagte, sie müsse ihrer Mutter beim Zubereiten des Abendessens helfen.
Ich spürte, dass sie froh war wegzugehen, und ich selbst war froh, dass sie ging. Widerwillig betrachtete ich die dünnen Bettvorleger, die alten Vorhänge und Bettdecken, und dabei bemerkte ich zwei klebrige Karamellen und einen welken Zweig Winter-Jasmin auf meinem Kissen. Ich schleuderte alles zornig in den Papierkorb. Mama und Frau Moody würden nie dulden, dass auf dem Kissen eines Gasts solches Zeug läge, und ich verstand nicht, wie Frau Morton dies erlauben konnte. Ich öffnete meinen Koffer und begann, meine Kleider in den Schrank zu hängen. Es tat mir wohl zu sehen, dass sie viel hübscher waren als Janets Kleider. Mein neues Nachthemd mit den vielen Fältchen breitete ich in seiner ganzen Pracht auf dem Bett aus. Vielleicht hatte ich Janet doch einiges voraus, auch wenn ich mich vor Hunden fürchtete!
Als ich gerade dabei war, die Fältchen hübsch zu legen, erschien Frau Morton mit dem Jüngsten auf dem Arm, einem rundlichen, strampelnden Baby, das noch kein Jahr alt sein konnte.
»Das ist Klein-Anne«, sagte sie. »Ich hoffe, du hast kleine Kinder gern. Ich zähle nämlich auf deine Mithilfe. Sechs Kinder machen eine ganze Menge Arbeit, und du wirst nun meine älteste Tochter sein. Du bist doch elf, nicht wahr?«
»Ja«, erwiderte ich und schaute gebannt auf Klein-Anne, die plötzlich einen glucksenden Laut von sich gab und breit lächelte, wobei zwei Zähnchen sichtbar wurden. Es war mir ganz neu, dass man von mir irgendwelche Mithilfe im Haushalt erwarten konnte. Zu Hause verrichtete Frau Moody alle Arbeit allein. Ich spielte oder saß vor dem Fernseher oder las. Nun wusste ich nicht recht, was ich von diesem neuen Gedanken halten sollte. Das Baby pflegen zu helfen, würde vielleicht Spaß machen. Ich konnte es jedenfalls einmal versuchen. Und wenn es mir dann nicht gefallen sollte, würde ich es einfach wieder bleiben lassen. Denn ich wollte auf meine Weise glücklich sein. Und das bedeutete: haben, was ich wollte, und tun, was mir gefiel. Von irgendeinem anderen Glück wusste ich nichts.
Ich sah zu, wie Frau Morton Anne in ihr Bettchen legte und zudeckte, und folgte ihr dann ins Esszimmer hinunter. Mit Erleichterung stellte ich fest, dass der riesige Kartoffelauflauf, der soeben aufgetragen wurde, von einem rotbackigen Mädchen namens Emma auf den Tisch gestellt wurde. Ich hatte schon befürchtet, es sei keine Hausangestellte da und man erwarte von mir, dass ich das Geschirr spülen oder Staub wischen solle, was ich auf keinen Fall vorhatte.
Als alles bereit war, kam Pfarrer Morton aus seinem Studierzimmer. Er war ein großer, schlanker Mann mit ernsten Zügen, aber freundlichen blauen Augen. Er hob Robert hoch, über den er beinahe gestolpert wäre. Dieser hatte ihm nämlich, sobald die Tür aufgegangen war, die Arme um die Beine geschlungen. Er begrüßte mich sehr herzlich. Nachdem er das Tischgebet gesprochen hatte, setzten wir uns unter unbeschreiblichem Stimmengewirr zu Tisch. Der Pfarrer war eben erst von seinen Hausbesuchen zurückgekehrt, und da Peter und Janet ihn seit dem Frühstück nicht mehr gesehen hatten, wussten sie ihm unglaublich viel zu erzählen. Johnny und Rosmarie schienen seit dem Mittagessen ebenfalls unerhört viel erlebt zu haben und platzten fast vor Neuigkeiten.
»Papa«, begann Peter, »ich sitze jetzt neben Glyn Evans. Er sagt, er würde mir für ein paar Marken und eine Schleuder zwei Kaninchen geben. Darf ich sie nehmen, Papa?«
»Papa«, fiel Janet ein, »vielleicht komme ich zur Basketball-Mannschaft. Könnten wir nicht im Garten einen Pfosten einschlagen, damit ich üben kann?«
»Darf ich, Papa?«, fragte Peter.
»Papa, Papa«, schrie Johnny, weil ihm plötzlich etwas ungeheuer Aufregendes einfiel, »wir sind gerade auf der Brücke gewesen, als der Zug unten durchgefahren ist, und der ganze Rauch ist rings um uns heraufgekommen!«
»Können wir, Papa?«, wiederholte Janet.
»Wir haben zwei ganz kleine Lämmer auf dem Feld gesehen, ich hab sie schreien hören«, sagte Rosmarie laut genug, um ihren Vater über all den Lärm hinweg zu erreichen. Sie strahlte ihn selig an, da sie ihre Neuigkeit ohne Zweifel für die allerwichtigste hielt. Und er strahlte zurück, denn er wusste genau, wie viel solche Erlebnisse seiner Fünfjährigen bedeuteten.
»Darf ich, Papa?«, fragte Peter wieder. Er war ein sehr ausdauernder Junge, wie ich später herausfinden sollte. »Können wir, Papa?«, rief Janet fast gleichzeitig.
»Ich glaube, ja«, erwiderte der Vater ruhig. »In der Garage liegt ein alter Pfosten, Janet. Wir könnten einen Ring aus Draht daran befestigen und ihn im Garten aufstellen. Und ich will sehen, ob ich eine Kiste und etwas Drahtgeflecht für deine Kaninchen auftreiben kann, Peter. Wie steht’s mit dir, Eliane? Spielst du auch Basketball?«
»Manchmal schon«, murmelte ich und wünschte, man würde mich in Ruhe lassen. Ich fühlte mich schrecklich verlegen all diesen fröhlichen, zutraulichen Kindern gegenüber. Wie unangenehm, dass Janet so versessen auf Basketball war! Ich selbst hatte mir nie viel aus Spielen gemacht. In den Ferien war ich entweder im Haus geblieben oder mit meiner Mutter einkaufen oder spazieren gegangen. Ich hatte nie gelernt herumzutollen, zu springen und zu spielen.
Der Kartoffelauflauf schmeckte mir auch nicht. Ich wäre gern nach Hause gegangen. Die Tränen stiegen mir in die Augen und wären vielleicht geflossen, hätte ich nicht plötzlich bemerkt, dass Rosmarie mich geheimnisvoll ansah, das runde Gesicht voll mühsam unterdrückter Erregung.
»Hast du sie gesehen?«, flüsterte sie. Ihre Frage blieb von den anderen ungehört, weil eine heftige Diskussion zwischen Peter und Janet entbrannt war. Es ging bei den beiden anscheinend darum, ob sie weiße oder braune, alte oder junge, männliche oder weibliche Kaninchen haben wollten. Es schien da zahllose Möglichkeiten zu geben.
»Was?«, flüsterte ich schüchtern zurück.
»Meine Überraschung«, erklärte sie leise, mit glänzenden Augen. »Was ich auf dein Kissen gelegt habe – hast du’s gesehen?«
Da fielen mir die klebrigen Karamellen und der welke Zweig ein. Ich hatte gemeint, es sei wertlos, aber nun merkte ich, dass es kostbare Dinge sein mussten. »Ja«, sagte ich, »ich hab’s gesehen … Danke, Rosmarie.«
Plötzlich trat Stille ein. Johnny legte eine Bibel vor seinen Vater auf den Tisch. Der Vater schlug sie auf, und sofort wurde die ganze lebhafte Schar ruhig. Ich hatte immer gedacht, die Bibel sei ein todlangweiliges Buch, aber hier schien jedermann aufmerksam zu werden, sogar die kleine Rosmarie.
Ich selbst machte gar keinen Versuch zuzuhören, war ich doch davon überzeugt, dass ich auch beim besten Willen nichts verstehen würde. Es war von einem Weinstock und ein paar Reben die Rede, aber erst der letzte Vers ließ mich aufhorchen.
»Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt.« (Johannes 15,11)
Der Klang dieser Worte gefiel mir; ich sagte sie in Gedanken noch einmal auf. Da schlossen auch schon alle die Augen und neigten die Köpfe zum Gebet. Ich merkte es, weil Frau Moody mich manchmal das Vaterunser hersagen ließ. Aber ich spürte auch sofort, dass dies hier etwas anderes war. Pfarrer Morton sprach wie zu jemandem, der bei uns im Zimmer war, und sein Gebet schloss uns alle auf geheimnisvolle Weise in eine große Geborgenheit ein: Mama weit weg in London, die Kinder rund um den Tisch, die schlafenden Kleinsten in ihren Bettchen – wir alle wurden jemandem nahegebracht, der sich um uns kümmerte und uns gut und glücklich machen wollte.
Eine Stunde später, nachdem Frau Morton uns einen Gutenachtkuss gegeben hatte und Janet neben mir eingeschlafen war, lag ich wach in meinem Bett, noch ganz benommen von allem, was ich erlebt hatte. Waren bereits Jahre vergangen, seit das Taxi in London um die Ecke gebogen und Frau Moody meinen Blicken entschwunden war? Wieder füllten sich meine Augen mit Tränen der Verlassenheit, und ich sehnte mich nach Hause zurück. Doch da stiegen jene seltsamen Worte in mir auf, die irgendwie einen wunderbaren Trost zu versprechen schienen: »Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt.«
»Was war mit ›dies‹ gemeint? Was hat er wohl gesagt?«, fragte ich mich. Und ich wünschte, ich hätte besser zugehört.
Der erste Tag
Als ich am folgenden Morgen erwachte, war Janet bereits fertig angezogen und traf Vorbereitungen für ihren freien Samstag zu Hause. Sobald sie sah, dass ich die Augen öffnete, fing sie an zu plaudern. Ihre Schüchternheit schien über Nacht verflogen zu sein. Während ich mich ankleidete, hopste sie auf ihrem Bett herum und weihte mich in alle Geheimnisse der Familie ein. Bis zum Frühstück war ich so gut informiert, dass ich mich nicht mehr fragen musste, wie man auf dem Land die Zeit totschlagen könne. Im Gegenteil wunderte ich mich nun, wie diese Kinder es fertigbrachten, so viele Abenteuer in zwölf kurze Stunden hineinzupacken.
Nach dem Frühstück halfen alle im Haus oder Garten und fanden anscheinend Spaß daran. Janet und Rosmarie stritten sich um das Vorrecht, Anne füttern zu dürfen. Die Kleine hatte uns während der ganzen Mahlzeit mit ihren Jauchzern und vergeblichen Versuchen, das runde Köpfchen durch die Stäbe ihres Laufstalles zu zwängen, köstlich unterhalten. Die beiden Mädchen ereiferten sich immer mehr, und ich begann, mich um Annes Sicherheit zu sorgen. Aber Frau Morton steckte den Kopf zur Tür herein und erinnerte die Mädchen daran, dass Rosmarie an der Reihe sei, die Kleine zu füttern. Rosmarie jedoch liebte ihre ältere Schwester so sehr, dass sie in einer plötzlichen Anwandlung von Großzügigkeit sagte, Janet dürfe Anne schon füttern. Aber Janet wollte nun nicht weniger großzügig sein und erwiderte: »Nein, Rosmarie, du darfst es machen. Ich helfe Emma!« – Und damit war sie zur Tür hinaus. Ich aber wunderte mich, wozu dann all die Aufregung gewesen war.
Die Jungen holten Holz zum Anfeuern, Frau Morton ging in die Küche, und auf einmal war es merkwürdig still. Nur Annes Schmatzen und Glucksen und Rosmaries sanfte Stimme waren zu hören. Ich stand am Fenster. Es war wieder ein regnerischer Tag, und ich konnte hinter dem Gartenzaun noch immer nichts erkennen als ansteigende gelbe Felder und schwarze Umrisse von Bäumen.
Feiner Nebel hüllte alles ein. Doch es war ein leichter, heller Nebel, der beinahe den kommenden Sonnenschein versprach. Ich fragte mich mit einiger Spannung, was ich erblicken würde, wenn der Nebel sich hob. Würden es weitere endlose Felder und Hecken sein, oder lag hinter dem Nebel eine freundlichere, abwechslungsreichere Landschaft? Während ich so vor mich hin träumte, stimmte irgendwo in der unsichtbaren, geheimnisvollen Gegend ein Vogel ein wohlklingendes Lied an.
Eine Hand legte sich auf meine Schulter und rief mich jäh in die Wirklichkeit zurück. »Eliane, mein Liebes«, sagte Frau Morton, »willst du dein Bett machen und mir dann bei den Betten der Kleinen helfen? Nachher wollen die Kinder draußen spielen, und ich denke, du gehst bestimmt gern mit.«
Ich blickte erstaunt und nicht besonders erfreut auf. Erstens: Weshalb sollte ich als Gast mein Bett selbst machen? Zu Hause tat Frau Moody das für mich. Und zweitens: Was in aller Welt konnte man bei so einem kalten, feuchten Wetter draußen unternehmen? Aber ich hatte in meinem kurzen Leben gelernt, meine Gedanken für mich zu behalten. Ich folgte Frau Morton in das obere Stockwerk und widmete mich der Aufgabe des Bettenmachens.
Aber da ich an Wohnungen mit Zentralheizung und elektrischen Öfen gewöhnt war, kamen mir die Schlafzimmer eiskalt vor. Mich schauderte, und ich machte ein missmutiges Gesicht.
Frau Morton meinte: »Auf dem Land ist es kalt im Vergleich zu London. Aber du wirst dich schnell daran gewöhnen. Du musst dir nur recht viel Bewegung verschaffen, dann wirst du bald so rosig aussehen wie Janet. Weißt du, Eliane, jetzt haben wir die unfreundlichste Jahreszeit, aber der Frühling steht vor der Tür. Jeder Tag ist ein bisschen länger und heller als der vorhergehende. Bald werden überall Blumen wachsen. Dann wird es dir bei uns gefallen.«
Auf einmal begann sie von meiner Mutter und ihrer gemeinsamen Schulzeit zu erzählen. Das fesselte mich. Ich hörte aufmerksam zu und musste sogar lachen. Es kam mir deshalb ganz ungelegen, als ein allgemeines Getöse im unteren Flur anzeigte, dass die Kinder bereit waren, ins Freie zu gehen.
Johnny kam die Treppe heraufgestürmt, wobei seine Stiefel gegen die Teppichstangen schlugen, und rief laut: »Mami, ich hab ’nen toten Hasen gefunden. Wir machen eine Beerdigung. Hast du eine alte Schuhschachtel?«
»Oh«, sagte Frau Morton leicht beunruhigt, »hoffentlich ist es nicht ein Hase, der schon allzu lange tot ist!«
Janet antwortete beschwichtigend: »Nein, nein, Mama, es ist ein eben erst gestorbener. Er fühlt sich noch warm an.«
Die Mutter eilte mit Zeitungen und einer Pappschachtel die Treppe hinunter. »Wickelt ihn in diese Zeitung und in ein paar große Blätter und legt ihn in die Schachtel. Aber rührt ihn nicht mehr an! Und du, Johnny, wasch dir die Hände!«
»Ich spiele nicht Beerdigung«, verkündete Peter überlegen. »Das ist was für Kleine. Ich gehe klettern!«
»Ach nein, Peti!«, rief Janet bestürzt. »Wir spielen doch immer erst was mit den Kleinen. Du brauchst nicht im Leichenzug mitzugehen. Du kannst vorauslaufen und das Grab ausheben. Dann läutest du die Glocke, und ich spiele den Pfarrer. Wir müssen auch einmal etwas unternehmen, was den Kleinen gefällt. Wir können nachher klettern gehen!«
Wie ich später herausfand, liebte Janet Begräbnisse über alles. Sobald Peter davongegangen war, um ihren Vorschlag auszuführen, nahm sie die Sache ernsthaft in die Hand. »Jedermann holt Blätter und Tannenzweige!«, befahl sie. »Die Schachtel muss schön aussehen.«
Sie wurde von Robert unterbrochen, der mit rotem Gesicht in unsere Mitte platzte. Er hatte soeben mit Emmas Hilfe einen siegreichen Kampf mit seinen Stiefeln ausgefochten. Er wusste nicht, was ein Begräbnis war, wollte es aber um keinen Preis verpassen. »Wobi kommt zu Beed’gung«, sang er vergnügt, »und Jumbo Efanti, Jumbo kommt zu Beed’gung auch!«
»Gut, gut, du darfst die Schuhschachtel ziehen, Robi«, erlaubte Janet freundlich. »Jumbo ist ein schwarzes Pferd. Wir binden ihm die Schachtel mit einer Schnur an den Schwanz. Du musst Jumbo dem Leichenzug voranführen. Ich bin der Taxifahrer und schiebe Rosmarie und Johnny als Trauergäste im Schubkarren hinterher.«
»Aber du bist doch der Pfarrer!«, warf Rosmarie ein.
»Nicht, bevor wir dort sind. O, Eliane ist ja auch noch da! Ich hatte sie ganz vergessen. Du kannst hinterhergehen, Eliane, und Blumen tragen!«
»Es gibt doch keine«, sagte ich kalt. Sie kamen mir allesamt verrückt vor.
»Dann nimm einen Eichenzweig«, befahl Janet und zeigte auf einen Baum beim Gartentor. »Und nun vorwärts, sonst wird Peter ärgerlich!«
Wir kamen äußerst langsam voran. Jumbo, ein merkwürdiges, formloses Gebilde mit vier Beinen, einem Rüssel und einem Schwanz, wurde nämlich Schritt für Schritt den Gartenweg hinabgeführt. Die Schachtel polterte hinter ihm her. Nach einer Weile läutete Peter hinter der Lorbeerhecke mit der Essensglocke Sturm, und schließlich wurde auch der Taxifahrer ungeduldig. Er überholte den Leichenwagen und warf dabei die Trauergäste in die Rosenkohlstauden. Das betrübte den Leichenwagenfahrer so sehr, dass er mit einem Erdnüsschen aus der Tasche des Totengräbers getröstet werden musste, bevor die Begräbnisfeier weitergehen konnte.
Was ich hinter der Hecke sah, versetzte mich in nicht geringes Erstaunen. Da war ein hübscher kleiner Tier-Friedhof mit winzigen Gräbern. Sie waren alle mit Kieselsteinen eingefasst und trugen hölzerne Kreuze. Auf manchen waren Namen eingeritzt, die mit Tusche nachgezogen waren. Hier lagen Drosseln und Hasen, ein Eichhörnchen, eine Maus und Schwarzpelz, das Kätzchen. Und am Ende des Friedhofs war ein frisch ausgehobenes Loch, mit Lorbeerblättern ausgelegt, bereit, das arme Häschen aufzunehmen. Es wurde behutsam hineingelegt. Rosmarie streute einige Gänseblümchen darüber. Nachdem das Grab zugeschaufelt worden war, hielt Janet eine Predigt für die beiden Trauergäste und mich. Der Totengräber war weggegangen, und der Leichenwagenführer machte einen Erdkuchen für Jumbo.
»Wir wollen ein Lied singen«, schlug Rosmarie am Ende der Ansprache vor. »Wir singen, was wir kürzlich in der Sonntagsschule gelernt haben: ›Um den goldnen Thron im Himmel stehn viel tausend Kinderlein.‹«
»Sollen wir singen: ›Stehn viel tausend Häselein‹?«, fragte Johnny.
»Auf keinen Fall«, wehrte der Pfarrer rasch ab, »das wäre sehr schlimm.« Aber er fing an zu kichern und konnte nicht mehr aufhören, sodass die Trauergäste allein singen mussten. Als die letzten Worte verklungen waren, sagte Janet: »Kommt, wir wollen gehen. Ich suche Peter, dann klettern wir auf einen Baum und wollen Pläne schmieden.«
Sie ergriff den Schubkarren und ließ Robert samt Jumbo einsteigen. Ich folgte mit Johnny. Nur Rosmarie blieb zurück. Sie liebte den kleinen Friedhof, denn sie stellte sich jedes Grab als Eingang eines langen Ganges vor, durch den der Begrabene ging, bis er endlich das Himmelstor erreichte. Und dort, ob man nun mit der Pfote anklopfte oder mit dem Schnabel tickte oder mit den Klauen kratzte, öffnete sich die Tür weit, und man stand mitten auf einer sonnigen Wiese voll immer blühender Blumen, wo es nichts mehr gab, das wehtat oder tötete oder zerstörte.
An diesem Tag wusste ich freilich noch nichts von alledem. Ich fragte mich nur, weshalb Rosmarie so still auf der feuchten Erde hinter der Lorbeerhecke knien blieb.
Heiße Schokolade und Butterbrote erwarteten uns am Küchenfenster. Dann gingen wir alle wieder weg. Nur Robert kroch zu der Katze unter den Küchentisch. An seiner Stelle nahmen wir Nero mit. Nero durfte bei Beerdigungen nicht mitkommen, weil er einmal, als er ein Trauergast hätte sein sollen, so geschmacklos gewesen war, dass er den Hasen anbiss, der gerade beerdigt werden sollte.
Wir eilten Peter hinterher, der schon vorausgegangen war. Am Gartentor stieß Rosmarie zu uns. Wir liefen einen schmutzigen Pfad hinunter, der mit weiß glänzenden Birkenstämmen gesäumt war.
Peter saß bereits mit baumelnden Beinen auf einem niedrigen Ast. Er sagte: »Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich muss nachher den ganzen Nachmittag an meinem Kaninchenstall arbeiten.«
»Zuerst Rosmarie«, befahl er und legte sich flach auf den Ast. Janet schob, und Peter fasste Rosmarie bei den Händen und zog sie hinauf. Sobald sie rittlings auf dem Ast saß, begann die Kleine, sich Stück für Stück in die Höhe zu arbeiten. Johnny tat es ihr gleich.
Mich selbst erfasste panischer Schrecken. Ich war in meinem Leben noch nie auf einen Baum geklettert und war davon überzeugt, dass ich es niemals schaffen würde.
»Komm nur, Eliane!«, ermutigte mich Peter. »Du kannst den Ast gut selber erreichen. Spring und schlag die Beine hinauf, dann schwing den ganzen Körper nach!«