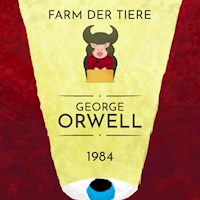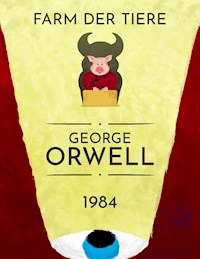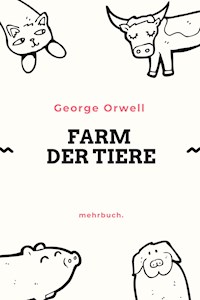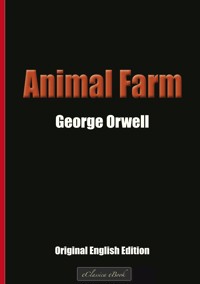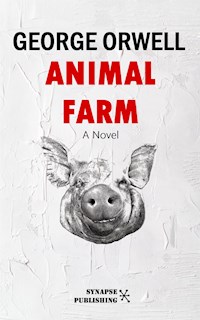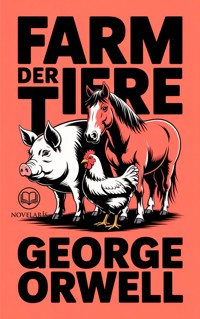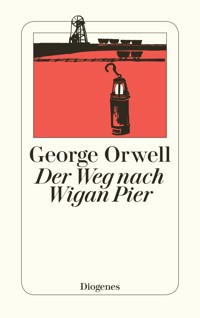
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1936 geht George Orwell in die Industriestädte Nordenglands, um an Ort und Stelle zu beobachten, wie Bergleute im Alltag arbeiten und wohnen. Er steigt mit in die Gruben hinunter und berichtet aufmerksam, sachlich, genau, mit Einfühlung und Gespür für die vielfachen Zusammenhänge. Diese Erfahrung führt zu Reflexionen über den Sozialismus als umsichtigen, schwierigen Weg zu Gerechtigkeit und Freiheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
George Orwell
Der Wegnach Wigan Pier
Aus dem Englischenund miteinem Nachwort vonManfred Papst
Die Originalausgabe
erschien 1937 in London
unter dem Titel ›The Road to Wigan Pier‹
Copyright © by The Estate of
the late Sonia Brownell Orwell
Umschlagzeichnung von
Tomi Ungerer
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 21000 2 (5.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60251 7
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Inhalt
Erster Teil
I
II
III
IV
V
VI
VII
Zweiter Teil
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Nachwort
Autorenbiographie
Mehr Informationen
[7] I
Das erste, was man am Morgen hörte, war das Klappern der Holzschuhe von Fabrikarbeiterinnen auf dem Kopfsteinpflaster. Noch früher gingen vermutlich die Fabriksirenen, aber dann war ich noch nicht wach.
Normalerweise waren wir zu viert im Schlafzimmer; das war ein scheußlicher Ort, mit dem schmutzigen und provisorischen Aussehen von Zimmern, die nicht zu ihrem eigentlichen Zweck gebraucht werden. Vor Jahren war das Haus ein gewöhnliches Wohnhaus gewesen, und als die Brookers es übernommen und zu einem Kuttelngeschäft und einer Pension umgebaut hatten, hatten sie einige der nutzloseren Möbelstücke geerbt und nie die Energie aufgebracht, sie wegzuschaffen. Wir schliefen deshalb in einem Raum, dem man das ehemalige Wohnzimmer noch ansah. Von der Decke hing ein Glasleuchter, auf dem der Staub so dicht lag, daß er wie ein Pelz aussah. Eine Wand wurde fast vollständig verdeckt von einem riesigen, gräßlichen Unding zwischen Garderobe und Büffet, mit einer Menge Schnitzereien, kleinen Schubladen und Streifen von Spiegelglas. Daneben gab es einen einstmals prunkvollen Teppich mit den Spüleimerringen vieler Jahre, zwei piekfeine Stühle mit geplatzten Sitzen und einen dieser altmodischen roßhaargepolsterten Sessel, von denen man herunterrutscht, sobald man sich hinzusetzen versucht. Zwischen dieses Gerümpel hatte man noch vier schäbige Betten gequetscht, und so war der Raum zu einem Schlafzimmer geworden.
Mein Bett stand in der rechten Ecke auf der Türseite. An seinem Fußende war ein weiteres Bett hineingezwängt (es mußte so stehen, damit man die Tür öffnen konnte), so daß ich mit [8] angezogenen Beinen schlafen mußte; wenn ich sie ausstreckte, trat ich dem im andern Bett ins Kreuz. Es war ein älterer Mann namens Mr.Reilly, so etwas wie ein Mechaniker, der »obendrin« bei einer der Kohlegruben angestellt war. Glücklicherweise mußte er morgens um fünf zur Arbeit, so daß ich, nachdem er fort war, meine Beine auseinanderwickeln und ein paar Stunden richtig schlafen konnte. Im Bett gegenüber war ein schottischer Bergmann, der bei einem Grubenunglück verletzt worden war (ein riesiger Steinbrocken preßte ihn auf den Boden, und es dauerte mehrere Stunden, bis der Stein weggehoben werden konnte) und dafür fünfhundert Pfund Abfindung erhalten hatte. Er war ein großer, stattlicher Mann um die vierzig, mit ergrautem Haar und einem kurzgeschnittenen Schnurrbart, eher ein Offizier als ein Bergmann; und er blieb, eine kurze Pfeife rauchend, bis spät am Tag im Bett liegen. Das vierte Bett wurde in rascher Folge von Handlungsreisenden, Zeitungsabonnentenfängern und Anreißern für Abzahlungsgeschäfte, die meist nur ein paar Nächte blieben, belegt. Es war ein Doppelbett und bei weitem das beste im Zimmer. Während meiner ersten Nacht hier hatte ich selber darin geschlafen, war dann aber hinausmanövriert worden, um einem andern Mieter Platz zu machen. Ich glaube, daß in dem Doppelbett, das sozusagen als Köder ausgelegt war, alle Neuankömmlinge ihre erste Nacht verbrachten. Alle Fenster waren mit einem roten, am unteren Ende festgeklemmten Sandsack fest verschlossen, und am Morgen stank das Zimmer wie ein Frettchenstall. Beim Aufstehen merkte man es nicht; aber wenn man aus dem Zimmer ging und dann zurückkam, schlug einem der Gestank mit voller Wucht entgegen.
Ich fand nie heraus, wie viele Schlafzimmer das Haus hatte, aber seltsamerweise gab es ein Badezimmer, das noch aus der Zeit vor den Brookers herrührte. Im unteren Stockwerk war die übliche Wohnküche mit ihrem riesigen offenen Kochherd, in dem Tag und Nacht Feuer brannte. Sie war nur durch ein Oberlicht erhellt, denn auf der einen Seite der Küche war der [9] Laden und auf der anderen die Speisekammer, die zu einem dunklen Kellerraum führte, wo die Kutteln gelagert wurden. Einen Teil der Tür zur Speisekammer versperrte ein unförmiges Sofa, auf dem Mrs.Brooker, unsere Vermieterin, ständig kranklag, eingewickelt in schmutzige Decken. Sie hatte ein großes, bleichgelbes, ängstliches Gesicht. Niemand wußte ganz sicher, was mit ihr los war; ich vermute, daß ihre einzigen wirklichen Beschwerden vom zu vielen Essen kamen. Vor dem Herd hing fast immer eine Leine mit feuchter Wäsche, und in der Mitte des Zimmers stand der große Küchentisch, an dem die Familie und alle Hausbewohner aßen. Ich habe diesen Tisch nie völlig unbedeckt gesehen, aber ich sah das, was ihn bedeckte, zu verschiedenen Zeiten. Zuunterst lag eine Schicht alten Zeitungspapiers, mit Worcestersauce getränkt, darüber eine Lage klebriges weißes Wachstuch, über diesem ein grüner Serge-Stoff und zuoberst ein grobes Leintuch, das niemals gewechselt und selten weggenommen wurde. Gewöhnlich lagen die Krümel vom Frühstück beim Abendessen noch auf dem Tisch. Einzelne Krümel konnte ich wiedererkennen, wenn sie von Tag zu Tag den Tisch hinauf- und hinunterwanderten.
Der Laden war ein enger, kalter Raum. Außen am Fenster klebten ein paar weiße Buchstaben, Überreste einer alten Schokoladenreklame, verstreut wie Sterne. Innen war eine Steinplatte, auf der in großen weißen Falten die Kutteln lagen, daneben die graue flockige, als »schwarze Kutteln« bekannte Masse, sowie die geisterhaft durchscheinenden abgekochten Schweinsfüße. Es war ein gewöhnlicher »Kutteln und Erbsen«-Laden, und außer Brot, Zigaretten und Dosenkram war kaum etwas am Lager. Im Schaufenster wurde für »Diverse Teesorten« Reklame gemacht, aber wenn ein Kunde eine Tasse Tee verlangte, wurde er gewöhnlich mit Entschuldigungen abgefertigt. Mr.Brooker hatte zwar seit zwei Jahren keine Arbeit mehr, war aber von Beruf Bergmann; seine Frau und er hatten jedoch ihr ganzes Leben als Nebenerwerb verschiedene Geschäfte betrieben. Einmal hatten sie eine Kneipe gehabt, aber sie verloren ihre Lizenz, [10] weil sie Glücksspiele zugelassen hatten. Ich bezweifle, daß eines ihrer Geschäfte je Gewinn gebracht hat; sie gehörten zu der Art von Leuten, die ein Geschäft vor allem betreiben, um etwas zu haben, worüber sie schimpfen können. Mr.Brooker war ein dunkler, kleingebauter, saurer, irisch aussehender Mann, und erstaunlich schmutzig. Ich glaube nicht, daß ich ihn je mit sauberen Händen gesehen habe. Weil Mrs.Brooker nun ständig krank war, machte er meist das Essen, und wie alle Leute mit ständig schmutzigen Händen hatte er eine besonders vertrauliche und schleppende Art, mit Dingen umzugehen. Wenn er einem eine Scheibe Butterbrot gab, war immer ein schwarzer Daumenabdruck drauf. Sogar am frühen Morgen, wenn er in die geheimnisvolle Grube hinter Mrs.Brookers Sofa hinabstieg und die Kutteln herausfischte, waren seine Hände schwarz. Von den andern Hausbewohnern hörte ich fürchterliche Geschichten über den Ort, an dem die Kutteln aufbewahrt wurden. Küchenschaben gäbe es dort in Mengen. Ich weiß nicht, wie oft frische Lieferungen von Kutteln bestellt wurden, aber es geschah in langen Abständen, denn Mr.Brooker pflegte Ereignisse danach zu datieren. »Lassen Sie mich mal überlegen, ich hatte drei Lieferungen Gefrorenes (gefrorene Kutteln), seit das passiert ist« etc. Wir Hausbewohner bekamen nie Kutteln zu essen. Damals dachte ich, sie seien zu teuer; heute meine ich eher, daß wir einfach zuviel über sie wußten. Ich bemerkte auch, daß die Brookers selber nie Kutteln aßen.
Die einzigen Dauermieter waren der schottische Bergmann, zwei Rentner und ein Arbeitsloser, der vom P.A.C. [Public Assistance Committee, Komitee für öffentliche Fürsorge] lebte. Er hieß Joe und gehörte zu der Art Leute, die keinen Nachnamen haben. Der schottische Bergmann war, wenn man ihn erst einmal kannte, recht langweilig. Wie so viele Arbeitslose verbrachte er zuviel Zeit mit Zeitunglesen, und wenn man ihn nicht abklemmte, hielt er stundenlang Vorträge über die »Gelbe Gefahr«, Morde mit Verstümmelungen, Astrologie und den Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft und ähnliches. Die Rentner [11] waren, wie üblich, durch den Means Test* [* Means Test: Behördliche Einkommensermittlung, die darüber entschied, ob man nach Ablauf der Zeit, während der man Arbeitslosenunterstützung bezogen hat, von der Wohlfahrt unterstützt wird oder nicht. Die Rentner haben früher vermutlich bei ihren Kindern gewohnt. Dort konnten sie nicht bleiben, weil sie nach dem Means Test als Untermieter galten und dadurch die Unterstützung der (ebenfalls arbeitslosen) Kinder gefährdeten.] aus ihren Behausungen vertrieben worden. Sie zahlten den Brookers zehn Shilling pro Woche und bekamen dafür an Annehmlichkeiten, was man für zehn Shilling erwarten kann: also ein Bett im Dachstock und Mahlzeiten, die hauptsächlich aus Butterbroten bestanden. Einer von ihnen war »etwas Besseres« und starb an einer bösartigen Krankheit dahin, vermutlich an Krebs. Er stieg nur noch an den Tagen aus dem Bett, an denen er seine Rente abholen ging. Der andere, den jedermann »Old Jack« nannte, war ein achtundsiebzigjähriger ehemaliger Bergmann, der weit über fünfzig Jahre in den Gruben gearbeitet hatte. Er war beweglich und intelligent, aber seltsamerweise schien er sich nur an die Erfahrungen seiner Knabenzeit erinnern zu können und alles über die neuen Maschinen und Verbesserungen in den Minen vergessen zu haben. Er erzählte mir oft Geschichten von Kämpfen mit wilden Pferden in engen unterirdischen Gängen. Als er hörte, daß ich Vorbereitungen träfe, in verschiedene Kohlengruben hinabzugehen, erklärte er mir geringschätzig, ein Mann von meiner Größe (sechs Fuß und zweieinhalb Zoll) würde das »Reisen« nicht schaffen; es war zwecklos, ihm zu sagen, das »Reisen« ginge besser als früher. Aber er war freundlich zu jedermann und rief uns immer ein tüchtiges »Gute Nacht, Jungens!« zu, wenn er die Treppe zu seinem Bett irgendwo unter den Dachsparren hochkletterte. Was ich an Old Jack am meisten bewunderte, war, daß er nie schnorrte. Am Ende der Woche war ihm gewöhnlich der Tabak ausgegangen, aber er weigerte sich stets, welchen von jemand anderem zu rauchen. Die Brookers hatten für die beiden Rentner bei einer Sixpence-pro-Woche-Firma eine Lebensversicherung abgeschlossen. Es wurde erzählt, man hätte sie den Versicherungsanreißer besorgt fragen hören, »wie lange Leute noch leben, wenn sie Krebs haben«.
[12] Wie der Schotte war Joe ein großer Zeitungsleser und verbrachte fast den ganzen Tag in der öffentlichen Bibliothek. Er war der typische unverheiratete Arbeitslose, ein verloren aussehendes, unverhohlen zerlumptes Wesen mit einem runden, fast kindlichen Gesicht, auf dem ein ungezogener Ausdruck lag. Er sah eher wie ein vernachlässigter Junge aus als wie ein erwachsener Mann. Ich glaube, es ist das völlige Fehlen von Verantwortung, das so viele dieser Männer jünger aussehen läßt, als sie sind. Nach seinem Aussehen hatte ich Joe auf etwa achtundzwanzig Jahre geschätzt und war dann erstaunt, als ich erfuhr, daß er dreiundvierzig war. Er hatte eine Vorliebe für großsprecherische Phrasen und war sehr stolz auf seinen Scharfsinn, durch den er ums Heiraten herumgekommen war. Oft sagte er zu mir: »Die Ketten des Ehestands, das ist eine kolossale Sache«, und hatte offensichtlich das Gefühl, das sei eine sehr feinsinnige und weitreichende Bemerkung. Sein gesamtes Einkommen betrug fünfzehn Shilling pro Woche, und sechs oder sieben davon mußte er den Brookers für sein Bett bezahlen. Manchmal sah ich ihn, wie er sich über dem Küchenherd eine Tasse Tee machte, aber sonst verpflegte er sich auswärts; vermutlich kam es meist auf Margarinebrote und Fish-and-Chips-Päckchen heraus.
Neben den Dauermietern gab es die rasch wechselnde Kundschaft von Handelsreisenden der ärmeren Sorte, Wanderschauspielern – nichts Ungewöhnliches im Norden, weil die meisten größeren Kneipen für die Wochenenden Varieteartisten einstellen – und Zeitungsabonnentenfängern. Das war eine Art Leute, der ich vorher noch nie begegnet war. Ihre Arbeit kam mir so hoffnungslos, so entmutigend vor, daß ich mich wunderte, wie jemand sich auf sie einlassen konnte, wo es als andere Möglichkeit doch das Gefängnis gab. Sie wurden vor allem von Wochenoder Sonntagszeitungen angestellt und von Stadt zu Stadt geschickt, ausgerüstet mit Karten und Listen von Straßen, die sie jeden Tag zu bearbeiten hatten. Wenn es ihnen nicht gelang, zwanzig Abonnementsbestellungen pro Tag festzumachen, wurden sie gefeuert. Solange sie ihre zwanzig Bestellungen pro [13] Tag schafften, bekamen sie ein schmales Gehalt, zwei Pfund pro Woche, glaube ich; für die Bestellungen über zwanzig erhielten sie eine winzige Provision. Das Ganze ist nicht so unmöglich, wie es tönt, denn in Arbeitervierteln hält sich jede Familie ein Zweipenny-Wochenblatt und wechselt es alle paar Wochen; aber ich bezweifle, daß irgendwer so einen Job lange behält. Die Zeitungen stellen verzweifelte arme Teufel ein, arbeitslose Büroangestellte, Handlungsreisende und ähnliche Leute, die sich eine Zeitlang anstrengen wie wild, um wenigstens den minimalen Absatz zu erreichen; sobald die tödliche Arbeit sie abgenützt hat, werden sie gefeuert und neue Leute eingestellt. Ich lernte zwei kennen, die von einer der berüchtigteren Wochenzeitungen angestellt worden waren. Beide waren Männer mittleren Alters, die Familien zu ernähren hatten, und der eine war schon Großvater. Sie waren zehn Stunden am Tag auf den Beinen, »bearbeiteten« die ihnen zugeteilten Straßen und waren bis spät in die Nacht damit beschäftigt, Formulare für irgendeine Gaunerei ihrer Zeitschrift auszufüllen – eines dieser Muster, bei denen man einen Satz Geschirr »geschenkt bekommt«, wenn man eine Bestellung für sechs Wochen abschließt und außerdem noch eine Postanweisung über zwei Shilling aufgibt. Der Dicke, der schon Großvater war, schlief gewöhnlich mit dem Kopf auf einem Stapel Formulare ein. Keiner von beiden konnte sich das Pfund pro Woche leisten, das die Brookers für Vollpension verlangten. Sie bezahlten eine kleine Summe für ihre Betten und machten sich in einer Ecke der Küche verschämt Mahlzeiten aus Schinken und Margarine, die sie in ihren Koffern bei sich hatten.
Die Brookers hatten Söhne und Töchter in Mengen; die meisten waren schon lange von Zuhause geflohen. Manche waren in Kanada, »auf Kanada«, wie Mrs.Brooker sich auszudrücken pflegte. Nur ein Sohn wohnte in der Nähe, ein großer, einem Schwein nicht unähnlich sehender Mann, der in einer Garage arbeitete und oft zum Essen nach Hause kam. Seine Frau war mit ihren beiden Kindern den ganzen Tag da; der größte Teil des Kochens und Wäschewaschens wurde von ihr und von [14] Emmie, der Verlobten eines anderen Sohns, der in London war, erledigt. Emmie war ein blondes, unglücklich aussehendes Mädchen mit einer spitzen Nase, das für einen Hungerlohn in einer der Fabriken arbeitete und sich trotzdem noch jeden Abend bei den Brookers abrackerte. Wie ich erfuhr, wurde die Hochzeit immer wieder verschoben und würde vielleicht nie stattfinden, aber Mrs.Brooker hatte Emmie schon als Schwiegertochter eingespannt und nörgelte in der eigenartig wachsamen und liebevollen Art, die Kranken eigen ist, an ihr herum. Die übrige Haushaltsarbeit wurde von Mr.Brooker erledigt oder auch nicht. Mrs.Brooker stand selten von ihrem Sofa in der Küche auf (sie verbrachte die Nacht dort so gut wie den Tag) und war zu krank, um irgend etwas zu tun, außer riesige Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Mr.Brooker kümmerte sich um den Laden, gab den Mietern ihr Essen und »machte« die Schlafzimmer. Er bewegte sich mit einer unglaublichen Langsamkeit von einer verhaßten Tätigkeit zur andern. Oft waren die Betten um sechs Uhr abends noch nicht gemacht, und zu jeder Tageszeit mußte man damit rechnen, Mr.Brooker mit einem vollen Nachttopf, den er mit dem Daumen auf der Innenseite festhielt, auf der Treppe zu begegnen. Morgens saß er mit einem Kübel schmutzigem Wasser am Feuer und schälte in Zeitlupengeschwindigkeit Kartoffeln. Ich habe nie jemanden gesehen, der mit solch einer Miene brütenden Widerwillens Kartoffeln schälen konnte. Man konnte seinen Haß auf die »verdammte Weiberarbeit«, wie er es nannte, wie einen bitteren Saft in ihm gären sehen. Er war einer jener Menschen, die ihren Verdruß unablässig wiederkäuen können.
Natürlich hörte ich, da ich oft im Hause war, alles über das Weh und Ach der Brookers, wie jedermann sie betrog und undankbar war und wie der Laden nichts einbrachte und die Pension kaum etwas. Nach lokalen Maßstäben waren sie gar nicht so schlecht dran, denn Mr.Brooker drückte sich, ich weiß auch nicht wie, um den Means Test und bezog eine Unterstützung vom P.A.C. Aber ihr Hauptvergnügen bestand darin, jedem, der zuhörte, ihr Leid zu klagen. Mrs. Brooker jammerte [15] Stunde um Stunde, auf ihrem Sofa liegend, ein weicher Hügel aus Fett und Selbstmitleid; und sie sagte immer und immer wieder das gleiche: »Wir bekommen wohl keine Mieter nicht mehr heutzutage. Ich weiß nicht, wie das ist. Die Kutteln liegen nur da herum Tag für Tag – und es sind so herrliche Kutteln! Es ist wirklich hart, jawohl«, etc. etc. etc. Alle Klagen von Mrs.Brooker endeten mit »Es ist wirklich hart, jawohl«, wie der Refrain einer Ballade. Sicher stimmte es, daß der Laden nichts einbrachte. Er hatte das unverkennbar staubige, schmuddelige Aussehen eines Geschäftes, mit dem es abwärts geht. Aber auch wenn jemand die Stirn gehabt hätte, ihnen zu erklären, warum niemand in den Laden kam, wäre es ziemlich unnütz gewesen. Keiner der beiden war imstande zu begreifen, daß im Schaufenster liegende tote Schmeißfliegen vom letzten Jahr den Umsatz nicht fördern.
Was sie aber wirklich quälte, war der Gedanke an diese beiden Rentner, die in ihrem Haus wohnten, Raum beanspruchten, Essen verschlangen und nur zehn Shilling pro Woche abgaben. Ich bezweifle, daß sie bei den Rentnern wirklich draufzahlten, obwohl der Gewinn bei zehn Shilling pro Woche sicherlich sehr klein gewesen sein muß. Aber in ihren Augen waren die beiden alten Männer eine Art gräßlicher Schmarotzer, die sich an sie gesetzt hatten und von ihrer Wohltätigkeit lebten. Old Jack konnten sie gerade noch ertragen, weil er tagsüber meist außer Haus war, aber den Bettlägerigen, Hooker mit Namen, haßten sie wirklich. Mr.Brooker sprach seinen Namen komisch aus, ohne H und mit einem langen U – »Uuker«. Was für Geschichten habe ich nicht über den alten Hooker gehört, über seine Widerborstigkeit, die Zumutung, sein Bett machen zu müssen, seine Art, dieses nicht essen zu mögen und jenes nicht essen zu mögen, und, vor allem, die selbstsüchtige Halsstarrigkeit, mit der er sich weigerte zu sterben! Die Brookers sehnten sich recht offen nach seinem Tod. Dann konnten sie wenigstens das Versicherungsgeld einstreichen. Sie schienen ihn zu spüren, wie er Tag für Tag ihre Substanz aufzehrte, als sei er ein lebender Wurm in ihren [16] Eingeweiden. Manchmal schaute Mr.Brooker vom Kartoffelschälen auf, begegnete meinem Blick und wandte seinen Kopf ruckartig und mit einem Ausdruck unbeschreiblicher Bitterkeit zur Decke, nach Mr.Hookers Zimmer hin. »Das ist doch ein –, nicht wahr?« sagte er. Es war nicht nötig, mehr zu sagen; ich hatte schon alles über die Schliche des alten Hooker gehört. Aber die Brookers hatten an allen ihren Mietern dieses oder jenes auszusetzen, zweifellos auch an mir. Joe, der vom P.A.C. lebte, gehörte praktisch in die gleiche Kategorie wie die Rentner. Der Schotte bezahlte ein Pfund pro Woche, aber er blieb fast den ganzen Tag im Haus, und sie »mochten es nicht, wenn er immer hier rumhing«, wie sie es ausdrückten. Die Zeitungswerber waren den ganzen Tag außer Haus, aber die Brookers hatten sie auf der Pike, weil sie ihre eigene Verpflegung mitbrachten, und sogar Mr.Reilly, ihr bester Mieter, war in Ungnade gefallen, weil Mrs.Brooker sagte, er wecke sie auf, wenn er morgens die Treppe herunterkomme. Sie konnten, wie sie sich ständig beklagten, einfach nicht die richtigen Mieter finden, »bessere Geschäftsherren«, die Vollpension bezahlten und den ganzen Tag weg waren. Ihr idealer Mieter wäre einer gewesen, der dreißig Shilling die Woche bezahlte und außer zum Schlafen nie ins Haus kam. Mir ist aufgefallen, daß Leute, die Zimmer vermieten, ihre Mieter fast immer hassen. Sie wollen ihr Geld, aber betrachten sie als Eindringlinge und bewahren eine sonderbar wachsame, eifersüchtige Haltung, die im Grunde die Entschlossenheit ist, den Mieter nicht zu sehr heimisch werden zu lassen. Das ist die unvermeidliche Folge eines schlechten Systems, nach dem der Mieter im Haus eines andern leben muß, ohne zur Familie zu gehören.
Die Mahlzeiten im Haus der Brookers waren gleichbleibend scheußlich. Zum Frühstück gab es zwei Scheiben Schinken und ein bleiches Spiegelei sowie Butterbrote, die oft schon am Abend vorher geschnitten wurden und auf denen immer Daumenabdrücke waren. Wie taktvoll ich es auch versuchte, ich konnte Mr.Brooker nie dazu bewegen, mich meine eigenen Butterbrote [17] machen zu lassen; jedesmal gab er sie mir Scheibe um Scheibe, jede Scheibe vom festen Zugriff des breiten schwarzen Daumens gezeichnet. Zum Mittagessen gab es gewöhnlich diese Dreipenny-Fleischkuchen, die fertig in Dosen verkauft werden – ich glaube, sie gehörten zum Ladenvorrat –, gekochte Kartoffeln und Reispudding. Zum Tee gab es wieder Butterbrote und abgenützt aussehende süße Kuchen, die vielleicht als altbackene Ware beim Bäcker gekauft worden waren. Zum Abendessen gab es weichlichen, schlappen Lancashire-Käse und Kekse. Die Brookers nannten diese Kekse nie Kekse. Sie bezeichneten sie immer ehrerbietig als Rahmbisquits – »Nehmen Sie noch ein Rahmbisquit, Mr.Reilly; ein Rahmbisquit zum Käse wird Ihnen schmecken« – so beschönigten sie die Tatsache, daß es zum Abendessen nur Käse gab. Mehrere Flaschen Worcestersauce und ein halbvoller Marmeladetopf standen immer auf dem Tisch. Es war üblich, alles, sogar den Käse, mit Worcestersauce zu tränken, aber ich sah nie einen sich an den Marmeladentopf wagen, in dem sich eine unbeschreibliche Masse von Klebrigkeit und Staub befand. Mrs. Brooker nahm ihre Mahlzeiten von uns getrennt ein, aß aber »ein paar Happen« mit bei jeder Mahlzeit, die sich sonst noch ergab, und machte sich immer mit großer Geschicklichkeit an das, was sie den »Boden des Topfes« nannte, d.h. die stärkste Tasse Tee. Sie hatte die Angewohnheit, ihren Mund ständig an einer der Decken abzuwischen. Gegen Ende meines Aufenthaltes ging sie dazu über, zu diesem Zweck Streifen von der Zeitung abzureißen, und am Morgen war der Boden oft mit zerknüllten Bällchen schleimigen Papiers bestreut, die stundenlang liegenblieben. Der Gestank in der Küche war furchtbar, aber wie beim Schlafzimmer bemerkte man ihn mit der Zeit nicht mehr.
Es erstaunte mich, daß dieser Ort für Mietshäuser in Industriegebieten nichts Ungewöhnliches sein konnte, denn im großen und ganzen beklagten sich die Mieter nicht. Der einzige, der, soviel ich weiß, es je tat, war ein kleiner schwarzhaariger Cockney mit einer spitzen Nase, Vertreter einer [18] Zigarettenfirma. Er war noch nie im Norden gewesen, und ich vermute, daß er bis vor kurzem eine bessere Anstellung gehabt und in Hotels für Handelsreisende gewohnt hatte. Dies war sein erster Eindruck von einer richtigen Unterschicht-Absteige, der Art Unterkunft, in der die Vertreter von der ärmeren Sorte und Anreißer auf ihren endlosen Reisen übernachten müssen. Am Morgen, als wir uns anzogen (er hatte natürlich im Doppelbett geschlafen), sah ich, wie er sich mit einer Art verwunderter Abscheu in dem trostlosen Raum umschaute. Unsere Blicke trafen sich, und er erriet plötzlich, daß ich ein Landsmann aus dem Süden war.
»Diese verdammten dreckigen Saukerle!« kam es ihm aus der Seele.
Dann packte er seinen Koffer, ging nach unten und sagte den Brookers mit großer Entschlossenheit, das sei nicht die Art Haus, die er gewohnt sei, und er reise unverzüglich ab. Die Brookers konnten das nie verstehen. Sie waren erstaunt und verletzt. So eine Undankbarkeit! Sie nach einer einzigen Nacht einfach so zu verlassen! Die Sache wurde wieder und wieder in allen Richtungen diskutiert und zum Vorrat an Verdruß gelegt.
An dem Tag, als ein voller Nachttopf unter dem Frühstückstisch stand, beschloß ich zu gehen. Der Ort begann mich zu bedrücken. Es war nicht nur der Schmutz, der Gestank, das minderwertige Essen, sondern das Gefühl sinnloser Verwahrlosung ohne Ausweg, das Gefühl, in eine unterirdische Welt geraten zu sein, in der die Menschen herumkribbeln wie Küchenschaben in einem ewigen Durcheinander schäbiger Arbeit und alltäglicher Sorgen. Man bekommt den Eindruck, sie seien gar keine wirklichen Menschen, sondern eine Art Gespenster, die ewig das gleiche nichtige Geschwätz herunterspulen. Zuletzt stieß mich Mrs. Brookers selbstmitleidiges Gerede – immer die gleichen Klagen, wieder und wieder, und immer in dem zitternden Gewinsel »es ist wirklich hart, jawohl« endend – noch mehr ab als ihre Gewohnheit, den Mund mit Zeitungspapierfetzen abzuwischen. Aber es hat keinen Zweck, einfach zu sagen, daß Leute wie die Brookers abstoßend sind, und zu versuchen, sie [19] aus dem Gedächtnis zu verdrängen. Denn sie existieren zu Dutzenden und Abertausenden; sie sind eines der charakteristischen Nebenprodukte der modernen Welt. Wenn man die Zivilisation, die sie hervorgebracht hat, gutheißt, darf man sie nicht übersehen. Denn sie sind zumindest ein Teil dessen, was die Industrialisierung für uns getan hat. Kolumbus segelte über den Atlantik, die ersten Dampfmaschinen setzten sich ruckelnd in Bewegung, die britischen Truppen hielten den französischen Gewehren bei Waterloo stand, die einäugigen Schurken des neunzehnten Jahrhunderts lobten Gott und füllten ihre Taschen, und das alles führte eben zu labyrinthischen Slums und dunklen, nach hinten gelegenen Küchen mit ungesunden, schnell alternden Menschen, die herumkribbeln wie Küchenschaben. Es ist eine Art Pflicht, solche Orte hin und wieder zu sehen und zu riechen, besonders zu riechen, damit man nicht vergißt, daß es sie gibt; obwohl es vielleicht besser ist, nicht zu lange dort zu verweilen.
Der Zug trug mich fort, durch die abscheuliche Gegend von Schlackenbergen, Kaminen, Schrotthaufen, stinkigen Kanälen, Pfaden im Aschenschlamm, kreuz und quer von Holzschuhabdrücken gezeichnet. Es war März, aber es war entsetzlich kalt gewesen, und überall lagen Hügel schwärzlichen Schnees. Wir fuhren langsam durch die Außenquartiere der Stadt und kamen an Reihen um Reihen kleiner grauer Slum-Häuser vorbei, die im rechten Winkel zu den Aufschüttungen verliefen. Hinter einem der Häuser kniete eine junge Frau auf den Steinen und stieß mit einem Stock in das bleifarbene Abflußrohr hinauf, das vom Ausguß drinnen kam und vermutlich verstopft war. Ich hatte Zeit, sie mir genau anzusehen – ihre sackleinene Schürze, ihre klobigen Holzschuhe, ihre von der Kälte geröteten Arme. Sie sah auf, als der Zug vorbeifuhr, und ich war beinahe nah genug, um ihrem Blick zu begegnen. Sie hatte ein rundes bleiches Gesicht, das gewöhnliche, erschöpfte Gesicht eines fünfundzwanzigjährigen Slum-Mädchens, das durch Fehlgeburten und Plackerei aussieht wie vierzig, und es hatte, in der Sekunde, da ich es sah, [20] den verlassensten, hoffnungslosesten Ausdruck, den ich je gesehen habe. Ich merkte mit einem Schlag, daß wir im Irrtum sind, wenn wir sagen, daß es »für sie nicht das gleiche ist, wie es für uns sein würde«, und daß Leute, die in den Slums großgeworden sind, sich nichts anderes vorstellen können als die Slums. Denn was ich in ihrem Gesicht sah, war nicht das unwissende Leiden eines Tieres. Sie wußte ganz genau, was mit ihr geschah – sie wußte so genau wie ich, was für ein schreckliches Los es war, da in der bitteren Kälte auf den schmierigen Steinen eines SlumHinterhofes zu knien und einen Stock in einem verdreckten Abflußrohr hinaufzustoßen.
Aber schon bald fuhr der Zug ins offene Land hinaus, und das wirkte seltsam, fast unnatürlich, als ob die Landschaft eine Art Park wäre; denn in den Industriegebieten hat man immer das Gefühl, daß der Rauch und der Schmutz immer weitergehen und kein Teil der Erdoberfläche ihm entgeht. In einem dichtbesiedelten, schmutzigen kleinen Land wie dem unseren nimmt man Verschmutzung beinahe als selbstverständlich hin. Schlackenberge und Kamine erscheinen als normalere und möglichere Landschaften als Gras und Bäume, und auch draußen auf dem Land erwartet man, wenn man seine Hacke in den Boden schlägt, so halb eine zerbrochene Flasche oder eine rostige Büchse. Aber hier draußen war der Schnee frei von Fußspuren und lag so hoch, daß nur der oberste Teil der steinernen Grenzmauern, die sich wie schwarze Wege über die Hügel zogen, zu sehen war. Es kam mir in den Sinn, daß D. H. Lawrence, als er über dieselbe oder eine in der Nähe liegende Landschaft schrieb, sagte, daß die schneebedeckten Hügel wellenförmig »wie Muskeln« zum Horizont liefen. Dieser Vergleich wäre mir nicht eingefallen. Für mein Auge wirkten der Schnee und die schwarzen Mauern wie ein weißes Kleid mit schwarzen Streifen. Von der Schneedecke war noch kaum etwas weggeschmolzen, aber die Sonne stand strahlend am Himmel, und hinter den geschlossenen Wagenfenstern schien das Wetter warm. Nach dem Kalender war es Frühling, und ein paar Vögel glaubten das wohl auch. [21] Zum erstenmal in meinem Leben sah ich, auf einem schneefreien Flecken neben der Eisenbahnlinie, Saatkrähen sich paaren. Sie taten es auf dem Boden und nicht, wie ich erwartet hätte, auf einem Baum. Der Balzvorgang war eigenartig. Das Weibchen stand mit offenem Schnabel da, und das Männchen ging um es herum und schien es zu füttern. Ich war kaum eine halbe Stunde im Zug, aber der Weg von der Küche der Brookers zu den weißen Schneehängen, dem strahlenden Sonnenschein und den großen schimmernden Vögeln kam mir lang vor.
Die ganzen Industriegebiete sind eigentlich eine riesige Stadt mit etwa der gleichen Einwohnerzahl wie Groß-London, aber glücklicherweise mit einer viel größeren Fläche, so daß sogar in ihrem Innern noch Platz ist für ein paar saubere und ordentliche Flecken. Das ist ein ermutigender Gedanke. Trotz hartnäckiger Versuche ist es dem Menschen noch nicht gelungen, seinen Dreck überall hinzubringen. Die Erde ist so weit und noch so leer, daß sogar im schmutzigen Herzen der Zivilisation noch Felder zu finden sind, wo das Gras grün ist und nicht grau; wenn man suchte, fände man vielleicht sogar noch Bäche mit lebenden Fischen anstatt Lachs in Dosen. Noch recht lange, vielleicht zwanzig Minuten, fuhr der Zug durch offenes Land, bevor die Vorstadtvillenzivilisation uns wieder einzuschließen begann; dann kamen die äußeren Slums und dann die Schlackenberge, die rauchenden Kamine, die Hochöfen, die Kanäle und Gaskessel der nächsten Industriestadt.
II
Unsere Zivilisation beruht – mit Verlaub, Herr Chesterton – auf Kohle, und zwar viel umfassender, als man sich im klaren ist, bis man einmal darüber nachdenkt. Die Maschinen, die für uns [22] lebensnotwendig sind, und die Maschinen, die die Maschinen herstellen, sind alle direkt oder indirekt von Kohle abhängig. Im Stoffwechsel der Westlichen Welt ist nur noch der Mann, der die Erde pflügt, wichtiger als der Bergmann. Er ist eine Art rußige Karyatide, auf deren Schultern fast alles ruht, was nicht rußig ist. Deshalb lohnt es sich durchaus, den tatsächlichen Prozeß der Kohlegewinnung zu betrachten, wenn man die Gelegenheit dazu hat und die Mühe auf sich nehmen will.
Wenn man in ein Kohlebergwerk einfährt, sollte man versuchen, zur Abbaustelle zu gelangen, wenn die »Füller« an der Arbeit sind. Das ist nicht einfach, denn während der Arbeitszeit sind Besucher lästig und werden nicht eben ermutigt; aber wenn man zu einer andern Zeit geht, bekommt man vielleicht einen völlig falschen Eindruck. An Sonntagen zum Beispiel sieht eine Grube fast friedlich aus. Man muß hingehen, wenn die Maschinen lärmen, die Luft vom Kohlestaub schwarz ist und man wirklich sieht, was die Bergleute tun müssen. Zu diesen Zeiten ist es da unten wie in der Hölle oder jedenfalls so wie in meinem Phantasiebild von der Hölle. Fast alles, was man sich in der Hölle vorstellt, ist da: Hitze, Lärm, Durcheinander, Dunkelheit, stickige Luft, und vor allem eine unerträgliche Enge. Alles ist da bis auf das Feuer, denn da unten gibt es kein Feuer außer dem schwachen Schein der Davylampen und Taschenlampen, die kaum durch die Kohlestaubwolken dringen.
Wenn man endlich unten angelangt ist – und das ist eine Sache für sich, wie ich gleich erklären werde –, kriecht man zwischen der letzten Reihe Grubenhölzer durch und sieht sich dann einer schimmernden schwarzen Wand von drei oder vier Fuß Höhe gegenüber. Das ist das Kohleflöz [engl. »Das Gesicht der Kohle«]. Über sich hat man die glatte Decke; sie besteht aus dem Fels, aus dem die Kohle herausgeschnitten wurde; unter einem ist wieder Fels, so daß der Stollen, in dem man sich befindet, nur so hoch ist wie die Kohleschicht selbst, wahrscheinlich nicht viel mehr als ein Yard. Der zunächst alles andere beherrschende Eindruck ist das fürchterliche, ohrenbetäubende Gerassel des [23] Förderbandes, das die Kohle abtransportiert. Man kann nicht weit sehen, weil der Kohlestaubnebel das Licht der Grubenlampen zurückwirft; aber man sieht auf beiden Seiten eine Reihe halbnackter, kniender Männer, vier oder fünf Yards voneinander entfernt, die ihre Schaufeln unter die herabgefallene Kohle stoßen und sie mit einem Schwung über die linke Schulter werfen. Sie füllen sie aufs Förderband, ein Gummiband von ein paar Fuß Breite, das ein bis zwei Yards hinter ihnen vorbeiläuft. Auf diesem Band fließt dauernd ein glitzernder Kohlestrom abwärts. In großen Gruben befördert es mehrere Tonnen Kohle pro Minute. Es bringt sie zu einem Platz im Hauptstollen, wo es sie in Förderwagen wirft, die eine halbe Tonne fassen, um dann zu den Förderkörben geschleppt und zur Erdoberfläche hinaufgezogen zu werden.
Man kann den »Füllern« unmöglich bei der Arbeit Zusehen, ohne einen Stich des Neids auf ihre Zähigkeit zu spüren. Sie verrichten eine schreckliche, ja nach gewöhnlichen Maßstäben fast übermenschliche Arbeit. Denn sie bewegen nicht nur ungeheure Mengen von Kohle, sondern sie tun das auch noch in einer Stellung, die die Arbeit verdoppelt und verdreifacht. Sie müssen die ganze Zeit knien – sie könnten sich kaum aufrichten, ohne an die Decke zu stoßen –, und man kann die ungeheure Anstrengung leicht ermessen, wenn man es selbst einmal versucht. Solange man aufrecht stehen kann, geht das Schaufeln relativ leicht, denn man kann die Schaufel mit Hilfe der Knie und Oberschenkel führen; wenn man kniet, liegt die ganze Belastung auf den Arm- und Bauchmuskeln. Die übrigen Arbeitsbedingungen machen die Sache auch nicht gerade leichter. Da ist einmal die Hitze – sie ist unterschiedlich, aber in manchen Gruben ist sie zum Ersticken –, dann der Kohlestaub, der Kehle und Nase verstopft und sich um die Augenlider festsetzt, und das endlose Rasseln des Förderbandes, das in dem engen Raum eher wie das Knattern eines Maschinengewehrs tönt. Aber die »Füller« arbeiten, als seien sie aus Eisen, und so sehen sie auch wirklich aus – wie gehämmerte Eisenstatuen – unter der glatten [24] Kohlestaubschicht, die sie von Kopf bis Fuß überzieht. Nur wenn man die Bergleute unten in der Grube und nackt sieht, wird einem klar, was für prächtige Männer sie sind. Die meisten sind klein (große Männer sind bei dieser Arbeit im Nachteil), aber fast alle haben die herrlichsten Körper; breite Schultern, schlanke, geschmeidige Hüften, ein kleines ausgebildetes Hinterteil und sehnige Oberschenkel, und nirgends eine Unze überflüssiges Fleisch. In den heißeren Bergwerken tragen sie nur ein Paar dünne kurze Hosen, Holzschuhe und Knieschoner. Nach ihrem Aussehen kann man kaum sagen, ob sie jung oder alt sind. Sie können jedes Alter haben, bis zu sechzig oder sogar fünfundsechzig Jahren; aber wenn sie nackt und schwarz sind, sehen sie alle gleich aus. Keiner, der nicht den Körper eines jungen Mannes hat – und die Figur eines Gardisten dazu –, könnte ihre Arbeit tun; ein paar zusätzliche Pfunde um die Hüften würden das ständige Gebücktsein verunmöglichen. Wenn man dieses Schauspiel einmal gesehen hat, kann man es nie mehr vergessen – die Reihe gebückter, kniender Gestalten, ganz schwarz vom Ruß, die ihre riesigen Schaufeln mit erstaunlicher Kraft und Geschwindigkeit in die Kohle stoßen. Ihre Arbeitszeit dauert siebeneinhalb Stunden, theoretisch ohne Pause, denn es gibt keine »freie« Zeit. Tatsächlich schnappen sie sich während der Schicht eine Viertelstunde oder so, um zu essen, was sie sich mitgebracht haben, gewöhnlich ein dickes Stück Brot mit Schmalz und eine Flasche kalten Tee. Als ich den »Füllern« zum erstenmal zusah, kam ich mit der Hand unter dem Kohlestaub an etwas Schleimiges. Es war ein ausgekauter Tabakpriem. Fast alle Bergleute kauen Tabak; man sagt, das lösche den Durst.
Wahrscheinlich muß man mehrere Gruben besuchen, bevor man sich von den Vorgängen um einen herum einen Begriff machen kann, hauptsächlich deshalb, weil die bloße Anstrengung, von einem Ort zum andern zu gelangen, es schwierig macht, noch etwas anderes wahrzunehmen. In mancher Hinsicht ist es sogar enttäuschend, zumindest aber anders, als man erwartet hat. Man steigt in den Käfig, einen Stahlkasten von der [25] Breite einer Telefonzelle und zwei- oder dreimal so lang. Er faßt zehn Personen, aber damit ist er vollgepackt wie eine Sardinenbüchse, und ein großer Mann kann kaum aufrecht stehen. Die Stahltür schließt sich über einem, und jemand, der das Kabelgewinde bedient, läßt einen ins Leere fallen. Man hat augenblicklich das gewöhnliche flaue Gefühl im Magen und heftiges Ohrensausen, aber kaum ein Gefühl von Geschwindigkeit, bis man sich dem Boden nähert und der Käfig sich so abrupt verlangsamt, daß man schwören könnte, er führe wieder aufwärts. Während der Fahrt erreicht der Käfig wohl sechzig Meilen pro Stunde, bei manchen tiefer gelegenen Gruben sogar noch mehr. Wenn man unten aus dem Käfig herausklettert, ist man ungefähr vierhundert Yards unter der Erdoberfläche. Das bedeutet, daß man einen ganz hübschen Berg über sich hat; Hunderte von Yards massives Gestein, Knochen ausgestorbener Tiere, verschiedene Erd- und Kieselschichten, Wurzeln von Pflanzen, grünes Gras, Kühe, die darauf weiden – das alles hängt einem über dem Kopf und wird nur von hölzernen Pfosten, die so dick sind wie eine Wade, abgestützt. Aber wegen der Geschwindigkeit, mit welcher der Käfig einen hinuntergebracht hat, und der völligen Dunkelheit, durch die man gefahren ist, glaubt man kaum tiefer unten zu sein als im Untergrundbahnhof von Piccadilly.
Wirklich überraschend sind dagegen die immensen horizontalen Entfernungen, die unter Tage zurückgelegt werden müssen. Bevor ich selber unten in einer Kohlengrube war, hatte ich eine vage Vorstellung vom Bergmann, der aus dem Käfig steigt und sich ein paar Yards weiter an einem Kohleflöz an die Arbeit macht. Mir war nicht klar gewesen, daß er, bevor er überhaupt zu seinem Arbeitsplatz gelangt, durch Stollen kriechen muß, die so lang sind wie der Weg von der London Bridge zum Oxford Circus. Am Anfang wird der Grubenschacht natürlich in der Nähe eines Kohlevorkommens gegraben. Aber wenn dieses Vorkommen ausgebeutet ist und man neuen Adern nachgeht, entfernen sich die Arbeitsplätze immer weiter vom [26] Einstiegsschacht. Wenn das Kohleflöz eine Meile vom Einstiegsschacht abliegt, dürfte das eine durchschnittliche Entfernung sein; drei Meilen gelten noch als normal; es soll sogar einige Gruben geben, in denen die Entfernung fünf Meilen beträgt. Aber diese Distanzen kann man nicht mit den entsprechenden Distanzen über Tage gleichsetzen. Denn auf der ganzen Meile oder vielleicht auf den ganzen drei Meilen gibt es außerhalb des Hauptstollens (und auch dort nur selten), kaum Stellen, an denen ein Mann aufrecht stehen kann.
Was das bedeutet, merkt man erst, wenn man ein paar hundert Yards gegangen ist. Zunächst geht man leicht gebückt durch den matt beleuchteten Stollen, der acht bis zehn Fuß breit und etwa fünf Fuß hoch ist und dessen Wände aus Schieferplatten bestehen, wie die Steinmauern in Derbyshire. Alle ein oder zwei Yards stehen hölzerne Pfosten, die die Träger und Balken abstützen. Einige Balken haben sich zu phantastischen Krümmungen verzogen, unter denen man sich durchbücken muß. Gewöhnlich kann man nur schlecht gehen – über dicken Staub und scharfkantige Schieferbrocken, und wo Wasser in der Nähe ist, ist es schlammig wie auf einem Bauernhof. Außerdem ist da noch das Gleis für die Kohlewaggons, eine Art Miniaturschienen mit Schwellen im Abstand von ein bis zwei Fuß, die das Gehen mühsam machen. Alles ist grau vom Schieferstaub, und überall hängt ein staubiger, brenzliger Geruch, der wohl in allen Bergwerken der gleiche ist. Man sieht geheimnisvolle Maschinen, deren Zweck man nie begreifen wird, Bündel von Werkzeugen, die auf Drähte gezogen sind, und manchmal Mäuse, die vor dem Lampenstrahl weghuschen. Mäuse sind überraschend häufig, besonders in Bergwerken, wo Pferde eingesetzt werden oder wurden. Es wäre interessant zu erfahren, wie sie ursprünglich dahingekommen sind; vielleicht sind sie einen Schacht hinuntergefallen – es heißt ja, daß eine Maus aufgrund ihrer im Verhältnis zum Gewicht großen Oberfläche einen Sturz aus beliebiger Höhe unverletzt überstehen kann. Man drückt sich an die Wand, um den Förderwagen, die langsam in Richtung Schacht rumpeln, [27] Platz zu machen. Die Waggons werden von einem endlosen Stahlkabel gezogen, das von oben her bedient wird. Man kriecht unter sackleinenen Vorhängen durch und kommt an dicke Holztüren, bei deren Öffnen einem heftige Zugluft entgegenschlägt. Die Türen sind ein wichtiger Teil des Ventilationssystems. Die verbrauchte Luft wird durch Ventilatoren aus dem einen Schacht gesaugt, und die frische Luft strömt dann von selbst in den andern Schacht. Sich selbst überlassen, würde die Luft den kürzesten Weg nehmen, und die tiefer gelegenen Abbaustellen blieben unbelüftet; deshalb müssen alle Abkürzungen verschlossen werden.