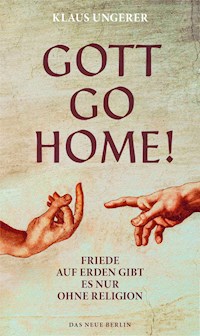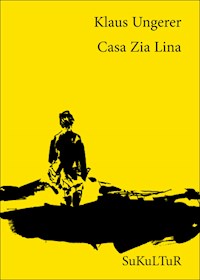Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bild und Heimat Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Berliner Kriminalgericht Moabit, wo schon gegen den Hauptmann von Köpenick oder Arno Funke alias Dagobert prozessiert wurde, werden zwar auch weniger bekannte, aber nicht minder erstaunliche Kriminalfälle verhandelt. Klaus Ungerer ist regelmäßig unter den Beobachtern vor Ort und berichtet unaufgeregt und ohne jeglichen Voyeurismus darüber, wie ältere Ostberliner Damen ihr Geld an einen äußerst netten Herrn verloren, wie in Köpenick Dutzende Tote spurlos verschwanden oder wie eine Frau in Friedrichshain wenig überraschend aus dem Fenster fiel. Der weinende Mörder versammelt knapp dreißig seiner in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlichten Kolumnen – allesamt Kabinettstücke über die Berliner Gerichtsbarkeit und die Menschen dahinter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Ungerer
Der weinende Mörder
28 Straffälle aus dem Berliner Kriminalgericht Moabit
Bild und Heimat
Zu diesem Buch:
Alle hier beschriebenen Fälle haben sich tatsächlich zugetragen. Die Namen der Täter, Opfer und Zeugen wurden aus personenrechtlichen Gründen verändert.
eISBN 978-3-95958-718-1
1. Auflage
© 2016 by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin
Umschlaggestaltung: fuxbux, Berlin
Umschlagabbildung: © Fotolia / Kozini; © Shutterstock / Izzet Ugutmen
Ein Verlagsverzeichnis schicken wir Ihnen gern:
BEBUG mbH / Verlag Bild und Heimat
Alexanderstr. 1
10178 Berlin
Tel. 030 / 206 109-0
www.bild-und-heimat.de
Der langsame Tod in der schnellen Welt
Wie eine sechsköpfige Familie stirbt, weil niemand das Fenster aufmacht
Die Gastherme, die sechs Menschen töten wird – vier Kinder, die Mutter, den Stiefvater –, sie ist eigentlich in Ordnung. Sie verrichtet ihren Dienst, genau wie sie soll. Lange war sie außer Betrieb, aber nun strömt das Gas. Soeben hat der Installateur Herr Schwierzke es wieder angestellt, jetzt verbrennt die verranzte, verstaubte Therme es brav, sorgt für warmes Wasser, kann vielleicht sogar die bodenkühle Erdgeschosswohnung in der Köpenicker Puchanstraße warm bekommen, damit es ein Leben ist in dieser nicht ganz so reizvollen Gegend.
Acht Jahre lang war das Gas abgestellt, wie auch immer man es anstellen mag, dort dann zu leben. Seit 2003 hatte die Mieterin Frau Haas, Jahrgang 1963, weder Heizung noch Warmwasser, da sie ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen war. Um dem Berliner Winter wenigstens ein wenig entgegenzusetzen, bat sie ihren Sohn Robert im Januar 2007, den Abzug der Therme zu verstopfen. In der Wohnung zog es nämlich. Der kurzgeschorene, einsilbige Sohn schritt zur Tat, ein Lappen und ein paar alte Zeitungen genügten, dann ruhte die Zugluft. Und die Therme verstaubte vor sich hin, sie wurde ja nicht gebraucht, lange nicht, bis schließlich Frau Haas 2011 die Wohnung verließ und eine ganze neue Familie einzog in die Puchanstraße: Die bekommen nun das Gas wieder angestellt. Und gäbe es Vorschriften zur Wiederinbetriebnahme von Thermen nach so langer Zeit, oder gäbe es eine umsichtige Hausverwaltung, oder würden Handwerker noch so bezahlt, dass sie vielleicht ein bisschen die Augen aufmachen und Dinge nach ihrem Handwerkerverstand beurteilen statt nach dem kargen Auftrag: Dann würden jetzt sicher nicht nur die Leitungen zur Therme und zum Herd hin geprüft. Sondern es käme Herrn Schwierzke auch die Idee, die verschmutzte, vergessene Therme in der Küche zu inspizieren. Dann begnügte er sich nicht mit dem kurzen Abnicken des fließenden Warmwassers. Er ließe die Therme ein wenig laufen, denn brav läuft sie ja, und dann, nach viereinhalb Minuten, passierte es: klick. Verschwände die kleine, unscheinbare Gasflamme. Schaltete die Therme sich aus. Weil ihre Sensoren die Abgaswerte im Ausgangsbereich erfasst und richtig gedeutet hätten: Kohlenmonoxid in einer Menge zum Fürchten.
Aber diese viereinhalb Minuten sind nicht vorgesehen im Auftrag. Die ganze Therme kommt nicht vor. Denn die Welt, sie ist nicht immer zum Besten geordnet, ein grausamer Wille zu Glück und Unglück wohnt in ihr. Jedes Regelmaß ruft seinen Gegenspieler auf den Plan, und je mehr Regelmaß in allen Abläufen vorhanden ist, desto leichteres Spiel hat der böse Unfall, den niemand mehr auf der Rechnung hat, da die Rechnung immer zu klein ist. Etwa hätte Herr Schwierzke ja kalkulieren können: Meine Firma ist heute nur ausnahmsweise in Köpenick unterwegs, für das wir sonst nie Aufträge kriegen, da die Hausverwaltung hier andere Lieblinge hat, und nur weil wohl ein Sachbearbeiter im Urlaub ist, bin ich also vorgedrungen auf unbekanntes Gebiet; noch größere Sorgfalt als ohnehin ist womöglich geboten. Auch hätte ein hellwacher, vielseitig interessierter Installateur ja von den Spatzen auf den Dächern hören können, dass der dänische Immobilieninvestor, welcher neben viel anderem Wohnschrott auch dieses Haus in Köpenick aufgekauft hat, sich aktuell in eine Finanzschieflage manövriert hat, so dass deutschlandweit die Mieter bitterlich klagen über Vernachlässigung, fehlende Heizung, überhöhte Abrechnungen, Warteschleifen … Herr Schwierzke hätte, nach Erwägung all dieser Tatsachen, zu dem Schluss kommen können: Ein solcher Hausbesitzer und seine beigeordnete, dubios beleumundete Hausverwaltung kümmern sich möglicherweise nicht so intensiv um bestehende Gasanlagen, und wenn ich nun ausnahmsweise in Köpenick prüfe und Gas freischalte, dann weiß ich ja gar nicht, ob eine Anlage seit Ewigkeiten außer Betrieb gewesen ist …
Einen solchen Installateur könnte man sich nur wünschen in einer kapitalistisch beschleunigten Welt. Aber eine kapitalistisch beschleunigte Welt läuft eben mit hurtigen und unterbezahlten Installateuren. Dieser hier stellt zufrieden das warme Wasser wieder ab. Die Therme schaltet sich aus. Herr Schwierzke kann sich verabschieden von der Kundschaft, hier war ihm eh zu viel Trubel: vier Kinder! Tür auf, Tür zu, ständig war da was los. Da konnte man kaum den Druck auf der Leitung messen. Die Familie aber freut sich: Sie hat warmes Wasser. Sie kann, wenn sie will, ihre klamme Erdgeschosswohnung endlich heizen, denn so wirklich kuschelig wird die auch im Sommer nicht von selbst, und am kommenden Wochenende wird es eher ungemütlich in Berlin.
So heizen sie drauflos, umso entschlossener, je mehr die Therme bockt: Die nämlich, wie gesagt, schaltet sich alle paar Minuten ab, so wie sie es auch tun sollte, da immer mehr Kohlenmonoxid in den Raum eindringt, statt den Weg durch die verstopfte Lüftung zu nehmen. Und dann, nach circa zwanzig Minuten, klick, da schaltet sie sich wieder an. Bald wieder ab. Und dann wieder an. Die beiden Erwachsenen mit den vier Kindern versuchen intensiv, ihre Wohnung mal so richtig einzuheizen. Sie haben die Fenster zu und die Rollos unten, sie wälzen die Betriebsanleitung der Therme, sie nehmen Ibuprofen und Paracetamol gegen immer stärker auftretendes Unwohlsein, sie messen Fieber, die Kinder übergeben sich, die Erwachsenen übergeben sich, die Therme springt an und geht wieder aus, springt an und geht wieder aus, wohl über Tage geht das so. Sechs Menschen, statt die Heizung auszuschalten, statt Tür und Fenster aufzureißen, werden immer matter, verwirrter, bleiben liegen. Sterben. »Es war ein schleichender Vergiftungsprozess«, sagt die junge Gerichtsmedizinerin. Alle Anzeichen deuten auf eine Kohlenmonoxidvergiftung, die Haut der Verstorbenen ist nicht blau, sondern »sehr schön rosa, wie es in der Literatur beschrieben wird«.
Sechs Menschen sind tot, vier Kinder, eine Mutter, ein Stiefvater. Der leibliche Vater wird ab und zu von BILD und B. Z. genutzt, um von seinen Gefühlen zu erzählen. Wer ist schuld? Frau Haas und ihr Sohn werden zu Geldstrafen verurteilt, 240 Tagessätze à 15 beziehungsweise 20 Euro. Herr Schwierzke, der Installateur, findet Halt in seiner Lieblingssentenz: »Heutzutage ist es leider so.« Heutzutage ist es leider so, dass die Handwerker nur noch machen, was auf dem Auftragszettel steht. Machen können. »Mein Auftrag war nicht die Überprüfung der Therme.« Wenn Herr Schwierzke jetzt gewusst hätte, dass die Anlage seit acht Jahren außer Betrieb war, dann hätte er bei seiner Firma angerufen und gesagt: Hier muss wohl noch einiges mehr geprüft werden. Da hätte man die Zündung rausgeholt und gesäubert, oben, der Kasten, das war alles verdreckt, das war ja zu sehen, das hätte man gereinigt, den Wärmetauscher gebürstet und durchgespült, den Brenner geputzt, neue Dichtungen rein … Na ja, und natürlich hätte man dann auch das Abgasprüfgerät oben reingehalten an jenem Julitag 2011, und da hätte man sofort eine extreme Messung gehabt.
Herrn Schwierzke trifft daher keine Schuld. Er hat, wegen einer Fehlermeldung auf dem Display, sogar noch selbsttätig den Temperaturfühler gewechselt. Er hat – nach den Maßstäben einer immer schneller, immer reibungsloser funktionierenden Welt – alles richtig gemacht.
Herr Korkmaz sucht seinen Frieden
Wie ein unruhiger Mensch sich von der Polizei erschießen lassen wollte
Herr Korkmaz möchte gern Hilfe haben. Oder wenigstens, dass ihn jemand ins Gefängnis bringt. Wo er in Sicherheit ist. Herr Korkmaz steht da, um ihn herum spielt sich alles in Zeitlupe ab. In Zeitlupe stürmt die Polizei in die Neuköllner Sparkassenfiliale, mit gezogenen Waffen, in Zeitlupe zieht sich die Filialleiterin von ihm zurück, Herr Korkmaz verwehrt es ihr nicht, er steht da, er hat das Messer in der Hand, und er muss jetzt dringend nachdenken. Über so viele Dinge. Über sich selbst. Wieso steht er hier, wo kommt der Tumult her, wie hat er, der Friedliebende, in eine solche Situation geraten können? »Messer fallen lassen!«, brüllen die Beamten, die Schusswaffen im Anschlag. »Messer fallen lassen!« Sie haben erst auf die Beine gezielt, jetzt legen sie auf seinen Körper an. »Erschießt mich doch!«, ruft Herr Korkmaz. »Erschießt mich doch!« Vielleicht wäre ja das eine Lösung?
Der Tag ist nicht so gut gelaufen für Ibrahim Korkmaz, 35 Jahre alt. Wenige seiner Tage laufen so richtig gut. Herr Korkmaz wohnt in Berlin-Neukölln, er hat das zerklüftete Felsgesicht eines Preisboxers, sein gepflegtes Deutsch aber wäre jedes akademischen Mittelbaus würdig. Die Sinnzusammenhänge sind es nicht immer. Nicht an den schlechteren Tagen. Und dieser 28. Juli 2011 ist definitiv einer davon. In seiner Wohnung fühlt Herr Korkmaz sich schon länger nicht mehr sicher, aber wie soll man das auch, wenn von einem Tag auf den anderen Risse in einer Fensterscheibe auftauchen, und man weiß nicht woher, und man weiß nicht, ob jemand in der Wohnung gewesen ist.
Hinzu kam der Hunger. Herr Korkmaz ist sehr hungrig gewesen. Und nichts ließ sich dagegen tun. Denn Schulden hatten sein Konto übermannt, und als er versuchte, Geld abzuheben, da spuckte der Automat nichts mehr aus. Nur deswegen hatte Herr Korkmaz die große Sparkassenfiliale in der Karl-Marx-Straße aufgesucht. Irgendjemand musste ihm doch helfen! Aber die junge Dame da, die auf der anderen Seite des Tischchens saß, die hatte sich offenbar gegen die Hilfsbereitschaft entschieden. Die guckte auf ihren Bildschirm und gab vor, nichts für ihn tun zu können. Stand dann auf, ging weg, wohl um Verstärkung zu holen – und autsch! Hatte Herr Korkmaz sich in den Finger geschnitten. An dem Messer in seiner Tasche.
Mit der Polizei hat Herr Korkmaz bis zu diesem Tag wenig zu schaffen gehabt. Es gab da diese Angelegenheit mit seiner Schwester, deren Lebenswandel er nicht billigt. In diesem Zusammenhang kam es einmal zu einer Auseinandersetzung, und da hat er von den Beamten einen Platzverweis gekriegt, und mit seiner Schwester hat er seitdem nicht mehr viel zu tun.
Auch die Sache, die ihm vor einiger Zeit im Jobcenter unterlaufen ist, war nicht wirklich der Rede wert. Die betroffene Sachbearbeiterin wird vor Gericht selber dazu sagen: »Man meint nicht uns, man meint das Gesetz.« Sie sei selber auch schon mal Hartz-IV-Empfängerin gewesen, sie wisse, wie man sich fühlt. Herr Korkmaz hätte wohl lieber mit einem männlichen Sachbearbeiter zu tun gehabt und sei dann aber an sie geraten – einen kalten, starren Blick habe er gehabt –, mit nichts habe er sich ausweisen können und sei lauter geworden, und inmitten der Eskalation habe sie dann zu einem Kniff aus ihrer Kommunikationsschulung gegriffen, habe den Blickkontakt mit ihm gesucht, ohne zu zwinkern. Um ihm klarzumachen: bis hierhin und nicht weiter. Und dann, wird sie vor Gericht ganz sachlich aussagen, sei eben der volle Aktenordner knapp an ihrem Kopf vorbeigeflogen, die Brille habe ein bisschen gewackelt, sie denke nicht, dass er habe treffen wollen. »Auf einen Meter Entfernung trifft man.« Sie sei dann eine rauchen gegangen. Für die Anzeige habe aber ihr Arbeitgeber gesorgt, sie habe mit so etwas täglich zu tun, der Bildschirm sei auch schon geflogen. Letzte Woche habe jemand den Mülleimer eingetreten. »Aber wenn wir alles zur Anzeige bringen würden«, wird sie sagen, »dann säße ich oft hier.«
Herr Korkmaz will nur seinen Frieden. Aber den bekommt er so selten. Er hat nach bestem Gewissen versucht, die Geldstrafe abzuarbeiten. Hat immer getan, was ihm auferlegt wurde. Und trotzdem setzten sie ihn an die Luft. Erst die Gebewo – Soziale Dienste: Da hat er in einem Aufnahmeheim für Obdachlose gejobbt, hat Geschirr gepackt in der Küche, alles wie man es ihm gesagt hat, und eines Tages kam die Teamleiterin zu ihm und sagte: Er passe nicht ins Team. Er habe zu viele Brötchen gegessen. Die Gebewo hat ihm sogar Hausverbot erteilt. Seinem Betreuer haben die dann erzählt: Er habe eine provozierende Art! Er habe Kollegen eingeschüchtert. Ein wandelndes Pulverfass sei er. Woher auch immer die das nahmen.
Als Nächstes kam Herr Korkmaz zum Guttemplerorden, und die Guttempler fanden ihn nach ein paar Wochen »nicht mehr tragbar«: Herr Korkmaz störe das Betriebsklima. Dann kam er, letzte Chance, zum Möbelspendenlager von »Hilfe mit Herz« im Wedding. Sehr nette Frauen sind das, sehr verständnisvoll. Für die hat er dann Möbel geschleppt. Klaglos. Über Monate. Bis die Strafe abbezahlt war.
Er hat immer das Seine abgeleistet, er war immer korrekt. Ihm selber hat niemals jemand geholfen. Im Jobcenter hat ihm keiner geholfen. Als er seine Fenster zersprungen fand, hat die Polizei das nicht interessiert. Schweigen war die Antwort, als er wegen seiner Schwester einen Brief an die Kanzlerin schrieb. Jetzt ist es schon so weit, dass ihn der Hunger quält und niemanden das zu kümmern scheint.
So steht Herr Korkmaz da, das Messer in der Hand. Die Polizisten brüllen ihn an, sie zielen auf sein Leben. In einer Sekunde kann alles vorbei sein, können die kleinen Stahlgeschosse seinen weichen Körper durchschlagen. Herr Korkmaz braucht Bedenkzeit. Er weiß nicht, ob er das wirklich will. Er hat die Leiterin der Sparkasse mit diesem Messer bedroht. Aber er wollte ihr doch niemals etwas tun! Alles, was er wollte, war Hilfe. »Messer fallen lassen!«, brüllen die.
Und Herr Korkmaz lässt sein Messer fallen. Legt sich langsam hin. Auf den Bauch. Die Beamten sind über ihm. Legen ihm Handschellen an. Stellen ihn sicher. Einer von ihnen, ein kleiner Mann, fragt: Ob er sich nicht hinsetzen wolle. Aber Herr Korkmaz bleibt lieber liegen. Er fragt den Polizisten nur: Warum der so freundlich zu ihm sei? Da kriegt er keine rechte Antwort. Der kleine Polizist, er zittert am ganzen Körper. Die Vernehmung macht dann eine Kollegin.
Herr Korkmaz will am Boden bleiben. Er liegt auf dem Bauch und gibt Auskunft. Geduldig befragt ihn die Beamtin. Herr Korkmaz sagt: Er wollte die alle abstechen, die Leute in der Bank. Und die Polizei, die wollte er auch abstechen. Er habe viele Gründe, Leute zu ermorden, er habe kein Geld mehr! Er wolle eine Mordanzeige.
Die bekommt er aber nicht. Herr Korkmaz wird ins Krankenhaus gebracht, er wird vor einen Richter gebracht. Jetzt hätte er gern seine Freiheit wieder. Er verspricht, er wird seine Medikamente nehmen! Und dass nie wieder etwas passiert. Auch in Freiheit kann man eine paranoide Schizophrenie ja behandeln lassen. Der fürsorgliche, menschliche Richter aber, er kann nicht anders: Er muss auch an die anderen Menschen denken. So spricht er Herrn Korkmaz frei. Und ordnet seine Unterbringung an in der Psychiatrie.
»Sie is’ ja manchmal unjehalten!«
Wie ein alter Herr sich partout nicht erinnern konnte, ob seine Frau ihn beinahe totgeschubst hätte
Ein kleines, gelbes Männchen aus Wachs rollt herein, ihm wird stattliche Aufwartung gemacht: Seine Betreuerin von Gerichts wegen ist mit; eine Dame von der Sozialstation; die Gerichtsbarkeit sitzt mitsamt Schöffen im Raum; ach ja, und nicht zuletzt die Frau des gelben Männchens, Frau Larissa Klötzer, und ihr Anwalt. Das gelbe Wachsmännchen, 89 klapprige Jahre alt, es japst, kollert und ächzt. Auweia, wird es zusammenklappen, jetzt hier, jetzt gleich, im Angesicht seiner gewalttätigen Frau und des erlittenen Unrechts? Weggelaufen vor ihr ist es im Dezember vergangenen Jahres, weggelaufen vor ihr und ihren Drohungen: Wenn es nicht mehr Geld hergebe, dann komme sie mit ihren Brüdern wieder! Da ist das gelbe Männchen, denn laufen konnte es damals noch, da ist es also zur Wohnungstür hinausgetürmt, so will es die Anklageschrift, da ist es zwei Treppen runter und in den Vorgarten hinein, ehe es von seiner Larissa, 31, hohnlachend eingeholt und niedergeschlagen wurde – Sturz, Oberschenkelhalsbruch, Riesenblutverlust, Notoperation. Und seither der Rollstuhl. Das gelbe Wachsmännchen, es ist so tapfer, wilden Entschlusses stürzt es sich in dieses schwere Gefecht. Geduldig und freundlich fragt die Richterin alles ab, und das Männchen, der Hauptbelastungszeuge, hyperventiliert wie kurz vorm Abheben und gibt nacheinander zu Protokoll: Sie sind also die Richterin, ja? Aha! Otto! 89 Jahre, geboren 16! Jawoll! Jawoll! Eine Scheidung kommt nicht in Frage!
Scheidung, welche Scheidung? Davon ist hier doch gar nicht die Rede. Hier sollen doch die Straftaten verhandelt werden, die man seiner Frau Larissa vorwirft, der Dame mit den dicken Zöpfen und dem dicken Silberkreuz auf dem Pulli, die irgendwie so verheult und gesichtsgedunsen aussieht, aber eben doch nicht zerknickt genug ist, als dass sie den Staatsanwalt nicht anfahren könnte: Er möchte sie bitte ausreden lassen! Frau Klötzer hat es nicht leicht: Alles ist ihr insolvent gegangen, das Solarium und die Friseursalons alle beide, nun hat sie gar nichts mehr zum Leben, und nie mehr hat sie solche Glückstage wie damals den einen: Als das wachsgelbe Männlein in den Frisiersalon kam, aus dem Wohnheim nebenan, und ihr überraschend die Heirat antrug. War das mal eine Aussicht auf Hilfe in Not! Otto Klötzer, gewesener Autohändler, hatte es gemäß eigener Auskunft zu einigem Wohlstand gebracht, und auch vor Gericht spricht er offen übers Geld. Er sagt: Ich habe ihr alles freiwillig gegeben, ohne jeglichen Druck! Meine Frau ist unverschuldet in Not geraten! Das kann ja unter Geschäftsleuten passieren! Denn wer hat heute noch Zeit, sich frisieren zu lassen! Herr Klötzer japst: Ich komme selbstverständlich für meine Frau auf, auch für ihre Schulden, aber unter einer Bedingung: Sie soll zu mir in die Wohnung ziehen!
Die Ehe ist eine Grube, viele Enttäuschungen lauern in ihr. Frau Klötzer hat sich das sicher alles anders vorgestellt an jenem Tag, als das gelbe Männlein mit dem Rollator hereingerollert kam, als es um ihre Hand anhielt und dabei gar nicht wusste, dass es auch im verheirateten Zustand nicht mehr ohne weiteres an sein schwindendes Vermögen herankäme. Darauf nämlich passt eine Betreuerin auf, gerichtlich bestellt. Die ist zäh. Die rückt gerade mal ein Taschengeld heraus. Weil Herr Klötzer leicht beeinflussbar sei. Fünfzig Euro die Woche, das ist alles, was er seiner jungen Frau anbieten kann, und die Schränke hat sie schon ausgeräumt. Nur dann und wann gelingt dem Männlein ein Coup: Damals etwa, als das Ehepaar plötzlich ein gemeinsames Schlafzimmer anschaffen wollte. Da pochte Herr Klötzer mit allem japsenden Nachdruck auf Sonderbedarf. Welcher dann, denn sie hatte drängende Schulden, von Frau Klötzer einer sinnvolleren Verwendung zugeführt wurde – Schlafzimmer kann man ja immer mal kaufen.
Nein, sie werden keine Freundinnen mehr, Frau Klötzer und die Betreuerin ihres Mannes; ewig wird das Geld zwischen ihnen stehen, jenes fehlende Geistergeld, welches der armen Frau Klötzer so unerquickliche Seiten abzwingt: Wenn sie ihren Mann anschreit, die Betreuerin beschimpft, wenn alles Verschwindende in Ottos Haushalt immer nur durch leere Wodkaflaschen ersetzt wird. Was soll Frau Klötzer tun? Die Umstände sind misslich, immer hat man die Finanznot im Nacken. Ihr Mann versteht das: »Sie is’ ja manchmal unjehalten! Das erjibt sich aus dem Temperament von ihr! Sie is’ kein schlechter Mensch, aber manchmal … Temperamentvoll is’ das richtje Wort! Aber da nehmen wir uns nischt!« Herr Klötzer steckt alles tapfer weg, er hat die Zeit verkraftet, da seine Frau ihn nicht im Krankenhaus und nicht in der Reha besuchte, ja, er hat es sogar verwunden, dass es jene Brüder gar nicht gibt, mit denen sie drohte. Wirklich stört ihn nur, dass seine Frau nicht zu ihm ziehen mag! Er vermutet: Amüsieren tue sie sich woanders.
Im Moment amüsiert Frau Klötzer sich weniger. Emsig ist sie in den Pausen mit Rauchen beschäftigt, oder sie verschwindet kurz, und zwischendurch kümmert sie sich rührend um den Hauptbelastungszeugen. Seit ein paar Wochen, so hört man, ist wieder die große Liebe ausgebrochen zwischen den beiden, sie kommt regelmäßig, macht ihm das Essen, sie kümmert sich. So auch jetzt: Er ist ihr »Mäuschen«, sie kniet sich hin zu ihm, sie beschwört das Mäuschen: Sollten die doch alle reden! Die lögen doch eh alle. Dann sei sie halt eine Alkoholikerin, das sei doch egal.