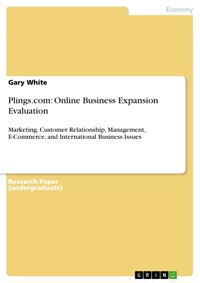9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Matt Damon besuchte 2006 das ländliche Sambia und traf dort Frauen und Mädchen, die täglich mehrere Stunden damit zubrachten, ihre Familien mit Wasser aus weit entfernten Quellen zu versorgen – Zeit, die ihnen fehlte, um zu spielen, zur Schule zu gehen oder eigenes Geld zu verdienen. Über zwei Milliarden Menschen weltweit haben keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen: Ein globales Problem, das durch den Klimawandel zunehmend verschärft wird und ursächlich dafür ist, dass Entwicklungsziele wie Gesundheit, soziale Sicherheit und Geschlechtergerechtigkeit nicht erreicht werden. Damon erkannte schnell, dass er einen echten Experten an seiner Seite brauchte, um die Situation der Mädchen in Sambia (und andernorts) zu verbessern. Er fand ihn in dem Bau- und Umweltingenieur Gary White, der bereits in den 90er-Jahren seinen gut bezahlten Beraterjob aufgegeben hatte, um sich für eine sichere Trinkwasserversorgung in Entwicklungs- und Schwellenländern zu engagieren. In diesem Buch erzählen die beiden ungleichen Verbündeten von ihrem gemeinsamen Kampf gegen das drängendste Entwicklungsproblem unserer Zeit und wie es ihnen mithilfe einer simplen Idee gelang, die Lebensqualität von fast 40 Millionen Menschen entscheidend zu verbessern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Ähnliche
Buch
Matt Damon besuchte 2006 das ländliche Sambia und traf dort Frauen und Mädchen, die täglich mehrere Stunden damit zubrachten, ihre Familien mit Wasser aus weit entfernten Quellen zu versorgen – Zeit, die ihnen fehlte, um zu spielen, zur Schule zu gehen oder eigenes Geld zu verdienen. Über zwei Milliarden Menschen weltweit haben keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen: ein globales Problem, das durch den Klimawandel zunehmend verschärft wird und ursächlich dafür ist, dass Entwicklungsziele wie Gesundheit, soziale Sicherheit und Geschlechtergerechtigkeit nicht erreicht werden. Damon erkannte schnell, dass er einen echten Experten an seiner Seite brauchte, um die Situation der Mädchen in Sambia (und andernorts) zu verbessern. Er fand ihn in dem Bau- und Umweltingenieur Gary White, der bereits in den 1990er-Jahren seinen Beraterjob aufgegeben hatte, um sich für eine sichere Trinkwasserversorgung in Entwicklungs- und Schwellenländern zu engagieren. In diesem Buch erzählen die beiden ungleichen Verbündeten von ihrem gemeinsamen Kampf gegen das drängendste Entwicklungsproblem unserer Zeit und wie es ihnen mithilfe einer simplen Idee gelang, die Lebensqualität von fast vierzig Millionen Menschen entscheidend zu verbessern.
Autoren
Der Bau- und Umweltingenieur Gary White setzt sich seit den 1990er-Jahren für sanitäre Anlagen und sauberes Trinkwasser in Entwicklungs- und Schwellenländern ein und gehört zu den international anerkanntesten Experten auf seinem Gebiet. Matt Damon, Schauspieler und oscarprämierter Drehbuchautor, wurde 2006 bei einem Besuch in Sambia auf die globale Wasserkrise aufmerksam. White und Damon gründeten 2009 Water.org, eine globale Nichtregierungsorganisation, die es lokalen Gemeinschaften über die Vergabe von Mikrokrediten ermöglicht, in eine funktionierende Wasserversorgung und sanitäre Anlagen zu investieren.
GARY WHITE UND MATT DAMON
DERWERTDES WASSERS
Unser gemeinsamer Kampf gegen das drängendste Entwicklungsproblem der Welt
Ins Deutsche übertragen von Kristin Lohmann und Dorothea Traupe
Die US-amerikanische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »The Worth of Water« bei Portfolio / Penguin. Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe September 2022
Copyright © 2022 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © 2022 der Originalausgabe by Water.org
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München, nach einem Entwurf von Brian Lemus
Umschlagmotiv: Erin Patrice O’Brien (Foto von Gary White), Sam Jones (Foto von Matt Damon)
Redaktion: René Stein
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
EB ∙ CF
ISBN 978-3-641-29520-2V001www.goldmann-verlag.de
Dieses Buch ist all den resilienten, einfallsreichen, inspirierenden Menschen gewidmet, denen wir uns verpflichtet fühlen. Mit einer Investition in sicheres Wasser und in die vielen Chancen, die es mit sich bringt, schlagen Sie einen völlig neuen Kurs ein – nicht nur für sich selbst und Ihre Familie, sondern für die gesamte Menschheit.
»Wenn der Brunnen trocken ist, kennen wir den Wert des Wassers.«
Benjamin Franklin
INHALT
1 Die »Wasserkrise« – was ist das eigentlich?
2 Die Wasser-Dekade
3 Die große Idee
4 Das erste Date
5 Die Anfänge von water.org
6 Die große Idee – Klappe, die zweite
7 Und die Welt bewegt sich doch!
8 Venture Philanthropy
9 Die Welle
Dank
Bildteil
Anmerkungen
Register
1DIE »WASSERKRISE« – WAS IST DAS EIGENTLICH?
Matt Damon
Bisher habe ich Geschichten fast immer auf der Leinwand erzählt, nicht auf Papier. Als ich mir Gedanken darüber machte, wie ich dieses Buch beginnen soll, habe ich mir deshalb auch gleich vorgestellt, wie ich einen Film über das Thema angehen würde. In der ersten Einstellung wäre eine Hütte im ländlichen Sambia zu sehen, die ich 2006 besucht habe. Ich sehe alles noch genau vor mir, die Wände aus Lehmziegeln, den Lehmboden, das strohgedeckte Dach. Normalerweise ist die Erde hier staubtrocken, aber jetzt im April, am Ende der Regenzeit, ist der Boden zumindest teilweise mit einem kargen grünen Teppich bedeckt. Ich sitze vor der Hütte und warte darauf, dass ein Mädchen im Teenageralter von der Schule nach Hause kommt.
In Sambia war ich, weil Bono – ja, genau, der Rockstar, der in seiner Freizeit weltweit extreme Armut bekämpft –, weil also Bono mir so lange damit auf die Nerven gegangen war, bis ich endlich zugesagt hatte. »Auf die Nerven gehen«, das hat übrigens Bono so formuliert, nicht ich. Er hat sich die Phrase wie ein Ehrenabzeichen ans Revers geheftet. Weil er stolz darauf ist, Leuten – in erster Linie Politikern, aber nicht nur – so lange auf den Keks zu gehen, bis sie Dinge tun, die sie sonst nicht tun würden. Das kann er richtig gut. Bono ist nämlich überzeugt, dass Menschen ihre Prioritäten nur dann ändern und aktiv werden, wenn sie Armut aus nächster Nähe erleben. Deshalb hatten er und seine Kollegen von DATA – das ist die von ihm gegründete Organisation, aus der später die ONE-Kampagne hervorging – mich auch dazu gedrängt, sie auf eine Reise nach Afrika zu begleiten. Bono hatte die Entschlossenheit eines Versicherungsvertreters an den Tag gelegt. Es war klar, dass er kein Nein akzeptieren würde.
Eigentlich wollte ich ja auch gar nicht Nein sagen. Ich hatte nur gerade unheimlich viel um die Ohren. Meine Frau würde zum Zeitpunkt der Reise im siebten Monat schwanger sein, und das Zeitfenster bis zu meinem nächsten Film war auch ziemlich eng bemessen. Schlechter Zeitpunkt, leider, meinte ich zu Bono. Er sah mich an und sagte: »Es ist nie der richtige Zeitpunkt.« Womit er natürlich völlig recht hatte.
Ich hatte keine großen Erwartungen, was den Sinn und Zweck der Reise anging. Ich würde ja keine Leben verändern. Bono sagt gerne, es gäbe nichts Schlimmeres als einen Rockstar, der sich für etwas starkmacht. Ich würde sagen, ein Schauspieler, der sich für etwas starkmacht, kommt gleich danach. Die Vorstellung, wie ich mit betroffenem Gesicht durch den Busch latsche oder durch irgendeinen städtischen Slum und danach in mein bequemes Leben zurückfliege, bereitete mir Magenschmerzen. Nur war das eigentlich eine noch dümmere Ausrede als »zu viel zu tun«. Und je mehr ich über die Reise nachdachte, desto klarer wurde mir, dass ich dabei sein wollte, dass ich persönlich Menschen treffen wollte, die in diesen extrem armen Gegenden leben, damit ich mir selbst ein Bild machen konnte, womit sie Tag für Tag zu kämpfen haben. Und um herauszufinden, ob es nicht doch etwas gab, das ich tun könnte. Also sagte ich Bono, ich würde ihn begleiten, und mein älterer Bruder Kyle sagte ebenfalls zu.
Wir waren etwa zwei Wochen unterwegs. Die Reise führte uns in Slums und ländliche Dörfer in Südafrika und Sambia. DATA hatte die Reise wie ein Kurzseminar am College organisiert. Jeden Tag erfuhren wir etwas über einen anderen Aspekt, der die Menschen daran hindert, den Teufelskreis der Armut zu durchbrechen: das unterfinanzierte Gesundheitssystem, die Herausforderungen des täglichen Lebens im Slum, die HIV-/AIDS-Krise. Zu jedem Thema bekamen wir eine Infomappe und besuchten Organisationen, die sich mit potenziellen Lösungen befassten, und vor allem sprachen wir mit den Menschen selbst.
An einem unserer letzten Tage in Sambia sollte es um das Thema Wasser gehen. Mir war nicht wirklich klar, warum eigentlich. Über Themen wie HIV, AIDS oder Bildung liest man in der Zeitung, darüber wird gesprochen, die Leute unterzeichnen Petitionen oder spenden Geld – aber als es jetzt hieß, wir würden uns mit der »Wasserkrise« beschäftigen, fragte ich mich, worin eigentlich die Problematik bestand. Wahrscheinlich war das Wasser verseucht, nahm ich an.
Dann las ich mir die Infomappe durch. Ja, das Wasser war verseucht, hieß es darin – und zwar so sehr, dass alle zwanzig Sekunden ein Kind an einer Krankheit starb, verursacht durch dieses verseuchte Wasser.1 Wasser ist aber auch schwer zugänglich. Die Dörfer haben keine Wasserleitungen und die Häuser keine Wasseranschlüsse. Also muss jemand losgehen, um Wasser zu holen, und dieser Jemand ist so gut wie immer ein Mädchen oder eine Frau. Sie müssen so lange gehen, bis sie an eine wie auch immer geartete Wasserquelle kommen, dort ihren Plastikkanister auffüllen – einen Zwanzig-Liter-Kanister, der folglich zwanzig Kilogramm wiegt2 –, umdrehen und das Wasser zurück nach Hause tragen: Das ist ihre Hauptaufgabe. Und wenn sie am nächsten Tag aufwachen, geht alles von vorne los.
Um uns selbst ein Bild zu machen fuhren wir in ein Dorf, das vier Stunden von Sambias Hauptstadt Lusaka entfernt liegt und in dem mit der Unterstützung eines Partnerunternehmens von DATA ein Brunnen gebaut worden war. Dessen Mitarbeiter hatten Kontakt zu einer Familie, die in der Nähe der Straße wohnte. Jeden Tag nach der Schule lief die vierzehnjährige Tochter Wema3 zum Brunnen und holte Wasser für die Familie. Wema hatte sich einverstanden erklärt, dass wir sie begleiteten, aber als wir bei ihrer Hütte ankamen, war niemand da. Alles war wie ausgestorben, nicht nur die Hütte, sondern die ganze Umgebung. Einen Ortskern gab es nicht, die Hütten standen lose verstreut in der Gegend. Alles war ruhig, ganz still, wir saßen einfach da und warteten.
Irgendwann sahen wir Wema den Pfad entlang auf uns zu kommen. Sie hatte Bücher dabei und trug ein einfaches blaues Kleid, das wie eine Schuluniform aussah. Schüchtern grüßte sie uns, legte ihre Bücher ab und holte den Wasserkanister ihrer Familie.
Gemeinsam machten wir uns auf den Weg zum Brunnen. Anfangs verlief das Gespräch noch schleppend und unbeholfen. Kein Wunder – Wema, die den Weg normalerweise Tag für Tag alleine zurücklegte, hatte plötzlich eine Entourage von Reisekoordinatoren, Vertretern ihres Dorfes und dann auch noch einen hyperaktiven Filmschauspieler im Schlepptau. Dazu kam, dass wir keine gemeinsame Sprache hatten und deshalb auf einen Dolmetscher angewiesen waren. Nach einer Weile ließen sich die anderen ein Stück zurückfallen, um uns etwas Raum zu verschaffen. Wema antwortete erst ziemlich knapp auf meine Fragen, aber irgendwann entspannten wir uns, und ab dann fühlte sich selbst das Schweigen zwischen uns natürlicher an. Ein ganz normaler friedlicher Spaziergang entlang einer Landstraße.
Nach ungefähr einer halben Stunde erreichten wir den Brunnen. Jemand schlug vor, ich könne ja mal versuchen, das Wasser hochzupumpen. An sich hielt ich mich für gut in Form, weil wir gerade die Dreharbeiten zu einem weiteren Film der Jason-Bourne-Reihe abgeschlossen hatten. Aber dann stellte sich die Sache als schwieriger heraus, als ich angenommen hatte. Wema und ich mussten beide lachen, weil ich mich so abrackerte. Sie dagegen ging so geübt mit der Pumpe um und hievte sich den schweren gelben Kanister so behände auf den Kopf, wo sie ihn einhändig balancierte, dass ich nur voller Bewunderung staunen konnte. Bis einem dann wieder einfiel (für den Fall, dass man das kurz vergessen hatte), dass das hier Arbeit für sie war: eine lebensnotwendige, essenzielle Aufgabe.
Auf dem Rückweg fing es an zu regnen. Niemand verlor ein Wort darüber, wir gingen einfach weiter. Es hat etwas, sich dem Regen einfach hinzugeben und zu akzeptieren, dass man völlig durchnässt wird, es macht einen irgendwie locker. Auch unsere Unterhaltung entspannte sich weiter. Ich fragte Wema, ob sie später als Erwachsene auch noch in ihrem Dorf leben wollte. Sie lächelte mich an, immer noch ein bisschen schüchtern – als würde sie abwägen, ob sie mir antworten sollte oder nicht. Nach einer Weile rang sie sich zu einer Antwort durch: »Ich will nach Lusaka gehen und Krankenschwester werden.«
Ich hatte das Gefühl, dass sie ihre Pläne normalerweise eher für sich behielt. Ob ihre Eltern überhaupt davon wussten und ob sie vielleicht deshalb gezögert hatte – weil ich es ihnen erzählen könnte? Das war ja keine Kleinigkeit – den Ort zu verlassen, der ihr von Geburt an vertraut war, auf eigene Faust loszuziehen und allen zu zeigen, dass sie etwas aus ihrem Leben machen wollte. Das berührte mich sehr. Ich weiß schon, es ist ein Klischee: Du triffst eine Person am anderen Ende der Welt, deren Leben sich komplett von deinem eigenen unterscheidet, und siehst dich plötzlich selbst in ihr – aber genau so war es. Wema erinnerte mich an dieses Gefühl der Rastlosigkeit, an den Drang, sich auf den Weg zu machen und an einem neuen Ort etwas völlig Neues anzufangen. Ich wusste noch genau, wie es sich anfühlte, wenn man als Teenager einen Traum hatte. Ich jobbte damals jahrelang jeden Sommer und zahlte das Geld auf ein gemeinsames Konto ein, das ich zusammen mit Ben Affleck eröffnet hatte, weil wir beide unbedingt nach New York wollten, um Schauspieler zu werden. Klar war es nicht dasselbe, aber irgendwie doch ähnlich genug, um eine Verbindung zwischen uns zu schaffen.
Für mich stand außer Frage, dass Wema ihren Plan durchziehen würde. Das strahlte sie einfach aus; sie hatte so selbstbewusst davon erzählt, dass ich mir sofort vorstellen konnte, wie sie eines Tages all ihren Mut zusammennahm und ihren Eltern erzählte, dass sie nach Lusaka gehen und dort ihren Traum verwirklichen würde. Vielleicht wären ihre Eltern wütend oder traurig darüber, dass sie sie verlieren würden; vielleicht wären sie aber auch stolz darauf, dass sie so groß dachte. Vielleicht auch alles zusammen. Jedenfalls würde sie eine Ausbildung machen, sie würde arbeiten und ihr Ziel erreichen. Mehr als fünfzehn Jahre später bin ich immer noch überzeugt, dass sie es geschafft hat. Dass sie nicht noch immer mit dem Kanister auf dem Kopf die Straße entlanggeht. Ich hoffe, ich habe recht.
Der Hauptgrund für meinen Optimismus – und übrigens auch der einzige – ist, dass Wema zur Schule gehen konnte. Bis zum Brunnen war es zwar immerhin eine halbe Stunde, aber bei einer Stunde Wasserholen pro Tag blieb ihr immer noch genug Zeit, um zur Schule zu gehen und vor Sonnenuntergang die Hausaufgaben zu erledigen – was sein musste, weil es in ihrem Dorf keinen Strom gab und sie deshalb nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr lesen konnte. DATA hatte damals Wema ausgewählt, weil ihre Geschichte – relativ gesehen – eine Erfolgsgeschichte war: ein Mädchen, das das Glück hatte, Wasser aus einem relativ nah gelegenen Brunnen holen zu können, sodass sie den größten Teil des Tages mit Lernen verbringen konnte. Millionen andere Mädchen haben nicht so viel Glück. Sie brauchen nicht eine Stunde zum Wasserholen, sondern drei oder vier oder sechs. Wasser zu holen ist ihre Hauptbeschäftigung. Die Notwendigkeit dieser Aufgabe hält sie davon ab, zur Schule zu gehen oder auf dem Feld zu arbeiten, um Geld für ihre Familien zu verdienen oder etwas herzustellen, das sich auf dem Markt verkaufen lässt. In manchen Regionen Indiens ist das Wasser so knapp, dass sich manche Männer »Wasserfrauen« nehmen – Zweit- oder Drittfrauen, die tagein, tagaus nichts anderes tun, als Wasser für ihre Familien heranzuschleppen.4
Immer wieder fiel mir dieses alte Sprichwort ein: Wasser ist Leben. Wie viele Stunden Lebenszeit hatte dieses vierzehnjährige Mädchen wohl schon sinnvoll nutzen können, nur weil jemand auf die Idee gekommen war, zwei Kilometer von ihrem Zuhause entfernt einen Brunnen zu bauen – und nicht etwa fünf oder zehn Kilometer? Allein diese Entscheidung erlaubte es ihr, die Zeit auch mit anderen Dingen zu verbringen als nur mit dem Weg zum Brunnen und zurück. Nur deshalb konnte sie einen Traum verfolgen, der sich so groß und kühn anfühlte, dass sie ihn kaum auszusprechen wagte. Für Wema war Wasser nicht nur Leben – es war zugleich die Chance auf ein besseres Leben.
An dieser Stelle sollte ich wahrscheinlich eine kurze Pause einlegen, weil Sie vermutlich gerade das große Kotzen kriegen angesichts meiner Promi-geht-nach-Afrika-und-rettet-die-Welt-Geschichte. Das geht mir übrigens nicht anders. Ja, dieser Promi bin ich wohl. Aber ich bin auch der Sohn meiner Mutter.
Als ich klein war, arbeitete meine Mutter Nancy Carlsson-Paige, die heute in den Siebzigern ist, als Professorin für Bildung und Erziehung in der Kindheit. Sie lehrte damals an der Lesley University in Cambridge, Massachusetts. Seit ich neun Jahre alt war, lebte ich zusammen mit ihr und meinem Bruder in einem Sechs-Familien-Gemeinschaftshaus in der Nähe des Campus. Kennen Sie das, wenn jemand über die linksliberale Einstellung der akademischen Welt lästert und dazu das völlig überzogene Bild einer Hippie-Kommune an die Wand malt, in der es nichts als Bücher gibt? Genau in so was bin ich aufgewachsen. Kein Witz, einer meiner Babysitter war Howard Zinn, ein sehr bekannter Professor der Boston University. Er schrieb Eine Geschichte des amerikanischen Volkes und war einer der führenden Köpfe der Bewegung, die sich dafür starkmachte, dass Geschichte aus der Perspektive der Unterdrückten gelehrt wird, nicht aus der der Unterdrücker. Wenn mich heute jemand als Hollywood-Linken bezeichnet, würde ein Teil von mir am liebsten direkt Contra geben – und ein anderer Teil würde eigentlich gerne erwidern: »Wenn schon links, dann aber wohl eher Cambridge als Hollywood.«
Zu den großen Themen, über die während meiner Teenagerzeit in den 1980er-Jahren in Cambridge gesprochen wurde (nicht da, wo Ben und ich am Central Square abhingen, aber auf jeden Fall bei mir zu Hause am Esstisch), gehörten auch die Unruhen im mittelamerikanischen Raum. Die Wurzeln dieser Krise reichen bis in die 1950er-Jahre zurück, als die Eisenhower-Regierung die CIA anwies, den Sturz des demokratisch gewählten Präsidenten von Guatemala zu unterstützen – in der Annahme, dadurch die Ausweitung des Kommunismus in unsere Breiten stoppen zu können. Dabei war der guatemaltekische Präsident nicht mal Kommunist, sondern nur ein linker Sozialreformer, aber allein die Befürchtung, er könne insgeheim doch einer sein oder eines Tages einer werden, reichte den USA aus, um einen Militärputsch zu unterstützen. Zweihunderttausend Menschen starben in dem darauffolgenden Bürgerkrieg.5 In den 1970er- und 1980er-Jahren stürzten dann linke Bewegungen in der Region – in Nicaragua die Sandinisten und in El Salvador die FMLN –, die bis dato in ihren Ländern herrschenden Diktatoren beziehungsweise Militärjunten. Die USA stellten sich hinter die Diktatoren und sorgten durch entsprechende Ausbildung und Finanzierung dafür, dass sie lange und blutige Bürgerkriege führen konnten. Es kam zu schrecklichen Menschenrechtsverletzungen auf beiden Seiten, denen ich angesichts des Ausmaßes all der tragischen Geschehnisse nicht ansatzweise gerecht werden kann in diesem Buch – zumal mir klar ist, dass manche Leute einem Typen, der seinen ersten Geschichtsunterricht von Howard Zinn bekommen hat, bei dem Thema sowieso nicht über den Weg trauen würden.
Jedenfalls war Cambridge in meiner Jugend ein Sammelbecken des Widerstands gegen die Außenpolitik der US-Regierung. In Kirchen wurden Gedenkfeiern für die Opfer politischer Unterdrückung abgehalten, und auf der Straße traf man immer wieder auf Freiwillige aus den Gemeinden, die mit Fotos von Kriegsopfern von Tür zu Tür gingen und Geld sammelten. Ich kann mich an riesige Protestkundgebungen im Boston-Common-Park erinnern, darunter auch eine, bei der fünfhundert Leute das JFK Federal Building besetzten. Meine Mom nahm an all diesen Protesten teil und wurde einmal sogar verhaftet. Die Demonstrationen bewirkten zwar keine Kehrtwende in der US-Politik, aber etwas bewegten sie doch. Unser Gouverneur zum Beispiel widersetzte sich der Reagan-Regierung, indem er sich weigerte, die Nationalgarde von Massachusetts zu Militärübungen nach Mittelamerika zu schicken. Und Cambridge erklärte sich zum Zufluchtsort für Menschen, die aus Krisengebieten geflüchtet waren, und wählte ein durch die Gewaltexzesse verwüstetes salvadorianisches Dorf zur Partnergemeinde, in die wir dann medizinische und andere Hilfsgüter schickten.6
Etwa zu der Zeit begann meine Mom, Spanisch zu lernen und nach Mittelamerika zu reisen, wann immer sie konnte. Sie flog nach Guatemala, El Salvador und Honduras. In erster Linie wollte sie sich ein besseres Bild von den Geschehnissen vor Ort machen und dann zu Hause von den neuesten Entwicklungen berichten, um so die Argumente gegen weitere Interventionen der USA zu untermauern. Außerdem glaubten viele der Aktivistinnen und Aktivisten damals, dass die US-Regierung keine Invasion riskieren würde, wenn amerikanische Bürgerinnen und Bürger vor Ort wären, um deren Leben nicht zu gefährden.
Auf drei der harmloseren Reisen nahm sie mich mit. Erst wohnten wir bei einheimischen Familien und nahmen an Sprachkursen teil, den Rest der Zeit tourten wir dann mit Rucksack quer durchs Land und waren in Bussen voller Hühner unterwegs. In dem Sommer, als wir nach Guatemala fuhren, wurde in den Bergen immer noch gekämpft. Einmal fuhr ein Lastwagen mit einer Gruppe von Kindern auf der Ladefläche an mir vorbei. Mit Tarnfarbe im Gesicht und Gewehr in der Hand waren sie auf dem Weg in die Berge. Ich war damals siebzehn; dem Aussehen nach waren sie vielleicht so alt wie ich oder sogar noch jünger. Ich werde nie den leeren Ausdruck eines Jungen vergessen, mit dem ich kurz Blickkontakt hatte. Dieser Junge hatte Dinge gesehen, von denen ich keine Ahnung hatte und auch nie haben würde.
Im nächsten Sommer – das war 1989, ich hatte gerade mein erstes Collegejahr hinter mir – meinte meine Mom: »Matt, ich habe mich bisher ziemlich eingeschränkt mit meinen Reisen, weil du und Kyle eine Mutter gebraucht habt. Aber jetzt seid ihr groß – ich werde das nicht mehr tun.« Von da an fuhr sie auch in gefährlichere Gebiete – Cambridges Partnerstadt in El Salvador eingeschlossen. Der Ort stand damals unter Verdacht, Guerilla-Kämpfern Zuflucht zu bieten. Während ihres Aufenthalts besetzte die salvadorianische Armee den Ort, feuerte in die Luft und urinierte in den Gemeindebrunnen, um das Wasser zu verseuchen. Zum Glück blieb meine Mom unversehrt. Und als sie nach Hause kam, war sie nur umso entschlossener, sich zu engagieren und herauszufinden, was in der Welt vor sich ging und wie sie aktiv noch mehr im Kampf gegen Ungerechtigkeit tun konnte.
Bei all dem war ihre Sichtweise ziemlich komplex. So entschlossen sie war, etwas zu bewegen, so skeptisch war sie allen Menschen, Regierungen und Hilfsorganisationen gegenüber – und ich meine wirklich allen –, die im Namen der Wohltätigkeit in Krisengebiete »einfielen«. Ich weiß noch, wie sie mir einmal erklärte, dass jede Intervention, und wenn sie noch so gut gemeint ist, immer Gefahr läuft, etwas Herablassendes zu haben oder sogar einen unbewussten Rassismus widerzuspiegeln – nämlich durch die Annahme, Schwarze und People of Colour seien nicht in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Sie fand die Arroganz der Entwicklungshelfer unerträglich, die meinten, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und die Not leiden-den Menschen würden nur darauf warten, in den Genuss ihres Wissens und ihrer Wohltätigkeit zu kommen (im Ernst: Sprechen Sie sie besser nicht darauf an).
Dieser kritischen Überprüfung unterzog sie sich auch selbst. Es genügte ihr nicht, das Herz am rechten Fleck zu haben. Auf ihren Reisen hatte sie am eigenen Leib erfahren, wie schwierig es war, die komplexen Lebensumstände eines Landes, in dem man nie selbst gelebt hatte, wirklich zu erfassen, die Gegebenheiten zu begreifen, die so anders waren als alles, was man bisher kennengelernt hatte, und die Folgen der von außen eingebrachten Aktivitäten abzuschätzen. Es gibt ja dieses relativ bekannte überspitzte Bild des liberalen Kreuzritters. Aber meine Mom war auf keinem Kreuzzug. Sie rang permanent – mit sich selbst und all ihren Bedenken. Sie bemühte sich nach Kräften, nicht in die Fallen zu tappen, die sie überall um sich herum wahrnahm. Und sie versuchte immer, bescheiden zu sein statt anmaßend – und sich nicht einzubilden, auch nicht insgeheim, sie wüsste besser über die Lebensumstände dieser Salvadorianer oder Mexikaner oder Guatemalteken Bescheid als diese selbst. Und dann, ausgestattet mit neuer Selbsterkenntnis, stieg sie ins nächste Flugzeug, um herauszufinden, wo sie als Nächstes etwas bewegen könnte.
Zwischen den Gesprächen mit meiner Mutter und dem Zeitpunkt, zu dem ich ihre Erkenntnisse schließlich auf mein eigenes Leben anwandte, vergingen Jahre. Jahre, in denen ich aus einem Seesack lebte und zwischen diversen Sofas bei Freunden und irgendwelchen Schauspielerjobs hin- und herpendelte. Um ehrlich zu sein, rückte die Auseinandersetzung mit der Welt für mich in dieser Zeit völlig in den Hintergrund; größere und bessere Rollen zu bekommen, mir ein geregeltes Arbeitsleben aufzubauen, das war alles, was damals zählte. Und als das geschafft war, musste ich alle Energie darauf aufwenden, dass es auch so blieb. Dann gründeten Lucy und ich eine Familie, und so vergaß ich den Gedanken daran irgendwann ganz. Und bevor ich mich versah, schrieben wir das Jahr 2006; Bono klopfte an und begann, mir damit auf die Nerven zu gehen, ich solle mich engagieren. Er hatte damals längst bewiesen, dass man sich durchaus für andere einsetzen und trotzdem sein eigenes Leben weiterführen kann. In all den Jahren, in denen er sich im Kampf gegen Armut engagierte, hatten U2 eine ganze Reihe Platten aufgenommen, und er hatte weder seinen Alltagsjob aufgegeben noch seine Frau Ali oder seine vier Kinder vernachlässigt.
Und auch dass die Leute jedes Mal die Augen verdrehen, wenn er als Rockstar über die Armut auf der Welt spricht, oder ihn als Heuchler oder Dilettanten oder fotogenen Philanthropen bezeichnen, hat ihn nicht davon abgehalten, sich auch weiterhin zu engagieren. Denn solche Sprüche kommen nach wie vor, und zwar bis heute – das gehört vermutlich dazu. Aber Bono ist der Meinung, dass man über ein bisschen Augenrollen oder den einen oder anderen fiesen Kommentar in den sozialen Medien locker hinwegsehen kann – vor allem, wenn man sich die Alternative klarmacht: nämlich gar nichts zu tun oder nur hin und wieder einen Scheck auszustellen. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich finde es total wichtig, für wohltätige Zwecke zu spenden. Wer wie ich im Leben Glück hatte, der sollte auch einen bestimmten Anteil seines Glücks weitergeben. Davon war ich schon immer überzeugt. Und trotzdem beschlich mich damals das Gefühl, ich könnte mehr tun, als nur zu spenden. Was genau das sein könnte, galt es herauszufinden – und die Reise mit Bono im Jahr 2006 war mein erster echter Schritt auf dem Weg dorthin.
Dass ich mich auf das Thema Wasser konzentrieren würde, war keineswegs von Anfang an klar. Die Afrikareise war wie im Flug an mir vorbeigerauscht. DATA hatte mich innerhalb kürzester Zeit mit so vielen Informationen überschüttet, dass ich gar nicht mehr klarsehen konnte. Ich musste erst einmal alles in Ruhe einordnen und würde dann entscheiden, in welchem Bereich ich mich engagieren wollte.
Intuitiv sprang mir zuerst die AIDS-Krise ins Auge, die allem Anschein nach für das größte Leid überhaupt verantwortlich war. Um tiefer in das Thema einzusteigen, hatten wir zu Beginn der Reise einen Tag in Soweto verbracht, dem größten Township Südafrikas. Dort hatten wir zwei Jungen getroffen – einer etwa zwölf, der andere vielleicht sieben Jahre alt –, deren Eltern beide an AIDS gestorben waren. Die Jungs lebten alleine, völlig auf sich allein gestellt. Der Ältere erzählte mir, wie er jetzt seinem kleinen Bruder gegenüber beide Rollen, die des Vaters und die der Mutter, erfüllen musste. Mir fiel auf, wie picobello ihr Zimmer aussah. Dabei gab es niemanden, der für sie putzte oder sie anhielt, selbst sauber zu machen. Sie machten das von ganz alleine.
»Wie wird es mit den beiden weitergehen?«, fragte ich, als wir wieder draußen waren. »Was für ein Leben erwartet sie?« Unsere Guides erklärten ganz sachlich, dass sich die beiden sehr wahrscheinlich einer Gang anschließen würden. Die Gangs in Soweto hätten eine Menge Tricks auf Lager, um Jungs an sich zu binden, die keine Perspektive hatten und Geld brauchten. Und meistens hätten sie Erfolg damit.
Die ganze restliche Reise über dachte ich immer wieder an diese Begegnung zurück. Ich wollte unbedingt etwas zur Bekämpfung der AIDS-Krise beitragen, und es fehlte auch nicht an Möglichkeiten – AIDS war einer der Schwerpunkte von DATA. Doch je mehr ich darüber erfuhr, desto mehr gelangte ich zu der Überzeugung, dass diese Krise mich nicht brauchte. Dank Aktivisten auf der ganzen Welt und Prominenten wie Bono und Bill Gates oder den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton und George W. Bush hatten sich viele Staaten, wenn auch reichlich spät, endlich dazu aufgerafft, die Ausbreitung von AIDS zu stoppen. Natürlich brauchte es auch hier immer noch viel mehr Mittel und Unterstützung. Aber auch andere Probleme verursachten eine Menge Leid – und bekamen nur einen Bruchteil der Aufmerksamkeit.
Bildung zum Beispiel. Dazu hatte ich durch meine Biografie einen direkten persönlichen Bezug, außerdem ist der Wert von Bildung leicht vermittelbar, weil so viele Menschen, unabhängig von ihrem Background, das Thema aus eigener Erfahrung kennen. Aber auch hier gab es schon jede Menge engagierte Leute. Als Nächstes dachte ich, ich sollte vielleicht dem Beispiel meiner Mutter folgen und mich an Themen halten, auf die mich die Menschen, denen ich auf meiner Reise begegnet war, direkt angesprochen hatten. Das war allerdings nur ein einziges Mal passiert. Wir hatten im Haus des Häuptlings eines Dorfes außerhalb von Lusaka zu Abend gegessen. Irgendwann hatte er sich unvermittelt vorgebeugt und gemeint: »Können wir nicht endlich etwas gegen die Krokodile unternehmen?«
Es stellte sich heraus, dass in seinem Dorf tatsächlich mehr Menschen durch Krokodile ums Leben kamen als durch AIDS. Unnötig zu erwähnen, dass es in meiner Mappe dazu keine Infos gegeben hatte. Ich sprach mit einer Mitarbeiterin von DATA, und sie meinte, sie würde sich darum kümmern. Die Lösung war vermutlich ziemlich einfach: Fallen, Waffen, solche Sachen. Um darauf zu kommen, brauchte es keine UN-Mission. Mich selbst als Held in der Geschichte zu sehen, fiel mir trotzdem schwer: Matt Damon auf Krokodilsjagd? Crocodile Damon?
Immer wieder musste ich an das Mädchen im blauen Kleid denken und an unseren gemeinsamen Gang zum Brunnen. Und je mehr ich über ihre Situation nachdachte und über alles andere, was ich inzwischen über das Thema wusste, desto klarer wurde mir, welche enorm bedeutende Rolle Wasser spielt, und zwar für alles. Ohne Wasser ist kein Leben möglich. Und ohne Zugang zu sauberem Wasser gibt es auch keinen Fortschritt.
Jede einzelne Problematik, der ich auf meiner Reise begegnet war oder von der ich in den Nachrichten gehört hatte, ließ sich letztlich auf Wasser zurückführen. Zum Beispiel Gesundheit. An Durchfall, dem häufigsten Symptom wasserbedingter Krankheiten, sterben mehr Kinder als an Malaria, Masern und AIDS zusammen.7 Millionen weiterer Kinder sind aufgrund wasserbedingter Krankheiten so massiv unterernährt, dass ihre körperliche und geistige Entwicklung für immer beeinträchtigt sein wird.8 Und die Frauen und Mädchen, die das Wasser transportieren, haben sogar mit noch mehr gesundheitlichen Folgen zu kämpfen. Åsa Regnér, die stellvertretende Leiterin von UN Women, formulierte es so: »Das permanente Tragen, meist schon ab jungen Jahren, führt zu zunehmenden Verschleißerscheinungen an Nacken, Wirbelsäule, Rücken und Knien. Diese Frauenkörper sind de facto ein Teil der Wasserversorgungsinfrastruktur – sie übernehmen die Aufgabe der Leitungen.«9
Wasser ist aber auch entscheidend, damit mehr Kinder regelmäßig in die Schule gehen. Wasserbedingte Krankheiten sind für 443 Millionen Fehltage pro Jahr in den Schulen verantwortlich.10 Hinzu kommt, dass viele Mädchen wegen fehlender Toilettenräume und Hygieneprodukte während ihrer Menstruation mehrere Tage im Monat zu Hause bleiben. Ganz zu schweigen von den langen Wegen bis zur Wasserquelle, die sie gleich komplett vom Schulbesuch abhalten. Wenn wir die Klassenzimmer voller (weiblicher) Kinder sehen wollen, müssen wir die Wasserkrise beenden.
Und sollte Ihnen die Gleichstellung der Geschlechter am Herzen liegen – welcher Schritt könnte bedeutender sein, um Frauen und Mädchen zu empowern, als ihnen ihre Lebenszeit zurückzugeben?
Aber auch für extreme Armut ist die Wasserkrise eine der Hauptursachen – 260 Milliarden Dollar kostet die Krise die Volkswirtschaften weltweit jedes Jahr.11 Wasserknappheit gehört außerdem zu den verheerendsten Folgen der Klimaerwärmung, das sehen wir bereits heute. Für Menschen, die an die Wasserversorgung angeschlossen sind, wird die zunehmende Wasserknappheit ziemlich teuer werden. Für alle anderen bedeutet sie das Todesurteil.
»Das Prinzip aller Dinge ist Wasser«12, sagte schon der griechische Naturphilosoph Thales von Milet. Für mich sah es ganz so aus, als hätte Thales recht gehabt. Jedes Gespräch, das ich über irgendein Entwicklungsthema führte – Gesundheit, Bildung, Frauenrechte, wirtschaftliche Möglichkeiten, Umwelt –, hätte eigentlich mit einer Diskussion über Wasser beginnen können, wenn nicht müssen. Beziehungsweise, um genau zu sein, mit einer Diskussion über WASH – das ist die übliche, im englischen Sprachraum verwendete Abkürzung für Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene, die häufig zusammengenommen als ein Thema behandelt werden. De facto aber hatte kaum jemand darüber gesprochen. Mir fiel immer wieder ein Satz eines Kollegen von Bono ein: »Wasser ist das unsexieste Thema überhaupt«, hatte er gesagt. Genau, dachte ich. Und rate mal, was passiert, wenn dann auch noch Kacke obendrauf kommt.
Aber warum sind die Themen Wasser und sanitäre Einrichtungen eigentlich so unsexy? Warum bekommen sie so wenig Aufmerksamkeit? Ich habe im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von Theorien dazu entwickelt und wieder verworfen. Die Theorie, an der ich bis heute festhalte, lässt sich am besten mit einem Gleichnis von David Foster Wallace beschreiben:
Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt: »Morgen, Jungs. Wie ist das Wasser?« Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter, und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt: »Was zum Teufel ist Wasser?«13
Wallace wollte mit dieser kleinen Geschichte zeigen, dass »die offensichtlichsten, allgegenwärtigsten und wichtigsten Tatsachen oft die sind, die am schwersten zu erkennen und zu diskutieren sind«. Für mich ist die Geschichte mehr als eine Metapher – in Bezug auf Wasser ist sie sozusagen buchstäblich wahr.