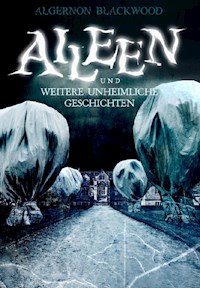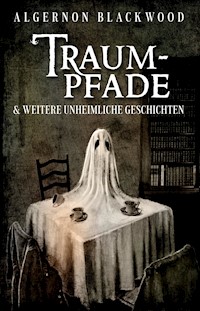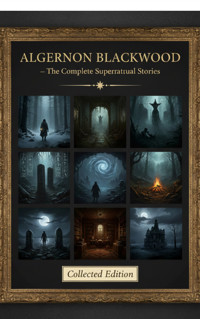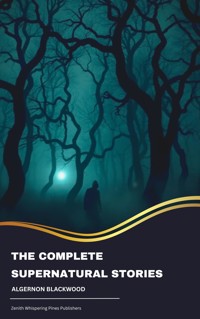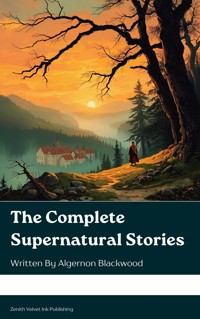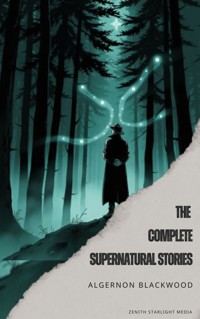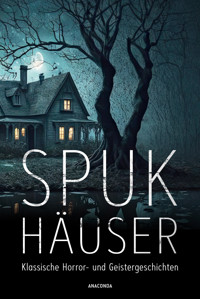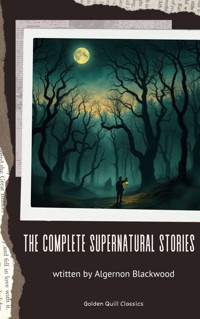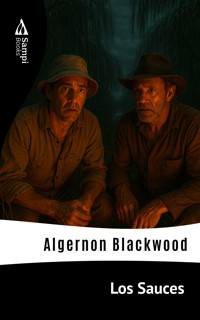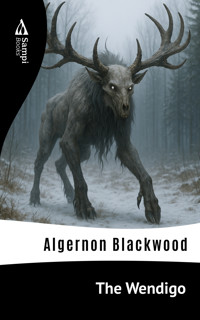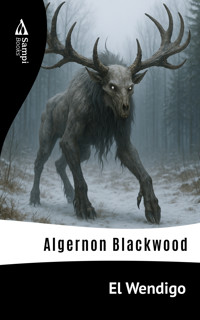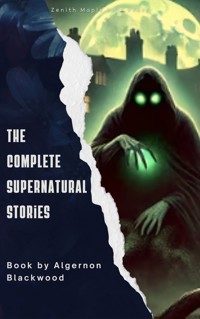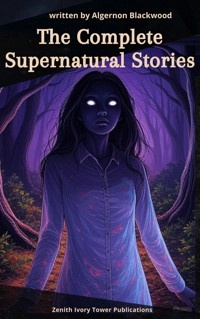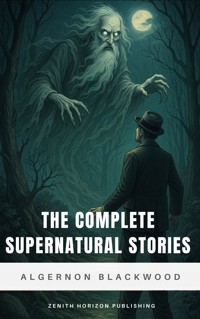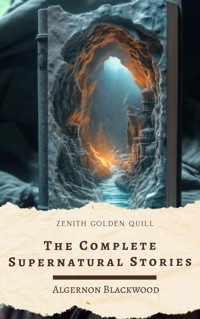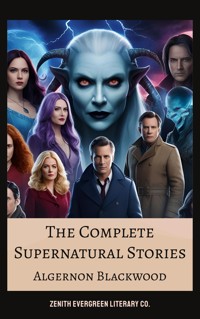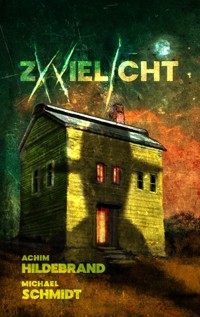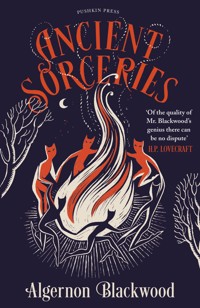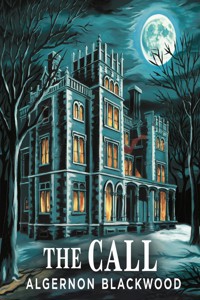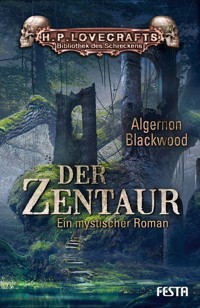
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: H. P. Lovecrafts Bibliothek des Schreckens
- Sprache: Deutsch
Europa Anfang des 20. Jahrhunderts. Auf einer Reise in das geheimnisvolle Bergland der Karpaten sichtet der britische Naturphilosoph O?Malley eine Schar mythischer Geschöpfe. Dies und seine Begegnung mit dem schweigenden Fremden bestätigt ihn in seiner Überzeugung, dass unser Planet ein lebendiges, beseeltes Wesen ist. Unsere Welt ließe sich von der Krankheit des modernen Lebens heilen, so O?Malley, würde die Menschheit zu einem einfachen Leben am Herzen der Mutter Erde zurückkehren. DER ZENTAUR ist ein poetischer Ideenroman und enthält die Kernideen einer Naturphilosphie. Usch Kiausch hat den Roman in eine moderne Sprache übersetzt, die nicht vor Überschwänglichkeiten strotzt, die aber dennoch möglichst werkgetreu ist. H. P. Lovecraft: 'Über den Rang von Algernon Blackwoods Genie lässt sich nicht streiten [?]. Wahrscheinlich zu subtil für eine Klassifizierung als Horrorgeschichten, möglicherweise jedoch in einem absoluten Sinn künstlerisch reifer, sind so feingesponnene Fantasien wie JIMBO oder THE CENTAUR. In diesen Romanen gelingt es Blackwood, sich dicht und fassbar der innersten Substanz der Träume zu nähern und dabei weite Strecken der konventionellen Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fantasie einzureißen.'
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Aus dem Englischen von Usch Kiausch
Impressum
Die englische Originalausgabe The Centaur erschien 1911 im Verlag Macmillan.
Copyright © 1911 by Algernon Blackwood
1. Auflage September 2014
Copyright © dieser Ausgabe 2014 by Festa Verlag, Leipzig
Alle Rechte vorbehalten
eBook 978-3-86552-342-6
www.Festa-Verlag.de
1
»Wir mögen uns im Universum vielleicht in einer ähnlichen Lage befinden wie die Hunde und Katzen in unseren Bibliotheken, wo sie unsere Bücher sehen und unsere Unterhaltung hören, ohne die geringste Ahnung davon zu haben, was das alles bedeutet.«
James William, Das pluralistische Universum
»Was am meisten über einen Menschen aussagt, sind seine Visionen. Wen interessieren schon Carlyles, Schopenhauers oder Spencers logische Überlegungen? Eine Philosophie drückt das Innerste eines Menschen aus, und alle Definitionen des Universums stellen nichts anderes dar als die willkürlichen Annahmen von Menschen, die je nach Wesensart darauf reagieren.«
Ebenda
»Es gibt gewisse Menschen, die – unabhängig von Geschlecht oder Liebenswürdigkeit – sofort persönliche Neugier in uns wecken. Diese Gruppe ist klein, aber ihre Mitglieder sind deutlich auszumachen. Sie müssen nicht unbedingt Vermögen oder gutes Aussehen besitzen, auch nicht jene Gabe weiser Voraussicht, die dumme Leute als pures Glück bezeichnen. Aber sie haben etwas Anspornendes an sich, das verrät, dass sie das Schicksal in die eigene Hand genommen, dessen ungestümen Hals in ein Geschirr gespannt und Zaumzeug und Zügel fest im Griff haben.
Wenn wir in ihrer Gegenwart einen Augenblick innehalten, um zu begreifen, was sie eigentlich vor anderen auszeichnet, ist den meisten von uns bewusst, dass uns nicht nur die Neugier dazu treibt, sondern auch der Neid. Denn sie haben sich genau das Wissen angeeignet, um das wir anderen uns ständig vergeblich bemühen. Auch wenn uns das sozusagen nur beiläufig auffällt, kommen wir damit der Wahrheit ziemlich nahe. Denn alle diese Menschen haben miteinander gemein, dass sie etwas gefunden und in Besitz genommen haben, das nur ihnen eigen ist. Man sieht es ihren Gesichtern und Augen an. Auf uns unbekannte Weise haben sie das entscheidende ›Teilchen‹ entdeckt, das ihnen das ganze verblüffende Puzzlespiel erspart. Sie wissen, wo sie hingehören, und deshalb auch, worauf sie zusteuern. Mehr noch: Sie befinden sich bereits auf dem Weg dorthin und entgehen dadurch der Beschränktheit des Daseins, die den meisten Menschen zu schaffen macht.
Schon aus diesem Grund«, fuhr O’Malley fort, »sind mir die Begegnungen mit jenem Mann unvergesslich. ›Schon aus diesem Grund‹ sage ich, weil es von Anfang an einen weiteren Grund gab. Wahrscheinlich fiel mir bei seinem Anblick als Erstes auf, wie ungewöhnlich kräftig, genauer gesagt, wie massig alles an ihm wirkte – Kopf, Gesicht, Augen, Schultern, ja, besonders der Rücken und die Schultern. Als ich diesen riesigen herumschlendernden Mann in Marseille auf dem Deck meines Dampfers entdeckte, erregte er meine Aufmerksamkeit, noch ehe er sich zu mir umdrehte und der Ausdruck auf seinem imposanten Gesicht nicht nur weitere Neugier, sondern auch Interesse und Neid in mir weckte. Dieser Ausdruck verriet die Selbstsicherheit, die sich aus Wissen speist, doch auch einen Anflug von Verblüffung, als hätte er dieses Wissen erst vor kurzer Zeit erworben. Allerdings war es kein Zeichen von Verwirrung, eher das leichte Staunen eines erfreuten Kindes – ein fast animalisches Staunen –, das aus den großen braunen Augen sprach ...«
»Willst du damit sagen, dass dir zunächst die körperliche Eigenart auffiel und die psychische erst danach?«, fragte ich, damit er beim Thema blieb, denn die Fantasie trug diesen Iren gern davon, sodass er zu plötzlichen Abschweifungen neigte.
Er bemerkte den Wink und lachte gutmütig. »Ja, ich glaube, so war es«, erwiderte er und wurde sofort wieder ernst. »Zunächst war es wohl der Eindruck ungewöhnlicher Massigkeit, der meinen Spürsinn, Gott weiß, warum, weckte, alles andere kam erst später. Anders als bei vielen stämmigen Menschen verbarg der Körperumfang nichts, sondern offenbarte eher etwas. Seinerzeit konnte ich natürlich keine Verbindung zwischen seinem Äußeren und dem Inneren erkennen. Ich spürte bei diesem Mann nur eine überwältigende Anziehungskraft und wollte mich unbedingt mit ihm anfreunden. So geht es mir ja recht oft, weißt du«, fügte er hinzu und warf das in die Stirn gefallene Haar entnervt zurück. »Ich gebe viel auf erste Eindrücke. Ich kann nur sagen, dass ich von dem Mann wie besessen war, alter Freund.«
»Das glaube ich dir aufs Wort«, gab ich zurück. Denn Terence O’Malley hatte sein Leben lang nie halbe Sachen gemacht.
2
»Der freundliche wallende Wilde, wer ist er? Harrt er der Zivilisation oder hat er sie hinter sich und beherrscht sie?«
Walt Whitman, Grasblätter
»Wir, die Menschen von heute, leben in einem eigentümlichen Gesellschaftszustand, den wir den der Zivilisation oder auch Kulturzustand nennen, der aber selbst den größten Optimisten unter uns nicht als ein durchweg wünschenswerter Zustand erscheint. Es gibt sogar Leute, die zu glauben geneigt sind, dass er ein Krankheitszustand sei, den die verschiedenen Menschenrassen durchzumachen haben (...) Die Geschichte erzählt uns wohl von vielen Nationen, die von dieser Krankheit ergriffen wurden, von vielen, die ihr erlegen sind, von einigen, die noch an ihr leiden; aber wir kennen noch keinen einzigen Fall, in dem eine Nation sich von ihr wieder erholt und durch sie hindurchgegangen und zu einem normalen und gesunden Zustand gelangt wäre. Mit anderen Worten: Die menschliche Gesellschaft ist unseres Wissens, sobald sie in ihrem Entwicklungsprozess in das Stadium der Zivilisation getreten ist, noch nie über eine bestimmte und, wie es scheint, endgültige Stufe hinausgekommen. In allen Fällen, die wir bisher beobachten konnten, ist das Volk, das auf dieser Stufe angelangt war, entweder der Krankheit erlegen oder in einer Art Stillstand verblieben.«
Edward Carpenter, Die Zivilisation
O’Malley hatte seinerseits Eigenarten, die gewöhnliche Menschen geradezu herausforderten, sich mit seiner Person zu befassen. Bei ihm hatte sich irisches und schottisches Blut mit englischem gemischt, wobei der irische Anteil vorherrschte und das keltische Erbe stark ausgeprägt war. Er war ein Mann von robuster Gesundheit, dem an persönlicher Bereicherung nichts lag, ein Mensch, den es hierhin und dorthin zog und der freiwillig das Leben eines Außenseiters führte. Bis zu seinem Tod lebte er wie ein Wandervogel, stets von der Hand in den Mund, und wurde nie richtig erwachsen. Offenbar war ihm das »Erwachsenwerden« im üblichen Sinne auch gar nicht möglich, denn sein Leitspruch war das Gegenteil von nil admirari (sich über nichts wundern). Die Phase, in der man fortwährend über geheimnisvolle Dinge staunt, hatte er nie hinter sich gelassen. Ständig versuchte er, das gewaltige Horoskop des Lebens zu enträtseln, gelangte aber nie weiter als bis zum Palast der Wunder, auf dessen Schwelle er zweifellos das Licht der Welt erblickt hatte. Gern sagte er, die Zivilisation habe die Menschen geblendet und ihre Augen mit Staub anstelle von Visionen gefüllt.
Zwar war er ein glühender Anhänger des Lebens in freier Natur, doch hin und wieder richtete sich sein stark ausgeprägter Forschungsdrang auch auf spirituelle Dinge, und dann ließ er die Außenwelt wie Unrat hinter sich und schien in einen rauschartigen Zustand zu fallen. Das geschah jedoch niemals in Städten oder inmitten seiner sich abrackernden, zusammengepferchten Mitmenschen, sondern nur, wenn er sich außerhalb, an abgeschiedenen Orten aufhielt, wo nur der Wind und die Sterne ihm Gesellschaft leisteten. Dort tauchte er manchmal in ein Stadium der Verzückung und Entrückung ein, erhaschte einen Blick auf die lange Prozession der Götter, deren letzte sich ihm näherten, und ertappte die Ewigkeit in einem Moment der Bewegung.
Denn die Launen der Natur erfassten ihn wie Flammen, brannten sich ihm wie Wesenheiten ein, so stark und plastisch, als wären es menschliche Wesen. Und sie hatten für ihn ebenso unterschiedliche Eigenarten: Der Wald schenkte ihm Liebe und Zärtlichkeit, das Meer mit seiner Magie weckte Ehrfurcht in ihm, die Ebenen und weiten Horizonte vermittelten wie weise, alte Gefährten inneren Frieden und Stille voller Wehmut. Hingegen erschreckte ihn die Schönheit der Berge, weil er sie nicht recht begreifen konnte. Das mochte daran liegen, dass er die Stimmung, die sie ausstrahlten, spirituell nicht nachvollziehen konnte.
Kurzum: Er empfand den Kosmos als beseelt und er offenbarte sich ihm in den Launen der Natur. Nur sie lösten bei ihm diese Phasen des Hochgefühls und des erweiterten Bewusstseins aus. Die Natur stieß die Tore zu seinem tieferen Innenleben weit auf, drang in ihn ein, nahm von ihm Besitz, umfing sein kleineres Ich mit ihrer ungeheuren Wesenheit und ließ es damit verschmelzen.
Was das moderne Leben betraf, so hatte O’Malley reichlich Erfahrung damit gemacht und bewies in dieser Hinsicht gelegentlich sogar ein scharfes Urteilsvermögen. Doch zugleich schäumte unter dieser Oberfläche die ganze Zeit über das unruhige Meer seltsam ungezügelter primitiver Instinkte. Ihm lag eine nicht zu stillende Sehnsucht nach der Wildnis sozusagen im Blut, ein heftiges, unersättliches Verlangen. Allerdings ging es dabei im Grunde um etwas viel Größeres als nur um die ungezähmte Natur. Die Wildnis war ihm nur ein Symbol, ein erster Schritt, der auf eine Fluchtmöglichkeit hinwies. Die Hetze und den Erfindungsreichtum des modernen Lebens empfand er als quälendes Fieber. Er verabscheute die unzähligen Winkelzüge der Zivilisation. Da er aber auch, zumindest ansatzweise, zur Selbstkritik fähig war, ließ er sich nur selten völlig gehen, denn vor seinen ungezügelten primitiveren Instinkten hatte er selbst Angst – Angst davor, von ihnen überwältigt zu werden. Falls er ihnen völlig nachgab, würde, wie ihm klar war, irgendetwas Schreckliches geschehen, das er jedoch nicht näher bestimmen konnte. Eine nicht benennbare Gewalt würde die Grundlagen seines Daseins dann so erschüttern, dass er mit der Welt würde brechen müssen. Die instinktiven Begierden betrachtete er als ein seelisches »Herumwildern«, dem er sich verweigern musste, da sonst die Auflösung, die Spaltung seiner Persönlichkeit drohte – und damit der Verlust der eigenen Identität.
Wenn das innere Aufbegehren so heftig wurde, dass er es kaum noch unterdrücken konnte, zog er sich in die Einöde zurück, um sich wieder in den Griff zu bekommen. Dieser Versuch, die innere Ordnung wiederherzustellen, führte zwar zu vorübergehender Beruhigung, hatte aber nie tief greifende Wirkung. Im Gegenteil: Nach der kurzen Auszeit verstärkten und vervielfältigten sich seine Sehnsüchte sogar noch, und oft rückte deren Befriedigung in gefährliche Nähe. »Eines Tages«, sagten seine Freunde, »wird der Damm brechen.« Diese Prophezeiung konnte man zwar unterschiedlich deuten, aber sie hatten recht, wie auch O’Malley klar war.
Kurz gesagt litt er ständig unter starken Stimmungsschwankungen und tat sich schwerer als die meisten anderen damit, das zugrunde liegende Ich zu erkennen, das diese äußeren Symptome, maskiert als vollständige Persönlichkeitsänderungen, hervorbrachte.
Das zugrunde liegende Ich, das all diese Projektionen in sich vereinte, gehörte zu dem Typus, den Henry Woodd Nevinson auf den ersten Seiten seines genialen Büchleins The Plea of Pan so trefflich charakterisiert hat. Zum Normalbürger taugte O’Malley nicht, und das wusste er auch. Hin und wieder schämte er sich sogar dafür.
Gelegentlich, auch in der Zeit dieses besonders »denkwürdigen Abenteuers«, das er als Dreißigjähriger erlebte, arbeitete er als Auslandskorrespondent. Doch selbst in dieser Funktion war er der Typ von Journalist, der Nachrichten nicht nur sammelt, sondern sie auch ausgräbt, enthüllt und produziert. Seine Auftraggeber, ältere Redakteure, waren so klug, sich ihre Profession ins Gedächtnis zu rufen, wenn sein Manuskript eintraf. In jener Zeit hatte man O’Malley mit Recherchen über die im Kaukasus lebenden Gebirgsstämme beauftragt. Einen besseren Mann hätte man dafür kaum finden können, denn er hatte ein Auge für Schönheit und die menschliche Natur, ein Gespür für alles Lebendige und Malerische und darüber hinaus die Fähigkeit, seine stark ausgeprägten Emotionen unmittelbar in knappe, treffende Formulierungen umzusetzen.
Als ich ihn kennenlernte, hatte er keinen festen Wohnsitz, da er ständig unterwegs war. Allerdings hatte er in der Nähe von Paddington nach wie vor ein schäbiges kleines Zimmer behalten, in dem sich Bücher und Papiere stapelten – von Staubschichten überzogen, aber zumindest sicher untergebracht. Als O’Malleys Tod mich zum Nachlassverwalter seiner Habseligkeiten machte, stieß ich dort auch auf die Manuskripte, in denen er seine Abenteuer festgehalten hatte. Der Schlüssel zu diesem Zimmer, sorgfältig mit einem beschrifteten Anhänger versehen, steckte in seiner Hosentasche. Und dieses einzige Anzeichen praktischer Vorsorge, das ich je bei ihm bemerkt habe, bewies, dass sich irgendetwas in diesem Zimmer befinden musste, das er als wertvoll – wertvoll für andere – betrachtete. Gewiss waren es nicht die bunt zusammengewürfelten Bücher aus zweiter Hand, auch nicht die unzähligen unbeschrifteten Fotografien und Zeichnungen. Deshalb fragte ich mich sofort, ob das, was O’Malley für so wertvoll gehalten hatte, seine handschriftlichen Manuskripte von Geschichten und Episoden und seine Notizen sein konnten. Ich fand sie, beinahe ordentlich aufgestapelt und mit Titeln versehen, in einem schmutzigen Seesack aus grünem Segeltuch.
Manches davon hatte er mir erzählt (anschaulicher, als er es zu Papier gebracht hatte), anderes war mir neu, vieles unvollendet. Doch sämtliche Manuskripte waren, gelinde gesagt, ungewöhnlich. Und alles, was darin festgehalten war, hatte er offensichtlich irgendwann während seiner Arbeit als freier Journalist und Auslandskorrespondent persönlich erlebt, auch wenn er hier und da E. T. A. Hoffmanns Kunstgriff gefolgt war, die Handlung aus der Perspektive eines Alter Ego zu schildern, um die eigene Rolle dabei zu verschleiern. Die Geschichten, die er mir mündlich übermittelt hatte, entsprachen meinem Gefühl nach der Wahrheit, zumindest seiner Wahrheit. Sie waren keinesfalls bloß erfunden, sondern in visionären Momenten entstanden, denen wirkliche Ereignisse zugrunde lagen.
Zehn Menschen werden in ebenso vielen Versionen beschreiben, wie eine Schlange ihren Weg kreuzte. Aber außer diesen zehn Menschen existiert oft noch ein elfter, der mehr sieht als die Schlange, den Weg und die Bewegung. Ein solcher elfter Mensch war O’Malley. Er sah die Dinge als Ganzes, verfügte über eine innere »Vogelperspektive«, während die anderen zehn nur bestimmte Aspekte aus unterschiedlichen Perspektiven erfassten. Häufig beschuldigte man ihn deshalb, Geschichten mit frei erfundenen Einzelheiten auszuschmücken; in Wirklichkeit hatte er diese Einzelheiten gespürt, ehe sie überhaupt in Erscheinung getreten waren. Als es so weit war, hatten die anderen den Schauplatz bereits verlassen.
Damit will ich sagen: In alltäglichen Ereignissen sah er im Unterschied zu seinen Mitmenschen größere Strömungen am Werk. Bei den kleinsten Veränderungen von Zeit und Raum – sei es, dass eine Minute verstrichen, sei es, dass eine Meile zurückgelegt worden war – erfasste er sofort das Gesamtbild. Während die anderen zehn sich wortreich über den Namen der Schlange ausließen, fesselten ihn die Schönheit des Weges, das geschmeidige Gleiten des Reptils, die Eigenarten der Naturkräfte, die alles vorantrieben, hemmten oder veränderten.
Während die anderen überlegten, wohin die Schlange unterwegs war, und deren Länge in Zentimetern und ihre Geschwindigkeit in Sekunden berechneten, achtete er nicht auf solche oberflächlichen Details, sondern ließ sich sozusagen auf den existenziellen Kern dieser Kreatur ein. Diese Besonderheit, die ihm wie allen Menschen mit mystischen Neigungen zu eigen war, drückte sich bei ihm auch in einer gewissen, seltsamen Verachtung der Ratio aus. Bloßes Geistesvermögen, auf das die moderne Welt so viel Wert legt, empfand er als saft- und kraftlos, als bloßen Kult um die äußere Form. Denn dieses Geistesvermögen war seiner Ansicht nach nicht in der Lage, die wesentliche, innere Wahrheit zu erfassen, die sich nur im eigenen Dasein und im eigenen Gefühl offenbart. Kurz gesagt hielt er die intellektuelle Herangehensweise für die des Kritikers, aber nicht für die eines kreativen Menschen. Und einen Mangel an Fantasie betrachtete er als schlimmste Form der Dummheit.
»Diese nüchternen, unfruchtbaren Geister!«, rief er zuweilen aus, wenn sein keltisches Temperament wieder einmal mit ihm durchging. »Wo, frage ich dich, haben die Philosophien und Wissenschaften dieser Welt je auch nur eine einzige Seele einen Zentimeter weitergebracht und glücklicher gemacht?«
Jeder armselige Träumer in seiner Dachmansarde, der bei trübem Licht sein Netz der Schönheit spann, galt ihm mehr als die schärfste kritische Intelligenz, die jemals existiert hatte. Denn dieser Träumer in der Dachkammer, meinte er, versuche zumindest etwas auszudrücken, das Gott ihm zugeflüstert habe, mochten seine Worte, Bilder oder Töne noch so unzulänglich sein. Der Kritiker hingegen zerstöre lediglich menschlichen Gehirnen entsprungene Gedankengebäude.
Diese Geisteshaltung O’Malleys muss ich an dieser Stelle erwähnen, weil sie Licht auf die folgenden Ereignisse wirft. In gewisser Weise – das Wie und Warum ist schwer zu erklären – hielt er Ratio und Intellekt, in der modernen Gesellschaft so hochgehalten, für maßlos überschätzt. Das menschliche Bewusstsein befasste sich seiner Ansicht nach viel zu eingehend damit, wies beidem in der »Ökonomie der Seele« einen viel zu wichtigen Platz zu. Sie zu vergöttern, sagte er, bedeute, hohle und unzulängliche Götzen zu schaffen. Die Vernunft müsse über die Weiterentwicklung der Seele wachen, dürfe jedoch niemals das Ziel dieser Weiterentwicklung sein. Ihre Aufgabe sei lediglich die eines Schmirgelpapiers, das Auswüchse abschleift. Wenn man die Vernunft vergötterte, messe man einem einzelnen Element unangemessene Bedeutung bei.
Nicht dass er ein solcher Narr gewesen wäre, die Vernunft völlig von ihrem Sockel zu stoßen, er wollte ihr lediglich einen »angemessenen Platz« zuweisen. Und er hielt sich für »weise« genug – bewusst benutzte er nicht das Wort »klug« – zu beurteilen, wie wenig sie in seelischen Dingen nützte. Seiner Ansicht nach gab es ein tiefer greifendes Verständnis des Lebens und der Welt, als die Vernunft es je vermitteln würde. Offenbar meinte er damit ein inneres, naturgegebenes Verständnis.
»Der größte Lehrer, den wir je hatten«, hörte ich ihn einmal sagen, »gab nichts auf den Verstand. Und wer, sag mir, kann durch eigenes Forschen Gott auf die Schliche kommen? Doch was sonst würde das Erforschen lohnen ...? Heißt es nicht wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen? Ein Kind erspürt Dinge und erschließt sie sich niemals durch logisches Denken. Wie werden die Geistesriesen vor dem großen weißen Thron dastehen, wenn ein einfacher Mensch mit dem Herz eines Kindes sie alle überflügelt?«
Ein anderes Mal kam er auf die Natur zu sprechen. »Ich bin davon überzeugt«, erklärte er, obwohl sein nachdenklicher Blick verriet, dass er sich in dieser Frage selbst noch vortastete, »dass die Natur unsere nächste Stufe sein wird. Die Vernunft hat jahrhundertelang ihr Bestes geleistet, bringt uns jetzt aber nicht mehr voran. Das kann sie auch gar nicht, denn sie kann nichts für das innere Leben tun, das doch die einzige Art von Wirklichkeit ist. Wir müssen zur Natur und zu einer von allem Äußerlichen gereinigten Intuition zurückkehren, müssen uns stärker auf das verlassen, was jetzt noch unbewusst ist. Müssen uns wieder auf die wohlwollende, würdevolle Lenkung durch das Universum besinnen, welche die Menschheit nach Überwindung ihres primitiven Stadiums als gleichfalls überwunden abgetan hat. Genauer gesagt: auf eine spirituelle Intelligenz besinnen, die sich deutlich von bloßer Verstandeskraft unterscheidet.«
Mit der Rückkehr zur Natur meinte er nicht die Rückkehr in die Barbarei. Mit seinen ungestümen Worten plädierte er nicht für eine Rückkehr in die Vergangenheit, sondern blickte eher nach vorn, so schwer das zu verstehen sein mag. Er stellte sich ein Stadium vor, in dem die Menschheit, ausgerüstet mit den besten Ergebnissen rationalen Denkens, das instinktive Leben wieder aufnehmen konnte – ein Leben, das vom Fühlen mit der Schöpfung bestimmt sein würde.
Die moderne, übertrieben vergeistigte Persönlichkeit würde dann ihren angemessenen Platz weiter unten in der Hierarchie einnehmen, in der Rolle des Ratgebers anstelle des Anführers. Er nannte es »Rückkehr zur Natur«, doch ich hatte stets den Eindruck, dass er damit etwas anderes meinte: die Wiederentdeckung, dass die Menschheit Teil des Universums ist, das Gespür für unsere Verwandtschaft mit dem Kosmos, das den Menschen durch Anbetung des bloßen Intellekts abhandengekommen war. Heutzutage brüsteten sich die Menschen als vereinzelte, von der Natur abgetrennte Wesen mit ihrer Überlegenheit über die Natur. Im Gegensatz dazu setzte O’Malley auf die Entwicklung, vielleicht sogar Wiederbelebung, irgendeines makellosen Instinktes, der sich aus der Verwandtschaft von Mensch und Natur speiste. Auf die Spitze getrieben, bedeutete es, dass dieser Instinkt alle Lebewesen leiten würde, das Tier wie den spirituellen Menschen, die Wildbiene wie die Brieftaube. Und letztendlich auch die Gott suchende Seele.
Diese Leitlinie, wie er es nannte, kristallisierte die Ergebnisse seiner mentalen Kämpfe so deutlich und schlüssig heraus, dass er der eigenen geistigen Entwicklung gleichsam Einhalt geboten hatte.
Deshalb interessierte ihn bei der Begegnung mit der Schlange am wenigsten deren Bezeichnung oder Familienzugehörigkeit. Ihm ging es vielmehr darum – was seltsam, aber in seinem Denken nur folgerichtig war –, die seelischen Verknüpfungen zu erfassen, welche die Schlange, die Natur und ihn selbst mit der ganzen Schöpfung verbanden. Ganze Truppen abenteuerlicher Gedanken hatte er sein Leben lang ins Gefecht geschickt, um dieses Land spekulativer Träume in Besitz zu nehmen. Seiner Vorstellung getreu, »dachte« er mit seinen Emotionen genauso wie mit seinem Gehirn. In der fragmentarischen Aufzeichnung des Abenteuers, die dieses Buch vermittelt, ist diese seltsame, in ihm wütende Leidenschaft von Anfang bis Ende der entscheidende Schlüssel. Denn alles, was ihm zustieß, geschah zugleich in seinem Innern. Es gelang ihm, die Erde in sein Dasein miteinzubeziehen, indem er mit ihr fühlte. Hingegen konnte er mit seinem Verstand dergleichen nur kritisieren und setzte es so zwangsläufig herab.
Häufig entschuldigte er sich auf die eine oder andere Weise für diese Herangehensweise, wenn er wieder einmal bis an die Grenzen jeglicher Glaubwürdigkeit vorgestoßen war. Im Gespräch trug er seine Thesen so brillant vor, dass sie überzeugend wirkten, doch als ich später dieselbe Geschichte schwarz auf weiß festgehalten sah, ließ diese Wirkung deutlich nach. Tatsächlich vermochte es keine Schriftsprache, diese außergewöhnliche Fracht zu transportieren, die er durch die instinktive Wahl gewisser Gesten, Blicke und Stimmmodulationen so mühelos übermitteln konnte. Bei ihm klang alles völlig einleuchtend.
O’Malley war noch nicht einmal 30 gewesen, als er einen Band, vielleicht auch zwei, mit seltsamen Erzählungen verfasst und veröffentlicht hatte. Alle handelten von Erweiterungen der Persönlichkeit – ein Thema, das ihn sehr interessierte und mit dem er sich auskannte, denn er bezog seinen Stoff vor allem aus eigenem Erleben. Alles, was mit Psychologie zu tun hatte, mochte es noch so fantastisch und spekulativ sein, verschlang er geradezu. Seine Visionen mochten zwar sehr viel großartiger sein als seine Formulierungskünste, dennoch besaßen diese seltsamen Bücher einen gewissen Wert und trugen auf originäre Weise zu den psychologischen Theorien bei. In England fielen sie selbstverständlich durch, aber die deutsche Übersetzung brachte O’Malley eine breitere und intelligentere Leserschaft ein. Die üblichen Leser waren mit Fällen wie denen von Sally Beauchamp, Hélène Smith oder Doktor Hanna nicht vertraut, deshalb empfand sie seine Studien über gespaltene Persönlichkeiten und einzigartige Erweiterungen des Bewusstseins lediglich als überspannte Ausgeburten zügelloser Fantasie. Aber es gab tatsächlich einen wahren Kern, auf den sich O’Malley in seinen Darlegungen stützen konnte: die persönliche Erfahrung. Hier und da hatten ihm die Bücher auch wertvolle Bekanntschaften eingebracht, darunter die mit dem deutschen Arzt Heinrich Stahl. Mit Dr. Stahl kreuzte er in einem unregelmäßigen Briefwechsel monatelang die Klingen, bis die beiden Herren sich schließlich an Bord eines Dampfers trafen, auf dem der Deutsche als Schiffsarzt arbeitete. Die Bekanntschaft entwickelte sich zu einer fast freundschaftlichen Beziehung, obwohl die beiden Männer in ihren Theorien scheinbar völlig gegensätzliche Positionen einnahmen. Gelegentlich trafen sie sich immer noch.
O’Malleys äußere Erscheinung hatte nichts Ungewöhnliches an sich, mal abgesehen von dem Kontrast zwischen den hellblauen Augen und dem dunklen Haar. Ich glaube, ich habe ihn nie etwas anderes tragen sehen als den alten grauen Flanellanzug mit dem tiefen Revers und die abgewetzte, speckig glänzende Krawatte. Er war mittelgroß und so feingliedrig, dass seine Hände eher wie die eines Mädchens als die eines Mannes aussahen. Wenn er sich in Städten aufhielt, rasierte er sich und sah einigermaßen salonfähig aus, doch auf Reisen ließ er sich Schnauzbart und Vollbart wachsen und vergaß über Wochen, sich die Haare schneiden zu lassen, sodass sie ihm wirr in die Stirn und die Augen fielen.
Sein Verhalten hing von seinen abrupt wechselnden Stimmungen ab. Manchmal war er umtriebig und geistig hellwach, zu anderen Zeiten tagelang geistesabwesend, versonnen und so mit sich selbst beschäftigt, dass er die Außenwelt kaum wahrnahm. In solchen Zeiten bestimmte eher ein unbewusster Instinkt als die eigene Willenskraft sein Verhalten und seine Handlungen. Ein Grund für seine geistige Einsamkeit – die ihm das Leben zweifellos sehr schwer machte und ihn mehr als alles andere quälte – lag darin, dass Durchschnittsmenschen nicht wussten, wie sie ihn nehmen sollten, nicht sicher waren, welche seiner extremen Stimmungen den Mann eigentlich ausmachte. Sie schätzten ihn als unbequem, unzulänglich, schwer fassbar und alles andere als verlässlich ein und hatten damit aus ihrer Sicht auch sicher recht. Die O’Malley eigene Unausgeglichenheit führte dazu, dass seine Mitmenschen ihm die Anteilnahme und vor allem die Gemeinschaft, die er gebraucht hätte und nach der er sich wirklich sehnte, schlicht verweigerten. Mit Frauen verkehrte er kaum; in gewisser Hinsicht war ihm das Bedürfnis nach weiblicher Gesellschaft sogar fremd. Zum einen mochte das daran liegen, dass bei ihm selbst das weibliche Element besonders stark ausgeprägt war. Deshalb war er sich, anders als die meisten Männer, der Unvollständigkeit des eigenen Daseins, der großen Lücke darin gar nicht bewusst, die Frauen so vorzüglich füllen können. Zum anderen führte diese Ignoranz – vielleicht zwangsläufig – dazu, dass die Frauen ihn überforderten, wenn sie tatsächlich einmal in sein Leben traten. Sie gaben ihm mehr, als er verkraften konnte, boten ihm mehr an, als er brauchte.
Vermutlich hat er sich nie im herkömmlichen Sinne »verliebt«, kannte jedoch sicher das Gefühl völliger Hingabe, einer Hingabe, bei der man sich ganz und gar in einem anderen Menschen verliert. Kannte die überschwängliche Liebe, die nicht nach Erfüllung durch Besitz des anderen strebt, da sie selbst nichts anderes als Besessenheit ist. Außerdem war O’Malley auch ein innerlich reiner Mensch, schon deshalb, weil es ihm nie in den Sinn gekommen war, sich anders zu verhalten.
Soweit ich seine komplexe Persönlichkeit überhaupt beurteilen kann, war er vor allem deshalb so einsam, weil er niemals ein mitfühlendes und wirklich verständnisvolles Ohr fand, dem er die tiefen primitiven Sehnsüchte, die ihm so sehr zu schaffen machten, hätte anvertrauen können. Diese Abkapselung von anderen Menschen machte ihm oft selbst Angst; sie bewies, dass der Rest der Welt, zumindest die geistig »normale« Mehrheit, solche Sehnsüchte wie die seinen strikt ablehnte. Selbst ich, der ich O’Malley liebte und ihm zuhörte, begriff nie ganz, worauf er eigentlich hinauswollte. Jedenfalls war das, was er spürte, weit mehr als der gewöhnliche »Ruf der Wildnis«. Eigentlich sehnte er sich gar nicht nach einer barbarischen, unzivilisierten Welt, sondern eher nach einer völlig von der Natur bestimmten, in der man die Zivilisation nie gekannt, vielleicht auch niemals benötigt hatte – nach einem Zustand der Freiheit in einem unbefleckten Leben.
Meinem Eindruck nach verstand er nie ganz, wieso er sich in so unversöhnlichem Widerspruch zur modernen Gesellschaft befand und warum Menschen sein Inneres so abtöteten, dass er sich, um wirkliches Leben zu finden, lieber der Natur zuwandte. Die Angelegenheiten, mit denen sich die Völker der Welt so ausschließlich befassten und belasteten, hielt er für offensichtlich selbstgefällig und nutzlos. Zwar hatte er sich selbst bei den größten Höhenflügen nie als einen Heiligen empfunden, aber es verwirrte und verblüffte ihn zutiefst, dass die modernen Nationen die Bezwingung der Natur in all ihrer Vielfalt anscheinend für so viel wichtiger hielten als die Selbstbezwingung. Was die Welt gemeinhin »Wirklichkeit« nannte, betrachtete er als die geschmackloseste, oberflächlichste, flüchtigste, krasseste Un-Wirklichkeit. Seine Naturliebe speiste sich aus mehr als der bloßen Freude an ungestümen heidnischen Instinkten. Für ihn, der sich nach einem einfachen Leben sehnte, bedeutete sie den ersten Schritt zur Wiederherstellung eines edlen, würdigen, von Sklaverei befreiten Daseins. Indem man sich allem äußeren »Humbug«, den er so verabscheute, verweigerte, würde man die Seele von allen Fesseln befreien und sich so der spirituellen Entwicklung widmen können. Seiner Meinung nach erstickte, unterdrückte, zerstörte die moderne Zivilisation die Seele. Aber da O’Malley sich hoffnungslos in der Minderheit sah, hatte er das Gefühl, sich an irgendeinem Punkt geirrt, getäuscht zu haben. Denn offenbar waren sich ja alle Menschen, vom Politiker bis zum Lokführer, darin einig, dass die Anhäufung äußerer Güter nützlich war und der materielle Gewinn reale Bedeutung hatte ... Er selbst dagegen fand völlige Geborgenheit bei der Erde. Die weise, wunderbare Erde öffnete ihm ihre Seele und ihr großes Herz auf eine Weise, die anscheinend nur wenigen anderen Menschen zuteilwurde. Durch die Natur konnte er sich mit verbundenen Augen bewegen und dort trotzdem den Weg zu Kraft und Mitgefühl finden. Dann erwachte ein großmütiges, barmherziges Leben in ihm, das die kleinliche Welt der Menschen ihm verweigerte. Häufig verglich er die Unterstützung oder Kollegialität, die ihm der normale gesellschaftliche Verkehr und die scheinbar so erfolgreichen Zusammenkünfte mit seinesgleichen boten, mit der inneren Kraft, die ihm Ausflüge in die Wälder oder Berge verliehen. Die Wirkung solcher Treffen, sagte er, verpuffe meistens an einem einzigen Tag, hingegen halte die Wirkung der Natur an und verstärke sich sogar noch im Laufe von Wochen und Monaten.
Das mochte stimmen oder auch ein Verkennen der eigenen Stimmungslage sein – jedenfalls litt er lebenslang unter dem Gefühl freudloser Einsamkeit und wandte sich immer mehr von den Menschen ab und der Natur zu.
Noch etwas anderes fiel mir hin und wieder an ihm auf, so albern es auch klingen mag: Tief in seinem Inneren verbarg sich irgendeine namenlose, undefinierbare Eigenart, die nahelegte, dass er besser in ein Leben gepasst hätte, in dem man die Zwänge der Konvention nie gekannt hatte – was etwas völlig anderes ist, als solche Konventionen bewusst zu missachten. Jedenfalls begegnete er der Welt mit kindlicher Unschuld, mit einer kaum vorstellbaren, überaus gewinnenden Naivität, die sich mittelbar darin zeigte, wie sehr ihn die modernen Verhältnisse belasteten. Das Gewicht, das der Zeitgeist der Technik beimaß, drückte ihn nieder; die Schnelllebigkeit, den Luxus und die Künstlichkeit des modernen Lebens empfand er als entsetzliche Schikane. Die Abscheu vor Städten lag ihm im Blut.
Ich beschreibe ihn hier als einen von der Gesellschaft Ausgestoßenen, aber später wird deutlich werden, dass er sowohl freiwillig als auch unfreiwillig zu einem solchen geworden war.
»Die Welt hat durch Intellektuelle weit mehr verloren als gewonnen ...«
»Du träumst wohl, mein Lieber«, unterbrach ich ihn, allerdings voller Sympathie, da mir klar war, dass ihn solche Gedanken wie dieser trösteten. »Deine schöpferische Fantasie geht mal wieder mit dir durch.«
»Allerdings«, erwiderte er freundlich, »aber irgendwo gibt es einen Ort oder einen Seelenzustand – was dasselbe ist –, wo das mehr ist als ein Traum. Überdies werde ich dort irgendwann hingelangen, du alter Miesmacher.«
»Auf keinen Fall in England«, wandte ich ein.
Einen Augenblick lang starrte er mich völlig traumverloren an. Gleich darauf schnaubte er verächtlich, was typisch für ihn war, und gestikulierte so, als wollte er die Gegenwart noch weiter von sich wegschieben.
»Mir hat stets die östliche Anschauung zugesagt – falls sie nicht aus dem Osten stammt, ist sie zumindest alt –, dass tiefe Sehnsüchte dazu führen, einen Ort zu schaffen, wo sie sich erfüllen ...«
»Subjektiv gesehen ...«
»Selbstverständlich. Objektiv gesehen natürlich nicht vollständig. Ich meine damit ein Paradies, das man sich sein Leben lang durch die eigene Sehnsucht und heftiges Verlangen schafft. Das man sich erdenkt. Es ist nichts anderes als die in einem selbst lebende Vorstellung!«
»Auch das ist nur ein Traum, Terence O’Malley.« Ich lachte. »Allerdings ein schöner, verführerischer Traum.«
Sich mit mir herumzustreiten langweilte ihn. Lieber brachte er eine bestimmte Sache vor, schmückte sie mit Einzelheiten aus, hauchte ihr Lebensatem ein und beließ es dabei. Seiner Ansicht nach setzten Auseinandersetzungen solche Dinge nur herab, ohne etwas zu klären; Kritik empfand er als destruktiv, sie verstopfe nur die Lebensquellen, meinte er. Jeder Schwachkopf könne herumkritteln. Die skeptischen Kleingeister seien stets Kritiker – und umgekehrt.
»Ja, ein Traum, aber ein verdammt guter, lass dir das gesagt sein«, rief er laut und fiel in seiner Begeisterung mal wieder in seinen irischen Dialekt. Einen Moment lang funkelte er mich wütend an, dann lachte er schallend. »Besser man hat geträumt und ist erwacht, als niemals geträumt zu haben.«
Und dann rezitierte er O’Shaughnessys leidenschaftliche Ode an die Träumer dieser Welt:
Wir sind die Musikanten,
wir sind die Träumer der Träume,
streifen an einsamen Meeresbrandungen
und sitzen an öden Flüssen;
Weltverlierer und Weltverlassende,
auf die der fahle Mond glänzt:
Doch wir sind die ewigen Urheber und Beweger
der Welt, so scheint’s.
Mit wunderbaren, unsterblichen Liedern
erbauen wir die größten Städte der Welt,
und aus einer legendären Geschichte
formen wir eines Reiches Ruhm:
ein Mann mit einem Traum wird, nach Belieben,
vorangehen und eine Krone erobern;
und drei mit dem Takt eines neuen Liedes
können ein Reich niedertreten.
Wir, die in den Zeitaltern ruhen,
in der vergrabenen Vergangenheit der Erde,
bauten Ninive mit unseren Seufzern
und Babel selbst mit unserer Heiterkeit
und stürzten sie, indem wir der alten Welt
die Werte der neuen verkündeten;
denn jede Zeit ist ein Traum, der eben stirbt,
oder einer, der gerade geboren wird.
Denn diese Vorliebe für die schlichte Unschuld und Schönheit einer vergangenen Welt erfüllte O’Malley wie erotische Lust – nie versiegend und unersättlich.
3
»Warum sollte ich mich einsam fühlen? Ist unser Planet nicht in der Milchstraße?«
Henry David Thoreau, Walden oder Leben in den Wäldern
Der März war mit viel Getöse vergangen und der April brachte uns mit seinen duftenden Regenschauern einen köstlichen Frühlingshauch, als O’Malley in Marseille an Bord eines Küstendampfers ging, der Kurs auf die Levante und das Schwarze Meer nehmen würde. Der Mistral machte den Aufenthalt auf dem Festland unerträglich, aber rings um die Bucht galoppierten Schimmelherden unter einem Himmel, der so blau wie in der Kindheit leuchtete.
Das Schiff legte pünktlich ab – wie üblich war O’Malley erst in letzter Minute eingetroffen. Als er das überfüllte Oberdeck kurz musterte, fielen ihm der Mann und der Junge offenbar sofort auf. Anfangs wunderte er sich leicht darüber, dass sie etwas ungewöhnlich Unförmiges an sich hatten, als Nächstes darüber, dass er diesen Eindruck an keinen Einzelheiten festmachen konnte. Sie wirkten sehr viel stämmiger, als sie in Wirklichkeit waren. Fast hätte er gelacht, doch so weit kam es nicht. Denn dieser Anschein von Masse und Unförmigkeit, von gut ausgeprägten, doch fast höckerigen Schultern bestätigte sich bei genauer Betrachtung nicht. Es war nur ein subjektiver Eindruck. Der Mann war zwar robust und gut proportioniert gebaut, hatte einen wuchtigen Rücken und Nacken und einen ungewöhnlich kräftigen Rumpf, wirkte aber in keiner Hinsicht monströs. Aus dem Augenwinkel heraus betrachtet empfand man ihn als stämmigen Riesen, doch das war eine Falschmeldung des Gehirns, wie sich bei direktem Blick auf ihn herausstellte.
Die Aufmerksamkeit, die O’Malley ihm widmete, verwandelte sich schnell in Respekt. Vergeblich suchte er in der Ausformung des Rückens, des Halses und der Glieder nach etwas, das den merkwürdigen Eindruck des Gigantischen hervorrief. Der Junge an seiner Seite, offensichtlich der Sohn, hatte dieselben, schwer zu fassenden Eigenheiten, die man nur spüren, nicht aber eindeutig erkennen konnte.
Während O’Malley zu seiner Kabine hinunterstieg, fragte er sich beiläufig, welcher Nationalität die beiden sein mochten. Er ging unmittelbar hinter ihnen. Als sich der Vater plötzlich zu ihm umwandte und sich ihre Blicke trafen, fuhr O’Malley so zusammen, dass er unfreiwillig französische und deutsche Urlaubsreisende anrempelte.
»Du meine Güte«, schoss es ihm durch den Kopf, denn aus einem breitflächigen Gesicht, das trotz aller Schroffheit sanft wirkte, leuchteten ihm große, scheue Augen entgegen – Augen wie die eines Tieres oder Kindes, das in einer so großen Menschenmenge die Orientierung verloren hat. Es war nicht so sehr Angst oder Bestürzung, was aus diesen Augen sprach, sondern die vergebliche Suche nach einem Fluchtweg. Es war der Blick eines in die Enge getriebenen Geschöpfes. Zumindest anfangs. Denn unmittelbar darauf entdeckte der aufgeweckte O’Malley einen anderen Ausdruck darin: den Blick einer gehetzten Kreatur, die endlich einen Zufluchtsort entdeckt hat. Der erste Ausdruck schwand mit der Schnelligkeit eines Tieres, das in seiner Höhle Schutz sucht. Doch kurz zuvor hatte dieser Blick ihm noch blitzschnell eine Botschaft übermittelt. War es eine Warnung, ein Willkommensgruß, eine Erklärung gewesen? O’Malley fand kein passendes Wort dafür, aber diese Botschaft hatte ihm persönlich als Artgenossen gegolten.
Wie angewurzelt blieb er stehen und starrte den Mann an. Gern hätte er irgendetwas gesagt, denn der Mann hatte ihn ja offensichtlich dazu aufgefordert, aber seltsamerweise stockte ihm der Atem und er brachte kein Wort heraus. Der Junge sah ihn nur von der Seite her an und schmiegte sich eng an seinen Hünen von Vater. Dieser Austausch intensiver Blicke zwischen den drei Menschen mag zehn Sekunden lang gedauert haben ... Dann beendete der Ire, verwirrt und innerlich aufgewühlt, diese wortlose Vorstellung mit einer kaum merklichen Verbeugung und ging langsam weiter zu seiner Kabine im Unterdeck, wobei er, geistig völlig abwesend, gegen andere Passagiere stieß.
Tief in seinem Herzen erwachte eine undefinierbare Anteilnahme an dem, was er in diesen beiden erkannt hatte. Es war eine Art innerer Verwandtschaft, die er aber noch nicht näher eingrenzen konnte. An der Oberfläche spürte er eine Emotion, die Beunruhigung oder auch Verblüffung sein mochte, doch darunter lag ein anderes, tiefer greifendes Gefühl, das diese Emotion fast verdrängte. Etwas überaus Gewinnendes in der Ausstrahlung von Vater und Sohn hatte ihn bei der wortlosen Begegnung unmittelbar angesprochen. Etwas Bedeutsames, auf seltsame Weise Verborgenes. Es war noch nicht so weit zum Vorschein gekommen, dass er sich dazu bekennen und es benennen konnte. Aber jeder von ihnen hatte es im anderen erkannt. Jeder wusste darum. Jeder wartete auf etwas. Und das verstörte ihn geradezu.
Ehe er auspackte, blieb er lange auf seiner Kojenpritsche sitzen und dachte nach ... Vergeblich suchte er in diesem Ansturm verblüffender Emotionen nach dem Begriff, der diesen Gefühlswirrwarr zu erklären vermochte. Dieser merkwürdige Eindruck eines gewaltigen Körperumfangs, den der abschätzende Blick keineswegs bestätigt hatte. Dieser gehetzte Ausdruck eines Menschen, der Schutz sucht, abgelöst von einer Miene, die besagte, dass er plötzlich wusste, wohin er sich wenden konnte, sogar schon dorthin unterwegs war. All das, so spürte O’Malley, waren nur Erscheinungsformen ein und derselben Ursache. Es war dieses in dem Mann Verborgene, das sich auf unsichtbare Weise zu ihm ausgestreckt und sein eigenes Bewusstsein berührt hatte, als ihre Blicke sich kurz getroffen hatten. Und das verstörte ihn so heftig, weil dasselbe auch in ihm selbst verborgen lag, auch wenn er es nicht greifen konnte. Dieser Mann wusste, was es war; hingegen hatte er selbst bislang nur eine Vorahnung davon. Was war es? Und warum löste es sowohl ein Glücksgefühl als auch Angst in ihm aus?
Das Wort, dem er wie eine Katze, die den eigenen Schwanz verfolgt, hinterherjagte und um das sein Denken unablässig kreiste, ohne eine Erklärung zu liefern, war Einsamkeit –
eine Einsamkeit, die er sich selbst kaum eingestand und schon gar nicht gegenüber anderen geäußert hätte. Denn es war eine Einsamkeit, aus der er vielleicht bald erlöst werden würde. Und wenn man sie zu laut kundtat, würden vielleicht jene auftauchen, die sich einmischen und es dadurch vereiteln würden. Außerdem waren der Mann und der Junge genau wie er auf der Flucht. Doch sie hatten einen Fluchtweg gefunden, waren zudem von sich aus willens und darauf bedacht, ihn auch anderen Gefangenen zu zeigen.
So weit konnte sich O’Malley einer Erklärung annähern und begann allmählich und mit außerordentlichem Hochgefühl einiges zu begreifen.
»Nun ja – und was hatte es mit diesem ungewöhnlichen Körperumfang auf sich?«, fragte ich, um einen eher trivialen Punkt aufzugreifen, nachdem ich so lange seinen Träumereien gelauscht hatte. »Wie hast du den gedeutet? Es muss doch sicher einen eindeutigen Grund dafür gegeben haben?«
Während wir neben der kurvenreichen Straße hergingen, drehte er sich zu mir um und richtete seine hellblauen Augen fest auf meine. An diesem Sommernachmittag erzählte er mir diese Geschichte zum ersten Mal.
Halb lachend, halb ernsthaft erwiderte er: »Der Körperumfang, das Stämmige, Kräftige an ihm, muss in Wirklichkeit wohl der Ausdruck einer geistig-seelischen Eigenart gewesen sein, die meine Psyche unmittelbar ansprach; es war kein durch die Augen vermittelter Eindruck.« In der mündlichen Erzählung benutzte er einen Vergleich, den er beim Niederschreiben weggelassen hatte. Denn natürlich war ihm wegen seines Humors klar, dass diese Sache, egal, in welche Sätze er sie verpackte, grotesk klingen musste, obwohl sie in Wirklichkeit weit davon entfernt und eher außergewöhnlich anrührend war. »Es war so, als wären der imposante Rücken und die kräftigen Schultern unter dem losen schwarzen Umhang, die wie Höcker wirkten, Auswüchse seines Inneren. Allerdings wirkten sie an sich nicht hässlich, sondern auf völlig natürliche Weise durchaus passend, weil sie seiner Person die Ausstrahlung gewaltiger Ausmaße verliehen. Sein Körper war zwar stämmig, jedoch normal proportioniert. Sein Geist aber verbarg eine andere Gestalt. Und ein Aspekt dieser anderen Gestalt sprach auf irgendeine Weise meine Seele an.«
Als er merkte, dass mir im Augenblick keine Antwort darauf einfiel, setzte er nach: »Vielleicht stellst du dir bei einem Mann, der wütend ist, die Farbe Rot vor und bei einem eifersüchtigen Mann die Farbe Grün!« Er lachte laut. »Verstehst du es jetzt? In Wirklichkeit ging es gar nicht um eine körperliche Sache!«
4
»Zweifellos denken wir nur mit einem kleinen Teil unserer Vergangenheit; mit unserer gesamten Vergangenheit jedoch und darin eingeschlossen der ursprünglichen Biegung unserer Seele wünschen, begehren und handeln wir.«
Henri Bergson
Seine übrigen Mitreisenden hatten nichts Auffälliges an sich. Eine Gruppe französischer Touristen wollte nach Neapel, eine deutsche Gruppe nach Athen, einige Geschäftsleute waren auf dem Weg nach Smyrna und Konstantinopel und einige Russen wollten über Odessa, Batumi oder Noworossijsk nach Hause zurückkehren.
O’Malley teilte sich seine Kabine mit einem etwas rundlichen, rotgesichtigen Handelsreisenden aus Kanada, der die obere Koje belegt hatte. Er handelte mit Erntemaschinen und sein ganzes Denken kreiste um deren Bezeichnungen, Preise und Bezugsbedingungen. All das konnte er in mehreren Sprachen ausdrücken, aber es war auch schon das einzige Gebiet, auf dem er sich auskannte. Er war ein gutmütiger Mensch, der in allem nachgab, um Problemen aus dem Weg zu gehen.
»Ich würde im Bett gern noch lesen. Stört es Sie, wenn ich das Licht noch eine Weile brennen lasse?«, fragte O’Malley.
»Mich stört fast nie etwas«, erwidert der Kanadier fröhlich. »Ich bin keiner, der gern herummäkelt, sondern ein verträglicher Mensch. Machen Sie sich keine Gedanken um mich.« Er drehte sich zum Schlafen um. »Bin ja ständig auf Reisen«, drang seine gedämpfte Stimme aus den Kissen. »Ich nehme die Dinge, wie sie kommen.«
Das Einzige, was O’Malley an seinem Zimmergenossen störte, war, dass er tatsächlich alles auf sich zukommen ließ und sich um nichts scherte. Weder machte er sich die Mühe, hin und wieder ein Bad zu nehmen, noch legte er die Kleidung ab, wenn er zu Bett ging.
Den Kapitän des Schiffes, der Englisch mit starkem Akzent sprach, kannte O’Malley von früheren Reisen her. Er war ein leutseliger deutscher Seemann mit bärbeißiger Stimme aus Sassnitz und schimpfte mit O’Malley, weil er »wie üblich« fast zu spät an Bord gekommen wäre. »Sie waren so spät dran, dass ich Ihnen jetzt keinen Platz mehr an meinem Tisch anbieten kann«, brummte er, lachte jedoch dabei. »Wirklich schade. Sie hätten mir Ihre Ankunft mit einem Telegramm ankündigen sollen, dann hätte ich Ihnen einen Platz reserviert. Jetzt ist für Sie höchstens noch ein Platz am Tisch des Schiffsarztes frei!«
»Der Dampfer ist diesmal wirklich sehr gut gebucht.« O’Malley zuckte die Achseln. »Aber darf ich hin und wieder zum Rauchen zu Ihnen auf die Brücke kommen?«
»Selbstverständlich.«
»Sind irgendwelche interessanten Leute an Bord?«, fragte O’Malley nach kurzem Schweigen.
Der Kapitän lachte. »Eigentlich die gleichen Leute wie immer. Keiner, der das Schiff zum Anhalten bringen wird! Fragen Sie den Schiffsarzt, er merkt so was eher als ich. Aber die netten Passagiere werden ja sowieso immer seekrank und verschwinden von der Bildfläche. Fahren Sie diesmal nach Trapezunt?«
»Nein, nach Batumi.«
»Ach! Wegen Öl?«
»Nein, ich bereise den ganzen Kaukasus – will ein bisschen Bergluft atmen.«
»Dann haben Sie hoffentlich jede Menge Waffen dabei. Da oben erschießt man Sie schon wegen zwei Pfennigen!« Und mit dem so typischen herzlichen, tiefen Lachen und einer recht behäbigen Munterkeit machte er sich auf den Weg zur Brücke.
Und so landete O’Malley bei den Mahlzeiten rechts von Doktor Stahl; ihm gegenüber, links von dem Schiffsarzt, saß ein gesprächiger Moskauer Pelzhändler, der dezidierte Ansichten über alles und jedes hegte. Nun war er davon überzeugt, sie auch mit der übrigen Welt teilen zu müssen; also gab er – fast im Ton päpstlicher Dekrete – wortreich Allgemeinplätze von sich, die zuweilen amüsant, meistens aber langweilig waren. Rechts von ihm saß ein armenischer Geistlicher – er hatte sanfte Augen und einen braunen Vollbart – aus dem venezianischen Kloster, das Byron Schutz gewährt hatte. Bis auf die Suppe aß er alles mit dem Messer, jedoch mit einer Eleganz, die man nur bewundern konnte. Seine Hände bewegte er so graziös, dass sie fast das Messer hätten ersetzen können, ohne dass es anstößig gewirkt hätte. Hinter dem Geistlichen saß der rundliche kanadische Handelsreisende. Er sagte kaum etwas; stattdessen verfolgte er genau, was an Gerichten aufgetragen wurde, damit ihm auch ja nichts entging, und aß. Weiter unten an der Tafel fielen der stämmige Fremde mit dem blonden Bart und sein Sohn neben zwei unscheinbaren Personen besonders auf. Da sie O’Malley und dem Arzt schräg gegenübersaßen, hatte O’Malley sie voll im Blick.
Er unterhielt sich mit allen in Hörweite, denn Menschen gegenüber, die er wahrscheinlich niemals wiedersehen würde, war er durchaus mitteilsam. Besonders freute er sich, dass man ihn neben dem Schiffsarzt Dr. Heinrich Stahl platziert hatte, denn der Mann zog ihn einerseits an, andererseits forderte er ihn zum Widerspruch heraus, und sie hatten sich schon auf mehr als einer Reise hitzige Wortgefechte geliefert. Im Charakter des Arztes gab es eine fundamentale Unstimmigkeit, wie O’Malley spürte: Dessen persönliche Erfahrungen entsprachen nämlich leider nicht seinen Überzeugungen – und umgekehrt. Zwar gab er vor, an nichts zu glauben, ließ aber trotzdem gelegentlich Bemerkungen fallen, die einen Glauben an alle möglichen Dinge verrieten und ihn als Querdenker entlarvten. Zum Beispiel hatte er den Iren O’Malley irgendwann dazu verleitet, seinen Glauben an Feen einzugestehen, nur um im nächsten Augenblick das ganze Thema mit einer zynischen Bemerkung als absurd abzutun. In Stahls sarkastischer Haltung entdeckte O’Malley ein Gehabe, das offenbar dem Selbstschutz diente. »Kein vernünftiger Mensch kann solche Dinge hinnehmen«, hatte er bemerkt. »Sie sind einfach nur unglaubwürdig und albern.« Und doch sagte er das so bissig, dass er sich selbst damit verriet. Genau das, was seine Vernunft zurückwies, sprach sein Gefühl an.
Allerdings muss man sich fragen, wie akkurat die intensiven Eindrücke waren, die der Ire von Menschen ganz allgemein mitnahm. Im Fall von Dr. Stahl mochte sein Eindruck allerdings weitgehend zutreffen: Dass sich ein Mann mit solchen Kenntnissen und Fähigkeiten damit zufriedengeben konnte, als bloßer Schiffsarzt sein Licht unter den Scheffel zu stellen, schrie geradezu nach einer Erklärung. Stahls eigene lautete, er wünsche sich genügend Freizeit zum Nachdenken und Schreiben. Er war kahlköpfig, nachlässig gekleidet, frühzeitig gealtert, zu kurz geraten und sein Bart von Schnupftabak und anderem Tabak verfärbt, aber ein Wissenschaftler mit so viel Vorstellungsvermögen, dass er jenseits aller Formeln zu Spekulationen neigte. Kurzum: eine Persönlichkeit, die einem unwillkürlich Achtung einflößte. Oft zwinkerte er mit den wachen dunklen Augen – manchmal spöttisch, was, ehrlich gesagt, hin und wieder recht unfreundlich wirken konnte, doch häufig auch aus gutmütiger Belustigung, die wohl von seinem Verständnis für menschliche Schwächen herrührte. Zweifellos war er warmherzig, wie nicht wenige Schiffspassagiere, denen es an Bord zeitweilig schlecht gegangen war, hätten bezeugen können.
Anfangs schleppte sich die Unterhaltung am Tisch dahin. Sie begann am unteren Ende, wo die französischen Touristen lebhaft plauderten, während sie ihre Suppe löffelten, und setzte sich so langsam wie ein Schwelbrand zum oberen Tischende fort, wobei sie mehrere Personen, die sich daran nicht beteiligten, übersprang. Darunter waren der Handelsvertreter für Erntemaschinen, die beiden Unscheinbaren und der stämmige blonde Fremde sowie sein Sohn.
Hingegen war vom Tisch hinter ihnen ständig lautes Stimmengewirr zu hören, was vor allem an der lockeren, leutseligen Art des Kapitäns lag. Er prophezeite den Damen rechts und links von ihm einen ruhigen Reiseverlauf. Übertönt von seiner voluminösen Stimme fiel es sogar den Schüchternen leicht, sich mit Bemerkungen an ihre Tischnachbarn zu wenden.
Während O’Malley Gesprächsfetzen aufschnappte, wanderte sein Blick unwillkürlich immer wieder zu den beiden Fremdlingen schräg gegenüber. Ein- oder zweimal traf sich sein Blick mit dem des Arztes, der in dieselbe Richtung schaute, und dabei lag es ihm auf der Zunge, eine Bemerkung über sie zu machen oder den Arzt etwas zu fragen. Doch er fand nicht die richtigen Worte und hatte den Eindruck, dass sich Dr. Stahl aus ähnlichen Gründen zurückhielt. Beide hätten gern etwas gesagt, schwiegen jedoch und warteten darauf, dass der andere das Eis brach.
»Dieser Mistral ist lästig«, meinte der Arzt, als die Unterhaltung an sein Tischende überschwappte und es unhöflich gewesen wäre, weiterhin zu schweigen. »Manchen Menschen geht er geradezu auf die Nerven.« Er sah zu O’Malley hinüber, doch es war der Pelzhändler, der etwas erwiderte, während er die beringte Hand über den Teller hielt, um zu sehen, wie heiß das Essen noch war.
»Damit kenne ich mich aus«, sagte er so wichtigtuerisch, als hätte er das Wissen mit Löffeln gefressen. »Der Mistral hält drei, sechs oder neun Tage an. Aber sobald wir den Golf von Lyon durchquert haben, liegt der Mistral hinter uns.«
»Ach ja? Da bin ich aber froh«, mischte sich der Geistliche mit zaghaftem Lächeln ein, während er auf der Messerklinge geschickt einen Fleischbrocken und grüne Erbsen, die wie kleine Geschosse aussahen, im Gleichgewicht hielt. Sein Ton, sein Lächeln und seine Gestik wirkten so vornehm, dass das Essen mit Metallbesteck jeglicher Art bei ihm wie ein Stilbruch wirkte.
»Selbstverständlich«, gab der Pelzhändler im Brustton der Überzeugung zurück. »Ich habe diese Reise schon so oft gemacht, dass ich es weiß. Von Sankt Petersburg nach Paris, ein paar Wochen an die Riviera, dann über Konstantinopel und die Krim zurück. Keine große Sache. Ich erinnere mich noch an letztes Jahr ...« Er schob eine große Perlennadel tiefer in die gesprenkelte Krawatte und begann mit einer Geschichte, die vor allem bewies, auf welch luxuriöse Weise er reiste. Mit seinem Blick versuchte er den ganzen Tisch einzubeziehen, doch während der Armenier höflich zuhörte, lächelte und nickte, wandte sich Dr. Stahl wieder dem Iren zu. Es war das Jahr des Halleyschen Kometen, und Stahl wusste Interessantes darüber zu berichten.
»Um drei Uhr früh ist immer die beste Zeit, ihn zu beobachten«, schloss der Arzt. »Ich werde Sie wecken lassen, denn Sie müssen den Kometen unbedingt durch mein Teleskop betrachten. Ende der Woche, sagen wir, nachdem wir von Catania nach Osten aufgebrochen sind ...«
Und genau in diesem Moment, nach lautem Gelächter am Kapitänstisch, trat eine dieser abrupten Pausen ein, die manchmal einen ganzen Raum gleichzeitig erfassen. Alle verstummten. Selbst der Pelzhändler stellte sein Champagnerglas ab und schwieg. Es waren nur noch das Mahlen der Schiffsschraube zu vernehmen, das unter den Bullaugen dahinströmende Wasser, das leise Schlurfen der Stewards. Deshalb war es im ganzen Raum überdeutlich zu hören, als der Arzt eine beiläufige Bemerkung mit den Worten beendete: »... wobei wir das Ionische Meer in Richtung der griechischen Inseln durchkreuzen.«
Im selben Moment bekam O’Malley mit, wie der stämmige Fremde plötzlich den Blick hob und ihn so auf den Arzt fixierte, als wäre er von diesen Worten völlig gebannt.
Unmittelbar darauf schaute der Fremde zu O’Malley hinüber und sah danach wieder auf den Teller, der vor ihm stand. Erneut versanken die Reisenden in irgendwelchen Gesprächen; der Pelzhändler setzte sein überschwängliches Selbstlob fort, während der Arzt über die Gase am Kometenschweif sinnierte. Doch der leicht erregbare Ire spürte, wie es ihn auf seltsame Weise davontrug, in eine andere Welt. Aus der Tiefe des Unbewussten stieg etwas ungeheuer Großes, Prophetisches auf. Die triviale Bemerkung des Arztes und der kurze Austausch von Blicken hatten eine wunderbare Tür in seinem Herzen geöffnet, sodass er sich sofort in Gedanken verlor. Oder treffender ausgedrückt: Wie auf Knopfdruck und völlig lautlos verlagerte sich die ganze Maschinerie seiner Persönlichkeit und präsentierte der Welt unverzüglich eine neue Facette. An die Stelle seines normalerweise wenig ausgeprägten Selbstbewusstseins trat kurzzeitig die majestätische Gelassenheit eines viel erhebenderen Gemütszustands, den auch der Fremde kannte.
Das Universum ist in jedem menschlichen Herzen eingebettet, und er tauchte in die archetypische Welt ein, die so nahe hinter allen Erscheinungsformen der Vernunft liegt. Er konnte es nicht erklären und versuchte es auch gar nicht, aber während es ihn davontrug, überwältigte ihn das Gefühl vollkommener Schönheit. Der Dampfer, die Passagiere und die Gespräche schwanden aus seinem Bewusstsein, nur der Fremde und dessen Sohn blieben real und lebendig. O’Malley hatte etwas geschaut, das er niemals vergessen würde. Der Zufall hatte diese Situation herbeigeführt, aber ungeheure Kräfte waren dabei ins Spiel gekommen und hatten sie für sich genutzt. Etwas tief in der Seele Verborgenes hatte aus den Augen des blonden Fremdlings gestrahlt und ihm ein Zeichen gegeben. Das Feuer hatte sich bis zu O’Malley erstreckt und war danach erloschen.
»Die griechischen Inseln ...« Einfache Wörter, und doch schien es O’Malley so, als hätte der Blick, den sie in den Augen des Fremden auslösten, diese Wörter beseelt und sie mit der Bedeutung lebenswichtiger Hinweise aufgeladen. Sie berührten ein überwältigendes fernes Rätsel, irgendein psychisches Drama im Leben dieses Mannes, dessen »Stämmigkeit« und unausgesprochene »Einsamkeit« auf ihre Weise ebenso wichtige andere Hinweise darauf gaben. Zudem begriff O’Malley beim Gedanken an den ersten Eindruck von den beiden Fremden vor ein paar Stunden auf dem Oberdeck, dass auch sein eigener Seelenzustand, befeuert durch ein eigenartiges, primitives Verlangen, mit diesem Rätsel zu tun hatte und er die heimliche Leidenschaft der beiden Fremden teilte.
Diese kleine Episode illustriert vortrefflich O’Malleys Eigenart, stets »das Ganze zu sehen«. Blitzschnell hatte er aufgrund seines inneren Gespürs die Wörter und den Blick des Fremden miteinander verbunden und die Situation so gedeutet, dass das eine das andere ausgelöst haben musste.
Die Gesprächspause hatte für die Gelegenheit gesorgt. Falls er sich das Ganze nur eingebildet hatte, dann dank seiner kreativen Fantasie. Falls nicht, hatte er zweifellos eine besondere spirituelle Erkenntnis gehabt.
Schließlich wurde sich O’Malley bewusst, dass sein Tischnachbar ihn mit zusammengekniffenen Augen aufmerksam beobachtete. Offenbar war er also eine Weile geistig weggetreten und hatte mit leerem Blick auf den Tisch gestarrt. Hastig wandte er sich um und blickte den Arzt offen an. Diesmal war es unmöglich, irgendein Gespräch zu vermeiden.
»Folgt Ihr den Morgensternen, die keinen Tag gebären?«, fragte Dr. Stahl hinterhältig. »Sie haben Ihre Gedanken schweifen lassen und meine letzten Bemerkungen gar nicht mitbekommen!«
Übertönt von der lauten Stimme des Pelzhändlers erwiderte O’Malley leise: »Ich habe die beiden beobachtet, die weiter hinten sitzen, uns schräg gegenüber. Wie ich sehe, interessieren Sie sich ebenfalls für sie.« Das war nicht als Provokation gemeint. Falls der Ton aggressiv wirkte, lag es nur daran, dass O’Malley annahm, sie könnten bei diesem Thema aneinandergeraten – er roch die kommende Diskussion. Deshalb überraschte es ihn ziemlich, dass der Arzt ihm schlicht zustimmte.
»Ja, die beiden interessieren mich sehr.« In Stahls Stimme schwang keine Spur von Streitlust mit. »Und das sollte gerade Sie eigentlich nicht überraschen.«
»Mich ... faszinieren sie einfach«, erwiderte O’Malley, der stets zum Einlenken bereit war. »Woran mag das liegen? Was an den beiden empfinden Sie denn als ungewöhnlich? Kommen Sie Ihnen auch außerordentlich ›massig‹ vor?« Da der Arzt nicht gleich antwortete, setzte O’Malley fort: »Der Vater ist ein wahrer Koloss, aber das allein ist es nicht ...«
»Zum Teil wohl doch«, meinte der Arzt, »glaube ich zumindest.«
»Was ist es sonst noch?« Da der Pelzhändler immer noch schwallte, hörte niemand das Gespräch mit. »Was unterscheidet die beiden von den anderen?«
»Sie sollten das doch wohl als Erster erkennen«, erwiderte der Arzt mit stillem Lächeln. »Wenn ein Mann mit Ihrer Vorstellungskraft da nichts sieht, wie soll da ein armseliger exakt denkender Mensch wie ich etwas erkennen?« Einen Moment lang musterte er O’Malley eingehend. »Wollen Sie wirklich behaupten, Ihnen sei an den beiden nichts aufgefallen?«
»Eine gewisse Andersartigkeit, ja; eine gewisse Abgehobenheit von den anderen. Auf bestimmte Weise wirken sie wie in sich eingekapselt; aber ich würde es eine selbst gewählte Einkapselung nennen ...«
Abrupt hielt O’Malley inne. Wie merkwürdig: Ihm wurde klar, dass er unversehens über die Wahrheit gestolpert war. Doch gleichzeitig wurde ihm bewusst, dass er mit seinem Reisegefährten nicht darüber reden wollte. Denn das hätte auch bedeutet, mit ihm über sich selbst zu reden, zumindest über etwas in seinem Innern, das er ihm nicht offenbaren wollte. Erneut schwang seine Stimmung sofort um, ohne dass er es verhindern konnte. Plötzlich kam es ihm so vor, als hätte er dem Arzt persönliche Geheimnisse enthüllt, zudem Geheimnisse, die dieser nicht wohlwollend aufnehmen würde. Der Arzt hatte ihn sozusagen »erwischt«, sein Innerstes scharfsinnig erforscht, nur hatten seine lockeren Formulierungen das kaschiert.
»Woher stammen die beiden Ihrer Meinung nach?«, fragte der Arzt. »Sind es Finnen, Russen, Norweger oder was sonst?« O’Malley erwiderte kurz angebunden, er halte sie am ehesten für Russen, vermutlich aus dem südlichen Russland. Sein Ton hatte sich verändert: Er wollte jede weitere Diskussion über die beiden vermeiden. Bei der erstbesten Gelegenheit wechselte er geschickt das Thema.
Es war eigenartig, wie gewiss er sich seiner Sache war. Etwas in ihm selbst, so ungezähmt wie die Wüste – etwas, das mit seiner Vorliebe für das primitive Leben zu tun hatte, über die er nur mit wenigen verständnisvollen Menschen geredet hatte –, dieses Etwas in seiner Seele empfand solche Verwandtschaft zu einer bei diesen Fremden ähnlich ausgeprägten Leidenschaft, dass es ein Verrat an ihm selbst wie an ihnen gewesen wäre, darüber zu sprechen.
Außerdem war ihm Dr. Stahls Interesse an den beiden Fremden suspekt, denn er spürte, dass es ein kritisches, rein wissenschaftliches Interesse war. Dahinter lauerte die Analyse, die sie auseinandernehmen und bloßstellen würde. In O’Malley war ein grundlegender Instinkt erwacht, der des Selbstschutzes.
Jetzt schon hatte er sich aufgrund einer geheimen Verbundenheit auf die Seite der Fremden geschlagen.
5
»Die Fabellehre enthält die Geschichte der urbildlichen Welt, sie begreift Vorzeit, Gegenwart und Zukunft.«
Novalis, Blütenstaub
Da dieses Thema also tabu war, entstand eine Barriere zwischen O’Malley und dem Schiffsarzt, die immer höher wurde, da keiner von beiden Anstalten machte, sie niederzureißen. O’Malley hatte sie errichtet und Dr. Stahl respektierte sie. Eine Zeit lang erwähnte keiner mehr den stämmigen Russen und seinen Sohn.
In seinem schriftlichen Bericht hatte O’Malley, der gewiss kein begabter Schriftsteller war, offenbar auf zahllose erhellende Einzelheiten verzichtet. Mündlich überzeugte er mich allerdings sofort davon, dass da tatsächlich ein Rätsel existierte, nur fiel es mir schwer, die mündliche und schriftliche Erzählung miteinander in Verbindung zu bringen. Aber zweifellos hatten der Russe und sein Sohn etwas an sich, das große Neugier weckte. Bei den anderen Passagieren paarte sich diese Neugier mit einer Abneigung, die die beiden Fremden isolierte. Zugleich wetteiferten die beiden Freunde, O’Malley und der Schiffsarzt, darum, das Rätsel um die Fremden zu lösen, wenn auch aus entgegengesetzten Motiven.
Wären Vater oder Sohn seekrank geworden, hätte Dr. Stahl dabei aus beruflichen Gründen den Vorteil eindeutig auf seiner Seite gehabt, aber da es beiden weiterhin gut ging und sich der Arzt ständig um andere Passagiere kümmern musste, war es der Ire, der den ersten Schritt tun und Bekanntschaft mit den beiden Fremden machen konnte.
Selbstverständlich trieb sein starkes persönliches Interesse an ihnen die Situation voran. O’Malley war nicht entgangen, wie sehr die beiden von den meisten Passagieren abgelehnt wurden, obwohl sie sich still und friedfertig verhielten und eigentlich gar keinen Stein des Anstoßes boten, und das empörte ihn. Offenbar hatten sie etwas an sich, das andere dazu herausforderte, sie schlicht links liegen zu lassen. Und auf einem kleinen Dampfer, wo die Reisenden mit der Zeit das Gebaren einer Großfamilie entwickeln, fiel die Ausgrenzung unangenehm auf.
Man merkte diese Ausgrenzung an vielen kleinen Einzelheiten, sofern man ein aufmerksamer Beobachter war. Winzige Annäherungsversuche, die üblichen höflichen Gesten von Reisenden, die normalerweise zu einem Gespräch geführt hätten, verliefen in ihrem Fall im Sande. Die anderen Passagiere zogen sich nach kurzer Zeit stets mit höflichen Entschuldigungen zurück, um weiterem Kontakt mit den beiden aus dem Wege zu gehen.
Obwohl dieses Verhalten der anderen bei O’Malley anfangs instinktiven Abscheu, fast Wut auslöste, spürte er mit der Zeit, dass dieses Paar nicht nur wenig einladend wirkte, sondern sogar eine Atmosphäre verbreitete, die ihre Mitmenschen geradezu vor den Kopf stieß. Jedes Mal, wenn er Zeuge solcher kurzen Szenen wurde, verstärkte sich das ursprüngliche Bild, das er sich von den beiden gemacht hatte: Er sah sie als einsame, von anderen abgelehnte Geschöpfe, die von der ganzen Menschheit verfolgt wurden. Und aus dieser Einsamkeit wollten sie sich an einen ihnen bekannten Ort flüchten, waren dorthin eindeutig unterwegs.
Nur ein Mensch mit sehr viel Vorstellungsvermögen konnte all dies erahnen, sofern er sich auf die beiden konzentrierte. Doch O’Malley war es sonnenklar. Zudem verstärkte sich bei ihm das Gefühl, dass der Zufluchtsort, zu dem sie unterwegs waren, auch ihm selbst Zuflucht bieten würde – nur zögerte er im Unterschied zu ihnen noch, diesen Weg einzuschlagen.