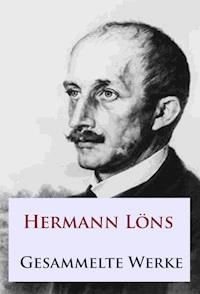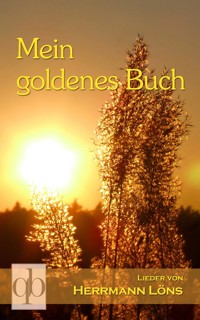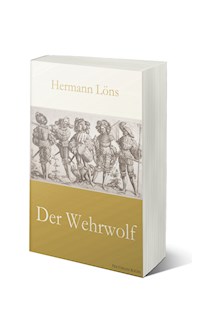Der zweckmäßige Meyer & Frau Döllmer (Humoristische Plaudereien des großen Heidedichters) E-Book
Hermann Löns
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Der zweckmäßige Meyer & Frau Döllmer (Humoristische Plaudereien des großen Heidedichters)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Hermann Löns (1866-1914) war ein deutscher Journalist und Schriftsteller. Schon zu Lebzeiten ist Löns, dessen Landschaftsideal die Heide war, als Jäger, Natur- und Heimatdichter sowie als Naturforscher und -schützer zum Mythos geworden. Aus dem Buch: "Sind Sie Nervös? Wenn ja, so schaffen Sie sich ein Aquarium an! Mögen Sie nun an fieberhaften Beunruhigungen, hysterischen Umwandlungen, neurasthenischen Anfällen, Gemütsdepressionen und so weiter leiden, schaffen Sie sich ein Aquarium an, Verehrtester; es gibt nichts Besseres für schlechte Nerven." Inahlt: Der zweckmäßige Meyer Ein Liebeslied Frühlingsprobe Billiger Sonntag Ein Naturfreund Der alte Herr und der junge Mann Der Maikäfer Aquariumsphilosophie Ein Schreckenstag Der Aronstab Der Vogel Wupp Die Forscher Ein eckliges Tier Quaaks Strandgut Ein Waldspaziergang Die beiden Seeigel Fallaub Wissenswertes vom Hasen Das Geheimnis der Bücherlaus Der Koloradokäfer Bei der Gnädigen Teckliges, Allzuteckliges Amalie Hannover, am Heutigen dieses Hujus O wie Billig Der Bürgervorsteher Es geht wohl noch Gerichtszeuge Influenza Lex Heinze Unsere Kindermädchen Schützenfest Der dicke Pilz Im Zoologischen Die Gesundbeterin Sieben Schulaufsätze von Aadje Ziesenis Die Aalenriede Das Osterfest Der Zologen Der Frühling Beschreibung der Stadt Hannover Der schnelle Graben Der Tiergarten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Der zweckmäßige Meyer & Frau Döllmer
Billiger Sonntag, Ein Naturfreund, Der alte Herr und der junge Mann, Aquariumsphilosophie, Ein Schreckenstag, Beschreibung der Stadt Hannover, Der schnelle Graben, Frühlingsprobe, Der Tiergarten...
Inhaltsverzeichnis
Der zweckmäßige Meyer
Der zweckmäßige Meyer
Meyer schwärmt sehr für die Natur, oder vielmehr, wie er sagt, für Natur, und zwar aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil dieser Sport billig ist, denn Meyer ist für das Billige; zweitens, weil er bekömmlich ist, denn Meyer ist für das Bekömmliche; drittens, weil Meyer eine bedeutende naturwissenschaftliche Bildung hat, denn er hat Primareife, ein Vergrößerungsglas, einem ziemlich richtig gehenden Laubfrosch und ist Mitglied des Kosmos.
Infolgedessen ist für Meyer die Natur eine leicht erklärbare Sache. Über die Tierseele hat ihn Doktor Zell, über die Entstehung der Welt der Urania- Meyer, über die Entwicklung des Menschen Friedrich Wilhelm Bölsche vollkommen genügend unterrichtet; den Rest denkt er sich selbst zusammen.
Meyer und ich gehen oft aus; Meyer redet, und ich höre zu; Meyer erklärt, und ich versuche zu folgen; Meyer lehrt, und ich stelle schüchterne Fragen; wenn er sie nicht beantworten kann, erklärt er sie für zu leicht, als daß er darauf eingehen könnte.
Auch gestern nachmittag drei Uhr hatten wir uns zu einem Spaziergang nach auswärts verabredet, weil dort, sagte Meyer, die Natur noch natürlicher sei als bei der Stadt, wo die Kultur schon so tief hineinschneide, daß man derselben nicht mehr bequem erkennen könnte.
Da das Wetter schön und warm war, hatte ich meinen dünnsten Anzug, den leichtesten Wanderstab und einen Strohhut gewählt. Meyer als Mann der Wissenschaft hatte seinen Laubfrosch befragt, und da dieser ihm zart andeutete, daß das Wetter sich ändern könne, erschien er in Lodenhut, Havelock und Regenschirm.
So hatte er an alle Möglichkeiten gedacht, nur nicht an die Zigarren, und war infolgedessen auf meine angewiesen, ein Vorgang, der mich stets in eine gereizte Stimmung versetzt.
Auf der ersten Haltestelle stiegen wir aus und wanderten in jenem gemessenen Gange, der den besonnenen Naturbetrachter in der unwissenschaftlichen Menge sofort kenntlich macht, unseres Weges.
»Wie zweckmäßig diese Blume, Hieracium, Habichtskraut heißt sie, eingerichtet ist,« sprach Meyer und zeigte auf einen Blume, die im grünen Grase stand und ob dieser unerwarteten Ansprache fast vom Stengel fiel; »ihre leuchtende Farbe zieht die Insekten an. Wäre sie zum Beispiel rot, so würde sie nicht bemerkt werden.«
In diesem Augenblick kam ein Hummel an, die irgend etwas in den Bart brummte, das wie Kartoffelkopp klang, übersah vollständig das schreiend gelbe Plakat des Habichtskrautes und ließ sich an einer roten Taubnessel nieder. Meyer wandte sich entrüstet ab.
»Es ist merkwürdig,« sprach Meyer, indem er sich mit einem rotbaumwollenen Taschentuch, auf dem die Schlacht bei Königgrätz abgebildet war, die Stirn abwischte, »welchen erhebenden Einfluß die Sonne auf alle Geschöpfe ausübt. Ein Zug von Frohsinn, Liebenswürdigkeit, Freude und Harmlosigkeit geht durch alle Wesen.«»Platz da, zum Donnerwetter,« brüllte eine rauhe Stimme, und in eine Staubwolke gehüllt und klingelnd, als risse er an der Nachtglocke einer Hebamme, sauste ein Radfahrer zwischen uns durch, es Meyer überlassend, bezüglich der Radfahrer eine einschränkende Fußnote zu seiner Theorie von der Wirkung der Sonnenstrahlen zu machen.
Dann zeigte mir Meyer ein Pflanze, die er Wasserhahnenfuß, Batrachium, nannte. »Sehen Sie,« sagte er, »würde dieser Graben fließen, so würde diese Pflanze lauter untergetauchte, aber keine schwimmenden Blätter haben. Da das Wasser aber steht, so bringt sie es zu letzteren. Das ist das Gesetzt der Anpassung, das Darwin entdeckt hat.«
»Stimmt,« sagte ich; »es ist dasselbe, als wenn man einen Anarchisten aus den bewegten Wellen des Proletariats in die ruhigen Verhältnisse des Kapitalismus bringt; schon nach fünf Bierminuten wird er konservative Blätter treiben.«
»Da ist Unsinn,« sprach Meyer, »geben sie mir lieber eine Zigarre.« Ich gab sie ihm, und er fuhr fort: »Bemerken Sie jenen blanken Käfer?« Ich bemerkte ihn. »Derselbe ist im Besitz von vier Augen. Mit den oberen sieht er über dem Wasser, mit den unteren unter demselben her, um sowohl die Beute zu erspähen, die auf, als auch die, die unter dem Wasser schwimmt. Zu dem Behufe sind die oberen Augen anders konstruiert als die unteren.«
»Das ist mächtig praktisch,« erwiderte ich; »aber was macht er, wenn er einmal auf dem Rücken schwimmt und mit Wasseraugen in die Luft und mit den Luftaugen in das Wasser guckt?«
Meyer überging diesen triftigen Einwand und fuhr fort: »Diese kleinen Käfer, die hier überall fliegen, sind Aphodien, Mistkäferchen. Die Natur hat sie dazu bestimmt, alle exkrementalen Stoffe fortzuräumen. Mit unglaublicher Sicherheit wissen sie jeden Mist aufzufinden und fliegen auf ihn zu.«
»Pfui, Spinne,« sprach er dann und spie eins dieser witzigen Insekten, das ihm in den stets offenen Mund geflogen war, in die Landschaft, und fuhr darauf fort: »Bemerken Sie diese Lerche da?« Ich bemerkte sie. »Dieselbe hat einen anderen Gesang als die Bachstelze, die überhaupt keinen hat, und diese einen anderen als der Hänfling; das ist deswegen so, damit die Arten sich zusammenfinden, sonst würde es ein heilloses Durcheinander geben.«
Entrüstet runzelte er die Stirne, denn besagte Lerche sang eben genau wie ein Hänfling, lockte dann wie eine Bachstelze, schlug darauf wie eine Wachtel, pfiff alsdann wie ein Star und schwirrte zuletzt wie ein Grünfink. »Was sagen Sie dazu?« fragte ich Meyern. Er schwieg verletzt.
Als sich aber im weiteren Verfolg unserer Wanderung eine Haubenlerche auf einem Stück Ödland niederließ, erhellten sich seine finsteren Züge: »Bemerken Sie den Vogel?« fragte er. Ich bemerkte ihn. »Er ist genau so grau gefärbt wie der Erdboden und dadurch vor den Nachstellungen seitens der Raubvögel völlig geschützt.«
Ein Sperbermännchen, das hinter einer krüppeligen Föhre hervorkam, war gegenteiliger Ansicht und bewies sie dadurch, daß es mit der Lerche in den Klauen abging und Meyer mit seiner Theorie aussitzen ließ. Ich grinste in mich hinein und gab Meyer die dritte Zigarre.
Als wir den Wald betraten, wies Meyer mir überzeugend nach, daß die Koniferen, also Nadelhölzer, aus Gründen der Zweckmäßigkeit Sommer und Winter die Nadeln behielten, was die Laubhölzer nicht könnten, einmal, weil sie keine Nadeln hätten, und dann überhaupt und so. Ich fragte ihn darauf, ob die Natur dazu da sei, um von dem Menschen erklärt zu werden, was er als selbstverständlich bezeichnete, und dann fragte ich ihn, warum die drei Lärchen auf der Lichtung, die doch auch Koniferen wären, ihre Nadeln abwürfen, worauf Meyer zu etwas anderem überging.
»Sehen Sie,« sagte er, indem er sich Nacken, Hals und Backen kratzte, »die Mücken, die sind so lästig, und es könnte scheinen, als sei hierin die Natur nicht zweckmäßig. Aber bedenken Sie, wovon sollten sie Vögel leben, wenn die Mücken nicht wären? Und stechen tun nur die Weibchen, die Männchen nicht, weil sie keine Eier zu legen brauchen, und so zeigt sich wieder die absolute Zweckmäßigkeit der Natur.«
»Die Hühner legen auch Eier,« wandte ich schüchtern ein, »sie stechen aber nicht; wie erklären Sie das?« Er verzichtete darauf und lenkte meine Aufmerksamkeit auf einige kleine Trichter in dem grauen Bleisande: »Darin sitzt die Larve des Ameisenlöwen. Sie baut sich diesen Trichter und frißt die Ameisen, die da hineinfallen. Das ist doch wieder überaus zweckmäßig.«
Da ich mit Erbitterung bemerkte, daß seine Zigarre sich wieder ihrem kurzen Ende zuneigte, stimmte ich nicht ohne weiteres bei, sondern meinte: »Es wäre doch viel einfacher, wenn die Larve es so machte, wie Mohammed es tat, als der Berg es nicht tun wollte. Ich fände das zweckmäßiger und einfacher.«
Meyer antwortete nicht, sondern fuhr mit der Hand durch die Atmosphäre und zeigte mir auf ihrer Innenfläche ein schwarzes Ding, das dünn und lang war und alle Augenblicke in die Höhe schnellte und ebenso oft wieder auf Meyers Handfläche zurückfiel. »Ein Schnellkäfer ist es, ein Elater. Die Natur hat ihm die Gabe verliehen, sich emporzuschnellen, damit er dadurch seinen Feinden, die dieser Vorgang verblüfft, entgehen kann,« belehrte er mich, und dann warf er den Käfer auf den Weg. Dort hopfte das Insekt so lange herum, bis eine Kohlmeise darauf aufmerksam wurde, es ergriff und verzehrte, was Meyer als mit seinen Ausführungen wenig übereinstimmend mißbilligte.
Eine Eidechse, die über den Weg lief, brachte ihn aber wieder auf frohe Gedanken. Er griff zu, erwischte sie beim Schwänze, dieser brach ab, und das um die Hälfte verkürzte Reptil verschwand in den Bickbeerbüschen, während das Schwänzchen in Meyers Hand zurückblieb und sich so aufgeregt benahm, als habe es eine dringende Verabredung mit seiner besseren Hälfte.
Meyer schleuderte strahlenden Auges das Schwänzchen beiseite und sprach: »Wäre ich ein Raubvogel und hätte der Schwanz der Eidechse nicht die Einrichtung, abzufallen, wenn sie fest daran faßt, so wäre die Eidechse um ihr Leben gekommen. So aber ist sie gerettet; der Schwanz wächst nach, wenn er auch nie die ursprüngliche Länge erreicht. Ungemein zweckmäßig, nicht wahr?«
Ich konnte dem nicht beistimmen, zumal er mich um eine neue Zigarre ersuchte, weil die zweckmäßigen Mücken so lästig wären, sondern ich meinte: »Wenn sie überhaupt keinen Schwanz hätte, stände sie sich noch besser.« Da Meyer gerade noch meine, jetzt seine Zigarre ansteckte, hatte er keine Zeit, zu antworten, und da wir mittlerweile aus der gedankenbelebenden Kühle des Waldes in das freie Feld und in die Sonne kamen und Meyers Havelock und Lodenhut sich als eine von der Natur unzweckmäßig eingerichtete Körperbedeckung erwiesen hatte, so schwieg er, bis er im Dorfe zwei Butterbrote mit Harzkäse und zwei Weißen binnen hatte, worauf er wieder zu seiner Zweckmäßigkeitstheorie zurückkam, nachdem er mir meine letzte Zigarre, seine fünfte, abgenommen hatte.
»Bemerken Sie, lieber Freund, dort oben in dem Baum die Mistel, den Schmarotzerstrauch?« Ich bemerkte sie. »Dieselbe hat weiße Beeren, deren Kerne ein klebriger Schleim umhüllt. Die Misteldrossel frißt nun die Beeren, verdaut aber nur das Fleisch, nicht den Kern mit der klebriger Masse. Mit ihren Exkrementen fällt nun die Beere auf den Ast und keimt dort. Finden Sie nicht, wie höchst zweckmäßig das ist?«
Da ich keine Zigarre mehr besaß, war ich in oppositioneller Stimmung: »Ich finde das durchaus nicht,« Sagte ich; »die Misteldrossel ist in meinen Augen ein Rindvieh. Denn warum frißt sie erstens die Beeren, aus deren Schleim man Vogelleim kocht, und wenn schon, warum setzt sie die Kerne nicht auf der Erde ab, wo sie nicht blühen, wachsen und gedeihen können, sondern mit Gewalt auf Bäumen, wodurch sie dem Strauch Gelegenheit gibt, zu keimen, so daß der Mensch wieder Vogelleim kochen kann, womit er die Drossel fängt?«
In diesem Augenblick huschte eine Waldmaus bei uns her und überhob Meyer der Antwort. »Haben Sie die Maus bemerkt?« Ich hatte es. »Wie unzweckmäßig erscheint auf den ersten Augenblick der lange Schwanz. Aber schneiden Sie ihn ab, und die Maus ist nicht mehr imstande, so geschickt zu laufen, weil sie sich nicht mehr im Besitze des für die Entwicklung einer größeren Schnelligkeit nötigen Gleichgewichtes befindet. Ist das nicht überaus zweckmäßig?«
Ich wollte zwar einwenden, daß ich es durchaus nicht zweckmäßig hielte, einer Maus den Schwanz abzuschneiden, um dessen Zweckmäßigkeit zu beweisen, aber Meyer bemerkte gerade, daß es sieben sei, und um acht müßte er zu Hause sein. Er verschob daher weitere Erörterungen auf das nächste Mal. Ich freue mich schon darauf.
Ein Liebeslied
Vor meinen Fenster sitzt ein Spatz und sagt in einem Ende: »Schilp, schilp, schilp, schilp.« Zweimal habe ich ihn schon fortgejagt, denn das ewige Geschilpe und Geschelpe störte mich; aber er kommt immer wieder und sagt das einzige Lied, das er auswendig kann, auf.
Gestern war er auch schon da und vorgestern desgleichen, und morgen wird er ebenfalls da sein und übermorgen erst recht, und er wird da sitzen und schilpen den einen wie den anderen Tag, bis er seinen Zweck erreicht hat und eine Spatzenfrau sein eigen nennt.
Denn darauf läuft die ganze Geschichte hinaus. Mit Speck fängt man Mäuse und mit Schilp und Schelp Spatzenfrauen. Man sollte es nicht glauben, aber es ist so. Diesen beiden langweiligen und keineswegs stimmungsvollen Tönen kann auf die Dauer kein Spatzenweibchen widerstehen.
Ich weiß nicht, ob ein Buch über das Liebeslied gibt; aber ich weiß, wenn es geschrieben wird, so muß es mit Schilp und Schelp beginnen, will es Anspruch auf Gründlichkeit machen. Wenn es mit dem Gesang der Nachtigall anfängt, so beweist der Verfasser, daß er keine Ahnung von dem Wesen des Liebesliedes hat, daß er von persönlichen Empfindungen und nicht von allgemeinen Gesichtspunkten ausgeht.
Denn der Begriff des Liebeslied hat mit Schönheit, Kunst und Ästhetik nicht das mindeste zu tun. Sänge mein Fensterspatz wie eine Nachtigall, eine Lerche oder eine Märzdrossel, wetten, daß er eine vollkommene Pleite erleben würde? Daß er bei keiner Spatzenjungfer auch nur für fünf Pfennige Eindruck schinden würde? Daß er sich vielmehr im höchsten Maße lächerlich, wenn nicht sogar in weiteren Kreisen unbeliebt machen würde? Vielleicht für übergeschnappt erklärt und weggebissen, oder gar wegen unspatzigen Auftretens vom Leben und Tode gebracht würde? Dasselbe würde natürlich eintreten, gäben Nachtigall, Rotkehlchen und Märzdrossel ihren Gefühlen auf spatzenhafte Weise Ausdruck. Wenn der betreffende Nachtigall-, Rotkehlchen- und Märzdrosselhahn auch sonst nach jeder Hinsicht ein Prachtexemplar seiner Art wäre, sein Lebelang bliebe er Junggeselle. Horch, was ist denn das da draußen? »Pink, ping, pink, ping, pink, ping« geht es. Das ist die Kohlmeise. Dieweil die Sonne so schön scheint, kommt sie jetzt schon auf Frühlingsgedanken und verabsäumt es nicht, ihnen auf ihre Art lauten Ausdruck zu geben. Und was fällt der Krähe denn da auf dem Dachfirste ein? Die stellt sich gerade so an, als ob sie etwas sehr Unbekömmliches gegessen hätte und ihr infolgedessen zum Sterben übel geworden wäre. Der Zweck dieser seltsamen Übung ist nun etwa nicht eine Regelung der Verdauungsverhältnisse, sondern ihr liegt die Absicht zugrunde, dadurch zu näherer Verbindung mit einer gleichgestimmten, aber weiblichen Seele derselben Art zu gelangen, ein Bestreben, das, wie ich bemerkte, des Erfolges nicht entbehren wird, denn auf dem anderen Ende des Daches läßt sich soeben eine zweite Krähe nieder, die mit viel Gefühl und Verständnis die schnurrige und nach menschlichen Begriffen keineswegs wohllautende Huldigung entgegenzunehmen geruht.
Wie die Sonne doch schon heizt! Ich muß wahrhaftig das Fenster öffnen. Sieh da, sieh da! Da ist ja auch schon ein Starmatz! Stellt der sich aber blödsinnig an! Plustert die Kehle auf, klappt mit den Flügeln und gibt Töne von sich, die einem durch Mark und Bein gehen, und die, horcht man genauer darauf, im Grunde wenig angenehm klingen und bald an das Quietschen einer schlecht geschmierten Schiebkarre, bald an das Knarren einer verrosteten Wetterfahne erinnern, ihren Zweck aber vollkommen erfüllen, denn auf dem Nistekasten sitzt die Starin und tut furchtbar geschmeichelt. Sie tut aber nicht bloß so, sie ist es auch, denn Schiebkarre hin, Wetterfahne her, gerade die Töne, die ihr blitzblanker Anbeter von sich gibt, sind die einzigen, bei der es ihr warm unter dem Brustlatz wird. Heute nacht, als ich gerade so im mittelsten und besten Schlafe war, träumte ich, ich hätte mich im indischen Dschungel verlaufen, die Nacht brach herein, und ich kletterte auf einen hohen Baum und lauschte zitternd und zagend und zähneklappernd dem Quarren der Panther und dem Gekreische der Pfauen. Da mir die Lage, in der ich mich befand, zu ungemütlich war, beschloß ich aufzuwachen, was mir auch nach einigen Bemühungen gelang, aber das Quarren und Kreischen hörte darum doch nicht auf, im Gegenteil, es nahm an Umfang und Stärke zu. Die Veranstaltung ging von zwei Katern aus, die eine Katze, die in dem alten Birnenbaume saß, wie ich bei dem hellen Mondlichte feststellen konnte, auf diese Weise zu verstehen gaben, wie reizendschön sie sie fänden. Als das Doppelständchen sich gerade auf dem Höhepunkt befand, wurde im Nachbarhause ein Fenster geöffnet und eine Kanne Wasser auf die verliebten Katzentiere entleert, worauf der Lärm aufhörte, um im nächsten Garten sofort wieder zu beginnen. Da ich nicht sofort das abgerissene Ende meines Schlummers wiederfinden konnte, dachte ich über das Liebeslied eines vor einigen Hunderten Jahren aus diesem Leben geschiedenen Arabers nach, der bei der Aufzählung der Reize seiner Angebeteten besonders erwähnt, daß ihr Gang dem eines Dromedars ähnele, daß ihre Augen an die einer Eselin erinnern, wie köstlich die Schweißtropfen auf ihrem Halse wirkten, sowie daß der Knoblauchduft ihres Atems alle Düfte der Blumen übertreffe, und ich dachte mir, was wohl ein junges Mädchen unserer Art sagen würde, fange man sie auf diese Weise an. Aber als fachlich und allgemein denkender Mensch fragte ich mich auch, was die betreffende Arabermaid wohl für runde Augen gemacht haben würde, stülpte einer von den Dichtern unserer Tage einem gehäuften Verskorb mit schöngebundenen Gefühlen vor ihr aus, und ich konnte mich der Annahme nicht verschließen, daß der Erfolg mindestens recht mäßig ausgefallen würde.
Es gibt ein uraltes Sprichwort, so da lautet: »Jedes Tierchen hat sein Pläsierchen.« Wie wahr ist es! Und wie wenig denkt der Mensch daran, führt er seine Gedanken in der Natur spazieren. Weil er den Gesang der Nachtigall schön findet, so erklärt er ihn schön, ohne aber den Beweis dafür zu erbringen, daß er nun auch wirklich schön ist. Und warum hält er ihn für schön, obwohl die Nachtigall glucksende, schnarrende und quiekende Töne neben ihrem Geflöte von sich gibt und fortwährend große Pausen macht? Nur weil sie gewisse Flötentöne hervorbringt, die denen, die der Mensch selber pfeifen kann, ähneln. Und da Amsel und Märzdrossel in ähnlicher Weise pfeifen, so steht es für ihn fest, daß diese Vögel Singvögel sind. Heult aber der Waldkauz noch so zärtlich, röchelt die Schleiereule noch so süß, brüllt die Dommel noch so ergreifend, so bedeckt sich der Mensch mit einer Gänsehaut und erklärt diese Laute für ungebildet, störend und unziemlich, und nur deshalb, weil er eine zu unbiegsame Stimme hat, um sie nachahmen zu können. Aber sich hinzusetzen, nachzudenken und zu dem Ergebnisse zu kommen, daß Waldkauz, Schleiereule und Dommel sich nicht nur in ihren, sondern auch in weiteren Kreisen unsterblich lächerlich machen würden, gäben sie ihrer Liebessehnsucht nach Art der Nachtigallen, Amseln und Märzdrosseln Ausdruck, das fällt ihm in seiner Eingebildetheit nicht ein.
Es ist ein wahrer Segen, daß der Weltenschöpfer die Beschaffung von Tieren nicht in die Hand des Menschen gelegt hat, denn es wäre ein schöner Blödsinn dabei herausgekommen, weil der Mensch dann lauter Vögel erfunden hätte, die so pfeifen, wie ihm selber der Schnabel gewachsen ist, und das wäre nicht zum Aushalten, sonder zum Auswachsen gewesen. Glauben Sie, daß er auf den Gedanken gekommen wäre, dem Specht das Trommeln beizubringen? Ich nicht! Wahrscheinlich hätte er ihn gezwungen, wie ein Schusterjunge oder ein Scherenschleifer zu flöten, und nun denken Sie sich bloß einmal einen flötenden Specht! Ebensogut können Sie sich ein nach Veilchen duftendes Automobil oder einen Vanilleeis essenden Eskimo einbilden. Oder stellen Sie sich bitte einmal vor, wie es sich machen würde, schlüge der Storch wie eine Nachtigall oder zwitscherte die Gans wie ein Stieglitz! Und denken Sie sich, wie langweilig und stumpfsinnig die Natur wäre, wären alle Vogellieder nach den Gesetzen des Kontrapunktes komponiert und jeder Piepmatz, vom Adler bis zum Zaunkönig, würde richtige Melodien verzapfen oder womöglich moderne Programmusik, bei der man sich etwas Bestimmtes denken kann, wenn man will, oder muß, wenn man nicht will! Zum Verrücktwerden wäre das.
Im zoologischen Garten zu Hannover ist ein australischer Flötenvogel, der pfeift von früh bis spät das Lied: »Lott ist tot.« Sein früherer Wärter hat es ihm beigebracht, und der Mann war sehr stolz darauf. Aber nach einem Vierteljahre hatte er genug davon. Wo er ging und stand, hörte er nichts und weiter nichts als: »Lott ist tot, Lott ist tot, Jule liegt im Sterben; das ist gut, das ist gut, gibt es was zu erben.« Alles, was er tat, ob er die Vögel fütterte oder sich selber, ob er sich die Nase oder die Fensterscheiben putzte, bewerkstelligte er nach dem Takte von »Lott ist tot«, sogar einen Lottisttotgang hatte er sich angewöhnt. Schließlich hielt er es nicht mehr aus und ließ sich zu den Löwen versetzen, um einmal etwas anderes zu hören. Aber es kam ihm so vor, als ob auch die Löwen »Lott ist tot« brüllten, und so blieb ihm, um nicht irrsinnig zu werden, nichts übrig, als seine Stelle aufgeben und Straßenbahnführer zu werden. Aber wenn er klingelt, hört man noch ganz deutlich das »Lott ist tot« heraus.
So und nicht anders würde es uns auch gegangen sein, hätten wir darüber zu befinden gehabt, wie jeder Vogel singen soll; wir wären alle miteinander mit erblicher Verrücktheit belastet und hätten wahrscheinlich sämtliche Vögel mit Feuer und Schwert vertilgt. Und deshalb will es mir so scheinen, als ob die Vogelschutzvereine nicht ganz auf dem richtigen Wege sind, denn die teilen die Vögel in zwei Gruppen ein, in Singvögel und in solche, die nicht singen, und die einen fördern sie nach der Schwierigkeit, wogegen sie sich um die anderen entweder gar nicht kümmern oder die, die sich ab und zu einmal einen Singvogel zu Gemüte führen, auf die schwarze Liste setzen und mit Mord und Totschlag bedrohen.
Daß aber ein jeder Vogel singt, und daß jeder nicht so singen kann, wie es von den Vogelschutzvereinen als vorschriftsmäßig und angemessen erachtet wird, daran wird nicht gedacht, und wenn ein Häher einmal einen jungen Spatzen oder eine Elster eine junge Lerche mit nach Hause nimmt, dann ist das Geschrei sehr groß, obwohl es mehr Spatzen als nötig gibt und die Lerche der allerhäufigste Vogel ist. Und dabei weiß der Häher, zwickt ihn die Liebe, ganz allerliebst zu singen, und die Elster, befindet sie sich in demselben Zustande, drückt sich so aus, daß die Elsterin das für die Höhe aller Liebeslyrik erachtet, und ich muß sagen, das verliebte Geplauder des Hähers und das noch verliebtere Geplapper der Elster höre ich lieber als das ewige und ewige Geflöte der Amsel und das unaufhörliche Gepfeife des Stares, zweier Vögel, die von den Vogelschutzvereinen im Großbetrieb gezüchtet werden, so daß jetzt auf jedem Baum mindestens eine Amsel und auf jeden Dach wenigstens drei Starmätze sitzen, was mir schon lange nicht mehr paßt, denn ich schätze die Abwechslung und mag nicht immerzu und überall Amselgeflöte und Starengepfeife anhören, denn das kann ich schon mehr als auswendig und bin dessen überdrüssig.
So überdrüssig, daß es für mich eine Erholung ist, höre ich die Katzen quarren und die Eulen heulen, und während mich die Liebeslieder von Star und Amsel kalt bis an den Kragen lassen, wird mir das Herz dicker, höre ich im Teiche die Frösche prahlen oder im Moore die Nachtschwalbe schnarren. Und wenn die Bekassine ihre Schwanzfeder als Kastagnetten benutzt, um ihrem Weibchen ihre Gefühle darzulegen, wenn der Birkhahn zischt wie ein Luftreifen, der sich einen Hufnagel eingetreten hat, um die Birkhenne seiner Verehrung zu versichern, wenn der Ringeltäuber zu diesem Behufe sich auf die Bauchrednerei verlegt und der Specht zu demselben Endzwecke wie ein Hosenmatz darauf losschlägt, dem der Weihnachtsmann soeben die erste Trommel gebracht hat, und der Bussard wie eine junge Katze schreit und der Storch wie eine Kaffeemühle rattert, oder der Rohrspatz den Strolch nachäfft und der Schwirrl der Heuschrecke, dann stelle ich mich nicht hin und sage: »Gut!« oder »Befriedigend!« oder »Ausreichend!« oder »Ungenügend!«, denn ich bin nicht im Vogelschutzverein und darum nicht auf eine bestimmte Art von Vogelmusik geeicht, sondern ich freue mich, daß jedes Tierchen seine eigene Art hat, sich lyrisch auszudrücken.
Deshalb will ich den Spatzen vor meinem Fenster nicht fortjagen, sondern ihm eine Handvoll Hanfkörner hinstreuen.
Der Spatz ist keine Nachtigall, aber Schilpschelp ist ein Liebeslied.
Frühlingsprobe
Ein Silberglöckchen klingt durch den Wald. Die Kohlmeiße läutet es. Sie sitzt auf dem Buchenzweig, in den Krallen eine dicke fette Spinne, und singt: »Spinn dicke, spinn dicke; de düre Tid is vorbei!«
Die Frau, die den Berg herunterkommt, denkt an ihre Mädchenzeit, »Spinn lütting, spinn lütting!« so hatten die Mädchen das Lied der Meise im Winter ausgelegt, und sie zogen den Faden dünn und fein vom Wocken.
Aber wenn die Schnee wegging und die Meise fröhlicher im Apfelbaum sang, dann ließen die Mädchen den Flachs dicker durch die Finger laufen, denn draußen sang der bunte Vogel: »Spinn dicke, spinn dicke!«
»Hähähä.« Die Meise lacht heiser, denn sie hat gehört, was die Frau ihrem kleinen Mädchen erzählte. »Hähähä.« Sie hat sich nie darum gekümmert, ob die Mädchen fein oder grob spannen, sie hat nur eine Bemerkung über die Beschaffenheit der Spinnen gemacht, die sie fing. Und weil sie heute eine dicke fing, darum klingt ihr Lied wie ein Silberglöckchen so lustig.
Der Haselbusch hat es gehört, und seine gelben Troddeln läuten im Takte mit. Ganz leise läuten sie; ein Mensch kann es nicht hören. Aber die kleinen pummelingen Haselweibchen hören es; schnell putzen sie sich mit drei rubinroten Federchen, die so zart und so dünn wie ein Seidenfaden sind.
Die Meise fliegt weiter und läutet ihr Glöckchen vom Dache der Gastwirtschaft. Dreimal ruft sie: »Titüdel, titüdel, titüdel!« Da klappt der Hahn im Hof mit den Flügeln, reißt den Hals auf und kräht, kräht ganz anders als sonst, mit weniger Stolz und mehr Gefühl in der Stimme.
Auch die Spatzen, die bis dahin ewig und immer dasselbe zweistimmige Lied geschilpt hatten, kommen bei dem Geläute des Glöckchen außer Rand und Band. Ein ganzer Haufen der grauen Kerle schnurrt lärmend unter das Fenster der Veranda; sechs Herren sind es und eine Madam. Die dreht sich fortwährend um ihre Perpendikulärachse, und die Herren Männer hopsen wie verdreht um sie herum, machen ein furchtbares Getöse und plustern plötzlich wieder fort, um auf dem Rasen weiterzutanzen.
Sogar die melancholische Haubenlerche, die den ganzen Winter bis zur Langweiligkeit wimmerte; »I wie mich friert!« versteigt sich zu einer kühnen Tat. Sie schwingt sich auf den Kehrichthaufen am Wege und zwitschert von diesem erhabenen Standpunkt ein zwar sehr dünnes, aber wegen seiner Unaufdringlichkeit immerhin ganz leidliches Liedchen. Das weckt bei der Amsel, die eben noch im faulen Laub einen Regenwurm mit sanfter Überredung aus seinem Loche hervorholte, gelben Neid und schwarze Eifersucht. »Igittigittigitt!« ruft sie der Haubenlerche zu, und fängt nun selbst an. »Tü!« Pause. »Rü!« Pause, »Lü!« Pause. Und dann eine Zehnminutenpause. Und dann wieder: »Tü!« Pause. »Rü!« Pause. »Lü!« Pause. Und endlich: »Türü!« Aber weiter geht es noch nicht, und erst, nachdem sie lange nachdenklich gegen den Himmel geguckt hat, wobei sie ganz begossen den Schwanz hängen läßt, wippt sie mit ihm, zum Zeichen, daß sie sich auf die vergessene Melodie wieder besonnen hat, und bringt es mit viel Ach und Weh endlich zu einem nur eine halbe Minute beanspruchenden »Tü-rü-lü!« und leistet sich darauf hochbefriedigt einen zweiten Regenwurm.
Kaum hat sie ihren Sitz im Faulbaumbusch verlassen, da treibt das Volk unter ihr Unfug. Quiekend jagen sich da zwei fuchsige Waldmäuse mit äußerst langen Schwänzen. Jetzt sitzen sie sich gegenüber und gucken sich mit ihren großen schönen schwarzen Augen lustig an. Dann macht der Mäuserich einen Hops, und die Mäuseline witscht nach der Seite, und mit Gequieke und Gekicher geht es dahin, daß ein Zaunkönig ganz erschrocken von seiner wissenschaftlichen Untersuchung einer ihm unbekannt vorkommenden Mücke aufschreckt, auf einem Buchenstrumpf hüpft und von da herunter mit schnarrendem Gardeton seiner inneren Entrüstung lauten Ausdruck verleiht.
Eigentlich hatte er vor, von drei bis vier Uhr zu singen; aber da die anderen alle singen, verzichtet er zugunsten seiner Gegner nach dem Motto: »Wenn alles singt, mag Karl allein nicht singen.« So ist er immer, und darum hat er wenig Verkehr, denn kein Vogel mag mit einem anderen umgehen, der im Winter, wenn alle die Schwänze hängen lassen, den seinigen so hoch trägt, als wäre er mit Bartwische gesalbt, und der, wenn die anderen vor Hunger kaum »Piep« sagen mögen, so fidel singt, als äße er jeden Tag dreimal warm.
Da ist die Fledermaus, die eigentlich gar kein richtiger Vogel ist, viel taktvoller; sie paßt sich der allgemeinen Sitte trotz ihres Mangels an Federn an und sagt keinen Ton. Vom November an hat sie unter den Dachsparren gehangen mit dem Kopfe nach unten. Auf einmal wacht sie auf, krabbelt, soweit es ihr ihre eingeschlafenen Fußflügel oder Flügelfüße erlauben, bis an die Dachlucke, läßt sich herausplumpsen und taumelt in einer so seltsamen Weise im Garten herum, daß die Spatzen, diese Klatschschnäbel, behaupten, sie hätte in unmäßiger Weise dem Genuß geistiger Getränke gehuldigt. Und dabei hat sie nur von dem langen Hängen mit dem Kopfe nach dem Erdinnern Blutandrang zum Gehirn bekommen.
Es ist aber auch möglich, daß sie taumelig fliegt, weil sie etwas schwach auf den Flügeln ist, denn seit Anfang Herbst hat sie keine warme Mücke mehr im Leibe gehabt und ist sehr von Kräften gekommen. Mißmutig zwitschernd zickzackt sie im Garten herum, so daß ein junges Mädchen schon ein Attentat auf ihr reizend hellblond gefärbtes Wuschelhaar vermutet und quietschend in das Haus flüchtet. Die arme Speckmaus aber erwischt schließlich noch eine Motte, die langsam und plump durch den Garten flatterte. Aber da sie sich als besonnenes Wesen sagt: »Eine Motte macht noch keinen Frühling!«, es ihr auch noch zu hell ist, so schlüpft sie wieder in die Luke, hängt sich kopfüber an den Dachsparren, wickelt sich die Flügel um den Leib und träumt von besseren Zeiten, in denen das Ungeziefer billiger ist.
Mit ähnlichen Hoffungsträumen tröstet sich auch die Wasserspitzmaus, die da am Graben herumhuscht, über die magere Zeit hinweg. Sie schnüffelt hier, sie schnüffelt da, und quietscht ärgerlich dabei, denn ihr hin- und herzuckendes Rüsselchen trifft nichts als mulmiges Holz und modriges Laub. Kurz entschlossen stürzt sie sich in eine Pfütze, so daß ein Buchfink, der da eben ein Bad genommen hatte, ängstlich lockend auffliegt, denn er glaubt, sie habe im Hungerwahnsinn Selbstmord verübt. Er macht aber große Augen, wie er sieht, daß sie ganz vergnügt unter Wasser herumläuft, wobei sie wie ein Stück Quecksilber aussieht. Dann taucht sie wieder auf und verschwindet in einem Moosloch.
Der Buchfink aber lockt. Er ist Strohwitwer; seine Frau kann das Klima hier nicht vertragen, sagt sie, und reist darum jeden Herbst nach Italien und Ägypten. Anfangs paßte ihm das gar nicht, und er machte ihr in jedem April schreckliche Eifersuchtsszenen, weil er annahm, daß sie sich da unten im Süden von irgendeinem leichtsinnigen jungen Hahn mehr den Hof machen ließ, als sich das für eine verheiratete Frau schickt. Schließlich aber gewöhnte er sich daran, wenn er auch jeden Herbst über die teure Reise knurrt. Aber in innerster Seele beneidet er den Goldammerhahn, dessen Frau nie verreist, und den Ringeltäuber, dessen Gattin auch hier blieb, als ihr Mann ihr erklärte, die Reise sei ihm zu weit, obgleich es ihr nicht gleichgültig ist, von den Turteltauben sich vorprahlen zu lassen, wie schön es in Ägypten gewesen sei, und sich teilnehmend fragen zu lasse, ob die Kinder dieses Jahr so viel gekostet hätten, daß es zur Mittelmeerfahrt nicht mehr langte.
Wieder bimmelt die Kohlmeise ihr Glöckchen. Ein dicker Kauz, der eng an der Stamm einer Tanne gedrückt dasitzt und über den auffallenden Mangel an Mäusen in diesen Jahre nachdenkt, der mit seinen Erhebungen über den Reichtum an Nüssen in keinen Zusammenhang zu bringen ist, wackelt mit dem Kopfe unwillig hin und her, denn er weiß, entdeckt ihn der bunte Vogel, dann hat er eine Stunde lang die Gesellschaft am Halse und muß sich die gemeinsten Redensarten gefallen lassen.
Aber es wird ihm sehr schwer, still zu sitzen, und sobald es dämmert und die Menschen das Waldwirtshaus verlassen, da drängt es ihn, dumpf aufzuheulen und gellend loszulachen, daß den paar Mäusen, die der Winter am Leben gelassen hat, die kalte Angst über das Fell läuft.
Und als der Dickkopf zum dritten Male gerufen hat, da kommt lautlos ein zweiter Schatten näher, die Käuzin. Und nun jagen sich die beiden im dunklen Walde, knappen mit den Schnäbeln, kreischen und schreien, als zöge man ihnen jede Feder einzeln aus. »Huh, wie schauerlich!« ruft ein Mädchen, das am Arme ihres Auserkorenen nach Hause geht; dann lacht sie laut auf über einen Witz ihres Begleiters, und darauf singen beide ein Frühlingslied.
Die Kauzin aber fragt zu den Kauz: »Nein, was diese Menschen doch für häßliche Stimmen haben! Das soll nun ein Frühlingslied sein! Dummes Volk!«
Und der Kauz fühlte sich geschmeichelt und singt dem kommenden Vorfrühling ein Lied nach Eulenart.
Billiger Sonntag
»Nun, wie befinden sie sich, Verehrtester?« fragte der alte Marabu seinen Nachbarn, den Jabiru. Der Marabu hatte sich schon eine ganze Weile die warme Morgensonne auf die ehrwürdige Senatorenglatze scheinen lassen und wieder, wie jeden Morgen, darüber nachgedacht, auf welche Weise er wohl am besten die frechen Spatzen bei seinem Freßnapf erwischen könnte, selbstverständlich ohne daß er sich dabei seiner Würde begäbe. Als der lange afrikanische Storch aus seinem Käfig humpelte, machte er ihm eine tiefe Verbeugung und richtete teilnahmsvoll und höflich die übliche Frage an ihn.
Der Jaribu lächelte süßsauer und humpelte näher: »Morgen, mein Lieber. Mir geht es nicht gerade erstklassig. Das verdammte Podagra!« Und damit hob er den geschwollenen rechten Fuß hoch und zeigte ihn dem Marabu. »Ja ja,« lächelte der, »so was kommt von so was! Fortgesetzter Lebenswandel, mein Bester! Die noblen Passiönchen, hehehe! Das rächt sich später. Bohnenabkochung soll dafür sehr gut sein; von Vietsbohnen, wissen Sie«