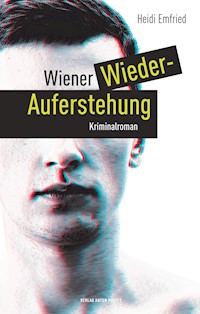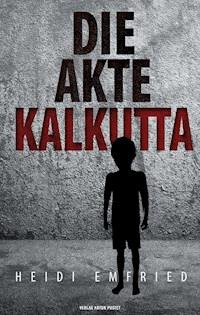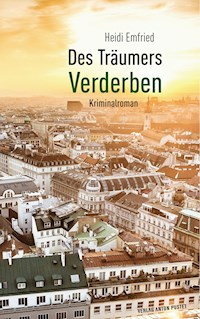
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Anton Pustet
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wo viel Licht ist, ist viel Schatten Der ebenso impulsive wie erfolgreiche Wiener Unternehmer Mathieu Rassling ist es gewöhnt, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Radikale Veränderungen machen ihm keine Angst, weder in seinem Liebesleben noch beruflich. An einem Sommerabend ermordet in der Tiefgarage eines Hotels aufgefunden zu werden, gehörte allerdings nicht zu seinen Plänen. Chefinspektor Leo Lang und sein Team sehen sich mit dem facettenreichen Umfeld des Industriellen konfrontiert, aus dem sich manches Mordmotiv ableiten ließe, schließlich ist viel Geld im Spiel. Die minutiöse Auswertung der Spuren führt zunächst ohne Ergebnis zu Technikfreaks, Wiener Lokalpolitikern, einer Geliebten, Mitarbeitern der Firma und zu seiner Familie. Wenig hilfreich ist die Personalknappheit im Team, auch wenn Langs Vorgesetzter eine Soziologiestudentin als Praktikantin organisiert. Ihre Meinung: "Dieser ganze Fall ist ein Paradebeispiel für die Auswirkungen des Patriarchats!" Ob sie recht hat? Die Wahrheit, die Lang mit seinem Team schließlich ans Licht bringt, zeigt ihm die Grenzen seines Wirkens auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2020 Verlag Anton Pustet5020 Salzburg, Bergstraße 12Sämtliche Rechte vorbehalten.
Lektorat: Beatrix BinderGrafik und Produktion: Nadine Kaschnig-LöbelCoverfoto: Calin Stan/shutterstock.com
eISBN 978-3-7025-8072-8Auch als gedrucktes Buch erhältlich,ISBN 978-3-7025-0968-2
www.pustet.at
Heidi Emfried
Des TräumersVerderben
Kriminalroman
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Glossar
Personenverzeichnis
Über die Autorin
Prolog
Ende OktoberSIE
Sie liebte es, mit dem Zug zu fahren.
Das Gleichmäßige, Meditative, Passive, Untätige, das Sich-schaukeln-Lassen, das Altmodische. Das Vorbeiziehen der Landschaft, der entlarvend hässlichen, bahnseitigen Hinterhöfe der Häuser an der Strecke, für die sich eine Behübschung nicht lohnte. Die Bahnübergänge, vor denen Reihen von Autos standen, deren Fahrer ungeduldig warteten, ihre Reise fortsetzen zu können, und froh waren, dass der Zug endlich durchfuhr.
Doch am meisten liebte sie die Anwesenheit der Mitreisenden. Dabei war es am wenigsten die Aussicht auf interessante Gespräche, die ihre Neigung beflügelte. Gerade die Mitteilsamen erwiesen sich häufig als langweilig und oberflächlich. Mit ihrem belanglosen Geschnatter zerstörten sie den Zauber, der der Bahnfahrt innewohnte – das Mysterium.
Denn das war es, was sie faszinierte. Das Geheimnis, das die Mitreisenden umgab, die Tatsache, dass man sich in Begleitung von Menschen befand, die man nicht kannte, von denen man nichts wusste. Über die man folglich seine Fantasie völlig ungehindert spielen lassen konnte. Die man je nach Art des Waggons mehr oder weniger ungeniert beobachten konnte, um ihnen die ausgefallensten Geschichten anzudichten. Was sie vor der Zugfahrt getan hatten und nach dem Aussteigen tun würden. Womit sie ihren Lebensunterhalt verdienten, wen sie liebten und hassten, wie sie ihre Freizeit verbrachten. Das Spiel funktionierte immer noch, auch wenn es zunehmend durch lautstarke Handytelefonate und die gebeugten Köpfe der Smartphone- und Tablet-Wischer gestört wurde.
Am besten und unverschämtesten konnte man sie beobachten, wenn es, so wie jetzt, draußen dunkel war. Dann wirkten die großen Fenster wie Spiegel, in denen sich der ganze Innenraum des Waggons glasklar abzeichnete. Sie hielt den Kopf gewöhnlich von den Mitreisenden abgewandt, scheinbar ziellos ins Dunkel starrend – das täuschte den Arglosen tatsächlich ein Unbeobachtet-Sein vor, das sie zu Präparaten unter ihrem Mikroskop machte. Keiner schien jemals die gleiche Idee zu haben wie sie. Niemand anderer als sie nutzte den Spiegel. Kein Blick eines Gleichgesinnten begegnete dem ihren dort.
Doch die heutige Fahrt würde wenig ergiebig sein, obwohl es schon völlig dunkel war. Es waren altmodische Nachtzug-Abteilwägen mit Vorhang zum Gang eingesetzt worden – vermutlich wegen irgendeines Defektes. Sie saß in einem Sechserabteil am Fenster. Nur zwei der übrigen Plätze, die gangseitigen, waren belegt. Die beiden Passagiere, ein Mann und eine Frau in den Fünfzigern, waren offenbar miteinander bekannt und nützten das zufällige Treffen im Zug zu einem ausführlichen Gedankenaustausch über diverse Bewohner ihrer ländlichen Heimatgemeinde. Uninteressante Menschen, die sich uninteressante Geschichten erzählten – ein arroganter Gedanke, aber denken würde man wohl noch dürfen. Gelangweilt betrachtete sie das Fenster-Spiegelbild, lehnte ihren Kopf gegen die Stütze. Sie fühlte Müdigkeit aufkommen, ihren Körper entlangkriechen. Sie schloss die Augen.
ER
Das mit dem Auto war ein verdammtes Pech. Dass die teure Karre ihn in Linz im Stich gelassen hatte, kam ihm wie ein persönlicher Affront vor. Natürlich war sie nicht mehr die Jüngste und hätte schon vor über zwei Monaten zum Service gemusst. Es rächte sich jetzt, dass er die Hinweise Zawlackys, die sich zuletzt schon mehr wie flehentliche Bitten anhörten, so beharrlich ignoriert hatte. Der kannte eben den ganzen Fuhrpark wie seine Westentasche und wusste, dass der Wagen des Chefs wie ein Kätzchen schnurren konnte, aber nur, wenn man ihn auch entsprechend pflegte.
Er fürchtete, dass Barbara telefonisch einen Teil seines Ärgers abbekommen hatte. Nicht, dass sie sich etwas hatte anmerken lassen. Mit ihrer neutralen, professionellen Sekretärinnenstimme hatte sie ihn effizient wie gewohnt mit der Straßenbahn zum Bahnhof gelotst, um diese Tageszeit die schnellste Fortbewegungsart. Die Tram- und Zugtickets hatte er am Automaten selbst kaufen müssen, doch dank Barbaras Hilfe verlor er keine Zeit bei der Suche nach der besten Verbindung oder dem Abfahrtsgleis.
»Wenn du dich beeilst, kannst du den 17:47er auf Gleis 5 erwischen, der hält nur in St. Pölten und braucht nicht einmal eineinhalb Stunden bis zum Hauptbahnhof. Dort nimmst du ein Taxi zur Oper. Du hast Glück, der Wozzeck fängt erst um halb acht an. Wenn die Bahn pünktlich ist und das Taxi nicht im Stau landet, könntest du es schaffen. Ich rufe Ingrid an und sage ihr, dass sie alleine zur Oper fahren, deine Sachen mitnehmen und dich vor der Toilette erwarten soll. Dann kannst du dich dort umziehen. Mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Gute Reise und viel Vergnügen in der Oper.«
Letzteres war ihre kleine Rache für sein nervöses Kurz-angebunden-Sein am Telefon. Sie wusste ganz genau, dass er diese Oper nicht mochte, aber sie wegen Ingrid und der gesellschaftlichen Verpflichtungen, die man als Geschäftsführer nun einmal hatte, erdulden musste. Aber sie hatte recht gehabt, es war sich gerade noch ausgegangen, Sekunden bevor sich die Waggons in Bewegung setzten. Verächtlich schnaufend ging er, in die hell erleuchteten Coupés blickend, den Gang entlang. Die meisten waren gut belegt. Ein Erste-Klasse-Ticket hatte er in der Eile nicht kaufen können, nun würde er sich halt zwischen schwitzende Omas und Kaugummi kauende Teenager zwängen müssen.
Gegen Ende des Waggons fand er einen Platz in einem Abteil mit nur drei Leuten. Er nahm auf dem mittleren Sitz Platz, neben einem Mann fortgeschrittenen Alters, der in ein Gespräch mit seinem Gegenüber vertieft war und schräg gegenüber einer schlafenden Frau. Wenigstens würde er jetzt Zeit finden, die Zeitung zu lesen, die ihm Barbara in der Früh in die Aktentasche gesteckt hatte.
SIE
Anscheinend war sie tatsächlich kurz weggenickt, denn das Geräusch der Schiebetür des Abteils weckte sie. Ohne die Augen zu öffnen, registrierte sie die weiteren Geräusche, die die Ankunft des neuen Passagiers mit sich brachte. Ein sehr knappes »frei?«, zweifellos begleitet von einer Geste hin zu den leeren Sitzen, das Platznehmen ihr schräg gegenüber – keine Verzögerung durch das Ausziehen eines Mantels –, das Klicken mit dem Verschluss einer Aktentasche, das Rascheln einer Zeitung. Der schwache Hauch eines sehr dezenten Duftwassers drang an ihre Nase.
Ihre Neugierde war geweckt. Vorsichtig öffnete sie die Augen einen Spalt und besah sich ihr neues Gegenüber im Scheibenspiegel. Groß, sehr schlank, perfekt sitzender grauer Anzug aus edlem Tuch – etwas zu hell für die Jahreszeit –, teures weißes Hemd, dessen Kragen gelockert war, dezente Krawatte. Interessantes Gesicht. Tiefliegende Augen, Charakterkopf, dunkle Haare mit einzelnen Silberfäden darin. Die Frisur bildete einen Gegensatz zu seiner sonstigen Erscheinung – zerzaust, jungenhaft, Haare etwas zu lang. Sie verlieh ihm eine fast schelmisch wirkende Sorglosigkeit. Sie schätzte ihn auf Anfang vierzig. Die Lässigkeit, mit der er die Beine übereinanderschlug und sich in den Polstersitz lümmelte, eine zusammengelegte Zeitung in der Hand, verriet großes Selbstvertrauen. Er passte nicht hierher.
ER
Die Zeitung reizte ihn nicht besonders. Gelangweilt glitt sein Blick über die Schlafende am Fenster. Nicht jung, nicht alt. Nicht hässlich, nicht besonders schön, sofern er das aus seinem Blickwinkel beurteilen konnte. Nicht blond, nicht schwarz, sondern irgendetwas dazwischen – dunkelblond hieß das wohl. Eher groß, schlank.
Das Entspannte, Wehrlose, Ausgesetzte an diesem ihm abgewandten Frauenkörper reizte ihn. Er konnte sie ungehindert beobachten, sie ungeniert anstarren, seine Blicke wandern lassen, ohne irgendwelche Benimmregeln zu verletzen. Er konnte sie, wie es so schön hieß, mit den Augen ausziehen.
Sie war nicht sehr körperbetont gekleidet, doch ihre Formen zeichneten sich im weichen Stoff des knielangen Rocks und in dem sandfarbenen, seidigen Pulli deutlich ab. Die Hände lagen im Schoß, die linke, mit einem antiken Brillantring geschmückt, umfasste das rechte Handgelenk. Der etwas hinaufgerutschte Rock gab den Blick auf ein Knie und zwei wohlgeformte, übereinandergeschlagene Unterschenkel mit sehr schlanken Fesseln frei, die in eleganten, schlammfarbenen Pumps steckten. Ihre ganze Kleidung schien dem Thema Sand und Schlamm gewidmet. Das passte zum restlichen Erscheinungsbild. Nicht hell, nicht dunkel. Doch anstatt sein Interesse erlahmen zu lassen, fachten die gedeckten Farben es noch weiter an. Sein Blick wanderte weiter hinauf.
Ihre Brüste schienen sich in dem dünnen Pulli mit V-Ausschnitt sehr wohl zu fühlen, so wie sie sich an den Stoff schmiegten. Um den Hals hatte sie ein Weißgoldkettchen mit einem antiken kleinen Brillantanhänger – passend zum Ring –, der knapp unterhalb des Halsgrübchens die Linien ihrer Schlüsselbeine hervorhob. Die Neigung des Kopfes zeigte einen langen, schlanken Hals und eine zarte, feine Ohrmuschel ohne Schmuck. Eine dünne Haarsträhne hatte sich von ihrem Platz hinter dem Ohr gelöst und fiel ihr über die Wange.
Er konnte nicht aufhören, dieses Zusammenspiel von Nackenlinie, Halsgrübchen, Wange und Haarsträhne anzustarren. Zu seiner Verwirrung wurde ihm plötzlich bewusst, dass er diese Frau begehrte. Ein Glück, dass er die Zeitung dabeihatte. Er legte sie sich rasch auf den Schoß.
SIE
Jetzt war dieser unverschämte Kerl doch tatsächlich dabei, sie mit den Augen auszuziehen! Die hungrigen – ja, hungrigen Blicke krochen ihren Körper entlang, fast konnte sie sie spüren wie Berührungen, tastend und fordernd. An ihrem Hals und Ohr blieben sie hängen, saugend, verschlingend. Er dachte anscheinend, dass eine alleinreisende Frau in einem Zugabteil automatisch Freiwild war. Eigenartig nur, dass sie keine echte Entrüstung aufbringen konnte. Im Gegenteil, mit einem Schock wurde ihr eine Empfindung bewusst, die sie schon sehr lange nicht mehr gehabt hatte – körperliches Verlangen. Das warme Gefühl breitete sich rasch in ihrem Schoß aus. Mit weit geöffneten Augen sah sie nun in den Fensterspiegel.
ER
Er versuchte, an etwas anderes zu denken, doch erfolglos. Wie durch ein magisches Band wurde sein Blick wieder zu ihr hingezogen. Der Hals, das Grübchen, das Ohr, die Strähne – letztere umspielte das Kinn, berührte fast den sinnlichen, leicht geöffneten Mund, der seinen Blick weiterwandern ließ über Nase und geschlossene Augenlider … doch nun waren diese Augen plötzlich geöffnet! Er erschrak wie ein Kind, das mit der Hand in der Keksdose erwischt wird, bis ihm klar wurde, dass sie ihn nicht sehen konnte – sie wandte den Blick ja von ihm ab. Mit weit geöffneten Augen starrte sie ins Leere, in die Nacht hinaus.
Er folgte ihrem Blick. Ihre Augen spiegelten sich im Fensterglas – sie sah ihn an!
Dieses Mal konnte er seinen Schrecken nicht gleich wieder in den Griff kriegen. Sein rasches Wegblicken war nichts als ein Schuldeingeständnis. Er hatte sich wie ein Pubertierender benommen.
Doch etwas in diesem blitzlichtartig aufgefangenen Blick berührte einen Nerv, ließ diesen vibrieren wie die Saite eines Streichinstruments – ließ ihn wieder hinsehen, diesmal direkt in den Spiegel, direkt in ihre Augen.
SIE
Er hatte sie angesehen.
Er hatte sie angesehen und war ihrem Blick begegnet. Er hatte sich ertappt gefühlt und rasch wieder weggesehen. Dann war sein Blick wie ein Jo-Jo an seinem Schnürchen zu dem ihren zurückgekehrt. Jetzt starrten sie sich im Spiegel an, ihre Augen so sehr ineinander verhaftet, dass die Zeit stillzustehen schien.
Sie sah als Erste weg, doch nur, um ihn jetzt ohne Umweg zu betrachten. Es war zu spät, so zu tun, als sei nichts geschehen.
ER
Er starrte weiterhin in den schwarzen Fensterspiegel. Das Zerreißen ihres Blickbandes hatte ihn fast zusammenzucken lassen, doch jetzt ruhten ihre Augen weiter auf ihm, nur ohne Vermittlung der reflektierenden Fläche. Ihre Rollen waren nun vertauscht: Sie ließ ihren Blick über ihn gleiten, er beobachtete sie dabei im Spiegel. Doch jetzt waren sie zu zweit, zwei Komplizen. Er wagte kaum zu atmen.
Er wusste nicht, wie lange sie so dagesessen hatten, als der Lautsprecher das baldige Eintreffen in St. Pölten verkündete. Die beiden Mitreisenden erhoben sich, immer noch in ihr Gespräch vertieft. Der Mann half der Frau in den Mantel, bevor er sich selbst anzog, dann waren sie mit einem »Wiedersehen!« verschwunden.
Die Unterbrechung hatte ihn veranlasst, den Blick vom Fenster abzuwenden, um ihr jetzt direkt in die Augen zu sehen – als ob diese hellblauen Lichter ihn blenden und gefangen nehmen würden wie ein Kaninchen der Lichtkegel eines Autos.
SIE
Sie fühlte, wie ihre Vernunft und ihre Reserviertheit in diesem Blickstrahl schmolzen. Alles, was folgte, war logisch, schicksalhaft, selbstverständlich.
Als sich der Zug wieder in Bewegung setzte, zog er, ohne den Blickkontakt zu unterbrechen, das Fensterrollo herab, schloss den Vorhang der Schiebetür und betätigte den Verschluss. Dann zog er sie zu sich herüber.
ER
Gedanken waren ausgeschaltet. Es war anders als alles, was er bisher erlebt hatte. Wer hatte seine Hose geöffnet, ihren Rock hinaufgeschoben und den Slip nach unten gezogen? Es schien alles von selbst zu gehen. Die Außenwelt existierte nicht. Ein letzter Rest von Vernunft ließ sie beide leise sein. Einzig ein kleines, kaum hörbares Geräusch, als sie kam – es brannte sich sofort in sein Bewusstsein ein.
SIE
Längst saß er wieder ihr gegenüber, alle Spuren waren getilgt, die Kleidung wieder in Ordnung, die Tür entriegelt.
Wie hatte sie nur so unglaublich unbeherrscht sein können? Kein Kondom – sie könnte sich eine Krankheit geholt haben! Der Mann könnte ein Irrer sein, der sie ab jetzt verfolgen würde. Einer, der ihre Adresse ausfindig machen und seinen Freunden von ihr erzählen könnte. Der sie erpressen könnte. Was für eine Art Mann konnte das sein, der es im Bahnabteil mit einer Fremden trieb?
Warum verspürte sie trotzdem keine Reue, keine Angst? Woher kam dieses anhaltende Hochgefühl?
Vielleicht von seinem Blick, der wieder auf ihr ruhte, jetzt anders, mit halb geschlossenen Augenlidern. Wahrscheinlich dachte er dasselbe von ihr wie sie von ihm.
Der Lautsprecher verkündete das baldige Eintreffen in Wien.
»Ich will dich wiedersehen« sagte er plötzlich.
Sie brachte keine Antwort zustande, nur ein kaum merk-bares Nicken.
»Nächste Woche, wieder Donnerstag, vier Uhr, Hotel Papaya. Das ist ganz in der Nähe vom Westbahnhof. Ich nehme ein Zimmer und hinterlege eine Nachricht mit der Zimmernummer bei der Rezeption für Tanja Müller. Das bist du.«
Sie nickte wieder. Er packte seine Zeitung in die Aktentasche, stand auf und verließ das Abteil, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Erleichtert atmete sie aus. Kein Austausch von Handynummern, Namen oder Adressen. Keine Spur zu ihr. Natürlich würde sie nächsten Donnerstag nicht in dieses Hotel gehen. Sie würde, wie jede Woche, den Bildhauerkurs in Linz besuchen und dann mit dem gleichen Zug wie jetzt heimfahren.
Ein einmaliges Abenteuer, nichts weiter.
Es sei denn, sie setzte den Kursbesuch eine Woche aus.
1Wien, drei Jahre später10. August
Lang hatte sich und Marlene gerade das zweite Glas vom guten Blauen Portugieser aus Sooß eingeschenkt, als die Zentrale sich auf seinem Handy meldete. Er seufzte. Wäre doch zu schön gewesen, den herrlichen Sommerabend ungestört auf der kleinen, aber gemütlichen Dachterrasse ausklingen lassen zu können.
»Verdacht auf Tod durch Fremdeinwirkung in der Garage des Hotels Papaya beim Westbahnhof. Der Notarzt wurde zu einem Mann gerufen, der leblos in seinem Auto aufgefunden wurde. Er konnte nichts mehr für ihn tun und hat uns gleich angerufen. Sendlinger ist schon verständigt und mit seinen Leuten unterwegs.«
»In Ordnung, ich komme sofort. Meine Leute verständige ich selbst.« Kurz überlegte er. Schneebauer auf Urlaub, Goncalves war die nächsten drei Wochen dran. Blieben Cleo und Nowotny. Sie wahrscheinlich mitten in einem amourösen Abenteuer mit wem auch immer, er gemeinsam mit seiner Frau vor dem Fernseher, das soeben begonnene Hauptabendprogramm, bestimmt irgendeine Wiederholung eines seichten Sommerschmarrns, verächtlich kommentierend. Aber schließlich ging es ihn überhaupt nichts an, was seine Mitarbeiter in ihrer Freizeit machten. Er wählte Cleos Nummer.
Während er wartete, dass sie dranging, nickte er Marlene bedauernd zu und ließ seinen Blick über die zum Glück schon leergegessenen Teller ihres leichten Abendessens schweifen – Insalata Caprese aus vollreifen, fruchtigen Tomaten, echtem italienischen Büffelmozzarella und frisch gepflücktem Basilikum aus dem Kräutertopf, der auf der Terrasse stand. Darüber bestes toskanisches Olivenöl extra vergine und Salz. Ein von ihm zubereitetes Balsamico-Dressing für eine individuelle Würzung hatte sich in einem eigenen Schälchen befunden, das jetzt auch fast leer war. Ein Glück, dass er nicht mehr getrunken hatte.
Cleo hob nach Luft ringend ab. Lang schmunzelte in sich hinein. Na also, hab ich recht gehabt, dachte er bei sich. Doch wie sich rasch herausstellte, war sie beim Laufen.
»Bis zu Hause brauche ich zwanzig Minuten, zehn Minuten zum Duschen und Umziehen, eine Viertelstunde Fahrt, also kannst du in ungefähr einer Dreiviertelstunde dort mit mir rechnen.«
»Gut«, erwiderte er knapp und beendete das Gespräch, dankbar, dass sich Cleo in solchen Situationen immer als effizient und uneitel erwies. Fürs Erste würden sie beide am Tatort wohl reichen. Trotzdem rief er Nowotny von unterwegs auch noch an, damit dieser keinen Grund haben würde, beleidigt zu sein oder besser gesagt beleidigt zu tun, weil er nicht gleich eingeweiht worden war.
»Hallo Helmut, ich hoffe, ich störe dich nicht beim Fernsehen«, begann er.
Am anderen Ende der Leitung war es einen Augenblick still, sodass Lang schon glaubte, die Verbindung sei abgebrochen. Dann schnarrte Nowotny: »Wos bringt di auf die Idee, dass i an so an Abnd vorm Fernseher sitz? I bin im Schweizerhaus und sitz vor ana Stözn mit meiner Frau und de Nochbarn. Kann ich dir auch empfehlen.« Letzteres in einwandfreiem Hochdeutsch, quasi als Kontrast.
Er war also mit seiner Vermutung wieder danebengelegen. Kurz erklärte er dem Älteren die Lage, sagte ihm, dass sie ihn vorläufig vermutlich nicht benötigen würden und wünschte ihm noch einen schönen Abend.
»Aber halte dich bitte bereit, für den Fall, dass wir dich doch brauchen«, fügte er noch rasch hinzu, bevor sich Nowotny wieder seiner Stelze und seinen Nachbarn zuwenden konnte. Gleichzeitig ging ihm durch den Kopf, dass er seinen Mitarbeitern gegenüber anscheinend ziemlich vorurteilsbehaftet war. Kein Ruhmesblatt für einen Vorgesetzten, wenn es ausgerechnet bei den eigenen Leuten an Menschenkenntnis fehlte. Als kleine Trotzreaktion erlaubte er sich – nebst einem kleinen Grinsen nur für sich allein – noch die Feststellung, dass Helmut zuerst die Stelze und dann erst seine Frau genannt hatte. Dann drehte er das Radio lauter und sang bei »Wumba-Tumba-Schokoladeneisverkäufer« mit. Das entsprach zwar nicht dem ernsten Anlass, zu dem er unterwegs war, aber ernst würde es noch früh genug werden.
2
Als er seinen Wagen außerhalb der Polizeiabsperrung parkte und ausstieg, stieg ihm sofort der charakteristische Tiefgaragengeruch nach Benzin, Auspuffgasen und abgestandener Luft in die Nase, der die Benutzer gewöhnlich den kürzesten Weg zum nächsten Ausgang anstreben lässt. Das hätte er jetzt auch gerne getan.
Sendlinger und seine Mitarbeiter in ihren weißen Schutzanzügen waren schon da. Der Gerichtsmediziner war in ein Gespräch mit einem müde wirkenden Mann mittleren Alters in Grellorange vertieft, während seine Leute bereits mit der Spurensicherung an einem bulligen beigen Luxuswagen älteren Baujahrs, wohl englischer Herkunft – Rolls? Bentley? Jaguar? – beschäftigt waren. Er winkte, als er Lang erspähte.
»Hallo Leo, wie geht’s? Das ist Dr. Hüpfl, der zuständige Notarzt.«
»Hallo Philipp, guten Abend, Herr Doktor. Danke, dass Sie uns gleich gerufen haben. Was genau hat Sie dazu veranlasst?«
»Also, ich habe schon über zehn Jahre Erfahrung als Notarzt, da entwickelt man ein gewisses Gefühl für Situationen und Symptome, das über das rein Medizinische hinausgeht. Bei diesem Opfer könnte man eine Überdosis vermuten, aber das Drumherum passt überhaupt nicht dazu. Kleidung, Fahrzeug, Umgebung, einfach alles.« Er machte eine weit ausholende Armbewegung, die das ganze Szenario umfasste. Leo ging um den Wagen herum und erblickte den äußerlich unverletzten, wie schlafend wirkenden Toten auf einer Matte am Boden.
»Wir mussten ihn aus dem Auto holen, um Wiederbelebungsmaßnahmen einzuleiten«, sagte Dr. Hüpfl fast entschuldigend. »Wenn auch erfolglos«, fügte er noch leise hinzu. Wenigstens hatte einer der Sanitäter daran gedacht, einige Handyfotos vom Toten zu machen, als dieser noch zusammengesunken auf dem Fahrersitz saß.
In diesem Augenblick traf Cleo ein, fünf Minuten früher als angekündigt, wie Leo im Stillen feststellte. Sie wirkte rosig-frisch und hatte feuchte Haare vom Duschen. Nachdem auch sie den Toten kurz betrachtet hatte, ersuchte Dr. Hüpfl, ihn zu entschuldigen.
»Wenn Sie mich nicht mehr brauchen, würde ich gerne wieder gehen«, sagte er ein wenig gehetzt. »Wir sind normalerweise schon stark unterbesetzt, und jetzt ist auch noch Urlaubszeit. Weniger Ärzte und mehr Notfälle, Sie verstehen. Wenn nötig, weiß Kollege Sendlinger, wo Sie mich erreichen.«
Als er zu den beiden Sanitätern in den Notarztwagen gestiegen war und dieser sich in Bewegung setzte, wandte Lang sich Sendlinger zu.
»Wer hat eigentlich den Notarzt gerufen? Und kannst du schon irgendetwas in Bezug auf die Todesursache und den Todeszeitpunkt sagen? Wisst ihr schon, wer er ist?«
»Eine Menge Fragen auf einmal. Gerufen hat ihn die Hotelrezeption, wurde mir gesagt. Der Zeitpunkt ist sehr gut eingrenzbar, weil das Einfahren in die Garage sicher von der Videoüberwachung erfasst wurde und der Tod zwischen diesem Zeitpunkt und dem Notruf eingetreten sein muss. Aber das herauszufinden ist euer Job. Unwahrscheinlich, dass es medizinisch genauer eingrenzbar sein wird, aber wenn, finden wir es bei der Obduktion heraus. Bezüglich einer ersten Einschätzung der Todesursache würde ich mal sagen, dass Kollege Hüpfl sicher ein gutes Gespür für solche Dinge hat. Ich habe mir den Kopfbereich vorhin schon kurz angeschaut, und hier«, – er ging neben der Leiche in die Hocke und die beiden anderen bückten sich über sie – »ja, hier, seitlich auf der rechten Halsseite, haben wir zwei kleine Rötungen, die mir verdächtig nach Elektroschocker aussehen. Und hier an der Vena jugularis interna, das könnten Spuren eines Einstiches sein. Allerdings ist das keine Stelle, die ein Junkie für einen Schuss benutzen würde. Erster Anschein: Fremdverschulden. Ohne Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.«
Lang schätzte es, dass Sendlinger zu dieser Art vorläufiger Blitzdiagnosen bereit war und nicht ständig den übervorsichtigen Wissenschafter heraushängen ließ. Inzwischen hatte sich einer der Weißgewandeten – nein, eine, es war Diana, ihren Nachnamen kannte Leo nicht – den Ermittlern genähert. Sie hielt einen Plastikbeutel mit einer Brieftasche in der Hand.
»Hi Leo, hi Cleo«, sagte sie als Begrüßung, »ich habe schon einen kurzen Blick darauf geworfen. Es sind unter anderem ein Personalausweis und ein Führerschein drin. Danach heißt er Mathieu Rassling.«
»Rassling … «, überlegte Lang stirnrunzelnd, »kommt mir irgendwie bekannt vor …«
Cleo tippte schon emsig auf ihrem Tablet herum. »Das muss einer der Vorstände der Rasslingwerke sein«, antwortete sie prompt. »Das ist eine alteingesessene Wiener Firma für Medizintechnikgeräte. Ein sehr erfolgreiches Familienunternehmen mit fast tausend Beschäftigten, schreiben sie hier. Es wird – oder besser gesagt, wurde – geleitet von zwei Brüdern, Marc und Mathieu Rassling. Letzterer liegt hier vor uns. Seit einem Jahr geschieden, keine Kinder.«
Lang stieß einen verhaltenen Pfiff aus. »Allerhand, ein prominenter Industrieller! Da wird sich die Presse gleich draufstürzen, möchte ich wetten. Wundert mich fast, dass die noch nicht da sind. Ist der Rettungsfunk jetzt eigentlich schon abhörsicher?« Damit spielte er darauf an, dass vor einigen Jahren ein Hacker brisante Daten ohne besonderen Aufwand über das Pager-Netz des Rettungsdienstes mitprotokolliert hatte.
»Du brauchst niemanden, der den Rettungsfunk abhört«, so Cleo. »Es reicht schon, wenn jemand mit einem Smartphone in der Nähe ist. Schnell ein schönes, breit grinsendes Selfie mit Kommentar: ›HashtagToter in HashtagTiefgarage Hotel HashtagPapaya, HashtagPolizei vor Ort, Hashtag-Mordverdacht.‹ Und schon verbreitet sich das im Netz.«
Lang sah die von Cleo erdachte Sensationsmeldung förmlich vor sich, garniert mit den nervigen Hashtag-Kanalgittern. Anscheinend hatten sie bisher Glück gehabt und es war niemand in der Nähe gewesen, der dergleichen hätte posten können. Er nickte mit einem halbherzigen Lächeln.
»Lassen wir die Kollegen hier ihre Arbeit weitermachen und gehen wir die Rezeptionsleute befragen. Mal sehen, was die uns über ihren hochkarätigen Gast zu sagen haben.«
3
Sie nahmen den Weg durch die Einfahrt der Tiefgarage und den straßenseitigen Hoteleingang, weil die Spurensicherung auch den Lift und die Treppe von der Tiefgarage zur Eingangshalle untersuchen musste. Nach kurzer Überlegung hatten sie beschlossen, dass ihnen eine Totalsperre des Betriebs mehr Schaden als Nutzen bringen würde. Der Mörder oder die Mörderin hatte bereits reichlich Zeit gehabt, sich aus dem Staub zu machen, und ein Großaufgebot an Uniformierten würde nur die Presse und sensationslüsterne Gaffer anlocken.
Cleo bemerkte beim Betreten der einladend gestalteten Eingangshalle, dass die Hotelkategorie – drei Sterne – eigentlich nicht zu einem Großindustriellen passte. Das Gleiche war auch Lang schon durch den Kopf gegangen. Bei dieser Art von Unterbringung hatte man alles, was man zum Übernachten brauchte, aber keinen Luxus. Grundvernünftig, aber nicht standesgemäß. Außerdem, wozu brauchte ein in Wien ansässiger Geschäftsmann ein Hotelzimmer in Wien?
»Vielleicht wollte er hier nur jemanden treffen«, mutmaßte er. »Hoffentlich können uns die von der Rezeption mehr dazu sagen.«
Hinter der seitlich angeordneten Budel standen ein blonder junger Mann, der gerade einem Gast höflich in gutem Englisch erklärte, dass der Lift leider außer Betrieb sei, und eine junge Frau mit mittellangen, zu einem Pferdeschwarz zusammengebundenen dunklen Haaren. Lang fiel sofort das fast in Vergessenheit geratene Wort »adrett« als Beschreibung für die beiden ein. Sie trugen die Betriebskleidung des Hotelkonzerns, T-Shirts mit fröhlich-farbigem Papayamuster, dazu farblich passende grüne Hosen. Die dazugehörenden Jacketts hatten sie über die Lehnen ihrer Bürostühle gehängt. Die wurden wohl nur bei Erscheinen von Vorgesetzten getragen. Sowohl die Halleneinrichtung als auch die Kleidung der Mitarbeiter strahlten Unbeschwertheit und Unkompliziertheit bei gleichzeitiger Sauberkeit und Effizienz aus, offenbar auf ein jüngeres internationales Publikum zielend. Bis auf die Rezeptionisten und den Gast, der gerne den Lift benutzt hätte, war die Halle leer. Auch in dem vom Eingangsbereich abzweigenden Seitenflügel, der sich mit gedämpftem Licht und leiser Musik als gemütliche Bar präsentierte, saß niemand. Offenbar besuchten die Hotelgäste an einem schönen Sommerabend wie diesem lieber einen der vielen Schanigärten, die Wien zu bieten hat. Recht hatten sie.
Nach der Mitteilung einer der Tatortgruppenleute, dass ein Teil der Tiefgarage, der Aufzug und ein Teil der Treppe wegen Polizeiermittlungen gesperrt werden würden, hatte die Rezeptionistin offenbar rasch reagiert, ihre Vorgesetzte informiert und eine Hilfskraft organisiert, die bereits unterwegs war. Als der Hotelgast missmutig die Treppe angesteuert hatte, wandte Lang sich an die beiden jungen Angestellten, deren Namensschildchen verkündeten, dass sie Anastazija Dujmović und Martin Föderl hießen.
»Können wir irgendwo in Ruhe reden?«
Die Frau nickte und deutete mit dem Kinn auf eine Stelle hinter Leo.
»Die Jessie ist schon da« sagte sie und hob die Hand zur Begrüßung. »Sie springt für uns am Desk ein, bis der Nachtportier kommt. Wir können nach hinten gehen.«
»Hinten« erwies sich als ein nüchterner, fensterloser Raum hinter der Budel oder dem »Desk«, wie das nun anscheinend hieß, ausgestattet mit einem Tisch und einigen Sesseln. Die beiden, die keineswegs erschrocken oder beunruhigt wirkten, nahmen den beiden Beamten gegenüber Platz.
»Wenn Sie etwas trinken möchten, müsste ich es kurz drüben in der Bar holen« sagte der Mann. Höflich, effizient, adrett. »Wenn so wenig los ist, machen wir die Bar mit.«
»Nein, danke«, erwiderte Lang nach einem kurzen Seitenblick zu Cleo, die fast unmerklich den Kopf schüttelte. »Fangen wir lieber gleich an. Was hat Sie eigentlich veranlasst, den Notarzt zu rufen?«
»Also«, begann Frau Dujmović nach tiefem Einatmen. Anscheinend war die Sache doch nicht ganz so spurlos an ihr abgeprallt, wie es zuerst den Eindruck erweckt hatte. »Es war ganz ruhig, wir hatten keinen Gast am Desk, als plötzlich die Lifttür aufging und diese Frau herausgestürzt kam, total aufgelöst, tränenüberströmt, mit verzerrtem Gesicht. Schon vom Lift aus schrie sie: ›Rufen Sie sofort einen Notarzt, mein Mann liegt unten leblos im Auto!‹ Wir haben sie gar nichts Weiteres gefragt, sondern sofort angerufen, wie sie verlangt hatte. Als ich ihr sagte, der Arzt ist schon unterwegs, sie soll sich beruhigen, es ist sicher nur eine Ohnmacht oder sowas, und ob sie in der Zwischenzeit ein Glas Wasser will – da hat sie noch einmal ganz laut aufgestöhnt und ist dann bewusstlos zusammengebrochen. Martin und ich haben sie schnell auf das Sofa gehoben, das mit dem Rücken zum Lift steht, und auf den Arzt gewartet. Zum Glück sind nur ein paar Gäste durch die Halle gekommen, und die haben nichts bemerkt. Wahrscheinlich haben sie sie gar nicht gesehen oder geglaubt, dass sie sich ein bisschen ausruht.«
»Wo ist sie denn jetzt?«, fragte Leo erstaunt. Er hatte nirgends eine verweinte Frau sitzen oder liegen gesehen.
»Der Notarzt hat sofort einen zweiten Wagen gerufen, als er hier ankam, und darin wurde sie weggebracht, wahrscheinlich ins Krankenhaus, als klar war, dass der Mann im Auto tot war«, meldete sich Martin Föderl nun zu Wort. Er war offenbar etwas jünger als seine Kollegin.
Cleo schlug mit der flachen Hand auf den Tisch und Lang riss die Augen auf.
»Zweiten Wagen? Es gab einen zweiten Rettungswagen?«
Die beiden Befragten nickten synchron. Davon hatte Dr. Hüpfl kein Wort gesagt, anscheinend war der Mann überarbeitet oder der Tote hatte seine Aufmerksamkeit so in Anspruch genommen, dass er die Frau darüber vergessen hatte. Wenigstens wussten sie anhand ihres Ausrufs, dass dies die Ehefrau des Opfers sein musste.
»Der Tote heißt Mathieu Rassling«, sagte er an die Rezeptionisten gerichtet. »Wir haben Grund zur Annahme, dass Fremdverschulden im Spiel ist. Alles, worüber wir hier sprechen, sollte von Ihnen streng vertraulich behandelt werden. Insbesondere sollten Sie der Presse bitte keine Auskünfte erteilen.« Weiteres Nicken.
»Jetzt also zu Frau Rassling. Haben Sie vielleicht mitbekommen, in welches Krankenhaus sie gebracht wurde?«
Jetzt blieb das Nicken aus. Stattdessen wechselten die beiden Blicke, die nicht verborgen blieben. Nach einem kurzen Moment brach Frau Dujmović das Schweigen.
»Wir glauben nicht, dass die Dame Frau Rassling war«, sagte sie, ihre Worte sorgfältig abwägend.
»Nicht Frau Rassling?«, wiederholte Cleo. »Was veranlasst Sie zu dieser Annahme?«
Die Rezeptionistin wechselte erneut einen Blick mit ihrem Kollegen. Er verzog das Gesicht zu einer missmutigen Grimasse, blies hörbar die Luft aus und sagte dann: »Erzähl du es, du bist länger da und kennst dich besser aus.«
»Das stimmt«, bestätigte sie. »Ich mache diesen Job schon über zwei Jahre, Teilzeit, neben dem Studium. Ich hab immer von Donnerstag bis Samstag Dienst, jeweils von vierzehn bis dreiundzwanzig Uhr. Martin studiert auch, aber er ist erst seit gut einem halben Jahr hier, er macht weniger Stunden.«
»Ja, ich bin nur jede zweite Woche da, meistens vier Tage hintereinander. Manchmal Montag bis Donnerstag wie diesmal, manchmal Freitag bis Montag, wie es halt gebraucht wird.«
Leo fragte sich, wozu diese Angaben gut sein sollten. Sie hatten schließlich noch gar nicht nach den Dienstplänen gefragt. Doch Anastazija Dujmović brachte rasch Licht in die Angelegenheit.
»Was ich Ihnen jetzt erzähle, ist eine Indiskretion einem Hotelgast gegenüber«, sagte sie ernst. »Das ist unter normalen Umständen ein absolutes No-Go. Aber in diesem Fall ist der Gast verstorben und die Polizei ermittelt. Ich habe mit meiner Chefin telefoniert und die hat mir grünes Licht gegeben, Ihnen alles zu sagen, was wir wissen.«
Leo verzichtete darauf, sie zu belehren, dass sie ohnehin verpflichtet sei, alles zu sagen, Indiskretion oder No-Go hin oder her, egal ob die Chefin einverstanden war oder nicht. Wobei man wahrscheinlich noch froh sein musste, dass es sich um eine Chefin handelte und nicht um eine Senior Managerin oder Supervisorin oder wie immer der gerade aktuelle Anglizismus hieß.
»Herr Rassling heißt im Hotel Herr Müller und kommt seit Jahren jeden Donnerstagnachmittag, meistens so um fünf oder sechs herum«, begann die Rezeptionistin ihre Erzählung. »Er hat immer dasselbe Zimmer, Zimmer 226 im zweiten Stock. Er kommt zum Desk, wo die Anmeldung schon ausgefüllt bereitliegt, er unterschreibt sie nur und nimmt die Keycard an sich. Dann bringt ihm einer der Rezeptionisten seinen kleinen Koffer, der im Gepäcklagerraum liegt. Er fährt hinauf und bezieht das Zimmer. Einige Stunden später kommt er wieder herunter und checkt ordnungsgemäß aus, zahlt bar für die ganze Nacht mit sehr, sehr großzügigem Trinkgeld, gibt das Kofferl wieder zur Aufbewahrung und geht.« Mit der Verwendung der Gegenwartsform schien die Frau der Tatsache, dass der Mann, von dem sie sprach, tot war, trotzen zu wollen. Vielleicht war es ihr leid um das gute Trinkgeld, dachte Lang ein wenig boshaft.
Cleo hatte längst zu ihrem Handy gegriffen, um Sendlingers Leuten die sofortige Abriegelung und Durchsuchung des Zimmers 226 zu kommunizieren und sie über den Koffer zu informieren.
»Wussten Sie, dass es sich um Herrn Rassling handelte? Und welche Rolle spielte die Frau, die nicht Frau Rassling ist?«, fragte sie dann die beiden Studierenden.
»Klar wussten wir, dass es der Rassling war«, antwortete Martin Föderl. »Er war zwar nicht wahnsinnig prominent, aber ab und zu hat man sein Foto im Wirtschaftsteil der Zeitungen gesehen. Natürlich haben wir uns nie etwas anmerken lassen, auch wenn die Rasslingwerke als Arbeitgeber nach dem Studium wahrscheinlich sehr interessant gewesen wären. Aber man will ja nicht als eine Art Erpresser dastehen.« Der wortreichen Erklärung merkte man an, dass Martin Föderl wohl zumindest mit dem Gedanken gespielt hatte, den mächtigen Mann nach Jobchancen abzuklopfen.
»Ja, und wegen der Frau«, ergänzte Anastazija Dujmović, »die gab es offiziell eigentlich gar nicht. Sie kam im Allgemeinen etwas später als er, meist durch die Tiefgarage, selten durch die Halle, und huschte diskret die Treppe hinauf zum Zimmer. Kurz bevor Herr Müller auscheckte, verschwand sie dann wieder auf demselben Weg.«
»Weshalb so umständlich? Wieso fuhr sie nicht mit dem Aufzug von der Tiefgarage direkt in den zweiten Stock? Dann hätte sie sich das diskrete Huschen erspart«, bemerkte Lang.
»Weil der Lift ohne Keycard nur bis zur Rezeption geht. Um in die anderen Stockwerke zu kommen, muss man eine Keycard stecken, also Hotelgast sein. Das ist ein Sicherheitsfeature.«
Offenbar kein besonders überzeugendes, dachte Lang, wenn jeder x-Beliebige ungehindert die Treppe benutzen konnte.
»Klingt nach Schäferstündchen«, fasste Cleo das Naheliegende in Worte. »Ist die Frau eine Prostituierte? Erlaubt ihre Firmenpolicy das denn überhaupt?«
»Natürlich nicht«, beeilte sich die Studentin zu versichern. »Sie ist ganz sicher keine Prostituierte. Nicht jung genug, nicht blond genug, überhaupt vom Typ und von der Kleidung her nicht grell oder auffällig. Sehr dezent und unauffällig. Sie war seine Geliebte, wenn Sie mich fragen. Auswärtige Gäste im Zimmer sind nicht erlaubt, aber wir sind auch nicht verpflichtet, ständig die Treppe zu überwachen und wir können auch nicht jeden Hotelgast kennen, bei dem ständigen Kommen und Gehen, außerdem haben wir ja nicht ständig Dienst.«
Während die blonde Cleo beleidigt zu Eis erstarrte, fragte Lang hastig weiter. Die vermeintliche Frau Rassling war dabei, sich in Luft aufzulösen. Er hoffte nur, dass sie wirklich in ein Krankenhaus eingeliefert worden war, sonst fehlte ihnen jeder Ansatzpunkt, sie zu finden. Nicht einmal einen Namen gab es. Die Beschreibung war mehr als dürftig und wurde auch bei intensiverer Befragung nicht viel besser. Die beiden Hotelangestellten waren sich aber sicher, dass die mysteriöse Geliebte heute durch die Eingangshalle hinaufgegangen und nach einiger Zeit über die Treppe in die Tiefgarage hinuntergegangen war, bevor sie in Panik aus dem Aufzug gestürzt kam.
»In letzter Zeit waren sie weniger vorsichtig als früher«, bemerkte Frau Dujmović nachdenklich. »Das zeigte sich allein schon daran, dass sie durch die Halle hinaufging. Und vorigen Donnerstag haben sie sogar kurz einen gemeinsamen Drink in der Bar genommen, bevor sie dann getrennt gegangen sind – das schon.«
Erleichtert fiel Lang ein, dass sie ja schließlich auch noch die Videoüberwachung hatten. Sicher würde diese – neben näheren Erkenntnissen zum Geschehen in dem Luxusauto – auch ein brauchbares Bild der Geliebten liefern. Doch als er danach fragte, breitete sich ein Schweigen wie eine undurchdringliche Wolke im Raum aus. Er wartete auf die Einwände, die jetzt kommen würden – nicht zuständig, Datenschutz, Chefin anrufen, Durchsuchungsbeschluss abwarten … bei Videos machten sich doch immer alle in die Hose!
Föderl fand als Erster seine Sprache wieder.
»Wir am Desk sind für die Videoüberwachung nicht zuständig. Um diese Dinge kümmert sich eine IT-Firma, die Juen IT-Services. Aber ich fürchte, die können Ihnen nicht helfen, weil sie selbst seit Tagen ganz verzweifelt herumsuchen. Es ist nämlich so, dass die Videoüberwachung schon seit Samstag hin ist.«
»Wie, hin?« Langs Stimme überschlug sich.
Der junge Mann schien einen Teil seiner höflich-effizienten Adrettheit abgelegt zu haben.
»Na, hin halt, wie beim lieben Augustin, alles ist hin. Nix geht mehr. Keine Aufnahme, keine Anzeige, keine Speicherung. Erst dachten die vom Juen, dass irgendein technischer Defekt vorliegt, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Dann haben sie irgendwas von einem Betriebssystemfehler gesagt, das ist aber offenbar auch nicht die Ursache. Alles andere funktioniert ja ganz normal, die Buchhaltung, das Reservierungssystem, die Keycards, die Warenwirtschaft … nur die Videoüberwachung halt nicht. Gestern ist sogar der Juen selber aufgetaucht und hat mit seinen Leuten über irgendeinen Bus diskutiert, keine Ahnung, was das mit der EDV zu tun hat. Nach ein paar Stunden hat er dann die Söllinger, das ist die Hotelmanagerin, angerufen und ganz kleinlaut zugegeben, dass es eine Malware sein muss, irgendein Trojaner oder so. Sie haben keine Ahnung, woher das Ding kommt. Anscheinend müssen sie alles neu aufsetzen, Riesenaction. Zum Glück sind die Brandmelder nicht betroffen, sonst hätte das Hotel zugesperrt werden müssen.«
Lang verspürte große Lust, den jungen Mann nach dessen mit einer gewissen genüsslichen Lässigkeit vorgetragenem Sermon anzubrüllen. Es hätte seinem rasant ansteigenden Frustpegel sicher gutgetan. Stattdessen begnügte er sich damit, kurz angebunden den Koffer zu verlangen. Föderl sprang diensteifrig auf, vermutlich froh, Leos finsteren Blicken für einen Augenblick entkommen zu können.
Als er mit dem kleinen Koffer zurückkehrte, war seiner Handhabung des Gepäckstücks zu entnehmen, dass es nicht schwer sein konnte. Anastazija Dujmović sah es sich nachdenklich an, bevor sie murmelte: »Die haben den Koffer letztes Mal gar nicht aufgemacht.«
»Was veranlasst Sie zu dieser Annahme?«, fragte Cleo, die die Anspielungen auf junge, blonde Frauen inzwischen weggesteckt und Sendlinger heraufgebeten hatte. Bevor die Befragte antworten konnte, trat dieser gemeinsam mit Diana, die eine Kamera in der Hand hatte, ein.
»Es ist da etwas eingeklemmt, ein kleines Stück von einem lila Bändchen, sehen Sie? Und das war auch schon genauso eingeklemmt, als ich Herrn Müller den Koffer das letzte Mal übergeben habe, und das Mal davor … ich war dazwischen zwei Wochen nicht da … also muss es am Donnerstag vor vier Wochen gewesen sein, da war das auch schon so.«
»Sind Sie sicher?«, hakte Cleo mit deutlich hörbarer Skepsis in der Stimme nach. Doch die Antwort kam sofort: »Ganz sicher, so etwas fällt mir einfach auf. Ich mag keine Unordnung. Martin, was sagst du? Du hattest doch einmal am Donnerstag Dienst, als ich nicht da war?«
»Keine Ahnung«, brummte ihr Kollege, »mir wäre das nie im Leben aufgefallen.«
»Gut, wir brauchen Sie jetzt nicht mehr, Sie können gehen – danke einstweilen. Bitte halten Sie sich für weitere Auskünfte zur Verfügung. Ach ja, und wenn Sie der Frau Bezirksinspektorin Oberlehner bitte die genauen Daten dieses Herrn Juen übermitteln würden.« Mit diesen Worten komplimentierte Lang die beiden Hotelangestellten hinaus.
Er und die beiden anderen hatten inzwischen Gummihandschuhe übergezogen, Sendlinger hatte den Koffer auf eine mitgebrachte Plastikfolie am Tisch gelegt und den Schlüsselbund des Mordopfers gezückt. Das Nummernschloss war nicht aktiviert. Der Kofferschlüssel war sehr rasch gefunden und Sendlinger klappte mit einem melodramatischen »Sesam öffne dich!« den Deckel zurück.
»Interessant«, war alles, was Leo zum Inhalt einfiel. Cleo und Sendlinger ließen gleichzeitig, als hätten sie es geprobt, einen Pfiff hören, worauf sie sich gegenseitig anlächelten. Im Köfferchen befand sich eine Kollektion von Erotikwäsche und einige Gegenstände, von denen Lang nur die wenigsten auf Anhieb identifizieren konnte. Dieses Problem schien Cleo nicht zu haben.
«Sexspielzeug«, war ihre ebenso schnelle wie präzise Diagnose. Anschließend unterhielt sie sich angeregt mit Diana, die alles mit der Kamera dokumentierte. Die beiden Beamtinnen wirkten, als würden sie sich dabei königlich amüsieren.
»Schau, ein Auflegevibrator mit Fernbedienung!«
»Dieses Fesselset schaut aber eher nach Mottenkiste aus!«
»Die Penisringe sind ziemlich kitschig, wenn du mich fragst. Die Farbe ist doch abtörnend!«
»Der Pulsator da, glaubst du, das funktioniert?«
»Warum nicht? Aber dieses Massage-Öl scheint eher nicht der Hit gewesen zu sein, die Flasche ist noch ganz voll!«
Wenigstens brauchten sie bei diesem Inhalt nicht lange über den Zweck des Koffers rätseln, dachte Lang. Sendlinger und sein Team würden die Sachen auf Spuren aller Art untersuchen, dann bekamen sie immerhin mit einiger Sicherheit die DNA der mysteriösen Geliebten. Die Tatortgruppe würde sich auch mit dem Hotelzimmer beschäftigen, doch davon war nicht allzu viel zu erwarten. Rassling war nicht dazu gekommen, es zu beziehen, und die Geliebte hatte keinen Schlüssel – keine »Keycard« – gehabt, um es zu öffnen. Seit dem amourösen Treffen des vorherigen Donnerstags war es vermutlich mehrmals belegt gewesen und gereinigt worden, das mussten sie noch prüfen.
Für heute schienen sie nicht mehr viel tun zu können. Doch dann fiel ihm ein, dass Cleo etwas von einem Bruder gesagt hatte, der gemeinsam mit Mathieu Rassling das Unternehmen geführt hatte.
»Dieser andere Rassling, der Bruder, wie hieß der, sagtest du? Haben wir von dem eine Adresse?« richtete er das Wort an Cleo, die immer noch mit Diana über den Kofferinhalt feixte.
Sofort wurde sie ernst.
»Klar, Marc Rassling, ich schau schnell ins ZMR«, antwortete sie, das Zentrale Melderegister ansprechend. Die Onlineauskunft auf dem Tablet lieferte rasch das Gewünschte.
»Institutsgasse 17 in Döbling, feine Gegend. Fahren wir noch hin?«
»Auf jeden Fall. Es ist zwar schon nach elf, aber die Angehörigen müssen so schnell wie möglich benachrichtigt und befragt werden. Wenn wir gleich aufbrechen, sind wir noch vor Mitternacht dort.«
4
Die Institutsgasse erwies sich, wenig verwunderlich, als Ansammlung luxuriöser Wiener Villen in verschiedenen historisierenden Stilen. Die Nummer 17 war, wie die meisten anderen Anwesen, mit einer hohen Mauer gesichert, in der ein massives schmiedeeisernes Tor mit Videoüberwachung und Gegensprechanlage die einzige Unterbrechung bildete. Durch das Tor konnten sie am Ende einer gepflegten, breiten Zufahrt vage ein großes Haus erkennen. Aus einem der Fenster drang noch Licht.
Lang klingelte und hielt, als eine Männerstimme ein knappes »Ja« hören ließ, seinen Dienstausweis in die Richtung der Überwachungskamera. Dann nannte er seinen und Cleos Namen und Dienstgrade und teilte mit, Herrn Doktor Rassling in einer wichtigen Angelegenheit sprechen zu müssen. Das Tor öffnete sich und gab den Weg zum Haus frei, einer zweistöckigen Villa im altdeutschen Stil. In der Eingangstür am oberen Ende einer kurzen Treppe erschien ein Mann Mitte vierzig, groß, schlank, braunhaarig, mit ernstem Gesichtsausdruck, trotz der späten Stunde leger, aber korrekt gekleidet in leichtem Pullover über Hemd und Anzughose. Wie hieß das nochmal im Bürojargon, Business Casual? Leo fragte sich, ob er noch Besuch erwartet hatte.
»Marc Rassling, bitte kommen Sie herein. Es kann nichts Gutes bedeuten, wenn die Polizei vor der Tür steht, noch dazu um diese Stunde. Wir gehen in die Bibliothek.« Mit diesen Worten durchschritt der Hausherr eine großzügige, mit einigen Antiquitäten ausgestattete hohe Eingangshalle, um die Tür zu einem Raum an der rechten Seite zu öffnen und die beiden eintreten zu lassen. Aus diesem Zimmer musste wohl das Licht stammen, das sie vom Tor aus gesehen hatten. Sie befanden sich in einer klassischen, repräsentativen Bibliothek mit Wänden voller Bücher, einem massiven Mahagonischreibtisch mit grüner Banker-Lampe, Computerbildschirm, aufgeschlagenen Ordnern und einigen Lederfauteuils um einen kleinen Tisch. Rassling bedeutete ihnen mit einer Handbewegung, Platz zu nehmen. Sein ganzes Gehabe und seine Stimme verrieten, dass er gewöhnt war, Anordnungen zu erteilen und deren widerspruchslose Befolgung erwartete.
»Es geht um Ihren Bruder«, begann Leo, doch bevor er fortfahren konnte, entspannte sich das Gesicht seines Gegenübers schlagartig. Er lehnte den Kopf zurück, schloss für einen Sekundenbruchteil die Augen und atmete tief aus. Dann gab er sich einen Ruck.
»Verzeihen Sie bitte. Meine Frau schläft schon, und meine beiden Söhne Jörg und Felix sitzen vermutlich noch hinter dem Haus im Garten, wenn sie nicht auch schon ins Bett gegangen sind. Aber meine Tochter – Marianne, sie ist zwanzig – ist mit Freunden unterwegs. Als ich ›Polizei‹ hörte, dachte ich natürlich sofort an einen Unfall. Gott sei Dank, dass es nicht um Marianne geht!«
Lang konnte Rasslings Sorge um seine Tochter gut verstehen – er hatte wieder den kleinen Stich gespürt bei dem Gedanken, selbst keine Tochter mehr zu haben, um die man sich Sorgen hätte machen können. Auch wenn es schon so viele Jahre her war. Cleo betrachtete Rasslings Aussage natürlich distanzierter. Lang bemerkte, dass sie zu einer kritischen Frage ansetzte, doch der Industrielle kam ihr zuvor, indem er sich aufrichtete und seine Züge straffte.
»Verstehen Sie mich bitte richtig«, beeilte er sich, um keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen, »ich freue mich keineswegs, wenn mein Bruder Probleme hat. Hatte er einen Unfall, ist er verletzt, oder was ist denn jetzt eigentlich passiert?«
»Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Bruder, Diplomingenieur Mathieu Rassling, heute Abend ums Leben gekommen ist. Alles deutet darauf hin, dass er weder durch einen Unfall noch durch Selbstmord zu Tode kam, sondern durch Fremdeinwirkung. Das bedeutet, dass wir in einem Mordfall ermitteln.« Cleo hatte langsam und deutlich in einem amtlich wirkenden Tonfall gesprochen, ihr Gegenüber nicht aus den Augen lassend.
Marc Rasslings Reaktion überraschte beide. Sein Gesicht zeigte keinerlei Regung – nicht einmal ein Blinzeln störte die ernste Harmonie seiner Züge. Lang fiel ein, was ihm eine Bekannte, die in der PR-Abteilung eines großen Unternehmens arbeitete, einmal erzählt hatte: dass sie vorsorglich Fotos der Mitglieder des Spitzenmanagements mit allen möglichen Gesichtsausdrücken angefertigt hätten, um für jede Eventualität sofort Bilder für Presseaussendungen bereit zu haben. Erfreut, belustigt, ernst, betroffen … »Wenn fünfhundert Leute gekündigt werden müssen oder die Umwelt durch einen Unfall beeinträchtigt wurde, darf kein Bild eines strahlend lächelnden Geschäftsführers publiziert werden«, hatte sie gesagt. »Da greifen wir halt zum ›Nachdenklichen‹ oder ›aufrichtig Betroffenen‹ oder gar zum ›Entsetzten‹, je nachdem, wie schlimm es ist.«
Rasslings Gesicht rief in Leo das Bild des »aufrichtig Betroffenen« hervor, ebenso glatt und professionell wie verlogen. Dieser Mann trauerte nicht um seinen Bruder.
»Ermordet? Um Gottes willen, das ist ja furchtbar! Wer hat das getan, wissen Sie schon Näheres? Wie wurde er denn getötet? Und wo? Ich habe ihn heute Vormittag noch gesehen!«
»Leider können wir aus ermittlungstechnischen Gründen noch keine Details bekanntgeben«, erwiderte Lang. Glatt und professionell konnte er auch, ebenso gut wie dieser Firmenboss. »Vielleicht können Sie uns helfen. Wissen Sie, ob jemand einen Grund gehabt haben könnte, Ihrem Bruder etwas anzutun?«
Rassling schwieg einige Zeit, bevor er antwortete.
»Wer, so wie mein Bruder und ich, ein größeres Unternehmen führt, hat nicht nur Freunde. Es ist möglich, dass Mathieu irgendwelche Konflikte hatte – mit Mitarbeitern, ehemaligen Angestellten, Mitbewerbern, nicht zum Zug gekommenen Lieferanten, was weiß ich – aber mir ist nichts Konkretes bekannt. Privat war er seit etwa einem Jahr geschieden, da gab es meines Wissens eine saubere Lösung, auch finanziell. Auf Anhieb fällt mir nichts ein, was Ihnen von Nutzen sein könnte.«
»Und wie war Ihr Verhältnis zu Ihrem Bruder? Harmonierten Sie gut bei der Unternehmensführung oder gab es Meinungsverschiedenheiten?« hakte Cleo nach.
Die Reaktion war ebenso kühl wie abweisend-arrogant.
»Falls Sie damit sagen wollen, dass ich etwas mit dem Tod Mathieus zu tun haben könnte, trifft das keineswegs zu«, kam es schneidend. »Mein Bruder und ich hatten ein völlig normales Verhältnis. Natürlich gab es auch einmal Meinungsverschiedenheiten, wie in jedem Unternehmen, aber wir haben immer eine Lösung gefunden. Und dank dieser letztlich harmonischen Zusammenarbeit stehen die Rasslingwerke hervorragend da, das kann ich Ihnen sagen!«
Das verräterische »letztlich« war weder Lang noch Cleo entgangen.
»Wussten Sie eigentlich, dass er sich regelmäßig mit einer Geliebten traf?« schlug Leo nun eine andere Richtung ein.
»Eine Geliebte?« fragte Rassling verblüfft. Diese Verblüffung, dachte Lang, war echt. »Nein, davon hatte ich keine Ahnung. Es wäre ja weiter nicht verwunderlich, wenn er nach der Scheidung wieder eine Freundin oder Partnerin gehabt hätte, aber ›Geliebte‹ klingt irgendwie melodramatisch und nach übertriebener Heimlichtuerei. Mich hat er jedenfalls diesbezüglich nicht ins Vertrauen gezogen, aber wir hatten privat, ehrlich gesagt, wenig Kontakt. Vielleicht weiß meine Schwester Claire Näheres. Ich werde sie gleich informieren.«
In diesem Augenblick hörten sie Geräusche in der Halle und der Hausherr ging rasch zur Tür.
»Marianne, du bist wieder da!« Er umarmte die schöne junge Frau mit den langen kastanienbraunen Haaren mit einer Heftigkeit, die unterstrich, wie groß seine Erleichterung war, dass seiner Tochter nichts zugestoßen war. Sie erwiderte die Umarmung lachend. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden war nicht zu übersehen.
»Pfoah Daddy, ich war doch nicht bei einer Nordpolexpedition! Nur a bisserl fort mit meiner Clique! Wer sind denn deine Gäste?«
Der Vater beeilte sich, sie über das Geschehene ins Bild zu setzen. Sie zeigte sich bestürzt, aber, so dachte Leo, auch nicht wirklich traurig über den Tod des Onkels. »Privat wenig Kontakt«, hatte der Vater gesagt, das traf sicher auch auf die Tochter zu. Ihrem Daddy schien sie aber sehr zugetan.
»Wir werden Ihre Hilfe in den kommenden Tagen wahrscheinlich noch benötigen. Außerdem brauchen wir eine formelle Identifikation des Leichnams. Wir melden uns bei Ihnen«, verabschiedete er sich, um gemeinsam mit Cleo die Villa zu verlassen.
511. August
Auch beim Betreten der Büroräume seiner Gruppe am nächsten Morgen spürte Lang nichts von der Betroffenheit, die das gewaltsame Ableben eines mitten im Leben stehenden Menschen gewöhnlich auslöst. Der klare, noch kühle Freitagmorgen, der mit dem fröhlichen Vogelgezwitscher vor den Fenstern einen wunderschönen Sommertag versprach, schien alles andere zu überlagern. Leos Mitarbeiter unterhielten sich offenbar über ihre Freizeiterlebnisse. Er konnte es ihnen nicht verargen – das Leben bestand schließlich nicht nur aus Arbeit.
»Morgen allerseits! Na Helmut, wie war’s im Schweizerhaus?« »Leiwand! A guats Papperl in angenehmer Gesellschaft, was wüst mehr?« An die anderen gewandt, gab Nowotny gleich eine Anekdote zum Besten. »Der Piefke am Nebntisch hat erst a Übersetzung braucht, Stözn is Stelze is Eisbein. Dann fragt er den Ober: ›Herr Ooober, sangsemal, was ist denn bai dieser Stellze dabai?‹« Nowotny versuchte, die Sprachfärbung des norddeutschen Gastes nachzuahmen, was ihm nicht besonders gut gelang. »Da sagt der Ober: ›A Gabl und a Messer, gnä Herr!‹ Dem sei Gesicht hättet’s sehn solln!«
Leo, Goncalves und Cleo setzten ihr Pflichtlächeln auf. In diesem Augenblick kam Leos Vorgesetzter, Oberst Bruno Sickinger, mit einem »Guten Morgen!« zur Tür herein. Anlässlich des neuen Falls würde er heute an der Gruppenbesprechung teilnehmen, wozu sie sich in den Besprechungsraum begaben.
Goncalves meldete sich, noch bevor die eigentliche Sitzung begonnen hatte. Leo hatte seine Unruhe schon bemerkt.
»Cleo hat uns erzählt, dass es einen neuen Fall gibt, ein prominenter Industrieller, also medienwirksam und wahrscheinlich mit Druck von verschiedenen Seiten.« Sickinger und Lang nickten. »Ich bin ja die nächsten drei Wochen auf Urlaub bei meiner Familie in Brasilien, morgen früh geht mein Flieger. Wenn es notwendig sein sollte, bin ich natürlich bereit, alles zu canceln. Müssen meine Eltern halt allein fliegen.«
Klar, dass sich Roberto, der Ehrgeizler vom Dienst, für unentbehrlich hielt, dachte Lang. Auch wenn der Milchkaffeebraune natürlich schmerzlich fehlen würde, mussten sie es doch schaffen, ein paar Wochen ohne ihn auszukommen, noch dazu, weil Schneebauer am Montag wieder aus dem Urlaub zurück sein würde. Dieser Meinung war auch Sickinger.