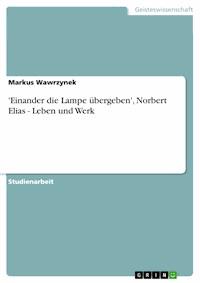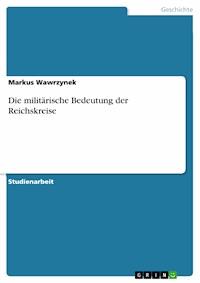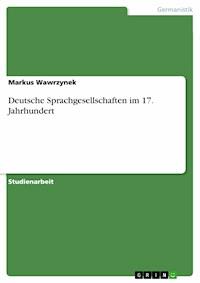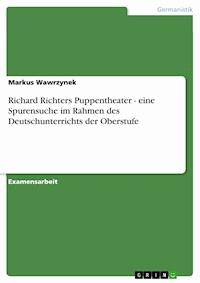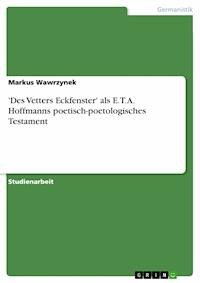
'Des Vetters Eckfenster' als E. T. A. Hoffmanns poetisch-poetologisches Testament E-Book
Markus Wawrzynek
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2000 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Institut für Germanistik), Veranstaltung: E. T. A. Hoffmann, Sprache: Deutsch, Abstract: E. T. A. Hoffmanns zu Lebzeiten zuletzt erschienene Erzählung „Des Vetters Eckfenster“, die im Gesamtwerk Hoffmanns aufgrund der autobiographischen Bezüge und der exemplarischen Durchführung seines im Spätwerk herausgearbeiteten poetologischen Konzepts („das serapiontische Prinzip“) eine zentrale Stelle einnimmt, wurde bisher literaturgeschichtlich sehr unterschiedlich eingeordnet. Die Spannweite der Einschätzungen reicht von der Zurechnung zur Romantik über die Schwelle zum Biedermeier bis hin zum poetischen (Früh-) Realismus, wobei viele Interpretatoren den fließenden Übergangs- bzw. Schwellencharakter der Erzählung herausstellen, der auf kommende literarische Epochen verweist. Die Unsicherheit in der literaturhistorischen Einordnung, die zweifelsohne aus Hoffmanns Entwicklung vom nachtseitigen „Gespenster-Hoffmann“ hin zum „späten Hoffmann [, der] andere, historisch konkretere Züge auf[weist] als das Frühwerk“ , herrührt, trübt jedoch in keiner Weise die enorme Wertschätzung, die Hoffmanns letzter Erzählung in der Sekundärliteratur entgegengebracht wird. Fritz Martini sieht in Hoffmanns „Des Vetters Eckfenster“ „eine seiner letzten und schönsten Erzählungen“ und nennt sie „einen geradezu typische[n] Ausdruck des bürgerlichen Biedermeier mit dem Einschluss eines mühsam gebändigten Grundgefühls schmerzlicher Resignation, mit weltverklärendem Realismus und weltüberwindenden Humor“. Auch Walter Benjamin streicht in seiner Untersuchung zum frz. Lyriker Baudelaire die Nähe der Hoffmannschen Skizze zum Biedermeier heraus. Kurt Willimczik rückt das „Eckfenster“, das er als „Höhepunkt des Hoffmannschen Schaffens“ anerkennt, eher in Richtung des Realismus, von dem „die Anfänger der ‘realistischen Erzählung’ […] lernen könnten“. Zu einem ähnlichen Urteil gelangt Lothar Köhn: Die „Gesamtstruktur [des „Eckfensters“] deutet, unmittelbarer vielleicht als die anderer Hofmannscher Erzählungen, auf die Literatur kommender Jahrzehnte hin.“ Er sieht „Des Vetters Eckfenster“ als Schlusspunkt einer Entwicklung hin zum poetischen Realismus, ebenso wie Karl Riha: „Als literarisches Dokument begründet Hoffmanns Erzählung […] in spätromantischer Landschaft eine der wesentlichen Positionen des deutschen Frührealismus.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2003
Ähnliche
Page 1
Abteilung für Vergleichende Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft
„‘Des Vetters Eckfenster’ als E. T. A. Hoffmanns
Page 3
1. Einleitung: Forschungsüberblick und Ziele
E. T. A. Hoffmanns zu Lebzeiten zuletzt erschienene Erzählung „Des Vetters Eckfenster“, die im Gesamtwerk Hoffmanns aufgrund der autobiographischen Bezüge und der exemplarischen Durchführung seines im Spätwerk herausgearbeiteten poetologischen Konzepts („das serapiontische Prinzip“) eine zentrale Stelle einnimmt, wurde bisher literaturgeschichtlich sehr unterschiedlich eingeordnet. Die Spannweite der Einschätzungen reicht von der Zurechnung zur Romantik über die Schwelle zum Biedermeier bis hin zum poetischen (Früh-) Realismus, wobei viele Interpretatoren den fließenden Übergangs- bzw. Schwellencharakter der Erzählung herausstellen, der auf kommende literarische Epochen verweist. Die Unsicherheit in der literaturhistorischen Einordnung1, die zweifelsohne aus Hoffmanns Entwicklung vom nachtseitigen „Gespenster-Hoffmann“ hin zum „späten Hoffmann [, der] andere, historisch konkretere Züge auf[weist] als das Frühwerk“2, herrührt, trübt jedoch in keiner Weise die enorme Wertschätzung, die Hoffmanns letzter Erzählung in der Sekundärliteratur entgegengebracht wird.
Fritz Martini sieht in Hoffmanns „Des Vetters Eckfenster“ „eine seiner letzten und schönsten Erzählungen“ und nennt sie „einen geradezu typische[n] Ausdruck des bürgerlichen Biedermeier mit dem Einschluß eines mühsam gebändigten Grundgefühls schmerzlicher Resignation, mit weltverklärendem Realismus und weltüberwindenden Humor“.3Auch Walter Benjamin streicht in seiner Untersuchung zum frz. Lyriker Baudelaire die Nähe der Hoffmannschen Skizze zum Biedermeier heraus.4Kurt Willimczik rückt das „Eckfenster“, das er als „Höhepunkt des Hoffmannschen Schaffens“ anerkennt, eher in Richtung des Realismus, von dem „die
1Vgl. Köhn (1966), S. 229f zur literarischen Einordnung des Gesamtwerks. - Ein kurzer Hinweis zur Zitierweise: Sekundärliteratur wird mit Nachnamen des Autors, Erscheinungsjahr und Seitenzahl zitiert, der Primärliteratur wird noch ein kurzer Titelzusatz zur schnelleren geistigen Verortung hinzugesetzt.
2Mayer (1969), S. 299.
3Martini (1955), S. 59.
4Benjamin (1997), S. 124f. - Lothar Pikulik weißt bereits für die spät entstandene Rahmen-erzählung der „Serapions-Brüder“ biedermeierliche Momente wie die Bedeutung der Behaglichkeit innerhalb der geselligen Ordensrunde nach. Im Spätwerk Hoffmanns steht „Des Vetters Eckfenster“ mit seinen biedermeierlich-realistischen Elementen folglich nicht singulär da [Vgl. Pikulik (1987), S. 21]. Eine Textstelle aus „des Vetters Eckfenster sei hier nur beispielhaft angeführt: „Sieh, […] wie jetzt dagegen der Markt das anmutige Bild der Wohlbehaglichkeit und des sittlichen Friedens darbietet.“ [Hoffmann (1978): Des Vetters Eckfenster, S. 620]
Page 4
Anfänger der ‘realistischen Erzählung’ […] lernen könnten“.5Zu einem ähnlichen Urteil gelangt Lothar Köhn: Die „Gesamtstruktur [des „Eckfensters“ - M. W.] deutet, unmittelbarer vielleicht als die anderer Hofmannscher Erzählungen, auf die Literatur kommender Jahrzehnte hin.“6Er sieht „Des Vetters Eckfenster“ als Schlußpunkt einer Entwicklung hin zum poetischen Realismus,7ebenso wie Karl Riha: „Als literarisches Dokument begründet Hoffmanns Erzählung […] in spätromantischer Landschaft eine der wesentlichen Positionen des deutschen Frührealismus.“8Andere Literaturwissenschaftler betonen dagegen die Kontinuität zu frühen romantischen Arbeiten Hoffmanns und unterstreichen eher den „testamentarischen“ Charakter der Erzählung, in der Hoffmann, vermittelt durch den kranken Vetter, versucht, den jungen Verwandten9und folglich den Leser gleichsam als Initiation in die „Primitien der Kunst zu schauen“10einzuführen und somit sein poetologisches Konzept am Beispiel offenzulegen und zu tradieren.11
Die inzwischen doch relativ zahlreichen Interpretatoren dieser kleinen Hoffmannschen Skizze heben zudem unterschiedliche Aspekte ins Gesichtsfeld des Betrachters. Walter Benjamin, Heinz Brüggemann und Karl Riha widmen sich der literarischen Wahrnehmung der „großen Stadt“ Berlin, Günter Oesterle untersucht die aufkärerisch geprägten Wahrnehmungsmuster, die die beiden Vettern erkennen lassen, während Helmut Lethen einen Vergleich Musilscher und Hoffmannscher Wahrnehmungsexperimente durchführt. Hans-Georg Werner hebt besonders Hoffmanns Hinwendung zum „einfachen Volk“ hervor, in der er eine besondere

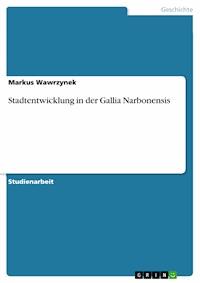
![Eine der ruhigsten und dem Gesetze folgsamsten Städte[.] des Königreichs? Sicherheitsinstitutionen in Fürth im 19. Jahrhundert - Markus Wawrzynek - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a79b9f77bd560d03385de8becef673c9/w200_u90.jpg)