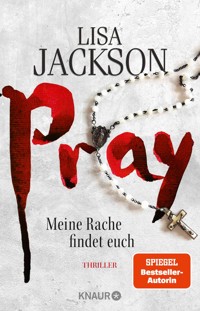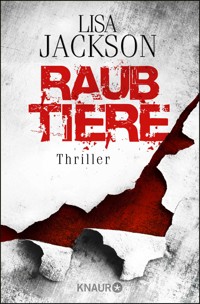9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Bentz und Montoya
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Der Anblick des Tatorts ist verstörend – selbst für erfahrene Detectives wie Rick Bentz und Reuben Montoya. In der Kirche St. Marguerite ist eine Nonne, bekleidet mit einem vergilbten Brautkleid, erdrosselt worden. Die Tatwaffe: ein Rosenkranz. Die Obduktion ergibt, dass Schwester Camille schwanger war. Schon wenige Tage später stirbt eine weitere Nonne. Aus sie hütete ein Geheimnis. Eine Mordserie, die Detective Bentz an den Rosenkranzmörder erinnert, den er vor zehn Jahren erschossen hatte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 692
Ähnliche
Lisa Jackson
Desire
Die Zeit der Rache ist gekommen
Aus dem Amerikanischen von Kristina Lake-Zapp
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Kapitel eins
Es ist so weit«, sagte die Stimme. Sie war deutlich zu hören.
Camille lächelte in sich hinein und verspürte eine unglaubliche Erleichterung, als sie das letzte Knöpfchen durch die kleine Schlinge steckte. Sie betrachtete sich in dem winzigen Spiegel und richtete ihren Schleier.
»Du bist ein Traum in Weiß«, schwärmte ihr Vater.
Aber er war ja gar nicht hier, oder doch? Er geleitete sie nicht den Mittelgang entlang zum Altar. Nein, nein, natürlich nicht. Schließlich war er seit Jahren tot. Zumindest nahm sie das an. Außerdem war ihr Vater gar nicht ihr Vater … nur von Rechts wegen. Nicht wahr? Camille blinzelte. Benommen versuchte sie, einen klaren Kopf zu bekommen, das Gefühl abzuschütteln, neben sich zu stehen.
Das liegt daran, dass heute dein Hochzeitstag ist, deine Nerven spielen dir einen Streich.
»Dein Bräutigam wartet.« Die Stimme drängte sie zur Eile, und sie fragte sich, ob wirklich jemand zu ihr sprach oder ob sie sich das nur einbildete.
Du Dummkopf, natürlich ist das echt!
Camille verließ das kleine Zimmer, in dem sie sich angekleidet hatte, und ging unsicheren Schrittes durch den dunklen Korridor, der nur von ein paar flackernden Wandleuchtern erhellt wurde.
Sie schritt eine breite Treppe hinunter, die blank getreten war von Tausenden auf und ab huschender Füße, und gelangte in eine kleine Kapelle. Dort, so wusste sie, würde er sie erwarten.
Ihr Herz pochte laut vor Aufregung, und das Blut pulsierte durch ihre Adern.
Was für eine herrliche, wundervolle Nacht!
Mit einer Hand hielt sie sich an dem langen, glatten Treppengeländer fest, ihre Fingerspitzen glitten über den polierten Handlauf.
»Beeil dich«, befahl ihr eine barsche Stimme direkt an ihrem Ohr, und sie wäre beinahe über ihr Kleid gestolpert. »Du darfst ihn nicht warten lassen!«
»Das wird nicht geschehen«, versprach sie. Ihre Stimme warf ein entferntes Echo, als hallte sie durch einen Tunnel, aber vielleicht war auch das nur Einbildung.
Sie raffte ihren Rock, um schneller gehen zu können. Ihre Füße berührten kaum den Fußboden. Sie fühlte sich leicht, als würde sie schweben, und die Vorfreude trieb sie voran.
Mondlicht fiel verschwommen durch die großen Maßwerkfenster aus Buntglas, warf Schatten und farbige Muster auf den Boden. Als sie die Kapelle erreichte, zitterten ihre Beine, als trüge sie hohe Absätze.
Doch ihre Füße waren nackt, die Kälte des Steinfußbodens kroch durch ihre Fußsohlen.
Armut, Keuschheit, Gehorsam.
Die Wörter wirbelten durch Camilles Kopf, als sie durch die geöffnete Tür trat. In ihrem Innern erklang Musik, die Stimmen der Engel stiegen auf an ihrem heutigen Hochzeitstag in der Kapelle von St. Marguerite.
Hochzeitsnacht … es ist Nacht.
Auf dem Altar flackerten Kerzen, darüber erhob sich ein gewaltiges Kruzifix, welches sie an das Leiden Christi gemahnte. Sie bekreuzigte sich und kniete nieder, dann ging sie langsam nach vorn.
Armut. Keuschheit. Gehorsam.
Ihre Finger schlossen sich um die glatten Perlen ihres Rosenkranzes. Die Musik in ihrem Kopf wurde lauter.
Als sie den Altar erreichte, begann die Kirchenglocke zu läuten, und sie sank vor dem Angesicht Gottes auf die Knie. Sie war bereit, ihre Gelübde abzulegen, ihr Leben dem zu schenken, den sie liebte.
»Gut … sehr gut … perfekt.«
Immer noch auf den Knien, senkte Camille ihren Kopf im Gebet. Dann hob sie ihn wieder, blickte zum Kruzifix auf und betrachtete die Wunden auf Jesu ausgemergeltem Körper, wurde Zeugin seines Opfers für ihre eigenen weltlichen Sünden.
O ja, sie hatte gesündigt.
Wieder und wieder.
Jetzt würde sie davon freigesprochen werden.
Geliebt werden.
Für immer.
Sie schloss die Augen und senkte mit einiger Mühe erneut den Kopf, der sich plötzlich schwer anfühlte, ihre zum Gebet gefalteten Hände ungelenk. Die Kapelle veränderte sich, wurde finsterer, die Statue der Heiligen Jungfrau mit den Engeln neben dem Taufbecken starrte sie auf einmal mit anklagendem Blick an.
Sie hörte das Scharren eines Schuhs auf dem Steinboden. Ihre Unbeschwertheit und Freude wichen Furcht.
Du darfst nicht verzagen. Nicht heute Nacht …
Doch selbst ihr Hochzeitskleid fühlte sich nicht mehr seidig und weich an – der Stoff war plötzlich grob und kratzig, ein modrig-muffiger Geruch stieg daraus auf.
Camille beschlich ein so beklommenes Gefühl, dass die Haut in ihrem Nacken unter dem Schleier zu kribbeln anfing.
Nein, nein, nein … hier stimmt etwas nicht.
»Dann weißt du es jetzt also«, zischte die Stimme an ihrem Ohr scharf. Sie schreckte zurück. »Der Sünde Lohn ist …«
»Der Tod«, flüsterte sie.
Nacktes Entsetzen ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. O Gott! In plötzlicher Todesangst bemühte sich Camille, auf die Füße zu kommen.
In diesem Augenblick schlug das Schicksal zu.
Der Rosenkranz wurde ihr aus den Händen gezerrt, die Schnur riss, die Perlen hüpften über den Boden.
Obwohl sie mit aller Macht aufzustehen versuchte, versagten ihre Knie, und ihre Beine waren wie aus Gummi. Es war ohnehin zu spät.
Eine feste Schnur legte sich um ihren Hals und zog sich zusammen.
NEIN! Was soll das?
Scharfkantige Perlen schnitten tief in ihren Hals.
Panik durchflutete sie.
Nein, nein, nein! Das darf nicht sein!
Helft mir!
Glühender Schmerz schoss durch ihren Körper. Sie machte einen Ruck nach vorn und versuchte, ihrem Angreifer zu entrinnen, doch sie bekam keine Luft mehr, konnte nicht mehr atmen. Ihre Lungen dehnten sich unter dem Druck.
Mein Gott, was geschah nur mit ihr?
Und warum?
Das Kirchenschiff schien sich zu drehen, die hohe Decke geriet ins Trudeln, als das Monster in ihrem Rücken die tödliche Schnur engerzog.
Entsetzen packte Camille. Verzweifelt versuchte sie, sich zu befreien, sich zu winden und um sich zu treten, aber ihr Körper wollte ihr nicht gehorchen. Das Gewicht in ihrem Rücken war erdrückend, die Schnur mit den scharfen Perlen schnitt tiefer und tiefer in das weiche Fleisch ihres Halses.
Das Blut pochte hinter ihren Augäpfeln und hallte dröhnend in ihren Ohren wider. Ihre Finger tasteten panisch nach der Schnur, ein Fingernagel brach ab.
Sie drückte den Rücken durch und kämpfte wie wild – vergeblich.
Bitte, bitte, bitte! Lieber Vater, verschone mich! Ich habe gesündigt, aber bitte –
Ihre Füße rutschten fort. Sie ruderte schwach mit den Armen. Langsam verließen sie ihre Kräfte.
Nein, Camille. Kämpfe! Gib nicht auf! Jemand wird dich retten.
Ihr Blick fiel auf das Kruzifix, doch das ausgemergelte Gesicht von Jesus Christus verschwamm. Es tut mir leid …
Sie war jetzt sehr schwach, ihre Versuche, sich zur Wehr zu setzen, sinn- und zwecklos.
Ihr Körper erschlaffte.
»Bitte«, bettelte sie, doch ihr Flehen war leise und kaum zu verstehen.
Der Dämon, der seinen Fuß in diese Kapelle gesetzt, das Monster, das diesen heiligen Boden entweiht hatte, hielt sie fest. Zog an der Schnur. Unbarmherzig. Mit einem finsteren, tödlichen Ziel.
Camilles Lungen brannten, ihr Herz klopfte so heftig, dass sie sicher war, es würde zerspringen. Sie hatte die Augen vor Angst weit aufgerissen, doch sie sah nichts als einen roten Schleier.
Oh, lieber Gott, dieser Schmerz!
Wieder versuchte sie, nach Luft zu schnappen, doch es gelang ihr nicht.
Die Schnur zog sich mit brutaler Stärke nur noch weiter zu.
Camille zuckte in ihrer Todesqual.
»Hure«, klagte die Stimme sie an. »Tochter Satans!«
Nein!
Ihr Blick richtete sich erneut auf Jesus am Kreuz. Er hatte einen blutroten Schleier über dem schönen Gesicht, Bluttränen liefen ihm aus den Augen.
Ich liebe dich.
Die Sintflut von Sünden, die sie ihr Leben genannt hatte, brach über sie herein – Bilder derer, die sie betrogen hatte, flackerten vor ihr auf. Ihre Mutter und ihr Vater, ihre Schwester, ihre beste Freundin … so viele Menschen, darunter manche, die sie geliebt hatten … die Unschuldigen.
Das hier war ihre Strafe, wurde ihr nun klar. Sie griff nicht mehr nach der Schnur, sondern ließ die Hände vom Hals über ihren Bauch gleiten, wo sie auf dem Unterleib liegen blieben.
Zisch! Ein helles Licht flammte vor ihren Augen auf, dann war alles dunkel.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wasche mich rein von meinen Sünden … Vergib mir, denn ich habe gesündigt …
Kapitel zwei
Um Himmels willen!« Valerie drückte immer und immer wieder auf die Escape-Taste ihres Laptops, als könnte sie so den völlig überholten Computer mit seiner antiquierten Festplatte ins Leben zurückholen. »Komm schon, komm schon!«, murmelte sie mit zusammengebissenen Zähnen, dann gab sie auf, unfähig, das verdammte Ding abzuschalten, ohne den Akku herauszunehmen.
Jetzt reichte es! Morgen würde sie sich einen neuen Computer kaufen, egal, was ihr Konto dazu sagte. Der Verfügungsrahmen ihrer Kreditkarte war noch nicht ganz ausgereizt, doch eine Ausgabe in der Höhe würde ihn sicherlich sprengen.
Der Preis einer Scheidung, gestand sie sich ein und schob den Laptop von ihrem Schoß auf das zerknitterte Bettzeug. In ihrem Pyjama, dessen Hose und Oberteil nicht zusammenpassten, ging sie in die Küche der kleinen Remise und hielt den Kopf unter den Wasserhahn, um zu trinken. Dann starrte sie durch das Fenster, das voller Regentropfen war, in die Nacht hinaus.
Hier in New Orleans war die Luft erfüllt vom bevorstehenden Sommer, und ein leichter Schweißfilm bildete sich auf ihrer Haut. Sie öffnete das Fenster einen Spaltbreit, so dass der dumpfige Geruch des langsam fließenden Flusses hereinwehte. In weiter Ferne war der Verkehr auf dem Freeway zu hören, ein permanentes Rauschen, das im Wettstreit stand mit dem Zirpen der Grillen und dem Rufen der Kröten.
Die Glocken von St. Marguerite läuteten Mitternacht, einsam hallten die Schläge durch die Dunkelheit.
Unerklärlicherweise fing Vals Haut an zu kribbeln. Ihre Polizistinneninstinkte schalteten auf Schnellgang, und wieder einmal hatte sie das Gefühl, beobachtet zu werden. Verborgene Augen verfolgten sie.
»Zu viele Nächte mit Science-Fiction-Filmen«, sagte sie zu sich selbst. »Zu viele Alpträume.«
Für eine flüchtige Sekunde schoss ihr eine Erinnerung mit scharfen, brüchigen Kanten durch den Kopf. Verschwommen. Bedrohlich.
Das Bild, das sie vor ihrem inneren Auge sah, ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. Gehüllt in schwarze Gewänder, mit grausam funkelnden Augen, wurde die unheilvolle Kreatur größer. In der klauenähnlichen Hand baumelte eine glitzernde Kette, die sie zu einer Art Schlinge formte. Valerie meinte, einen fauligen Geruch wahrzunehmen.
Niemand könnte ihr helfen.
Niemand könnte sie retten.
»Sssss«, zischte die Kreatur und senkte die silbrige Schlinge. »Sssss.«
Camille!, dachte Val voller Entsetzen. Der Dämon will Camille …
Im selben Augenblick verschwand das entsetzliche Bild, versank in den Tiefen ihrer Seele. Aus Erfahrung wusste Val, dass es dort lauerte, bis es ungebeten erneut an die Oberfläche dringen würde.
»Lass mich in Ruhe«, murmelte sie und ignorierte die feinen Härchen, die sich auf ihren Armen gesträubt hatten. Dieser Teufel war ein Ausbund ihrer Phantasie, mehr nicht – nichts, woran eine geistig gesunde, bodenständige Frau glauben sollte.
Val holte tief Luft, um sich zu beruhigen. Immer noch hallte der Glockenschlag von St. Marguerite in klagendem Ton durch die Nacht. Innerlich fröstelnd, hielt sie sich an der Kante des Küchentresens fest.
Denk nicht mehr daran, ermahnte sie sich. Sich näher mit den heimtückischen Bildern in ihrem Kopf zu befassen würde zu nichts anderem als einer sich selbst bewahrheitenden, abscheulichen Prophezeiung führen.
»Alles ist in Ordnung«, sagte sie laut, obwohl sie innerlich zitterte, geschüttelt von einer Angst, die sie zu verbergen suchte. Niemand durfte davon etwas wissen. Sie war eine starke Frau. Alpträume oder Visionen, heraufbeschworen von ihrem so bereitwilligen Gehirn, würden sie nicht das Fürchten lehren. »Um Gottes willen, reiß dich zusammen!«, befahl sie sich.
Sie war lediglich gestresst. Wer wäre das nicht an ihrer Stelle? Vor ihr lag eine Scheidung, mit ihrer Karriere war es zu Ende, sie stand unmittelbar vor dem Bankrott, und sie hatte eine Schwester – nur diese einzige –, die im Begriff war, ihre Gelübde in einem Konvent abzulegen, der direkt aus dem Mittelalter zu stammen schien! Und dann war da noch diese E-Mail von Camille, ihrer Schwester, die ziemlich beunruhigend klang.
Val dachte an St. Marguerite, die historische Kathedrale, in der Camille zur Braut Jesu werden wollte.
Vorausgesetzt die Klostervorsteherin akzeptierte ihren Wunsch.
Diese Entscheidung war einfach untypisch für Camille, das Partygirl, das immer einen Freund, immer mit Problemen zu kämpfen gehabt hatte. Valerie bezweifelte, dass ausgerechnet ein Konvent wie St. Marguerite Camille ihre Sünden vergeben würde. Dieses Frauenkloster mit den verschlossenen Toren, dem antiquierten Kommunikationssystem und den strikten Regeln erinnerte sie mehr an eine mittelalterliche Festung als an ein Gotteshaus. Es war ein vom Rest der Welt isolierter Ort, an dem das einundzwanzigste Jahrhundert vorbeigezogen war. Die Menschen in den heiligen Mauern dort orientierten sich an vergangenen Jahrhunderten, in denen archaische Sitten, grausame Disziplin und vorsintflutliche Meinungen vorgeherrscht hatten. Vielleicht wegen der Äbtissin oder Mutter Oberin oder wie sich die alte Fledermaus von Klostervorsteherin, Schwester Charity, nennen mochte. Diese Schwester Charity, die den alten Zeiten anhing, in welchen die Nonnen düstere Gewänder trugen und nichtsahnenden Schülern auf die Finger schlugen, in denen Drohungen und Einschüchterungen noch vor den Lobpreisungen standen, erinnerte eher an eine Gefängnisaufseherin als an eine geistliche Führerin.
Warum Camille beschlossen hatte, ausgerechnet in einer so strengen Einrichtung wie St. Marguerite ihr Gelübde abzulegen, war Valerie ein Rätsel.
Nein, das ist dir keineswegs ein Rätsel. Du kennst die Gründe – du willst sie dir nur nicht eingestehen.
Pssst!
Ein Flüstern des Bösen drang in Schwester Lucys Gehirn.
Sie riss die Augen auf und starrte in die Dunkelheit ihres winzigen Zimmers im Konvent. Ihre Haut kribbelte, ihr Mund schmeckte nach Metall. Vater im Himmel, bitte lass das bloß den Nachklang eines schlechten Traums sein, eines Alptraums, der –
Pssst!
Da war es wieder, der entsetzliche Vorbote dessen, was kommen würde. Sie warf die dünnen Decken von sich und fiel auf die Knie. Ihr Nachthemd bauschte sich um sie, als sie instinktiv nach dem Rosenkranz griff, den sie über den Pfosten des Metallbetts gehängt hatte. Schwester Lucy schlug mit dem daran befestigten Kruzifix das Kreuzzeichen und begann, stumm das Apostolikum aufzusagen. Schweiß sammelte sich auf ihrer Stirn. »Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde …« Und sie glaubte tatsächlich. Voller Inbrunst. Für gewöhnlich fand sie Trost in diesem Ritual, das sie seit ihrer Jugend kannte. In Zeiten großer Belastung, Sorge oder Not tröstete es sie, ihre Finger über die glänzenden Perlen gleiten zu lassen und die Gebete zu flüstern, die sie Gott näherbrachten.
Pssst! Wieder dieses elektrisierende Kribbeln unter ihrer Haut. Der Schweiß lief ihr zu den Augenbrauen.
Nicht hier, bitte nicht hier … nicht im Konvent! Ihr Gebet war unterbrochen, und sie begann von vorn, die Augenlider zusammengepresst, die Ellbogen auf die dünne Matratze gestemmt. Ihr Kopf surrte.
Wieder berührte sie mit dem Kruzifix ihre Stirn und begann mit der Folge von Gebeten, die ihr so leicht in den Sinn kamen.
Das muss ein Irrtum sein, dachte sie, während sie stumm die vertrauten Worte murmelte. Seit sie dem Konvent von St. Marguerite beigetreten war, in der Absicht, ihre letzten Ordensgelübde abzulegen, waren derartige »Zwischenfälle« – wie ihre Mutter sie genannt hatte – nicht mehr vorgekommen. Schwester Lucy hatte gemeint, hier in Sicherheit zu sein.
»Ich glaube an –«
Pssst! Lauter diesmal.
Schwester Lucy – ehedem Lucia Costa – holte scharf Luft und ließ ihren Rosenkranz fallen. Abermals war ihr Gebet unterbrochen worden. Sie erhob sich und gab es auf, dem Unvermeidlichen aus dem Weg gehen zu wollen. Barfuß schritt sie über den Hartholzboden und spürte, wie sich Ärger zusammenbraute, und zwar so gewiss wie ein Hurrikan vor der Küste Louisianas. Vor ihrem inneren Auge sah sie die Kapelle dieser Kirchengemeinde und blinzelte gegen eine wahre Flut von Bildern an.
Rot flackerndes Licht.
Ein verschwommenes Gesicht.
Ein abgetragenes, vergilbtes Kleid. Fadenscheinig. Zerrissen.
Ein wogendes, dunkles Gewand.
Verkniffene, todbringende Lippen.
Eine schwere Tür, die klickend ins Schloss fiel.
Ein blutiges Kruzifix, aus Christi heiligen Wunden tropfte es blutrot.
Tod, psalmodierte eine Stimme über das statische Rauschen in ihrem Kopf hinweg.
Sie stürmte in die Halle, die schwach von vereinzelten Wandleuchtern erhellt war, und rannte die Treppe hinunter. Ihre Finger glitten über den abgenutzten Handlauf. Sie folgte einem vorbestimmten Weg. Blasses Licht fiel durch die Buntglasscheiben, und die Hitze des Junitages war auch nachts noch zu spüren.
Warum?, fragte sich Lucia verzweifelt. Warum jetzt? Warum hier? Es ist nichts … bloß ein schlechter Traum. All deine Ängste kristallisieren sich, mehr steckt nicht dahinter.
Ihr Herz trommelte ungleichmäßig. Sie wandte sich der Kapelle zu – dem kleineren Ort der Andacht, im Gegensatz zu der gewaltigen Kathedrale. Ein Gefühl der Ungewissheit trieb sie vorwärts, und sie drückte gegen die zweiflügelige Tür, die sich leichtgängig öffnete, und betrat das Haus Gottes. Die Kapelle war für gewöhnlich ein Ort der Helligkeit, der Güte und Tugend, des Vergebens und der Erlösung, doch heute Nacht spürte Lucia, dass hier das Böse lauerte, so dunkel wie Satans Seele.
»Vater, steh mir bei.« Lucia tauchte die Fingerspitzen in geweihtes Wasser, bekreuzigte sich und betrat das Kirchenschiff. Es war, als sähe sie die Szene aus ihrem Kopf vor sich: Rote Votivkerzen flackerten und warfen zuckende Schatten auf die Steinwände. Ein riesiges Kruzifix hing von der Deckenwölbung über dem Altar, von wo aus Jesus in seiner Todesqual die Kapelle überblickte.
Instinktiv schlug Lucia erneut das Kreuz. Das Surren in ihrem Kopf verwandelte sich in ein Hämmern.
Aus dem Augenwinkel nahm sie eine flüchtige Bewegung wahr – eine dunkle Gestalt in sich bauschenden Gewändern, die durch eine Tür verschwand.
»Vater?«, rief sie in der Annahme, die Person, die aus der Kapelle eilte, sei ein Priester. Die Tür fiel mit einem Klicken ins Schloss. »Warten Sie! Bitte …« Sie lief zur Tür. »Vater – o nein …!« Ihre Stimme verklang, als sie auf dem Steinfußboden vor der ersten Bankreihe den Zipfel eines hauchzarten weiß-gelblichen Spitzenstoffes erblickte.
Was war das?
Um ein Haar wäre ihr Herz stehengeblieben.
Die Bilder, die ihr zuvor durch den Kopf geschossen waren, fielen ihr wieder ein.
Ein vergilbtes Kleid.
Grausame Lippen.
Eine Tür, die ins Schloss fiel.
Die Szene vor ihr war genau wie in ihrer Phantasie.
Wieder vernahm sie das Flüstern des Bösen. Lucia stürmte nach vorn, Richtung Altar, und wäre beinahe gestolpert. Ihre nackten Füße klatschten auf den kalten Steinboden, das Geräusch hallte von der hohen, gewölbten Decke wider.
Das kann nicht sein! Es kann einfach nicht sein!
Voller Angst, was sie vorfinden würde, stürzte sie in den vorderen Teil der Apsis, der von den prächtigen, jetzt dunklen Buntglasfenstern umgeben war. Das Kruzifix ragte hoch auf, der Sohn Gottes starrte in seinem Schmerz auf sie herab.
»O Gott!«, schrie Lucia. »Dios! Mi Dios!«
Eine gekrümmte Gestalt lag vor der ersten Bankreihe neben dem Taufbecken.
»No, por favor, Jesús. No, no, no!«
Der Anblick ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. Lucia unterdrückte mühsam einen weiteren Schrei und fiel neben der Braut in dem zarten, abgetragenen Brautkleid auf die Knie. Ein dünner Schleier bedeckte deren Gesicht.
Lucias Magen drehte sich um, als sie Schwester Camille erkannte – das Gesicht leichenblass, die Lippen blau, die Augen weit aufgerissen, starrte sie sie durch die durchsichtige Spitze blicklos an.
»Um Himmels willen …« Lucia schnappte nach Luft. Sie berührte Camilles noch warme Haut und tastete an ihrem Hals, an dem sich kleine Blutergüsse und Einschnitte zeigten, nach dem Puls. Fast hätte sie sich übergeben. Jemand hatte versucht, Camille zu töten. Aber, o Gott, war sie überhaupt noch am Leben? Spürte sie tatsächlich einen leichten Pulsschlag, oder bildete sie sich das nur ein?
»Camille«, krächzte Lucia verzweifelt und mit brechender Stimme, »halte durch! Bitte, halte durch … Mi Dios!«
Die Glockenschläge über ihrem Kopf klangen wie ein Totengeläut.
Sie blickte auf. »Hilfe! So hilf mir doch jemand!« Ihre Stimme stieg auf zu den Dachsparren und hallte zu ihr zurück. »Bitte!«
Der Frau, von der sie nicht wusste, ob sie noch lebte oder schon tot war, flüsterte sie zu: »Camille, ich bin’s, Lucia. Halte durch … Bitte, bitte … Deine Zeit ist noch nicht gekommen …« Aber jemand hatte beschlossen, dass Camille sterben sollte, und Lucia kannte die Person, die Camille Renard bestimmt gern tot gesehen hätte.
Aus tiefster Seele murmelte sie ein rasches Gebet, dann beugte sie sich mit Tränen in den Augen dicht an Camilles Ohr: »Bitte halte durch.« Mit ihrem Nachthemd versuchte Lucia, das immer stärker aus Camilles Halswunden austretende Blut zu stoppen.
Camille regte sich nicht.
Ihre Pupillen waren starr.
Ihre aschfahle Haut wurde kälter.
Lucia geriet in Panik. Sie musste etwas tun! Irgendetwas! Bitte, lieber Gott, nimm sie nicht zu dir. Noch nicht … O Vater!
»Hilfe!«, schrie Lucia wieder. Sie wollte die Freundin, die seit über einem Jahr zu ihrer Vertrauten geworden war, nicht verlieren, eine Frau, die sie einen Großteil ihres Lebens gekannt hatte. Sie durfte nicht sterben …
Bilder von Schwester Camille stürzten auf Lucia ein. Wie schön sie war mit ihrem geheimnisvollen Lächeln und den Augenbrauen, die oft amüsiert oder ungläubig in die Höhe schossen!
Mit zusammengeschnürter Kehle flüsterte sie wieder: »Deine Zeit ist noch nicht gekommen, Camille, hörst du? Geh nicht …«
Doch die arme, gequälte Frau war tot, ihr Geist stieg aus der leblosen Hülle ihres Körpers zum Himmel empor. Des Körpers, dessen man sie gewaltsam beraubt hatte.
»Nein … bitte … Vater –«
Wumm! Irgendwo schlug eine Tür zu.
Lucia sprang auf.
Jemand war zu ihnen unterwegs!
Gut. »Halte einfach nur durch«, sagte sie zu der aschfahlen Gestalt, obwohl sie intuitiv wusste, dass es zu spät war. »Hilfe ist unterwegs.« Ihre Worte hingen in der kühlen Nachtluft.
Zweifel befielen Lucia. Sie verschränkte ihre Finger mit denen ihrer Freundin und schickte ein weiteres Gebet zum Himmel.
Nahte tatsächlich Hilfe? Oder kehrte die Person, die Camille das angetan hatte, zurück?
Kapitel drei
Val fühlte sich jetzt ruhiger, das innere Zittern hatte nachgelassen. Sie füllte ihre angeschlagene Lieblingstasse mit heißem Wasser und stellte sie in die Mikrowelle.
Camille hatte sie ihr zu Weihnachten geschenkt, damals, als nichts und niemand einen Keil zwischen sie hätte treiben können, nicht einmal Slade Houston.
»Oh, Cammie«, flüsterte sie und schüttelte den Kopf über ihre lächerlichen Auseinandersetzungen. Die Mikrowelle klingelte. Vorsichtig fasste Val die Tasse am Griff, zog den letzten Teebeutel aus der Schachtel und tauchte ihn in das fast kochende Wasser.
Obwohl es schon nach Mitternacht war, würde Valerie noch stundenlang nicht einschlafen können, wenn überhaupt. Was hatte Slade immer behauptet? Ihre Schlaflosigkeit sei einer der Gründe, warum das Department sie behalten hätte – sie war ein Workaholic, der wegen seiner Unfähigkeit zu schlafen sechzehn Stunden durcharbeiten konnte, auch wenn er nur acht bezahlt bekam.
Aber Slade neigte eben dazu, zu übertreiben, das war Teil seines lächerlichen Humors.
Val massierte die Knoten in ihrem Nacken und schloss die Augen. Für einen Augenblick sah sie wieder das Gesicht ihres Ehemanns vor sich: ein kräftiges, bartbeschattetes Kinn, ein schiefes Grinsen, das weiße Zähne entblößte, die von der unerbittlichen Texas-Sonne gebräunte Haut, durchdringende blaugraue Augen. Slade Houston. Zäh wie altes Leder, ganz der wilde Cowboy und höllisch sexy, was nichts als Schwierigkeiten bedeutete.
Warum dachte sie dann heute Nacht an ihn?
Und warum hatte sie gestern Nacht an ihn gedacht und in der Nacht zuvor …
»Idiotin«, murmelte sie und bemühte sich, Slades Bild vor ihren Augen zum Verschwinden zu bringen. Die Kirchenglocken waren endlich verstummt. Gut. Ruhe. Frieden.
Doch das unheimliche Gefühl, dass heute Nacht irgendetwas ganz und gar nicht stimmte, hielt an, und ihre innere Unruhe wollte nicht nachlassen.
Morgen würde sie Camille einen Besuch abstatten, gleichgültig, welche machiavellistischen Methoden die alte Fledermaus anwenden würde, um sie davon abzubringen. »Es tut mir leid, aber im Augenblick ist es unmöglich, Ihre Schwester zu besuchen. Wir haben hier strikte Regeln«, hatte Schwester Charity Val das letzte Mal mitgeteilt, als sie Camille unangemeldet hatte sehen wollen. »Regeln, an die wir uns halten, Regeln, die uns von Gott, dem Herrn, auferlegt sind.«
Ganz bestimmt. Wenn Schwester Charity irgendwelche guten Absichten hatte, hatte zumindest Val noch nichts davon bemerkt. Ihrer Ansicht nach war die Mutter Oberin einzig und allein machtbesessen, befeuert von Selbstüberschätzung und einem verzerrten Religionsbild.
Was immer eine schlechte Kombination abgab.
Aber diesmal hatte Valerie vor, den Spieß umzudrehen.
Im Treppenhaus vor der Kapelle war jetzt das Geräusch von Schritten zu vernehmen. Lucia starrte die tote junge Frau an. Ihre Haut kribbelte. Sie versuchte zu beten, aber es wollten ihr nicht die rechten Worte einfallen. Wer hatte Camille das angetan? Warum? Und dieses merkwürdige Brautkleid, die Kette aus Blutstropfen um ihren Hals – was hatte das alles zu bedeuten?
Sie blickte auf die Seitentür, die sich gerade geschlossen hatte, als sie eingetroffen war, und ihr Herz hämmerte. Es hatte noch jemand Schwester Camille auf dem Boden der Kapelle liegen sehen – der Mörder oder aber ein Zeuge. Vor Angst sträubten sich Lucias Nackenhärchen. Entweder war Hilfe im Anmarsch … oder der Mörder kehrte zurück.
Lucia bekreuzigte sich, wandte sich der Tür zum Treppenhaus zu und schrie aus vollen Lungen: »Hilfe!«
Die Tür wurde aufgestoßen und prallte krachend gegen die Wand. Die Mutter Oberin, eine stattliche Frau in einem langen, schwarzen Ordensgewand, eilte in die Kapelle. Ihr ergrauendes Haar, das für gewöhnlich unter dem Nonnenschleier verborgen war, wirkte unordentlich und zerzaust. »Schwester Lucy! Was in Gottes Namen geht hier vor?« Ihre Röcke fegten über den glatten Fußboden, ihr Gesicht war eine Maske der Missbilligung, ihr Mund ein schmaler Strich. Plötzlich schien ihr bewusstzuwerden, wo sie sich befand, und sie schlug schnell das Kreuz über ihrem üppigen Busen.
»Es geht um Schwester Camille …« Lucia rappelte sich hoch, den Blick noch immer auf die am Boden liegende Frau gerichtet.
»Was ist denn …? Oh!« Die Mutter Oberin zog scharf die Luft ein, während sie die vordere Bankreihe umrundete. »Gott steh uns bei.« Mit wehenden Röcken eilte sie an die Seite des Opfers und ließ sich auf die Knie fallen.
»Es ist zu spät. Sie ist tot!«
»Aber wieso? Weshalb?«, flüsterte Schwester Charity, als rechnete sie mit einer Antwort von Gott persönlich. »Wer könnte das getan haben?«
»Ich weiß es nicht. Es war jemand hier, unmittelbar bevor ich gekommen bin«, sagte Lucia und versuchte, die Tatsachen von den Bildern zu trennen, die sie in ihrem Kopf gesehen hatte. »Ich habe bemerkt, wie die Tür zum Garten ins Schloss gefallen ist.« Ja, ja, das stimmte. Lucia wies auf die Seitentür. »Und … ich denke, da hat Schwester Camille noch gelebt.«
Die ältere Nonne berührte Camilles Handgelenk, hielt ihr Ohr dicht an Camilles Nase und lauschte nach einem Lebenszeichen. Lucia wusste, dass sie keins finden würde.
»Was hatten Sie eigentlich hier zu suchen, Schwester Lucy?«, fragte die Mutter Oberin plötzlich.
»Ich, ähm, ich habe etwas gehört«, log Lucia, wie schon so oft in der Vergangenheit. Niemand hier im Konvent kannte ihr Geheimnis, nicht einmal die Priester, bei denen sie die Beichte ablegte.
»Etwas gehört? Waren Sie nicht in Ihrem Zimmer?«
»Ich war unterwegs zur Toilette.«
Als würde ihr plötzlich klar, dass es momentan wichtigere Themen gab, befahl Schwester Charity, die immer noch neben Camille kniete: »Gehen Sie zu Vater Paul und sagen Sie ihm, er soll unverzüglich in die Kapelle kommen.«
»Müssen wir nicht die Polizei rufen?«
Die Mutter Oberin schloss die Augen, als ersuche sie um Geduld. »Tun Sie, was ich sage. Wenn Sie Vater Paul hergeschickt haben, begeben Sie sich in mein Büro und wählen den Notruf.«
»Aber sollten wir die Polizei nicht zuerst informieren –«
»Keine Widerrede! Das Beste, was wir für Schwester Camille tun können, ist, für ihre Seele zu beten. Und jetzt gehen Sie! Und wenn eine der anderen aufgewacht ist, schicken Sie sie zurück in ihr Zimmer!« Der Gesichtsausdruck der Mutter Oberin ließ keinerlei Widerspruch zu. Lucia drehte sich um und schritt eilig durch genau die Tür, durch die sie zuvor jemanden hatte verschwinden sehen. Die anderen Nonnen in ihre Zimmer zurückschicken? »Zellen« war wohl das passendere Wort. Oder Zwinger. Wie für Hunde. O Gott, sie wusste, dass sie nicht zur Nonne gemacht war. Nicht wenn sie unreine Gedanken hegte wie diese.
Mit klopfendem Herzen schloss Lucia die Tür hinter sich und sprintete los –, doch nicht in Richtung Bogengang, der zu den Wohnungen von Vater Paul und Vater Frank führte, sondern auf das Gebäude zu, aus dem sie gekommen war. Sie schlüpfte hinein und eilte die Treppe in den ersten Stock hinauf, direkt zum Büro der Mutter Oberin. Sollte sie sie ruhig bestrafen – Lucia wusste, dass Camille Vorrang hatte. Sie stieß die Tür mit dem Milchglasfenster auf und stürmte in Schwester Charitys Heiligtum.
Alles war ordentlich in Bücherregalen verstaut, die die Wände säumten: Bücher, Kerzen, Kruzifixe, eine gesunde Amaryllis mit einer üppigen weißen Blüte, ein einzelnes Bild des Papstes. Lucia umrundete den großen, abgenutzten Schreibtisch, vor dem sie unzählige Male auf einem der unbequemen Besucherstühle gesessen hatte, die Hände vor Aufregung verkrampft, während die Mutter Oberin ihr einen Vortrag über die Ausdehnung von lackiertem Walnussholz hielt. Sie griff nach dem Telefon, einem schwarzen Dinosaurier aus längst vergangenen Jahrzehnten, hob den schweren Hörer ab und wählte rasch, wobei sie ungeduldig darauf wartete, dass sich die Wählscheibe mit einem Klackern zurückdrehte.
»Hier 911. Möchten Sie einen Notfall melden?«, sagte eine Frauenstimme.
»Schwester Camille ist tot! Hier im Konvent St. Marguerite ist irgendetwas passiert – nein, in der Kapelle –, und sie ist tot! Ich … ich glaube, sie ist ermordet worden. Bitte schicken Sie rasch jemanden her!« Lucias ohnehin zittrige Stimme überschlug sich bei jedem Wort.
»Wie lautet die Adresse?«
Lucia nannte die Straße, dann – als sie dazu aufgefordert wurde – ihren Namen und ihre Telefonnummer.
»Was genau ist denn vorgefallen?«
»Ich weiß es nicht. Vielleicht … vielleicht ist sie erwürgt worden. Jedenfalls ist sie tot! Die Mutter Oberin ist jetzt bei ihr.«
»Ein Mord.«
»Oh, ich weiß es nicht! Wir brauchen Hilfe. Bitte, bitte schicken Sie Hilfe!«
»Das tun wir. Es sind bereits Beamte unterwegs. Bleiben Sie in der Leitung.«
»Das geht nicht … ich muss es Vater Paul sagen.«
»Bitte, Miss Costa, legen Sie nicht auf. Bleiben Sie in der Leitung –«
Doch Lucia ignorierte die Anweisung und ließ den Hörer fallen. Dann rannte sie in vollem Tempo durch die Hintertür des Büros, die sonst nur Schwester Charity benutzte.
Lucias Herz schlug wie eine Trommel, als sie durch die dunklen Flure mit ihren glänzenden Fußböden die Treppe hinunter- und durch die Doppeltür in den Garten hinausrannte. Als wäre ihr der Teufel persönlich auf den Fersen, stürmte sie an einem Springbrunnen vorbei durch den regennassen Kreuzgang, der zu den Wohnungen der Priester führte. Der Wind fegte über die großen Steinplatten, wirbelte nasse Blätter auf und riss am durchweichten Saum ihres Nachthemds.
Sie durfte niemandem verraten, wodurch sie mitten in der Nacht so abrupt geweckt worden war. Was sollte sie bloß sagen? Jeder, dem sie von der Stimme erzählte, die sie geleitet, von dem Ungeheuer, das sie von der Leine gelassen hatte, würde sie für unzurechnungsfähig halten. Sie war der Ansicht, die Stimme in ihrem Kopf ginge nur sie und Gott etwas an und sonst niemanden. Nicht einmal Vater Paul oder Vater Frank. Sie würden womöglich annehmen, sie sei von einem Dämon besessen, und vielleicht war sie das ja auch, aber sie wollte keine unnötige Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Hier geht es nicht um dich! Camille ist tot! Jemand hat sie umgebracht und tot in der Kapelle liegen lassen.
Und irgendwie hat die Stimme davon gewusst. Und dich geweckt.
Oh, das war alles so verwirrend.
Endlich stand sie vor Vater Pauls Tür und hämmerte verzweifelt dagegen.
»Vater!«, schrie sie, während sie zitternd im fahlen Schein der Eingangsbeleuchtung stand. »Bitte! Vater! Es hat einen … Unfall gegeben!«
Über das Tropfen des Regens hinweg hörte sie Schritte hinter sich, das Scharren von Leder auf nassen Steinen. Aus dem Augenwinkel sah sie eine Bewegung in der Dunkelheit, eine düstere Gestalt, die durch ein Gartentor schlüpfte. Sie schnappte nach Luft und trat einen Schritt zurück, wobei sie fast über den Saum ihres Nachthemds gefallen wäre. Ein großer Mann erschien, das Gesicht weiß und ernst, die tief in den Höhlen liegenden Augen verschattet.
»Vater Frank«, flüsterte sie, als sie den jüngeren Priester erkannte. Sie schlug sich die Hand vor die Brust und stellte fest, dass ihr Nachthemd völlig durchnässt war und eng an ihrer Haut anlag. »Es hat einen Unfall gegeben oder … oder …«
Sie schluckte mühevoll und dachte an all die Geheimnisse, die sie mit Schwester Camille geteilt hatte. Geheimnisse, die diesen großen Mann betrafen, der hier vor ihr stand. »Es geht um Schwester Camille, sie ist in der Kapelle. Sie … sie …« In diesem Augenblick sah sie das Blut auf seiner Soutane, das in roten Rinnsalen auf die glatten, glänzenden Steinplatten rann.
»Sie ist tot«, sagte er mit seiner rauhen Stimme, die über das Gurgeln des Regenwassers in den Gullys kaum zu vernehmen war. Sein Blick wirkte gequält. »Und das ist meine Schuld. Gott vergebe mir, es ist alles meine Schuld.«
Kapitel vier
Du bist immer noch auf?«, unterbrach Freyas Stimme ihre Gedanken.
»Ich schlafe nie.« Val versuchte, ihre Sorge um Camille zu unterdrücken. Sie warf den Teebeutel ins Spülbecken und blickte über die Schulter zu dem Verbindungsgang, der zum Haupthaus führte. Als sie das alte Inn gekauft hatten, hatte sich Val gleich zu dem kleinen Kutschenhaus hingezogen gefühlt, während sich Freya ihre Privaträume direkt neben der großen Küche eingerichtet hatte. Freya mit ihren wuscheligen roten Locken und den vielen Sommersprossen trug eine kurze Hose und ein übergroßes T-Shirt. Sie hielt eine Tasse mit so viel Schlagsahne in der Hand, dass ein dicker Klecks davon über den Rand tropfte. Irgendwie gelang es Freya, den Klecks aufzulecken, bevor er auf den Linoleumboden klatschte.
Freya war fünfunddreißig, hatte immer noch den wohlgeformten Körper der Turnerin, die sie an der Highschool gewesen war, und den Stoffwechsel einer Fünfzehnjährigen.
»Du siehst schrecklich aus«, stellte sie jetzt fest.
»Vielen Dank.«
»Nein, wirklich, du solltest versuchen, etwas zu schlafen.«
Wenn das so einfach wäre! Val drehte sich um und lehnte sich mit der Hüfte gegen den Küchentresen. »Wir sind eben zwei Ruhelose.« Die Unfähigkeit zu schlafen war etwas, das sie mit Freya teilte.
Freya prostete ihrer Freundin zu. »Meiner ist koffeinfrei. Obwohl das nicht heißt, dass ich anschließend tatsächlich einschlafen werde.«
»Mein Tee ist auch ohne Koffein, außerdem trägt er den vielversprechenden Namen ›Ruhe‹.« Val nahm einen vorsichtigen Schluck. Das heiße, nach Ingwer und Kamille schmeckende Wasser verbrühte ihr die Zungenspitze. »Angeblich hilft es einem, sich zu entspannen … Wart mal, ich schau mal eben nach, was genau auf der Packung steht.« Sie holte die leere Schachtel und las. »O ja, hier steht es: ›Die einzigartige Rezeptur von Ruhe nimmt Ihnen mit jedem genussvollen Schluck alle Sorgen dieser Welt – eine beruhigende Mischung aus Kamille und Ingwer mit einem Hauch Jasmin, die Ihnen Linderung verschaffen wird.‹«
»Aber sicher doch«, spöttelte Freya und rümpfte die Nase. »Dir Linderung verschaffen? Niemals. Und überhaupt: Das klingt ja abscheulich!«
»Nein, nur langweilig im Vergleich zu dreifachen Karamell-Schokolade-Latte-Macchiatos, zusammen mit Wodka-Red-Bull.«
»Sehr lustig.« Freya, die ein Grinsen nicht unterdrücken konnte, setzte sich auf einen der beiden Kaffeehausstühle an Vals Bistro-Tischchen.
Sie waren seit der achten Klasse Freundinnen, und es war Freya Martin gewesen, die Val dazu überredet hatte, in dieses Bed & Breakfast Inn im Garden District, ein paar Blocks von der St. Charles Avenue entfernt, zu investieren. Das alte georgianische Haus mit den acht Zimmern, das »The Briarstone House« genannt wurde, hatte nur wenig Schaden genommen, als der Hurrikan Katrina mit voller Wucht über die Küste von New Orleans hereingebrochen war, aber die Besitzer – Freyas Großtante und ihr Mann – beschlossen damals, dass sie sich Stürmen der Kategorie fünf nicht mehr gewachsen fühlten, und sie wollten auch keine weiteren Stürme der Kategorie eins, zwei, drei oder vier miterleben. Deswegen hatten Tantchen und Onkel die Golfregion verlassen wollen, und zwar schnell.
Freya war gern eingesprungen.
Sie hatte Onkel Blair und Tante Susie ausbezahlt und das Bed & Breakfast übernommen, in das sie gemeinsam mit ihrem Freund eingezogen war. Onkel und Tantchen hatten fast ihre gesamte Einrichtung dagelassen, ihr Wohnmobil vollgetankt und waren gen Westen Richtung Sonnenuntergang gefahren, auf der Suche nach einem trockenen Klima, neuen Sonnenanbeterfreunden und endlosen Nächten bei Kartenspielen und Martinis.
Für Valerie, deren Nerven gerade blanklagen, hatte es wie der Himmel auf Erden geklungen. Sie stand in ihrem Leben an einem Scheideweg, als sich Freya von ihrem Freund trennte und Val fragte, ob sie ihre Teilhaberin werden wolle. Es hatte nicht viel gebraucht, um sie davon zu überzeugen, dass es die beste Idee auf der ganzen Welt war, in das knarzende, alte georgianische Anwesen, in dem es angeblich sogar spukte, zu investieren. Vor allem, da das Inn nur eine knappe Meile Luftlinie von Camille und St. Marguerite entfernt lag.
Freya hatte Val per E-Mail die Details geschickt, und Val hatte die Gelegenheit beim Schopf ergriffen.
Der Rest war sozusagen Geschichte. Manches davon allerdings eher schlechte Geschichte.
Und jetzt, beim Geräusch des in den Gullys gurgelnden Regens, fragte sich Val, ob sie wohl die richtige Entscheidung getroffen hatte. Wieder einmal. Außerdem war das unheimliche Gefühl von vorhin noch nicht verschwunden. Um es endlich abzuschütteln, blickte sie aus dem Fenster Richtung St. Marguerite, aber natürlich konnte sie die Kirchturmspitze bei der Dunkelheit nicht sehen.
»Na schön, spuck’s aus. Etwas stimmt nicht, hab ich recht?«, fragte Freya mit zusammengezogenen Augenbrauen. »Moment, vergiss es. Lass mich raten – es geht um Slade.«
»Es geht nicht um Slade«, widersprach Val mit Nachdruck, und Freya, die ihr kein Wort abkaufte, verdrehte die Augen.
»Wenn du es sagst.«
»Glaub mir, es geht wirklich nicht um Slade.«
»Es geht immer um Slade. Wir sollten darüber reden.«
»Nein.« Val warf Freya ihren finstersten Wag-es-ja-nicht-Blick zu.
»Also echt, du solltest wissen, dass –«
»Wir haben es bereits durchgekaut. Ich möchte nicht über ihn reden, nicht mal an ihn denken, solange es nicht unbedingt sein muss. Erst vor Gericht.«
»Aber –«
»Ich meine es ernst, Freya. Slade ist tabu!« Sie würde sich nicht auf eine weitere Diskussion über ihren Ex einlassen, und schon gar nicht heute Nacht, wo sie sich ohnehin so merkwürdig unruhig fühlte.
Freya sah aus, als wollte sie etwas entgegnen, doch dann überlegte sie es sich anders. »Gut. Aber denk dran: Ich habe es zumindest versucht.«
»In Ordnung.«
»Hat er irgendetwas angestellt, wovon ich nichts weiß?«
»Vielleicht.« Val zuckte die Achseln. »Vielleicht auch nicht.«
Freya öffnete den Mund, doch bevor sie Slades Namen noch einmal aussprechen konnte, sagte Valerie: »Es geht um Cammie, okay? Ich habe seit über einer Woche nichts mehr von ihr gehört.« Die alten Balken über ihren Köpfen knarzten, und für einen kurzen Augenblick glaubte Val, Schritte gehört zu haben. Vermutlich wieder das Gespenst. Mochte Freya ruhig glauben, dass es hier spukte, sie glaubte es nicht.
»Hast du das gehört?«, fragte Freya.
»Das Haus setzt sich.«
»Es hat sich schon vor zweihundert Jahren gesetzt.«
Valerie verdrehte die Augen.
Freya verstand den Wink. »Schon gut. Du sorgst dich wegen Cammies Isolationshaft. Na und? Ich habe von Sarah auch schon seit Wochen nichts mehr gehört, und sie ist meine Zwillingsschwester. Wenn man der ganzen Literatur über Zwillinge Glauben schenken kann, liegen wir auf genau derselben Wellenlänge und haben eine ganz besondere« – sie malte mit den Fingern Anführungszeichen in die Luft – »geistige Verbindung, was auf das Band zurückzuführen ist, das uns seit unserer gemeinsamen Zeit im Mutterbauch verbindet. Aber irgendwie hat Sarah meine Nachrichten nie bekommen.«
Val fuhr mit dem Daumen über den angeschlagenen Rand ihrer Tasse. »Cammie ist anders.«
»Cammie ist vielleicht nur zu beschäftigt. Du weißt doch, was Nonnen alles zu tun haben: beten, Buße und gute Taten tun, was auch immer.« Freya machte mit ihrer freien Hand eine weitschweifende Handbewegung, um zu zeigen, dass es sicher eine Myriade Dinge gab, die Cammie davon abhielt, mit Val in Kontakt zu treten. »Vielleicht hat sie ein Schweigegelübde abgelegt.«
»Cammie?«, fragte Val ungläubig. Die gesellige, extrovertierte, kokette, überschäumende Camille Renard? »Du erinnerst dich doch an sie, oder?«
»O ja.« Freya biss sich auf die Lippe. »Immer in Schwierigkeiten.«
»Sie hat sich nicht geändert«, gab Val zu, und das unbehagliche Gefühl wurde wieder stärker.
»Ich weiß, und das ist das Problem, hab ich recht? Cammie ist einfach nicht zur Nonne geboren.« Freya nahm einen Schluck aus ihrer Tasse. »Genau wie du nicht zum Cop geboren bist.«
Val verspürte einen Stich, wie immer, wenn sie an ihre Karriere dachte, die sie in den Sand gesetzt hatte. Sie wollte Freya widersprechen, sie sei ein guter Cop gewesen, aber das wäre ohnehin sinnlos gewesen. Eine heftige Windböe wehte durch das offene Fenster und rüttelte an den Jalousien. »Nun, darüber muss ich mir jetzt wohl keine Gedanken mehr machen, oder?«
»He, ich habe nicht gemeint –«
»Ich weiß.« Sie wedelte mit der Hand durch die Luft, als verscheuchte sie eine lästige Fliege. Dennoch war es für Val ein schmerzliches Thema, das sie unentwegt beschäftigte. Sie schloss das Fenster und entdeckte in der Scheibe ein verschwommenes Abbild von sich selbst: blass und gespenstisch dünn, die hohen Wangenknochen traten scharf hervor, der breite Mund war nach unten gezogen, in den haselnussbraunen Augen lag ein besorgter Blick. Ihr lockiges kastanienbraunes Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden. Mein Gott, sie war ein Wrack. Innerlich und äußerlich. Der Regen verwischte ihre Züge, und sie legte den Riegel vor. »Übrigens: Du hast recht. Ich sehe wirklich entsetzlich aus.«
»Zweiundsiebzig Stunden Schlaf könnten Wunder wirken.«
Das bezweifelte Val.
»Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du dir zu viele Sorgen machst?«
»Bis jetzt nur du.«
»Dann solltest du das zu deinem Evangelium machen. Hör auf, dich wegen Cammie fertigzumachen. Dann zieht sie eben diese Ich-flüchte-mich-in-ein-Kloster-Masche durch. Das wird schon wieder vorbeigehen.« Freya zog einen Mundwinkel nach oben. »Ich bin ohnehin überrascht, dass man sie nicht längst rausgeschmissen hat.«
Wenn du nur wüsstest, dachte Valerie, trank in kleinen Schlucken ihren Tee und blickte wieder aus dem Fenster, hinaus in die undurchdringliche Dunkelheit, welche die Kirchturmspitze der St.-Marguerite-Kathedrale umhüllte.
O Gott, Freya, wenn du nur wüsstest.
Slade Houston spähte blinzelnd in die Dunkelheit. Die Reifen seines alten Pick-ups surrten über den schlüpfrigen Asphalt, und die Scheibenwischer hatten alle Mühe, der Sturzflut Herr zu werden, die sich auf die Windschutzscheibe ergoss, während er die Staatsgrenze nach Louisiana überquerte. Sein Hund Bo, ein Jagdhund unbestimmter Abstammung, saß neben ihm, die Nase ans Beifahrerfenster gedrückt. Ab und an warf er Slade einen mitleiderweckenden Blick zu, in der Hoffnung, dass er das verdammte Ding ein Stück öffnete.
»Heute Nacht nicht, mein Junge«, sagte Slade und fummelte lange Zeit am Radio nach einem Sender, der nicht rauschte. Er fand einen. Ein alter Song von Johnny Cash ertönte, der ihn jedoch nicht davon ablenken konnte, warum er hier mitten in der Nacht von Bundesstaat zu Bundesstaat kutschierte. Eine völlig unsinnige Aktion, zumindest hatten das seine Brüder Trask und Zane behauptet, als er kurz vor Anbruch der Abenddämmerung den Ford mit seinem Schlafsack und seiner Reisetasche beladen und nach Bo gepfiffen hatte.
»Warum du noch etwas mit dieser Frau zu tun haben willst, geht über meinen Verstand«, hatte Trask, der mittlere der drei Houston-Brüder gemurmelt. »Das bringt dir doch nichts als Kummer.«
»Noch mehr Kummer«, hatte Zane, der Jüngste, hinzugefügt.
Nicht, dass Slade einen der beiden um Rat gebeten hätte.
»Kümmert euch einfach darum, dass hier alles läuft. Ich werde nicht lange weg sein«, hatte er gesagt, als der Hund mit seinem hinkenden Bein und dem abgebissenen Ohr in die Fahrerkabine gesprungen war, und die Tür zugeknallt, die missmutigen Blicke seiner Brüder im Rücken.
»Wie lange?«, fragte Zane.
»Das weiß ich noch nicht. Kommt darauf an.«
»Bitte benutz einfach mal deinen Kopf«, riet Trask ihm.
»Warum sollte ich jetzt damit anfangen?«, erwiderte Slade mit einem Grinsen, um die Situation ein wenig aufzuheitern – ohne Erfolg. Seine Brüder hatten nicht mal andeutungsweise gelächelt, sie hatten ihn nur mit zusammengebissenen Zähnen angestarrt.
Großartig.
Obwohl das keine große Überraschung gewesen war. Keiner von beiden hatte Valerie vor der Hochzeit gemocht, und ihre Meinung hatte sich über die Jahre nicht verändert.
Slade versuchte, nicht weiter darüber nachzudenken. Durchs offene Wagenfenster hörte er, wie die Grillen ihr abendliches Gezirpe anstimmten, und sah die Hügel im Westen, die sich als dunkle Silhouette vor einem brillanten orange-goldenen Himmel abzeichneten.
Trask hatte nicht lockergelassen. »Hast du vor, sie zurückzuholen?«
»Valerie?«, hatte er gefragt, nur um seinen Bruder zu reizen. Als hätte es eine andere gegeben. »Das weiß ich noch nicht.«
»Wenn du dich wieder mit ihr einlässt«, hatte Trask gesagt, »bist du ein noch größerer Dummkopf, als ich dachte.«
»Sie würde ohnehin nicht mitkommen, selbst wenn ich sie darum bitten würde.« Das war die Wahrheit.
»Sie macht doch nichts als Ärger«, hatte ihn Zane erinnert.
»Als ob ich das nicht wüsste.« Trotzdem hatte er den Motor des staubigen Wagens angelassen und mit drei Zügen in der Kiesauffahrt gewendet, ohne einen Blick auf das verwitterte zweistöckige Ranchhaus zu werfen, in dem er aufgewachsen war. Dann hatte er das Gaspedal durchgedrückt. Er hielt sich nicht damit auf, den im Licht der untergehenden Sonne lodernden Himmel hinter den Stallungen mit ihren quietschenden Wetterfahnen zu betrachten. Sein alter Ford rumpelte über die ausgefahrene Zufahrt. Trockene Gänsedisteln und Wilde Mohrenhirse kratzten an der Unterseite des Pick-ups, während dieser Meile um Meile zurücklegte, vorbei an Feldern voller Rinder und Pferde – Land, das er und seine Brüder von seinem Vater geerbt hatten.
Ein Rotschwanzbussard schoss durch den dunkler werdenden Abendhimmel, als er an der alten Windmühle vorbeifuhr, die reglos und einsam in der unbewegten Luft stand. Ein gutes Omen.
Er hatte das Radio angestellt und den Wagen an dem zerbeulten Briefkasten vorbei auf die Landstraße gelenkt, dann war er durch das kleine Städtchen Bad Luck nach San Antonio gefahren, wo er auf die Interstate 10 abbog, den langen Asphaltstreifen, der durch acht Bundesstaaten die Ost- und die Westküste vom Pazifik bis zum Atlantik miteinander verband. Bald schon hatte er seine Brüder, Texas und die Sonne weit hinter sich gelassen.
Um eine Frau aufzuspüren, die ihn nicht wollte.
Die Scheidungspapiere, die im Handschuhfach seines Pick-ups lagen, erinnerten ihn allzu deutlich an diese traurige Tatsache.
Kapitel fünf
Der Anruf kam nicht lange nach Mitternacht.
Montoya rollte sich stöhnend übers Bett und griff nach seinem Handy. Er senkte die Stimme und schlüpfte aus dem Bett wie schon Hunderte Male zuvor, um seine Frau Abby nicht zu wecken, die unter die Decken gekuschelt schlief. Reuben Diego Montoya arbeitete als Detective für das Police Department von New Orleans, kurz NOPD. Ungewöhnliche Arbeitszeiten und nächtliche Anrufe gehörten zu seinem Job.
»Was gibt’s denn jetzt schon wieder?«, fragte Abby, als er aufgelegt hatte. Ihre Stimme klang gedämpft unter der Decke, dann zog sie sie ein Stück herunter und wischte sich eine Haarsträhne aus den Augen.
»Eine tote Frau. Eine Nonne. Wahrscheinlich Mord.«
Abby richtete sich auf, lehnte sich mit dem Rücken gegen die Kissen und knipste das Licht an. »Eine Nonne?«
»Das sagt die Beamtin, die den Notruf entgegengenommen hat.« Er fuhr in seine abgewetzte Jeans, die er über das Fußende geworfen hatte, dann nahm er ein sauberes T-Shirt aus dem Kleiderschrank und zog es sich über den Kopf.
»Wer bringt denn eine Nonne um?« Seine Frau gähnte herzhaft.
»Keine Ahnung, aber ich werd’s rausfinden.« Er warf ihr ein humorloses Grinsen zu und dachte an eine andere Nonne zurück, die man ermordet hatte – und die seine eigene Tante gewesen war. »Dafür werde ich schließlich bezahlt.«
»Ja, richtig.« Sie lächelte nicht. »Sei bitte vorsichtig.«
»Das bin ich doch immer.« Montoya wandte sich zur Tür.
»He! Hast du nicht etwas vergessen?«, fragte sie und reckte ihm ihre Lippen zum Kuss entgegen.
»Oh, natürlich!« Er ging zum Kleiderschrank, öffnete den verschlossenen Waffenbehälter und nahm seine Pistole heraus. Dann legte er sein Schulterholster an, schlüpfte in die Lederjacke und ging zur Tür.
»Du kannst ein echter Scheißkerl sein, wenn du willst«, tadelte sie. Aber sie zwinkerte dabei. Mit den rotbraunen Locken, die ihr Gesicht umrahmten, sah sie teuflisch sexy aus. »Du bist jetzt Vater, also … geh keine unnötigen Risiken ein, ja? Ich will, dass Benjamin mit seinem Daddy aufwächst.«
Montoya steckte die Glock ins Holster, dann ging er quer durch den Raum auf Abby zu und drückte sie auf die Matratze. »Das will ich auch.« Er schob sich auf sie und küsste sie fordernd, erforschte mit der Zunge ihren Mund und spreizte die Hände um ihren Po. »Warte auf mich«, flüsterte er ihr ins Ohr.
»Auf gar keinen Fall, Detective«, sagte sie mit einem Lächeln, und er musste sich zwingen, seine Gedanken auf die bevorstehenden Ermittlungen zu lenken und seinen Schwanz zu kontrollieren, der steinhart geworden war. Sie musste nur die Augenbraue hochziehen, um diese Reaktion bei ihm auszulösen.
»Die hat dich ja ganz schön unter dem Pantoffel«, hatte sein Bruder Cruz bereits bei mehr als einer Gelegenheit bemerkt.
In diesem Fall hatte Cruz recht.
»Ich komme so schnell wie möglich zurück. Mach dich auf etwas gefasst.«
»Oh, Gott bewahre, Montoya«, wehrte sie ab und kuschelte sich wieder unter die Decke.
Lächelnd verließ Montoya das Schlafzimmer und wäre beinahe über Hershey, ihren großen, schokoladenbraunen Labrador gestolpert, der wie immer in der Nähe der Schlafzimmertür Wache hielt. Hershey rappelte sich auf die dicken Pfoten und blockierte den schmalen Flur. Sein Schwanz schlug gegen ein antikes Sideboard. Wie immer war der Hund zu allen Schandtaten bereit, vor allem dazu, Montoyas Platz im Bett einzunehmen.
»Vergiss es, klar? Sie braucht ihren Schönheitsschlaf.«
»Das habe ich gehört!«, rief Abby leise durch die geöffnete Tür.
Hershey nahm das als Einladung und galoppierte ins Schlafzimmer. Ein schmaler dunkler Schatten, der scheue Kater Ansel, sprang vom Sideboard und folgte dem Labrador.
»Na großartig.« Montoya kämpfte mit seinen Schuhen. Er hatte keine Zeit mehr, den Hund zurückzupfeifen, außerdem war er sich sicher, dass Abby mit den Tieren schon zurechtkommen würde. Er orientierte sich an den Nachtlichtern, die die Räume seines langen Shotgun-Hauses in ein bläuliches Licht tauchten, und ging durch Küche und Wohnzimmer zur Eingangstür.
Die Nacht war schwül. Drückend. Der Geruch des träge dahinfließenden Mississippi hing schwer in der Luft. Es regnete stark, und das Wasser strömte die Straße hinunter. Montoya lief durch den aufgeweichten Vorgarten zur Auffahrt und ließ sich auf den Ledersitz seines Mustang fallen. Er schlug die Tür zu und steckte den Schlüssel in die Zündung. Dröhnend erwachte der Motor zum Leben.
Montoya stellte die Scheibenwischer an, drückte aufs Gas und fragte sich, was zum Teufel in diesem so konservativen Kloster wohl vorgefallen sein mochte. Er verzichtete auf Sirene und Blinklichter, machte das Radio an und lauschte der Stimme von Dr. Sam, Psychologin und Moderatorin der Spätabendsendung Midnight Confessions – Mitternachtsbeichte. Stirnrunzelnd fuhr er durch die vertrauten Straßen und dachte an einen früheren Fall, bei dem ebenjene Moderatorin, Samantha Leeds Wheeler, im Visier eines mordenden Psychopathen gestanden hatte. Zum Glück war Dr. Sam noch am Leben und konnte den Leuten, die sie in ihrer Show anriefen, mit Ratschlägen zur Seite stehen.
Auf den Straßen herrschte kaum Verkehr. Doch als Montoya an der St.-Marguerite-Kathedrale ankam, wimmelte es bereits von Streifenwagen mit zuckenden Lichtern, die die Straße absperrten. Ein Fahrzeug der Feuerwehr blockierte die halbkreisförmige Zufahrt, ein Rettungswagen parkte mit laufendem Motor unter einer der riesigen Lebenseichen, die rund um den Gebäudekomplex standen.
Montoya stellte den Mustang in zweiter Reihe ab und schritt auf die Kathedrale zu, ein hoch in den Himmel ragendes Bauwerk mit Türmen, einem Glockenturm und Maßwerkfenstern, die die blinkenden roten und blauen Lichter der parkenden Einsatzfahrzeuge reflektierten. Wasserspeier befanden sich hoch oben an den Dachrinnen, finstere, drachenähnliche Skulpturen, die mit verschlagenem Blick auf den heiligen Boden spähten – das Böse, das sie repräsentierten, war ein starker Kontrast zu dem Kreuz, das hoch über der höchsten Kirchturmspitze aufragte.
Vor der breiten, zweiflügeligen Eingangstür blieb Montoya stehen, gerade lange genug, um sich einen Überblick über den Ort des Verbrechens zu verschaffen und sich von einem der uniformierten Beamten, die den Tatort bewachten, ins Bild setzen und sich den Weg beschreiben zu lassen. Anschließend betrat er die große Kathedrale, ging bis zu einer Seitentür und durch einen Bogengang zu der kleineren Kapelle, die, angeschlossen an den Konvent mit dem Wohnbereich der Nonnen, dem Büro der Mutter Oberin und den etwas abseits gelegenen Priesterwohnungen, von Gartenanlagen umgeben war.
Als er eintrat, wurde er von einer Welle der Nostalgie überwältigt und in seine Jugend zurückgeworfen, als seine Mutter jeden Sonntag mit ihm und seinen Geschwistern zur Messe gegangen war – der Geruch nach Weihrauch und brennenden Kerzen, deren winzige Flammen ein flackerndes Licht und Schatten an die Wände warfen, die gedämpften Stimmen, das hohe Gewölbe mit den schmalen, langgezogenen Buntglasfenstern darunter.
Sein Blick fiel auf das riesige Kruzifix, das von der Decke hing, und er bekreuzigte sich, mehr aus Gewohnheit denn aus echter Überzeugung.
Die Beamten sprachen im Flüsterton mit verschiedenen Leuten, die an der Rückseite der Kapelle standen, doch Montoya ignorierte sie, da er soeben Rick Bentz, seinen langjährigen Partner beim NOPD, entdeckt hatte.
Bentz stand neben dem Altar. Er war gut fünfzehn Jahre älter als Montoya, gehörte fast schon einer anderen Generation an. Zusammen mit seiner zweiten Frau hatte er vor knapp einem Jahr ein Kind bekommen, und der Schlafmangel zeigte sich deutlich an den Falten auf seinem markanten Gesicht und den immer stärker ergrauenden Schläfen. Er humpelte leicht, was von einer früheren Verletzung herrührte, doch ansonsten war sein Körper so durchtrainiert und muskulös wie der eines Schwergewichtsboxers. Heute Nacht trug Bentz Jeans und ein T-Shirt, über das er eine Jacke gezogen hatte. Mit finsterem Blick starrte er auf den Fußboden neben dem Altar.
Montoya eilte den breiten Mittelgang entlang. Das Opfer lag vor der ersten Bankreihe. Sein Gesicht war mit einem Altartuch bedeckt, unter dem dunkle Haarsträhnen hervorlugten. Der Körper der Frau schien zurechtgelegt worden zu sein: Die Arme waren vor der Brust gefaltet, die Finger um einen hölzernen Rosenkranz geschlungen. Sie trug ein vergilbtes, teils zerrissenes Hochzeitskleid und einen silbernen Ring am Ringfinger ihrer linken Hand. Ihre Füße waren nackt.
»Wer ist sie?«, fragte Montoya.
»Eine von den Nonnen aus dem Konvent«, sagte Bentz. »Schwester Camille.«
»Ist sie hier umgebracht worden? Vor dem Altar?«
Wie ein Opferlamm.
»Ich glaube schon. Es gibt Hinweise auf einen Kampf, Schrammen an den Füßen, ein abgebrochener Fingernagel.« Bentz deutete auf ihre rechte Hand. »Hoffentlich hat sie sich so fest in die Haut des Angreifers gekrallt, dass wir DNS-Spuren unter ihren Fingernägeln finden.«
Sollten sie wirklich so viel Glück haben und gleich auf einen genetischen Fingerabdruck des Mörders stoßen? Montoya bezweifelte es.
»Bislang haben wir noch keinen zweiten in Frage kommenden Tatort entdeckt.« Bentz blickte sich in der Kapelle um. Es gab gleich mehrere Türen, durch die man aus und ein gehen konnte. »Aber es ist ja auch ein ziemlich großes Gelände.«
Und ein teuflischer Ort für einen Mord, dachte Montoya und betrachtete das gewaltige Kruzifix über dem Altar.
»Die Kathedrale, der Konvent und die Außenanlagen sind sehr weitläufig«, gab Bentz zu bedenken und machte weiterhin ein finsteres Gesicht.
»Das Gelände ist doch abgeschlossen, oder?«
»Alles ist nachts abgeschlossen, selbst die Haupteingangstüren zur Kathedrale. Entweder hat sich der Mörder vor der Schließungszeit eingeschlichen und irgendwo versteckt, oder er gehört zur Ordensgemeinschaft.«
Stirnrunzelnd betrachtete Montoya den sorgfältig zurechtgelegten Leichnam. »Haben wir Fotos davon?«
»Ja.«
Montoya streifte sich ein Paar Latexhandschuhe über, bückte sich und hob das dünne Altartuch an. Er blickte in die starren, schönen Augen der toten Frau.
Einer Frau, die er kannte.
Auf intime Art und Weise kannte.
Verdammt.
Er hatte das Gefühl, einen Schlag in die Magengrube bekommen zu haben, und zog scharf die Luft ein. Das Blut erstarrte ihm in den Adern. Eine Sekunde lang glaubte er, ihm würde schlecht.
»Das ist Schwester Camille?«
»Ja. So hat die Mutter Oberin sie genannt. Ihr offizieller Name ist –«
»Camille Renard.« Montoya schloss kurz die Augen. Versuchte, sein inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Wie hatte das passieren können? Und warum? Mein Gott, er hatte nicht mal gewusst, dass sie in der Stadt war! Er zwang sich, die Augen wieder zu öffnen, und betrachtete Cammies blasses Gesicht mit den glasigen Augen. »Verdammt, verdammt, verdammt!«, stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
»Du kennst sie?«
»Ich kannte sie. Es ist lange Zeit her.« Camille Renard. So voller Leben, stets zu einem Spaß aufgelegt. So … unberechenbar. Niemals hätte er damit gerechnet, dass sie den Nonnenschleier nehmen würde. »Ich bin mit Camille Renard zur Highschool gegangen.«
»Oh, Schei… um Gottes willen.« Bentz’ Augen wurden noch dunkler vor Sorge. »Erzähl mir nicht, du hattest was mit ihr.«
Montoya presste die Kiefer noch fester aufeinander. »Na gut, ich erzähl’s dir nicht.«
»Dann wart ihr also tatsächlich zusammen.«
»Auf der Highschool.«
Gerade lange genug, um das erste Mal Sex zu haben und sie zu entjungfern.
Kapitel sechs
Schwester Maura schlüpfte unter die Decke ihres schmalen Einzelbetts und legte ihre Brille auf den winzigen Nachttisch, wobei sie beinahe den Stapel Bücher umgerissen hätte, den sie unter der Wandlampe aufgeschichtet hatte. Die alte, harte Matratze quietschte unter ihrem Gewicht. Schwester Maura tastete nach ihrem Gebetbuch, das sie unter dem Bettzeug verwahrte, und drückte es fest an die Brust, doch sie schloss nicht die Augen.
Durch das schmale Fenster zuckten blaue und rote Lichter von den Einsatzfahrzeugen, strichen über die weiße Wand neben der Tür und tauchten das kleine Kruzifix darüber in pulsierende Farben.
Ihr Herz schien kontrapunktisch zum Rhythmus der Lichter zu schlagen.
Gut.
Sie lächelte in der Dunkelheit, und ihre Finger strichen über die abgegriffenen Seiten des Gebetbuchs, doch sie betete nicht, brachte dem Herrn keinen Psalm und keine Hymne dar. Nicht jetzt, nicht wenn hier so viel Spannendes passierte.
Gedämpfte Stimmen erklangen in den alten Fluren und drangen unter ihrer Tür hindurch.
Sie war aufgeregt, das konnte sie nicht leugnen.
Bleib im Bett und tu so, als würdest du schlafen, sagte sie sich, und wenn dich jemand gesehen hat, behauptest du, du wärst auf der Toilette gewesen. Mühevoll widerstand sie dem Drang, noch einmal aufzustehen. Sie konnte sogar vorgeben, sie sei von ihrer Periode geweckt worden, wer wollte das schon überprüfen?
Manchmal fragte sie sich, ob die Mutter Oberin, diese alte Hexe, die direkt aus dem Mittelalter zu stammen schien, die Menstruationszyklen der jungen Frauen notierte. Es hätte Maura nicht verwundert. Dieser Ort war einfach vorsintflutlich, und Schwester Charity wachte über die Regeln, als stammten sie von Gott persönlich.
Stimmte das tatsächlich?
Interessierte sich Gott wahrhaftig dafür, wann jemand am Morgen aufstand? Sein Frühstück zu sich nahm? Fastete? Maura glaubte das nicht. Genauso wenig wie sie glaubte, dass es ihn interessierte, welche Bücher sie las, wie sie sich kleidete oder ob sie ihr Zimmer tadellos in Ordnung hielt. Sie konnte sich Gott einfach nicht als Zeitmesser und Kerkermeister vorstellen.
Die Mutter Oberin dagegen schon.
Es war eine solche Qual.
Aber nicht für Maura, jedenfalls nicht für immer.
St. Marguerite war lediglich ein düsteres Sprungbrett zu ihrem eigentlichen Ziel – ein Ziel, das sie schon bald erreicht haben würde. Sie musste sich nur noch etwas gedulden und noch eine Zeitlang Gehorsam heucheln.
Ungehalten warf sie die steife, weiße Decke zurück, schleuderte ihren widerspenstigen Zopf über die Schulter und schlüpfte aus dem Bett. Der Fußboden fühlte sich unter ihren Sohlen glatt und kühl an. Maura warf einen Blick auf die unverschlossene Tür und schlich ans Fenster. Ihr Zimmer hatte ein Eckfenster, und wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellte, konnte sie in einer Richtung über das Dach des Klosters in den Garten blicken. Reckte sie den Hals, so schaute sie auf die Seitenmauer des Konvents und über die dicken Mauern hinweg auf die Straße, über die soeben ein Übertragungswagen gerollt kam, dessen Lichter auf dem nassen Asphalt reflektierten.
Die Glocken fingen wieder an zu schlagen. Maura lächelte.
Vielleicht würden nun die Sünden von St. Marguerite ans Tageslicht kommen.
Montoyas Kehle schnürte sich zusammen. Er konnte den Blick nicht von Camille Renards blutleerem Gesicht abwenden. Selbst im Tod war sie noch schön, ihre Haut glatt, makellos. Die großen, weit aufgerissenen Augen sahen nichts mehr, nie wieder.
Aufgewühlt dachte er an ihre gemeinsame Zeit auf der Highschool zurück. Sie war so lebendig gewesen …
Aufreizend. Gerissen. Und höllisch sexy.
»Verflucht«, murmelte er. Was war hier bloß passiert?
Er versuchte, sich zu konzentrieren, im Hier und Jetzt zu bleiben und die Bilder von Camille als Teenager auszublenden, die ihm immer wieder durch den Kopf gingen.
»He!« Bentz warf ihm einen durchdringenden Blick zu. »Alles in Ordnung mit dir?«