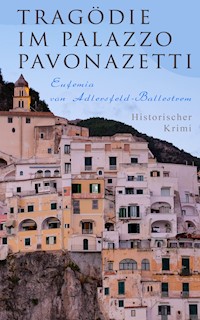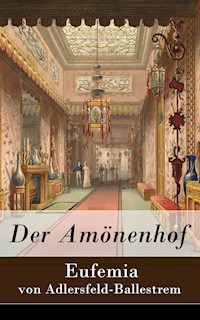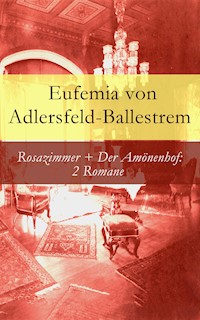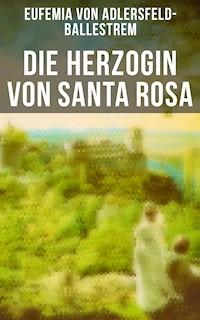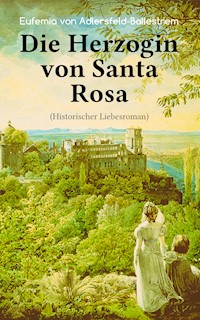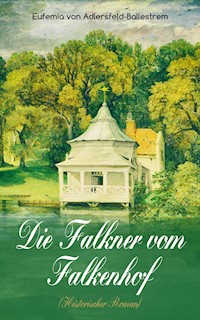Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In 'Detektiv Dr. Windmüller: Gesammelte Krimis' präsentiert die Autorin Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem eine faszinierende Sammlung von Kriminalgeschichten, die den berühmten Detektiv Dr. Windmüller auf seinen aufregenden Abenteuern durch mysteriöse Fälle begleiten. Der literarische Stil der Autorin zeichnet sich durch eine geschickte Kombination von Spannung, Humor und raffinierter Detektivarbeit aus, die Leser jeden Alters anspricht. Die Geschichten bieten nicht nur fesselnde Handlungen, sondern auch Einblicke in die sozialen und kulturellen Kontexte der zeitgenössischen Gesellschaft, die von Adlersfeld-Ballestrems Schreiben bereichern. Mit ihrem Werk bringt die Autorin eine einzigartige Perspektive auf das Krimigenre und hebt sich von anderen Schriftstellern ihrer Zeit ab. Eufemia von Adlersfeld-Ballestrems Hintergrund als Adelsdame und Schriftstellerin könnte sie inspiriert haben, eine solche vielschichtige und unterhaltsame Sammlung von Detektivgeschichten zu schaffen. Ihre Fähigkeit, komplexe Charaktere zu entwickeln und eine atmosphärische Welt zu erschaffen, die den Leser in den Bann zieht, macht 'Detektiv Dr. Windmüller' zu einem Muss für Liebhaber des Krimigenres und Fans von rätselhaften Geschichten. Empfohlen für Leser, die nach einer packenden Lektüre suchen, die sowohl intellektuell anregend als auch unterhaltsam ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1782
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Detektiv Dr. Windmüller: Gesammelte Krimis
Inhaltsverzeichnis
Weiße Tauben
Doktor Franz Xaver Windmüller atmete tief und befriedigt auf, als er nach einer langen und heißen Fahrt mit dem Expreß Wien-Rom endlich in Venedig in der Gondel saß, die ihn in sein Hotel am Canale Grande bringen sollte. Er pries seinen schnellen Entschluß, der ihn statt in seiner Villa am Janiculus in Rom zu einer kurzen Erholung hier haltmachen ließ. Denn in Rom erwarteten ihn augenblicklich keine großen Aufgaben, und die, die er eben in Wien gelöst hatte, bedeuteten solch eine Summe von geistiger Arbeit, physischer Anstrengung und persönlicher Gefahr, daß er sich schon gönnen konnte auszuruhen, auf den unsichtbaren – dem großen Publikum unsichtbaren – Lorbeeren, aus denen allerdings hin und wieder sichtbare Blüten in Gestalt von buntbebänderten Orden entsprossen. Mit einem solchen in der Reisetasche, saß Doktor Franz Xaver Windmüller auch jetzt in der Gondel, und obgleich die seltene Dekoration großartig aussah, war sie doch nur eine kleine Anerkennung für seine Arbeit, die den Frieden zwischen zwei Großmächten retten half. Denn wenn ein gewisses Dokument, das Windmüller an sich zu bringen verstanden hatte, in die Hände der einen jener beiden Mächte gefallen wäre, hätte es die Kriegsfackel unfehlbar entzündet. Zwar sind das Dinge, die sich alle Tage in der hohen Diplomatie ereignen, doch hier hatte der Fall so scheinbar hoffnungslos gelegen, daß nur einer noch helfen konnte: Der stille Raritätensammler in der kleinen Villa am Janiculus in Rom, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, das Verbrechen zu entlarven und Rätsel zu lösen, die sonst keiner lösen konnte. Jetzt da er älter geworden war, und sich erworben hatte, was er zu einem behaglichen Leben und zu seiner Leidenschaft fürs Raritätensammeln brauchte, öffneten sich überall die Türen exklusivster Kreise nicht dem Detektiv, sondern dem feingebildeten, liebenswürdigen Gentleman. Nun war er freilich wählerischer geworden, und »Fälle«, die ihn nicht interessierten, nahm er nicht mehr an, besonders seit die Lösungen diplomatischer Probleme ihn mehr und mehr fesselten.
Wie er so mit seinem feinen, charakteristischen Moltkeprofil in der Gondel saß, hätte man ihn wohl für einen Gelehrten oder für einen Diplomaten, sicherlich aber nicht für den »Bluthund« halten können, der er nach der Ansicht der Leute sein mußte, die sich unter einem »Detektiv« nichts anderes vorstellen konnten, und es wahrscheinlich gar nicht für möglich hielten, daß dieser Mann den alten Palästen der ehemaligen Beherrscherin der Meere solch tiefes Interesse entgegenbringen konnte.
Doktor Franz Xaver Windmüller liebte Venedig, weil er es kannte und studiert hatte, weil er die wunderbare Stadt begriff und ihr ins Herz gedrungen war. Nur einer, der ihre Geschichte kennt, und sie mit offenen Augen sieht, nur einer, der ihr mehr Zeit widmet, als der Durchschnittstourist, wird dazu kommen, Venedig so sehr zu lieben.
Man muß es sehen mit den Augen des Malers und des Archäologen, und man wird in der »Meereskönigin« mehr finden, als in jeder andern Stadt.
Vielleicht liebte Doktor Windmüller, der mit all diesen Augen sah, Venedig um so mehr, als sein Beruf ihn seltsamerweise noch nie dahin geführt hatte, sondern immer nur stets die reine Freude an diesem einzigen Städtejuwel. Venedig war in der Chronik seiner »Fälle« ein ganz unbeschriebenes Blatt, blütenrein, ungetrübt durch Erinnerungen, die geeignet sind, den Glauben an die Menschheit für immer zu begraben. Merkwürdigerweise war Doktor Windmüller dieser Glaube aber nie abhanden gekommen, dank seines Idealismus, den nichts in ihm hatte töten können. Er wollte helfen, weil das die ideale Seite seines Lebensberufes war, und gerade wo er nicht nur aus Interesse sondern aus Menschenliebe half, feierte sein Menschenglaube auch meist einen jener Triumphe, die ihm mehr galten, als seine Berufserfolge, trotzdem er diese in keiner Weise verachtete: ja, die vielen bunten Bändchen in seinem Knopfloch machten ihm sogar kindischen Spaß.
Doktor Windmüller kam also nach Venedig, um sich auszuruhen – eine Woche oder länger, wenn's ging; er kam, um sich an den Kunst- und archäologischen Schätzen zu erfreuen, um er selbst zu sein, in einem Hotel abzusteigen wie andere Reisende, denn kein »Fall« rief ihn hierher, und er hatte nicht nötig, sich in einem Privatlogis unter erborgtem Namen einzumieten, damit die »Herren Verbrecher« nicht wußten, wer ihnen auf der Spur war. Selbstverständlich hatte er für diese Inkognitos die gesetzliche Lizenz und die Behörden wurden darüber verständigt. Damit verschwand auch das charakteristische Moltkeprofil unter einer der vielen Masken, die ihm je nach Bedarf zu Gebote standen.
Für dieses Mal aber durfte er, wie gesagt, er selbst sein, und mit diesem schönen Bewußtsein setzte er sich nach der langen Fahrt im Hotel an den Schreibtisch mit der schönen Aussicht auf den Canale Grande und die vielgeschmähte und doch so unendlich malerische Kirche Santa Maria della Salute, um den schon bereitliegenden Meldezettel auszufüllen, den der Portier ihm sogleich nachgetragen hatte und alsbald wieder abzuholen versprach.
Und Doktor Franz Xaver Windmüller aus Rom, für dessen Beruf die leiseste Zerstreutheit oder nur Gedankenabirrung verhängnisvoll werden konnte, ließ sich im schönen Gefühl, augenblicklich ganz frei und unverantwortlich zu sein, dazu hinreißen – – Doktor Müller aus Wien auf den Meldezettel zu schreiben. Als er's nochmals überlas wie alles, was er schrieb, fiel ihm erst auf, was seine Hand hingezeichnet hatte, ungewollt, überflüssigerweise, als hätte es ein anderer für ihn getan, und gedankenverloren sah er auf den Zettel herab, bis der Portier kam, ihn zu holen. Denn es darf nicht verschwiegen werden, daß der Mann, der die furchtbarste Realistik, die Verfolgung und Heimsuchung des Verbrechers zu seinem Beruf gemacht hatte, metaphysischen Einflüssen zugänglich war.
»Ist das nun ein Wink, daß ich besser hier als Windmüller aus Rom nicht bekannt werde, oder – einfach die Macht der Gewohnheit des Maskierens? »fragte er sich mit dem Blick auf den Zettel. »Nun, wenn ein Mensch anfängt, sich von seinen Gewohnheiten beherrschen zu lassen, dann darf er getrost daheim bleiben. Franz Xaver, solltest du alt werden? Hm, eigentlich habe ich eben noch in Wien bewiesen, daß ich kein Jubelgreis bin. Mit fünfzig Jahren schon – – das wäre noch schöner. Also bliebe der ›Wink‹. Es gibt solche Winke. Aber wir wollen sie nicht beachten und, wenn der Herr Portier kommt, ihn wegen ›Verschreibens‹ um einen neuen Zettel bemühen. Herein!«
Darf ich um den Meldezettel bitten?« schob der so prompt Zitierte sich zur Tür herein mit sehr höflichem Tonfall, denn der neue Fremde sah entschieden wohlhabend aus. Im nächsten Moment hatte er den Zettel in der Hand. »Küss' die Hand, Herr Doktor«, sagte er mit einem Blick darauf auf gut wienerisch und war im zweitnächsten Moment schon wieder draußen.
»Es muß ein Wink sein – ich wollte dem Kerl den Wisch ja gar nicht geben!« setzte Doktor Windmüller sein Selbstgespräch fort. »Oder aber – ich bin so müde von der Aufregung und der physischen Anstrengung der letzten Tage, daß ich schon nicht mehr weiß, was ich will oder was ich tue. Ruhen wir also vor allen Dingen aus: man wird mich schon – über Rom – finden, wenn man mich braucht.«
Aber die Ruhe des großen Mannes blieb ungestört, und auch später fand er unter seinen postlagernden Briefen keinen, der ihn nach irgendeinem fernen Land gerufen hätte. Ein telephonisches Gespräch mit seiner braven schlesischen Haushälterin in Rom belehrte ihn zudem noch, »daß nischt nich los wäre und niemand nich nach ihm gefragt hätte«.
Ungestört lauschte Doktor Windmüller am Abend den Klängen der Serenata auf dem unvergleichlichen Markusplatz. Er lehnte voll Behagen in seiner Gondel und folgte dem Spiel des Mondlichtes, das auf die dunkeln Wasser Millionen von Goldflittern warf. Am nächsten Tag streifte er umher, brachte der »Assunta« von Tizian seine Huldigung dar, und in den Sälen der Academia war es denn auch, wo er den Namen hörte, den er nicht unterbringen konnte.
»Palazzo Favaro« sagte jemand hinter ihm.
In dem gerade sehr vollen Saal war es schwer festzustellen, wer den Namen genannt hatte, denn die Leute drängten sich, als Doktor Windmüller sich umdrehte, gerade so um den Ausgang, daß ein einzelner gar nicht herauszufinden war. Übrigens kam es darauf auch gar nicht an, stellte Doktor Windmüller fest, sondern nur um die Unterbringung des Namens. Favaro! Favaro! Wo hatte er diesen Namen nur schon unter besonderen Beziehungen und Umständen gehört! Natürlich wußte er, daß es einen Dogen dieses Geschlechtes gegeben hatte, der einen Riesenpalast am Canale Grande besaß, welcher jetzt städtischer Besitz war, aber diese Kenntnis konnte es nicht sein, die ihm den Namen so aufdringlich in den Ohren klingen ließ; doch soviel er auch suchte, er fand die Beziehung nicht, und das verleidete ihm fast den Rest des Tages, an dem es ihn, wo er auch ging, stand und sah, förmlich verfolgte mit dem ewigen: Favaro! Favaro!
Nachts, als er gerade einschlafen wollte, nachdem er sich gezwungen hatte, an andere Dinge zu denken, kam natürlich die Erleuchtung, wie es zu gehen pflegt, wenn dem Willen die Ausschaltung eines hartnäckigen Gedankens gelungen ist. Wie er nur hatte vergessen können, daß ja das einzige Kind des letzten Favaro, des italienischen Botschafters in London, die Gattin des deutschen Botschaftsrats von Verden war – einfach nicht zu glauben! Nachdem er diesem Diplomaten erst vor sieben Jahren die Sache mit dem verschwundenen Brief des Königs von – hm! – in Ordnung gebracht hatte, die seiner Karriere einen schweren Stoß zu geben drohte, und er zu diesem Zweck fast vierzehn Tage lang sein Gast gewesen war!
»Franz Xaver, was ist denn mit dir los?« fragte er sich im Bett aufsitzend. »Überarbeitung«, gab er sich selbst zur Antwort. Und dann kam ihm die ganze Sache zurück ins Gedächtnis samt den dazugehörigen Personen. Vor allem natürlich Frau von Verden, die schlanke, elegante und aparte venezianische Patrizierin. Sie hatte ihm erzählt, daß ihr Vater, der alte Herzog Favaro, der sich eben hatte pensionieren lassen, das alte Stammhaus ihres Geschlechtes in Venedig bewohnte, nicht aber den Palazzo am Canale Grande, der sich in einer jüngeren, weiblichen Linie vererbt hatte, die nun erloschen war. Der monumentale Bau, den der Doge Favaro vor zweihundertfünfzig Jahren errichtet hatte, war als Schenkung der Stadt übergeben worden.
»Mein Vater wünscht, daß mein Mann seinen Namen annimmt«, hatte sie hinzugefügt, »aber was hat es für einen Zweck? Wir haben ja nur eine Tochter, mit der der Name doch erlischt.«
Die Tochter war ein langer, wilder Schlaks, der sich überall unnötig machte, in den schönsten Lümmeljahren ihres Geschlechtes, mit zwei Händen und zwei Füßen zuviel, aber mit ein Paar intelligenten, beredten und klaren rostbraunen Augen von wunderbarer Schönheit, – Augen, die es ganz unmöglich machten, dem Mädel böse zu sein, wenn es sein Mütchen an jedermann im Hause ohne Unterschied von Alter, Würde und Geschlecht kühlte. Doktor Windmüller erinnerte sich ganz genau, daß er eine Schwäche für diese Augen hatte, und ihrer Besitzerin noch später mal eine Schachtel Bonbons schickte, für die er einen so charakteristischen Dankesbrief erhielt, daß er den für verständnislose Seelen nichts wie entsetzlich geschmierten Wisch schmunzelnd unter seinen Briefschätzen aufbewahrte. Solch eine Auszeichnung pflegte Doktor Windmüller nicht an Unwürdige zu verschwenden und zeugte außer für seine Sympathie in diesem besonderen Fall noch für das fast unfehlbare Urteil dieses großen Menschenkenners. Er wußte, daß sich die klaren und reinen Tiefen dieser Kinderaugen durch den Hauch der Welt nicht trüben würden und sah viele glänzende und seltene Möglichkeiten des noch ungeformten Charakters dieses jungen Wesens voraus. Schon die Rassenmischung in der kleinen Verden hatte ihn höchlich interessiert und ihm die Frage vorgelegt: Wer wird den Sieg in ihr davontragen: Der Vater, der echte, rechte, kraftvolle, deutsche Krautjunker, den Gott in seinem Zorn zum Diplomaten gemacht haben mußte, oder die venezianische Mutter, die einem langreihigen Diplomatengeschlecht entstammte, dessen Hyperkultur seine Glieder in vielfältigen Facetten erglänzen ließ, bis in die Tage der Neuzeit, in der das sterbende Venedig wieder auflebte und gesundete. Mochte man die Geschichte der Länder nachschlagen wo immer man wollte im Lauf der letzten vierhundert Jahre – wieder und wieder tauchte der Name Favaro auf unter den Gesandten der venezianischen Republik, immer wieder war es ein Favaro, der die schwierigsten diplomatischen Fragen zugunsten Venedigs zu lösen verstanden hatte, und auch die Generäle dieses Geschlechtes waren zugleich Diplomaten, die ihre ruhmreichsten Schlachten mit dem Kopfe schlugen. Der größte von ihnen trug am Ende seines Lebens auch die Mitra eines Bischofs, und seiner gleichzeitigen Eigenschaft als Mäzen der Kunst verdanken wir heute noch eine von Tizians unvergleichlichen Schöpfungen . . .
Der berühmteste der Favaro trug den »Corno«, die Krone des Dogen von Venedig. Er hatte als Gesandter der Republik in Wien, Paris, London und Madrid die schwierigsten diplomatischen Fragen zugunsten seiner Heimat glänzend gelöst, er hatte durch seinen persönlichen Einfluß im Senat Venedig vor einem schmählichen Frieden mit den Türken bewahrt. Diesen glänzenden und einflußreichen Geist stellte die Republik zum Danke kalt dadurch, daß sie ihn zum Dogen erwählte: »Rex in purpura, Senator in curia, in urbe Captivus.« Im Purpur König, im Rate Senator, in der Stadt Gefangener. Ein knappes Jahr nur trug Giovanni Favaro den »corno«; der Rat der Zehn gestattete ihm, in den Purpur gehüllt ins Grab zu steigen und unter dem pompösesten Monument den jüngsten Tag zu erwarten. Denn man hatte ja aus der Geschichte der Dogen gelernt – auf beiden Seiten. Ein Marino Falieri war nicht mehr wiedergekehrt und das Schicksal des gefährlich gewordenen, aber unangreifbaren Francesco Foscari hatte zu viel Murren erregt, um noch einmal wiederholt zu werden. Man wählte und krönte also den zu klugen, zu einflußreichen Mann, man gab ihm nach einer sorglich abgewogenen Frist des Glanzes einen Trunk, der ihm nicht bekam, und begrub den Gefürchteten mit einem Gepränge, das die Augen blendete und die Mäuler stopfte. Die letzte, direkte Nachkommin dieses Dogen von vor zweihundertfünfzig Jahren hatte den jungen deutschen Diplomaten geheiratet, den sie in Berlin kennenlernte, wo ihr Vater damals Botschafter war. Nicht eben sehr zu des letzteren Erbauung, denn so sehr er die moralischen Eigenschaften des mit Gewalt zur Diplomatie gepreßten jungen Mannes schätzte, so gut er begriff, daß seine Tochter ihr Herz an dieses Prachtexemplar eines germanischen Recken verlieren konnte, so genau erkannte er auch die Grenzen der Befähigung seines Schwiegersohnes, aber er liebte seine Tochter zu sehr, um sich ernstlich ihrem Glück entgegenzustellen. Und so wurde denn Giovanna Favaro Frau von Verden, und wenn sie selbst sich auch in ihrem Glück nicht getäuscht sah, so enttäuschte sie ihren Vater zum zweitenmal dadurch, daß sie ihm den erwarteten Enkel, auf den der große alte Name übertragen werden sollte, nicht bescherte, denn sie hatte »nur« eine Tochter, die wie ihre Mutter Giovanna hieß, zum Unterschied von dieser aber nicht mit der beliebten Abkürzung »Vanna«, sondern »Gio« gerufen wurde.
»Richtig, – Gio! Gio von Verden«, schloß Doktor Windmüller beruhigt seine Reminiszenzen über den halbvergessenen Namen Favaro. Der alte Herzog, dessen Vater von Österreich nebst andern Patriziern mit einem Titel für das bedeutungslos gewordene Patriziat entschädigt worden war, mußte nach Doktor Windmüllers Wissen schon fast acht Jahre pensioniert und gewiß schon drei bis vier Jahre tot sein. Auch daß Hans von Verden wenige Jahre vor seinem Schwiegervater gestorben war, wußte Windmüller; was aber war aus der Witwe und deren Tochter geworden? Waren sie in Deutschland geblieben? Waren sie in Venedig? Palazzo Favaro – der Riesenpalast dieses Namens am Canale Grande, war jetzt Eigentum des Staates, aber es war ja nicht ausgeschlossen, daß es noch einen zweiten Palast dieses Namens gab, einen älteren, denn das Geschlecht war ja schon zu Beginn des dreizehnten Jahrhunderts nach Venedig gekommen und in dem »Goldenen Buche« der Republik eingetragen worden.
Doktor Windmüller, der nun fand, daß ihm der Name Favaro genug seines kostbaren Schlafes geraubt hatte, faßte noch den Entschluß, morgen Erkundigungen einzuziehen, legte sich auf die andere Seite und holte nach, was er versäumt hatte.
Und in der Nacht träumte ihm so lebhaft von – weißen Tauben, daß er beim Erwachen am andern Morgen noch ganz erfüllt davon war.
»Was man doch gleich für sanfte Träume hat, wenn man einmal ›blau‹ macht«, schmunzelte Doktor Windmüller vor sich hin, als er sich zum Frühstück setzte. »Von Tauben – nicht doch, von weißen Tauben zu träumen! Wenn ich nur wüßte, in welchem Zusammenhang! Was hat mich denn ausgerechnet auf Tauben gebracht? Ja und – was wollte ich doch gleich heute früh tun? Richtig, mich nach den Favaros erkundigen. Werde nachher mal bei dem Manager anklopfen . . . Er ist Venezianer; vielleicht weiß er etwas über den Verbleib der letzten Favaro.«
Der vielbeschäftigte Allwisser der großen Karawanserei aber war heute früh nicht zu sprechen, denn er war damit beschäftigt, sich, figürlich geredet, die Haare auszuraufen, als Doktor Windmüller vor seinem Bureau stand: einer im Hotel wohnenden Multimillionärin aus Chikago waren während der Nacht ihre ganzen Brillanten gestohlen worden. Aus dem verschlossenen Zimmer, aus dem Nachttisch neben ihrem Bett! Der unglückliche Manager war nahe daran, in den Kanal zu springen, denn die Beraubte zeterte mit einem Organ, das man vom Lido bis Santa Chiara hören konnte, und denunzierte das Hotel als eine »Räuberhöhle« in einer Sprache, die stark an die Fabrikhöfe erinnerte, während ihr Gatte unter allerlei Drohungen fortwährend ausspuckte. Wenn nun, hörbar für alle Gäste, das erste Hotel der Stadt eine Räuberhöhle und ein »dreckiges Loch von einem Gasthof« genannt wird, aus dem man »das gestohlene Gut schon herausquetschen würde«, so hat der unglückliche Direktor des besagten Hauses schon das Recht, für andere Gäste unsprechbar zu sein, und Doktor Windmüller sah das auch ohne weiteres ein. Heroisch den Instinkt in sich unterdrückend, der ihn zwingen wollte, dem Brillantendieb sofort auf die Spur zu kommen, verließ er schleunigst das Hotel, um den kleinen, flinken Dampfer zu besteigen, der ein so angenehmes und amüsantes Beförderungsmittel ist. Doch zunächst trat er in die stille, kleine Kirche der Zobenigo und Barbaro ein, um den Gemälden von Tizian, Tintoretto und Rubens eine vom gewöhnlichen Reisepöbel ganz unbehelligte halbe Stunde kunstfrohen Schauens zu widmen.
Als er wieder auf den kleinen Campo hinaustrat, sah er für einen Moment unschlüssig nach dem Zugang zur Dampferhaltestelle hin und wandte sich dann nach rechts, Santa Maurizio zu, weil er gelesen hatte, daß diese Kirche schöne Skulpturen von Domenico Fadiga enthalten sollte. Doch die Pforten waren geschlossen, und Doktor Windmüller wollte über den großen palastumsäumten Campo Morosini zur Academia gehen. Aber ein Schwarm von Tauben, der über seinen Kopf wegflog und sich vor der Pforte des schönen Doms von San Stefano niederließ, lenkte ihn nach der entgegengesetzten Richtung.
»Die Tauben von San Marco«, dachte er und beobachtete die gierig pickende Schar. Alle ganz gleich: grau mit schillernden Flügeln, unverändert seit Hunderten von Jahren. Natürlich, es gibt ja gar keine andere Rasse hier, keine weißen Tauben, von denen ich geträumt habe. Nun trat er in die Kirche ein und nach einem Rundgang auch in den ehemaligen Klosterhof mit den grotesken Resten der Fresken des Pordenone. Gerade als Doktor Windmüller aus der Kirchentür trat, kam von der entgegengesetzten Seite vom Campo San Angelo eine weißgekleidete Dame, begleitet von einer älteren Person in dem charakteristischen, schwarzen, langbefransten Umschlagetuch der venezianischen Frauen und Mädchen aus dem Volk, den wohlfrisierten Kopf unbedeckt, wie es die alte Sitte will, die zum Glück noch keine »Mode« verdrängen konnte. Doch nicht von ihr wurde Doktor Windmüllers Blick gefesselt, sondern von ihrer »Dame«, die eine junge Dame war, groß, schlank, elegant und doch sehr einfach und mit einem Gesicht, das schon in der Entfernung Doktor Windmüllers Adlerauge bekannt schien und doch auch wieder fremd war: ein zartes, aber sehr charakteristisches Gesicht durch die kurze, schmale und kühn gebogene Nase, den schönen, festen und doch lieblichen Mund und die großen, etwas tiefliegenden Augen unter den geraden, schmalen Brauen. Und unter dem großen, schwarzen Hut rostbraunes Haar, das ganz golden schimmerte, wo es die hellsten Lichter fing.
Links um den Kreuzgang biegend, kam sie Doktor Windmüller gerade entgegen, stutzte sichtlich, als sie ihn sah, machte einen Schritt vorwärts, stutzte wieder und lief ihm dann mit ausgestreckten Händen entgegen.
»Onkel Windmüller!« rief sie halb lachend, halb zögernd. »Ja, ist es denn menschenmöglich, sind Sie es wirklich?«
»Ich bin's, schwelle vor Stolz über den Onkeltitel, der mir zwar unverdient, aber glatt und angenehm heruntergeht«, versicherte er schmunzelnd. »Aber Sie, meine Gnädigste, Sie sind – – ja – nein – Sie sind doch nicht die kleine Gio Verden?«
»Na, hören Sie mal, Onkel Windmüller, ›klein‹ haben Sie mich eigentlich nie gekannt«, begann sie entrüstet.
»Nein, es ist wahr«, unterbrach er sie lachend. »Sie fielen mir heut nacht ein und ich nannte Sie in Gedanken einen ›langen – hm – langen Schlaks‹, mit Ihrer gütigen Erlaubnis!«
»Die haben Sie«, rief sie hell auflachend. »Gottlob, es ist wieder einer da, der Deutsch reden kann!« setzte sie inbrünstig hinzu.
»Und folglich bezog ›klein‹ sich nur auf Ihre damalige größere Jugend«, vollendete Doktor Windmüller erläuternd und bewunderte mit wachsendem Wohlgefallen die äußerst pikant wirkende Mischung der lateinischen und der teutonischen Rasse in dem blühenden, jungen Gesicht, aus dem die rostbraunen Augen mit den goldenen Lichtern ihn mit demselben freien, furchtlosen und reinen Ausdruck ansahen, wie vor sechs Jahren.
»Alter!« machte sie befriedigt und war dabei ganz Italienerin. »Also, Sie haben heut nacht an mich gedacht, Onkel Windmüller?« fuhr sie lebhaft fort. »Wußten Sie denn, daß ich jetzt hier lebe – wenigstens fürs erste?«
»Nein, das wußte ich nicht«, erwiderte er überrascht. »Ich weiß überhaupt nichts mehr von Ihnen allen. Es nannte gestern jemand den Namen Favaro und dieser brachte Sie meinem Gedächtnis zurück, und ich bin eigentlich heut ausgegangen, um mich zu erkundigen, ob etwa Ihre Frau Mutter noch gelegentlich hierherkommt.«
»Meine Mutter liegt seit fast einem Jahr neben Großpapa in der Familiengruft da –«, sie deutete auf die Kirche hinter Doktor Windmüller, der erschrocken und bewegt ihre Hand ergriff und herzlich drückte.
»Und ich habe keine Ahnung davon gehabt!« sagte er statt aller Gemeinplätze einfach und doch so voll inniger Teilnahme, daß ein Mehr – weniger gewesen wäre. »Kam es sehr überraschend für Sie?« fragte er dann.
»Ganz überraschend«, sagte Gio Verden leise. »Sie starb hier in Venedig, während ich in Deutschland zu Besuch bei Verwandten war, vergnügt, glücklich, ahnungslos. Sie müssen wissen, Onkel Windmüller, daß wir, Mama und ich, nach Vaters Tod ganz zu Großpapa nach Venedig übersiedelten, in die alte Ca' Favaro, das Stammhaus da drüben – Sie können es vom Campo San Angelo über alle andern Paläste herüberragen sehen. Großpapa hatte zwar, um nicht allein zu sein, eine Kusine von meiner Mutter auf unbestimmte Zeit mit ihrem Mann zu sich eingeladen – sie sind noch da –, aber das Haus ist ja groß genug für ein Dutzend Familien! Ja, und Mama starb so plötzlich, so unerwartet! Ein Herzschlag, sagte der Arzt. Niemand hat gewußt, daß sie herzkrank war, sie selbst sicher nicht. Und nun bin ich natürlich hiergeblieben und habe das große Haus – –«
Sie stockte; ein herber Zug legte sich um ihren lieblichen Mund und ihre Augen sahen Doktor Windmüller mit einem eigenen Ausdruck an. »Rita«, sagte sie dann, und wandte sich ihrer Begleiterin zu, welche den Fremden mit ein Paar sehr mißtrauischen Augen beobachtete, die in dem pergamentartig braunen und mageren Gesicht wie schwarze Kirschen aussahen, »Rita, Sie können wieder heimgehen. Ich habe einen alten Freund meines Vaters getroffen, der die Güte haben wird, mich zu begleiten.«
Die Person murmelte etwas vor sich hin, zuckte mit den Achseln, machte unentschlossen einen Schritt rückwärts und blieb dann stehen.
»Was wird Donna Onesta sagen?« kam es halb herausfordernd, halb furchtsam über ihre schmalen Lippen.
»Das müssen wir Donna Onesta überlassen«, erwiderte Gio von Verden scheinbar ganz gelassen. »Es kann Ihnen übrigens gleichgültig sein, was sie sagen wird, Rita, da ich ja die Herrin der Ca' Favaro bin, nicht?«
»Freilich!« murmelte die Person mit sichtlich sehr geteilten Gefühlen. »Aber Donna Onesta ist – war – hat so lange in der Ca' Favaro zu befehlen gehabt – – und ist Ihre Tante, Donna Giovanna.«
»Sie ist die Kusine meiner Mutter, Rita«, verbesserte Gio ebenso gelassen wie vorher. »Sie ist aber nicht meine Herrin, sondern mein Gast. Nicht wahr, Sie verstehen den Unterschied?«
»Sicher! Sicher!« beeilte sich die Dienerin zu sagen, und der Ausdruck ihrer Augen bewies, daß sie wirklich den feinen Unterschied begriffen hatte. »Donna Onesta hat dann auch mir nichts zu befehlen », setzte sie fragend hinzu.
»Nun, wenn sie einen Dienst von Ihnen erbittet, so versteht es sich von selbst, daß Sie ihn einem Gast der Ca' Favaro nicht verweigern werden«, erwiderte Gio mit Nachdruck.
»Freilich! Natürlich! Donna Giovanna! Damit wandte sich die Person um und verschwand alsbald durch die Pforte zur Kirche.
»Verzeihen Sie die Lektion, Onkel Windmüller«, wandte sich Gio nun an ihren Begleiter. »Es mußte aber einmal doch gesagt werden und die Gelegenheit war so wundervoll günstig. Übrigens sind Sie ja in Italien so zu Hause, daß es Sie nicht wundern wird, solche Angelegenheit mit den Dienstboten disputiert zu hören.«
»Wer ist denn diese Donna Onesta, gegen die Sie Ihre Rechte zu verteidigen haben?« fragte Doktor Windmüller interessiert.
»Donna Onesta Favaro ist die Kusine meiner Mutter, die Tochter von Großpapas jüngerem Bruder«, erklärte Gio mit eigentümlich trockenem Ton. »Er lud sie ein, ihm den Haushalt zu führen und die fehlende Dame des Hauses zu ersetzen, als er nach seiner Pensionierung nach Venedig zurückkehrte. Natürlich kam ihr Gatte mit ihr . . . Er ist Amerikaner und heißt Tom Morgan. Sie hat ihn beim amerikanischen Botschafter in Rom kennengelernt und er soll aus guter oder sogar bester Familie sein. Er ist gewiß zehn Jahre jünger als Donna Onesta, die ein Jahr älter ist als meine Mutter. Ja, und als meine Mutter Witwe wurde und Großpapa wünschte, daß wir zu ihm kämen, da war er natürlich zu höflich, um den Morgans zu bedeuten, daß er ihrer nicht mehr bedurfte . . . Mr. Morgan war aber gewissermaßen Großpapas Privatsekretär und Verwalter geworden und schien anzunehmen, daß er dadurch für die genossene Gastfreundschaft ein Äquivalent bot – kurz, sie blieben, und auch nachdem Großpapa gestorben war, sprach niemand mehr davon, daß sie gingen oder gehen könnten. Es ist ja wahr, daß Mr. Morgan meiner Mutter in jeder Hinsicht sehr nützlich war, als sie nun ganz allein zurückblieb, und mir auch, als ich in dieselbe Lage kam. Aber ich habe mich dann selbst in alles hineingearbeitet, denn ich hasse die Abhängigkeit. Selbst ist der Mann und heutzutage auch die Frau«, schloß sie mit einer sie gut kleidenden Miene von Selbstbewußtsein, das Doktor Windmüller ihr ohne weiteres zutraute.
»Mr. Morgan scheint danach keinen Beruf zu haben«, meinte er mit einem Interesse, daß er selbst nicht gerechtfertigt fand.
»Nein – 's scheint wirklich nicht der Fall zu sein«, gab Gio trocken zu, so trocken für ihre Jugend, daß Doktor Windmüller aufhorchte. »Aber unheimlich klug ist er«, setzte sie hinzu.
»So so! Nun, manche Leute betrachten es als genügenden Beruf, Privatier zu sein«, bemerkte Doktor Windmüller, ohne auf den Zusatz zu achten.
»Oder von anderer Leute Renten zu leben«, ergänzte Gio noch trockener. Und dann wandte sie sich plötzlich ihrem Begleiter voll zu. »Wissen Sie was, Onkel Windmüller? Ich habe eine herrliche Idee – wenigstens wäre ihre Ausführung herrlich für mich. Kommen Sie und seien Sie mein lieber und verehrter Gast in der Ca' Favaro. Das heißt natürlich, wenn Sie gerad' Zeit haben . . . Sie wollten ja immer einmal einen echten, venezianischen Palast kennenlernen . . . Erinnern Sie sich noch, wie Sie damals davon sprachen, als Sie bei uns waren, um – wie ich's jetzt weiß – Vaters Ehre und Karriere zu retten? Nein, Sie brauchen nicht abzuwehren, ich weiß ja, daß Sie's taten und den Verdacht von Vater nahmen, ein Landesverräter zu sein. Und den richtigen Dieb des Briefes oder Dokuments, für das Vater verantwortlich war, fanden – – ach ja, ich habe das alles verstehen gelernt und gelernt, Ihnen dankbar zu sein . . .«
Sie hatte rapid gesprochen, die Worte überstürzend, »wie es nur eine Italienerin kann«, dachte Doktor Windmüller und drückte die schmale Hand, die sie ihm reichte.
Das ist ja mein schönster Lohn in meinem so viel Häßliches enthüllenden Beruf, wenn er mir neue Freunde erwirbt«, sagte er und sah dem jungen Mädchen forschend in die Augen. »Es war ein Glück für mich, daß ich den Dieb damals in Ihres Vaters Hause zu vermuten Ursache hatte, denn das führte mich als Gast dort ein und ich durfte damit auch Ihre liebe, schöne Mutter kennenlernen. Und Sie selbst, Fräulein von Verden, trotzdem ich schon gestehen muß, daß Sie mir das Vergnügen Ihrer Bekanntschaft oft recht sauer machten . . .«
»Ich wußte doch nicht, warum Sie bei uns waren, – selbst Mama wußte es nicht – sonst hätte ich Sie ja nicht mit meinen dummen Streichen, Fragen und was weiß ich, geplagt!« verteidigte sie sich, indem es unwiderstehlich um ihren Mund zuckte – ein Beweis, daß ihre Reue darüber jedenfalls nicht in Sack und Asche ging. »Ich hatte Sie nämlich gleich tief in mein Herz geschlossen, Herr Doktor– nun ja, wenn Sie mich ›Fräulein‹ titulieren! – also, Onkel Windmüller!«
»Erlauben Sie – war es denn durchaus nötig, mir saure Gurken ins Bett zu legen?« unterbrach er sie, herzlich lachend.
»Nötig nicht, aber irgendwie muß man's doch zeigen, wenn man jemand seiner Beachtung für würdig hält«, erwiderte Gio von Verden im gleichen Ton. »Ach, wenn Sie wüßten, wie oft ich an Sie gedacht und Sie herbeigesehnt habe! – Glauben Sie mir's oder glauben Sie mir's nicht: ich hab' mir aber jahrelang einen von den Bonbons zum Andenken aufgehoben, die Sie mir von Rom aus schickten!«
»Das war wohl eine Sorte, die Sie nicht besonders gern aßen?« erkundigte sich Doktor Windmüller neckend und setzte im gleichen Ton hinzu: »Aber ich halte Sie wirklich nicht für so egoistisch, sich nur wegen der bevorzugten Sorte nach mir gesehnt zu haben. ›Gesehnt!‹ wie schön das klingt – für mein Ohr! Im übrigen haben Sie aber recht: erst gestern, als ich vor dem Holzmodell des nie vollendeten Palazzo Valier im Museum stand, dachte ich mir, wie gern ich einmal einen alten venezianischen Patrizierpalast sehen und studieren möchte. Die Ca' Favaro ist wohl wesentlich älter als der Palazzo am Canale Grande?«
»Sie ist aus dem zwölften Jahrhundert«, rief Gio Verden, aus deren Augen mit einem Schlag das Lachen verschwand, das noch auf ihren Lippen lag. »Sie müssen das Haus sehen«, fuhr sie eindringlich fort, »es ist zwar düster, weil es so eingekeilt liegt, aber es ist interessant. Und dann habe ich doch auch Großpapas Antiquitätensammlung – wunderbare Sachen! Und alte Bilder und Waffen – o kommen Sie, ja? Aber nicht nur für einen kurzen Besuch, sondern für Tage, Wochen – solange Sie wollen, bis – – bis Sie alles gesehen und studiert haben.«
Windmüller kämpfte einen kleinen Kampf mit sich; er liebte die Unabhängigkeit, die er im Hotel hatte und die man als Logierbesuch in einem Privathaus zweifellos aufgibt, man mag's drehen und wenden, wie man will. Er überlegte, daß er ja alle Tage, solange er hier war, in die Ca' Favaro gehen und dann wieder in die Unabhängigkeit seines Hotels zurückkehren konnte, aber er sah die beiden wunderbaren rostbraunen Augen mit den schönen, goldenen Lichtern darin auf sich geheftet mit einem Ausdruck, der ihn genau so unbewußt zwang, nachzugeben und zuzusagen, wie er vorgestern unter einem Einfluß, den er sich nicht erklären konnte, den Zettel mit seinem abgekürzten Namen dem Hotelportier wider seinen Willen gegeben hatte.
»Wenn Sie mich haben wollen, Gio, so komme ich gern«, hörte er sich bedächtig sagen. »Mein Koffer im Hotel ist rasch wieder gepackt –«
»Und die Gondel bringt Sie in einer Viertelstunde zur Ca' Favaro«, fiel Gio mit einem tiefen Atemzug ein. »Ich danke Ihnen tausendmal für dieses Opfer, das Sie mir bringen – oh, ich weiß, es ist ein Opfer für Sie, das Opfer Ihrer paar Erholungstage. Das einzige, was mich dabei tröstet, ist, daß Sie vielleicht – wahrscheinlich später, nicht bereuen werden, das Opfer gebracht zu haben. Und wann darf ich Sie erwarten? Schon zu unserem italienischen Gabelfrühstück um ein Uhr?«
»Ja«, erwiderte er, ohne die Augen von ihr zu wenden. »Ich werde bald nach zwölf Uhr bei Ihnen sein.«
Wieder atmete sie tief auf.
»Nochmals Dank, vielen, vielen Dank. Und gleichzeitig ›auf Wiedersehen‹, denn ich muß zurück ins Haus, Ihr Zimmer zurechtmachen zu lassen. Und – und darf ich noch eine große Bitte aussprechen, eine ganz furchtbar große, ja?«
»Steht es in meiner Macht, sie zu erfüllen?«
Gio nickte bejahend, zögerte, sah sich um . . . es war keine Seele zu sehen in dem stillen Klosterhofe, nur ein paar Katzen sonnten sich auf dem erhöhten Rasen an der längst verschlossenen Zisterne, dennoch aber war ihre Stimme zum Flüstern gedämpft, als sie hastig sagte:
»Ich möchte Sie – unter einem andern Namen in der Ca' Favaro einführen.«
Vor Windmüllers geistigem Auge zerriß plötzlich ein Schleier: er sah Licht, und zwar ein Licht, das ihn für den Augenblick so blendete, daß Gio Verden hastig und leise fortfahren konnte:
»Sehen Sie, Onkel Windmüller, Ihr Name ist so berühmt – in gewissen Kreisen, wie Vater sagte und Großvater auch, denn woher sollte ich es sonst wissen? ›Vor dem Namen zieht die Schnecke ihre Hörner ein‹, hat Vater gesagt. Es – es könnte ja Schnecken in der Ca' Favaro geben, sehen Sie, die zu erschrecken es mir leid wäre. Nicht wahr, ich darf Sie unter anderm Namen einführen bei – meinen Verwandten und überhaupt. Ganz einzig und allein überhaupt –«
Windmüller fand, daß vor dem plötzlich enthüllten Licht eine dichte Milchglasscheibe stand und war entschlossen, diese im Notfall zu zerschlagen.
»Nein, das geht nicht«, sagte er leise und sehr deutlich. »Sie werden das selbst einsehen, Gio, daß ich ohne Grund, ohne einen zwingenden Grund nicht unter einem Decknamen in Ihr Haus kommen kann. Überlegen Sie es und Sie werden mir recht geben. Aber Sie haben einen zwingenden Grund; so viel kann ich mir aus einzelnen Ihrer hingeworfenen Worte zusammenreimen: Sie haben ihn oder glauben ihn zu haben. Wie dem auch sei, ich muß wissen, warum ich in ihrem Hause meine Identität verstecken soll, oder – ich kann überhaupt Ihr Gast nicht werden.«
Gio war blaß geworden. Sie preßte ihren lieblichen Mund fest zusammen und schüttelte den Kopf.
»Ich weiß nichts – ich kann nichts sagen«, murmelte sie mit abgewendetem Blick.
»Dann also vermuten Sie etwas, das Ihnen meine Gegenwart in Ihrem Hause erwünscht macht«, forschte Windmüller sehr freundlich, und als er sah, wie schwer sie mit sich kämpfte, nahm er ihre schlaff herabhängende Rechte in seine beiden Hände: »Gio, wie kann ich Ihnen denn helfen, wenn Sie kein Vertrauen zu mir haben?«
»Kein Vertrauen! Ich, die ich Häuser auf Sie baue, die ich Sie herbeigesehnt habe, wie – wie –«
»Nun also! Aber gar nicht oder ganz. Weshalb wollen Sie, daß ich zu Ihnen komme?«
Sie sah zu ihm auf mit ein Paar Augen, aus denen alle goldenen Lichter verschwunden waren.
»Oh, ich sehe ein, daß es töricht war, es zu wollen – in dieser Meinung«, erwiderte sie klar und ruhig. »Vergessen Sie also meine dumme Bitte und kommen Sie ohne Inkognito, ja?«
»Nein, Gio, das möchte ich jetzt nicht mehr«, sagte Windmüller sehr bestimmt. »Damit würde ich sicherlich das in eine andere Bahn lenken, was zu enthüllen Sie mich – und mit Ihren eigenen Worten zu reden – herbeigesehnt haben. Ich bin nach meinen Erfahrungen gar nicht sicher, ob diese andern Bahnen die richtigen und für Sie gefahrlosen sind. Gio, Sie sind doch ein vernünftiges Wesen und konnten nicht erwarten, daß ich ohne weiteres und ohne nach dem Warum zu fragen, unter einem Decknamen in Ihr Haus kommen würde. Ich besitze ja eine gewisse Beobachtungsgabe und würde auch mit einem unbestimmten Verdacht vielleicht herausbekommen, was in Ihren Gedanken ist, aber erstens brauche ich dazu mehr Zeit, als ich aufwenden darf, und dann kann ich mich doch auch in Irrwegen verlieren. Das ist menschlich und ist auch mir schon passiert. Also – heraus mit der Katze aus dem Sack: Was soll ich in der Ca' Favaro? Was beunruhigt Sie dort?«
»Gut!« rief Gio Verden entschlossen. »Gut, Sie sollen es mit zwei Worten erfahren und mich dann gründlich auslachen: ein Traum! Das heißt, ich vermute, daß es ein Traum ist. Was sollte es anders sein? Aber ob es etwas anderes ist, das eben sollten Sie herauskriegen.«
»Ohne daß Sie mir den ›Traum‹ erzählen? Ich bin doch kein Hexenmeister!« sagte Windmüller mit wachsendem Interesse.
»Das muß ich wohl angenommen haben, als ich Ihnen meine strohdumme Bitte vorplapperte«, gab Gio ohne weiteres zu. Aber warum lachen Sie mich denn nicht aus?« fuhr sie heftig auf.
»Ich? Nun, weil ich doch nicht zu den Philistern gehöre, die sich jedes Ding zwischen Himmel und Erden ›ganz leicht‹ erklären können«, verwahrte Doktor Windmüller sich. Träume, auch Tagesträume, das heißt, mit offenen Augen, gehören zu den unerforschten Gebieten, hinter deren Geheimnisse wohl hienieden keiner kommen wird. Man hat versucht, aber man hat keine annehmbare wissenschaftliche Erklärung dafür geben können. Nein, ich lache gar nicht über Ihren Traum, den ich natürlich aber erst erfahren müßte, weil ich ja nur Dingen auf den Grund gehen kann, die ich kenne.
In Gios Augen war während dieser Worte das Licht zurückgekehrt und eine Reihe widerstreitender Gefühle malten sich auf ihrem intelligenten Gesicht.
»Gut«, sagte sie nach kurzem Kampfe. »Da Sie mich nicht auslachen, so will ich Ihnen den Traum erzählen. Aber wo? Hier? Freilich, hier kann ja niemand zuhören. Also – nicht wahr, ich sagte Ihnen schon, daß ich verreist war, als Mama starb? Ich kam, vor ihrer Beisetzung in der Gruft der Favaro, zurück nach Venedig und habe sie noch im Sarge sehen können. Sie war ja auch im Tod noch sehr schön, aber es war doch in ihrem Gesicht etwas mir Fremdes, das ich mir nicht erklären konnte . . . Und an ihrer Hand trug sie einen Ring, den ich nie zuvor bei ihr gesehen hatte: einen goldenen Spiralring in Form einer Schlange mit Rubinenaugen und einem wunderfeinen, goldenen Krönchen auf dem Kopf! Donna Onesta behauptete, Mama hätte diesen Ring schon so lange gehabt, als sie sie gekannt hätte, und wollte mich ihn nicht abziehen lassen – man dürfe den Toten nichts fortnehmen. Ich halte das für Aberglauben, aber ich hab' nachgegeben, denn es war ja schließlich ganz egal. Ich kann aber schwören, daß ich diesen Ring nie an Mamas Hand, nie in ihrem Besitz gesehen habe, obgleich ich doch hundertmal in ihren Sachen, in ihren Juwelen kramen durfte! Freilich muß ich zugeben, daß ich damit nicht alles gesehen zu haben brauche, was Mama besaß, wie Mr. Tom Morgan ganz richtig bemerkte. . . . Man kommt nämlich nie gegen Mr. Tom Morgan auf, und wenn unser Herrgott alles weiß, so weiß Mr. Tom Morgan sicherlich alles besser . . . Doch das gehört ja nicht hierher; die Zeit vergeht und ich vertrödle sie ausgerechnet mit Tom Morgan! Ich sagte Ihnen schon, daß Mama ohne vorhergehende Krankheit oder auch nur Unwohlsein mitten am Tage starb – sie fiel plötzlich um, als sie nach Tisch mit Donna Onesta und deren Mann in einem der Zimmer Kaffee trank, in dem Großpapa seine Sammlungen aufbewahrte. Es ist ein hübsches Zimmer, mit bequemen Möbeln; die Sammelkästen stehen in hübschen Schränken an den Wänden, und auch die Tische sind als Sammelkästen eingerichtet mit darüberliegender, dicker Glasplatte. Ich habe mir ausgebeten, dieses Zimmer zum erstenmal nach Mamas Tode allein betreten zu dürfen: Donna Onesta wollte mir zwar ›beistehen‹, aber ich wollte allein sein, und Sie werden mich darin vielleicht besser verstehen . . . Das ist eine deutsche Eigentümlichkeit, deutsches Empfinden, nicht wahr? Nun gut, ich betrat das Zimmer allein und setzte mich auf einen Sessel dicht neben der Tür und da hatte ich zum erstenmal den Traum. Er fing damit an, daß ich eine Gegenwart fühlte, die mich beunruhigte und beeinflußte und mich gewissermaßen lähmte, daß ich mich nicht bewegen konnte und meine Sinne abstarben für meine Umgebung. Und dann sah ich – das heißt, ich träumte es natürlich – meine Mutter, Donna Onesta und Tom Morgan. Auf dem Tisch nahe dem Fenster stand das Kaffeeservice, eine Schublade war herausgezogen, und Donna Onesta beugte sich über ihren Inhalt, der zierlich geordnet und numeriert auf dem roten Damastpolster der Lade lag, meist waren es Schmuckgegenstände. Sie beugte sich darüber, aber sie sah nicht hinein, sondern beobachtete mit vorgestrecktem Halse und gierigen Augen Mama, die ihr halb den Rücken kehrte, und ihren Mann, der Mamas linke Hand in der seinen hielt und – einen Ring auf ihren vierten Finger schob. Er lachte dabei, Mama lächelte, aber Donna Onesta war ernst. Und – ja, das ist alles. Absolut alles, mit Ausnahme dessen, daß ich dieses Bild so oft sehe, als ich in das Zimmer gehe und mich neben die Tür hinsetze. Manchmal deutlicher, manchmal wie durch einen Schleier – immer aber fühle ich vorher das Absterben für meine Umgebung und das Vorempfinden dessen, was ich dann sehe – pardon träume. Und dann, wenn das Bild erblaßt ist, dann kommt das Entsetzen vor dem – was nicht zu sehen war. Aber an dem ganzen Bild, das so deutlich vor mir erscheint, daß ich jede Falte in den Kleidern sehe, ist doch gar nichts Entsetzliches, gar nichts. Es sieht wie ein Genrebild aus: das Zimmer mit den Spitzbogenfenstern, mit den seegrünen, seidenen Damasttapeten, den vergoldeten, geschnitzten Möbeln, den dreieckigen, venezianischen Spiegeln, und vor dem Tisch mit dem Kaffeeservice auf der Glasplatte meine schöne Mutter, der Tom Morgan einen Ring an die Hand steckt – und beide lachen. So, nun wissen Sie alles, Onkel Windmüller, wirklich alles, alles. Ich halte nichts zurück!«
Windmüller hatte sehr aufmerksam zugehört, ohne die Augen von der Erzählerin zu lassen.
»Haben Sie Donna Onesta oder Mr. Morgan oder sonst jemand diesen Traum erzählt?« fragte er nach einer kleinen Pause.
»Niemand habe ich davon erzählt. Sie sind der erste und einzige, der ihn erfahren hat und – wird.«
»Ja, aber es lag doch so nahe, Donna Onesta zu erzählen, was Sie sicher sehr beschäftigt hat«, meinte Windmüller.
»Gerade weil's so nahe lag, hab' ich's nicht getan«, erklärte Gio das für ein junges Mädchen mindestens ungewöhnliche Faktum. »Ich – wollte abwarten, ob ich mehr sehen würde, aber ich sah niemals mehr, als was Sie wissen. Nur gefühlt habe ich hinterher mehr oder weniger stark das Entsetzen über das, was ich nicht mehr sah! Offen gesagt: ich hatte mehr als einmal Lust, Donna Onesta meinen – Traum zu erzählen, weil ich gern wissen möchte, warum sie darin so gespannt und gierig zugesehen hatte, aber ich dachte mir: dann erfährst du's nie! Ich habe sie darauf beobachtet, lange, scharf . . . aber das Rätsel bleibt ungelöst.«
»Hm – wer weiß!« Windmüller strich mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand langsam über den Rücken seiner Moltkenase, was bei ihm das sicherste Zeichen eines stark erwachten Interesses war. »Wer weiß! – Hm – ja – und da packen Sie mich an meiner schwachen Seite: Der Passion fürs Rätselraten! Eine Frage, Gio, müssen Sie mir aber doch noch beantworten, ehe ich mich entscheide, und zwar müssen Sie mit nichts dabei zurückhalten. Also hören Sie: Ist Ihnen ein Motiv bekannt oder haben Sie einen Verdacht, der die Annahme rechtfertigen könnte, Donna Onesta oder Mr. Morgan hätten Ihrer Mutter nicht wohlwollend gegenübergestanden?«
Gio Verden zog scharf den Atem ein.
»Ich wußte ja, daß Sie verstehen würden«, murmelte sie kopfnickend. »Großpapa sagte einmal von Ihnen: Man braucht diesem merkwürdigen Menschen gar nicht zu sagen, was man selbst zu denken nicht wagt, und er errät es doch . . . Nein, Onkel Windmüller, es fehlt jegliches Motiv für ein mangelndes Wohlwollen, jegliches von beiden Seiten. Denn Onesta ist keine leichtzunehmende Person, aber meine Mutter war sehr verträglich und verstand es trefflich, mit ihr umzugehen. Ich habe nie einen Mißklang zwischen den beiden Kusinen wahrgenommen. Und von Mr. Morgan war meine Mutter entzückt – es bestand ein ständiges Neckverhältnis zwischen beiden. Sie, die vollendete Dame, er der perfekte Gentleman! Beide Morgans hatten ferner, von der realistischen Seite betrachtet, allen Grund, nicht nur Mamas Gunst, sondern auch ihr Leben zu erhalten, denn die Ca' Favaro ist doch ein ganz sicherer Hafen, ein ganz behagliches Nest und sehr den billigen ›möblierten Zimmern‹ vorzuziehen, in denen sie vorher gelebt haben . . . Nein, nein, es fehlt jegliches Motiv für ein Übelwollen von Mr. Morgan und seiner Frau gegen meine Mutter!«
Doktor Windmüller ließ mit halbgeschlossenen Augen seinen Zeigefinger wieder die feine Linie seiner Nase nach ziehen, und Gio hätte wirklich nicht sagen können, ob ihre Gegenwart noch bemerkbar für ihn war, so lange dauerte es, bis er wieder sprach. Gespannt sah sie ihn an, weil sie das Gefühl hatte, daß er in ihren Augen lesen wollte.
»Ja«, begann er nach einer Weile in einem Ton, der sie aufhorchen ließ, »es trifft sich gut, daß Doktor Müller, der – hm – bekannte Professor der Kunstgeschichte aus – hm aus Wien, Ihres Vaters Vetter im Grandhotel abgestiegen ist und Sie ihm gerade begegnen mußten. Er war auf dem Weg zu Ihnen und weil er so schrecklich begierig auf die Sammlung Ihres Großvaters war, so haben Sie ihn eingeladen. Soweit die Personalien. Zur Charakteristik können Sie mir die bekannte deutsche Professorenzerstreutheit anhängen: mein Geist weilt dermaßen in der Vergangenheit, daß die Gegenwart mich nur soweit interessiert, als sie Antiquitäten aufstöbert, aufbewahrt oder vernichtet. Bei letzterem werde ich fuchsteufelswild, aber in den Angelegenheiten, die mich, meine Umgebung – hören Sie wohl! meine Umgebung und die Welt im allgemeinen betreffen, sehe ich nicht weiter, als meine Nase lang ist. Und meine Nase ist kurz. Ich werde sie übrigens etwas verändern, also wundern Sie sich nicht, wenn Sie mich wiedersehen. Und nennen Sie mich nicht Windmüller, sondern Onkel Müller kurzweg, Gio! Es liegt viel daran, daß Sie sich nicht versprechen. Haben Sie mich verstanden?«
»Ich denke schon«, erwiderte Gio mit solch ruhiger Zuversicht, daß Windmüller befriedigt nickte. Er kannte seine Leute und sah aus den klaren, jungen Augen Zuverlässigkeit hervorblicken, daneben aber auch das Verständnis für Unausgesprochenes und die hochgradige Intelligenz der alten Diplomatenrasse der Favaro, die zwar einmal auf dem Dogenthrone Venedigs kaltgestellt worden war, sich aber sonst siegreich im Großen Rat, im Rate der Zehn und im Rate der furchtbaren Drei behauptet hatte. Eine Rasse, die in ihrem letzten Sprossen der weiblichen Deszendenz aber durch urgermanisches Blut zu einem, wie es dem großen Menschenkenner Windmüller scheinen wollte, sehr glücklichen Resultat temperiert worden war.
Sie machten beide weiter keine Worte mehr; der reife Mann und das junge Mädchen verstanden sich unausgesprochen.
»Also werde ich jetzt heimgehen und Ihren Empfang vorbereiten«, sagte sie nach einer kleinen Pause, indem alle goldenen Lichter in ihre Augen zurückkehrten mit dem Lächeln um ihren lieblichen Mund. »Und da ist auch Rita wieder«, setzte sie hinzu und deutete auf die Kirchenpforte, durch welche die übrigens sehr respektabel aussehende Dienerin eben in den Klosterhof trat. »Nein, sie hat nicht aufgepaßt, denn sie trägt die Blumen, die wir zusammen besorgen wollten – –«
»Man wird alt«, unterbrach Windmüller sie schmerzlich. »Ich hatte auf Rita vergessen –«
»Ah – sie versteht kein Deutsch!« fiel Gio schnell ein.
»Das steht auf einem andern Blatt«, murmelte Windmüller. »Aber Rita hat mich vorhin sehr scharf gemustert – ich werde also meine werte Nase so lassen müssen, wie sie ist. Es ist immer ein Risiko ohne Maske, aber es ist ja andere Male auch geglückt . . .«
»Gut, Rita, daß Sie kommen!« rief Gio der Dienerin entgegen, die in der Ca' Favaro geboren und aufgewachsen war. »Der Signor hier – er ist übrigens ein Onkel von mir – hat versprochen, mir einen langen Besuch in der Ca' Favaro zu machen und will Mittag mit seinen Sachen aus dem Hotel bei uns sein. Wir müssen also eilen, daß wir heimkommen, um seine Zimmer zu richten.
»Sie sind gerichtet bis auf die frischen Überzüge des Bettes«, fiel Rita ein, indem sie dem Gast eine tadellose Verbeugung machte, denn sie wußte, was sich schickte, gleichviel ob der Gast ihr persönlich recht war oder nicht.
»Nun, um so besser, wenn es keine Umstände macht«, sagte Windmüller freundlich auf italienisch, und setzte plötzlich, an die Dienerin gewendet, deutsch hinzu: »Rita, wie spät ist es?«
Der Trick versagte aber, denn mit einem erstaunten »Commanda, Signor«, sah Rita den Frager verständnislos an, den aber sein Fehlschlag zu befriedigen schien.
»Nein, sie versteht wirklich kein Deutsch«, sagte Gio lachend, »nur ein paar Brocken Englisch hat sie von Großpapas englischem Kammerdiener aufgeschnappt, den er von London mitgebracht hat. Aber die andern verstehen Deutsch; sie etwas, genug, um deutsche Bücher zu lesen, er natürlich perfekt. Er kann alles perfekt!«
»So? Nun, ich bin selbst kein ganz schlechter Fechter, und es macht mir Spaß, mit guten zu fechten«, erklärte Windmüller verständnisvoll, und dann gingen die beiden vom sogenannten »Zufall« Zusammengeführten ihre für jetzt noch entgegengesetzten Wege.
Windmüller machte der von ihm gewünschten Charakteristik als »zerstreuter Professor« schon im voraus alle Ehre, denn er ging so tief in seine Gedanken versunken dahin, daß er mehrmals an andere anrannte. Es waren zu meist leichte Zusammenstöße, die sich mit einem flüchtig gemurmelten »Verzeihung« ausgleichen ließen; aber einmal rief ein »fliegender« Fruchthändler, dem bei dem Anprall einige Pfirsiche zu Boden rollten, Liebesnamen hinter dem Zerstreuten her, der noch beim Passieren der letzten Ecke mit einem jungen Mann zusammenrannte, daß beiden gleichzeitig der Hut vom Kopfe flog.
»Donnerwetter!« rief Windmüller, der auf diese Weise zu sich kam.
»Potz Blitz!« schimpfte der Angerempelte wütend. »Können Sie nicht Obacht geben?« Damit raffte er seinen Hut vom Boden auf und ging weiter. Windmüller tat dasselbe, blieb aber stehen und schaute der schlanken, tadellos gekleideten Gestalt nach.
»Eine Figur, um einem Bildhauer zum Modell zu dienen, ein prächtiger Kopf, und ein Temperament, das unter Umständen gewiß prähistorisch werden kann.«
Dieses Temperament hatte Windmüller aber entschieden aufgeweckt und in die Wirklichkeit zurückgebracht. Ohne weiteren Zwischenfall langte er in seinem Hotel wieder an, bat um seine Rechnung und in einer Stunde um eine Gondel, hörte mit verstecktem Interesse, daß die Brillanten der Chikagoer Millionärin von ihr selbst unter dem Keilkissen in ihrem Bett wiedergefunden worden waren, und begab sich dann in sein Zimmer, um seine Sachen zu packen. Er war damit längst fertig, ehe die Stunde verstrichen war, und zündete sich eine Zigarre an, um seinen Vormittag zu überdenken.
»Wenn das die heilige Hermandad wüßte – für verrückt würden diese braven Leute mich erklären«, lachte er leise vor sich hin. »Und sie haben vielleicht nicht einmal Unrecht. Ich habe einen ›Fall‹ übernommen – es ist angesichts der Tatsache einer erborgten Persönlichkeit nicht mehr zu leugnen, daß es ein ›Fall‹ ist – ein Fall, den ich in den Augen eines jungen Mädchens gelesen habe. Diese Augen gehören zu den seltenen ihrer Art, die Dinge sehen können – und gesehen haben – welche andern unsichtbar bleiben. Ich zweifle nicht einen Augenblick, daß sie gesehen hat, was man mir erzählte. Und sie fürchtet Unausgesprochenes, das hinter ihrem Seherblick liegt. Aber sie bekennt ehrlich und rückhaltlos, daß jedes Motiv für das Unausgesprochene fehlt. Der unbekannte Ring am Finger ihrer Mutter, an den sich die Vision in dem Zimmer, wo sie starb, eng anschließt, könnte einen Fremden zu der Annahme verführen, daß zwischen Frau von Verden und dem Gatten ihrer Kusine – wie heißt er doch? – ah, Morgan – ein Einverständnis bestanden hat, um es ganz diskret auszudrücken. Aber mich verführt diese naheliegende Lösung des Rätsels nicht, denn Vanna von Verden war nicht von jener Art, die über dem geschlossenen Grab ihre Liebe vergißt und ihre Augen begehrlich auf die verbotene Frucht richtet. Und in dem geschauten Bild, das sich wie ein Verlöbnis den Augen der Tochter zeigte, war noch eine dritte Person, die nicht etwa eifersüchtig oder schmerzlich, sondern ›gierig‹ zusah: die Gattin des Mannes, der seiner Gastfreundin den Ring an den Finger steckte. Denselben Ring, den Gio an der Hand der Toten sah. Den die Frau als einen alten Besitz erklärte. Hm – warum sollte Vanna von Verden nicht Dinge besessen haben, die ihre Tochter nicht kannte. Es reizt mich, der Geschichte dieses Ringes auf die Spur zu kommen – und dem Unausgesprochenen im Blick von Gio von Verden. Dann, was sie einen Traum in Ermangelung eines besseren Ausdrucks nennt! Als ob man am hellen Tage träumte, wenn man sich auf einen Stuhl neben die Tür setzt . . . Natürlich, die Neunmalweisen würden Gio Verden als ›hysterisches Frauenzimmer‹ wissenschaftlich abtun. Ich nicht. Denn erstens macht sie nicht im mindesten den Eindruck eines hysterischen Frauenzimmers, und zweitens muß man zugeben, daß es diese Art von Erscheinungen, Visionen, Gedankenübertragungen oder wie man es nennen will, gibt.
Warum aber sieht nun Gio Verden eine Szene, die nichts Entsetzliches oder Aufregendes hat, und warum hat sie nachher nur das Gefühl von etwas Furchtbarem, das sie nicht sehen kann? Ich muß mir die Angelegenheit rekonstruieren, obgleich ich mir der schwachen Seiten jeder Rekonstruktion bewußt bin. Wer also von den drei Personen der Szene in der ›Vision‹ Gios von Verden war so furchtbar erregt, daß seine entfesselten, geheimen Kräfte es vermochten, die scheinbar so malerische und hübsche Szene dermaßen dem Raum einzuprägen, daß die offenbar sympathetisch veranlagte Gio sie deutlich und wiederholt vor sich sehen kann? Die zuschauende Kusine? Ihr Mann? Jene schaut ›gierig‹ zu, dieser lacht. Leute, die nie tiefer gesehen haben, würden sagen: also die Kusine. Ich aber, ich weiß, daß es Mörder gibt und gegeben hat, die da lachten, während sie mordeten. Und in Gios ›Vision‹ lacht auch ihre Mutter. Aber ich habe sie gekannt und möchte darauf schwören, daß ihr Lachen sich dem Zimmer nicht in einem solchen Grade vermöge der damit entfesselten geheimen Kräfte einprägen konnte. Das Furchtbare, das Gio nach dieser Vision fühlt, geschah also so schnell und unerwartet, daß die verborgenen Kräfte des Opfers sich nur teilweise dem Raum einprägen konnten, daß für die Sinne der Vorgang äußerlich nicht mehr wahrnehmbar ist. Das ist logisch, dächte ich. Die Rekonstruktion steht aber auf tönernen Füßen, wegen der Abwesenheit jeglichen Motivs. Das heißt: Gio kann keines finden. Doch liegt genug Unausgesprochenes hinter ihrer Einladung meiner Person unter erborgtem Namen. Sicher erwartet und hofft sie von mir, daß ich das Motiv finde.
Aber Doktor Windmüller mußte sich beeilen; die bestellte Gondel lag bereit.
Der Manager des Hotels hielt es für angemessen, dem Gast das Geleit bis zur Gondel zu geben; es lag etwas Zwingendes in der großen, mageren Gestalt mit dem scharfen Profil.
»Wohin?« fragte der Portier beflissen, denn das Trinkgeld war gut ausgefallen.
»Oh – nach der alten Ca' Favaro am Canale de Sacco«, sagte Windmüller im Einsteigen.
»Ah – Herr Doktor kennen die Besitzerin, die junge, deutsche Baronesse, des alten Duca Enkelin und Erbin?« rief der Manager neugierig.
»Sie nennt mich Onkel und ich gehe zu Besuch zu ihr«, erwiderte Windmüller, dem aus wohlerwogenen Gründen diese Antwort gelegen kam.
»So so!« machte der Manager interessiert. »Es hat allgemeines Bedauern erregt, daß die junge Dame durch den plötzlichen Tod ihrer Mutter so gänzlich verwaiste. Ein Glück noch, daß Donna Onesta Favaro – ich meine Donna Onesta Morgan, anwesend war und noch ist. Ein großer Trost für die junge Baronesse. Man hatte gedacht, sie würde den Namen und Titel von ihrem Großvater, dem Duca, erben . . .
»So? Hat man das gedacht?« fragte Windmüller. »Ja, ja, die Leute machen sich gleich immer über alles ihre Gedanken. Adieu!«
Damit winkte er dem Gondolier abzustoßen und fuhr den Canale Grande entlang davon.
Es gehörte zu seinem Beruf, nichts unbeachtet zu lassen, nebensächlich wie es auch sein mochte, und so war ihm das Aufleuchten der Augen des Gondoliers bei Nennung der Ca' Favaro nicht entgangen. Der Mann war nicht mehr jung, aber kräftig; er stammte also noch aus der Zeit, in der die Gondoliere Interesse hatten für die alten Familien und oft besser Bescheid über deren Angelegenheiten wußten, als mancher ihnen Näherstehende. Es gibt ja auch heute noch jüngere Gondoliers, die wissen, wem der oder jener Palast gehört, und die natürliche und naive Neugierde der Italiener hält sie an sich schon auf dem laufenden, aber im allgemeinen hat das Aufblühen Venedigs das Interesse abgeschwächt. »Sie wissen doch, wo die alte Ca' Favaro liegt?« fragte Windmüller nach einer kleinen Pause.
»Ja, Herr«, erwiderte der Mann höflich. Dann spuckte er aus, was immer eine unfehlbare Einleitung zu einem Gespräch ist, und setzte hinzu: »Die alte Ca' Favaro kenne ich wohl, denn ich habe mir meine Frau daraus geholt. Sie ist die Tochter des damaligen Kustode und die Tante des jetzigen. Und das erste Zimmermädchen, die Rita, ist ihre Schwester. Also kann der Herr ganz ruhig darüber sein, daß ich weiß, wo die Ca' Favaro liegt! Der selige Duca hat auf meiner Hochzeit getanzt, wie's damals die schöne Sitte war, und auch jetzt noch ist bei den Patriziern, die etwas auf ihre Dienerschaft halten. Im vorigen Jahr habe ich mir ausgebeten, den Sarg der armen Donna Vanna tragen zu helfen. Das ist Ehrensache und wie's mir die junge Baronesse gedankt hat, Herr, das zeigte am besten, daß sie im Blut eine Favaro ist, trotz dem deutschen Namen. Verdén – es klingt aber ganz venezianisch!«
»Vollkommen venezianisch«, gab Windmüller bereitwilligst zu. »Und wenn's Gio populär macht, warum sollte es anders ausgesprochen werden?« setzte er in Gedanken hinzu, um dann laut fortzufahren: »Es freut mich, daß Sie die junge Baronesse gern haben, denn ich habe sie auch sehr lieb.«
»Sicher! Sicher!« rief der Gondolier enthusiastisch. Sie ist die echte Enkelin des alten Duca und hat das Blut der Favaro in sich. Gutes Blut, Signor, sehr gutes Blut, großmütig und edel und wohltemperiert, aber wenn's aufgebracht wird – mein Gott. Dann kann der, der's zum Kochen gebracht hat, schon machen, daß er weiterkommt. Der alte Duca schrie, daß die Wände zitterten: Donna Vanna brach helles Feuer aus den Augen, aber sie sagte nichts, rein nichts. Es war schlimmer, als wenn der Duca wetterte, meinte Rita, meine Schwägerin.«
»Hm – ja. Und dann wäre noch Donna Onesta Favaro –«
»Sie beißt, Herr, beißt mit der Zunge, wenn das Favaroblut in ihr wach wird«, sagte der Gondolier. »Sie ätzt wie Scheidewasser – sagt die Rita. Kommt oft vor, sagt die Rita. Sie beklagt sich nicht etwa, die Schwägerin; 's ist ja natürlich, daß eine Frau gewissermaßen ins Gereizte hineinkommt, wenn sie immerzu in der Furcht lebt, jeden Tag älter zu werden . . . wegen ihrem Fremden. Ich sage nichts gegen die Fremden; sie bringen Geld ins Land und geben unsereins manchmal noch etwas zu verdienen. Was ich gegen sie habe, ist ja nur, daß sie einen ehrlichen Mann nicht von einem unterscheiden können, der seinen Profit aus ihnen ziehen will. Die meisten verstehen nicht, was wir sagen. Warum lernen die Fremden nicht unsere Sprache? Sollen wir alle ihre lernen?«
»Sie haben ganz recht, lieber Freund«, nickte Windmüller lächelnd. »Und nun wegen der Fremden in der Ca' Favaro –«
»Ah – ich sage nichts gegen Herrn Verdén, den Gemahl der Donna Vanna«, fing der Gondolier sofort seinen verlorenen Faden wieder auf. »Das war ein vornehmer Mann. Und richtig seine zehn Jahre älter, als Donna Vanna . . . Ist ja ein bißchen viel, aber es macht nichts, weil es auf der rechten Waagschale liegt. Doch es tut nicht gut, wenn der Mann jünger ist, sogar viel jünger, wie der Amerikaner der Donna Onesta. Natürlich paßt dann die Frau auf wie ein Luchs, ob dem Herrn Gemahl nicht etwa Jüngere besser gefallen. Solche Ehen sind unnatürlich, sage ich!«
»Aber der Gemahl der Donna Onesta ist doch sonst beliebt, nicht wahr?« fragte Windmüller unschuldig.
»So, so!« brummte der Gondolier, spuckte aus, machte den Mund zum Sprechen auf, besann sich aber, daß er den Fremden ja in die alte Ca' Favaro ruderte, und sagte nur ganz sachlich: »Schön wie Luzifer.«
Windmüller fragte natürlich nicht weiter. Das »so, so«, das der Italiener so vielsagend gebraucht hatte, ließ eine ganze Menge erraten, mehr noch das plötzliche Schweigen des redseligen Gondoliers.
Als der Kanonenschuß von San Giorgio gerade den Mittag verkündete und die Glocken von allen Kirchen zu läuten begannen, bog die Gondel rechts in den schmalen Kanal zwischen zwei Cinquecentopalästen ein, schoß unter einer hochgewölbten Brücke durch und legte links vor der fünfstöckigen, düstern, mit fast schwarzer Patina überzogenen Ca' Favaro an, einem Paladialbau aus dem zwölften Jahrhundert, den Windmüller sich nicht erinnerte je gesehen zu haben, wennschon er das höchste Geschoß vom Canale Grande aus, gewahr geworden war. Und dieser Koloß von einem Bau lag eingekeilt rückwärts an dem engen Kanal, an beiden Seiten an kaum zwei Meter breiten Gassen, die Front auf ein ganz kleines Plätzchen mit einem Brunnen gerichtet, das durch die umschließenden Gebäude noch kleiner erschien, als es in Wahrheit war.
Die Ca' Favaro in dem eigenartig venetianisch-gotischen Stil mit den eleganten Spitzbogenfenstern, gehört sicher zu den schönsten Baudenkmälern der Stadt. Ihre Balkone zeigen reichste Skulpturen, die Marmorsäulen, welche die Spitzbogen der Loggien tragen, haben köstliche Kapitäle, die Spitzbogen selbst wunderbare Aufsätze in Form von schlanken Blumenvasen, die Eckpilaster der mit Marmor belegten Front sowie der Rahmen des rechteckigen Hauptportals zeigen Bildhauerarbeit von unübertrefflicher Eleganz.