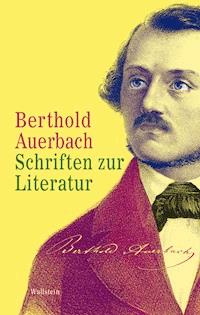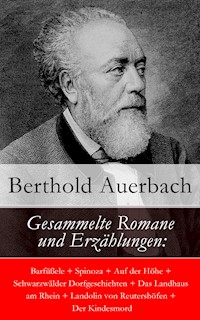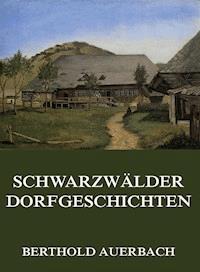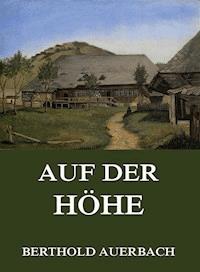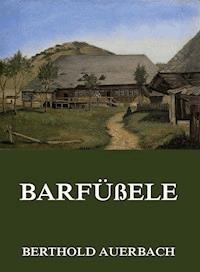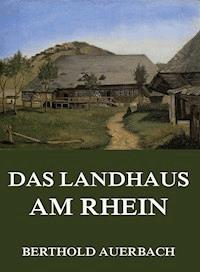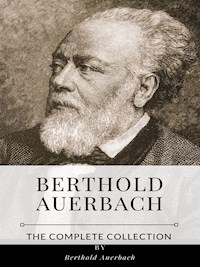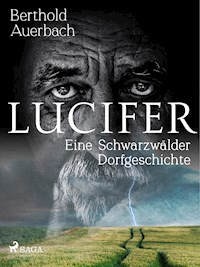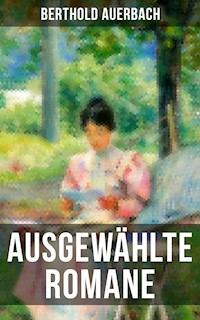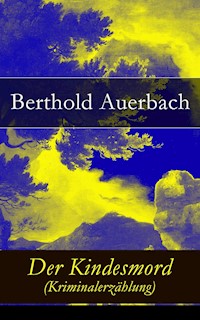4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deutscher Novellenschatz
- Sprache: Deutsch
Der "Deutsche Novellenschatz" ist eine Sammlung der wichtigsten deutschen Novellen, die Paul Heyse und Hermann Kurz in den 1870er Jahren erwählt und verlegt haben, und die in vielerlei Auflagen in insgesamt 24 Bänden erschien. Um die Lesbarkeit zu verbessern, wurden in dieser Edition die sehr alten Texte insofern überarbeitet, dass ein Großteil der Worte und Begriffe der heute gültigen Rechtschreibung entspricht. Dies ist Band 7 von 24. Enthalten sind die Novellen: Auerbach, Berthold: Die Geschichte des Diethelm von Buchenberg. Gotthelf, Jeremias [d. i. Albert Bitzius]: Der Notar in der Falle. Wilbrandt, Adolph: Johann Ohlerich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Deutscher Novellenschatz
BAND 7
Deutscher Novellenschatz, Band 7
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849661106
Das Korpus „Deutscher Novellenschatz“ ist lizenziert unter der Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Lizenz und Teil des Deutschen Textarchivs. Eine etwaige Gemeinfreiheit der reinen Texte bleibt davon unberührt. Näheres zum Korpus und ein weiterführender Link zu den Lizenzbestimmungen findet sich unter https://www.deutschestextarchiv.de/novellenschatz/. Um die Lesbarkeit zu verbessern, wurden die sehr alten Texte insofern überarbeitet, dass ein Großteil der Worte und Begriffe der heute gültigen Rechtschreibung entspricht.
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Der Notar in der Falle.1
Die Geschichte des Diethelm von Buchenberg.30
Johann Ohlerich.183
Der Notar in der Falle.
Jeremias Gotthelf
Vorwort
Albert Bitzius, geboren den 4. Oktober 1797 zu Murten, studierte in Bern und nachher einige Zeit in Göttingen, wurde 1832 Pfarrer zu Lützelflüh im Emmental, wo er den 22. Oktober 1854 starb. Im Drange politisch-religiös-sozialen Wirkens veröffentlichte er unter dem Namen Jeremias Gotthelf jene allbekannten Schriften, die im reichsten Maße Freunde und Gegner gefunden haben. Gotthelf ist eine mit großer dichterischer Kraft ausgestattete Kernnatur, der es jedoch selten einfällt, rein dichterisch wirken zu wollen. Sein Streben ist auf sittliche und wirtschaftliche Verbesserung seiner Bauern gerichtet, wobei er, der zum Sturze der Berner Aristokratie mitgewirkt, dem Radikalismus gegenüber Kehrt macht, um sich diesem als entschlossener, charaktervoller "Reaktionär" entgegenzuwerfen; und die Fülle von Poesie, die er in seinen Schilderungen des Volkslebens entwickelt, ist meist nur wie eine unwillkürlich nebenher laufende Temperamentseigenschaft, die ihn nicht verhindert, Züge von gewaltiger Schönheit mit ebenso unästhetischen, ja ganz unleidlichen Auswüchsen zu mischen. Nur in wenigen seiner kleineren Dorfgeschichten ist der lehrhafte Zug, der stellenweise an den Kanzelton erinnert und seine großen Volksbücher, "Uli der Knecht," "Leiden und Freuden eines Schulmeisters" u. a. m., durchaus beherrscht, bis auf ein gelegentliches Einmischen derber, sprichwörtlicher Lebensweisheit gemildert. So steht Gotthelf in der Mitte zwischen seinem trefflichen Landsmanne Pestalozzi, dessen "Lienhard und Gertrud" noch ganz als moralisches Not- und Hilfsbüchlein gedacht ist, und den deutschen Meistern der Dorfgeschichte, in deren Sittenschilderungen das Element der Sittlichkeit keine andere Rolle spielt, als in allen dichterischen Verklärungen des Lebens.
Leider ist es uns versagt, die Erzählung, der wir den Preis zuerkannt, "Wie Christen eine Frau gewinnt", unsern Lesern vorzuführen, da die Verlagshandlung so eben diese und andere ausgewählte Dorfgeschichten Gotthelfs in einer illustrierten Volksausgabe erscheinen lässt. Indem wir uns aber vorbehalten, in einem der späteren Bände eine sehr merkwürdige und dem Charakter nach ganz alleinstehende Dichtung G.‘s, seinen "Kurt von Koppigen", zu bringen, freuen wir uns, bei der Armut unserer Literatur an echt humoristischen Erzählungen, unserem Novellenschatz eine kleine "Stadtgeschichte" einfügen zu können, die von Allem, was G. geschrieben, dem Begriff der eigentlichen Novelle am nächsten kommen dürfte und eine sehr lustige Erfindung in glücklichster Weise durchführt. Zwar wirkt auch hier die unausbleibliche Säure gegen die liberale Richtung störend mit, da der Spekulant, um den es sich handelt, der Naturwahrheit völlig unbeschadet ebenso gut ein Konservativer als ein Radikaler sein könnte; aber die behagliche Schalkhaftigkeit aller andern Partien überwiegt glücklich diesen unliebsamen tendenziösen Zug, und der unerwartet versöhnende und gutherzige Schluss entlässt uns mit dem heitersten Eindrücke.
Noch erübrigt uns, die mundartlichen Ausdrücke, welche Gotthelf in sein mitunter ziemlich krauses Hochdeutsch einzuflechten pflegt, so weit als nötig zu erklären:
Seimeisterin: seien heißt im Berner Oberlande ein Gemeingut nach der Zahl der Kühe schätzen, die es ernähren kann. — Ihns (mit nasalem i gesprochen) ist der Akkusativ des persönlichen Es, das auf Diminutivnamen, z B. das Vreneli, aber auch auf Tiernamen, die im Neutrum stehen, z. B. das Eichhorn u. dgl., sich bezieht; kommt bekanntlich auch bei Hebel vor. — Währschaft: entweder, was währt oder, was gewährleistet werden kann; dauerhaft, tüchtig, derb. — Werweisen : in der Irre gehen, unentschieden schwanken, im Zweifel sein. — Von wegen: denn. — Ringgeln: schnallen, festschnüren. — Bessern: besser werden. — z'Best; z'Sach: das Beste; die Sache. — Wo wird auch für das Relativpronomen gebraucht.
***
Kleine Städtchen sind in der Regel ganz allerliebst. Gewöhnlich liegen sie an einem Bache, dem es so wohl im Städtchen ist, dass man nicht weiß, läuft er nach Westen oder nach Osten; sie sind statt mit Wällen und Graben mit kleinen Scheuern und großen Düngerhausen umgeben, wenn man es nicht vorzieht, dieselben mitten im eigenen Schosse, d. h. im Städtchen selbst zu behalten. Die Menschen darin sind allerliebst, nicht über eine Form geschliffen, sondern jeder trägt sein eigen Gepräge; allgemein ist bloß, dass die Mädchen zumeist zärtlich sind und guten Herzens, die jungen Herren aber etwas hölzern und nicht fein gehobelt, haben aber auch schrecklich viel Liebe im Leibe, heiraten daher gewöhnlich sehr jung; tun sie es nicht, so müssen sie von morgens früh bis abends spät schrecklich viel Flüssiges in den Leib gießen, um nicht zu verbrennen. Manchmal gießen sie als Ehemänner die doppelte Portion sich ein, wahrscheinlich, damit die Frau an ihrer Liebe nicht verbrenne. Das Städtchen, von welchem wir reden wollen, lag aber nicht an einem Bache, sondern an einem Fluss, aber die Mädchen waren deswegen nicht weniger zärtlich, die Herren nicht gehobelter und weniger durstig. Das Städtchen hatte eine wunderschöne Lage, mancher Düngerhaufen hatte einem schönen Hause Platz machen müssen, auf die schönen Häuser tat man sich viel zu gut, der Natur daneben frug man wenig nach, ausgenommen, wenn sie sich essen und trinken ließ oder sonst was eintrug. Ganz herrliche Spaziergänge fanden sich ums Städtchen, waren allerdings auch sehr gesucht und geschätzt. Bekanntlich gehen zärtliche Mädchen gern mit jungen Herren spazieren, da werden auch die Hölzernsten warm, der Liebe Gold wird flüssig, und wie manches zärtliche Herz wurde glücklich im Freien an der Sonne, wo das Holz Feuer fing. Alte Leute gehen auch gern spazieren in der Natur, wenn es nicht weit geht, ein guter Kaffee und delikate Fische oder sonst was Gutes in Aussicht steht.
In diesem Städtchen lebte ein Mädchen, Namens Luise. Nicht weniger zärtlich als die andern war die gute Luise, nicht weniger liebte sie die Natur zum Spazierengehen; aber wie hölzern Einer auch war, Feuer fangen wollte Keiner, flüssig ward nie die Liebe, wie heiß die Sonne auch schien, wie sehr der junge Herr auch schwitzte. Ach, dem schönen Herzen voll Liebe entsprach Luises Äußeres nicht. Sie war nicht klein, glich nicht auffallend einem Bohnenstecken, noch einer Kegelkugel, ihr Gesicht war weder rot wie eine Klapperrose, noch blass wie geronnene Milch vom Mond beleuchtet, aber sie war eben eigentlich gar nichts; sie war eben eins von den unglücklichen Wesen, deren Äußeres gar nichts Bemerkbares hat, weder was Hässliches noch was Liebliches; die man wieder vergisst, wie oft man sie sieht, die gar keinen Widerhaken haben, welchen sie einschlagen können in ein anderes Herz und daran sich festhalten, wie Flößer ihre Haken in Bäume oder Ufer, an denen sie vorbei fahren. Nicht einmal die Stimme hatte etwas Angreifliches, sie floss akkurat wie ein Bächlein in einem kleinen Städtchen, welches verlegen ist, soll es zum oberen oder zum untern Tore hinaus. Zudem redete Luise noch leise, dass, wer nicht haarscharf hörte, die Hände hinter die Ohren halten musste, wenn er mit ihr konversieren wollte, eine Haltung, welche der Liebe nichts weniger als förderlich sein soll. Das gute Kind war schüchtern, hatte gar keine Ursache, zum Selbstbewusstsein zu kommen, wusste nicht, wenn sie was sagte, war es dumm oder war's gescheit; im ersten Fall war es also besser, man verstand es nicht; zudem war es ihr oft, als müsste sie weinen, wenn sie lauter rede und den Mund weiter aufmache. Luise war keine Bürgerin des Städtchens, sondern eine sogenannte Hintersässin, hatte also keine Bürgernutzung, weder Holz aus dem Wald, noch eine Pflanzstelle auf der Allmend, was begreiflich ihr Ansehen auch nicht vermehrte. Sie lebte bei einer Tante, der Frau Spendvögtin; diese hatte Holz, Platz zum Kohl, ein eigen Gärtchen, sonst wenig Vermögen, aber Viele, welche darauf warteten. Von Luises Vermögen war nichts bekannt, man nahm also an, sie hätte keins; wenn sie welches hätte, würde sie es schon sagen. Der Schluss ist ziemlich bündig und wurde noch bestätigt durch Luises sehr einfache Kleidung und das Versäumen, zu gehöriger Zeit ändern zu lassen, was nicht mehr in Mode war. So z. B. trug sie noch wenigstens drei Monate lang weite Ärmel, als kein einziger im ganzen Städtchen zu finden war, so dass die Mägde bei dem Brunnen aufmerksam wurden und die arme Luise zur Zielscheibe ihres Witzes machten.
Die Tante war eine rechte Bürgerin, kümmerte sich wenig um Luise, war aber sehr stolz auf ihren Mann selig, den Spendvogt. Wenn die andern Frauen, die Allmend-, Spital- und Seivögtinnen ihre Kindbetten erzählten, so gab sie zum Besten, wie ihr Mann Spendvogt geworden und sie Spendvögtin.
Luise hatte viele Freundinnen, sie war keiner im Wege, und wenn eine was anzuvertrauen hatte, so ward Luise die Vertraute. Sie missbrauchte das Vertrauen nie, machte keinen Geliebten abspenstig, entweder aus bloßer Bosheit oder weil sie ihn selbst fangen wollte. Eine solche Freundin ist unbezahlbar, sie sind aber auch selten. Daran gedachte aber keine, welche bittere Qualen die arme Luise erlitt, wenn wieder und wieder eine Freundin kam und ihr das Glück der Liebe verkündete, zu ihr sprach: O Gute, ich habe gefunden! — Jedes Kind weiß, wie es der Eva ging, als sie die Schlange in den Apfel beißen sah, dass es sie nicht leben ließ, bis sie ebenfalls hineingebissen; jedes Kind erfährt, wie es ihm im Munde so wunderlich wird, wenn es andere was essen sieht, und es hat selbst nichts, und wie es nicht ruht, bis es selbst auch zu etwas gekommen. Ja, unsere humanen Juristen, welchen Diebe und Mörder weit lieber sind als ehrliche Leute, sintemalen sie von Dieben und Mördern leben und umso besser, je mehr deren sie pflanzen, beweisen ja, dass nichts ansteckender sei und lasterpflanzender, als wenn man jemand hänge oder köpfe. Da wandle männiglich, statt abgeschreckt zu werden, die Lust an, geköpft und gehängt zu werden, daher auch nie mehr Laster begangen würden, als gerade an einem Hinrichtungstage. Die guten Juristen treiben es wohl gut, wenn sie es dahin bringen mit angeblicher Humanität, dass am Ende nichts überbleibt als Diebe, Mörder und — Juristen; — so nimmt es uns Wunder, was die für Augen machen und den Dieben und Mördern vordemonstrieren und plädieren werden? Wird man nun nach den Juristen unter einem Galgen galgensüchtig, was meint man, was muss erst an einer Hochzeit die ledige Mannschaft werden? Factum ist auch, dass bei einer Hochzeit andere Hochzeiten sich machen, blasierte Hagestolze zu schmachten anfangen, Spröde aufschauen, Unbefangene zu überlegen beginnen. Aber noch viel angreiflicher ist es, absonders für ein Mädchenherz, wenn eine Freundin kommt, — gewöhnlich kommt sie auf den Fußspitzen und schlägt die Augen nieder — und was erzählen will und nicht weiß wo anfangen, und wenn sie angefangen, reuig wird und lieber nicht fortführe, und am Ende doch erzählt, wie sie spazieren gegangen, und was er gesagt, und was sie gesagt, und wie es dann weiter gegangen, und wie sie jetzt einen Geliebten hätte, einer, wie keiner noch gewesen, und wie sie jetzt glücklich sei wie im Himmel, und dazu sich die Augen wischt, vielleicht der Freundin noch um den Hals fällt und spricht: Ach Gott! wie glücklich, wenn du nur wüsstest wie! — Ach Gott! wie gerne wüsste ich es! denkt die um den Hals Gefallene und kann fast die Tränen nicht verdrücken, wenn sie herausstottert: So, so, he nun, es freut mich für dich, wenn du glücklich bist. Per se kennst du ihn besser, er wird nicht sein wie die Andern! Ach ja. Aber was mich dauert, ist, dass ich wieder eine Freundin weniger habe, denn wer Mann und Kinder hat, denkt weiter an nichts mehr. Zuletzt bleibt man ganz isoliert, alleine in der Welt! — Dann weint sie ganz bitterlich, aller Trost ist umsonst, wie die Freundin auch zuspricht, sie solle sich doch nicht desolieren, sie bleibe da, und ihre Freundschaft solle die gleiche bleiben ewiglich, alle Tage wollten sie sich sehen; es wäre doch sonderbar, wenn man wegen dem Mann keine Freundin mehr haben sollte, ein so eng Herz hätte sie doch wahrlich nicht. Begreiflich hatte die Freundin schon Erfahrungen über die Weite ihres Herzens gemacht und meinte nicht bloß a priori, sondern wusste a posteriori, dass mehr als eine Person darin Platz hätten. Es gibt ja Herzen, in denen die Menschen nicht bloß Compagnien-, sondern Regimenterweise Platz haben. Habe erst eine Anekdote der Art von einem alten Pferde gelesen. Ist ein Rossherz so weit, wie weit muss erst ein menschlich Herz sein, und zwar ein junges, welches noch elastisch, nicht verknöchert ist! Aber die Freundin tröstet umsonst, Luise weint immer bitterlicher, bis endlich die Freundin recht verlegen wird und sagt, sie müsse gehen, sie habe ein Rendezvous mit dem Geliebten. Ach, da weint Luise noch bitterlicher, ihr Lebtag hat sie noch nie ein Rendezvous gehabt, als etwa mit ihrer Tante, der Frau Spendvögtin, wenn sie in verschiedener Gesellschaft waren im Winter und doch nur mit einem Laternchen heimgehen wollten. Ach, das Luise ist doch herzensgut, sagt die Freundin, ich wusste gar nicht, wie lieb ich ihm war. Du glaubst gar nicht, wie das arme Geschöpf weinte, als ich ihm sagte, ich sei versprochen, es hat mich recht können erbarmen. Es hätte dann niemand mehr auf der Welt, wenn ich ihn verlasse, hat es gejammert. Es ist wahr, verheiraten wird es sich per se nicht, Geschwister hat es keine, und wenn einmal die alte Spendvögtin weg ist, so wird es wirklich nicht wissen wohin.
Aber Luise dachte weder an die Freundin, nach an die Spendvögtin, und darum weinte sie nicht, weil sie nicht in Ewigkeit ihr Haupt in ihren Schoss legen konnte; aber anders wohin hätte sie dasselbe für ihr Leben gerne gelegt, und weil sie dieses nicht konnte, darum weinte sie bitterlich. Ach, will mich denn niemand lieben, und meinte ich es doch so gut; ach, und wie wollte ich einen glücklich machen, o anders als die Andern alle, welche Egoistinnen sind. An mich denkt Keiner! Eine nach der Andern findet Einen, ich Keinen, ich muss allein bleiben, niemand hat mich lieb Ai, ai! So jammert Luise, hält die Hand aufs Herz, denn dort pocht es gewaltig, als ob es gesprungen sein müsste. Und doch wurde Luise nicht neidisch, stellte sich nicht vor den Spiegel, verglich sich nicht mit der Glücklichen, fand sich nicht zehnmal hübscher als sie und unbegreiflich, wo der Schlingel, der sie auserwählt, seine Augen gehabt, rupfte auch nicht der Freundin alle ihre Sünden auf, stellte die eigenen Tugenden daneben, sagte nicht: He nun so dann, wenn sie nicht mehr Verstand haben, so ist es ihnen zu gönnen, wenn sie so recht getäuscht werden! — lief ebenfalls nicht bei den Freundinnen herum, zählte an den Fingern die Laster der Freundin her und schloss weinerlich: wie doch der arme Mensch sie daure, der meine, er kriege einen Tugendspiegel und habe die schrecklichste Sündenbüchse auf Erden. Wenn sie nur jemand wüsste, sie ließe ihn im Vertrauen warnen, es sei doch nicht recht, wenn man seinen Nächsten ins Unglück rennen sehe und gebe ihm keinen Wink. Von diesem Allem sagte Luise nichts, sie dachte nur: Will mich denn keiner lieben? und wenn sie unter die Leute kam, so schien sie noch farbloser, redete noch leiser, und wie gesagt, Worte, welche man mit den Händen hinter den Ohren auffangen muss, sind eben nicht förderlich Liebe zu wecken und anzubrennen. Endlich hatte sie nur noch eine Freundin, denn, wie gesagt, die Mädchen in dem Städtchen waren berühmt wegen der Zärtlichkeit, und eine herrlichere Aussicht auf Erden kannten sie nicht, als die Aussicht, Spendvögtin, Seimeisterin, Seckelmeisterin oder gar Frau Ratsherrin zu werden. Für diese Aussichten schwärmten sie förmlich, während sie die Aussicht auf dem Riesen sehr fade fanden, dieweil kein Wirtshaus dort sich findet. Auf dem Faulhorn ist ein Wirtshaus, die Aussicht aber dumm; man sehe ja nur Berge, die könnten sie vom Haus aus auch sehen, und eigentlich wüssten sie nicht, was man an den Bergen sehe. Genau besehen, sei ein Berg wie der andere. Da gefalle ihnen eine schöne Promenade, auf welcher Herren und Damen spazieren gingen, viel besser. Wegen den Herren wollten sie nun nichts sagen, aber wo viele Damen und Töchter spazierten, absonderlich, wenn Fremde da seien, sehe man alleweil was Neues, neue Häubchen, neue Hüte, neuen Zeug, kurz immer was, das einem zu denken gebe, erstlich, wie man wohlfeil dazu kommen könnte, und zweitens, wie schön es einem stehen müsste, so kalkulierten sie. Die letzte der Freundinnen hatte den Wahlspruch der alten Garde: die Garde stirbt, ergibt sich nicht, nicht zu dem ihren gemacht, sie hatte von je für die Aussicht, Vögtin oder gar Meisterin über irgendwelchen Zweig der bürgerlichen Verwaltung zu werden, stark geschwärmt, aber fruchtlos, war indessen nicht in Verzweiflung darüber geraten, denn Julie war ein zäh Ding, hielt sich am Vers: Wenn Hoffnung nicht wär', ich lebte nicht mehr! Diese Hoffnung ließ sie auch nicht zu Schanden werden. Endlich auf einem Spaziergange im vergangenen Jahre, an einem schönen Sonntagnachmittag — in den Hundstagen war es — ging an ihrer Seite ein hölzernes Subjekt in Feuer auf. Es war ein Schreiber auf dem Amte mit großen Aussichten. Julie schrie begreiflich nicht Fürio, sie ließ brennen was brennen wollte, ihr Herz und des Subjekts Herz, beide zusammen gaben eine artige Flamme. In diesen Flammen wurden beide eins, d. h. glücklich und rätig, Mann und Frau zu werden. Schon montags in der Früh kam Julie zu Luise, ihr zu verkünden, wessen ihr Herz voll war. Wie da Luise weinte und trostlos war, kann man sich denken. Ihr Elend ging Julie zu Herzen, fast hätte sie mit geweint, sie zeigte die herzlichste Teilnahme, las in den hintersten Winkeln die Trostgründe zusammen. Zwischendurch entrannen ihr Bruchstücke ihrer Aussichten und Gedanken, ob sie sich am Hochzeitstage schwarz oder weiß kleiden solle, mit einem Häubchen oder ohne Häubchen, den Blumenstrauß in der Hand oder angeheftet? Endlich schloss Julie, da alle Trostgründe bei Luise nicht anschlagen wollten: Du musst dabei sein, denn ich bin gekommen, dich zu bitten, meine Brautführerin zu sein. Mein Fritz hat mir gesagt, es müsste glänzend zugehen an unsrer Hochzeit, drei oder gar vier Fuhrwerke müssten es sein. Näheres haben wir noch nichts abgeredet. Es hat gestern sich nicht alles ergeben mögen, und immer kam jemand dazwischen, hing sich an uns, wenn unsere Herzen im besten Zuge waren, und heute habe ich ihn noch nicht gesehen, meinen Fritz, den Spitzbuben! — das hölzerne Subjekt.
Luises Tränen versiegten nicht auf der Stelle, aber doch schneller, als man hätte erwarten sollen. Wie nach einem Gewitterregen wächst und blüht, was noch wachsen und blühen kann, so wuchs aus Luises Tränen eine Freude auf, die sie noch nie gehabt, die Freude, Brautjungfer sein zu können. Ganz wonniglich warm rieselte es in ihrem Herzen, wenn sie daran dachte, es war ihr halb und halb als wäre sie selbst Braut, Brautführerin war die gute Luise auch noch nie gewesen. Die einen ihrer Freundinnen dachten nicht an sie, andere wollten ihr die Kosten nicht verursachen, fürchteten, sie möchte gar zu armselig erscheinen und die Leute sagen: ob keine miserablere Brautführerin zu finden gewesen, das Hochzeitpaar müsse auch nichts Besonderes sein. Endlich lagen wohl auch der Auswahl von Brautjungfern und Brautführern heimliche Pläne zu Grunde, bald die Braut, bald der Bräutigam, bald beide zusammen, wünschten Die und Jenen in Berührung zu bringen, Bekanntschaft zu vermitteln. Wo war dazu bessere Gelegenheit und wann die Herzen günstiger gestimmt, als an einer Hochzeit und bei den Brautführern und Brautführerinnen, wenn sie, nachdem sie ihre Pflicht getan, Braut und Bräutigam zusammen geführt, diese vom Pfarrer eingesegnet, Arm in Arm die Kirche verlassen, sich nun gegenseitig die Arme geben. Paar und Paar hinter dem eigentlichen Paar herziehen: — da wäre es doch wunderlich, wenn sie nicht auch Heiratsgedanken fassten und wenigstens als halbe Ehepaare sich vorkämen. Luise hatte nie daran gedacht, dass sie auch Brautführerin sein könnte, nun jetzt einmal war sie erkoren, es war, als ob ihr ein Licht angezündet sei in der Seele. Gern würden wir erzählen, wie dieses Licht, das da erschien in der Finsternis, leuchtete, den Funken folgen, welche aufstiegen von diesem Lichte, Raketen gleich und wunderherrlich schwammen hoch oben als wie im Himmel, aber wir hätten nicht Papier genug. Lärm machte Luise dabei nicht, plagte auch Tante Spendvögtin wenig wegen der Toilette, aber fast kriegte sie Glanz auf die Wangen, und wer die Muße genommen hätte, sie zu beobachten, würde in ihren Augen ein süßes, seliges Träumen gelesen, gesehen haben, dass dahinten eine neue Welt aufgegangen sei, von welcher die eigentliche Welt keine Ahnung hatte. Vergesslich ward Luise, und darüber führte die Spendvögtin bittere Klagen: Aber Luise, was hast auch? keinen Kreuzer bist mehr wert, vergisst alles unter den Händen. Ich glaube bald, es fehle dir im Hirn und werdest ganz einfältig, das Gescheitest' warst ohnehin nie; so redete die Spendvögtin. Tante Spendvögtin hatte keine Ahnung der eigentlichen Ursache von Luises Vergesslichkeit, denn in ihrer Geschichte, wie sie den Spendvogt bekam, kam Vergesslichkeit gar nicht vor.
Endlich rückte er heran, der hochwichtige Tag, und Luises Herz zitterte in freudigem Bangen. Es waren Hochzeitgäste, welche am Abend vor demselben stark den Barometer misshandelten und alle Augenblicke sagten: Wenn wir morgen nur schönes Wetter haben, aber es wird kaum sein. — Allerdings machte der Himmel trübe Miene, und alle Regenzeichen waren so sichtlich da, dass man vergeblich gegen sie ein Auge zuzudrücken versuchte. Luise dachte weder an Barometer noch an Regen, noch an Sonnenschein, das kümmerte sie all nichts, wenn es nur bald fünf Uhr früh geschlagen hätte, um welche Stunde man abfahren wollte. Frau Spendvögtin war auch aufgestanden aus Angst wegen Luises Vergesslichkeit, sie wäre im Stande das Hemd über den Rock anzuziehen und die Nachthaube auf dem Kopf zu behalten, hatte sie gesagt. Die Tante hatte nicht Unrecht. Marei, sagte sie zu der Magd, geh mit, sonst läuft sie zum Berntor statt zum andern, und wart' bis sie wirklich in der Kutsche sitzt, sonst setzt sie sich hinten aufs Brett oder vorne auf den Bock. Wie es den ganzen Tag gehen soll, das weiß der himmlische Vater, ich darf nicht daran denken. Wenn du nicht so mager wärest, so hättest müssen zu Ader lassen, und bessert es nicht, so muss es mir wenigstens geschröpft sein. — Der Regen kam bachweise vom Himmel, aber das kümmerte Luise hell nichts; so tapfer war die alte Garde nicht aus Russland marschiert, als Luise an diesem Morgen durch Dick und Dünn. Auf dem Sammelplatz machten alle Ankommenden grämliche Gesichter, und so Mancher als kam, sagte: Es regnet. Bei jedem ging das Werweisen von Neuem an, ob es den ganzen Tag regnen, oder am Mittag oder am Abend das Wetter sich aufheitern werde? Luise allein hatte heute zum ersten Male etwas Ausgezeichnetes, sie machte ein glückliches Gesicht, jammerte über den Regen nicht, zuckte beständig, wenn sie reden wollte, mit den Füßen, als setzte sie zum Tanzen oder Hüpfen an, und sagte gewöhnlich, das Wetter dünke sie nicht so schlimm, und sei man einmal in der Kutsche, so merke man es nicht, regne es oder scheine die Sonne. Da trat ein schön geputzter Herr an sie und sagte: es sei schön von ihr, dass sie den Muth nicht verliere, und wenn es regne, sei man eigentlich viel heimeliger beisammen. Es freue ihn ihre Bekanntschaft zu machen, er hätte die Ehre Brautführer zu sein. Ach Gott! wie dies Wort Luise durchzuckte, und wie sie plötzlich ihre Augen aufschlug und in das Gesicht sah, welches dieses Wort gesagt hatte! Es war ein schönes, glattes Gesicht, rot und weiß mit blauen Augen, langer Nase, süßem Lächeln, verziert durch ein blondes Schnäuzchen, welches etwas schamhaft unter der langen Nase durchkroch. Das Halstuch war wohl eng gezogen, die Figur steif, spitz standen die Ellbogen hinten aus, die Arme hatten sich aus langer Übung die rechtwinklige Haltung angewöhnt.
Der Herr war nämlich mehrere Jahre mit dem Hochzeiter-Subjekt in einer Amtsschreiberei auf dem Lande gewesen, hatte sich endlich nach zehnjähriger Lehrzeit zum Notar aufgeschwungen und wollte sich als solcher in dem Städtchen setzen, wo sein Freund einstweilen noch Substitut, sogenanntes Subjekt war. Es schien Luise, als hätte sie solche Holdseligkeit und Schönheit noch nie in einer Menschengestalt vereinigt gesehen, sie fand kaum den Muth zur Antwort, lispelte sie endlich noch einmal so leise, als sie sonst zu reden gewohnt war. Ihr Herz war so voll Seligkeit, dass es ihr bis vor die Luftröhre kam, denn nicht bloß das Reden, auch das Atmen ward ihr schwer. Endlich, eine Stunde später, als angesagt war, nachdem man Boten nach allen Windgegenden ausgesandt, die Kutscher sich fast die Zungen aus dem Munde geflucht hatten, kam der letzte angerannt. Es war auch ein Subjekt, es trug das Halstuch noch in der Hand; es hatte sich erstlich verschlafen, zweitens sich zu lang mit dem Kamm versäumt und schließlich, ob dem Wichsen der Stiefel, welche nie glänzend werden wollten. Er hatte vor wenig Tagen sie mit Fett eingeschmiert, weil er bei schlechter Witterung an eine Steigerung musste, jetzt wollten sie ihr Angesicht nicht bald wieder ändern, waren konservativer als viele Menschen. Das gute Subjekt weinte fast aus Angst und Zorn über dieses verfluchte konservative Wesen. Und in der Tat, es hatte Recht. Was hilft es, wenn man mit dem Kopf radikal ist, ihn dreht, je nachdem von Oben geblasen wird, und die Stiefel bleiben konservativ, sind es doch am Ende die Beine, mit welchen man seinen Weg machen muss. Nun konnte man endlich an das Einpacken gehen, was gewöhnlich bei derlei Anlässen ein schwer Stück Arbeit ist, weil man sich die Kutschen zu weit, die Menschen zu dünn gedacht. Nun, wenn man recht stößt und drückt, der Kutscher mit grimmigem Gesichte nachhilft, fluchend, man versprenge ihm den Kasten, findet am Ende doch Jedes sein Plätzchen, und der Kasten springt nicht. An einem solchen Tage leidet und duldet Jedes gern, und die zarteste Tochter schreit nicht, wenn ihr ein Herr schon halb auf dem Schosse sitzt. Ja, währschafte Töchter nehmen freiwillig schmächtige Freundinnen auf den Schoss, wenn sie Gefahr laufen zu ersticken. Und je gepresster man sitzt, die Kutsche gerade aussieht, wie eine Heringstonne; desto mehr rühmt man, wie heimelig man sich befinde, und wie man es nie besser wünsche. Etwas Molest entsteht freilich noch, wenn die Damen gnädig sind und den Herren das Rauchen erlauben; vielleicht mit dem Beisatz, sie lebten erst recht, wenn sie Rauch röchen; es dünke sie, ein Herr sei kein Herr, wenn er nicht rauche. Besonders wohl stehe Pfeife oder Zigarre einem männlichen Gesichte. Was das kostet, bis in dieser Presse die Herren das Rauchzeug bei der Hand haben! Was das für ein Winden und Biegen und Strecken ist, und ohne weibliche Nachhilfe käme man doch nicht zu Stande. Und wenn man es endlich bei der Hand hat, so ist noch kein Feuerzeug da, und was da alles verwunden werden muss, bis man endlich zu Feuer und endlich zu Rauch kommt, hat gesehen, wer mal dabei gewesen ist.
Am Ende geht es uns in diesem eigentümlichen Presszwang, wenn man nämlich weder Gift oder Ungeduld im Gemüt hat, wie in manch anderem Zwang: er scheint sich allmählich zu erweitern, es wird uns behaglicher und zuletzt ist es uns sogar leid, wenn wir an Ort und Stelle sind und wieder ausgepackt werden sollen. Das ist nun wieder mit Beschwerden verbunden, indessen alle Glieder sind ganz geblieben, sogar die Haut, und wenn sie schon starke Eindrücke empfangen hat: wer sagt uns, dass starke Eindrücke immer unangenehm sind? Freilich, die Garderobe der Damen ist nicht mehr ganz so frisch, sieht gerunzelt aus, wie alte Zigeunergesichter. Indessen die Damen geben schon nicht mehr so viel darauf, die sind überzeugt, die im Wagen entfaltete Liebenswürdigkeit bedeckt unendlich viele Falten, und mit Hauchen und Dämpfen kann man viel nachhelfen, Krummes gerade machen, Zerknittertes wieder blank. In unendlichem Glück war Luise neben dem Notar gesessen, die ganze Fahrt war ihr ein himmlischer Augenblick. Sie ahnte, wie vor Gott tausend Jahre wie ein Augenblick sein können, jetzt da vier Stunden neben einem Notar zu einem Moment zusammenstoßen. Nun, wie es bei einer Hochzeit vor dem Kirchengehen zugeht, weiß Jedermann. Es ist der zweite Aufzug des Schauspiels, welches beim Einsteigen aufgeführt wurde, es ist eine respektive Unordnung. Die einen kommen nie zum Frühstück, die Andern kommen nie davon, man wird nie fertig. Der Sigrist würde aus der Haut fahren, wenn nicht die Neugierde, wie groß das ihm gespendete Trinkgeld sein würde, ihn zurückhielte. In der Kirche ging's ebenfalls wie üblich; einige Freundinnen der Braut weinten, die Freunde des Bräutigams dagegen blieben hölzern und unempfindlich, woran aber weder die Kirche noch der Pfarrer schuld sind. Von wegen, jaget Kamele, Büffel, Bisonochsen, Elefanten, ja Rhinozerosse und Giraffen in eine Kirche und lasst einen Pfarrer beten und predigen, so streng er mag: weder Giraffen, noch Rhinozerosse, noch Elefanten, noch Bisonochsen, Büffel, Kamele und anderes Hornvieh wird was Anderes denken, als wenn es nur wieder raus wäre, und nichts Anderes im Auge haben als das Loch, wo es hinein kam, und wenn das nicht mehr sichtbar ist, nach einem andern spähen, wo es wieder 'raus kann. Luise war unter den Weinenden, ihr Schnupftuch wurde ganz nass, aber es waren selige Tränen, sie rieselten ganz weich und warm über die Wangen nieder. Der Notar dagegen weinte nicht, aber er machte einen steifen Hals und gab genau Acht, ob alles pünktlich nach Gesetz und Propheten vor sich gehe, nicht irgendein Formfehler passiere, dass er hintendrein sagen könne: die Sache sei zwar vorbei, aber wenn er wollte, er könnte den Pfaffen ringeln, dass ihm die Schwarten wehe täten, er möchte es aber seinem Freunde nicht zu Leide tun und dessen Fraueli, die könnten ihn dauern. Der Notar war von Natur eine ganz gute Seele, d. h. eigentlich eine gute Haut. Ob er eine Seele hatte, das wissen wir nicht. Wenn er eine hatte, so bestand sie hauptsächlich in dem eminenten Vermögen, ein Gsätzlein nachzupfeifen und zwar ununterbrochen so lange, bis man ihm wieder ein anderes vorpfiff. Wahrscheinlich hatte sie ein ähnliches Eingericht wie trompetende Tabaksdosen oder Kasten eines Leiermannes. Nun, alles auf Erden geht zu Ende, selbst die Zeit, in welcher gepresste Helden des Zeitgeistes und hölzerne Subjekte in der Kirche sein müssen. Aus dicken Wolken strömte dicker Regen nieder, aber eben das war wieder unaussprechlich schön und heimelig. Nun kam der Herr Notar in seiner unaussprechlichen Holdseligkeit, verbeugte sich, so schön er konnte, nahm Luise nicht bloß untern Arm, sondern auch unter seinen Regenschirm, und zog dicht hinter dem Ehepaar mit ihr davon. Das war schön, und was das für Gedanken gab! Aber nicht bloß das war schön, sondern der Notar entfaltete eine Sorglichkeit und Höflichkeit, welche Luise nie erlebt hatte. Er trat ihr nicht bloß nie auf die Füße, sondern er leitete sie sogar auf die besten Stellen des Weges; er hielt sie nicht bloß nicht unter der Traufe seines Regenschirms, sondern er gab sich wirklich Mühe, sie trocken zu erhalten, so dass seine linke Seite ganz nass wurde, was zu einem edlen Wettstreit fortdauernd Anlass gab, und welchen der Notar mit so schönen Manieren und Redensarten führte, dass Luise einmal über das andere denken musste, die würde er bloß von den Engeln im Himmel erlernt haben, ja gar Angst und Zweifel kriegte, er könnte plötzlich Flügel bekommen und ihr davon fliegen samt dem Regenschirm, als ein wirklicher Engel. Zwischen der Kirche und dem Essen ist für Viele eine langweilige Zeit, man weiß gar oft nicht, was miteinander machen, besonders wenn man früh aufgestanden und der unterdrückte Schlaf seine Rechte geltend macht, wie ein ungestümer Untertan. Ach, und es schien keine heiße Sonne, in welcher man spazieren, in welcher, was hölzern war, Feuer fangen konnte. Aber man weiß sich zu helfen, man spielte, da die Geiger noch nicht da waren, Blinde Maus im Saale und Versteckens im ganzen Hause, man amüsierte sich herrlich; absonderlich Luise, welche der Notar immer sorglichst geleitete, sie schützte, die besten Verstecke zu finden wusste, und alles so zart, so zart, dass Luise immerfort denken musste: Ach, das ist Einer, das ist Einer!
Ach, und das: Ach, das ist Einer, das ist Einer! musste Luise selben Tages sich noch viel hundertmal wiederholen. So artig und so zart war noch nie Einer neben ihr gesessen, als der Notar, und noch nie hatte Einer so artig und so zart für alle ihre Bedürfnisse gesorgt. Luise konnte ihm gar nichts abschlagen, aß noch einmal so viel, als sie sonst pflegte, und trank mehr als ein Schlücklein über das gewohnte Maß. Dies hatte den glücklichen Erfolg, dass Luises Stimme sich kräftigte, so dass der Notar sie wirklich, ohne die Hände hinter den Ohren zu halten, verstand. Nun erst ging die Seligkeit an, d. h. Gespräche, sinnig, tief und hehr, wo der Notar Grundsätze zeigte, ach ganz herrliche! wie Luise nie gesehen. Seine Seele war ganz feurig und zwar freisinnig-feurig, und so freisinnig-feurig, wie er war, wollte er die ganze Welt machen, dann erst sei man glücklich und frei und habe die rechte Religion. Die Religion sei das Höchste, aber ganz freisinnig müsse sie sein; wenn sie nicht freisinnig sei, so sei sie das Unglück der Welt und beraube die Menschen der höchsten Güter. Das habe man erfahren, und jetzt wolle man die Menschen glücklich machen und nicht bloß Einige, sondern Alle, Alle. Seid umschlungen, Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt! so rief der Notar begeistert, und Luise wurde rot und auch feurig im Herzen. Eine andere wäre eifersüchtig geworden auf die Welt, mit welcher sie einen Kuss teilen sollte, homöopathischen Küssen frage sie nicht viel nach, würde sie gesagt haben. Luise war nicht so, sie war ganz glücklich mit ihrem Tausend-Millionstel-Teilchen-Kuss und seufzte: Ach, welch herrlicher Mensch, für eine bessere Welt geboren! Und als es erst ans Tanzen ging, wie war es da Luise? Es war ihr, wenn sie mit dem Notar tanzte, als ob zwei Engel durch den Äther schwebten. Er ragte über sie empor, trug den Kopf nach hinten und schloss halb die Augen, wie ein Engel, der in seliger Verzückung gen Himmel fahren will. Ungestört konnte Luise zu ihm aufsehen, ungestört trinken die Wonne seines Anblickes; er sah es nicht, er störte sie nicht, sie konnte träumen, wie der Boden weiche und sie auf Fittichen leise schwebten zu den Sternen empor, die in seligen Räumen wohnen. Aber alles nimmt ein Ende auf der Welt, der glücklichste Tag verrinnt dem unglücklichsten gleich. So ging es auch diesem Tage, die Geiger mussten verstummen vor dem Fluchen der Kutscher, die keinen Augenblick mehr warten wollten, drohten mit Fortfahren; wer nicht mitkommen wolle, könne ins Teufelsnamen da bleiben. Nun, es blieb noch das Heimfahren, und das ist manchmal das Schönste von allem, der Punkt auf dem I. Die Herzen sind weich geworden, die Sehnsucht ist groß geworden, die Zungen lösen sich, mit traulichen Geständnissen macht man sich glücklich, verewigt den glücklichen Tag.
Es war Nacht, als man endlich den Befehlen der Kutscher nachkam und in die finstern Kasten kroch, ach, wo es so heimelig war, wo das Gemüt sich entfalten konnte, so schön als es war, so traulich es wollte, die Hände sich drücken konnten, die Herzen sich finden, ungehört und ungesehen von Allen, welche es nichts anging. Alles war so recht, wie es sein musste, nur leider eines nicht: die Stimmung der männlichen Bevölkerung; diese unterlag leider dem Zeitgeiste, war nicht sentimental, nicht liebenswürdig, d. h. liebedurstig, sondern patriotisch und freisinnig. Es wurde gesungen, und zwar stark, dass man das Rasseln der Wagen, das Knallen der Peitschen nicht hörte. "Ho, ho, ihr Schützenbrüder" und "lasst die Fahnen wehen", das sind Lieder, welche Liebesmucken vertreiben, blutdürstig machen und schlachtensüchtig. Paff, Paff! jagte ein Lied das andere, und wenn man wegen dem Verschnaufen Pausen machen musste, so brach der Muth in Prosa aus, und absonderlich der Notar erzählte von seinen Heldentaten, welche er zu verrichten gedachte, und wie er sich lieber zu Kraut und Rüben verhacken, zu Pulver verstoßen ließe, als sich gefangen geben. Schieße man ihm die Beine ab, so stelle er sich an einen Baum und schlage mit dem Säbel drein; haue man ihm die Arme ab, so lade er Flinten und Pistolen mit den Füßen und schieße fort wie's Wetter, oder renne mit dem Kopf die Leute vor die Bäuche; so könne man ganze Regimenter sprengen. Er legte eine Gesinnung, eine Tapferkeit an den Tag, dass es Luise ganz kalt den Rücken auflief, dass sie ausrief, einmal über das andere: O nein doch, ach nein doch, schweiget doch, es wird mir weh! Sie sah ihren schönen Notar schon ohne Beine, ohne Arme, mit dem Kopf im Bauche eines dicken Jesuiten oder eines Österreichers stecken wie eine Kanonenkugel in einer Mauer. In dieser patriotischen Begeisterung ging jede Privatstimmung unter, wie billig, und diese Begeisterung war so hartnäckig und schwunghaft, dass sie nicht verflog, als man aus dem Wagen stieg, sondern dass sie in immer lichtere Flammen ausbrach, als der Notar Luise durch Dick und Dünn, Nacht und Graus zu ihrer Wohnung geleitete. Er erzählte Luise, wie er das Vaterland liebe, was er schon alles für dasselbe getan und noch tun wolle, wenn dasselbe auch noch nichts für ihn getan hätte. Undank sei der Welt Lohn. Aber es komme doch die Zeit, wo man ihn erkennen werde, er zähle fest darauf, es komme nur darauf an, ob er dann annehmen wolle, was man ihm anbiete; jedenfalls wolle er sich besinnen. Ach, welch herrliche Gesinnung und wie selten in unsern Tagen! seufzte Luise. Sie ist häufiger, als man glaubt, sagte der Notar. Ich will nicht sagen, dass ganz so wie ich Viele sind, aber unter den Freisinnigen ist im Allgemeinen eine herrliche Gesinnung und Vaterlandsliebe, und wenn man schon begreift, dass das Vaterland nicht alle auf einmal belohnen kann, so darf man doch erwarten, dass es nach und nach geschieht und Unwürdige nicht den Würdigen vorgezogen werden. Ach, wie edel! sagte Luise, fast wird das nicht mehr geschehen, wir leben ja in einer so schönen Zeit. Man kann nicht wissen, sagte der Notar, aber es ist nicht Alles, wie es sein sollte; es steht Mancher hoch, er tat nicht die Hälfte, was ich, für das Vaterland. Aber ich will nicht klagen, ich bin im Stande mich selbst durchzubringen, was bei Andern nicht der Fall ist, das wird man gedacht haben. Wenn man mich nötig hat, wird man mich schon finden. Ach, wie bescheiden, sagte Luise, wenn doch alle so wären! Da standen sie vor der Frau Spendvögtin Häuschen, und ehe der Notar sich noch gebührend über die Freude ausgelassen, Luises Bekanntschaft gemacht zu haben, und die Hoffnung ausgesprochen, das Vergnügen zu haben, sie fortzusetzen, ließ von hinten die Stimme der Frau Spendvögtin sich hören, welche heftig schalt über das späte Nachhausekommen. Luise erschrak, der Abschied verwirrte sich, die lieben Worte blieben ihr im Halse stecken, und ehe sie wusste, wie es geschah, war der Notar verschwunden, und sie stand im Kreuzfeuer des Zornes der Frau Spendvögtin. Die schönsten Tage enden gerne mit einem Gewitter. Das erlebte Luise.
Tage vergehen, aber sie hinterlassen oft Eindrücke, welche nicht bloß nicht vergehen, sondern ein eigenes Leben erhalten, wachsen und, als Frucht, ein neues eigentümliches Dasein bilden. Luise schwelgte die ersten Tage in der Rückerinnerung. Wie oft des Tages sie jenen Tag von vorne bis hinten wieder durchlebte, bis Tante Spendvögtin im Hausgang erschien, wissen wir nicht. Aber wenn das Kind einen Weg bis zu einem bestimmten Punkte mehrere Male gemacht hat, so strebt es darüber hinaus, es nimmt ihn Wunder, wie es jenseits desselben aussehe; das liegt in der Natur. Das lag auch in Luises Natur. Als sie einige Mal bis zur Spendvögtin gekommen war, so gleichsam das Gitter hinter dem Paradiese, nahm es sie Wunder, was hinter dem Gitter stehe, d. h. was geschehen wäre, wenn die Spendvögtin nicht gekommen wäre. Wie die Kinder tun, tat Luise das Gitter nur ganz wenig, ganz leise auf, dass kaum das Näschen durchmochte, setzte schüchtern einen Fuß hinaus, den zweiten endlich auch, tat einige Schritte, und wenn dieser Anfang einmal gemacht ist, weiß man wohl, wie es geht. Es geht Mädchen akkurat, wie Mohammed seinen Arabern drohte, dass es ihnen ergehen werde, wenn sie sich unterstünden, Bilder zu machen. Diese Bilder, drohte er ihnen, würden als Schatten sie verfolgen, sich an ihre Fersen heften, Leben und Seele von ihnen fordern, ihnen nicht Ruhe lassen. Pflanzen nun Mädchen Bilder in ihre Herzen, absonderlich von Notarien oder selbst bloßen Subjekten, machen diese Bilder fest darin und beschauen sie alle Tage, so werden diese Bilder das Herz schwer plagen; das Herz aber, um der Plage los zu sein, will das Bild, welches es plagt, aus dem Herzen heraus vor Augen haben, lebendig und als sein eigen, so dass es dasselbe ansehen und behandeln darf nach Belieben. Das empfand die arme Luise, welche der Notar im Herzen alle Tage ärger plagte, dass es eine strenge Sache war. Es dünkte sie, wenn sie ihn nur sehen könnte, es würde ihr schon bessern, leichter im Herzen werden. Aber mit keinem Auge sah sie ihn, vernahm nichts von ihm, er war gleich einer himmlischen Erscheinung verschwunden. Ihre Freundin Julie war abwesend auf einer Hochzeitreise. Luise war ganz schwermütig, musste immer strenger an ihn denken, und wenn sie am strengsten an ihn dachte, so musste sie seufzen und denken, wenn sie Flügel hätte, sie flöge ihm nach! Mit der Spendvögtin durfte sie über Mannspersonen nicht reden, ausgenommen über den alten Spendvogt selig, es schicke sich nicht für so junge dumme Dinger, meinte die Spendvögtin, und doch war Luise näher den Dreißigern als den Zwanzigern. Durch die Heirat ihrer Freundinnen war sie nach und nach von der Welt so quasi getrennt worden, d. h. sie machte ihre Schwingungen nicht mehr mit, glich so gleichsam einem Krebs, der bei einer Meeresflut weit auf den Strand getrieben wurde, und als die Ebbe kam, in einer Pfütze einsam zurückgelassen worden war. Endlich vernahm sie, Julie sei wieder angelangt, sie säumte nicht, der jungen Frau ihre Aufwartung zu machen. Sie fand diese voller Freuden, sie hatte einen ganzen Himmel voll Hoffnungen, und zwar ganz solide, mitgebracht. Sie waren nicht weit gereist, aber mehr als acht Tage hatten sie sich in der Hauptstadt aufgehalten, wo Fritz, der Spitzbube, vornehme Bekanntschaften hat, welche ihn versicherten, dass er nicht länger bloßes Subjekt bleiben, sondern die erste beste Stelle, welche brav eintrage, erhalten solle. Sie könnten sich ganz bestimmt darauf verlassen, die Herren hätten es ihr selbst in die Hand versprochen und sie hätte versprechen müssen, dieselben aufzunehmen und gut zu bewirten, wenn sie hinaus zu ihnen kämen; sie wollten wissen, ob die junge Frau Fische backen und Mehlsuppen machen könnte. Es seien gar scharmante Herren, und wer bei ihnen den Fuß im Hafen hätte, könnte haben was er wolle, die sorgten für ihre alten Freunde und Bekannten. Julie war so voll Freude und Hoffnung, dass es Luise viele Mühe kostete, das Gespräch so unvermerkt als tunlich auf ihren Notar zu bringen und so unverfänglich als möglich merken zu lassen, was das für ein herrlicher Mensch sei; sie glaube nicht, dass es zwei von dieser Sorte auf Erden gebe.
Da lächelte Julie schalkhaft und sagte: Luise, nimm dich in Acht, der sagt dir nicht Herr, der will oben aus, macht Ansprüche. Mein Fritz, der Spitzbube, sagt, der Notar habe gesagt, er wolle entweder gar nicht heiraten oder reich; er glaube, dem Vaterland, welches feste, grundsätzliche, unabhängige Männer nötig hätte, auf diese Weise am besten zu dienen. Daneben frage er dem Gelde gar nichts nach, es sei ihm nur Mittel zum Zweck. Er sei gar fest mit den Grundsätzen, der Notar, sagt mein Mann, und werde es weit bringen, wenn man einmal mit Grundsätzen was machen könne. So speiste Julie die arme Luise ab und konnte ihr nicht einmal nähere Auskunft geben, was er treibe, der Notar. Es ging nicht lang, so kriegte Fritz, der Spitzbube, eine sehr schöne Stelle, wurde aus einem Subjekt Präsident, oder noch mehr, und musste über Hals und Kopf mit seiner Frau von dannen ziehen. Nun war die Brücke zwischen Luise und dem Notar vollständig abgebrochen, Luise trostlos. Den Notar im Herzen ward sie nicht los. Derselbe ward ungestümer und plagte sie alle Tage wilder, wollte hinaus, wollte Leben, Seele, wollte Luise alles in Allem sein! Die arme Luise, wie sie sich auch Mühe gab, kam nie zum Glück, mit dem Notar zusammenzutreffen, sie sah ihn höchstens zuweilen von ferne und von hinten. Wie sehr sie dies für einen Augenblick auch glücklich machte, hintendrein ward sie nur unglücklicher, das Bild in ihrem Herzen ungestümer. Sie hatte keine Freundin, welcher sie sich mitteilen konnte; der Frau Spendvögtin musste sie sogar ihre Seufzer verbergen. Diese war ohnehin sehr unzufrieden wegen Luises Vergesslichkeit, klagte, es sei gar nichts mit ihr anzufangen, und drang mit Ernst darauf, dass Luise, wenn nicht zu Ader, so doch schröpfen lasse. Die Spitalvögtin missriet dies sehr. Sie sagte, ein Fall, wie der, dass man Personen von diesem Aussehen geschröpft, sei ihr nicht vorgekommen, das könnte sie ja töten. Sie habe augenscheinlich zu wenig Blut und nicht zu viel, sie wäre sonst nicht so blass; sie wette, Luise habe die Auszehrung, oder gar die galoppierende Bleichsucht. Da wäre nichts besser als ab Bocksbart zu trinken. Möchte nicht dabei sein, möchte ab diesem oder jenem Bocksbart ein absonderlich Trinken sein. Die Frau Seimeisterin war anderer Meinung. Sie hielt dafür, die Kost der Frau Spendvögtin sei nicht gut für Luise, die sollte nicht bloß Kaffee trinken, sondern tüchtig Fleisch essen, Brat- und andere Würste, gebratene Kartoffeln, kurz so was Währschaftes, Tüchtiges; die Krankheit liege sicherlich im Magen, und wenn alle Glieder schwach würden, so wüsste sie nicht, warum nicht auch das Hirn schwachen und das Gedächtnis abnehmen müsste. Andere hatten andere Meinungen, schlugen andere Mittel vor, und da alle Tage die Konsultationen von vorne anfingen, aber nicht zu Ende kamen, so blieb Luise einstweilen mit Schröpfen und Bocksbart verschont.
Diese Uneinigkeit kam Luise sehr zu statten, sonst hätte sich an ihr das Sprichwort erwahren können: viele Köche versalzen den Brei, und viele Hunde sind des Hasen Tod. Wenn sie der Reihe nach alle Mittel hätte gebrauchen sollen, welche die Meisterinnen, Vögtinnen und Herrinnen ihr verordnet, das Ding hätte schlimm kommen können. Luise war krank, aber sie wusste allein, wo es ihr fehlte; aber wie helfen, das wusste sie nicht, und doch trieb sie der Instinct der Selbsterhaltung, Heilmittel zu suchen. Dieser Instinct geht zuweilen über alle Doktoren, er fordert Dinge, welche der Arzt auf das schärfste verboten hat; kalte Milch z. B. in heißen Fiebern, und zum großen Erstaunen von männiglich weicht die Krankheit, und gesund wird der Mensch. Solcher Instinct stellt sich aber zumeist nur ein, wenn die Krankheit den Höhepunkt erreicht hat, die Krisis naht, das Leben des Menschen in der Schwebe ist. So war es wirklich auch mit Luise, sie war ein Schatten geworden, nur fiel es an ihr weniger auf, weil sie nie eine blendende Erscheinung gewesen. Und weiß Gott, wie manchen Tag Luise es noch gemacht hätte, wenn sie nicht eines Morgens früh zu Marei, der Magd, welche ihr wohlwollte, gesagt hätte: Marei, willst mir einen Gefallen tun, aber versprechen, keinem Sterbensmenschen was davon zu sagen? Ja, wenn ich kann und es sich mir schickt, warum nicht, ja freilich, antwortete Marei. — Du weißt, Tante geht diesen Nachmittag zur Frau Seckelmeisterin, aber ich darf dir nicht sagen, was ich möchte, gewiss darf ich nicht, stotterte Luise. — Pah, sagte Marei, tut nicht dumm und scheut Euch nicht; wenn Ihr wüsstet, was ich mein Lebtag schon alles gehört habe, Ihr machtet nicht so lange Flausen. — Aber willst es dann Niemanden sagen? fragte Luise. Ei nun so dann: wann du diesen Morgen in die Metzg gehst, so geh doch zum Notar Stößli, er hat seine Schreibstube hinten am Waschhaus, und sage ihm, ich lasse meine Komplimente vermelden und ihn ersuchen, diesen Nachmittag zu mir zu kommen, es sei wegen Geschäften, wenn ich wohl wäre, so wäre ich zu ihm gekommen. — Das kann ich machen, sagte Marei trocken. Verdammt Wunder nahm es Marei, was ihre Jungfer mit Dem wolle, wenn die Tante nicht daheim sei. Wie aber Luise zitterte und bebte, als Marei fort war, und wie gern sie den Auftrag zurückgenommen hätte und wieder nicht warten mochte, bis Marei zurückkam und Bescheid brachte, ob er komme oder nicht! Er lasse sein Kompliment machen und werde, wenn nichts dazwischen komme, sich einstellen, brachte Marei zurück. Er hat mich gefragt, was er machen solle. Was sollte ich ihm sagen? Ich wisse es nicht, habe ich ihm gesagt; was habe ich anders sollen? erörterte Mareili unwillig und erwartete als Trinkgeld und Botenlohn weitere Eröffnungen. Aber umsonst. Luise seufzte nur, ward bleich und rot, und Marei musste brummend sich schieben. Beim Mittagessen brachte Luise keinen Bissen hinunter, so dass es der Frau Spendvögtin Angst wurde. Ich ließe der Frau Seckelmeisterin absagen, sagte sie, wenn ich ihnen nicht die Partie verderben würde. Aber gewiss muss ernstlich dazu getan sein. Sie mögen sagen, was sie wollen, sicher wäre Schröpfen am besten. Jedenfalls muss morgen der Arzt kommen. Marei, hörst, gehe und sage dem Doktor Habicht: ich lasse das Kompliment vermelden, und morgen solle er kommen, wenn er könne. Louise protestierte umsonst. Es werde schon bessern, sagte sie, es sei nur vorübergehend u. s. w. Die Tante bezeugte das Gegenteil und vertiefte sich so in das Thema, dass es Luise katzangst wurde, die Tante vergesse die Frau Seckelmeisterin und die Partie Boston, treffe mit Notar Stößli unter der Haustüre zusammen und frage barsch: Was wollt Ihr hier? Nun, diese Angst ging glücklich vorüber, Tante segelte ab, und zwar mit geschwellten Segeln; die Andern saßen sicher bereits hinter dem Spieltische, denn schon hatte es Ein Uhr geschlagen. Die Spendvögtin wusste, welches scharfe Gericht von Vorwürfen über solch unverantwortliche Verspätung sich ergoss. Kaum war diese Angst gehoben und die Tante verschwunden, kam Luise die Angst vor dem Erscheinen des Notars, und zwar so heftig, dass sie zu ersticken meinte, und ihr sonst so stilles Herz polterte, als plumpste eine zweizentrige Köchin Tritt für Tritt eine hölzerne Treppe hinunter. Und wie das Herz am stärksten plumpste, klopfte es an der Türe. Die Stimme versagte Luise, die Glieder zitterten, vom Sofa konnte sie sich nicht erheben. Da öffnete sich die Türe, und ein schönes Gesicht schob sich durch die Spalte, eine schöne Figur kam nach, und leibhaftig stand Notar Stößli vor Luise, verbeugte sich zierlich und fragte, womit er dienen könne, oder ob er etwa ungelegen komme? Nein, hauchte Luise, tat einen tiefen Atemzug, zeigte auf einen Stuhl und sagte endlich: Ihr seht, ich bin krank! Mit schönen Redensarten drückte der Notar sein Bedauern aus und begann zu vermuten, warum er gerufen worden. Ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe, hauchte Luise und Herr Stößli musste sich ganz nahe setzen, um zu verstehen, was Luise hauchte. Es wäre mir eine Erleichterung, wenn ich wüsste, in welche Hände mein kleines Vermögen käme, nahe Verwandte habe ich nicht. Aber ich weiß nicht, wie dieses machen, ich habe mein Lebtag kein Testament gesehen und weiß nicht, wie eins aussieht. Da habe ich gedacht, ich könnte Sie fragen. Sie wüssten es am besten. Zu Ihnen hätte ich das Zutrauen, mehr als zu jemanden sonst. Tante soll Nichts davon wissen, es schmerzte sie viel zu sehr, wenn sie wüsste, wie weit es mit mir ist. Erschöpft schwieg Luise, und dienstfertig, nachdem er noch einmal erst sein Bedauern, dass sie so unwohl sei, und dann seine Hoffnung, dass sie doch nicht so unwohl sei, als sie glaube, ausgedrückt hatte, begann Herr Stößli ihr die notwendigen Formalitäten auseinanderzusetzen, und wie ein Testament beschaffen sein müsse, um gültig zu sein. Das sei keine schwere Sache, sagte er; wenn man einmal wisse, wie man disponieren wolle, so sei die Sache bald geschrieben. Am besten freilich sei es immer, wenn die Zeit es erlaube, man mache erst seinen Aufsatz, gebe seinen Willen dem Notar kund, der könne die Sache gehörig zu Faden schlagen, es gehe dann um so schneller, wenn die Sache gültig ausgefertigt werden solle, und sei für die Zeugen und den Testator äußerst angenehm. Wenn es der Jungfer Luise wohl genug sei und sie das Vertrauen zu ihm habe, so könnte er ihr gleich einen flüchtigen Entwurf machen; wenn man es auf dem Papier habe, so komme einem das eine oder das andere in Sinn, man übersehe das Ganze besser. Der Notar wusste, dass, wenn man einen Fisch vor dem Garn habe, es am besten sei, nicht zu rasten, bis man ihn darin habe. Vielleicht nahm es ihn auch Wunder, worüber Jungfer Luise, von deren Vermögen er nie was gehört, eigentlich zu testieren habe. Der Vorschlag hatte Luise ganz rot gemacht, wieder eng ward es ihr auf der Brust, mit Mühe sagte sie: Ach, wie gut Ihr doch seid; aber diese Mühe darf ich Euch nicht machen! Ei warum nicht? sagte Herr Stößli, nahm aus seiner Brieftasche das nötige Schreibzeug und schrieb kürzlich den schönen Eingang, wie man seine Seele der Gnade Gottes empfehle, sein zeitlich Gut aber in folgende Hände geben wolle. Luise weinte, als er ihr das vorlas. Er wolle es noch schöner machen in der Ausfertigung, sagte Herr Stößli, das sei nur so oberflächlich hingeworfen. Jetzt muss ein Haupterbe sein, mahnte Herr Stößli. Tante Spendvögtin, sagte Luise. Und jetzt allfällige Vergabungen. Julie, meiner Freundin, mein Haus, stotterte Luise. Ja so, dachte Herr Stößli, also darum hat die mir nicht von Vermögen gesagt. Meinem Küher den Berg. Wie heißt der Berg? fragte Herr Stößli. Sie hätte ihm nie anders gesagt als Berg, sagte Luise. Und weiter fragte Herr Stößli, und Luise, welche nach und nach auflebte, machte Vergabung um Vergabung, und zwar stattliche, dass Herr Stößli endlich sagte, er müsse mahnen, nach seiner Pflicht, der Armen zu gedenken, und alsobald bedachte Luise die Armen ihrer Gemeinde mit 2000 Gulden. Man müsse sich immer in Acht nehmen, sagte Herr Stößli, dass man durch zu viele Vergabungen den Haupterben nicht in Verlegenheit setze; dadurch könnten fatale Geschichten entstehen. Die Tante weiß, was ich habe, antwortete Luise. Ganz ehrerbietig sagte Herr Stößli: So so! Wir wollen hoffen, das alles sei nicht nötig, Jungfer Luise erhole sich wieder, setzte er mit großer Teilnahme hinzu. Wenn sie wolle, sagte er, so wolle er ihr den Entwurf da lassen; sie könne ihn übersehen und bedenken und allfällige Änderungen ihm später diktieren. Wenn es Jungfer Luise gelegen sei, dass er wiederkomme? Luise bestimmte den Tag; am selben war die Tante bei der Seckelmeisterin, und sie dankte herzlich Herrn Stößli für seine Gefälligkeit, stand auf, wie sehr er auch bat, doch ja sich zu schonen, und begleitete ihn bis zur Türe, wo ein recht inniger und herzlicher Wettstreit, welcher sie um Vieles näher brachte, stattfand, wie weit die Höflichkeit gehen solle. So rosig und süß im Gemüte war es Luise noch nie gewesen; was sie im Herzen getragen, war nun vor ihr gesessen, ganz freundlich und herzig, und wollte wieder kommen; es war, als ob ihr Blut ein anderes würde, ein anderes Leben einziehe in ihren Körper.
Aber auch im Herrn Notar ging eine Veränderung vor. Er machte sehr ernsthafte Mienen, war zerstreut, rechnete zu Hause allerlei, sein Subjekt wusste nicht was, schüttelte den Kopf, lächelte, kurz, er machte eine Menge Manövers, welche man an ihm zu sehen sonst nicht gewohnt war. Er mochte den Tag gar nicht erwarten, an welchem die Tante bei der Seckelmeisterin war und er Luise besuchen konnte. Er fand sie viel besser, als das letzte Mal. Sie kam ihm entgegen, redete lauter, schien überhaupt an Kräften zugenommen zu haben. Das erfreute sichtlich Herrn Stößli, gut wusste er seine Freude auszudrücken, eine innige Teilnahme an den Tag zu legen, schob selbst das Beraten des Entwurfes für heute auf und füllte die Zeit so interessant aus, dass sie unbemerkt vorüber rauschte wie im Himmel. Das nächste Mal, als Herr Stößli wieder kam, war man schon ganz heimelig, aber Luise hustete mehrere Male. Der Teufel, dachte Herr Stößli, die Sache könnte doch fehlen. Er wurde noch viel liebenswürdiger, und in Luise gingen Adern auf, welche bisher ganz verpicht waren. Sie sprach gut, machte selbst Witz, und zu seinem Erstaunen fand Herr Stößli sie tief gebildet, nicht bloß so oberflächlich. Sie sprach von Grundsätzen und Bildung, hatte die besten Bücher gelesen, sogar vom ewigen Juden von Sue gehört, redete von Lebenszwecken und vom Vorabend einer neuen Zeit, dass Herrn Stößli fast Hören und Sehen verging. Eine solche Bildung, eine so innige Harmonie mit den Grundgedanken seiner Seele war ihm noch nie vorgekommen. Es war an Herrn Stößli, verlegen zu werden, gegenüber einem Mädchen von solchem Vermögen, solcher Bildung, solcher Bescheidenheit obendrein, als er auch einen Lebenszweck erreichen wollte, als er Luises Hand ergriff, als er sich zärtlichst vor ihr beugte, als er sagte: Ach, Jungfer Luise, ich wage es nicht. Schon lange suche ich umsonst eine Gefährtin nach meinem Sinn, mit der ich glücklich zu werden hoffen darf, mit Bildung und Grundsätzen, mit einer Seele, welche mich und die Zeit versteht. Jetzt, wo ich eine solche finde, jetzt darf ich mich nicht aussprechen, darf nicht hoffen, dass sie mein bescheiden Loos mit mir teilt. Luise — ach! — soll der glücklichste Zeitpunkt meines Lebens, wo ich Sie kennen lernte, mein unglücklichster werden?! Er zog mit der einen Hand das baumwollene Foulard, wischte ihre Hand nicht, und mit der andern griff sie auch zum Schnupftuch, aber wischte sich nicht bloß die Augen, sondern begann zu weinen, ganz erbärmlich. Herr Stößli war sehr erschrocken und im Ungewissen, was das bedeuten solle; er tröstete, er drückte, er schlang den Arm um sie, so zart und artig, wie nur ihm gegeben war, und doch weinte Luise fort, und zwar immer erbärmlicher, dass es fast krampfhaft wurde und sie nach Luft schnappen musste.