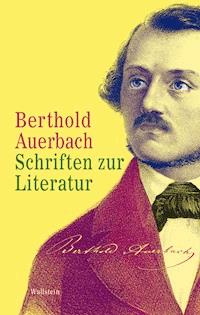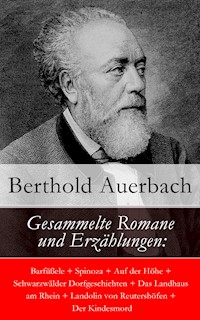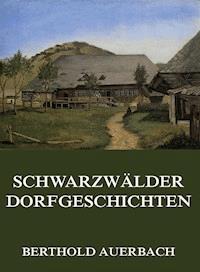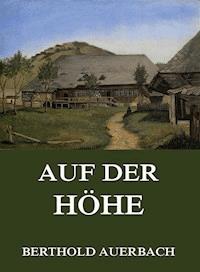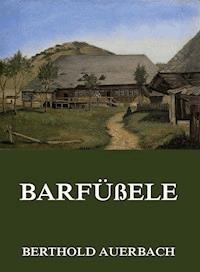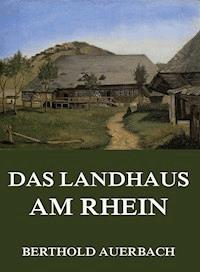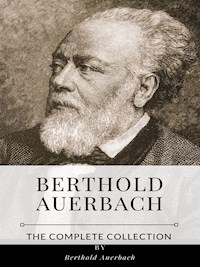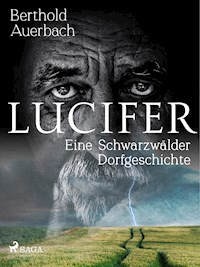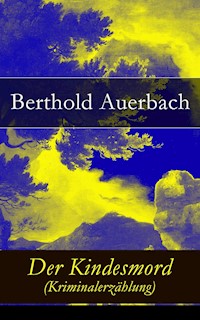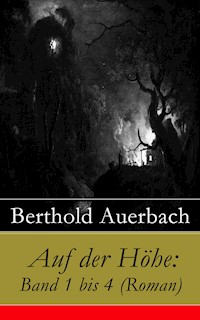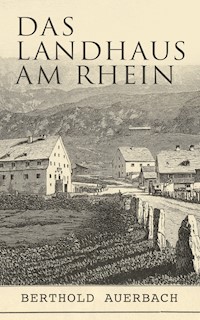Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auerbachs biographischer Roman befasst sich mit dem Leben und Werk des niederländischen Philosophen des Rationalismus.
Das E-Book Spinoza - Ein Denkerleben wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Spinoza– Ein Denkerleben
Berthold Auerbach
Inhalt:
Spinoza – Ein Denkerleben
Aus der Vorrede zur zweiten Auflage
Zum dritten Male
Zur siebenten Auflage
1. Akosta
2. Ein Freitagabend
3. Der jüdische Dominikaner
4. Die Synagoge
5. Vater und Sohn
6. Talmud und Latein
7. Der Friedenstraktat
8. Der Kabbalist
9. Der Luzianist
10. Benedictus sit
11. Ein neuer Mensch
12. Cartesianer
13. Der neue Alliierte
14. Die Hantierung
15. Das Unausgesprochene
16. Pantheismus
17. Proselyten
18. Küssen und Sterben
19. Stillleben
20. Konfessionen
21. Mikrokosmus
22. Besonderheiten
23. Missionäre
24. Der Bann
25. Freiwerben
26. Wundenmal und Abklärung
Epilog
Spinoza, Berthold Auerbach
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849603984
www.jazzybee-verlag.de
Berthold Auerbach – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 28. Febr. 1812 im Dorfe Nordstetten im württembergischen Schwarzwald, gest. 8. Febr. 1882 in Cannes, entstammte einer unbemittelten jüdischen Familie, studierte seit 1832 in Tübingen, München und Heidelberg erst die Rechte, dann Philosophie und begann früh zu schriftstellern. Von den Verfolgungen der Burschenschaft betroffen, wurde er 1837 zwei Monate auf dem Hohenasperg gefangen gehalten. In seinem ersten Roman: »Spinoza« (Stuttg. 1837, 2 Bde.), bekundete er seine Vorliebe für diesen Denker und für jüdisches Leben, offenbarte seine philosophische Grundrichtung und seinen scharfen Verstand, Eigenschaften, die auch in seinen spätern, scheinbar ganz anders gearteten Werten immer wieder hervortreten. In dem nächsten Roman: »Dichter und Kaufmann« (Stuttg. 1839, 2 Bde.; 4. umgearb. Aufl. 1860), schildert A. das bewegte Leben des Breslauer Epigrammatikers Moses Ephraim Kuh (1731 bis 1790) und gibt ein interessantes Bild von dem Leben der deutschen Israeliten des 18. Jahrhunderts. Bald ließ er eine Übersetzung der Werke Spinozas mit Biographie folgen (Stuttg. 1841, 5 Bde.; 1871, 2 Bde.). Aber den sichern Boden für sein Talent fand er erst, als er die Erinnerungen an sein heimisches Dorf im Schwarzwald zum Gegenstand ansprechender Erzählungen machte. Seine »Schwarzwälder Dorfgeschichten« (1843–53, 4 Bde.) erwarben A. seine europäische Berühmtheit vor allem durch die glückliche Schilderung des Milieus. Von einfachen Genrebildern steigt der Dichter darin zu tragischen Erzählungen empor. Zu den beliebtesten gehören »Der Lauterbacher«, »Die Frau Professorin«, »Ivo der Hajrle« und »Der Lehnhold«. Seine theoretischen Grundsätze in volkstümlicher Schriftstellerei entwickelte A. in »Schrift und Volk« (Leipz. 1846). Von ähnlicher Gesinnung erfüllt war der von ihm herausgegebene verbreitete Volkskalender »Der Gevattersmann« (1845 bis 1848), dem er später den »Volkskalender« (1858 bis 1869) folgen ließ. A., der seit 1850 in Dresden. seit 1859 in Berlin lebte, scheiterte mit seinen dramatischen Versuchen »Andree Hofer« (Leipz. 1850) und »Der Wahrspruch« (das. 1860), auch sein sozialer Roman aus der Gegenwart »Neues Leben« (Mannh. 1851, 3 Bde.) hatte wegen seiner ausgeklügelten und überdies wenig künstlerisch komponierten Handlung keinen Erfolg. Dagegen traf er mit den neuen Dorfgeschichten »Barfüßele« (Stuttg. 1856, 34. Aufl. 1902), »Joseph im Schnee« (das. 1861) und »Edelweiß« (das. 1861) wiederum den Geschmack des Publikums, und dies um so mehr, als er seine geschminkten Bauerngestalten mit Gefühlen ausstattete, die einem verwöhnten städtischen Lesepublikum entsprachen. Viel Beifall gewann das gedankenreiche Zeitbild seines Romans »Auf der Höhe« (Stuttg. 1885, 3 Bde.; 14. Aufl. 1893), auch der Roman »Das Landhaus am Rhein« (das. 1868, 3 Bde.; 4. Aufl. 1874) fand trotz mangelhafter Komposition wegen seiner reichen philosophischen Reflexionen sein Publikum. Dagegen bereitete sein nächster Roman: »Waldfried« (das. 1874, 3 Bde.), mit seinem zerhackten Stil und seiner zerfahrenen, uninteressanten Komposition größern Kreisen eine Enttäuschung. Die neuen Dorfgeschichten »Nach dreißig Jahren« (das. 1876, 3 Bde.) standen, wie die meisten Fortsetzungen, nicht auf der Höhe der ersten Sammlung, und die Erzählungen »Landolin von Reuters hösen« (Berl. 1879) und »Brigitta« (Stuttg. 1880) verraten noch mehr die abnehmende Kraft. Mit Beifall begrüßt war vorher die von Menzel, Kaulbach, L. Richter und Meyerheim illustrierte Sammlung »Zur guten Stunde« (Berl. 1872, 2 Bde.) und die »Tausend Gedanken des Kollaborators« (das. 1876). A., eine lebendige, redselige Natur, hatte am pointenreich zugestutzten Wort eine auffallende Freude; die »Schlager« und »Drucker«, die ihm reichlich einfielen, konnte er nicht unterdrücken. Seine Bauern sind nur halb echt. Kluge Berechnung und theoretische Reflexion bestimmte sein Schaffen fast mehr als die Freude an der lebendigen Vergegenwärtigung der schönen Eindrücke seiner frühen Jugend. Die antisemitische Bewegung, deren ersten Ansturm er noch erlebte, nahm er sich sehr zu Herzen. Seine »Schriften« gab er zuerst 1851–59 in 20 Bänden heraus, die neueste Ausgabe (Stuttg. 1893–95, 18 Bde.) enthält nur seine besten Romane. »Sämtliche Schwarzwälder Dorfgeschichten« erschienen 1900 in 10 Bänden. Aus seinem Nachlaß erschienen »Dramatische Eindrücke« (Stuttg. 1893). Vgl. »Auerbachs Briefe an seinen Freund Jakob A., ein biographisches Denkmal« (Frankfurt a. M. 1884, 2 Bde., mit einer Vorbemerkung von Spielhagen); Ed. Lasker, Berthold A., eine Gedenkrede (Berl. 1882).
Spinoza – Ein Denkerleben
Aus der Vorrede zur zweiten Auflage
Achtzehn Jahre sind es, seit ich dies mein erstes Buch der Öffentlichkeit übergab.
Ich erkenne es als ein hohes Glück, daß Schicksal und Bildungsgang mich in erster Jugend dahin drängten, mich in das Leben eines so erhabenen Geistes zu vertiefen; und daß mir hierzu jetzt von neuem Veranlassung geboten wurde, daß ich ein andächtiges Jugendstreben mit dem Eifer des Mannes wieder zu erfassen Gelegenheit hatte, das zähle ich zu meinen freudigsten Erlebnissen.
In dieser Empfindung habe ich das Buch nach Maßgabe meiner Kraft mit Sorgfalt durchgearbeitet.
Der große Genius hat das Recht und die Pflicht, die ersten Arbeiten seines Geistes unberührt stehen zu lassen, da sie als Denkmale seiner Entwicklungsgeschichte eine Bedeutung haben. Wir anderen sind meiner Überzeugung nach verpflichtet, den Leistungen des ersten Schaffenstriebes dadurch Berechtigung der Dauer zu geben, daß wir Gehalt und Gestalt derselben mit reiferer Erkenntnis möglichst zu vollenden und abzuklären suchen.
Möge nun der Einblick in die Lebensbedingungen und in das Walten einer solchen Menschennatur dem vorurteilsfreien Leser den Segen der Erhebung bringen und ihn zur freien Erkenntnis seines eigenen Wesens und Geschickes führen.
Ich weiß, wie viel mir dazu fehlt, um dem Meister in seinem Gange nachzugehen, aber ich nehme mir die Schlußworte seiner Ethik zum Troste:
»Alles hohe ist so schwer als selten.«
Dresden, 12. August 1854.
Berthold Auerbach
Zum dritten Male
hatte ich nun dieses Buch unter der Hand und aufs neue erkannte ich wieder die Größe der Aufgabe nicht minder, als die Unmacht, sie in dieser Form zu lösen.
Ich habe bei dieser neuen Durchsicht mehreres bestimmter abgeschlossen, da ich nicht voraussehe, wann und ob ich überhaupt noch zur Ausführung eines ehedem lang gehegten Planes komme: das fernere Leben Spinozas, nach seinem Weggange von Amsterdam, in ähnlicher Weise zu behandeln. Einige Berichtigungen verdanke ich freundlicher Mitteilung aus Amsterdam, die ich noch bestimmter werde benützen können, wenn ich, wie ich hoffe, in den nächsten Jahren die Zeit gewinne, mit der Durchsicht meiner Übersetzung von Spinozas sämtlichen Werken auch die Biographie neu zu bearbeiten.
Dresden, im Dezember 1857.
B. A.
Zur siebenten Auflage
Seit der dritten Auflage habe ich an diesem Buche nichts geändert. Auch jetzt belasse ich es in der gegebenen Gestalt.
Durch die in diesen Tagen erschienene neue Auflage meiner Übersetzung von Spinozas Werken ist mir nun auch die oben ausgesprochene Hoffnung erfüllt.
Gernsbach im Schwarzwald, 18. August 1871.
B. A.
1. Akosta
Es war an einem Freitag Nachmittage zu Ende April 1647, als in einem abgelegenen Winkel des jüdischen Friedhofes zu Oudekerk bei Amsterdam emsig geschaufelt wurde, um einen eben eingesenkten Sarg mit Erde zu bedecken. Kein Klagender stand dabei. Die Anwesenden teilten sich in Gruppen, wo man bald von Begebenheiten des Tages, bald vom Leben und Sterben dessen, der hier der Erde übergeben worden, sich unterhielt, und die am Grabe selber beschäftigt waren, sputeten sich schweigend und mit gleichgültigen Mienen; denn schon mahnte die Sonne, die sich gen Westen neigte, daß es bald Zeit sei, »das Antlitz des Sabbats zu begrüßen«. Nur zu Häupten des Grabes stand ein blasser Jüngling, der nachdenklichen Blickes die braunen Schollen in die Grube hinabwälzen sah. Mit seiner Linken zerpflückte er, ohne zu wissen, Knospen, die an dem glattgeschorenen Buchenzaune hervorkeimten.
»Junger Freund,« redete in spanischer Sprache ein Fremder den Jüngling an, »Ihr seid wohl der einzige Anverwandte dessen, der da unten ruht? Ich seh's Euch an, Ihr kanntet ihn gut, und könnt mir wohl sagen, wer es denn ist, der hier wie ein Verpesteter eingescharrt wird, ohne Trauerwort, ohne Klage, ohne Seufzer. Ich bin fremd –«
»Ich bin nicht mehr mit ihm verwandt als Ihr« – sprach der Jüngling nach einigem Zaudern – »wofern Ihr, wie ich vermute, von Israels Stamm seid. Wohl müßt Ihr fremd und von fernen Landen hergekommen sein, da Ihr das Schicksal dieses Unglücklichen, Gottverlassenen nicht kennt. O! er war groß und herrlich und wie ist er in die Grube gesunken –«
»Ich bitt' Euch,« unterbrach der Fremde, »macht es nicht wie die anderen, die ich schon befragte, als ich von der Straße aus hieher einlenkte; erzählt –«
»Kennt Ihr das Geschlecht der da Costa aus Oporto?« fragte der Jüngling.
»Wer hätte in Spanien gelebt, zu dem der Ruhm dieses Geschlechtes nicht gedrungen wäre? Die angesehensten Ritter trugen diesen Namen. Miguel da Costa, nach dessen Tode die ganze Familie aus Oporto verschwand, war einer der stattlichsten Ritter, die ich auf dem Turniere zu Lisboa gesehen; er war einst ein eifriger Anhänger unserer heimlichen Gemeinde gewesen.« –
»Der nun endlich dort seine Ruhe gefunden,« begann der Jüngling, »das war sein Sohn, und wie mein Vater oft sagte, in Gestalt und Haltung das vollkommene Ebenbild seines Vaters. Gabriel, so hieß er, war in allen ritterlichen Künsten geübt, in den Wissenschaften erfahren, besonders in der Rechtsgelehrsamkeit. Obgleich schon frühe von Religionszweifeln gemartert, hatte er dennoch in seinem fünfundzwanzigsten Jahre das Amt eines Schatzmeisters bei der Stiftskirche angenommen; da erwachte endlich in ihm der Eifer für die angestammte Religion, und er verließ mit Mutter und Brüdern das Land, wo die Gebeine so vieler ob unseres Glaubens Erschlagenen ruhen, wo Juden ohne Zahl vor Bildern knien und sie küssen, die sie –.« Hier hielt der Jüngling plötzlich inne, und horchte auf das Gespräch zweier, die am Grabe schaufelten.
»Gott verzeih mir meine Sünden,« sprach der eine, »aber ich bleibe doch dabei, der Bösewicht hätt' es nicht verdient, daß er noch am Freitag Abend begraben wird; nun ist er, weil der Sabbat eintritt, von den Qualen der ersten Verwesung erlöst. Jetzt, wenn seine Seele hinüberkommt, kommt er zum gedeckten Tisch, er braucht auch nicht alsbald in das Gehinom (die Hölle) einzuspazieren, denn am Sabbat dürfen ja alle Bösewichte von ihren Qualen ruhen; ich hab's ja gesagt, man solle ihn liegen lassen bis Sonntag Morgen wär' immer noch Zeit genug für die Bescherung, die auf ihn wartet, und am Ende verleitet er uns noch in seinem Tod dazu, ein Loch in den Sabbat hinein zu arbeiten. Drum mach hurtig, daß wir fertig werden.«
»Ja, ja,« entgegnete der andere, »der wird sich wundern, wenn er hinüberkommt, und ihn die Würgengel mit feurigen Ruten peitschen; da wird er's doch wohl glauben, daß es noch eine andere Welt gibt, was er sein Lebtag nicht einsehen wollte. Meinst du nicht auch?«
»Ich bitt' Euch, erzählt mir weiter,« sprach der Fremde.
»Ihr habt's gehört, was die da sagten,« erwiderte der Jüngling, »und der Kleine dort mit dem hohen Rücken, der jetzt so über ihn schimpft, hat viel Gutes von ihm genossen, denn seine Mildtätigkeit war ohne Grenzen. Gabriel kam hieher nach Amsterdam, unterwarf sich allen Vorschriften und trat in unseren Glauben ein. Er führte von nun an den Namen Uriel Akosta. Er befolgte eifrig was geschrieben steht: ›Du sollst darin forschen Tag und Nacht.‹ Man hat mir oft erzählt, es war rührend anzusehen, wie der stattliche Mann es nicht verschmähte, selbst von einem kleinen Jungen sich im Hebräischen und in der Heiligen Schrift unterweisen zu lassen. Aber bald ist ein unheiliger Geist in ihn gefahren, und er begann zu spotten über unsere frommen Rabbinen. Ihr habt's soeben hier gehört, daß er einer von denen war, welche die Grundlehren leugnen; er hat die Sünden seines Herzens in Schriften niedergelegt und sie noch durch das göttliche Wort begründen wollen. Rabbi Salomon de Silva, unser berühmter Arzt, hat seine Lügenlehren widerlegt. Akosta wurde in den Bann getan, er befreite sich davon durch Widerruf. Aber der Widerspruchsgeist in ihm ruhte nicht; er widersetzte sich nicht nur unserer heiligen Religion, indem er, wie sein eigener Neffe von ihm aussagte, den Sabbat entweihte und verbotene Speisen genoß, zwei Christen, die zum Judentum übertreten wollten, solches aufs höchste widerriet, sondern er sprach sich auch noch öffentlich als ein wahrer Gottesleugner gegen alle Religion aus. Sieben Jahre lang weigerte er sich, den Vorschriften unserer Religion nachzuleben, und sich der Buße, die ihm auferlegt würde, zu unterziehen. Er sollte in den großen Bann getan und auf ewig aus unserer Gemeinde ausgestoßen werden. Auf Zureden seines ehemaligen Freundes, des frommen Rabbi Naphthali Pereira, unterwarf er sich dem Ausspruch des Beth-Din (kirchliches Rabbinengericht) und trug alle die harten Strafen, die man über ihn verhängte. Mein Vater hat oft gesagt: hätte Akosta für unsere Religion in die Schlacht ziehen dürfen, er wäre freudigen Mutes für sie in den Tod gegangen; aber für sie leben konnte er nicht. – Häusliche Zerwürfnisse, die Auflösung seiner Verlobung mit einer Tochter des Josua di Leon zerrütteten seinen Geist vollends. Er hat als Testament eine Beschreibung seines Lebens hinterlassen, worin er sich zu verteidigen sucht; wenn Ihr aber in Amsterdam verweilt, könnt Ihr noch manches andere über ihn vernehmen. Schon seit langer Zeit sprach er ganz gegen seine frühere Weise fast mit niemand mehr ein Wort; man hielt es für Reue, aber er brütete auf neue Untat. Den Rabbi Naphthali Pereira mied er jetzt, denn er hielt ihn für den Urheber seiner Leiden und seines Mißgeschicks. Gestern früh, als der Rabbi aus der Synagoge heimkehrt und an Akostas Haus vorübergeht, schießt der Abtrünnige mit einer Pistole nach dem frommen Manne. Er war sonst ein guter Schütze und soll in seiner Vaterstadt deshalb berühmt gewesen sein, aber ein Engel vom Himmel muß seinen Arm erfaßt haben, denn es ist wunderbar, daß er den frommen Mann nicht beschädigte! Er scheint alles vorbedacht zu haben, denn gleich darauf ergriff er eine zweite geladene Pistole und schoß sich in den Mund, daß sein Gehirn bis an die Decke hinauf gespritzt sein soll. Darum wird er nun so ehrlos –«
»Baruch!« unterbrach hier den Jüngling eine lange Gestalt, die sich ihm näherte, »Baruch, komm, es ist alles fertig, wir wollen mit unserem Lehrer heimgehen.«
»Ich komme, Chisdai,« erwiderte Baruch, verbeugte sich vor dem Fremden und ging dahin, wo die versammelten Anwesenden das in aramäischer Sprache verfaßte Gebet für die Auferstehung der Toten und den Wiederaufbau Jerusalems sprachen. Beim Herausgehen aus dem Friedhofe raufte ein jeder dreimal Gras aus dem Boden, warf es über den Kopf hinweg hinter sich und sprach hiebei in hebräischer Sprache die Worte: »Sie sprossen aus der Stadt wie das Gras des Feldes« (Ps. 72,16.). Vor dem Friedhofe wusch man sich mit bereit gehaltenem Wasser dreimal die Hände, um sich von der Berührung der Dämonen, die auf dem Todesacker hausen, zu reinigen. Dabei mußte man den Vers (Jes. 25, 8.): »Den Tod verschlingt er auf ewig etc.« sprechen. Jetzt erst machte man sich auf den Weg nach Hause: aber auch beim Gehen mußten noch dreimal die Verse von Ps. 90, 15. und Ps. 91 gesprochen werden. Dem Brauche gemäß setzte man sich jedesmal beim Beginn der Verse auf einen Stein oder Rasen; war der erste Vers gesprochen, dann förderte man wieder betend seine Schritte. So gingen Baruch und Chisdai, ihren Lehrer Rabbi Saul Morteira in der Mitte.
»So mögen alle deine Feinde zu Grunde gehen, Herr!« (B. d. Richt. 5, 31.), sprach Chisdai endlich. »An diesem Stolzen hat sich das Strafgericht Gottes wieder in all seiner Macht offenbart. Du hast seine Büßung nicht gesehen, Baruch, auch ich wünsche, daß mein Auge nie mehr solches erschaue. Ein sündiges Mitleid regte sich anfangs in mir, bis ich reuevoll einsah, daß die Menschen verpflichtet sind, die Geißel Gottes zu schwingen. Unvergeßlich ist mir alles. Ich sehe den Abtrünnigen vor mir, wie er im weißen Sterbehemde öffentlich in der Synagoge sein Sündenbekenntnis ablas, das war nicht seine gebieterische Stimme von sonst, er trug seine Stirn nicht mehr so übermütig hoch; aber was nützte es, daß er, wie der Prophet Jesaias sagt, sein Haupt wie Schilf beugte? Und wie er dann in die Ecke geführt wurde, wie man seine Simsonsarme an die Säule festband, wie man seinen breiten Rücken entblößte, das alles seh' ich noch so deutlich vor mir, als ob es jetzt vor meinen Augen geschähe. Der Chacham stand neben dem Küster und sprach den Vers (Ps. 78, 38.): »Der Unbarmherzige vergibt Sünden, schonend wendet den Zorn er, dämpft seinen Grimm er.« Dreimal sprach er die dreizehn Worte und bei jedem Worte gab der Küster dem Abtrünnigen einen Schlag auf den entblößten Rücken. Nicht den geringsten Schmerzenslaut ließ er vernehmen, und als er die gebotene Zahl längst erhalten hatte, lag er noch immer regungslos da, sein Mund küßte den Boden, den sein Fuß zu betreten sich geweigert hatte. Endlich wurde er wieder angekleidet und an den Ausgang der Synagoge geführt; dort unter der Tür mußte er hinknieen, der Küster hielt ihm den Kopf, und ein jeder, der aus der Synagoge ging, setzte den Fuß auf seinen mit Schwielen besäten Rücken und schritt über ihn weg; ich machte mich schwerer als ich auf ihm stand, daß er meinen Tritt auch fühle. Ich sage dir, es ist schade, daß dein Vater gerade jenen Tag mit dir verreist; ich sah ihn dann, wie er, da alles fort war, sich aufraffte, nochmals in die Synagoge zurückging, die heilige Lade stürmisch aufriß und lange hinstarrte auf die Gesetzesrollen, bis ihn der Küster ans Weggehen mahnte. ›Sind mir die Himmelstore jetzt wieder offen?‹ fragte er, und mir war's, als ob er ein gellendes Gelächter dabei ausstieße. Er hüllte sich in seinen Mantel und schlich nach Hause. Gottes Wege sind gerecht! Er ist in die Grube gefallen, die er anderen gegraben. So müssen sie alle zu Grunde gehen. Er ist verloren hier und dort.« Chisdai schielte nach seinem Lehrer, um aus seinen Mienen den beifälligen Lohn für seinen heiligen Eifer zu lesen; dieser aber schüttelte nachdenklich den Kopf und sprach noch leise das Gebet vor sich hin.
Baruch hatte schon zweimal den Mund geöffnet, um seinem Mitschüler zu antworten; doch in der Furcht, er könnte den Sünder aus Mitleid mit seinem Schicksale zu warm verteidigen, hatte er geschwiegen. Als er aber jetzt das Mißfallen seines Lehrers wahrnahm, sprach er ermutigt: »Du scheinst das Beispiel der Frau des Rabbi Mejir nicht nachahmen zu wollen.« – Er deutete hiemit auf jene Erzählung im Talmud, wo die Frau in dem Verse (Ps. 104, 35.): »O daß die Sünder von der Erde vergingen, auf daß die Gottlosen vernichtet wären,« das Wort »Sünder« in »Sünden« verwandelte – und fuhr dann fort: »Wo gibt es einen Gerechten auf Erden, der nur Gutes tue und nicht sündige? (Pred. 7, 20.) Auch ich verabscheue jene Lehren, die den wirren Uriel verleiteten –«
»Du darfst seinen Namen nicht mehr nennen, er ist ausgelöscht,« unterbrach Chisdai und Baruch fuhr fort: »Er hat seine Lehre selbst damit verworfen, da sie ihn zum Selbstmorde führte. Da er noch lebte, haben ihn die Menschen gerichtet; nun er tot ist, darf nur Gott ihn richten.«
Der Rabbi nickte Baruch zu, ohne ein Wort zu sagen, da er noch immer mit dem Sprechen des Psalmes beschäftigt war.
»Es steht ja aber auch geschrieben,« sprach Chisdai trotzig (Spr. 10, 7.): »Der Name der Gottlosen soll verfaulen.«
Lautlos gingen die Drei noch einige Minuten nebeneinander, ein jeder von eigentümlichen Gedanken bewegt. Endlich brach der Lehrer sein Schweigen und erklärte, daß das offenbarte Gesetz keine Abtrünnigkeit dulde; denn darum habe es Gott mit seinem Finger geschrieben und uns überliefert, daß wir alle danach leben. Wer nach den Eingebungen seiner Vernunft leben zu können vermeint, leugnet damit die Notwendigkeit der Offenbarung, leugnet ihre Wahrheit und verhöhnt somit das Gesetz, das ihn treffen muß. »Es gibt wohl Menschen,« schloß der Rabbi, »die da sagen: Laßt jeden denken und glauben, wie er's vor sich verantworten kann – diese sind selbst, ohne daß sie es wissen, abgefallen. Wir dürfen niemand, der in unserm Glauben geboren ist, seinem Verderb überlassen, der auch unser Verderb sein würde. Können wir ihn mit Worten zu Reue und Buße zurückführen, singen wir Hallelujah; bleibt er verstockt und widerspenstig, so zerreißen wir unser Kleid: er ist tot, er muß sterben oder den Satan in seinem Herzen töten. Wir zwingen ihn mit aller Macht, die uns Gott gegeben.«
»Man zwingt ihn, bis er sagt: ich will,« schaltete hier Chisdai aus dem Talmud ein und der Rabbi fuhr fort: »Können wir den Lügengeist nicht von ihm trennen, so vertilgen wir ihn selbst mit samt seinem Satan. Wo kein Wort mehr ausreicht, hat uns der Herr den Stein gegeben um zu steinigen. Laßt euch nicht verleiten von denen, die jetzt weichen Herzens sind über das Ende des Abtrünnigen dort und mitleidig sagen: man hätte ihn schonen, ihn nicht so weit treiben sollen. – Es ist ihm wohl geschehen, daß er nicht länger sündigen durfte.«
Es mußte sich eine eigentümliche Gedankenfolge in Baruch gebildet haben, denn er fragte nach einer Pause: »Wo ist in der Heiligen Schrift der Selbstmord verboten?«
»Was das wieder für eine Frage ist!« antwortete der Rabbi mürrisch und Chisdai setzte hinzu: »Es heißt ja im sechsten Gebote: du sollst nicht morden – Ohne Beisatz, und das heißt weder einen anderen noch dich selbst.«
»Du kommst heute wieder auf seltsame Querfragen,« sagte der Rabbi meisternd zu Baruch. Dieser konnte nicht erklären, was ihn bewegte. Der Fremde hatte ihn aus schweren Gedanken herausgerissen, als er am Grabe des Ketzers stand und in die Grube hineinstarrte, darein man den Leib versenkte; es war ihm, als ob man seinen eigenen Körper versenkte und sein Geist irrte fragend und klagend durch die Welt: ist das des Abirrenden Los, daß man ihn in den Abgrund stößt? Wer kann einer fremden Seele gebieten, wer seiner eigenen, daß sie den Weg innehalte, der vorgeschrieben ist? Wie unzerstörbar muß in dem Eingescharrten sein Denken gewesen sein, daß er um seinetwillen anderen den Tod zu geben trachtete und sich selber den Tod gab? Wer darf hier richten und verdammen?
Die Ansprache des Fremden hatte solch schweres Sinnen unterbrochen, die Worte des Rabbi auf dem Heimwege hatten aufs neue den scharfen Gegensatz erweckt und jetzt tauchte eine Erinnerung in der Seele des Jünglings auf: Vor Jahren, als er hier zum ersten Male unter den Grabhügeln gestanden, hatte tiefe Wehmut das Herz des Knaben beschlichen. Man begrub damals den Oheim Immanuel, der immer krank und an das Haus gebannt, sich viel mit den Kindern abgab und sie zu Boten seiner Wünsche an die Außenwelt machte. Als nun alle Leute den Friedhof verlassen hatten, der eine in die Schule, der andere nach dem Hafen oder auf die Börse und wieder andere nach ihren Werkstätten und Kaufläden gingen, und drinnen in der Stadt sich das laute Getümmel fortbewegte, als wäre nichts geschehen, da erzitterte das Herz des Knaben, denn die Frage regte sich in ihm: wie kann alles so ununterbrochen fortbestehen, da ja der Oheim nicht mehr zu Hause ist? Stundenlang weinte der Knabe im öden Zimmer des Verstorbenen, dessen Fenster alle weit offen standen wie noch nie, und er schalt über die Leute, die den kranken Mann da draußen liegen ließen und taten, als ob man von gar keinem Oheim wüßte. Die Mutter – denn dem Vater durfte er solches nicht klagen – suchte ihn zu beruhigen und ihm zu erklären, daß der Oheim nicht mehr allein und nicht mehr krank sei, vielmehr gesund und wohlauf droben bei Gott und allen seinen Vorfahren und allen guten Menschen. Der Knabe konnte das nicht fassen und schrie immer: Ja, du hast's nicht gesehen, sie haben ihn in eine tiefe Grube hineingelegt und viel große Erdschollen auf den Schrein geworfen, in dem er geschlafen hat; er ist gewiß aufgewacht und jetzt kann er nicht mehr heraus. Die Mutter suchte dem Knaben zu erklären, daß nur der Körper begraben, die Seele aber bei Gott sei. Der Knabe ward beruhigt, wochenlang mußte er aber bei Sturm und Wetter noch oft plötzlich daran denken: Wie geht es jetzt wohl dem Oheim draußen in der Erde? ...
Seitdem hatte er am Grabe der Mutter gestanden und sich ihrer trostreichen Lehre erinnert. Heute aber am Grabe Akostas waren jene Erinnerungen von der Beerdigung des Oheims aufs neue in ihm erwacht. Den Abgefallenen, den man hier einscharrte, hatte sein Leben lang jenes Schmerzgefühl nicht verlassen, das das Herz erzittern macht.
Wie kommt es, daß Kindern und Abgefallenen sich dieselben Fragen aufdrängen? Ist es, weil die einen noch nichts wissen von den offenbarten Lehren und die anderen sie freiwillig abwerfen und aus sich selbst die Fragen zu lösen vermeinen? Wer darf strafen wegen solchen Ringens? ...
»Sei nicht allzugerecht und klügle nicht allzusehr, warum willst du verderben?« Diesen Vers aus dem Prediger Salomos (7,17.) sprach sich Baruch im Innern vor und war still.
Man war am Hause des Rabbi angelangt und dieser erinnerte seine Schüler mit bedeutungsvoller Miene, daß morgen der sechste Jjar sei. Man trennte sich, ein jeder begab sich nach Hause, um noch rasch die Kleider zu wechseln und in die Synagoge zu eilen. –
In die offene Erde fällt das Samenkorn, eine Scholle zerbröckelt und deckt es zu, und niemand gedenkt wie es keimt und Wurzel schlägt, dem forschenden Auge verborgen. Wohl mag auch das Menschenleben solch verhülltem Wachstum gleichen, und seine Gesetze sind noch minder offenbar; nur das Gewordene läßt sich fassen, nicht das Werden selbst, die Forschung vermag nur, immer mehr Absatzpunkte in diesem zu erkennen.
Und wiederum erwächst keine Frucht als solche aus einer anderen, das Samenkorn muß die Wandlungen des Lebens erneuen, muß keimen und sprossen, Halm, Strauch und Baum werden, um siebenfältig und hundertfältig die Frucht zu erzeugen, die allzeit das Leben neu nährt.
2. Ein Freitagabend
In dem Eckzimmer des hohen Hauses mit den großen Bogenfenstern und der reichen Stukkaturarbeit, das auf dem Burgwall unweit der Synagoge stand, herrschte an jenem Abend eine ungewöhnliche Pracht und Lichtfülle. Die silberne in der Mitte des Zimmers hängende Lampe, deren seltsame Arabesken sonst mit Flor umhüllt waren, glitzerte hell im Widerschein der sieben Lichter, die kreisförmig an ihr brannten. Sie hatten der Herrlichkeiten noch gar viele zu beleuchten: die Polster der kunstreich geschnitzten Sessel hatten die werkeltägigen grauen Überzüge abgestreift und boten die Farbenpracht ihrer gold- und seidengestickten Blumen und Vögel dem Auge des Beschauers, so daß man dem bunten Teppiche, der auf dem Boden ausgebreitet lag, kaum einen Blick widmen mochte. Die glänzenden Trinkschalen und Gläser, die in gleichmäßiger Ordnung auf den Schränken standen, spiegelten das Licht in mannigfachen Strahlenbrechungen zurück. Vom Ofen her durchwürzte ein leiser Duft von Sandelholz das ziemlich geräumige Zimmer, in dessen Mitte, gerade unter der Lampe, ein runder Tisch stand. Er war mit rötlich geblümten Linnen bedeckt, die silbernen Becher und Krüge schienen einer kleinen, heitern Gesellschaft zu harren. An der Wand gegen Osten hing ein auf vergilbtem Pergament gezeichnetes Bild, und darüber standen mit goldenen Buchstaben die hebräischen Worte: »Von dieser Seite weht der Hauch des Lebens.« Ein vom Alter gebräunter Rahmen umschloß die halbverwischten Umrisse, aus denen jedoch das Bild einer alten Stadt noch erkenntlich war; darunter stand in hebräischer Sprache: »Und die übrigen Völker um euch her sollen erfahren, daß ich der Herr bin, der da bauet was zerstöret, und pflanzet was verheeret war. Ich der Herr sage es und tue es auch.« (Hes. 36, 36.) Es war die alte Gottesstadt Jerusalem, und wohl manches Auge, das längst vermodert im dunkeln Schoß der Erde, hatte in Tränen der Trauer oder mit dem Freudenblitze der Sehnsucht auf diesem vergilbten Pergamente geruht. – Sonst war kein Bild zu schauen innerhalb der vier Wände, die mit reichen Tapeten geschmückt waren. Auf der Ottomane ruhte eine jugendliche Mädchengestalt: das runde Köpfchen nachlässig auf die Rechte gestützt, deren Finger sich in den kunstlos herabwallenden schwarzen Locken verloren, lag sie unbeweglich da; vor ihr war das Gebetbuch aufgeschlagen, ihr Auge schweifte über dasselbe hinweg und starrte vor sich hin. War's Andacht, war's der Gedanke an Gott, in dem ihre Seele ruhte? war's eine holdschimmernde Erinnerung, die vor ihr auftauchte, oder sind's traumhafte Bilder der Zukunft, die sie umgaukeln und jenes engelhafte Verlangen um die Rosenlippen legen und den Pulsschlag des Herzens verdoppeln? Oder ist es jenes unbewußt selige Traumwachen, welches das Mädchen, das zur Jungfrau reift, so oft überrascht und namen- und gegenstandloses Verlangen in ihm erregt? – Sabbatliche Stille ruhte auf der ganzen märchenhaft gestalteten Umgebung. –
»Ich glaub's, daß du müd bist, Miriam, ist gar kein Wunder,« ließ sich eine näselnde Stimme vernehmen, indem sich die Tür öffnete. Miriam sprang hastig auf, strich die Haare aus der Stirn, küßte inbrünstig das Gebetbuch, legte es auf das Fenstersims, und lockerte schnell die Ottomane wieder auf.
»Nun? was ist das für ein Schreck? Meint einer es käm' eine Hex. Es ist wahr, man kann an mir erschrecken wie ich ausseh'; hab' noch nicht Zeit gehabt meine Schmutzkleider auszuziehen. Das heißt aber auch einmal geschafft.« So sprach die alte Chaje, und in der Tat, ihr ganzer Aufzug konnte zu der Bezeichnung, die sie sich selber beilegte, auffordern. Eine in Rauch gebräunte Haube bedeckte ihre grauen Haare genugsam; nur einzelne lockere spannen sich vorwitzig wie Herbstfäden über das runzlige Gesicht herab; ein Kohlenstreif auf der linken Wange bis über die Hälfte der Nase war von Miriam bemerkt worden, und Chaje war eben vor dem Spiegel damit beschäftigt, denselben abzuwischen. »Du hast ganz recht getan,« fuhr sie fort, während sie sich mit ihrer Küchenschürze abtrocknete, »du hast ganz recht, daß du dich ein bißchen niedergelegt hast. Wozu steht das Ding das ganze Jahr da und wird nicht gebraucht? Ich wollt', ich könnt' mich jetzt gerad ins Bett legen, ich wollt' gar nichts zu Nacht essen, so müd bin ich; ja, wenn man bald achtzehn Jahr in einem Dienst ist, spürt man die Strapazen, sie setzen sich nicht in die Kleider. Du wirst auch müd sein, zehnmal rauf und runter, alles selbst ausräumen, dem Fremden sein Bett zurecht gemacht, es ist keine Kleinigkeit; jetzt ist aber auch alles proper, er wird sich verwundern. Wie gut ist es, daß du den Fisch noch gekauft hast. Wein, Fisch und Fleisch, das hat der Arme unter den Armen jeden Sabbat; ohne Fisch ist kein rechter Sabbat, es steht ja auch in der Thora. Du bist eine so gute Hauswirtin, daß du bald heiraten darfst; du ladst mich doch auch zur Hochzeit? Mach nur, daß du keinen solchen kleinen Schlemiehl bekommst wie deine Rebekka. – Hast du gesehen, wie der Baruch heut wieder aussieht? Als ob er schon zehn Jahr unter dem Boden gelegen hätt'. Ich fürcht', ich fürcht', das viele Lernen kann ihm, Gott bewahre! an seiner Gesundheit schaden. Tag und Nacht nichts als Lernen und Lernen, wo soll das hinaus? Mein Bruder Abraham hat einen Sohn gehabt, der war so gescheit wie Ristotles, der hat auch zuviel gelernt, bis er sich am Ende ganz hintersinnt hat. Doch still, ich glaub' die Synagog ist schon aus, ich muß gehen, ich darf mich vor keinem ehrenhaften Judenkind sehen lassen wie ich daherkomme, sie kommen schon die Stieg herauf« – und hiemit huschte sie zur Türe hinaus.
Miriam war froh, die leidige Schwätzerin los zu sein. Ihr Vater, der Fremde, den wir auf dem Friedhofe mit Baruch im Gespräche gesehen haben, und Baruch selbst traten ein. Miriam ging ihrem Vater entgegen, neigte sich vor ihm, und dieser legte beide Hände auf das Haupt seiner Tochter und segnete sie leise mit den Worten: »Der Herr mache dich gleich den Erzmüttern Sara, Rebekka, Rahel und Lea!« Auch seinen Sohn Baruch segnete er und sprach dabei leise: »Der Herr mache dich gleich Ephraim und Menasse.« (Gen. 18, 20.) Der Vater und Baruch stimmten einen kurzen Gesang an, worin sie die Schar der Engel begrüßten, die jedesmal am Sabbat ins Haus des Juden einziehen. Der Ton des Vaters klang wehmütig, als er hierauf in üblicher Weise mit dem Sohne das Frauenlob (Spr. Sal. Kap. 31, Vers 10) »Wer ein tugendhaftes Weib gefunden« sang. Die Schönheit und der wohlgeordnete Friede des Hauses war noch wie ehedem, die Hausfrau hatte ihm Bestand gegeben, sie selber aber war ihm durch den Tod entrissen. Doppelt schmerzlich war ihr Gedenken in der Freude des Sabbats.
Der Fremde betrachtete das an der Wand hängende Bild.
»Kennst du es noch, Rodrigo?« sagte der Vater, nachdem er die leisen Gebete beendigt, »es ist ein altes Erbstück und hing einst in unserer Kellersynagoge zu Guadalajara; ich habe es mit vieler Gefahr gerettet.«
Während die beiden nun von ihren ehemaligen Zusammenkünften sprachen, standen Baruch und Miriam am anderen Ende des Zimmers.
»Du machst ja heute wieder ein entsetzlich finsteres Gesicht,« sagte Miriam und strich dem Bruder mit zarter Hand die Haare aus der Stirn; »da komm an den Spiegel.« Baruch faßte die Hand der Schwester und hielt sie fest, er sprach kein Wort und lauschte mit Miriam auf das Gespräch der Männer.
»Das ist eine Fügung Gottes, wofür ich ihm ewig danke, daß ich dich sogleich beim Vorübergehen erkannte,« sagte der Vater zu dem Fremden; »also du kennst meinen Baruch schon? Siehst du, das ist meine jüngste Tochter. Wie alt bist du jetzt, Miriam?«
»Nur ein Jahr jünger als Baruch,« antwortete das Mädchen hocherrötend.
»Närrische Antwort,« sagte der Vater. »Sie ist, glaub' ich, vierzehn Jahr alt. Ich habe noch eine ältere Tochter, Rebekka, die hier verheiratet ist.«
»Nun, meine Lieben, auch ich habe zwei Kinder,« sprach der Fremde, »meine Isabella ist ungefähr so alt als du, Miriam, mein Sohn wird jetzt zwanzig Jahre alt. Ich hoffe, wenn meine Kinder hieher kommen, ihr nehmt euch ihrer an, besonders was unsere heilige Religion betrifft, denn darin sind sie noch unerfahren. Aber hör einmal,« fuhr der Fremde fort, indem er sich mit verschränkten Armen vor Baruch hinstellte. »Wenn ich mir deinen Baruch jetzt betrachte, ist es mir unbegreiflich, daß ich ihn nicht gleich auf dem Friedhof erkannte: diese eigentümliche Bräunlichkeit der Gesichtsfarbe, diese langen, etwas finster hereingezogenen schwarzen Brauen, ganz wie du in deinen jungen Jahren, wenn du auf einen abenteuerlichen Streich sannest, auch diese Falte auf der unebenen Stirne, das bist ganz du; dagegen die gekrausten schwarzen Haare, die feingeschnittenen Lippen mit den sanften Anlagerungen um die Mundwinkel, o! wie himmlisch süß Manuela mit diesen Lippen lächelte. Ein gewisser kühner Trotz, der aus dem Angesichte spricht, alles das gibt ihm ein teilweise moriskisches Ansehen, das hat er von seiner Mutter; ach! wenn die noch lebte, was hätte sie für eine Freude, mich jetzt hier zu sehen.«
Baruch hörte die Schilderung seiner selbst unwillig und fast zitternd mit an. Als er nun gar von seiner halb moriskischen Abstammung hörte, erinnerte er sich wieder, daß Chisdai ihn in der Schule damit geneckt; er zürnte seinem Vater, der ihm noch nie etwas davon mitgeteilt hatte. Dieser merkte die Verlegenheit seines Sohnes und sagte zu dem Fremden: »Du kannst es nicht verbergen, Rodrigo, daß du ein Schüler von Silva Velasquez bist und am Hofe Philipps den Damen die Schönheiten und Häßlichkeiten anderer ausdeuten halfst. Baruch, du mußt morgen deine Zeichnungen dem Herrn vorlegen. Sei nur nicht so bang, es ist dir ja nichts geschehen.«
»Nein, nein,« sagte der Fremde, indem er dem Jüngling die Wange streichelte, »ich hoffe, wir werden gute Freunde. Hast du meinen Vetter, den gelehrten Jakob Casseres, nicht gekannt?«
»Ihn selbst nicht,« sagte Baruch, »aber sein Buch: ›Die sieben Tage der Woche bei der Weltschöpfung› kenne ich.«
Man hatte sich zu Tische gesetzt, den Segen über Wein und Brot gesprochen und den Sabbat eingeweiht.
»Es ist doch sonderbar,« sagte der Hausvater nach dem Schlußgebete, »sonst, kaum hab ich den letzten Bissen hinunter, kann ich nicht erwarten, bis ich die brennende Zigarre im Munde habe; aber am Sabbat, es ist gerade, als ob unsere Neigungen andere geworden wären, da fällt mir's gar nicht ein zu rauchen und es kostet mir gar keine Mühe, das Verbot nicht zu übertreten.« Der Fremde erwiderte nichts darauf. »Lieber Gott, jetzt bemerk' ich's erst,« fuhr der Vater fort, »du hast noch die vaterländische Sitte, den Wein mit Wasser zu vermischen. Bleib nur bei uns im nebligen Norden, hier auf dem Grunde, den man gewaltsam dem Meere abgerungen und stündlich dagegen wahren muß, wo während der Hälfte des Jahres die Erde erstarrt und des Himmels blau Gezelt stets von Wolken umlagert ist, wo du statt einer von Wohlgerüchen durchwürzten Luft Feuchtigkeit und Dünste einatmest, hier in unserer Stadt, wo kein Brunnen quillt und man das Wasser zum Trinken aus der Ferne holen muß, wo man sich allzeit gleich dem Boden vom Meere gefangen vorkommt; wo das Klima selber den Menschen so ruhig und gelassen macht, und Vorsicht und Geduld, die den Boden des Landes geschaffen haben und erhalten, auch die Haupttugenden der Menschen sind; bleibe nur hier, glaub mir, du gewöhnst dich auch an die Sitte, in dein träges und alterndes Blut lauteres Traubenblut zu gießen und es rascher rollen zu lassen. O! es ist ein liebliches und prächtiges Land unser Spanien, ein Eden, aber von Teufeln bewohnt. Jetzt, da ich bald mein müdes Haupt in den Schoß der Erde legen muß, jetzt erst fühle ich, daß hier nicht der heimische Boden ist, der mich aufnimmt.«
»Du wirst ungerecht,« entgegnete der Fremde, »nun du hier sorglos an deinem Tische sitzest und nicht fürchten darfst, dein Freund oder gar dein einen Kind könnte morgen mit reuigem Gemüte beichten, daß du insgeheim den Gott Israels verehrst, und es könnte dann die Glut des Scheiterhaufens statt wie jetzt des köstlich perlenden Weines deine alten Glieder erwärmen, nun denkst du nur noch der Freuden des Vaterlandes und vergissest des jammervollen Greueltodes, der uns überall anstarrte; uns sollten die prächtigen Kastanienwälder mit ihren dunkeln Schatten nicht zur Ruhe und die reichen Forste nicht zur fröhlichen Jagd einladen, morgen konnten jene Bäume unsere Scheiterhaufen, morgen konnten wir das gejagte Wild sein. Wahrlich, wenn ich dich so reden höre, könnte ich jenen Eiferern fast beistimmen, wenn sie die Schuld all der Qualen, die uns erreicht, dem allein beimessen, weil wir unser Vaterland zu sehr geliebt, zu vergnüglich und stolz im dort erlangten Ansehen uns gefielen.«
»Ja, ja, du hast recht,« entgegnete der Vater, »aber laß uns die Freude des Wiedersehens nicht durch trübe Betrachtungen stören; komm, trink; doch nein, Miriam hol die venetianischen Gläser dort her, laß dir von Elsje in den Keller leuchten, und bring die zwei Flaschen, die mir de Castro unlängst geschickt hat.«
»Herrlich,« sagte der Fremde, als er das Glas des neu aufgetischten Weines an den Mund gebracht hatte, »das ist ja echter Val de Pennas, wo hast du den her?«
»Wie ich dir sagte, Ramiro de Castro hat mir ihn von Hamburg aus geschickt; der Wein hat mit uns geblüht, er ist aber mit der Zeit feuriger geworden, und wir –?«
»Nun, wir haben auch gelebt; sei zufrieden. Der Wein weckt die alten längst verrauchten Geister wieder in mir; weißt du noch? Solchen Wein tranken wir an jenem Abend in der Posada neben dem Hause der Donna Ines, die dich schon seit zwei Abenden vergebens harren ließ; du schlugst auf den Tisch und schworst, sie nie wieder zu sehen, und den anderen Abend hieß es in der verschwiegenen Laube: lieber Alfonso und liebe Ines, ha! ha! ha!«
Der Vater ermahnte seinen Gastfreund leise, doch Rücksicht auf die Kinder zu nehmen; der Fremde aber achtete nicht darauf und ergötzte sich an dem vaterländischen Weine.
»Denkst du noch jener himmlischen Sommerabende,« fuhr er dann fort, »als wir auf der Almeda in Guadalajara umherschlenderten? Ich seh' dich noch, wenn um neun Uhr das Glöckchen läutete und alles wie bezaubert still stand, um ein Paternoster zu beten; ich seh' dich noch vor mir stehen, wie du deinen Hut in der Hand zusammenknitterst, deine Augen sprühten Feuer, als wolltest du die ganze Welt in Flammen setzen und nicht nur Donna Ines allein, du warst stets ein gefährlicher Caballero. Gott im Himmel!« fuhr der Fremde fort, nachdem er noch einen guten Zug Weines genommen, »mir steht noch der Angstschweiß auf der Stirne, wenn ich daran denke, wie wir einst in Toledo vor der Kirche Unserer Frau del Transito standen: siehst du, sagtest du zähneknirschend, das prachtvolle Gebäude, das war einst eine Synagoge unserer Vorfahren. Samuel Levi, der sie erbaut hat, ist am Galgen verfault, und jetzt – es ist em wahres Wunder, daß wir bei deinem übermütigen Geiste immer mit heiler Haut davongekommen sind.«
So ergingen sich die beiden Freunde in Jugenderinnerungen; in einer Stunde lebten sie noch einmal ein Leben voll Liebeslust und Jugendmut.
»Ich kann nicht begreifen,« sagte Baruch einmal, »wie man nur eine Minute glücklich sein kann in einem Lande, wo man stets Verrat und Schmach und Tod um sich her sieht.«
»Darum bist du eben noch zu jung,« sagte der Fremde. »Glaub mir, und belauscht man jeden deiner Atemzüge, es gibt Stunden, ja Tage, wo du fröhlich sein und alles vergessen kannst; und stößt man dich in Schmach, und wirft man dich und die Deinigen in den Kot – ein Allerheiligstes gibt's, wohin keine Erdenmacht reicht, es ist das eigene Bewußtsein und der trauliche Kreis der Unsrigen, der Himmel, der sich uns dort erschließt, den kann uns niemand rauben, selbst das ewige Schreckbild des Todes nicht. Alle diese Qualen sind über uns gekommen, und doch waren wir glücklich.«
»Aber der unaufhörliche Zwiespalt in der Seele? Christ vor der Welt und Jude im Herzen?«
»Das war unser Unglück, das sah ich an deinem Oheim Geronimo.«
»Warum verläßt der nicht seine finstere Klause und kommt zu uns herüber?« fragte Baruch.
»Er hat seine Klause verlassen und wir kommen zu ihm. Er ist tot. Junge, diese Leidensgeschichte hättest du mit erleben sollen, es käme dir zu gute fürs ganze Leben.«
Baruch hatte sich von seinem Sitze erhoben und leise den bei einer Todeskunde vorgeschriebenen Spruch gesagt: »Gelobt seist du Herr unser Gott, König der Welt, wahrhaftiger Richter.«
»O erzählt, ich bitt' Euch,« sprach er dann; auch Miriam rückte näher an den Tisch und vereinigte ihre Bitte mit der des Bruders.
»Es ist heute Sabbat und ich sollte nicht,« sagte der Fremde; »doch weil ihr so sehr bittet, so sei es; ist es ja sein Tod, der mir die Entschlossenheit gab, mich und die Meinen mit Gottes Hilfe aus der Lüge zu retten.«
3. Der jüdische Dominikaner
Rodrigo Casseres nahm noch einen vollen Zug aus seinem langen Glase und erzählte: »Es werden jetzt ungefähr acht Monate sein, als ich durch Philipp Capsoli einen Brief aus Sevilla erhielt; ich erschrak schon als ich die Aufschrift las: ›An Daniel Casseres in Guadalajara.› Das konnte wieder nur ein unvorsichtiger Jude sein, der mich bei meinem jüdischen Namen nannte; wie erzitterte ich aber erst über den Inhalt des Briefes: ›Daniel, Mann des Gefallens,› hieß es darin, ›der Tag der Rache und des Todes ist da; ich will sterben mit den Philistern. Hei! sie sollen spüren wie's tut, wenn man bratet; komm zu mir; ich bin von heiligen Schergen bewacht. Bei dem Namen des allerheiligsten Gottes, bei der Asche unserer gemordeten Brüder und Schwestern beschwöre ich dich, komm zu deinem sterbenden Geronimo de Espinosa.‹ – Es war kein Zweifel, Geronimo selbst hatte den Brief geschrieben; der feine wagrechte Strich, das Zeichen der Verehrung des einzigen Gottes unter seiner Namensunterschrift, zeigte mir das vollkommen, wenn ich gleich die zitternde Handschrift nicht als die seinige erkannte. Ich eröffnete meinen Kindern den Entschluß, nach Sevilla zu reisen; ich war so schwach, mich durch ihre Bitten und Tränen von der Ausführung abhalten zu lassen. Ich hatte den armen Geronimo fast ganz vergessen, als mich einst ein schaudervoller Traum an ihn erinnerte, und des anderen Tages war ich auf der Reise. Ich trennte mich mit beklommenem Herzen von meinen Kindern, denen ich gesagt hatte, ich reiste nach Kordova zu meiner Schwester. Ich zog durch Kordova und schlich mich unbemerkt an dem Hause meiner Schwester vorüber; nirgends konnte ich ruhen noch rasten, es war als ob eine unsichtbare Hand mich unaufhaltsam fortdrängte. Ich kam nach Sevilla. Eben läutete das Glöcklein zur Hora als ich den Trianenberg hinanstieg. Dort weilst du, glühender Geronimo, sprach es in mir, und förderst deine Schritte zur Kapelle; hast Gebet auf den Lippen und Fluch im Herzen. Hieß es nicht Gott versuchen, da du, im Innern ein Jude, dich hineinwagtest mitten in den Rat der Inquisition, um so deinen Brüdern zu helfen? – Ich trat in die Kapelle und kniete nieder, bis die Messe beendigt war. Ich richtete mich auf und betrachtete die fetten und die abgehärmten Klosterbrüder genau; in keinem erkannte ich Geronimo. Ich fragte einen Familiaren nach ihm, er sagte, schon seit Wochen läge Geronimo zwischen Leben und Tod und spräche stets mit Daniel in der Löwengrube. Er führte mich in seine Zelle. Mit abgewandtem Gesichte schlummerte der Kranke, nichts als ein kahler Schädel war zu schauen; ein Kruzifix hing über seinem Bette und neben ihm saß ein betender Klosterbruder, der mir zuwinkte, ich möge leise auftreten. Nur das mühsame Atemholen des Kranken und ein leises Geflüster des Betenden zeigte von Leben in dieser Grabesstille. Endlich richtete sich der Kranke auf, ich erkannte ihn nicht: diese tiefliegenden Augen und hohlen Wangen, diese blassen Lippen vom lang herabwallenden weißen Bart umflossen, so konnte sich das Ansehen Geronimos nicht verändert haben; er erkannte mich aber alsbald, und leise, kaum die Lippen bewegend, sprach er: ›Bist du noch da, Daniel? Das ist schön, daß du mich nicht verlassest; brauchst dich nicht zu fürchten, bist auch in der Löwengrube, aber Gott hilft dir heraus wie unserem Propheten zu Babel; nur mir haben sie Blut und Mark ausgesogen, ich kann nicht hinaus. Nicht wahr, du gehst nicht von mir?‹
Ich hatte gefürchtet, der Augenblick des Wiedersehens würde vielleicht seinen Tod beschleunigen; ich konnte kaum begreifen, wie er tat, als ob wir längst beisammen, ja als ob wir nie getrennt gewesen. Er winkte dem betenden Bruder neben ihm und dieser nahm sein Buch unter den Arm und ging. Beim Hinausgehen sagte er mir aber noch leise ins Ohr, daß ich, wenn es zu arg würde, dort an der Klingel läuten könnte.
›Ist er fort?‹ sagte nun Geronimo, ›komm, gib mir schnell die Pechkränze, die du unter deinem Mantel hast, ich will sie hier verbergen in meinem Bett. Heute nacht, wenn sie alle schlafen, zünden wir ihnen das Nest über dem Kopfe an; das wird eine lustige Opferflamme sein, die Engel im Himmel sollen drob lachen; ich bin gebunden, ich kann nicht hinaus. An allen vier Enden muß man's zugleich anzünden: wir müssen eilen, sonst steigt der Quadalquivir von selbst aus seinem Bette und löscht die Flamme auf der Burg, sie haben ihn im Solde. Hilf mir, das Wasser reicht ans Leben. Herr Gott! ich habe gesündigt, ich habe deinen heiligen Namen verleugnet; du hast ja sonst dich gezeigt in Wundern, sende deinen Blitz, daß er sie vertilge, mich auch, mich zuerst, ich habe gesündigt, vertilge mich.‹
So sprach er schnell, und dabei schlug er sich mit seinen knöchernen Fäusten auf die Brust, daß es dröhnte; ich konnte ihm nicht wehren, er sank fast atemlos zurück; ich fürchtete, daß er jetzt verscheide, und wollte eben an der Klingel läuten, da richtete er sich plötzlich wieder auf und weinend sprach er: ›Komm, gib mir deine Hand, sie ist rein, rein vom Blute deiner Brüder; es war des Satans Eingebung, daß ich Wurm den Riesenbaum zu zernagen trachtete. Ich büße für meinen Stolz, ich habe meinen Gott verleugnet, ich sterbe nutzlos, wie ich nutzlos lebte. Siehst du nicht meinen Vater dort? er kommt auch uns zu helfen; so, du hast Pechkränze genug, Vater. Hörst du die Gefangenen drunten Hallelujah singen? Ah, das ist ein schöner Gesang, Hallelujah Hallelu El. Wir befreien euch, ihr dürft sterben. Seht mich nicht so grinsend an, ich bin nicht schuld!‹ – Er sank wieder zurück und stierte mich mit unheimlich gläsernem Blicke an. Ich bat ihn um Gottes und unserer selbst willen, ruhig zu sein; ich erzählte ihm, wie ich hergekommen sei, seinem Briefe Folge leistend; er solle ruhig sein, er habe viel Menschenleben gerettet, und Gott sei auch gnädig und verlange nur das Herz.
Mit vollem Bewußtsein redete er sodann mit mir von seinem nahen Tode, und wie er sich dessen freue; ein gewaltiger Tränenstrom enthob seine Seele der schweren Pein, die auf ihr lastete; doch plötzlich riß wieder alles in furchtbarer Zerrüttung durcheinander; er verlangte nach dem geweihten Wasser, das lindere seine Schmerzen; hier in der Herzgrube, da brenne es wie glühendes Eisen; ›trink auch,‹ sagte er zu mir, ›der heilige Vater hat es geweiht; segne mich, mein Vater, es ist Sabbat. Wo ist die Mutter? noch drunten im Keller in der Synagoge? Mutter, mach auf, ich bin's, dein Moses‹. – So sprach er, und mir schwindelte vor dem entsetzlichen Abgrunde, an dem ich stand. Es wurde Abend und Geronimo glaubte, man schleppe ihn in einen finstern Kerker, man spanne ihn auf die Folter; schmerzvoll ächzend und mit fast ersterbender Stimme rief er stets: ›Ich bin kein Jude, ich weiß nicht, wo verborgene Juden sind. Daniel, verlaß mich nicht, verlaß mich nicht, Daniel!‹ Endlich schlummerte er wieder ein. Es war Nacht geworden, das volle Antlitz des Mondes blickte durch das Fenster und goß sein silbernes Licht über den Kranken. Ich war zum Tode bereit, denn jedes Wort aus unserem Gespräche hätte, wenn es vernommen worden wäre, mir den Martertod gewißlich gebracht; zu gutem Glücke war aber fast der ganze Orden heute bei der Untersuchung gegen die Lutheraner in der Stadt beschäftigt. Ich betete zu Gott, daß er sich Geronimos erbarmen und ihm den Tod senden möge. Kinder! Es ist gräßlich, um den Tod eines Menschen zu beten, und noch dazu um den eines Jugendfreundes. Warum aber sollte diese Seele noch länger gemartert werden? Es war aber anders beschlossen, ich sollte noch Erschütternderes erfahren. Ich saß in trübe Gedanken versunken da, als ein Familiare eintrat und mir befahl, zu dem Inquisitor zu kommen. Mein Herz pochte laut, als ich zu ihm eintrat; ich warf mich vor ihm auf die Knie und bat um seinen Segen. Er erteilte ihn mir und sprach alsdann: ›Du bist ein Freund Geronimos. Wofern du ein guter Christ bist,‹ und hiebei richtete er einen durchbohrenden Blick auf mich, ›sorge dafür, daß Geronimo von seiner Hartnäckigkeit läßt und noch vor seinem Tode das heilige Abendmahl nimmt; versuch's und berichte mir sogleich, so darf er nicht sterben.‹ Ich ging wieder in die Zelle des Kranken, er schlummerte noch; ich neigte mich leise über ihn, er wachte auf. ›Komm,‹ sprach er hastig sich aufrichtend, ›jetzt ist's Zeit. Siehst du? Gideon mit seinen dreihundert Mann kommt auch, sie tragen die feuergefüllten Krüge ins Lager der Midianiten; still – leise – blast noch nicht in die Posaunen, laßt uns das Hochamt halten.‹ Er faltete seine Hände und bekreuzte sich darauf dreimal.
Ich bat, ich beschwor ihn, ich weinte vor innerer Angst, und redete ihm zu, ruhig zu sein; ich erzählte ihm von den Tagen unserer Kindheit und wie er mich nun selber morde, wenn er nicht das heilige Abendmahl nehme. ›Warum gibt man mir's nicht?‹ sprach er ruhig, ›ich bin ja Priester; komm, wasche meine Hände, ich bin unrein, dann will ich's empfangen.‹
Ich ging zum Inquisitor und sagte ihm, daß Geronimo zwar noch immer wirr sei, daß er aber selbst nach dem heiligen Abendmahl verlange. Der Inquisitor versammelte den ganzen Orden, und als sie den langen Gang heranzogen mit den Weihegefäßen und dem schauerlichen Totengesang, der in der hohen Halle lange nachtönte, sang Geronimo laut mit, und noch als der Gesang verklungen war, sang er de profundis clamavi mit lang anhaltendem Tone, wobei er die Hände stets gefaltet hielt; dann riß er seine Hände schnell auseinander, bedeckte damit seinen Kopf und sang die hebräischen Worte: Heilig! Heilig! Heilig! Adonaj Zebaot! (Jehovah, Gott der Heerscharen) Ave Maria gratia plena, sprach er in derselben Lage fast mechanisch vor sich hin. Der Inquisitor benutzte diesen Augenblick und reichte ihm die Hostie; er verschlang sie wie mit Heißhunger.
›Den Kelch! den Kelch!‹ rief er, ›ich bin Priester.‹ Der Inquisitor reichte ihm den Kelch, er schlang seine beiden Hände krampfhaft um denselben und begann den jüdischen Sabbatsegen darüber zu sprechen: dann richtete er sich mit Macht im Bette auf, er stand da in seiner ganzen schauererregenden Gestalt und schrie: ›Auf Gideon! Zerschmettert die Krüge! Feuer! Feuer!‹ Er setzte den Kelch an die Lippen, warf ihn an die Wand daß die Scheiben klirrten, sank um und – war tot. –
Der Fremde bedeckte seine Augen mit der Hand und stand auf, als er diese Worte gesprochen hatte. Niemand wagte ein Wort laut werden zu lassen, denn welches konnte die namenlosen Erschütterungen der Seele in sich fassen? Jeder fürchtete nur durch einen Laut, durch einen Seufzer, die tiefe Bewegung des anderen zu stören. Es war eine Totenstille. Draußen klopfte es wie mit gespenstischen Fingern an die Scheiben; alle zuckten zusammen, der Fremde öffnete das Fenster, es war nichts zu sehen. Er setzte sich wieder an den Tisch und fuhr fort: »Ich war halb besinnungslos an dem Bette Geronimos niedergesunken, der Kelch mit dem verschütteten Weine lag neben mir am Boden, Ich wagte nicht, mich aufzurichten, aus Furcht, daß mein Blick zuerst meinem Henker begegnen müsse. ›Steh auf,‹ sprach eine rauhe Stimme zu mir. Ich richtete mich auf, der Inquisitor stand vor mir, keiner der Mönche war mehr zugegen. ›Wie heißt du?‹ fragte er mich barsch. Ich war in peinigendem Zweifel: sollte ich meinen wahren Namen angeben, sollte ich nicht? Aber vielleicht hatte er ihn schon erspäht und eine Lüge brachte mir den zwiefach gewissen Tod. Ich sagte die Wahrheit; er frug nach einem Zeugen. ›Hier kennt mich niemand,‹ antwortete ich, ›aber mein Schwager, Don Juan Malveda in Kordova kann mir bezeugen, daß jener Casseres, in dessen Hause zu Segovia die erste Sitzung der Inquisition gehalten wurde, mein Ahnherr ist.‹ Ich muß mich noch jetzt über den Mut wundern, mit dem ich in diesem entscheidenden Augenblicke zu dem Inquisitor redete. ›Schwöre mir,‹ sagte er nach einer peinlich langen Pause, ›nein, schwöre mir nicht, aber wofern du nur eine Silbe von dem, was du hier gesehen, über deine Lippen bringst, so stirbst du mitsamt deinen beiden Kindern des Feuertodes. Du bist in meiner Gewalt, ich halte dich mit unsichtbaren Banden, du kannst mir nicht entrinnen.‹ Er befahl hierauf einem Familiaren, mich aus dem Kastell zu entlassen. –
Wenn wir die Geschichte des Propheten Jonah buchstäblich nehmen dürfen, gleich mir muß es ihm zu Mute gewesen sein, als er vom Seeungeheuer ausgespieen wurde. Ich glaubte noch immer den schauerlichen Grabgesang zu hören, und doch war alles um mich her totenstill. Alles war so heimlich, so bedrohlich: jeder Busch, der im Mondlichte schwankte, schien mir Eile zuzuwinken. Ich war vor Ermattung und Angst kaum mehr eines Gedankens mächtig, und nirgends in der weiten Umgebung eine Seele, an der ich mich aufrichten konnte. Da blickte ich hinauf in das zahllose Heer der Sterne, ihr himmlisch Licht glänzte wohltuend in mein Inneres, Gott, der Gott der Heerscharen, wachte über mir; meine ganze Seele war ein Gebet, er vernahm's. – Ich gelangte in meine Herberge, sattelte mein Pferd, und ritt wie auf Sturmesflügeln davon. Der Mond war hinter Wolken verschwunden, und nur der Sterne mattes Licht beschien meinen einsamen Weg. Das Pferd selbst schien wie von unsichtbaren Geißeln getrieben, es stürmte unaufhaltsam fort über Berg und Tal, und schnaubte und schäumte fürchterlich. Vielleicht, dachte ich, ist die Seele eines grimmigen Judenfeindes, vielleicht gar die Seele des verstorbenen Großinquisitors, in dieses Tier gefahren, und ist nun verdammt, mich durch die Nacht dahinzutragen zur Rettung vor meinen Feinden. Oft, wenn es seinen Kopf nach mir zurückwendete und zu mir umschaute mit seinen feurigen Augen, schien mir's als ob es zu mir spräche: Leide ich nicht genug für mein früheres Leben? Ich fürchtete mich fast vor meinem eigenen Schatten, der rastlos über Felsen und Gestrüppe dahinhüpfte, und drückte die scharfen Sporen nur noch mächtiger in die Rippen des Pferdes. – Ihr, die ihr in Freiheit aufgewachsen seid und darin lebt, ihr könnt es nicht wissen, welch eine Verwirrung des Lebens in solchen Stunden eintritt; die Erde ist nicht mehr fest, der Himmel ist verschwunden und was je von Schrecken und Gespenstern die Erinnerung aufgenommen hat, wacht auf. Ein Wunder, wenn es sich zeigte, würde ohne Staunen angesehen, denn alles ist Wunder, alles unfaßlich geworden und das eigene Leben am meisten. Ermattet kam ich in Kordova bei meiner Schwester an; erst an ihrem treuen Herzen verscheuchte ich die Angst, die mich kaum frei atmen ließ. Als ich des anderen Morgens in den Stall kam, um mich nach meinem Pferde umzusehen, lag es tot da; seine großen Augen stierten noch so unheimlich wie am gestrigen Abend. Mit einem frischen andalusischen Renner meines Schwagers setzte ich die Reise fort. Ich nahm von meiner Schwester Abschied; ich durfte ihr nicht sagen, daß ich sie zum letzten Male sah. – Als ich in der Heimat ankam, war mir die alte Ruhe und Sicherheit im Hause verschwunden. In jedem Freunde, der mich herzlich willkommen hieß, in jedem Fremden, der mich auf der Straße ansah, glaubte ich einen Abgesandten jener Mörderbande, die sich ein Gericht nennt, zu erblicken; jeder, meinte ich, müßte den Mantel zurückschlagen, und mir das blutigrote I auf seiner Brust zeigen. Die alte Sorglosigkeit war verschwunden, ich kannte nur noch Furcht und Mißtrauen. Dazu kam noch, daß wachend und schlafend mir das Bild Geronimos vorschwebte; auch du, auch du, sprach es in mir, kannst eines solchen Todes sterben, verlassen vom Glauben, der ein Spielzeug deiner Feigheit war, haltlos herumgezerrt zwischen Wahrheit und Heuchelei. Ich verkaufte all meine Güter, und machte mich nicht ohne große Gefahr – denn ihr wißt, daß niemand ohne besondere Erlaubnis des Königs Spanien verlassen darf – mit Gottes Hilfe davon. Ich schickte meine Kinder auf verschiedenen Umwegen voraus; sie sind aber in Leiden geblieben. Wenn Gott mir das Leben erhält, bringe ich sie nächste Woche hieher, Wollt' ich noch alles erzählen, was ich ausgestanden, bis ich hieher gekommen, es währte bis zum nächsten Morgen, und ich hätte noch nicht den zehnten Teil berichtet; aber es ist schon spät und wir bleiben ja, will's Gott, länger beieinander,«
»Ja, die Lichter sind auch schon ganz herabgebrannt, und morgen ist der sechste Jiar, da müssen wir früh heraus, darum wollen wir in Gottes Namen zu Bette gehen.« So sprach der Vater und Alles schied.
So behaglich anmutend ein jüdisches Haus am Freitagabend in den Stunden festlichen Beisammenseins ist, ebenso mit wundersamen Schauern erfüllt ist die Zeit der Trennung. Die sieben Lichter brennen still aus in der leergewordenen Wohnstube, und es ist eine seltsame Empfindung, wenn man sich dorthin denkt, wo ein Licht nach dem andern erlischt; denn das Gesetz verbietet, am Sabbat ein Licht auszulöschen oder eines anzuzünden und in die Hand zu nehmen.
In dem Eckhause auf dem Burgwall ging ein jedes im Dunkel nach seiner Ruhestätte und jedem folgten die Schreckbilder aus der Erzählung des Gastfreundes.
Die alte Chaje schlief schon lange und träumte eben von der Hochzeit Miriams und wie sie selbst eine so wichtige Rolle dabei spielte, als ihre Stubengenossin Miriam eintrat und sie durch Rufen und Rütteln weckte. »Was ist? was ist?« fuhr Chaje auf, sich die Augen reibend.
»Du schnarchst so sehr und schwatzest aus dem Schlaf, daß ich entsetzlich Angst bekommen habe,« antwortete Miriam; im Grunde war es aber noch eine andere Furcht, die sie zur Ruhestörerin machte: im undurchdringlichen Dunkel glaubte sie jeden Augenblick das Gespenst ihres Oheims zu sich heranschleichen zu sehen, und sie wollte durch Reden ihre Angst verscheuchen. Chaje erzählte nun ihren Traum, und wie es schade gewesen sei, daß sie geweckt wurde, der Mund wässere ihr noch von den vielen guten Speisen, die sie bei der Hochzeit genossen, sie sei obenan gesessen neben dem Bräutigam, mit ihrer goldenen Kette und ihrem rotseidenen Kleid; »ja lach nur,« sagte sie, »was einem in der Freitagnacht träumt, wird so gewiß bald wahr, so gewiß als jetzt Sabbat über der ganzen Welt ist.«