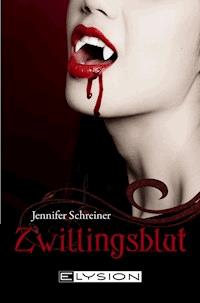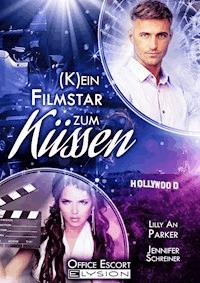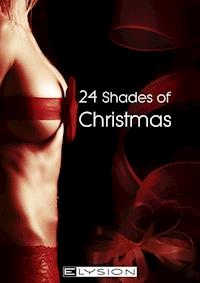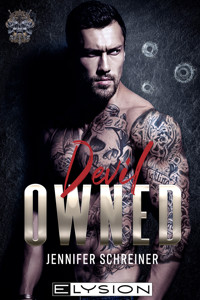
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elysion Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Trau dich zu fliehen: Als Anna erwacht, hat sie keine Ahnung, wieso sie sich in einem Hochsicherheitsgefängnis befindet und warum der ebenso eiskalte wie attraktive Gefängnisdirektor Hobbs ausgerechnet an ihr ein Exempel statuieren will. Gewillt, den Willen seiner neuen, aufsässigen Gefangenen zu brechen, greift Hobbs tief in seine Trickkiste und verstrickt Anna und sich in ein intensives Spiel um Dominanz und Macht. Als ihm schließlich Zweifel an der Schuld seiner Gefangenen kommen, ist es zu spät. Längst hat er die Kontrolle über das Spiel verloren und Anna scheint nicht mehr gewillt zu sein, Informationen preiszugeben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jennifer Schreiner
Devil Owned
Trau dich zu fliehen
Jennifer Schreiner wurde 1976 geboren und lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern mittlerweile in Leipzig.
Seit 2002 ist sie Magister der Philologie.
Neben ihren über 50 fantastische, erotische und gruselige Kurzgeschichten, die in Anthologien und Zeitschriften erschienen und teilweise prämiert worden sind, sind inzwischen zahlreiche Bücher von ihr veröffentlicht. Zum Beispiel:
»Zwillingsblut«, »Honigblut«, »Venusblut«
»Erosärger«
»Satanskuss«
»Ich bin dann mal ganz anders«
»Das Leid mit der Leidenschaft«
Schreiner ist Mitglied des VS und bei den DeLiA.
Seit 2010 leitet sie mit »Elysion-Books« ihren eigenen Verlag und betreut dort inzwischen mehr als 150 Autoren und Projekte.
Jennifer Schreiner
Devil Owned
Trau dich zu fliehen
ELYSION-BOOKS
Print; 2 überarbeitete Auflage: 2024
eBook; 2 überarbeitete Auflage: 2024
(Die erste Auflage erschien unter dem Titel »Catch & Kiss: Trau dich zu fliehen«)
VOLLSTÄNDIGE AUSGABE
ORIGINALAUSGABE
© 2015 BY ELYSION BOOKS
ALL RIGHTS RESERVED
UMSCHLAGGESTALTUNG: Jessica Mohring
www.ravenink.com
ISBN (vollständiges Ebook) 978-3-96000-336-6
ISBN (gedrucktes Buch) 978-3-96000-335-9
www.Elysion-Books.com
Jennifer Schreiner
Inhalt
1. Gefangen S. 7
2. Abläufe und Konsequenzen S. 21
3. Strafen und Erpressung S. 37
4. Resultate und Nachwirkungen S. 47
5. Möglichkeiten und Bestechungen S. 61
6. Deal und Wahrheit S. 79
7. Angreifer und Waffenstillstand S. 93
8. Begreifen und Emotionen S. 115
9. Verführung und Chancen S. 134
10. Freiheit oder Liebe? S. 151
Leseprobe S. 161
1. Kapitel
2. Kapitel
»Verführung bedeutet nicht, jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was er nicht tun möchte; Verführung ist, jemanden dazu zu verleiten, das zu tun, was er heimlich schon tun möchte.«
Benjamin T. Russell
»Wenn du einen Engel verführen willst, musst du die Rolle eines Teufels spielen.«
Eliphas Levi
1. Gefangen
Der Nachhall des bösen Traumes geisterte noch immer durch meinen Verstand und bescherte mir Kopfschmerzen. Ich war irgendwo gewesen, einer Party oder so und dann war da jemand hinter mir, hatte mich gepackt und rückwärts gezogen. Hinter einen Vorhang. Niemand hatte etwas bemerkt. Meinen erstickten Laut nicht, die Bewegung nicht. Da war ein übel riechendes Tuch gewesen, Luftnot und plötzliche Dunkelheit. Das Gefühl getragen zu werden, Fahrgeräusche und ein kurzer Schmerz in meinem rechten Oberarm.
Unwillkürlich griff ich an die Stelle, die jetzt wieder zu schmerzen begonnen hatte, und registrierte, dass mein Mund trocken war und ich immer noch diesen üblen Geruch in der Nase hatte.
Sekunden später begriff ich, dass etwas nicht stimmte. Komplett und vollkommen. Ich war nicht zu Hause. Nicht in meinem Bett. Und das, was ich für Schlafen gehalten hatte, musste in Wirklichkeit von einem Betäubungsmittel gekommen sein.
Verwirrt setzte ich mich auf und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen und die ersten Eindrücke zu ordnen. Ich trug noch das Partykleid und die hohen Schuhe. Selbst der erlesene und sehr teure Schmuck war noch da und mein verdammter Oberarm schmerzte, als hätte die Person, zu deren Opfer ich geworden war, mich mit einem stumpfen Löffel schachmatt gesetzt. Mein Mund schaffte es, noch trockner zu werden.
Ich blinzelte in das plötzlich aufflammende, helle Licht und versuchte zu erkennen, wo ich war. Dann entschied ich, dass es aufgrund einer fehlenden, akuten Bedrohung auf die paar Sekunden auch nicht ankommen würde und bedeckte meine Augen mit den Händen, um ihnen Zeit zu geben, sich an die Helligkeit zu gewöhnen.
Ich musste einen Traum im Traum haben! Verwirrt sah ich mich noch einmal um, aber der erste Eindruck verschlimmerte sich lediglich. Mein Bett oder besser gesagt das Teil, auf dem ich lag und das eventuell ein Bett sein sollte, war aus Plexiglas und hart. Es gab auch eine Toilette aus Plexiglas und ich befand mich in einem winzigen Raum, der ebenfalls durchsichtig war. Vermutlich nicht aus Plexiglas, sondern aus irgendetwas sehr Stabilem. Ich blinzelte, aber der Eindruck blieb.
Ich stand auf und wie auf Kommando gingen auch Lichter außerhalb meines Raumes an. Und offenbarten mehr Räume aus Glas. Räume, die ebenfalls Menschen enthielten. Menschen und Menschen und Menschen.
Ich setzte mich wieder, weil meine Beine mich auf einmal nicht mehr tragen wollten, und ich blinzelte wieder. Irgendwann musste ich doch aufwachen!
Jemand trat hinter meiner Glaswand in mein Gesichtsfeld. Erst jetzt erkannte ich, dass es nicht nur aneinandergereihte Glaswaben gab, sondern auch Treppen und Stahltrassen, auf denen Personen standen. Bewaffnete Personen, ganz in schwarz gekleidet, mit weißen Masken.
Das konnte nur ein Alptraum sein! Aber normalerweise waren doch für so etwas Alien zuständig und keine Maskenwesen und … ich sah mich abermals um und entdeckte, dass sogar das Toilettenpapier nur durch das Glas hindurch zugänglich war. Ebenso ein Handtuch. Durch eine Klappe, wie man sie von Tankstellen her kannte – wenn man abends tanken und bezahlen wollte. Es erinnerte mich an den Film »Das Schweigen der Lämmer« nur in noch gruseliger. Und am allergruseligsten war, dass ich mich auf der falschen Seite des Glases befand. Auf der von Hannibal.
Ich atmete tief durch, aber Glas und die Inneneinrichtung blieben, was sie waren: unheimlich.
Wie von selbst wanderte mein Blick durch meine Zelle und ich entdeckte ein kugelförmiges Gerät an der Decke und einen Duschkopf. Das Gerät befand sich in der Mitte, der Duschkopf in der Ecke, die vom Rest durch die Toilette ein wenig abgetrennt war.
Das kann nicht sein, das kann nicht sein … im Takt meiner Gedanken schüttelte ich den Kopf, ohne das ich es verhindern konnte. Wenn man mich entführte, dann doch nicht, um mich … ja, um was eigentlich? Mich in so etwas einzusperren? Was war denn so was? Und wer waren die anderen Eingesperrten? Und die Wärter?
Ich sah noch einmal hin und stellte fest, dass sie tatsächlich alle ungefähr dieselbe Größe und Statur hatten und man nicht einmal ihre Haarfarbe erkennen konnte. Das war mehr als gruselig, es war Absicht.
Gerade als ich tief durchatmete und versucht war, mich selbst zu kneifen, um herauszufinden, ob ich nicht vielleicht doch immer noch schlief und einfach schlecht träumte, setzten sich die Wachen in Bewegung. Und ihr Ziel war klar: ich.
Kurz war ich versucht aufzustehen und mich in der hintersten Ecke des Raumes zu platzieren, aber ich wusste, dass mein Kreislauf noch nicht mitspielen würde. Mal abgesehen davon, gab es hier weder eine Möglichkeit mich zu verstecken noch eine zu fliehen – und beides lag mir auch nicht sonderlich. Folglich blieb ich sitzen und versuchte nur mir einzuprägen, welche der Wachen woher gekommen war, ob sie kommunizierten und wie die Tür zu meinem Raum funktionierte. Leider war das die nächste schlechte Nachricht, denn keine der Wachen tat irgendetwas, die Schiebetür glitt einfach so zur Seite, wurde also von einem anderen Ort gesteuert und ließ sich vermutlich nicht manuell oder mit direktem Zugriff öffnen. Eine ähnlich schlechte Nachricht betraf die Wachen. Keiner von ihnen wies ein Merkmal auf, das einen Wiedererkennungswert hatte, kein Humpeln, keine seltsame Körperhaltung oder einen Besonderheit beim Gehen. Nichts. Dafür wirkten die Abläufe insgesamt sehr gut aufeinander abgestimmt und präzise. Es gab keinen Raum für Fehler. Zwei der Wächter positionierten sich mit gezogenen und im Anschlag befindlichen Waffen vor der Tür. Die Tür glitt auf, die anderen zwei Wachen traten ein, ebenfalls mit Waffen in der Hand. Dann positionierten sie sich neben der Tür und warteten. Ich ebenfalls, allerdings auf einen Herzinfarkt infolge des Adrenalins, das in übergroßen Mengen durch meine Adern schoss.
Obwohl keine der Wachen auf mein Auftauchen reagierte, wurden meine Aufmerksamkeit sofort von den Schwarzgekleideten fort- und auf die andere Person gelenkt, kaum das sie in Sichtweite gekommen war. Wie ein Schatten in einem dunkelgrauen Anzug bewegte sich der Mann langsam und bedächtig die Stufen hinab und in meine Richtung. Dabei sah er scheinbar geschäftig in eine Akte und achtete nicht auf seine Umgebung. Ein Wunder, dass er heil die Treppe passieren konnte und in meinem Raum ankam.
Ohne von den Papieren aufzusehen, strich er sich wie unbewusst die Krawatte glatt und lenkte meine Aufmerksamkeit auf seine Kleidung. Maßgeschneidert und teuer. Trotz seiner grauen Schläfen und des perfekt rasierten markanten Bartes wirkte er nicht wie das, was er vorgab zu sein, distinguiert, sondern schaffte es, trotz seiner Ruhe, Eiseskälte und Gefahr auszustrahlen. Etwas, was nicht an seinen relativ vollen Lippen lag, oder der Nase, die vielleicht ein klitzekleines bisschen zu groß war – geziert von einem kleinen Höcker, der von einem früheren Bruch stammen mochte, sondern an seinen Augen. Blaugrau und so, als hätten sie bereits alles gesehen und als interessiere ihn nichts wirklich. Ein Mann, der augenscheinlich so glatt war, dass es beinahe körperlich schmerzte und mit dem man sich besser nicht anlegte und ehrlich? Mein Blick glitt unwillkürlich zu den Wachen … wenn die anderen auch nur annähernd so waren wie er, konnte ich froh sein, dass ihre Gesichter im Gegensatz zu seinem verborgen waren.
Nervös fuhr ich mir durch die Haare und hätte mich beinahe doch spontan in die Ecke zurückgezogen, als mich sein Blick direkt traf. Ein gefasster Blick, bar jeder Gefühlsregung. Ob er überhaupt zu einer fähig war, fand ich plötzlich mehr als fraglich. Aber dass ich mich intuitiv panisch fühlte, rief mindestens genauso spontan eine unterschwellige Wut in mir hervor.
»Fräulein Morgen, nehme ich an?«, begann der Anzugträger und machte eine Frage aus seinen Worten, obwohl er diesen Namen vermutlich direkt vor sich in der Akte stehen hatte. Er musterte mich so finster, dass ich annehmen musste, irgendetwas an mir würde ihn stören. Vermutlich bereits meine Anwesenheit in seiner perfekt organisierten Welt. »Herzlich Willkommen. Ich bin Direktor Hunter und muss Ihnen ja nicht viel erzählen, Sie waren ja oft genug in einem Gefängnis.«
»Tatsächlich?«, entschlüpfte mir, bevor sich mein Verstand zwischen meinen Mund und mir einschalten konnte. Er wusste, nicht wer ich war, oder? Und ich wusste nicht, ob das gut oder schlecht für mich sein konnte. Insgeheim hatte ich trotz der Gefängnissituation mit einer Lösegeldforderung gerechnet, nicht damit, weggesperrt zu sein und zu bleiben. Kurz überlegte ich, zu widersprechen und zu erklären, dass mein Name nicht »Fräulein Morgen« war – und ich weit davon entfernt eine Strafgefangene zu sein, entschied mich aber dagegen.
Einem Mann wie ihm konnte man nicht trauen. Außerdem … ich sah mich ein weiteres Mal um … konnte dies hier unmöglich ein offizielles Gefängnis sein. Schließlich war ich verschleppt worden, nicht verurteilt.
Also war ich erst einmal prinzipiell im Vorteil, wenn ich die Klappe hielt.
Zum Glück ging der Direktor nicht auf meine Worte ein, sondern fuhr ungerührt in seinem Standardtext fort: »Ich denke Sie werden sich schnell einleben und einsehen, dass Flucht unmöglich ist.«
»Ein Hochsicherheitsgefängnis«, riet ich, mich wieder an Hannibal Lector erinnernd, und fügte hinzu: »Ich fühle mich ein wenig geschmeichelt.«
Im letzten Moment gelang es mir, meine Mundwinkel unter Kontrolle zu bekommen. Mein Gegenüber klang so heiter, als meine sie exakt, was sie sagte und wirkte dabei gleichzeitig so hoheitsvoll, als hätte ich ihr einen Gefallen getan, indem ich sie wie den Schwerverbrecher behandelte, der sie ja war.
Zum ersten Mal blickte ich wirklich von der Akte auf und von den Buchstaben, die ich ohnehin eher ignoriert hatte, um die junge Frau direkt anzusehen. Etwas, was ich sonst so gut wie nie tat. Die meisten Menschen waren einfach zu … uninteressant.
Ungerührt hielt sie meinem Blick stand und ihr Lächeln geriet nicht einmal für einen Sekundenbruchteil ins Wanken. Wieder eine Überraschung. Normalerweise sahen die Gefangenen weg, als ahnten sie, was ich wirklich über sie dachte und als wollten sie auf gar keinen Fall meine Aufmerksamkeit erregen. Und die wenigen, die es darauf anlegten … nun ja, die musterten mich absichtlich herausfordernd und ihre Mine ließ eine kommende, offene Provokation vermuten. In der Mine meines derzeitigen Gegenübers las ich etwas anderes: Neugierde.
Entweder war sie eine verdammt gute Schauspielerin oder nicht clever genug, um mich in Ruhe zu lassen.
Oder sie ist wirklich einfach nur neugierig, schlug eine leise Stimme in meinem Kopf vor. Eine Stimme, die sich selten meldete und wenn, dann eigentlich auch nur, wenn irgendetwas nicht stimmte oder mein intensiveres Interesse und einen zweiten Blick erforderte.
»Sie haben keine Ahnung, warum Sie hier sind, oder wer Sie hier drin sehen will?«, hakte ich nach, obwohl mir klar war, dass die Frau bei jeder der drei möglichen Alternativen an dieser Stelle verneinen würde.
»Überraschen Sie mich!«, forderte sie. Tatsächlich ein »nein«, aber ein charmanteres.
»Wer könnte sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben haben, dass wir Sie hier drin begraben? Am Leben erhalten und für bisher unbefristete Zeit aus dem Verkehr ziehen?«, konterte ich.
Sie zuckte mit den Schultern, schien aber über meine Worte nachzudenken, obwohl sie nun ihren Blick von mir abwendete.
»Na ja, immerhin ist es ein Glassarg«, murmelte sie. »Ein bisschen wie in Schneewittchen.«
Sie schwieg und ich kam mir irgendwie … entlassen vor, obwohl sie immer noch mein Projekt begutachtete. »Sieht gut aus.«
»Benehmen Sie sich und halten sich an meine Regeln und Sie werden so etwas wie ein Leben haben«, meinte ich, weil mir das Gefühl, sie habe plötzlich die Kontrolle an sich gerissen, nicht gefiel.
»Mhh«, machte sie und lachte leise. Eine Antwort, die so gut wie alles bedeuten konnte – und es wahrscheinlich auch tat.
Eine Provokation, die ich gerade am Anfang nicht durchgehen lassen konnte. »Ich denke, wir fangen mit dem Umziehen an!«
»Umziehen?«, wiederholte ich lahm und fühlte mich zum ersten Mal, seit ich begriffen hatte, dass ich mich aus irgendeinem Grund in so etwas wie einem Gefängnis befand, vollständig überrumpelt. »Bestimmt nicht!«
»Das war keine Bitte.« Obwohl Hunter Ton weiterhin ruhig und freundlich blieb – vielleicht sogar noch ein wenig ruhiger und freundlicher wurde – konnte man die Härte hinter den Worten hören. Er war jemand, dessen Anweisungen befolgt wurden, wenn sie kamen, weil sie kamen.
»Ich werde mich bestimmt nicht vor Ihnen allen umziehen!«, betonte ich, da ich nicht das Gefühl hatte, in naher Zukunft eine Umkleidekabine gestellt zu bekommen.
»Fräulein Morgen, entweder Sie ziehen sich freiwillig um, oder einer der Wärter wird das übernehmen«, warnte Hunter. Er sah mich abwartend an, schien aber nicht wirklich davon überrascht zu sein, dass ich nicht reagierte. Anscheinend ließen es die meisten der Neuankömmlinge darauf ankommen.
Der Schlag in den Magen kam von einem der Wärter und vor allem kam er unerwartet. Mein Kleid riss unter dem Griff des Schwarzgekleideten, bevor ich überhaupt wieder zu Luft kam. Als ich mich endlich wieder aufrichten konnte, war ich nur noch mit Unterwäsche und einem frisch zum Cape degradierten Stoffteil bekleidet.
»Wollen Sie sich vorher waschen, oder sollen wir das auch übernehmen?«, erkundigte sich Direktor Hunter und unter seine Freundlichkeit hatte sich ein Unterton geschlichen, den ich unschwer als süffisant klassifizieren konnte.
Ich presste meine Lippen aufeinander und schluckte die Beleidigung herunter, die mir auf der Zunge lag, um keinem der Gorillas abermals Gelegenheit zu geben, Hand an mich zu legen. Dementsprechend wütend ging ich zu dem Duschkopf, der bereits angenehm temperiertes Wasser von sich gab, und befreite mich auf dem Weg von dem Cape. Dabei entdeckte ich den Seifenspender in der Wand, der anscheinend ebenfalls von einer fernen Kommandozentrale gesteuert wurde, denn auch er wies keine Möglichkeit für den Insassen auf, von ihm bedient zu werden. Aber immerhin funktionierte er und die Waschlotion war nicht ganz so schrecklich wie erwartet. Sekunden, nachdem ich mich eingeschäumt und wieder abgewaschen hatte, versiegte das Wasser und die Handtuchklappe öffnete sich ohne mein Zutun. Dem wortlosen Befehl folgend, nahm ich das Frottee zur Hand und bedankte mich bei der Kamera. Und weil mich der Direktor fragend ansah, erklärte ich: »Nur weil man eingesperrt ist, muss man ja nicht seine Kinderstube vergessen.«
»Sie hatten eine Kinderstube?«, fragte er, wirkte aber, als interessierten ihn meine Worte nicht mehr wirklich. Stattdessen reichte er mir die Uniform, die ich auch an den anderen Gefangenen erkennen konnte und meinte: »Die Unterwäsche, bitte.«
»Was?«
»Wie bitte heißt das.« Er lächelte, obwohl er immer noch abwesend wirkte – so als rede er auf Autopilot. »Soviel zur Kinderstube.«
»Sie wollen meine Unterwäsche?«, fragte ich und abermals regte sich Trotz in mir. Das durfte doch alles nicht wahr sein!
»Sie bekommen täglich frische Kleidung. Unsere Kleidung«, erklärte Hunter, als wäre ich begriffsstutzig und so als seien diese Tatsachen vollkommen belanglos. Man redete eben über sie, wie andere Leute Konversation über das Wetter hielten. Als würde das nicht bedeuten, dass ich nackt vor ihm und den Wärtern stand, gut sichtbar auch für die anderen Insassen. Ich hielt mich selbst wahrlich nicht für hässlich, warum war es ihm dann egal? Die Antwort lag auf der Hand beziehungsweise im restlichen Gefängnis: weil er jede dieser anderen gefangenen Frauen nackt gesehen hatte. Irgendwann war eine nackte Frau eben nur noch irgendeine nackte Frau.
Ich schlüpfte in den Anzug, der eher ein Strampler für Erwachsene war, mit integrierten Socken und Handschuhen und einem Reißverschluss am Rücken, und meinte ob seines Blickes: »Keine Sorge, Sie bekommen meine Unterwäsche.«
Kaum dass ich in dem hässlichen Anzug-Unding war, zerriss ich meine Spitzenhose und öffnete den BH, bevor ich ins Oberteil glitt. Erst als es nur noch den Reißverschluss zu bedienen galt, reichte ich Hunter die beiden Kleidungsteile.
»Sie wissen, dass auf dem Schwarzmarkt horrende Preise für getragene Frauenwäsche zu kriegen sind?«, erkundigte ich mich, weil er mich gezwungen hatte, meine Lieblingswäsche zu zerfetzen, und den beiden sündhaft teuren Teilen nicht einmal einen Blick gegönnt hatte. Albern, aber es wurmte mich.
»Von Straftäterinnen?« Er zog eine Augenbraue hoch, schien aber gewillt zu sein, seine Aufmerksamkeit wieder auf mich zu richten.
»Die sind seltener, also noch teurer«, behauptete ich. »Sozusagen eine Marktlücke.« Provozierend sah ich mir das draußen außerhalb meines kleinen Reiches an. »Wahrscheinlich könnte man die ganze Einrichtung damit finanzieren.«
»Ich werde drüber nachdenken«, versprach Hunter in einem Tonfall, der seine Worte Lügen strafte, warf mir noch einen prüfenden Blick zu, beschloss dann aber doch, dass er mir genug seiner vermutlich kostbaren Zeit gewidmet hatte, nickte mir zu und setzte damit seine Abgangszeremonie in Gang. Sprich: Die zwei Wachen vor der Tür hielten ihre Waffen wieder bereit und auf mich, beziehungsweise den Durchgang gerichtet, die Tür öffnete sich, Hunter ging hindurch, dann die zwei Wachen, die Tür schloss sich und ich war allein. Mutterseelenallein unter den Blicken, die mich von Außen und durch die Kamera verfolgten.
2. Abläufe und Konsequenzen
Als ich wach wurde, benötigte ich einige Sekunden, um mich zu orientieren und einige weitere, um zu begreifen, dass ich leider nicht geträumt hatte. Ich befand mich in einem Hochsicherheitsgefängnis und hatte zu allem Überfluss auch noch Kopfschmerzen wie Sau.
Vermutlich, eben weil ich in einem Hoch- sicherheitsgefängnis war.
Ich setzte mich auf dem Plexiglasbett auf und betrachtete meine Zelle. Nicht, dass sich irgendetwas verändert oder gar verbessert hätte. Ich wollte nur auf Nummer Sicher gehen, dass ich gestern Nacht alles richtig wahrgenommen hatte. Obwohl … Nacht war ja bereits vage genug. Vielleicht hatten wir gar nicht Morgen, sondern erst jetzt drei Uhr nachts? Das war schwer zu sagen, da es kein Tageslicht gab und keinerlei Uhren, die einen Hinweis darauf geben konnte. Sicherlich keine Absicht, dachte ich ironisch und schenkte der Kamera an der Decke einen bösen Blick.
Nachdenklich erwiderte ich in der Schaltzentrale den bösen Blick, den unser neuster Neuzugang der Kamera schenkte, und verfolgte auf dem Monitor, wie sie sich langsam sammelte. Sie schien Kopfschmerzen zu haben, eine normale Reaktion auf das Betäubungsmittel; sie würden bald verfliegen.
Trotzdem würde ich sie, bis sie sich halbwegs integriert und in die Prozesse eingefügt hatte, genau beobachten, um direkt von Anfang an jede Auflehnung zu unterdrücken, und ihr bei der Anpassung zu … helfen.
Aber am Anfang tat sie genau das, was die meisten Neuankömmlinge taten: Sie sah sich um und suchte anscheinend etwas, an dem sie sich orientieren konnte. Keine große Überraschung. Genauso wie die Tatsache, dass sie nichts fand und auch nichts finden würde.