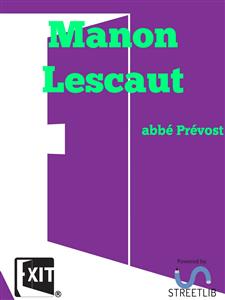Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Erotische Bibliothek Band 14: Die Abenteuer der Manon Lescaut und des Chevalier des Grieux von Abbé Prevost Sammlung klassischer erotischer Werke der Weltliteratur "Die Abenteuer der Manon Lescaut" ist die Geschichte der attraktiven, gut situierten Manon und ihres Geliebten Chevaliers des Grieux, für den sie ihre Karriere und ihre Familie aufgibt. Sie verstrickt sich in ein Geflecht aus Lügen und ist letztlich mit gesellschaftlichem Ausschluss und Verbannung konfrontiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Abenteuer der Manon Lescaut
und des Chevalier des Grieux
Abbé Prévost
Erotische Bibliothek
Band 14
Abbé Antoine François Prévost d'Exiles
Die Abenteuer der Manon Lescaut und des Chevalier des Grieux
Erstmals erschienen 1731 unter dem Titel Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut
Aus dem Französischen von Wilhelm Bremer 1914
© Lunata Berlin 2019
Inhalt
Ohne Titel
Über den Autor
Die erotische Bibliothek
Ich bin genötigt, den Leser bis zu jener Zeit meines Lebens zurückzuführen, da ich zum ersten Mal den Chevalier des Grieux traf. Das geschah etwa sechs Monate vor meiner Abreise nach Spanien. Obgleich ich nur selten aus meiner Zurückgezogenheit heraustrat, unternahm ich doch aus Liebe zu meiner Tochter verschiedene kleine Reisen, die ich aber nach Möglichkeit abkürzte.
Einmal befand ich mich auf dem Rückweg von Rouen. Meine Tochter hatte mich gebeten, vor dem normannischen Parlament ihren Anspruch auf einige Güter zu vertreten, der noch von meinem Großvater mütterlicherseits herrührte. Ich fuhr über Evreux, wo ich das erste Mal übernachtete, und kam am nächsten Tag zur Mittagszeit nach Passy, das fünf oder sechs Meilen davon entfernt liegt. Zu meiner Verwunderung fand ich bei meiner Ankunft die ganze Einwohnerschaft in großer Aufregung. Die Leute stürzten aus ihren Häusern und versammelten sich vor der Tür einer elenden Schenke, vor der zwei bedeckte Fuhrwerke standen. Die Pferde waren noch angeschirrt, sie dampften vor Müdigkeit und Hitze.
Ich blieb einen Augenblick stehen, um mich nach der Ursache der Erregung zu erkundigen, konnte aber von der neugierigen Menge keine Aufklärung erhalten. Die Leute beachteten meine Frage gar nicht, sondern drängten sich stoßend und lärmend um die Schenke. Endlich erblickte ich im Tor einen Soldaten mit Bandelier und einer Muskete über der Schulter. Ich winkte ihn heran und bat ihn, mir den Grund der Aufregung mitzuteilen.
»Es ist nichts von Bedeutung, mein Herr«, sagte er zu mir. »Es handelt sich um ein Dutzend Freudenmädchen, die ich und meine Kameraden nach Le Havre-de-Grâce bringen, von wo aus sie nach Amerika eingeschifft werden. Es sind ein paar hübsche Mädchen darunter, was offenbar die Neugier dieser braven Bauern erregt.«
Ich wäre nach dieser Erklärung weitergeritten, wenn mich nicht das Geschrei einer alten Frau festgehalten hätte. Sie kam händeringend aus dem Gasthof heraus und rief, es sei eine solche unmenschliche Grausamkeit, daß einen Entsetzen und Mitleid ankämen.
»Was gibt es denn?« fragte ich sie.
»Ach, mein Herr, gehen Sie hinein«, sagte sie, »und sehen Sie selbst, ob ein solcher Anblick einem nicht das Herz zerreißt.«
Neugier trieb mich, vom Pferd zu steigen, das ich meinem Stallknecht überließ. Nur mit Mühe konnte ich mich durch die Menge drängen und trat dann ins Haus, wo sich mir in der Tat ein ergreifender Anblick bot.
Unter den zwölf Mädchen, die zu sechst an der Taille zusammengekettet waren, befand sich eins, dessen Gesicht und ganze Erscheinung so wenig seiner augenblicklichen Situation entsprachen, daß ich es in anderer Umgebung für eine Dame von Rang gehalten hätte. Die Niedergeschlagenheit dieser anmutigen Person und auch die Unsauberkeit der Kleidung beeinträchtigten ihre Schönheit so wenig, daß ihr Anblick mir Achtung und Mitleid einflößte. Sie versuchte, sich abzuwenden, soweit es ihr die Kette erlaubte, und ihr Gesicht den Blicken der Neugierigen zu entziehen. In dieser Bewegung lag eine Natürlichkeit, die aus wahrem Feingefühl zu kommen schien.
Da sich die sechs Wächter, die diese unglückliche Schar begleiteten, ebenfalls im Zimmer befanden, nahm ich ihren Anführer beiseite und bat ihn, mir Genaueres über das Schicksal dieses schönen Mädchens mitzuteilen. Er konnte mir nur eine ganz allgemeine Auskunft geben.
»Wir holten sie auf Befehl des Herrn Polizeipräfekten aus dem Pariser Frauengefängnis, dem Hospiz«, sagte er. »Sicherlich war sie nicht um ihrer Tugend willen dort untergebracht. Ich habe ihr unterwegs wiederholt einige Fragen gestellt, doch sie verweigert hartnäckig jede Antwort. Obwohl ich keinen Auftrag habe, sie mehr als die anderen zu schonen, lasse ich ihr doch einige Erleichterungen zukommen, denn sie scheint mir etwas tauglicher zu sein als ihre Gefährtinnen. – Übrigens«, fügte der Soldat hinzu, »dort ist ein junger Mann, der Ihnen sicher besser als ich über die Ursache ihres Missgeschicks Auskunft geben kann. Er ist ihr aus Paris gefolgt und hat kaum einen Augenblick aufgehört zu weinen. Er muß ihr Bruder oder ihr Liebhaber sein.«
Ich wandte mich nach der Zimmerecke, wo der junge Mann saß. Er schien tief in Gedanken versunken. Niemals sah ich ein solches Bild des Schmerzes. Er war einfach gekleidet, verriet aber auf den ersten Blick den Mann von Stand und Erziehung. Ich näherte mich ihm. Er erhob sich, und ich erkannte in seinem Blick, in seinen Gesichtszügen und seinen Gebärden etwas so Edles und Vornehmes, daß ich sofort Wohlwollen empfand.
»Ich möchte nicht aufdringlich erscheinen«, sagte ich, indem ich mich neben ihn setzte, »aber ich brenne vor Verlangen, etwas über dieses schöne Mädchen zu erfahren, das mir durchaus nicht für den bejammernswerten Zustand geboren zu sein scheint, in dem es sich augenblicklich befindet.«
Er antwortete mir offen, daß er mir nicht sagen könne, wer sie sei, ohne sich selbst zu erkennen zu geben, und daß er gute Gründe habe, unbekannt bleiben zu wollen. »Ich kann Ihnen nur so viel mitteilen, wie auch diesen Schuften dort bekannt ist«, fuhr er fort und wies auf die Soldaten. »Nämlich, daß ich sie mit einer Leidenschaft liebe, deren Heftigkeit mich zum unglücklichsten aller Menschen macht. Ich habe in Paris alles versucht, sie zu befreien. Aber Bitten, List und Gewalt blieben erfolglos, und so habe ich mich entschlossen, ihr, wenn es sein muß, bis ans Ende der Welt zu folgen. Ich werde mich mit ihr nach Amerika einschiffen. – Was aber das Unmenschlichste ist«, fügte er hinzu, indem er wieder auf die Häscher wies, »diese feigen Schufte wollen mir nicht erlauben, in ihre Nähe zu kommen. Ich hatte die Absicht, die Wächter einige Meilen hinter Paris anzugreifen, und schon vier Männer gedungen, die mir für eine beträchtliche Summe ihre Hilfe versprachen. Die Betrüger ließen mich jedoch im Stich und machten sich mit meinem Geld davon. Allein konnte ich jedoch mit Gewalt nichts ausrichten, und so streckte ich die Waffen. Ich schlug den Soldaten vor, mir wenigstens zu gestatten, ihnen zu folgen, und erbot mich, sie dafür zu bezahlen. Aus Habsucht willigten sie ein. Sie forderten aber jedesmal, wenn ich mit meiner Geliebten sprechen durfte, neuen Lohn. In kurzer Zeit war meine Börse leer, und da ich jetzt keinen Sou mehr besitze, stoßen sie mich brutal zurück, wenn ich nur einen Schritt auf sie zugehe. Erst vorhin, als ich mich der Geliebten trotz ihrer Drohungen zu nähern wagte, besaßen sie die Unverschämtheit, das Gewehr auf mich zu richten. Um ihre Habgier zu befriedigen und ihnen wenigstens zu Fuß folgen zu können, bin ich gezwungen, mein armseliges Pferd zu verkaufen, das mich bisher getragen hat.«
So gefaßt er diesen Bericht zu geben schien, es kamen ihm doch zum Schluß einige Tränen. Ich fand sein ganzes Abenteuer ungewöhnlich und ergreifend.
»Ich möchte mich nicht in Ihre Geheimnisse drängen«, sagte ich, »aber wenn ich Ihnen in irgendeiner Weise nützlich sein kann, so biete ich Ihnen meine Hilfe an.«
»Leider sehe ich nicht den kleinsten Hoffnungsschimmer«, antwortete er. »Ich muß mich meinem harten Schicksal unterwerfen. Ich werde nach Amerika gehen, wo ich wenigstens mit der, die ich liebe, in Freiheit leben kann. Einem meiner Freunde habe ich geschrieben und hoffe, in Le Havre-de-Grâce von ihm einige Hilfe zu erhalten. Meine einzige Sorge ist, glücklich dorthin zu gelangen und unterwegs diesem armen Geschöpf soviel Erleichterung wie möglich zu verschaffen.« Und er warf seiner Geliebten einen traurigen Blick zu.
»Ich will Ihre Sorgen erleichtern«, sagte ich. »Ich bitte Sie, diese kleine Summe anzunehmen. Es tut mir leid, daß ich Ihnen nicht in anderer Weise dienen kann.«
Ich gab ihm, ohne daß die Wächter es bemerken konnten, vier Louisdor; denn ich dachte mir, daß sie ihm ihre Vergünstigungen noch teurer verkaufen würden, wenn sie von dem Gelde wüßten. Ich kam sogar auf den Gedanken, mit ihnen zu verhandeln, um für den jungen Liebenden die Erlaubnis zu erwirken, bis Havre jederzeit mit seiner Geliebten reden zu dürfen. Ich winkte also den Anführer zu mir und machte ihm einen entsprechenden Vorschlag, Trotz seiner Frechheit schien er sich ein wenig zu schämen.
»Nicht, daß wir uns weigern, mein Herr«, antwortete er mit verlegener Miene, »ihn mit dem Mädchen reden zu lassen. Aber er möchte immerfort bei ihr sein, und das ist uns unbequem. Da ist es doch nur recht und billig, wenn er uns für diese Unbequemlichkeit entschädigt.«
»Gut«, sagte ich zu ihm, »wieviel kostet es, Euch diese Unbequemlichkeit erträglich zu machen?«
Er besaß die Dreistigkeit, zwei Louisdor zu verlangen, und ich gab sie ihm sofort.
»Aber nehmt Euch wohl in acht«, sagte ich zu ihm, »daß Ihr mich nicht betrügt. Ich werde diesem jungen Manne meine Adresse geben, damit er mir berichten kann; und seid überzeugt, daß ich wohl in der Lage bin, Euch zur Rechenschaft zu ziehen.«
Die Geschichte kostete mich also sechs Louisdor.
Der vornehme Anstand und die aufrichtige Herzlichkeit, mit der dieser junge Unbekannte mir dankte, überzeugten mich vollends, daß er von Herkunft war und meine Freigebigkeit wohl verdiente. Ehe ich ging, sprach ich noch einige Worte mit seiner Geliebten. Sie antwortete mir mit einer so sanften und anmutigen Bescheidenheit, daß ich beim Weiterreiten unwillkürlich endlose Betrachtungen über die Unergründlichkeit des weiblichen Charakters anstellte.
Ich kehrte wieder in meine Abgeschiedenheit zurück. Eine Nachricht über den weiteren Verlauf dieses Abenteuers erhielt ich nicht. Fast zwei Jahre vergingen, und ich hatte es schon ganz vergessen, als der Zufall mich mit allen Einzelheiten der Umstände bekannt machte.
Ich war mit meinem Zögling, dem Marquis de X., von London nach Calais gekommen und, wenn ich mich recht erinnere, im Goldenen Löwen abgestiegen, wo uns bestimmte Gründe zwangen, den Tag und die folgende Nacht zu verbringen. Als wir des Nachmittags durch die Straßen schlenderten, glaubte ich jenen jungen Mann zu erkennen, dem ich in Passy begegnet war. Er war ziemlich schlecht gekleidet und viel blasser als bei unserer ersten Begegnung. Offenbar war er gerade in der Stadt angekommen, denn er trug unter dem Arm einen alten Mantelsack. Seine Züge waren jedoch so auffallend schön, daß man sie nicht so leicht vergaß.
»Wir müssen diesen jungen Mann sprechen«, sagte ich zu dem Marquis.
Die Freude des Fremden war unbeschreiblich, als er mich wiedererkannte.
»Ach, mein Herr«, rief er und küßte mir die Hand, »ich kann Ihnen also noch einmal meine ewige Dankbarkeit aussprechen!«
Ich fragte ihn, woher er komme, und er teilte mir mit, daß er vor kurzem aus Amerika nach Le Havre-de-Grâce zurückgekehrt sei.
»Sie scheinen nicht sehr bemittelt zu sein«, sagte ich. »Gehen Sie in den Goldenen Löwen, wo ich wohne. Ich werde Sie dort erwarten.«
Ich kehrte dann auch gleich voller Ungeduld zurück, um die Einzelheiten seines Missgeschicks und die näheren Umstände seiner Reise nach Amerika zu erfahren. Ich erwies ihm alle erdenkliche Fürsorge und gab Anweisung, es ihm an nichts fehlen zu lassen. Er wartete nicht, bis ich ihn bat, mir seine Lebensgeschichte zu erzählen, sondern kam meinem Wunsche zuvor.
»Mein Herr«, sagte er, »Sie haben so edel an mir gehandelt, daß ich es mir als Undankbarkeit anrechnen müßte, Ihnen irgend etwas von mir zu verheimlichen. Ich will Ihnen daher nicht nur mein Unglück und meine Leiden erzählen, sondern auch meine Fehler und meine tadelnswerten Schwächen bekennen. Ich bin sicher, wenn Sie mich auch verdammen, so werden Sie doch nicht umhin können, mich zu beklagen.«
Ich muß hier für den Leser bemerken, daß ich seine Geschichte fast unmittelbar, nachdem ich sie gehört hatte, niederschrieb und daß die Wahrheitstreue und Genauigkeit dieser Erzählung über jeden Zweifel erhaben sind. Ich gebe auch ebenso wahrheitsgetreu die Gedanken und Gefühle wieder, die der junge Abenteurer mit liebenswürdiger Unbefangenheit zum Ausdruck brachte.
Hier folgt nun sein Bericht:
Ich war siebzehn Jahre alt und beendete die oberste Klasse auf dem Gymnasium zu Amiens, wohin mich meine Eltern geschickt hatten, die zu einer der ersten Familien in P. gehören. Ich führte ein so besonnenes und geregeltes Leben, daß mich meine Lehrer als Musterschüler bezeichneten. Nicht, daß ich mir besondere Mühe gab, dieses Lob zu verdienen, aber ich besaß von Natur aus eine sanfte und ruhige Veranlagung und eine besondere Neigung zum Studium, und meinen natürlichen Widerwillen gegen das Laster rechnete man mir als besondere Tugend an. Meine Herkunft, der Erfolg meiner Studien und einige äußere Vorzüge brachten mir die Bekanntschaft und Achtung aller Bürger der Stadt ein.
Das öffentliche Examen bestand ich so glänzend, daß der anwesende Bischof mir vorschlug, mich dem geistlichen Stand zu widmen, in dem ich mir, wie er sagte, größere Auszeichnung verschaffen würde als in dem Malteserorden, für den mich meine Eltern bestimmt hatten und dessen Kreuz sie mich bereits unter dem Namen eines Chevalier des Grieux tragen ließen. Als die Ferien nahten, traf ich meine Vorbereitungen, um zu meinem Vater zurückzukehren, der mir versprochen hatte, mich bald auf die Akademie zu schicken.
Beim Abschied von Amiens bedauerte ich allein, daß ich dort einen Freund zurücklassen mußte, mit dem ich von jeher schon auf das innigste verbunden war. Er war einige Jahre älter als ich; wir sind zusammen erzogen worden. Da aber seine Familie nur wenig begütert war, mußte er in den geistlichen Stand treten und in Amiens zurückbleiben, um hier sein Studium fortzusetzen. Er war reich an guten Eigenschaften, und seine wertvollsten werden Sie im Verlauf meiner Geschichte kennenlernen, in der vor allem sein Eifer und sein Edelmut beispielhaft sind. Hätte ich damals seinen Rat befolgt, so wäre ich immer weise und glücklich geblieben. Und selbst in dem Abgrund, in den mich meine Leidenschaften gestürzt haben, hätte ich immer noch manches aus dem Schiffbruch meines Glücks und meines Ansehens gerettet, wenn ich aus seinen Vorwürfen Nutzen gezogen hätte. Aber für alle seine Bemühungen hat er nur den Schmerz geerntet, einsehen zu müssen, daß sie umsonst waren und ihm von einem Undankbaren übel vergolten wurden, der sie als lästig oder zudringlich empfand.
Ich hatte den Zeitpunkt meiner Abreise von Amiens festgesetzt. Ach, hätte ich sie doch einen Tag früher angetreten! Ich hätte meinem Vater meine ganze Unschuld zurückgebracht. Am Vortag meiner Abreise aus der Stadt schlenderte ich mit meinem Freund Tiberge durch die Straßen, als wir den Postwagen aus Arras ankommen sahen. Wir folgten ihm bis zum Gasthof, wo er hielt. Uns trieb dabei nichts anderes als die Neugierde. Einige Frauen stiegen aus, die rasch verschwanden; nur ein sehr junges Mädchen blieb allein im Hofe stehen. Ein Mann von vorgerücktem Alter, der ihr offenbar als Führer diente, war bemüht, ihr Gepäck aus dem Fahrzeug zu schaffen. Sie erschien mir so reizend, daß ich – der noch nie an die Verschiedenheit der Geschlechter gedacht, noch nie ein Mädchen mit Aufmerksamkeit betrachtet hatte, dessen Vernunft und Zurückhaltung alle Welt bewunderte – plötzlich bis zum Wahnsinn entflammt ward. Ich besaß den Fehler, daß ich außerordentlich schüchtern und leicht aus der Fassung zu bringen war, aber in diesem Augenblick hinderte mich meine Schwäche durchaus nicht daran, mich der Herrin meines Herzens zu nähern. Obgleich sie noch jünger war als ich, ließ sie sich meine Aufmerksamkeiten ohne merkliche Verlegenheit gefallen. Ich fragte sie, was sie nach Amiens führe und ob sie hier Bekannte habe. Sie antwortete mir unbefangen, ihre Eltern schickten sie hierher, damit sie Nonne werde. Die Liebe hatte mich seit dem Augenblick, da sie von mir Besitz genommen, schon so erleuchtet, daß ich diese Absicht als einen tödlichen Schlag gegen meine Wünsche empfand. Ich sprach zu ihr in einer Art, die ihr meine Gefühle wohl verständlich machte, denn sie war viel erfahrener als ich, und ohne Zweifel schickte man sie ja gerade deshalb ins Kloster, weil man dort ihrem schon damals offenbaren Hang zu Vergnügungen, der in der Folge ihr und mein Unglück herbeiführen sollte, entgegenzuwirken hoffte. Ich bot gegen die grausame Absicht ihrer Eltern alle Gründe auf, die meine aufkeimende Liebe und meine scholastische Beredsamkeit mir nur eingeben konnten.
Nachdem sie einen Augenblick geschwiegen hatte, sagte sie, daß sie nur zu gut voraussehe, wie unglücklich sie sein werde, aber daß dies wohl der Wille des Himmels sei, da sich ihr kein Ausweg biete. Ihre sanften Blicke, der Zauber ihrer Schwermut, mit der sie dieses sprach, vielleicht auch mein Verhängnis, das mich ins Verderben reißen wollte, ließen mich keinen Augenblick mit meiner Antwort zögern. Ich versicherte ihr, wenn sie in meine Ehre und die unendliche Zuneigung, die sie mir schon jetzt einflöße, Vertrauen setze, so wolle ich mein Leben wagen, um sie aus der Tyrannei ihrer Eltern zu befreien und glücklich zu machen.
Meine schöne Unbekannte wußte sehr wohl, daß man in meinem Alter kein Betrüger ist. Sie gestand, mir mehr zu schulden als das Leben, wenn ich eine Möglichkeit zu ihrer Befreiung ausfindig machte. Ich sei zu jedem Wagnis bereit, beteuerte ich. Da ich aber nicht genug Lebenserfahrung besaß, um auf der Stelle einen Weg zur Rettung zu erkennen, blieb es zunächst bei dieser allgemeinen Versicherung, die weder ihr noch mir half.
Ihr bejahrter Argus war inzwischen zurückgekehrt, und alle meine Hoffnungen wären gescheitert, hätte sie nicht genügend Geistesgegenwart besessen, meiner Unbeholfenheit beizuspringen. Zu meinem Erstaunen nannte sie mich in seiner Gegenwart Vetter und erklärte mir ohne die geringste Verlegenheit, sie sei so glücklich, mich hier in Amiens getroffen zu haben, daß sie ihren Eintritt ins Kloster bis zum nächsten Tag verschieben wolle, um sich das Vergnügen zu verschaffen, mit mir des Abends zu speisen. Ich verstand den Sinn dieser List sehr gut und schlug ihr vor, in einem Gasthof zu übernachten, dessen Besitzer sich in Amiens niedergelassen hatte, nachdem er lange Zeit bei meinem Vater Kutscher gewesen und mir in jeder Beziehung ergeben war.
Ich führte sie selbst dorthin, während der alte Begleiter etwas unzufrieden schien und mein Freund Tiberge, der nicht wußte, was er von diesem Vorgang halten sollte, schweigend folgte. Unsere Unterhaltung hatte er nicht gehört, da er im Hofe auf und ab gegangen war, während ich meiner schönen Gebieterin Liebesworte zuflüsterte. Aus Furcht vor seiner Tugendstrenge befreite ich mich von ihm dadurch, daß ich ihn bat, mir etwas zu besorgen. Bei unserer Ankunft im Gasthaus hatte ich also das Vergnügen, mit meiner Herzenskönigin allein zu sein.
Ich erkannte bald, daß ich weniger Kind war, als ich es zu sein glaubte. Mein Herz öffnete sich tausend Empfindungen der Lust, von denen ich niemals etwas geahnt hatte. Eine süße Glut durchrann meine Adern. Ich befand mich in einem solchen Zustand der Verzückung, daß ich oft kein Wort hervorbringen und mich nur durch die Sprache meiner Augen verständlich machen konnte.
Mademoiselle Manon Lescaut, wie sie sich nannte, schien über die Wirkung ihrer Reize sehr erfreut. Wie ich zu bemerken glaubte, war sie nicht weniger bewegt als ich.
Sie gestand mir, daß sie mich liebenswert finde und entzückt wäre, mir ihre Freiheit zu verdanken. Sie wollte wissen, wer ich sei, und diese Kenntnis vermehrte noch ihre Zuneigung, denn sie war von bürgerlicher Herkunft und fühlte sich geschmeichelt, einen Verehrer von Stand gewonnen zu haben. Wir unterhielten uns über die Möglichkeiten, einander anzugehören.
Nach mancherlei Erwägungen fanden wir kein anderes Mittel als das der Flucht. Wir mußten dabei die Wachsamkeit ihres Begleiters täuschen, der, wenn auch nur ein Bedienter, doch zu berücksichtigen war. Wir kamen überein, daß ich während der Nacht einen Reisewagen bereitstellen und in aller Frühe zurückkommen sollte, ehe man im Gasthof erwachte. Dann wollten wir uns still davonmachen und geradewegs nach Paris fahren, um uns dort trauen zu lassen. Ich besaß etwa fünfzig Taler, die Frucht meiner kleinen Ersparnisse, sie hatte etwa das Doppelte. Wie unerfahrene Kinder bildeten wir uns ein, diese Summe werde nie ein Ende nehmen; und in gleichem Maße waren wir auch vom Gelingen unserer anderen Pläne überzeugt.
Nachdem ich mit einem Genuss, wie ich ihn nie zuvor gekannt, zu Abend gespeist hatte, zog ich mich zurück, um an die Ausführung unseres Planes zu gehen. Meine Maßnahmen waren um so leichter zu verwirklichen, als ich in der Absicht, am nächsten Tag zu meinem Vater zurückzukehren, mein geringes Gepäck schon vorbereitet hatte. Ich brauchte es also nur fortschaffen zu lassen und für fünf Uhr einen Wagen zu bestellen. Um diese Zeit mußten die Stadttore schon geöffnet sein. Trotzdem aber fand sich ein Hindernis, an das ich nicht gedacht hatte und das beinahe das ganze Unternehmen vereitelt hätte.
Tiberge war zwar nur drei Jahre älter als ich, aber schon ein gereifter Jüngling mit ausgeprägtem sittlichem Empfinden. Er liebte mich mit außergewöhnlicher Zärtlichkeit, und der Anblick eines so hübschen Mädchens wie Manon, meine Beflissenheit, sie zu begleiten, und dann der auffallende Eifer, ihn fernzuhalten, hatten ihn argwöhnisch gemacht. Zwar hatte er es nicht gewagt, in den Gasthof zurückzukehren, um mich durch sein Erscheinen nicht zu kränken, aber er war in meine Wohnung gegangen und wartete dort auf mich, obgleich es bis zu meiner Ankunft zehn Uhr wurde. Seine Anwesenheit verdroß mich, was er leicht aus meinem gezwungenen Wesen ersehen konnte.
»Ich bin überzeugt«, sagte er ganz offen, »daß du Absichten hegst, die du mir verbergen willst. Ich sehe es an deinem Gesicht.«
Ich antwortete ihm schroff, ich sei nicht verpflichtet, ihm über meine Pläne Rechenschaft abzulegen.
»Gewiß nicht«, fuhr er fort. »Aber bisher hast du mich immer als Freund behandelt, und in dieser Eigenschaft könnte ich wohl ein wenig Vertrauen erwarten.«
Er bat mich so inständig und beharrlich, ihm mein Geheimnis zu entdecken, daß ich, der ihm nie etwas verhehlt hatte, auch meine Leidenschaft unumwunden gestand. Er nahm meine Beichte mit so deutlicher Missbilligung zur Kenntnis, daß ich unwillkürlich erbebte. Ich bereute sofort die Voreiligkeit, mit der ich ihm meinen Fluchtplan mitgeteilt hatte.
Er sagte, er sei zu sehr mein Freund, um sich all dem nicht nach Kräften zu widersetzen. Zunächst einmal wolle er mir alle Gründe vorhalten, die mich vielleicht noch umstimmen könnten. Wenn ich aber auch dann nicht von meinem verderblichen Entschluss zurücktrete, dann werde er Leute benachrichtigen, die der Sache ein für allemal ein Ende machen könnten. Er hielt mir wohl eine Viertelstunde lang eine ernsthafte Strafpredigt, die mit der Drohung endete, mich zu verraten, wenn ich ihm nicht mein Wort gäbe, ehrenhaft und vernünftig zu handeln.
Ich war verzweifelt, mich so zur Unzeit verraten zu haben. Aber die Liebe hatte in den zwei oder drei Stunden meinen Verstand schon so geschärft, daß mir einfiel, ihm von der Absicht, meinen Plan schon am nächsten Morgen auszuführen, noch nichts gesagt zu haben; und ich beschloß, ihn zu täuschen.
»Tiberge«, sagte ich zu ihm, »ich habe dich immer für meinen Freund gehalten und wollte dich nur auf die Probe stellen. Es stimmt, daß ich verliebt bin. Was aber meine Flucht angeht, so ist das ein Unternehmen, das man nicht unüberlegt durchführen darf. Komm morgen früh um neun zu mir; ich will Dich meiner Geliebten vorstellen, und du sollst selbst urteilen, ob sie es wert ist, daß ich einen solchen Schritt für sie unternehme.«
Hierauf verließ er mich, mir unzählige Male seine Freundschaft beteuernd.
Ich verbrachte die Nacht damit, alle meine Angelegenheiten zu ordnen; und als ich bei Tagesgrauen vor den Gasthof kam, erwartete mich Manon bereits. Sie stand an ihrem Fenster, das nach der Straße hinausging, und öffnete mir sogleich die Tür. Geräuschlos verließen wir das Haus. Sie hatte kein anderes Gepäck als ihre Wäsche, die ich trug. Der Wagen stand zur Abfahrt bereit.
Später werde ich erzählen, was Tiberge tat, als er mein Täuschungsmanöver entdeckte. Doch entzog er mir nicht seine Freundschaft. Sie werden sehen, wie weit er ging und wie viele Tränen ich vergießen müßte bei dem Gedanken, ihm seine Treue so übel vergolten zu haben.
Wir beeilten uns so sehr, daß wir noch vor Einbruch der Nacht Saint-Denis erreichten. Da ich neben dem Wagen hergeritten war, hatten wir uns nur unterhalten können, wenn die Pferde gewechselt wurden. Aber jetzt, so nahe bei Paris und damit sozusagen in Sicherheit, gönnten wir uns Zeit für einen Imbiss, denn wir hatten seit unserer Abreise aus Amiens noch nichts gegessen. So leidenschaftlich verliebt ich in Manon war, wußte sie mich doch zu überzeugen, daß sie mich nicht minder liebte. Wir hielten mit unseren Zärtlichkeiten so wenig zurück, daß wir uns gar nicht erst geduldeten, unser Alleinsein abzuwarten. Die Kutscher und Gastwirte sahen uns kopfschüttelnd an, und ich bemerkte, wie erstaunt sie waren, daß sich zwei Kinder unseres Alters so rasend liebten.
Unsere Heiratspläne waren in Saint-Denis vergessen. Wir setzten uns über die Rechte der Kirche hinweg und waren Gatten, ehe wir überhaupt nur nachgedacht hatten. Bei meiner zärtlichen und beständigen Veranlagung wäre ich sicher mein ganzes Leben lang glücklich geblieben, hätte mir Manon die Treue gehalten. Je besser ich sie kennenlernte, desto mehr liebenswürdige Eigenschaften entdeckte ich an ihr. Ihr Geist, ihr Herz, ihre Sanftmut und Schönheit bildeten eine so starke und süße Kette, daß ich es als mein höchstes Glück betrachtete, immer von ihr gefesselt zu sein. Wie furchtbar sollte sich das ändern!
In Paris mieteten wir eine möblierte Wohnung, Sie lag in der Rue V... und zu meinem Unglück neben dem Haus des Herrn de B., eines bekannten Steuerpächters. Drei Wochen vergingen, und ich war in dieser Zeit so von meiner Leidenschaft erfüllt, daß ich wenig an meine Familie dachte und an den Kummer, den mein Vater über meine Abwesenheit empfinden mußte. Da ich mir aber keine Ausschweifung vorzuwerfen hatte und auch Manon zurückhaltend war, mußte mich die Ruhe unseres Daseins allmählich wieder an meine Pflicht erinnern.
Ich beschloß, wenn möglich, mich mit meinem Vater auszusöhnen. Meine Geliebte war so reizend und würde ihm ohne Zweifel gefallen, wenn es mir nur gelänge, ihn mit ihren Vorzügen bekannt zu machen. Mit einem Wort, ich schmeichelte mir, seine Erlaubnis zur Heirat zu erlangen, nachdem meine Hoffnung, sie ohne diese Zustimmung zu heiraten, enttäuscht worden war. Ich teilte Manon meine Absicht mit und gab ihr zu verstehen, daß mich außer den Gefühlen der kindlichen Liebe und des Gehorsams auch die Not dazu treibe, da unsere Mittel sehr schnell zur Neige gingen und ich nicht mehr an ihre Unerschöpflichkeit glaubte.
Manon nahm diesen Vorschlag kühl auf, doch kamen ihre Einwendungen nur aus ihrer großen Zärtlichkeit und aus ihrer Sorge, mich zu verlieren. Wenn mein Vater unseren Zufluchtsort kannte und unsere Absichten nicht billigte, so war nicht im geringsten daran zu zweifeln, welches grausame Verhängnis mir drohte. Auf meinen Einwand, die Not zwinge uns dazu, entgegnete sie, für einige Wochen hätten wir ja noch genug zum Leben und dann werde sie schon dank der Freundschaft einiger Verwandter in der Provinz, an die sie schreiben wolle, neue Hilfsmittel erschließen können. Sie versüßte mir ihre Weigerung durch so hingebende und leidenschaftliche Zärtlichkeiten, daß ich, der ich nur in ihr lebte und nicht das geringste Mißtrauen gegen sie hegte, alle ihre Einwände und Pläne billigte.
Ich hatte ihr die Kasse und die Sorge für unsere täglichen Bedürfnisse anvertraut. Nach und nach bemerkte ich, daß unser Tisch besser bestellt war und daß sie sich einige kostspielige Kleidungsstücke angeschafft hatte. Da ich wohl wußte, daß wir höchstens noch zwölf bis fünfzehn Pistolen besitzen konnten, äußerte ich meine Verwunderung über diesen offenbaren Zuwachs unseres Reichtums. Lachend bat sie mich, mir keine Sorgen zu machen.
»Habe ich dir nicht versprochen«, sagte sie, »Geldquellen zu finden?«
Ich liebte sie viel zu arglos, um so leicht einen Verdacht zu schöpfen.
Eines Nachmittags war ich mit dem Bescheid ausgegangen, daß ich länger als gewöhnlich fortbleiben werde, und mußte bei der Rückkehr zu meiner Verwunderung zwei oder drei Minuten an der Tür warten. Wir hatten ein junges Mädchen zur Bedienung, das ungefähr in unserem Alter war. Als sie mir endlich öffnete, fragte ich sie, wo sie so lange geblieben sei. Sie antwortete verlegen, sie habe mein Klopfen überhört.
»Wenn du mich nicht gehört hast«, sagte ich, »wie kommt es dann, daß du mir überhaupt aufmachst?«
Ich hatte nämlich nur einmal geklopft.
Meine Frage brachte sie in eine solche Verwirrung, daß sie nicht genügend Geistesgegenwart zu einer Ausrede fand. Sie begann zu weinen und versicherte mir, es sei nicht ihre Schuld, denn Madame habe es ihr verboten zu öffnen, ehe nicht Herr de B. sich über die zur Wohnung gehörige Hintertreppe entfernt habe.
Ich war so fassungslos, daß ich nicht den Mut hatte, die Wohnung zu betreten. Ich entfernte mich wieder, unter dem Vorwand, noch eine Besorgung machen zu müssen. Ich befahl dem Mädchen, seiner Herrin auszurichten, ich käme gleich zurück, ihr aber zu verschweigen, daß ich etwas von Herrn de B. wisse.
Meine Bestürzung war so groß, daß ich Tränen vergoß, während ich die Treppe wieder hinabstieg, ohne zu wissen, aus welchem Gefühl diese Tränen kamen. Ich betrat das erste beste Kaffeehaus, setzte mich an einen Tisch und stützte den Kopf in beide Hände, um mir klarzuwerden, was in meinem Inneren vorging. Ich wagte kaum an das zu denken, was ich soeben gehört hatte. Ich wollte es als eine Sinnestäuschung betrachten und war zwei- oder dreimal im Begriff heimzukehren, ohne mir anmerken zu lassen, daß ich etwas wisse. Es schien mir so unmöglich, daß Manon mich habe verraten können, daß ich sogar in der bloßen Vermutung eine Ungeheuerlichkeit sah. Ich betete sie an, das stand fest, und ich hatte von ihr ebenso viele Beweise der Liebe empfangen, wie ich ihr gegeben hatte. Wie kam ich dazu, sie zu beschuldigen, sie sei weniger aufrichtig und treu als ich? Welchen Grund hätte sie gehabt, mich zu betrügen? Es war erst drei Stunden her, seit sie mich mit den zärtlichsten Liebkosungen überschüttet und die meinigen mit Entzücken empfangen hatte.
»Nein, nein«, sagte ich zu mir. »Es ist unmöglich, daß Manon mich verraten hat. Sie hat keinen Grund, mich zu betrügen.«
Trotzdem beunruhigte mich der Besuch und der heimliche Aufbruch des Herrn de B. Mir fielen auch die kleinen Anschaffungen Manons ein, die nicht recht zu unseren augenblicklichen Geldverhältnissen zu passen schienen. Und das Geständnis, das sie mir über Geldquellen gemacht hatte, die mir unbekannt waren? Ich hatte Mühe, so vielen Rätselfragen eine Auslegung zu geben, wie sie mein Herz ersehnte.
Andererseits hatte ich sie, seit wir in Paris waren, fast nie aus den Augen verloren. Bei allen Geschäften, Spaziergängen, allen Zerstreuungen waren wir immer zusammen gewesen, denn schon eine kurze Trennung hätte uns allzu sehr betrübt. Wir mußten uns unaufhörlich sagen, daß wir uns liebten, wir wären sonst vor Angst umgekommen. Ich konnte mir daher einfach nicht vorstellen, daß Manon auch nur einen Augenblick an einen anderen als mich denken sollte.
Schließlich glaubte ich die Lösung des Geheimnisses gefunden zu haben. »Herr de B.«, sagte ich mir, »ist ein großer Geschäftsmann, der viele Beziehungen hat. Die Verwandten Manons werden sich seiner bedient haben, um ihr Geld zukommen zu lassen. Vielleicht hat sie schon etwas von ihm erhalten, und heute hat er ihr wieder etwas gebracht. Zweifellos hat sie mir das verheimlicht, um mir eine freudige Überraschung zu bereiten. Vielleicht hätte sie auch schon mit mir darüber gesprochen, wenn ich in gewohnter Weise zurückgekommen wäre, statt mich hier trüben Gedanken zu überlassen. Sie wird es mir um so weniger verschweigen, als ich selbst mit ihr darüber sprechen will.«
Ich hatte mir diese Auffassung so fest in den Kopf gesetzt, daß meine Traurigkeit merklich nachließ, und kehrte alsbald in meine Wohnung zurück. Ich umarmte Manon mit gewohnter Zärtlichkeit, und sie empfing mich sehr liebenswürdig. Anfangs war ich geneigt, ihr meine Vermutungen, von deren Richtigkeit ich jetzt fest überzeugt war, zu offenbaren. Ich hielt mich aber zurück in der Hoffnung, daß sie mir vielleicht zuvorkommen und den ganzen Vorgang mitteilen werde.
Das Abendessen wurde aufgetragen. Ich setzte mich froh und guter Dinge zu Tisch. Aber beim Schein der Kerze, die zwischen uns stand, glaubte ich, im Gesicht und in den Augen meiner Geliebten eine gewisse Traurigkeit zu bemerken. Diese Beobachtung betrübte mich ebenfalls. Mir fiel auf, daß ihre Blicke in einer ganz anderen Art als sonst auf mir ruhten, aber ich konnte nicht unterscheiden, ob dies Liebe oder Mitleid war. Jedenfalls schien es mir ein sanftes, schmachtendes Gefühl. Ich betrachtete sie mit derselben Aufmerksamkeit, und vielleicht hatte sie die gleiche Mühe, aus meinen Blicken auf den Zustand meines Herzens zu schließen. Wir dachten weder an Sprechen noch an Essen. Endlich sah ich, wie Tränen aus ihren schönen Augen fielen – verräterische Tränen!
»Mein Gott!« rief ich aus. »Du weinst, süße Manon? Du bist zu Tränen betrübt und sagst mir mit keinem Wort, was dir fehlt?«
Sie antwortete mir nur mit einigen Seufzern, die meine Unruhe noch vergrößerten. Zitternd stand ich auf und beschwor sie mit dem innigsten Ausdruck meiner Liebe, mir die Ursache ihres Kummers zu entdecken. Ich vergoß selber Tränen, während ich die ihrigen trocknete. Ich war mehr tot als lebendig. Ein Barbar wäre durch die Äußerungen meines Schmerzes und meiner Besorgnisse gerührt worden.
Während ich so beschäftigt war, hörte ich, daß mehrere Leute die Treppe heraufkamen. Es klopfte leise an die Tür. Manon gab mir einen Kuss und entschlüpfte schnell meinen Armen, floh in das Schlafzimmer und schloß sofort hinter sich zu. Ich glaubte, da ihr Kleid etwas in Unordnung geraten war, wolle sie sich vor den Augen der Fremden, die angeklopft hatten, verbergen. Ich öffnete ihnen selbst.