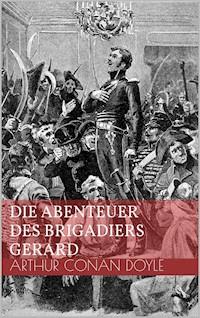
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sir Arthur Ignatius Conan Doyle M.D. (geboren 22. Mai 1859 in Edinburgh, Schottland; gestorben 7. Juli 1930 in Crowborough, Sussex, England) war ein britischer Arzt und Schriftsteller. Er veröffentlichte die Abenteuer von Sherlock Holmes und dessen Freund Dr. Watson. Bekannt ist auch die Figur Professor Challenger aus seinem Roman "Die vergessene Welt", die als Vorlage für zahlreiche Filme und eine mehrteilige Fernsehserie diente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Abenteuer des Brigadiers Gerard
Vorwort.Erster Teil. Wie der Brigadier das Ohr verlor. Wie der Brigadier Saragossa eroberte. Wie der Brigadier an einer Fuchsjagd teilnahm. Wie der Brigadier eine Armee rettete. Zweiter Teil. Wie der Brigadier die »Brüder« erschlug. Wie der Brigadier den König hatte. Wie der König den Brigadier hatte. Wie der Brigadier gegen Millefleurs zog. Dritter Teil. Wie der Brigadier das Schicksal Deutschlands in der Tasche hatte. Wie der Brigadier nach Minsk ritt. Wie der Brigadier nach der Schreckensburg kam. Wie sich der Brigadier seine Medaille holte. Vierter Teil. Wie der Brigadier vom Teufel versucht wurde. Wie der Brigadier in England Triumphe feierte. Wie sich der Brigadier bei Waterloo auszeichnete. I Die Geschichte in der Waldschenke. II Die Geschichte von den neun preußischen Reitern. Wie der Brigadier sein letztes Abenteuer bestand.ImpressumVorwort.
Diejenigen der freundlichen Leser, welche sich für die kleinen Erzählungen eines napoleonischen Soldaten genug interessieren, um mir bis zu den Quellen zu folgen, aus welchen ich schöpfte, mögen sich im Geiste um ein Jahrhundert zurückversetzen. Es war eine wechselvolle, militärisch reich bewegte Zeit damals, und die zeitgenössische Literatur gehört zu der fesselndsten, die ich jemals gelesen. Abgesehen von den großen geschichtlichen Werken oder den Biographien der Heerführer gibt es eine Menge Aufzeichnungen von solchen, die am Kriegsleben aktiv teilgenommen und die ihre Erlebnisse immer von dem Standpunkte desjenigen Truppenteils aus schilderten, dem sie angehörten. Die Reiterei war besonders glücklich daran in bezug auf Schreiber von Memoiren. So de Rocca mit seinen » Mémoires sur la Guerre des Français en Espagne«, die Erzählungen eines Husaren enthaltend. während de Naylies in seinen » Mémoires sur la Guerre d'Espagne« dieselben Kriegsereignisse vom Standpunkte eines Dragoners aus schildert. Dann haben wir die » SouvenirsMilitairs du Colonel de Gonnville«, die eine Anzahl Feldzüge, darunter auch den spanischen, behandeln, betrachtet vom Standpunkte eines stahlgepanzerten, schwer behelmten Kürassiers. Besonders wertvoll unter all diesen Werken und unter allen militärischen Memoiren überhaupt sind General Marbots berühmte Memoiren.1 Marbot war von den Chasseurs, so haben wir also auch hier wieder den Standpunkt des Kavalleristen. Unter anderen Büchern, welche das Verständnis für den napoleonischen Soldaten fördern, sind noch zu nennen: » Les Cahiers du Capitaine Coignet«2, das Kriegstheater vom Standpunkt des Gardisten aus beleuchtend, und » Les Mémoires du Sergeant Bourgogne«3, ebenfalls von der Garde. Das » Journal« des Sergeanten Fricasse und die » Recollections« de Fecenacs und de Ségurs vervollständigen das Material, welches ich benutzte, um für die fiktive Gestalt des Brigadiers Gerald ein historisch treues und militärisches Milieu zu schaffen.
Arthur Conan Doyle.
Deutsche Ausgabe im Verlag von Robert Lutz in Stuttgart. Siehe Seite 207 und 208.
Eine deutsche Ausgabe erscheint demnächst im selben Verlag.
Deutsche Ausgabe im Verlag von Robert Lutz in Stuttgart. Siehe Seite 207 und 208.
Erster Teil.
Wie der Brigadier das Ohr verlor.
Im Café saß der alte Brigadier und erzählte Geschichten aus seiner Jugendzeit.
Ich habe eine erkleckliche Anzahl Städte gesehen, Messieurs. In viele bin ich als Sieger eingezogen an der Spitze meiner achthundert braven, sporenklirrenden Reiter. An der Tete der Grande Armée war die Kavallerie, an der Spitze der Kavallerie waren die Husaren, und an der Spitze der Husaren war ich. Aber von all diesen Städten, die wir besucht haben, hat Venedig die ungünstigste und lächerlichste Lage. Ich kann mir nicht denken, wie sich die Erbauer dieser Stadt eigentlich ein Kavalleriemanöver vorgestellt haben. Selbst ein Murat oder Lasalle könnte keine Schwadron in diesem Nest einstellen. Deshalb ließen wir die Kellermannschen schweren Reiter und auch meine Husaren in Padua in Quartier. Nur Infanterie unter dem Kommando Suchets hielt die Stadt besetzt. Mich hatte dieser General als Adjutanten für diesen Winter ausgesucht, weil ihm meine Affäre mit dem italienischen Fechtmeister in Mailand imponiert hatte. Der Mann schlug eine gute Klinge, und es war ein Glück für das Ansehen der französischen Waffen, daß ich's war, der ihm als Gegner gegenübergestellt wurde. Uebrigens geschah's ihm recht, denn, wenn man den Gesang einer Primadonna nicht schön findet, so braucht man ja nicht zuzuhören: aber ein hübsches Weib öffentlich zu beleidigen, ist eine Angehörigkeit, die geahndet werden muß. So hatte ich denn auch die allgemeine Sympathie auf meiner Seite, und, nachdem die Geschichte vorüber und der Witwe des Mannes die beanspruchte Pension zugestanden war, wählte mich Suchet zu seinem persönlichen Adjutanten, und ich ging mit ihm nach Venedig, wo ich das seltsame Abenteuer erlebte, das ich Ihnen eben erzählen will, meine Herren.
Es ist wohl kaum jemand von Ihnen in Venedig gewesen? Nein, denn die Franzosen reisen nicht viel. Aber in jenen Tagen waren wir tüchtige Reisende. Von Moskau bis nach Kairo sind wir gereist, freilich in größeren Gesellschaften als den Leuten angenehm war, die wir besuchten, und unsere Pässe und Visitenkarten bildeten die Kanonenrohre. Es wird eine böse Zeit für Europa anbrechen, wann die Franzosen wieder auf Reisen gehen, denn sie verlassen zwar ihre Heimat äußerst ungern, aber wenn sie einmal den schwierigen Entschluß gefaßt haben und einen Führer besitzen wie unseren kleinen Korporal, der ihnen den Weg richtig weist, dann weiß auch kein Mensch, wann sie wieder umkehren. Doch diese glorreichen Zeiten sind dahin, die großen Männer sind tot, und ich, der letzte von ihnen, muß hier bei einer Flasche Landwein sitzen und mich darauf beschränken, alte Anekdoten aus jener Zeit im Café zum besten zu geben.
Aber richtig, ich wollte ja von Venedig sprechen, Messieurs. Die Leute wohnen dort wie die Wasserratten auf Dünen und Sandbänken; aber sie haben sehr feine Paläste, und die Kirchen, besonders die von St. Marcus, gehören zu den größten, die ich je gesehen habe. Aber ihr größter Stolz sind ihre Statuen und Gemälde, die in ganz Europa berühmt sind. Es gibt nun viele Soldaten, die meinen, daß ein Krieger weiter nichts kennen dürfe als Kämpfen und Plündern. Dazu gehörte zum Beispiel der alte Bouvet – der gegen die Preußen am nämlichen Tage fiel, wo ich mir die Kaiser-Medaille verdient habe; wenn Sie den aus dem Lager und der Kantine wegnahmen und über Wissenschaft oder Kunst zu ihm sprachen, saß er da und sah Sie verständnislos an. Am höchsten steht meiner Meinung nach aber doch derjenige Soldat, der wie ich nebenbei auch die Produkte des Geistes und des Gemütes zu beurteilen versteht. Ich bin zwar auch sehr jung in die Armee eingetreten, und der Feldwebel war mein einziger Lehrer: aber ich bin mit offenen Augen durch die Welt gegangen, und auf diese Weise kann und muß man sehr viel lernen.
Daher war ich auch in der Lage, in Venedig die Gemälde zu bewundern, und ich kannte die Namen der großen Meister, die sie gemalt hatten, den Michel Tizian und den Angelo und die anderen großen Meister. Auch Napoleon war ein Bewunderer ihrer Schöpfungen, wie jedermann zugeben wird, denn das erste, was er nach der Einnahme der Stadt tat, war, daß er die besten nach Paris schickte. Wir alle nahmen, was wir kriegen konnten: ich für meinen Teil hatte zwei Bilder. Das eine davon, »Die überraschten Nymphen«, behielt ich für mich, und das andere »Die Heilige Barbara«, machte ich meiner Mutter zum Präsent.
Uebrigens ist es wahr, daß sich einige von unseren Leuten, soweit es sich um die Statuen und Gemälde handelte, nicht besonders schön benommen haben. Die Venetianer hingen sehr an diesen Dingen, und die vier Bronzepferde über dem Hauptportal ihres Domes liebten sie wie ihre Kinder. Ich habe stets etwas von Pferden verstanden, und ich habe diese vier ordentlich betrachtet; aber wahrhaftig, es war nicht viel dran. Sie waren zu grobknochig für leichte Reiterei, und vor die Geschütze fehlte ihnen das nötige Gewicht. Sie waren jedoch die einzigen Pferde, die's in der ganzen Stadt gab, und die Bewohner kannten eben keine besseren. Sie weinten bitterlich, als sie fortgeschickt wurden, und in der darauffolgenden Nacht schwammen die Leichen von zehn französischen Soldaten in den Kanälen. Zur Strafe für diese Mordtaten wurden noch viel mehr Gemälde fortgesandt, und die Soldaten demolierten die Statuen und zerschossen die schön bemalten Fensterscheiben. Dies versetzte die Einwohnerschaft in Wut, und unser Aufenthalt in der Stadt wurde sehr ungemütlich. Viele Offiziere und Mannschaften sind in jenem Winter verschwunden, und man hat nicht 'mal ihre Leichname gefunden.
Ich persönlich hatte mächtig zu tun und daher nicht weiter unter diesen Verhältnissen zu leiden. In jedem Lande pflegte ich die Sprache zu studieren. Zu diesem Behuf halte ich immer nach irgend einer Dame Umschau, die so freundlich ist, mich zu unterrichten, und dann üben wir praktisch miteinander. Das ist die interessanteste Methode zur Erlernung, und als ich noch nicht dreißig Jahre alt war, konnte ich fast jede Sprache in ganz Europa. Allerdings hat, was man auf diese Weise lernt, keinen großen Zweck für den gewöhnlichen Umgang, denn was für'n Nutzen hat's für jemanden, der wie ich mit Soldaten und Bauern zu tun hat, wenn er ihnen sagen kann, ich liebe Euch ganz allein, oder, wenn der Krieg vorüber ist, komme ich zu Euch zurück?
Ich habe nie im Leben eine so süße Lehrerin gehabt wie in Venedig. Lucia hieß sie mit Vornamen und mit Zunamen – na, ein Kavalier merkt die Zunamen weniger. Ohne indiskret zu sein, kann ich Ihnen aber sagen, Messieurs, daß sie einer alten Patrizierfamilie entstammte, und ihr Vater war Doge von Venedig gewesen. Sie war eine auserlesene Schönheit – und wenn ich, Etienne Gerard, das Wort »auserlesen« anwende, so will das 'was heißen,Messieurs. Ich besitze ein Urteil, ich habe ein gutes Gedächtnis und auch reichhaltiges Vergleichsmaterial. Von all den Weibern, die mich geliebt haben, kann ich noch nicht zwanzig dieses Attribut erteilen. Aber ich wiederhole Ihnen, mes amis, Lucia war auserlesen schön. Von dem dunkeln Typus könnte ich ihr höchstens noch Dolores von Toledo zur Seite stellen. Als ich unter Massena in Portugal kämpfte, liebte ich in Santarem eine kleine Brünette – der Name ist mir entfallen. Sie war auch eine vollkommene Schönheit, aber die Figur und die Grazie der Lucia hatte sie doch nicht. Da war auch noch Agnes. Ich wüßte nicht, welcher ich den Vorzug geben sollte; aber Lucia bleibt doch die herrlichste von allen.
Bei Gelegenheit der Bilderaffäre hatte ich sie zum erstenmal gesehen. Ihr Vater besaß einen Palazzo auf der anderen Seite der Rialtobrücke am Canale Grande; an den Wänden dieses vornehmen Gebäudes befanden sich so wertvolle Bildhauerarbeiten, daß Suchet eine Abteilung Sappeurs hinschickte, um einige herauszunehmen und nach Paris senden zu können. Ich stand an der Spitze dieser Leute, und nachdem ich die Tränen der Lucia gesehen hatte, bekam ich den Eindruck, als ob die Kunstwerke zerbrechen würden, wenn ihnen die stützende Wand fehlte. Ich meldete das, und die Sappeurs wurden zurückgezogen. Dadurch wurde ich der Freund der Familie, und ich habe manchen Fiasco Chianti mit dem Vater geleert und manche süße Unterrichtsstunde bei der Tochter gehabt. Verschiedene französische Offiziere haben sich in jenem Winter in Venedig verheiratet, und ich würde es auch getan haben, denn ich liebte Lucia von tiefstem Herzen; aber Etienne Gerard hat sein Schwert, sein Roß, sein Regiment, seine Mutter, seinen Kaiser und seine Karriere. Ein flotter Husar hat wohl Platz in seinem Herzen für eine Geliebte, aber nicht für eine Frau. So dachte ich damals,Messieurs, freilich kannte ich die einsamen Tage noch nicht, in denen ich mich nach liebenden Händen sehnen und mich vor Wehmut umdrehen sollte, wenn ich alte Kameraden im Kreise ihrer Familie sah. Diese Liebe, die ich für Scherz und Spielerei gehalten hatte, sie verleiht – jetzt sehe ich's ein – dem Leben erst seinen wahren Gehalt, sie ist das Feierlichste und Heiligste auf Erden ... Danke,mon cher ami, merci! Der Wein ist gut, und eine zweite Flasche dürfte nichts schaden.
Und nun will ich Ihnen erzählen, inwiefern meine Liebe zu Lucia an dem schrecklichsten der vielen Abenteuer schuld war, die ich erlebt habe; und wo die Spitze meines rechten Ohrs geblieben ist. Sie haben schon oft wissen wollen, wie das gekommen ist. Heute abend sollen Sie's endlich 'mal erfahren, Messieurs.
Suchet hatte damals sein Hauptquartier in dem Palast des Dogen Dandolo in der Nähe des Marcusplatzes aufgeschlagen. Es war gegen Ende des Winters, und ich hatte das Theater Goldini besucht. Bei meiner Rückkehr fand ich ein Billett von Lucia vor, und draußen wartete eine Gondel. Sie bat mich, sofort zu ihr zu kommen, weil sie in Bedrängnis sei. Für einen Franzosen und einen Soldaten war die Antwort nicht zweifelhaft. Im nächsten Moment war ich im Boot, und der Gondoliere ruderte hinaus in den dunkeln Kanal. Ich weiß noch, daß mir beim Einsteigen die gewaltige Körpergröße des Mannes auffiel. Er war einer der breitesten Männer, die ich je gesehen habe. Aber die Gondolieri in Venedig sind überhaupt ein kräftiger Schlag, und man sieht häufig mächtige Kerle darunter. Der Bursche nahm hinter mir Platz und ruderte weiter.
Ein guter Soldat sollte in Feindesland immer auf seiner Hut sein. Das ist bei mir eine stete Lebensregel gewesen, und nur ihrer Befolgung verdanke ich's, daß ich heute in meinen alten Tagen noch das Leben habe. Aber in jener Nacht war ich so sorglos wie ein törichter junger Rekrut, der Angst hat, daß man ihn für furchtsam halten könnte. Meine Pistole hatte ich in der Eile zu Hause liegen lassen. Meinen Säbel hatte ich zwar an der Seite, aber er ist nicht in jedem Falle eine sonderlich geeignete Waffe. Ich saß zurückgelehnt in meiner Gondel, traumverloren bei dem lieblichen Rauschen des Wassers und dem monotonen Knarren des Ruders. Unser Weg führte durch ein Netzwerk enger Kanäle, zu beiden Seiten erhoben sich hohe Häuser, und über uns erblickte ich einen schmalen Streifen glitzernden Sternenhimmels. Hier und dort an den Brücken verbreitete eine Oellampe ihren trüben Schein, und manchmal schimmerte noch das schwache Licht einer Kerze vor einem Heiligenbild zu uns herüber. Sonst war alles dunkel und man konnte nur vorne am langen Schnabel unseres Fahrzeugs den weißen Saum des durchschnittenen Wassers sehen. Ort und Zeit waren wie geschaffen zum Träumen. Ich dachte an meine Vergangenheit, an all die groben Taten, an denen ich beteiligt gewesen war, an die Pferde, die ich geritten, und an die Frauen, die ich geliebt hatte. Dann flogen meine Gedanken auch zu meiner teuren Mutter, ich stellte mir die Freude vor, welche sie haben würde, wenn die Leute im Dorf den Ruhm ihres Sohnes verkündeten. Auch an den Kaiser dachte ich und an Frankreich, das Land meiner Väter, das sonnige Frankreich, das Mutterland so schöner Töchter und so tapferer Söhne. Mein Herz schlug höher in meiner Brust bei dem Gedanken, welchen Länderzuwachs wir ihm gebracht hatten. Seiner Größe wollte ich mein Leben weihen. Ich legte die Hand aufs Herz, um einen Schwur darauf zu tun, aber in diesem selben Augenblick fiel der Gondoliere von hinten über mich her.
Wenn ich sage, er fiel über mich her, so soll das nicht heißen, daß er mich bloß angriff, sondern daß er wirklich mit seinem ganzen Gewicht sich auf mich warf. Der Kerl steht hinter und über einem, während er rudert, sodaß man ihn weder sehen noch sich sonst gegen einen derartigen Ueberfall irgendwie schützen kann. Im Moment hatte ich noch mit stolzerhobener Brust dagesessen und im nächsten lag ich flach auf dem Boden des Bootes, und dieses Ungetüm auf mir, sodaß mir die Luft ausging. Ich spürte in meinem Nacken seinen heißen Atem. Im Nu hatte er mir den Säbel entrissen, einen Sack über meinen Kopf gestülpt und ihn mit einem Strick fest zugebunden. Da lag ich nun am Boden der Gondel, hilflos wie ein gefangener Vogel. Ich konnte nicht schreien, ich konnte mich nicht bewegen; ich war ein bloßes Bündel. In der nächsten Sekunde hörte ich wieder das Rauschen des Wassers und das Knarren des Ruders. Der Kunde hatte seine Arbeit vollendet und setzte seine Fahrt so ruhig und unbekümmert fort, als ob er gewöhnt wäre, alle Tage einen Husarenoberst in einen Sack zu stecken.
Ich kann Ihnen nicht in Worten ausdrücken, Messieurs, welche Demütigung und welche Wut ich empfand, als ich dalag wie ein geknebeltes Schaf, das zum Metzger gefahren wird. Ich, Etienne Gerard, der beste Reiter von sechs Brigaden, der beste Fechter derGrande Armée, in dieser Weise von einem einzigen unbewaffneten Manne gefangen! Trotzdem blieb ich ruhig liegen, denn es gibt eine Zeit des Widerstands und eine Zeit, wo man seine Kräfte aufsparen muß. Ich hatte gespürt, wie mich der Kerl am Arm gepackt hatte, und ich wußte, daß ich ihm gegenüber nur ein Kind wäre. Ich wartete also mit brennendem Herzen, bis sich eine passende Gelegenheit für mich bieten würde.
Wie lange ich da unten gelegen habe, weiß ich nicht, aber es kam mir lange vor, und ich hörte immer das Plätschern des Wassers und das monotone Geräusch der Ruder. Verschiedene Male bogen wir um eine Ecke, denn an mein Ohr drang der langgezogene, traurige Ruf, den die Gondolieri ausstoßen, wenn sie ihre Kollegen von ihrer Annäherung in Kenntnis setzen. Nach einer langen Fahrt merkte ich endlich, daß das Boot gegen eine Landungsstelle stieß. Der Kerl pochte dreimal mit dem Ruder gegen Holz, und als Erwiderung darauf hörte ich bald Riegel zurückschieben und Schlösser aufschließen und dann eine schwere Türe in den Angeln knarren.
»Hast du'n?« fragte eine Stimme auf Italienisch.
Das Scheusal, das mich in der Gewalt hatte, lachte laut auf und stieß mit dem Fuß auf den Sack, der mich enthielt.
»Da steckt er drin,« antwortete er.
»Sie warten schon.«
»Nehmt ihn doch,« sagte mein Räuber. Er hob mich auf, stieg ein paar Stufen hoch und warf mich auf einen harten Fußboden. Dann wurde das Tor wieder zugeriegelt und verschlossen. Ich war nun ein Gefangener in diesem Hause.
Aus dem Stimmengewirr und dem Getrampel erkannte ich, daß eine größere Anzahl Leute um mich herumstanden. Ich verstehe Italienisch viel besser als ich's spreche, und ich wußte sehr gut, was sie sagten.
»Du hast'n doch nicht totgeschlagen, Matteo?«
»Was schadet's, wenn ich's getan habe?«
»Meiner Treu, du wirst's vor dem Tribunale zu verantworten haben.«
»Sie wollen ihn ja doch töten, nicht wahr?«
»Allerdings, aber 's ist nicht unsere Sache, ihnen ins Handwerk zu pfuschen.«
»Ruhig! Er ist nicht tot. Tote beißen nicht, und ich hab' seine verdammten Zähne deutlich in meinem Daumen gespürt, als ich ihm den Sack über'n Kopf zog.«
»Er liegt aber sehr still.«
»Macht den Sack auf, dann werdet ihr schon sehen, daß er noch lebt.«
Das Seil wurde gelockert und der Sack fortgenommen. Ich lag mit geschlossenen Augen regungslos am Boden.
»Weiß Gott, Matteo, du hast ihm den Hals umgedreht.«
»Ach wo, er ist nur ohnmächtig. Um so besser für'n, wenn er nicht wieder zu sich kommt.«
Ich fühlte, wie mich jemand anfaßte.
»Matteo hat recht,« sagte eine Stimme. »Sein Herz klopft wie'n Hammer. Laßt'n ruhig liegen, er wird bald wieder aufwachen.«
Ich wartete noch einen Moment, dann wagte ich, verstohlen zwischen den Augenwimpern durchzublicken. Zuerst konnte ich nichts sehen, denn ich hatte zu lange im Dunkeln gesteckt, und es war an meinem gegenwärtigen Aufenthaltsort auch ziemlich düster. Allmählich fand ich jedoch heraus, daß ich eine hohe gewölbte Decke über mir hatte, die mit Gemälden von Göttern und Göttinnen geziert war. Das konnte keine gewöhnliche Halsabschneiderhöhle sein, ich mußte vielmehr in die Halle eines venetianischen Palazzo geschleppt worden sein. Dann warf ich ganz langsam und heimlich, ohne mich nur im geringsten zu rühren, einen Blick auf die Kerle, die um mich 'rum standen. Ich bemerkte meinen Gondelführer, einen dunkelbraunen, rohen Mordbuben, dann einen kleinen, schwächlichen Burschen, der eine befehlshaberische Miene machte und ein Schlüsselbund in der Hand hatte, und noch zwei große junge Kerle in schmucker Dienerlivree. Aus ihrem Gespräch entnahm ich, daß der Kleine der Hausmeister war, dem die anderen unterstanden.
Es waren ihrer also vier, aber den Schwachmatikus brauchte man nicht zu rechnen. Hätte ich eine Waffe gehabt, würde ich über eine solche Partie gelacht haben, aber im Handgemenge hatte ich keine Chancen gegen den einen allein, geschweige denn gegen alle. Ich mußte mich also auf meinen Kopf, nicht auf meine Faust verlassen. Ich blickte mich nach irgend einem Ausgang um und bewegte dabei ganz unmerklich den Kopf; aber so vorsichtig ich's auch getan hatte, es war meinen Wächtern nicht entgangen.
»Kommen Sie, wachen Sie auf, wachen Sie auf!« rief der schmächtige Hausverwalter.
»Steh' auf, kleiner Franzmann,« brummte der Gondoliere. »Marsch, auf!« und seiner zweiten Aufforderung verlieh er bereits mit dem Fuß den nötigen Nachdruck.
Noch nie ist ein Mensch einem Befehl so prompt nachgekommen, wie ich diesem. Im Moment war ich auf den Beinen und sauste, so rasch ich konnte, nach hinten. Sie rannten hinter mir her wie die Hunde auf einer Fuchsjagd, ich bog links in einen langen Gang, und noch 'mal links, und befand mich wieder in der alten Halle. Sie erwischten mich schon beinahe, ich hatte keine Zeit zum Ueberlegen, ich lief die Treppe 'nauf, aber zwei Männer kamen gerade 'runter, mir entgegen, ich machte kehrt, raste gegen die Tür, durch die ich 'reingeschafft worden war, aber ich konnte die schweren Riegel nicht aufkriegen. Der Gondoliere stürzte mit dem Dolch auf mich los, aber ich versetzte ihm 'nen Tritt vor den Bauch, daß er umfiel und sein Messer weit fortflog. Ich hatte keine Zeit, es aufzuheben, denn jetzt hatte ich ein halbes Dutzend auf dem Hals. Als ich zwischen ihnen durchraste, hielt mir der kleine Verwalter das Bein vor, ich fiel krachend zu Boden, war aber im nächsten Augenblick wieder auf, brach mitten durch sie durch, entriß mich ihren Händen und raste auf eine Tür zu am anderen Ende der Eingangshalle. Ich erreichte sie noch rechtzeitig, drückte auf die Klinke, stieß schon einen Triumphschrei aus, als ich merkte, daß sie aufging und ins Freie führte und ich gerettet wäre. Aber ich hatte nicht bedacht, in welch sonderbarer Stadt ich mich befand. Jedes Haus ist eine Insel. Als ich die Tür aufriß und hinauseilen wollte auf die Straße, sah ich im Schein des Flurlichtes das stille, schwarze Wasser vor mir, das bis an die oberste Stufe reichte. Ich prallte entsetzt zurück, und im nächsten Moment waren meine Verfolger an mir. Ich bin jedoch nicht so leicht zu fangen,Messieurs.
Wieder erfocht ich mir durch Tritte und Knüffe einen Weg, wenn ich auch ein Büschel Haare in der Hand des einen Burschen zurücklassen mußte. Der kleine Hausmeister schlug mit den Schlüsseln auf mich los, und ich wurde gerissen und gezerrt, aber ich kam durch. Ich stürzte wieder die Treppe 'nauf, stieß oben eine riesige Flügeltür auf, die mir im Weg stand, und sah nun endlich ein, daß alle meine Anstrengungen umsonst gewesen waren.
Der Raum, in den ich eingebrochen war, war prächtig erleuchtet. Die massiven Säulen mit den vergoldeten Cornichen, die bemalten Wände und die Decke sagten mir, daß ich mich in der großen Halle eines berühmten venetianischen Palastes befinden mußte. In dieser merkwürdigen Stadt gibt's viele Hunderte solcher Palazzi, von denen ein jeder Säle enthält, die sich leicht mit dem Louvre oder mit Versailles messen können. In der Mitte dieses großen Saales war ein hohes Postament errichtet, und darauf saßen im Halbkreis um einen Altar zwölf Männer in schwarzen Roben und mit einem schwarzen Schleier um die Stirn.
Eine Gruppe Bewaffneter – lauter rohe Schergen – standen an der Türe und zwischen ihnen, den Blick nach dem Altar gerichtet, stand ein jugendlicher Mann in der Uniform unserer leichten Infanterie. Als er sich nach mir umdrehte, erkannte ich ihn. Es war der Hauptmann Auret von den Siebenern, ein junger Baske, mit dem ich während des Winters manch Glas geleert hatte. Er war totenbleich, der unglückliche Junge, aber er hielt sich mannhaft unter dem Mordgesindel um ihn herum. Nie werde ich den Hoffnungsblitz vergessen, der in seinen dunkeln Augen aufleuchtete, als er einen Kameraden hereinstürzen sah, aber auch nicht den darauffolgenden Blick der Verzweiflung, als er merkte, daß ich nicht gekommen war, sein Schicksal abzuändern, sondern zu teilen.
Sie können sich wohl denken, Messieurs, wie erstaunt diese Leute waren, als ich plötzlich unaufgefordert zur Verhandlung kam. Meine Verfolger hatten sich hinter mir hereingedrängt und versperrten die Türe, sodaß an kein Entfliehen mehr zu denken war. In solchen Augenblicken kommt meine natürliche Unerschrockenheit zur Geltung. Mit Würde schritt ich auf den Gerichtshof zu. Mein Waffenrock war zerrissen, mein Haar zerzaust, aber in meinem Blick und in meiner Haltung lag ein gewisses Etwas, woran die Richter erkannten, daß sie's mit keinem gewöhnlichen Sterblichen zu tun hatten. Keine Hand erhob sich gegen mich, um mich zu arretieren. Vor einem furchtbaren Alten, an dessen langem, grauen Bart und dessen herrischem Benehmen ich ersah, daß er in Anbetracht seines Alters und seiner Würde der angesehenste war, machte ich halt.
» Monsieur,« sagte ich, »Sie können mir vielleicht Auskunft geben, warum ich gefesselt und in dieses Haus gebracht worden bin. Ich bin ein ehrenwerter Soldat, ebenso wie dieser Herr hier auch, und ich fordere Sie auf, uns beide augenblicklich in Freiheit zu setzen.«
Auf diese Anrede folgte ein tiefes Schweigen. Es ist nicht angenehm, mes amis, zwölf maskierte Gesichter und zwölf Paar rachedurstige italienische Augen starr auf sich gerichtet zu sehen. Aber ich stand vor ihnen, wie's einem strammen Soldaten zukommt, und dachte nur daran, welche Ehre ich durch mein stolzes Benehmen den Conflanser Husaren machen müßte. Ich glaube kaum, daß sich jemand unter solch' erschwerenden Umständen besser und würdiger hätte betragen können. Ich blickte furchtlos von einem der Mörder zum anderen hinüber und wartete auf eine Erwiderung.
Endlich unterbrach der alte Graubart das Schweigen und fragte:
»Wer ist dieser Mann?«
»Sein Name ist Gerard,« antwortete der kleine Verwalter hinten an der Türe.
»Oberst Gerard,« sagte ich. »Ich will Sie nicht über meine Person im unklaren lassen. Ich bin Etienne Gerard, der Oberst Gerard, fünfmal in Schlachtberichten ehrend erwähnt und mit dem Ehrendegen geziert. Ich bin der Adjutant des Generals Suchet und verlange, zugleich mit meinem Waffenbruder hier, meine sofortige Freilassung.«
Dasselbe furchtbare Schweigen wie vorhin trat ein, und dieselben zwölf Paar unerbittliche Augen waren auf mich gerichtet. Und wieder ergriff der Graubart das Wort.
»Er ist noch nicht an der Reihe. Auf unserer Liste sind zwei Namen vor ihm verzeichnet.«
»Er ist unseren Händen entwichen und hier hereingestürzt.«
»Laßt ihn warten, bis er an die Reihe kommt. Bringt ihn hinunter in die hölzerne Zelle.«
»Wenn er uns Widerstand leistet, Exzellenz?«
»Dann stoßt ihm eure Dolche in den Leib. Der Gerichtshof wird euch entschuldigen. Fort mit ihm, bis wir mit den anderen abgerechnet haben.«
Sie traten auf mich zu. Einen Augenblick dachte ich an Widerstand. Es würde ein heroisches Ende gewesen sein. Aber wer sollte es bezeugen, wer übermitteln? Ich mochte ja mein Geschick freilich nur 'nausschieben, aber ich hatte schon so vieles durchgemacht und war unversehrt davongekommen, daß ich gelernt hatte, zu hoffen und meinem Stern zu vertrauen. Ich erlaubte diesen Schurken, mich zu greifen, und ich wurde hinausgeführt. Der Gondoliere ging mit dem lang gezückten Dolch an meiner Seite. Ich konnte ihm an seinen wilden Augen ansehen, mit welcher Befriedigung er ihn in meine Brust gebohrt hätte, wenn er eine Veranlassung hätte finden können.
Es sind wunderbare Gebäude, mes amis, diese venetianischen Paläste: Häuser, Festungen und Gefängnisse, alles in einem. Ich wurde durch einen Gang geführt und eine kahle steinerne Treppe hinunter, bis wir auf einen kurzen Korridor kamen, auf den sich drei Türen öffneten. Durch die eine derselben wurde ich hindurchgeschoben, und hinter mir wurde das Sprungschloß geschlossen. Durch ein schmales Gitterloch fiel ein spärliches Licht vom Flur. Mit Augen und Händen tastete ich umher und untersuchte meine Zelle. Nach dem, was ich gehört hatte, war mir klar, daß ich hier nicht lange zu warten, sondern bald vor diesem Gerichtshof zu erscheinen haben würde, aber doch bin ich nicht der Mann, der sich irgend eine Möglichkeit entgehen läßt.
Der Boden meines Gefängnisses war so feucht und seine Wände einige Fuß hoch so naß, daß ich nicht darüber im Zweifel war, daß es unter dem Wasserspiegel lag. Ein enges Loch hoch oben nahe an der Decke bildete die einzige Oeffnung für Licht und Luft. Dadurch sah ich einen hellen Stern auf mich herabscheinen, und sein Anblick erfüllte mich mit Freude und Hoffnung. Ich bin selbst nie ein religiöser Mann gewesen, wenn ich auch diejenigen stets geachtet habe, die es waren, aber ich erinnere mich, daß mir in jener Nacht dieser Stern wie ein allsehendes Auge erschien, das auf mich herniederblickte, und ich hatte dasselbe Gefühl, das einen jungen, ängstlichen Rekruten beschleichen mag, wenn er in der Schlacht den ruhigen Blick seines Obersten auf sich geheftet sieht.
Drei Wände meiner Zelle waren von Stein, aber die vierte war aus Holz, und ich konnte bemerken, daß sie erst vor kurzem errichtet worden war. Es war offenbar nur eine Scheidewand, um eine große Zelle in zwei kleinere zu teilen. Auf die alten Steinmauern, das winzige Fensterloch und die massive Türe konnte ich keine Hoffnung setzen. Nur die Holzwand konnte in Betracht kommen. Mein Verstand sagte mir freilich, daß, wenn ich durch sie durchdränge – was mir nicht allzu schwer schien – ich mich wahrscheinlich nur in einer anderen ebenso starkbefestigten Zelle befinden würde wie die, in welcher ich eben war. Immerhin hielt ich's für ratsamer, etwas zu tun, als untätig zu warten. Ich lenkte also alle Energie und Kraft auf die Holzwand. Zwei Bretter waren schlecht aneinandergefügt und so lose, daß sie sich sicher leicht abreißen lassen mußten. Ich suchte nach irgend einem Instrument und fand eines in Gestalt eines der Beine von einem schmalen Bett, das in einer Ecke stand. Ich zwängte das Ende desselben zwischen zwei Planken und war gerade im Begriff, sie loszubrechen, als ich rasche Schritte hörte. Ich hielt inne und horchte.
Ich wünschte, ich könnte vergessen, was ich hörte. Ich habe viele Schlachten gesehen und selbst mehr Menschen getötet als ich manchmal gerne zugeben möchte, aber da handelte sich's um ehrlichen Kampf und war's meine Soldatenpflicht. Aber etwas ganz anderes ist's, jemanden in solch 'ner Mördergrube abmurksen zu hören. Sie schleiften einen den Gang entlang, einen, der sich widersetzte und sich im Vorbeikommen an meine Tür klammerte. Sie mußten ihn in die dritte Zelle gebracht haben, die von meiner am weitesten ablag. »Hilfe! Hilfe!« rief eine Stimme, und dann hörte ich einen Schlag und einen Schrei. »Hilfe! Hilfe!« schrie's wieder, und dann: »Gerard! Oberst Gerald!« Es war mein armer Hauptmann von der Infanterie, den sie abschlachteten. »Mörder! Mörder!« brüllte ich und schlug wild gegen meine Tür, aber nur noch einmal hörte ich ihn rufen, dann war alles still. Kaum eine Minute danach hörte ich einen Platsch und wußte, daß kein menschliches Auge Auret je wiedersehen würde. Er hatte denselben Weg genommen, den hundert andere schon vor ihm in diesem Winter in Venedig genommen hatten, die sich nicht mehr zum Appell bei ihren Regimentern melden konnten.
Die Henkersknechte kehrten zurück, und ich glaubte, ich sollte nun an die Reihe kommen. Statt dessen öffneten sie die Tür der Zelle neben mir und zogen jemanden heraus. Ich hörte sie die Treppe hinaufgehen. Sofort machte ich mich wieder an die Arbeit. In wenigen Minuten hatte ich ein paar Bretter soweit losgemacht, daß ich sie nach Belieben vor- und zurückschieben konnte. Als ich durchkroch, war ich, wie ich erwartet hatte, in der anderen Hälfte der Zelle. Ich hatte ebensowenig Aussicht zu entkommen, wie vorher, denn weiter gab's keine Holzwände und die Tür war verschlossen. Ich konnte nicht entdecken, welch unglücklicher Leidensgenosse hier eingesperrt gewesen war. Ich ging also wieder in meine eigene Zelle zurück und schob die beiden Planten wieder vor. Ich wartete hier mit Todesverachtung, was kommen würde.
Die Zeit wurde mir lang, das können Sie mir glauben, meine jungen Freunde; aber endlich hörte ich wieder Tritte und machte mich drauf gefaßt, Ohrenzeuge einer neuen Mordtat zu sein und wieder die Schreie des unglücklichen Opfers hören zu müssen. Doch nichts derart trat ein; ein Gefangener wurde ruhig in die Zelle gebracht. Ich hatte jedoch nicht Zeit, durch mein Verbindungsloch zu lugen, denn im nächsten Moment wurde bei mir die Tür aufgerissen, und mein elender Gondoliere trat herein und hinter ihm die anderen Mordgesellen.
»Komm', Franzmann,« sagte er, den blutbefleckten Dolch in seiner großen, behaarten Hand. Ich las aus seinen grimmigen Blicken, daß er nur auf eine Veranlassung lauerte, ihn mir ins Herz stoßen zu können. Widerstand war nutzlos. Ich folgte ihm ohne ein Wort. Ich wurde die Treppe hinaufgeführt und wieder in jenen Saal, in welchem das Blutgericht seine nächtlichen Sitzungen abhielt. Als ich eintrat, widmeten mir die Richter merkwürdigerweise jedoch keine Aufmerksamkeit, sondern alle Blicke richteten sich auf einen von ihnen selbst. Einer der ihrigen, ein schlanker, dunkler Jüngling, stand vor ihnen und verhandelte mit ihnen mit leiser, ernster Stimme. Sie zitterte vor Erregung, und er rang flehentlich die Hände. »Ihr könnt es nicht! Ihr dürft es nicht!« rief er. »Ich bitte den Gerichtshof, den Beschluß zurückzunehmen.«
»Stelle dich zur Seite, Bruder,« sagte der Alte, der den Vorsitz führte. »Die Sache ist entschieden, und jetzt haben wir über die nächste zu urteilen.«
»Ums Himmels willen seid barmherzig!« rief der junge Mann.
»Wir sind schon barmherzig gewesen,« antwortete der Alte. »Der Tod würde die geringste Strafe für ein solches Verbrechen gewesen sein. Sei mutig und lasse der Gerechtigkeit ihren Lauf.«
In wildem Schmerz warf sich der junge Mann in seinen Stuhl. Ich hatte jedoch keine Zeit, Betrachtungen über die Ursache seines Kummers anzustellen, denn seine elf Kollegen hatten schon ihre strengen Augen auf mich gelenkt. Meine letzte Stunde hatte geschlagen.
»Sie sind Oberst Gerard?« ertönte die furchtbare Stimme des Alten.
»Der bin ich.«
»Adjutant des Räubers, der sich General Suchet nennt, der seinerseits wieder den Erzräuber Bonaparte vertritt?«
Mir lag's schon auf der Zunge, ihm zu sagen, daß er ein Erzlügner und Schuft sei, aber, mes amis, es gibt Zeiten, wo man sich verteidigen, und solche, wo man ruhig sein muß.
Ich antwortete also nur: »Ich bin ein ehrbarer Soldat, ich habe meinen Befehlen gehorcht und meine Pflicht getan.«
Dem Alten stieg das Blut in den Kopf und seine Augen funkelten wie glühende Kohlen.
»Spitzbuben und Mörder seid ihr, jeder von euch,« rief er laut. »Was habt ihr hier zu suchen? Ihr seid Franzosen. Warum seid ihr nicht in Frankreich geblieben? Haben wir euch etwa eingeladen, nach Venedig zu kommen? Mit welchem Recht seid ihr hier? Wo sind unsere Gemälde? Wo sind die Rosse von San Marco? Wer seid ihr, die ihr die Schätze stehlt, die unsere Väter in Jahrhunderten gesammelt haben? Wir waren eine mächtige Stadt, als Frankreich noch 'ne Einöde war. Ihr versoffenes, lärmendes, ungebildetes Soldatengesindel habt die Werke unserer Heiligen und Helden zerstört. Was haben Sie dagegen vorzubringen?«
Messieurs, er war tatsächlich eine furchtbare Erscheinung, dieser Alte. Sein weißer Bart sträubte sich vor Wut, und er belferte die kurzen Sätze hervor wie ein gereizter Hund. Ich hätte ihm sagen mögen, daß seine Gemälde in Paris gut aufgehoben seien, und daß seine Pferde es gar nicht lohnten, so viel Aufhebens davon zu machen, und daß er Helden sehen könne – von Heiligen will ich nicht reden – ohne bis auf seine Vorfahren zurückzugehen, ja, ohne sich vom Stuhl zu erheben. Das hätte ich ihm alles entgegenhalten mögen, aber ebensogut hätte man mit einem Murmeltier über Religion rechten können. Ich zuckte also nur die Schultern und erwiderte nichts.
»Der Gefangene verantwortet sich nicht,« sagte einer meiner maskierten Richter.
»Bittet jemand, bevor das Urteil gesprochen wird, noch ums Wort?« fragte der Alte und sah sich im Kreise um.
»Eins möchte ich noch bemerken, Exzellenz,« rief einer. »Es kann leider nicht geschehen, ohne die Wunde eines unserer Brüder wieder aufzureißen, aber ich möchte zu berücksichtigen bitten, daß in dem Falle dieses Offiziers eine ganz exemplarische Strafe aus einem ganz bestimmten Grunde am Platze ist.«
»Ich hatte schon daran gedacht,« erwiderte der Alte. »Bruder, wenn dich der Gerichtshof im einen Fall gekränkt hat, wird er dir andererseits weitgehende Genugtuung verschaffen.«
Der junge Mann, der bei meinem Eintritt in den Saal auf seine Kollegen eingeredet hatte, war aufgesprungen.
»Ich kann es nicht ertragen,« rief er aus. »Euere Exzellenz müssen mir verzeihen. Das Gericht kann auch ohne mich fertig werden. Ich bin krank, bin wahnsinnig!« Er gestikulierte mit den Händen in der Luft 'rum und stürzte zur Türe hinaus.
»Laßt ihn gehen! Laßt ihn gehen!« sagte der Präsident. »Es ist wahrhaftig mehr, als man von einem Menschen aus Fleisch und Blut verlangen kann, daß er unter diesem Dach bleiben soll. Aber er ist ein treuer Venetianer, und wann sich der erste Schmerz gelegt hat, wird er einsehen, daß es nicht anders ging.«
Während dieses Zwischenfalles war ich vergessen worden, und obwohl ich, wie Sie wissen, Messieurs, nicht daran gewöhnt bin, übersehen zu werden, würde mir damals doch viel wohler zumute gewesen sein, wenn sie mich noch länger und ganz vernachlässigt hätten. Aber gleich danach blickte mich der alte Präsident wieder an wie ein Tiger, der wieder zu seinem Opfer zurückkommt.
»Sie sollen alles bezahlen, und es ist nur billig, daß Sie's sollen,« begann er. »Sie, ein hergelaufener Abenteurer und Fremdling, haben sich erkühnt, Ihre Augen in Liebe aufzuheben zu der Enkelin eines Dogen von Venedig, die schon mit dem Erben der Loredani verlobt war. Wer sich solcher Gunst erfreut, muß auch entsprechend büßen.«
»Die Strafe kann nicht höher sein als diese Gunst,« versetzte ich.
»Wir wollen uns wieder sprechen, nachdem Sie einen Teil Ihrer Strafe erlitten haben,« erwiderte er. »Vielleicht werden Sie dann weniger hochmütig reden. Matteo, bringe diesen Gefangenen in die hölzerne Zelle. Heute ist Montag. Er soll weder Speise noch Trank bekommen und am Mittwoch wieder vorgeführt werden. Wir werden dann entscheiden, welchen Todes er sterben soll.«
Das war keine angenehme Aussicht, mes amis, und doch war's eine Gnadenfrist. Man ist für alles dankbar, wenn einen ein wilder Mordbube mit blutbeflecktem Dolch am Wickel hat. Er schleppte mich hinaus, die Treppe hinunter in meine Zelle zurück. Die Türe wurde verschlossen und ich meinen Betrachtungen überlassen.
Mein erster Gedanke war, mich mit meinem unglücklichen Nachbar in Verbindung zu setzen. Ich wartete, bis die Tritte verhallt waren, dann schob ich die zwei Bretter vorsichtig beiseite und blickte hindurch. Das Licht war sehr kümmerlich, so trübe, das; ich gerade noch eine Gestalt in einer Ecke kauern sehen konnte, und ich vernahm das leise Flüstern einer Stimme, die betete, die so inbrünstig betete, wie es nur jemand in Todesgefahr tut. Die Planken mußten geknarrt haben. Ich hörte einen Schrei der Ueberraschung.
» Courage, Freund, courage!« rief ich. »Noch ist nicht alles verloren. Nur den Mut nicht sinken lassen, Etienne Gerard lebt noch!«
»Etienne!« tönte mir eine weibliche Stimme entgegen – eine Stimme, die mir immer wie Musik in den Ohren geklungen hatte. Ich sprang durch den Spalt und schlang sie in die Arme. »Lucia! Lucia!« rief ich.
Einige Minuten waren »Etienne!« und »Lucia!« die einzigen Worte, die über unsere Lippen kamen, denn, glauben Sie mir's, mes amis, in solchen Momenten gibt's keine langen Reden. Endlich fand sie zuerst die Sprache wieder.
»Oh, Etienne, sie werden dich töten. Wie kamst du in ihre Hände?«
»Durch deinen Brief.«
»Ich habe nicht geschrieben.«
»Die teuflischen Schurken! Aber du?«
»Ebenfalls durch deinen Brief.«
»Lucia, ich habe keinen Brief geschrieben.«
»Sie haben uns beide mit demselben Köder gefangen.«
»An meinem Leben ist mir nichts gelegen, Lucia. Außerdem ist für mich die Gefahr nicht dringend. Sie haben mich einfach in meine Zelle zurückgebracht.«
»Oh, Etienne, Etienne, sie werden dich töten. Lorenzo ist dabei.«
»Der Alte mit dem grauen Bart?«
»Nein, nein, ein junger, dunkler Mann. Er liebte mich, und ich glaubte, ich liebte ihn, bis – bis ich erfuhr, was Liebe ist, Etienne. Er wird dir nie vergeben. Er hat ein Herz wie Stein.«
»Laß sie tun, was sie wollen. Die Vergangenheit können sie mir nicht rauben, Lucia. Aber du – was ist mit dir?«
»Weiter nichts, Etienne. Nur eine augenblickliche Pein, und dann ist alles überstanden. Sie meinen, es sei ein Schandmal, Geliebter, aber ich will es tragen wie ein Ehrenzeichen, weil ich's durch dich bekomme.«
Ihre Worte machten das Blut in meinen Adern erstarren. All meine Abenteuer waren nichts im Vergleich mit dem furchtbaren Gedanken, der damals in mir aufdämmerte.
»Lucia!« rief ich, »Lucia! Ums Himmels willen sag' mir, was diese Schlächter mit dir machen wollen. Sag' mir's, Lucia! Sag' mir's!«
»Ich will dir's nicht sagen, Etienne, es würde dich tiefer verletzen als mich. Doch, doch, ich will dir's doch sagen, damit du nicht noch Schlimmeres befürchtest. Der Präsident hat befohlen, mir das Ohr abzuschneiden, damit ich für immer gebrandmarkt sei, daß ich einen Franzosen geliebt habe.«
Ihr Ohr! Das teure kleine Ohr, das ich so oft geküßt hatte. Ich fühlte mit der Hand an die beiden kleinen samtnen Oehrchen, um mich zu vergewissern, ob die Schändung nicht schon begangen sei. Nur über meinen Leichnam sollten sie zu ihr gelangen. Ich schwor es zähneknirschend, daß es nur über meine Leiche hinweg geschehen könne.
»Du mußt nicht traurig sein, Etienne. Und trotzdem freue ich mich auch wieder, daß du bekümmert bist.«
»Sie sollen dich nicht verletzen – die Teufel!«
»Ich hab' noch Hoffnung, Etienne. Lorenzo ist dabei. Er war still, als ich verurteilt wurde, aber er hat vielleicht, nachdem ich fort war, ein gutes Wort für mich eingelegt.«
»Das hat er. Ich hab's gehört.«
»Dann hat er vielleicht ihre Herzen erweicht.«
Ich wußte, daß es nicht der Fall war, aber wie hätte ich's über mich gewinnen können, Freunde, es ihr zu sagen? Doch hätte ich's ruhig tun können, denn mit dem raschen Instinkt des Weibes erkannte sie genug aus meinem Schweigen.
»Sie wollten nicht auf ihn hören! Du brauchst dich nicht zu fürchten, mir's zu sagen, Geliebter, denn du sollst erfahren, daß ich würdig bin, von einem solchen Soldaten geliebt zu werden. Wo ist Lorenzo jetzt?«
»Er hat den Saal verlassen.«
»Dann wird er wohl das Haus überhaupt verlassen haben.«
»Ich glaube, ja.«
»Er hat mich meinem Schicksal überlassen. Sie kommen, Etienne, Etienne!«
Von ferne hörte ich jene verheißungsvollen Tritte und das Rasseln der Schlüssel. Was mochten sie jetzt wollen, andere Gefangene, die sie vor das Tribunal hätten schleppen können, waren doch nicht mehr da? Sie konnten nur kommen, um an meiner Geliebten das Urteil zu vollstrecken. Ich stellte mich zwischen sie und den Eingang; in meinen Gliedern fühlte ich die Kraft des Löwen. Ich würde eher das Haus einreißen als sie berühren lassen.
»Zurück! Zurück!« rief sie. »Sie ermorden dich, Etienne. Mein Leben ist wenigstens nicht in Gefahr. Bei deiner Liebe zu mir bitte ich dich, Etienne, geh' zurück. Es ist nichts. Ich will keinen Laut ausstoßen. Du wirst nichts hören.«
Sie rang mit mir, dieses zarte Wesen, und zog mich mit aller Kraft an die Oeffnung in der Holzwand. Da kam mir plötzlich ein Gedanke.
»Noch ist Rettung vorhanden,« flüsterte ich. »Tu', was ich dir sage, sofort und ohne Widerrede. Geh' in meine Zelle. Rasch!«
Ich schob sie durch das Loch und half ihr, die Bretter wieder in Ordnung bringen. Ich hatte ihren Mantel zurückbehalten, ich schlug ihn schnell um mich und kroch in die dunkelste Ecke ihrer Zelle. Dort kauerte ich, als die Türe aufging und mehrere Männer 'rein kamen. Ich hatte damit gerechnet, daß sie keine Laterne bei sich haben würden, weil sie auch vorher keine gehabt hatten. Sie konnten nur einen schwarzen Klumpen in der Ecke entdecken.
»Hol'n Licht,« sagte einer.
»Nein, nein; zum Teufel damit!« rief eine rauhe Stimme; es mußte der elende Matteo sein, »'s ist keine Arbeit, die ich gern mache, und je deutlicher ich seh', um so widerwärtiger ist sie mir. Es tut mir leid, Signora, aber der Befehl des Tribunals muß ausgeführt werden.«
Im Moment trieb mich's, aufzuspringen, zwischen ihnen durch und zur Tür hinauszurennen. Aber wie sollte ich dadurch Lucia helfen? Selbst angenommen, ich hätte die Freiheit erlangt, so würde sie doch in ihrer Gewalt gewesen sein, bis ich zurückgekommen wäre und Hilfe gebracht hätte, denn allein hatte ich keine Aussicht, sie ihren Händen zu entreißen. Das alles wurde mir augenblicklich klar, und ich sah ein, daß mir nichts übrig blieb, als ruhig zu sein, alles über mich ergehen zu lassen und abzuwarten, bis die Chancen günstiger wären. Die ungefüge Hand des Burschen tastete in meinen Locken herum – in den Locken, die nur zarte Frauenhände gestreichelt hatten. Im nächsten Moment packte er mein Ohr, und es durchzuckte mich ein Schmerz, als ob ich mit einem glühenden Eisen berührt würde. Ich biß die Zähne auf einander, um nicht zu schreien, und ich fühlte, wie das warme Blut den Nacken herunterlief.
»Na, Gott sei Dank, das hätten wir,« sagte der Kerl und gab mir einen freundschaftlichen Schlag auf den Kopf. »Sie sind ein wackeres Mädchen, Signora, das muß ich Ihnen nachsagen, und ich wünschte nur, Sie hätten 'nen besseren Geschmack gehabt, als so 'nen Franzosen zu lieben. Ihm haben Sie's zu verdanken; ich hab' keine Schuld.«
Was konnte ich tun, Messieurs, als mich ruhig verhalten und ob meiner eigenen Hilflosigkeit mit den Zähnen knirschen? Immerhin wurden mein Schmerz und meine Wut durch den Gedanken gelindert, daß ich für das Weib duldete, das ich liebte. Männer haben's an der Mode, Damen zu sagen, sie würden gerne jeden Schmerz für sie ertragen, aber mir blieb's vorbehalten, den Beweis zu erbringen, daß ich nicht zu viel gesagt hatte. Ich stellte mir ferner auch vor, wie ritterlich ich gehandelt hätte, und wie stolz das Regiment Conflans auf seinen Obersten sein würde, wenn die Geschichte bekannt würde. Diese Gedanken ließen mich alles ertragen, während das Blut noch immer an meinem Hals herunterrieselte und auf den steinernen Boden tropfte. Dieses Geräusch hätte beinahe meinen Untergang veranlaßt.
»Sie blutet stark,« sagte einer der Schergen. »Wir täten gut, einen Arzt zu holen, sonst finden wir sie womöglich am Morgen tot.«
»Sie liegt sehr still und hat keinen Ton von sich gegeben,« sagte ein anderer. »Sie ist vor Schrecken gestorben.«
»Unsinn; ein junges Weib stirbt so rasch nicht,« warf Matteo ein. »Uebrigens hab' ich nur soviel abgeschnitten, daß sie das gerichtliche Kennzeichen eben hat. Stehen Sie auf, Signora, steh'n Sie auf!«
Er rüttelte mich an der Schulter, und mir blieb das Herz stehen vor Angst, daß er meine Epauletten unter dem Mantel fühlen könnte.
»Wie ist Ihnen jetzt?« fragte er.
Ich gab keine Antwort.
»Zum Teufel! Wenn man nur nicht mit Weibern zu tun hätte, und wenn's auch das schönste Weib in ganz Venedig ist,« sagte der Gondoliere. »Nicholas, gib 'mal dein Schnupftuch her, und bring' 'n Licht.«
Alles schien verloren, Messieurs. Das Schlimmste war eingetreten. Es gab keine Rettung mehr. Ich hockte noch still in der Ecke, aber jeder Muskel war gespannt wie bei einer wilden Katze, die zum Sprung bereit ist. Oui, mes amis, wenn ich sterben sollte, wollte ich auch ein meines Lebens würdiges Ende nehmen.
Einer war fortgegangen, eine Lampe zu holen, und Matteo beugte sich über mich und drückte mit dem Taschentuch an die Stelle, wo mein Ohr gewesen war. Im nächsten Augenblick würde das Geheimnis entdeckt sein. Aber plötzlich richtete er sich empor und stand regungslos. Im selben Augenblick hörte ich verworrenes Gemurmel durch das kleine Fenster dringen. Es war Ruderschlag und Stimmengewirr. Dann pochte es draußen an das Tor und eine gewaltige Stimme brüllte: »Aufgemacht! Aufgemacht im Namen des Kaisers!«
Kaiser! Dies Wort wirkte wie der Name eines Heiligen, bei dessen bloßem Ruf die Dämonen erschrecken. Fort rannten sie unter entsetzlichem Geschrei – Matteo, die Diener, der Hausmeister, die ganze Mordbande. Noch eine Aufforderung zum Oeffnen ertönte, und dann krachte die Axt gegen das Tor und die Planken zersplitterten. Vom Flur her wurden Waffengeklirr und die Rufe französischer Soldaten vernehmbar. Im nächsten Augenblick kam jemand die Treppe heruntergestürzt und direkt in meine Zelle.
»Lucia!« schrie er, »Lucia!« Ich sah ihn, wie er in dem matten Licht stand, keuchend und nach Worten ringend. Dann rief er aus: »Habe ich dir nun meine Liebe bewiesen, Lucia? Hab' ich nicht das Höchste getan, sie dir zu zeigen? Ich hab' mein Vaterland verraten, mein Gelübde gebrochen, meine Freunde ruiniert und mein Leben hingegeben, dich zu retten!«
Es war der junge Lorenzo Loredano, der Liebhaber, den ich vorhin erwähnt habe. Er tat mir außerordentlich leid, Messieurs, aber in Liebesangelegenheiten sind wir Männer alle selbstsüchtig, und wenn die Geliebte einen anderen vorzieht, wollen wir wenigstens die Befriedigung haben, daß es ein ebenbürtiger und achtungswürdiger Nebenbuhler ist. Ich wollte ihm das gerade auseinandersetzen, aber gleich nach dem ersten Wort stieß er einen Schrei des Erstaunens aus, stürzte hinaus, ergriff die Lampe, die im Gang hing, und leuchtete mir ins Gesicht.
»Du bist's, du elender Lump!« schrie er. »Du französischer Laffe. Du sollst mir für all das Leid büßen, das du mir angerichtet hast.«
Aber gleich erblickte er die Blässe in meinem Gesicht und das Blut, das immer noch aus der Wunde quoll.
»Was ist das?« fragte er. »Wie sind Sie zum Verlust Ihres Ohrs gekommen?«
Ich unterdrückte meine Schwäche, preßte mein Taschentuch fest auf die Wunde, richtete mich kerzengerade in die Höhe und trat ihm entgegen, wie's einem Husarenobersten zukommt.
»Die Verletzung ist nicht schwer,« versetzte ich. »Mit Ihrer Erlaubnis wollen wir diese kleine persönliche Sache nicht weiter erörtern.«
Aber Lucia war herbeigestürzt aus ihrer Zelle und erzählte, an Lorenzos Arm hängend, die ganze Geschichte.
»Dieser edelmütige Herr – er hat meinen Platz eingenommen, Lorenzo! Er hat's an meiner Statt ertragen. Er hat gelitten, um mich zu retten.«
Ich konnte sehen, welch innerer Kampf sich auf den Gesichtszügen des jungen Italieners abspiegelte, und ich konnte es ihm nachfühlen. Endlich reichte er mir die Hand.
»Oberst Gerard,« sagte er, »Sie sind hoher Liebe wert. Ich verzeihe Ihnen, denn, wenn Sie mir auch unrecht getan haben, so haben Sie's nobel gesühnt. Aber es wundert mich, daß ich Sie noch lebendig hier wiedersehe. Ich verließ den Gerichtshof, bevor Sie abgeurteilt waren, aber ich hörte, daß keinem Franzosen seit der Zerstörung der Kunstwerke mehr Pardon gegeben werden sollte.«
»Er hat keine zerstört,« rief Lucia. »Er hat dazu geholfen, daß sie in unserem Palazzo erhalten worden sind.«
»Eins auf alle Fälle,« bemerkte ich, als ich mich verbeugte und ihr die Hand küßte.
So kam es, mes chers amis, daß ich mein Ohr verlor. Lorenzo wurde bereits in der zweiten Nacht nach unserem Abenteuer auf dem Markusplatz erdolcht aufgefunden. Von jenem Gerichtshof und seinen Helfershelfern wurden Matteo mit noch drei anderen erschossen, die übrigen aus der Stadt verbannt. Lucia, meine reizende Lucia, ging, nachdem die Franzosen die Stadt verlassen hatten, in ein Kloster nach Murano, wo sie vielleicht jetzt noch als ehrbare Aebtissin leben mag. Vielleicht hat sie die Tage lange vergessen, wo unsere Herzen aneinanderschlugen, und wo uns die ganze große Welt noch zu klein vorkam, wann unsere Liebesglut das Blut erhitzte. Vielleicht ist's auch nicht der Fall. Vielleicht hat sie's auch nicht vergessen. Vielleicht kommen auch bei ihr noch Zeiten, wo der Klosterfrieden unterbrochen wird durch die Erinnerung an den Soldaten, der sie liebte in jenen längst vergangenen Tagen. Die Jugend ist dahin, und die Leidenschaft ist dahin, aber das Herz und die Ritterlichkeit sind geblieben, und auch heute noch würde Etienne Gerard sein graues Haupt vor ihr beugen und mit Freuden das andere Ohr hingeben, wenn er ihr dadurch einen Dienst erweisen könnte.
Wie der Brigadier Saragossa eroberte.
Ihr wißt sicher noch nicht, mes amis, unter welchen Umständen ich zu den Conflanser Husaren kam, zur Zeit der Belagerung von Saragossa, und kennt nicht die denkwürdige Tat, die ich in Verbindung mit der Einnahme dieser Stadt vollbrachte? Nein? Das müssen Sie hören! Ich will's Ihnen genau der Wahrheit entsprechend erzählen. Außer zwei oder drei Männern und einem oder zwei Dutzend Frauen sind Sie, Messieurs, die allerersten, welche diese Geschichte von mir erfahren.
Ich muß vorausschicken, daß ich als Leutnant und jüngerer Rittmeister bei den zweiten Husaren – den Husaren von Chamberan – gestanden hatte. Zur Zeit, von der ich spreche, war ich erst fünfundzwanzig und ein Kerl, so sorglos und waghalsig wie nur irgend einer in der großen Armee. In Deutschland war zufällig gerade Ruhe, aber in Spanien gärte es noch. Nun wünschte der Kaiser, die spanischen Truppen zu verstärken, und versetzte mich unter Beförderung zum Rittmeister erster Klasse zu den Conflanshusaren, die jenesmal zum fünften Korps unter Marschall Lannes gehörten.
Es war ein langer Ritt von Berlin nach den Pyrenäen. Mein neues Regiment bildete einen Teil der Belagerungsarmee, die damals unter Lannes vor Saragossa lag. Ich ritt also in dieser Richtung und befand mich nach ungefähr einer Woche im französischen Hauptquartier, von wo ich ins Lager der Conflansschen Husaren dirigiert wurde.
Diese berühmte Belagerung ist Ihnen gewiß aus Büchern bekannt, Messieurs, und ich will nur hinzufügen, daß einem General kaum eine schwierigere Aufgabe zufallen konnte als diejenige, die dem Marschall Lannes zuteil geworden war. Die riesige Stadt war voll von spanischem Gesindel aller Art – Soldaten, Bauern, Pfaffen – alle von furchtbarem Franzosenhaß erfüllt und fest entschlossen, lieber zu sterben als sich zu ergeben. Achtzigtausend Mann lagen in der Stadt, während die Belagerer nur dreißigtausend hatten. Doch hatten wir eine starke Artillerie und die besten Genietruppen. Eine solche Belagerung hat's noch nie gegeben; gewöhnlich fällt eine Stadt, wann ihre Festungswerke genommen sind, aber hier ging der Kampf erst richtig los, als die Befestigungen erobert waren. Jedes Haus bildete eine Festung, und jede Straße ein Schlachtfeld, sodaß wir nur langsam, Tag für Tag, ein Stückchen vordringen konnten, nachdem wir die Häuser samt ihren Besatzungen weggefegt hatten. So ging's, bis bereits über die Hälfte der Stadt verschwunden war. Aber trotzdem war die andere Hälfte noch so entschlossen wie je zuvor. Außerdem befand sie sich in einem viel besseren Verteidigungszustand, weil sie aus ungeheueren Klöstern bestand mit Mauern wie die Bastille, die nicht so leicht weggeräumt werden konnten. Das war der Stand der Dinge, als ich ankam.
Ich will Ihnen jetzt nun gestehen, Messieurs, daß Kavallerie bei einer Belagerung keinen großen Zweck hat; freilich gab's 'ne Zeit, wo ich niemanden erlaubt haben würde, eine solche Bemerkung zu machen. Die Conflansschen Husaren hatten ihr Lager im Süden der Stadt, und sie hatten die Aufgabe, Patrouillen auszusenden und auszukundschaften, ob keine feindlichen Streitkräfte von dieser Seite zum Ersatz heranrückten. Der Oberst des Regiments war nicht sehr tüchtig, sodaß es auch selbst damals noch sehr weit von jener Höhe entfernt war, die es später erreicht hat. Noch an demselben Abend bemerkte ich ganz haarsträubende Dinge, denn ich brachte sehr strenge Begriffe von Dienst mit, und es fiel mir stets schwer aufs Herz, ein ungeordnetes Lager, ein schlechtgesatteltes Pferd und einen nachlässigen Reiter zu sehen. Ich speiste an jenem Abend mit sechsundzwanzig neuen Kameraden, und ich fürchte, daß ich ihnen in meinem Eifer nur zu offen zeigte, daß ich hier ganz andere Verhältnisse gefunden hätte, als ich sie von unserer Armee in Deutschland gewöhnt sei. Nach meinen Bemerkungen wurden alle sehr zurückhaltend, und als ich die Blicke gewahr wurde, die man mir zuwarf, fühlte ich, daß ich unvorsichtig in meinen Aeußerungen gewesen war. Der Oberst speziell war wütend, und ein großer Major namens Olivier, der stärkste Esser im Regiment, der mir gegenübersaß und seinen kolossalen schwarzen Schnurrbart drehte, stierte mich an, als ob er mich auffressen wollte. Ich tat jedoch, als ob ich's nicht sähe, denn ichhatte ja selbst das Gefühl, daß ich beleidigend gewesen war, und wußte, daß es einen schlechten Eindruck machen würde, wenn ich gleich am ersten Abend mit meinen Vorgesetzten in Streit geriete.
Soweit gebe ich zu, daß ich unrecht hatte, aber nun hören Sie weiter, meine Herren. Nachdem das Essen vorüber war, gingen der Oberst und einige andere Offiziere fort, denn die Messe wurde in einem Bauernhaus abgehalten. Ein Dutzend blieben wohl zurück, und bei einigen Schläuchen spanischen Weins kamen wir alle rasch in bessere Laune. Bald richtete dieser Major Olivier verschiedene Fragen über unsere Armee in Deutschland an mich und über die Rolle, die ich in diesem Feldzug gespielt hätte. In meiner Weinstimmung erzählte ich eine Geschichte nach der anderen. Das war ganz natürlich, und Sie werden mir das nachfühlen können, Messieurs. Bis dahin war ich das Muster für jeden Offizier in meinen Jahren gewesen. Ich war der beste Fechter, der wildeste Reiter, der Held von hundert Abenteuern. Hier war ich ein Unbekannter, und noch nicht 'mal beliebt. War es da zu verwundern, daß ich diesen biederen Kameraden mit Freuden auseinandersetzte, was für eine Aquisition sie an mir gemacht hatten? War es da nicht selbstverständlich, daß ich ihnen am liebsten zugerufen hätte: Freut euch, Kameraden, freut euch! Es ist kein gewöhnlicher Mann, den ihr heute zugeteilt bekommen habt, sondern ich bin's,der Gerard, der Held von Regensburg, der Sieger von Jena, der Mann, der die österreichische Schlachtlinie bei Austerlitz ins Wanken brachte!? Ich konnte ihnen freilich nicht alles erzählen, aber wenigstens konnte ich ihnen einige Erlebnisse zum besten geben, aus denen sie das übrige selbst schließen konnten. Das tat ich auch. Sie hörten gespannt zu. Ich erzählte noch mehr. Endlich, nachdem ich mit meiner Geschichte, wie ich die Armee über die Donau geführt hatte, fertig war, brachen sie alle in ein homerisches Gelächter aus. Ich sprang auf, rot vor Scham und Aerger. Sie hatten mich dazu veranlaßt, sie wollten ihren Jux mit mir treiben. Sie glaubten's mit einem Aufschneider und Lügner zu tun zu haben. Sollte das mein Empfang bei den Conflansschen Husaren sein? Ich wischte mir die Tränen der Wut aus den Augen, und als sie das sahen, lachten sie noch lauter.
»Wissen Sie, Herr Rittmeister Pelletan, ob der Marschall Lannes noch bei der Armee hier ist?« fragte der Major.
»Ich glaube wohl, Herr Major,« erwiderte dieser.
»Tatsächlich, ich hätte gedacht, seitdem wir den Rittmeister Gerard hier haben, würde seine Gegenwart kaum noch erforderlich sein.«
Wieder erhob sich ein schallendes Gelächter. Ich sehe heute noch den Kreis höhnischer Gesichter und spöttischer Augen vor mir – Olivier mit seinen langen, schwarzen Borsten, den hageren Pelletan mit seinem ekelhaften Grinsen, und selbst die jungen Unterleutnants waren außer sich vor Freude. Himmel, was für'n unanständiges Benehmen! Aber meine Wut hatte nachgelassen, meine Tränen waren getrocknet. Ich hatte wieder die Gewalt über mich erlangt, ich war wieder kalt, ruhig und gefaßt, außen Eis und innen Feuer.
»Darf ich fragen, Herr Major, wann Sie das Regiment paradieren lassen?«
»Ich hoffe, Herr Rittmeister Gerard, daß Sie unsere festgesetzten Stunden nicht umändern wollen,« antwortete er, und wieder entstand ein allgemeines Gelächter, das erst allmählich aufhörte, als ich mich langsam in der Runde umblickte.
»Um wieviel Uhr ist Reveille?« fragte ich den Rittmeister Pelletan in scharfem Tone.
Er hatte irgend eine ironische Antwort auf der Zunge, aber infolge meines Blickes behielt er sie für sich. »Um sechs Uhr,« erwiderte er.
» Merci,« sagte ich. Dann zählte ich die Gesellschaft und fand, daß ich's mit vierzehn Offizieren zu tun hatte, von denen zwei noch junge Bürschchen frisch von der Kriegsschule waren. Ich konnte mich nicht herablassen, von ihrer Ungehörigkeit weitere Notiz zu nehmen. Es blieben also noch der Major, vier Rittmeister und sieben Leutnants übrig.
» Messieurs,« fuhr ich fort, sie nacheinander scharf ins Auge fassend, »ich würde mich dieses berühmten Regimentes unwürdig fühlen, wenn ich keine Satisfaktion von Ihnen verlangte wegen der Unhöflichkeit, mit der Sie mich begrüßt haben, und ich würde auch Sie desselben für unwürdig erachten, wenn Sie sie mir unter irgend einem Vorwand verweigerten.«
»In dieser Beziehung werden Sie nicht auf Schwierigkeiten stoßen,« sagte der Major. »Ich bin bereit, meinen Rang außer acht zu lassen und Ihnen jede Genugtuung zu geben im Namen der Conflansschen Husaren.«
»Danke Ihnen,« antwortete ich. »Ich bin jedoch der Ansicht, daß ich auch die anderen Herren, die sich auf meine Kosten lustig gemacht haben, zur Rechenschaft ziehen kann.«
»Gegen welche wollen Sie dann fechten?« fragte Rittmeister Pelletan.
»Gegen Sie alle,« antwortete ich.
Sie sahen einander erstaunt an. Darauf traten sie alle in eine Ecke des Zimmers und flüsterten zusammen. Sie lachten dabei. Offenbar befanden sie sich noch in dem Wahn, es mit einem leeren Schwätzer zu tun zu haben. Dann kehrten sie wieder an den Tisch zurück.
»Ihre Forderung ist zwar ungewöhnlich,« sagte der Major, »sie soll Ihnen jedoch gewährt werden. Welche Waffe wünschen Sie? Sie haben zu bestimmen.«
»Säbel,« sagte ich. »Und ich will dem Dienstalter nach mit Ihnen antreten und um fünf Uhr mit Ihnen beginnen, Herr Major. Auf diese Weise kann ich jedem fünf Minuten widmen und vor der Reveille fertig sein. Ich muß Sie jedoch ersuchen, mir, bitte, den Platz zu bezeichnen, wo wir uns treffen wollen, weil ich die Oertlichkeiten hier noch nicht kenne.«
Meine energische Sprache und mein ruhiges und bestimmtes Auftreten hatten einen gewaltigen Eindruck auf sie gemacht. Der ironische Zug um ihren Mund war verschwunden. Oliviers spöttisches Gesicht war ernst und finster geworden.
»Hinter den Pferdestallungen ist ein kleiner freier Platz,« sagte er. »Dort haben wir schon einige Ehrenhändel ausgefochten. Wir werden uns um die von Ihnen angegebene Zeit dort einfinden, Herr Rittmeister.«
Als ich gerade meine Verbeugung machte, um ihnen für die Annahme des Duells zu danken, wurde mit einemmal die Tür aufgestoßen und hereinstürzte in großer Aufregung der Oberst.
» Messieurs,« begann er, »ich habe den Auftrag, Sie zu fragen, wer von Ihnen freiwillig bereit ist, einen Dienst zu leisten, der mit der größten Gefahr verknüpft ist. Ich will Ihnen nicht verschweigen, daß es sich um eine außerordentlich ernste Sache handelt, und daß der Marschall Lannes einen Kavallerieoffizier dazu ausersehen hat, weil er eher zu entbehren ist als einer von der Infanterie oder vom Geniekorps. Verheiratete kommen nicht in Betracht. Wer von den übrigen meldet sich freiwillig?«
Mes amis, ich brauche wohl kaum zu erwähnen, daß sämtliche unverheirateten Offiziere vortraten. Der Oberst blickte sich etwas verlegen um. Ich konnte ihm sein Dilemma ansehen. Der Beste sollte gehen, auf den Besten wollte er aber auch ungern verzichten.
»Herr Oberst,« sagte ich, »darf ich Ihnen vielleicht einen Vorschlag machen?«
Er sah mich scharf an, denn er hatte meine Bemerkungen beim Essen noch nicht vergessen. »Sprechen Sie!« sagte er.
»Ich wollte darauf hinweisen,« sagte ich, »daß diese Mission von Rechts- und Vernunftwegen mir zukommt.«
»Wieso, Herr Rittmeister Gerard?«
»Von Rechts wegen, weil ich Rittmeister ersten Ranges bin, und aus Rücksichten der Klugheit, weil ich im Regiment am wenigsten vermißt werde, weil mich die Leute noch nicht kennen gelernt haben.«
Sein Blick milderte sich.
»Sie haben eigentlich recht, Herr Rittmeister,« antwortete er. »Ich glaube tatsächlich, daß Sie sich am besten dazu eignen, diesen Auftrag zu übernehmen. Wenn Sie mit mir kommen wollen, so will ich Ihnen Ihre Instruktionen geben.«
Ich wünschte meinen neuen Kameraden im Hinausgehen gute Nacht und schärfte ihnen nochmals ein, daß ich mich um fünf Uhr zu ihrer Verfügung halten würde. Sie machten eine stumme Verbeugung und ich vermeinte an ihrem Gesichtsausdruck bemerken zu können, daß sie bereits angefangen hatten, mich richtiger zu taxieren.
Ich hatte erwartet, daß mir der Oberst gleich näheren Aufschluß über die Arbeit geben würde, die meiner harrte, aber statt dessen schritt er schweigend dahin und ich hinter ihm her. Wir gingen durch das Lager, über die Schanzen und über Ruinen von Steinen, die Ueberreste der alten Stadtmauer. Dann kamen wir durch ein Labyrinth von Gängen, die zwischen den Trümmern der Häuser hindurchführten, welche unsere Pioniere in die Luft gesprengt hatten. Weite Gebiete waren mit Steinbrocken und Schutt bedeckt, wo früher eine volkreiche Vorstadt gestanden hatte. Lannes hatte Wege anlegen und an den Ecken Laternen und Inschriften anbringen lassen, damit man sich zurecht finden konnte. Der Oberst eilte immer weiter, bis wir nach langem Wandern endlich an eine hohe graue Mauer kamen, die gerade über unseren Weg ging. Hier hinter einer Barrikade lag unsere Avantgarde. Er führte mich in ein Haus ohne Dach, wo ich zwei Stabsoffiziere fand, die eine Karte auf einer Trommel ausgebreitet hatten. Sie lagen daneben auf den Knien und studierten sie sorgfältig beim Schein einer Laterne. Der eine mit dem glattrasierten Gesicht und dem langen Hals war Marschall Lannes, der andere General Razout, der an der Spitze des Geniekorps stand.
»Rittmeister Gerard hat sich freiwillig dazu gemeldet,« sagte der Oberst.
Lannes stand auf und schüttelte mir die Hand.
»Sie sind ein wackerer Soldat, Herr Gerard,« sagte er zu mir. »Ich habe Ihnen ein Präsent zu überreichen,« fuhr er fort, indem er mir ein kleines Glasröhrchen einhändigte. »Es ist von Dr. Fardet besonders präpariert. Im äußersten Notfall brauchen Sie's bloß an die Lippen zu bringen, um momentan zu sterben.«
Das war eine vielversprechende Einleitung. Ich muß Ihnen gestehen, mes amis, daß mich ein kalter Schauder überlief und mir die Haare zu Berge standen.
»Pardon, Exzellenz,« sagte ich salutierend, »ich weiß wohl, daß ich mich zu einer äußerst gefahrvollen Leistung gemeldet habe, aber die genauen Einzelheiten sind mir noch nicht bekannt gegeben worden.«
»Herr Oberst,« versetzte Lannes in strengem Ton, »es ist unfair, die freiwillige Meldung dieses tapferen Offiziers anzunehmen, ohne ihm vorher die Gefahren genau mitzuteilen, denen er sich aussetzt.«
Aber schon hatte ich meine alte Furchtlosigkeit wiedergefunden.
»Herr General,« rief ich, »erlauben Sie mir, eine Bemerkung zu machen: je größer die Gefahr, um so höher der Ruhm: ich müßte es bedauern, freiwillig vorgetreten zu sein, wenn die Sache gefahrlos wäre.«
Es war heldenmütig gesprochen und meine Erscheinung verlieh meinen Worten den nötigen Nachdruck. Ich stand in jenem Augenblick auch da wie ein Held. Als ich des Marschalls Blicke bewundernd auf mich gerichtet sah, erzitterte ich vor Wonne bei dem Gedanken, welch brillantes Debüt ich in Spanien vor mir hatte. Wenn ich noch in dieser Nacht stürbe, würde mein Name unvergessen werden. Meine neuen Kameraden wie auch die alten, wie weit sie auch im übrigen von einander abweichen mochten, würden einen Berührungspunkt haben, in dem sie sich in ihrer Liebe und ihrer Bewunderung für den Rittmeister Gerard zusammenfinden könnten.
»Herr General, setzen Sie die Sache auseinander!« sagte Lannes zu Razout.
Der Genieoffizier erhob sich. Den Kompass in der Hand geleitete er mich zur Türe und zeigte auf die alte graue Mauer, die aus den Trümmern der zerstörten Häuser hervorragte.





























