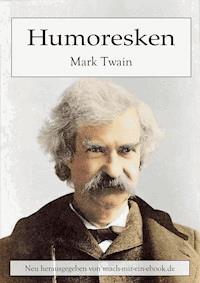3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenpoträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Schule schwänzen, Höhlen erforschen, als Pirat auf dem Mississippi leben: Mark Twains aufmüpfiger, liebenswerter Held Tom Sawyer ist ein Lausbube, wie er im Buche steht. Nicht zufällig gehört ›Tom Sawyer‹ zu den beliebtesten Kinder- und Jugendromanen der Weltliteratur. Darüber hinaus aber ist der Roman mit seiner Kritik am spießbürgerlichen Leben ein bis heute aktueller Gesellschaftsroman, der sich an alle jung gebliebenen Erwachsenen richtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Ähnliche
Mark Twain
Die Abenteuer von Tom Sawyer
Roman
Aus dem Amerikanischen von Peter Torberg
Fischer e-books
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon.
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.
Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.
Vorwort
Die meisten der in diesem Buch beschriebenen Abenteuer sind wirklich geschehen; das eine oder andere habe ich selbst erlebt, die anderen sind Erlebnisse von Jungen, mit denen ich in die Schule gegangen bin. Huck Finn ist nach dem Leben gezeichnet; Tom Sawyer ebenfalls, aber nicht nach einer einzelnen Person; vielmehr stellt er eine Kombination von drei Jungen dar, die ich kannte, und ist daher eher einem gemischten Architekturstil zuzurechnen.
Die hier erwähnten seltsamen abergläubischen Vorstellungen waren zum Zeitpunkt dieser Geschichte, also vor etwa dreißig, vierzig Jahren, unter Kindern und Sklaven im Mittelwesten weit verbreitet.
Mein Buch ist zwar hauptsächlich zur Unterhaltung von Jungen und Mädchen bestimmt, doch hoffe ich, daß Männer und Frauen es nicht aus diesem Grunde meiden, denn eine meiner Absichten bestand darin, die Erwachsenen freundlich daran zu erinnern, was sie selbst einst gewesen, was sie fühlten, dachten und sprachen und in welche sonderbaren Unternehmungen sie manchmal verwickelt gewesen sind.
Der Autor
Hartford, 1876
Erstes Kapitel
»Tom!«
Keine Antwort.
»Tom!«
Keine Antwort.
»Was ist nur in den Jungen gefahren, frage ich mich? He, Tom!«
Die alte Dame zog ihre Brille auf der Nase nach vorn und schaute über die Gläser hinweg im Zimmer umher; dann schob sie sie ganz hoch und blickte unter den Gläsern hervor. Nach etwas so Kleinem wie einem Jungen sah sie so gut wie nie durch sie hindurch, denn dies war ihre Feiertagsbrille, ihr ganzer Stolz; sie waren nur zur Zierde angefertigt worden, nicht weil sie sie brauchte – durch ein Paar Ofenringe hätte sie genausogut sehen können. Sie blickte sich einen Augenblick lang verwirrt um und sagte, nicht wütend, aber immer noch laut genug, daß die Möbelstücke es hören konnten: »Also, wenn ich dich erwische, dann werde ich …«
Sie sprach den Satz nicht zu Ende, denn sie beugte sich bereits vor und stocherte mit dem Besen unterm Bett – und jeder einzelne Stoß wurde von einem heftigen Keuchen begleitet. Außer der Katze scheuchte sie allerdings nichts auf:
»So was wie diesen Jungen habe ich noch nie gesehen!«
Sie ging zur Tür, die offenstand, stellte sich in den Türrahmen und blickte hinaus zwischen die Tomatenstauden und das Stechapfelgestrüpp, aus denen der Garten bestand. Kein Tom. Also erhob sie die Stimme zu einer Lautstärke, die für größere Entfernungen bestimmt war, und rief: »Ju-hu, Tom!«
Sie hörte ein leises Geräusch hinter sich und konnte sich gerade noch schnell genug umdrehen, um einen kleinen Jungen am Zipfel seiner kurzen Jacke zu erwischen und seine Flucht zu verhindern. »Hab ich dich! In der Speisekammer, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Was hast du da drin gemacht?«
»Nichts.«
»Nichts? Schau dir mal deine Hände an. Und schau dir mal deinen Mund an. Was ist das da?«
»Ich weiß nicht, Tante.«
»Aber ich weiß es. Das ist Marmelade. Ich hab dir schon hundertmal gesagt, wenn du die Finger nicht von der Marmelade läßt, zieh ich dir das Fell über die Ohren. Gib mir die Rute.«
Die Rute zitterte in der Luft. Die Lage war verzweifelt.
»Oh! Schau mal, hinter dir, Tante!«
Die alte Dame drehte sich auf dem Absatz um und raffte ihre Röcke hoch. Der Bursche machte sich augenblicklich aus dem Staub, kletterte den hohen Lattenzaun hinauf und verschwand auf der anderen Seite.
Seine Tante Polly stand einen Augenblick lang überrascht da und lachte dann gnädig.
»Also, da soll doch einer den Jungen … lern ich denn nie dazu? Hat er mir denn noch nicht schon genug Streiche gespielt, so daß ich eigentlich auf der Hut sein müßte? Aber alte Narren sind die größten Narren, die’s gibt. Einem alten Hund bringt man keine neuen Kunststücke bei, wie man so sagt. Du meine Güte, jedesmal kommt er mit einem anderen Trick daher, wie soll man da ahnen, was kommt? Er weiß genau, wie lange er mich ärgern kann, bevor er mich auf die Palme bringt, und er weiß, wenn er es schafft, daß ich einen Augenblick durcheinander bin oder lachen muß, ist die Wut schon wieder verraucht, und ich kann ihn einfach nicht mehr verhauen. Ich tue einfach nicht meine Pflicht gegenüber dem Jungen, und Gott weiß, das ist die reine Wahrheit. ›Wer sein Kind liebt, der züchtigt es‹, das steht schon in der Bibel. Ich lade nur Schuld und ewige Verdammnis auf uns beide, soviel steht fest. Der Teufel ist in ihn gefahren, aber, Himmel noch eins, er ist der Junge meiner eigenen Schwester selig, armer Kerl, und ich hab einfach nicht das Herz, ihn zu schlagen. Jedesmal, wenn ich ihn davonkommen lasse, hab ich ein schlechtes Gewissen, und jedesmal, wenn ich ihn verhaue, bricht es mir fast mein altes Herz. Na ja, ›der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe‹, wie schon die Bibel sagt, und ich denke, da ist was dran. Er wird den Nachmittagsunterricht schwänzen, und dann muß ich ihm morgen zur Strafe eine Arbeit aufbrummen. Ganz schön schwer, ihn am Samstag zur Arbeit zu kriegen, wo doch alle Jungen frei haben, aber er haßt Arbeit mehr als alles andere, und wenigstens ab und zu muß ich ja meine Pflicht an ihm tun, sonst verderbe ich das Kind noch völlig.«
Tom schwänzte tatsächlich die Schule, und an diesem Nachmittag hatte er viel Spaß. Er kam gerade rechtzeitig wieder nach Hause, um Jim, dem kleinen farbigen Jungen, wie üblich dabei zu helfen, vor dem Abendessen noch das Holz für den nächsten Tag zu sägen und zu Brennholz zu zerhacken – zumindest war er noch rechtzeitig da, um Jim seine Abenteuer zu erzählen, während dieser drei Viertel der Arbeit erledigte. Sid, Toms jüngerer Bruder (Halbbruder, besser gesagt), hatte seinen Teil der Arbeit schon erledigt (die Späne aufsammeln), denn er war ein stiller Junge und hatte mit Abenteuern und Aufsässigkeiten nichts im Sinn.
Als Tom beim Essen saß und, wenn die Gelegenheit günstig war, Zuckerstückchen aus der Dose am Tisch stibitzte, stellte Tante Polly ihm listige und sehr hintersinnige Fragen – sie wollte ihn hereinlegen und ihn dazu bringen, sich zu verplappern. Wie so viele andere schlichte Seelen auch wiegte sie sich mit Vorliebe in dem Glauben, eine Begabung für dunkle und geheimnisvolle Diplomatie zu haben, und gerade ihre am leichtesten zu durchschauenden Einfälle hielt sie selbst für wahre Wunderwerke schlauester Gerissenheit. Beiläufig fragte sie: »Tom, es war doch ziemlich warm in der Schule, oder nicht?«
»Ja, Ma’m.«
»Mächtig warm, oder nicht?«
»Ja, Ma’m.«
»Und, wolltest du nicht schwimmen gehen, Tom?«
Der Schreck fuhr Tom durch die Glieder – ein leiser, ungemütlicher Verdacht keimte in ihm auf. Er sah Tante Polly ins Gesicht, aber ihre Miene verriet nichts. Er erwiderte: »Nein, Ma’m, na ja, nur ein bißchen.«
Die alte Dame streckte ihre Hand aus, befühlte Toms Hemd und sagte: »Aber jetzt ist es dir doch nicht zu warm, oder?«
Und der Gedanke, daß sie geprüft hatte, ob das Hemd trocken war, ohne daß irgend jemand ihre Absicht bemerkt hatte, schmeichelte ihr. Trotz ihrer Hinterlist wußte Tom aber nun, woher der Wind wehte. Und so kam er schon dem möglichen nächsten Schritt zuvor: »Ein paar von uns haben die Köpfe unter die Pumpe gesteckt … ich hab immer noch nasse Haare, siehst du?«
Tante Polly ärgerte sich bei dem Gedanken, daß sie dieses Indiz übersehen und einen Stich verloren hatte. Dann hatte sie einen neuen Einfall: »Um den Kopf unter die Pumpe zu halten, mußtest du doch nicht deinen Hemdkragen auftrennen, wo ich ihn angenäht habe, oder, Tom? Knöpf deine Jacke auf!«
Die Sorgenmiene verschwand aus Toms Gesicht. Er knöpfte seine Jacke auf. Sein Hemdkragen war fest angenäht.
»Also so was! Na, raus mit dir. Ich war mir sicher, daß du die Schule geschwänzt hast und schwimmen warst. Aber ich verzeihe dir, Tom, ich denke, du bist wie die sprichwörtliche Katze, die zu nah ans Feuer geraten ist, du bist gar nicht so schlecht, wie es den Anschein hat … aber paß bloß auf.«
Teils tat es ihr leid, daß ihr Scharfsinn nichts gebracht hatte, teils war sie froh, daß Tom wenigstens einmal gehorsam gewesen war.
Aber Sidney sagte: »Ich hab gedacht, du hast seinen Kragen mit weißem Faden angenäht, aber der Faden da ist schwarz.«
»Stimmt, ich habe ihn mit Weiß angenäht! Tom!«
Aber Tom wartete den Rest gar nicht erst ab. Als er zur Tür hinausschoß, sagte er: »Siddy, dafür gibt’s ’ne Tracht Prügel.« Als er sich in Sicherheit gebracht hatte, untersuchte Tom zwei große Nadeln, die in den Aufschlägen seiner Jacke steckten – und die mit Faden umwickelt waren –, eine Nadel mit weißem und die andere mit schwarzem Faden. Er sagte: »Wenn Sid nicht gewesen wäre, hätte sie es nie gemerkt. Verdammich, manchmal näht sie mit Weiß und manchmal mit Schwarz. Ich wünschte, sie könnte sich mal für das eine oder das andere entscheiden, herrjemineh … ich komm ja kaum hinterher. Aber Sid kriegt Dresche, da kannst du drauf wetten. Ich werd’s ihm schon heimzahlen!«
Tom war nicht gerade der Musterknabe des Städtchens. Aber er kannte den Musterknaben sehr gut und konnte ihn nicht ausstehen.
Nach zwei Minuten, oder sogar noch weniger, hatte er all seine Sorgen vergessen. Nicht, weil seine Sorgen auch nur einen Deut geringer und weniger schwer waren, als die Sorgen eines Mannes für einen Mann sind, sondern weil ein neues, mächtiges Interesse sie verdrängte und für eine Weile aus seinem Gedächtnis verbannte, ebenso wie ein erwachsener Mann in der Aufregung neuer Unternehmungen seine Schicksalsschläge vergißt. Dieses Interesse konzentrierte sich auf eine hochbedeutende Neuerung in der Kunst des Pfeifens, die er gerade von einem Neger gelernt hatte, und er konnte es kaum erwarten, endlich ungestört üben zu können. Es handelte sich um ein besonderes, vogelartiges Motiv, eine Art von fließendem Triller, der dadurch entsteht, daß man die Zunge mitten in der Melodie kurz hintereinander an den Gaumen bringt. Falls der Leser jemals ein Junge gewesen ist, wird er sich vielleicht daran erinnern, wie man das macht. Mit Eifer und Konzentration bekam Tom den Bogen schnell heraus, und forschen Schritts ging er die Straße hinunter, den Mund voller Töne und die Seele voller Dankbarkeit. Er kam sich vor wie ein Astronom, der gerade einen neuen Planeten entdeckt hat. Und wenn es um den starken, tiefen, reinen Spaß an der Sache ging, so war der Junge unzweifelhaft im Vorteil, nicht der Astronom.
Die Sommerabende waren lang. Es war noch nicht dunkel. Schließlich hörte Tom auf zu pfeifen. Ein fremder Junge stand vor ihm, eine Spur größer als er selbst. Ein Neuankömmling, gleich welchen Alters oder Geschlechts, war in dem armen heruntergekommenen Städtchen namens St. Petersburg ein bemerkenswertes Ereignis. Und dieser Junge war auch noch gut gekleidet – und das an einem Wochentag. Es war einfach nicht zu fassen. Seine Mütze war ein zierliches Etwas, seine enggeknöpfte Jacke aus blauem Tuch war neu und piekfein, seine Hose ebenfalls. Er trug Schuhe – dabei war erst Freitag. Er trug sogar eine Krawatte, ein leuchtendes Stoffband. Der Junge hatte eine vornehm-städtische Art an sich, etwas, woran Tom schwer zu kauen hatte. Je länger Tom die blendende Wundererscheinung anstarrte, desto mehr rümpfte er die Nase über die feinen Klamotten und desto schäbiger und schäbiger kam ihm seine eigene Kleidung vor. Keiner der beiden Jungen sagte etwas. Wenn sich einer rührte, bewegte sich auch der andere – und so umkreisten sie sich. Dabei blieben sie aber die ganze Zeit einander zugewandt und behielten sich fest im Auge. Schließlich sagte Tom: »Ich kann dich auch verprügeln!«
»Das will ich doch mal sehen.«
»Kann ich wohl.«
»Kannst du doch sowieso nicht.«
»Kann ich doch.«
»Nein, kannst du nicht.«
»Kann ich.«
»Kannst du nicht.«
»Doch.«
»Nein.«
Nach einer unbehaglichen Pause sagte Tom: »Wie heißt ’n du?«
»Das geht dich überhaupt nichts an!«
»Na, ich kann ja dafür sorgen, daß es mich was angeht.«
»Und, warum tust du’s nicht?«
»Wenn du noch lange so weiterredest, mach ich das auch.«
»Weiter, weiter, weiter! Also, was jetzt?«
»Du hältst dich wohl für mächtig gescheit, oder? Ich könnte dir mit einer Hand hintern Rücken gebunden eine kleben, wenn ich wollte.«
»Und, warum tust du’s nicht? Du redest immer nur davon.«
»Ich werd schon noch, wenn du dich mit mir anlegst.«
»Ach ja? Ich hab schon ganze Familien in derselben Zwickmühle sitzen sehen.«
»Klugscheißer! Du hältst dich wohl für sonstwen, oder was? Und diese Mütze!«
»Du kannst sie dir ja holen, wenn sie dir nicht gefällt. Trau dich und hol sie dir. Aber da mußt du dir schon was einfallen lassen.«
»Du bist ein Lügner!«
»Selber Lügner.«
»Du bist ein verdammter Lügner und traust dich nicht mal.«
»Ach, hau doch ab!«
»Noch mehr von deinen Frechheiten, und ich schmeiß dir einen Stein an den Kopf.«
»Na klar tust du das.«
»Bestimmt.«
»Und warum tust du’s dann nicht? Die ganze Zeit redest du nur davon, was du tun willst! Warum tust du’s nicht? Weil du nämlich Angst hast.«
»Ich hab keine Angst.«
»Hast du doch.«
»Hab ich nicht.«
»Hast du doch.«
Eine weitere Unterbrechung, und noch mehr Beäugen und Umkreisen. Schließlich standen sie sich dicht gegenüber. Tom sagte: »Verschwinde von hier!«
»Verschwinde doch selber!«
»Tu ich nicht.«
»Ich auch nicht.«
Und so standen sie da, jeder einen Fuß quergestellt zum besseren Stand, schoben aus Leibeskräften und starrten sich haßerfüllt an. Doch keiner konnte einen Vorteil erringen. Nachdem sie sich so lange gemüht hatten, bis sie erhitzt waren und hochrote Köpfe hatten, ließen beide aufmerksam lauernd nach, und Tom sagte: »Du bist ein Feigling und eine Niete. Ich werd meinen großen Bruder auf dich hetzen, der kann dich mit dem kleinen Finger verdreschen, und ich sag ihm, daß er’s tun soll.«
»Was interessiert mich denn dein großer Bruder? Ich hab einen Bruder, der ist noch größer, und außerdem kann er deinen großen Bruder über den Zaun da schmeißen.« (Beide Brüder existierten nur in der Phantasie.)
»Das ist gelogen.«
»Nur weil du das sagst, ist es noch lange nicht so.«
Tom zog mit dem großen Zeh eine Linie in den Staub und sagte: »Wag es ja nicht, da drüberzutreten, sonst prügel ich dich durch, bis du nicht mehr aufstehen kannst. Wer das wagt, ist so gut wie tot.«
Der neue Junge trat sofort über die Linie und sagte: »Du hast gesagt, du machst es, jetzt wollen wir auch mal sehen.«
»Komm mir ja nicht zu nahe; paß bloß auf.«
»Also, du hast gesagt, du machst es. Und, warum machst du’s nicht?«
»Verdammt, für zwei Penny mach ich’s.«
Der neue Junge zog zwei glänzende Kupfermünzen aus seiner Tasche und streckte sie Tom mit verächtlicher Geste entgegen.
Tom schlug sie ihm aus der Hand.
Im nächsten Augenblick rollten und purzelten die beiden Jungen wie zwei ineinander verbissene Katzen im Staub, und eine Minute lang zerrten und rissen sie sich gegenseitig an den Haaren und Kleidern, schlugen sich gegenseitig auf die Nasen und zerkratzten sich und bedeckten sich mit Staub und Ruhm. Schließlich nahm das Durcheinander wieder Form an, und durch den aufgewirbelten Staub hindurch tauchte Tom auf, der auf dem neuen Jungen hockte und ihn mit Fäusten traktierte.
»Sag: ›Genug‹!« schrie er.
Der Junge strampelte, um freizukommen. Er heulte – hauptsächlich vor Wut.
»Sag: ›Genug‹!«, und es hagelte weiter Schläge.
Endlich brachte der Fremde ein gepreßtes »Genug!« hervor, und Tom ließ ihn aufstehen und meinte: »Laß dir das eine Lehre sein. Das nächste Mal paß besser auf, mit wem du dich anlegst.«
Der neue Junge zog ab und klopfte sich den Staub von den Kleidern, schluchzte, schniefte, warf ab und zu einen Blick nach hinten, schüttelte den Kopf und drohte, was er Tom antun würde, wenn er ihn »das nächste Mal erwischte«. Worauf Tom mit Hohngelächter antwortete und mit stolzgeschwellter Brust davonging. Doch kaum hatte er dem neuen Jungen den Rücken gekehrt, griff sich dieser einen Stein, warf ihn, traf Tom zwischen den Schultern, machte kehrt und rannte schnell wie eine Antilope davon. Tom verfolgte den Verräter bis nach Hause und bekam so heraus, wo er wohnte. Dann hielt er eine Weile Wache vor dem Gartentor und forderte den Feind auf, herauszukommen, doch der Feind schnitt nur Grimassen durchs Fenster und verschwand schließlich. Zum Schluß kam die Mutter des Feindes heraus, schimpfte Tom einen üblen, hinterhältigen, vulgären Bengel und scheuchte ihn davon. Und so ging er, meinte aber, daß er sich den »Kerl schon noch schnappen« würde.
An diesem Abend kam er ziemlich spät nach Hause, und als er vorsichtig durchs Fenster stieg, stieß er dort auf einen Hinterhalt in Gestalt seiner Tante. Und als sie den Zustand seiner Kleidung sah, stand ihr Entschluß, seinen freien Samstag in eine Gefangenschaft mit schwerster Zwangsarbeit umzuwandeln, felsenfest.
Zweites Kapitel
Es war Samstagmorgen, und die ganze sommerliche Welt war klar und frisch und strotzte nur so vor Leben. In jedem Herzen klang ein Lied, und wenn das Herz jung war, floß ein Lied über die Lippen. Alle Gesichter strahlten, und in jedem Schritt lag Schwung. Die Robinien blühten, und der Duft ihrer Blüten erfüllte die Luft.
Cardiff Hill, ein kleiner Hügel, der die Stadt in einiger Entfernung überragte, war grün bewachsen. Der Hügel lag gerade weit genug weg, um wie ein Märchenland zu wirken, verträumt, ruhig und einladend.
Tom erschien mit einem Eimer Tünche und einem langstieligen Pinsel auf dem Gehweg. Er besah sich den Zaun, alle Freude verließ ihn, und eine tiefe Melancholie machte sich in seiner Seele breit. Zehn Meter Lattenzaun, fast drei Meter hoch! Das Leben kam ihm öde vor, das menschliche Dasein eine einzige Last. Seufzend tauchte er den Pinsel in die Tünche und fuhr damit über die oberste Planke. Er wiederholte diesen Vorgang; dann noch einmal; dann verglich er den unbedeutenden getünchten Strich mit dem endlosen Kontinent des ungetünchten Zauns und setzte sich entmutigt auf eine Holzkiste, die, um einen Baum herum gebaut, dessen Stamm schützte. Jim kam mit einem Blecheimer durchs Tor gesprungen und sang Die Mädchen von Buffalo. Wasser von der Pumpe des Städtchens holen zu müssen, hatte Tom stets als hassenswerte Pflicht empfunden, doch nun sah er das ganz anders. Ihm fiel ein, daß es ja an der Pumpe immer Gesellschaft gab. Stets waren Jungen und Mädchen, Weiße, Mulatten und Neger da, die darauf warteten, an die Reihe zu kommen, sich ausruhten, Spielzeug tauschten, miteinander stritten, kämpften und Blödsinn machten. Und ihm fiel ein, daß Jim immer über eine Stunde brauchte, um einen Eimer Wasser zu holen, obwohl die Pumpe nur hundertfünfzig Meter entfernt lag, und selbst dann mußte man noch jemanden hinter ihm herschicken. Tom sagte: »Hör mal, Jim, ich hol das Wasser, wenn du ’n bißchen für mich streichst.«
Jim schüttelte den Kopf und erwiderte: »Geht nich, Master Tom. Die alte Missis, die hat gesagt, ich soll los und das Wasser holen und nich mit wem rumalbern. Sie sagt, sie denkt, Master Tom wird mich bitten zu streichen, und sie sagt, ich soll mich nur um mein eigenen Kram kümmern. Sie sagt, sie wird sich schon ums Streichen kümmern.«
»Ach, kümmer dich nich drum, was sie gesagt hat, Jim. So redet sie doch immer. Gib mir den Eimer. Ich bin nur ’ne Minute weg. Das kriegt sie doch gar nich mit.«
»Nee, ich darf nich, Master Tom. Die alte Missis, die reißt mir den Kopf ab. Bestimmt.«
»Die? Die schlägt doch niemanden … haut einem höchstens mit dem Fingerhut über den Kopf, und wen stört denn das schon, möcht ich mal wissen? Sie redet doch nur, und reden hat noch keinem weh getan … solange sie nicht weint. Jim, ich geb dir ’ne Murmel. Ich geb dir ’nen weißen Schusser!«
Jim zögerte.
»Einen weißen, aus Marmor. Der titscht ganz prima.«
»O je. Das is ’ne mächtig tolle Murmel, kann man wohl laut sagen. Aber, Master Tom, ich hab mächtig Angst vor der alten Missis.«
Aber Jim war auch nur ein Mensch – diese Versuchung war zu groß für ihn. Er stellte seinen Eimer hin, nahm die weiße Marmormurmel und beugte sich vor lauter Anspannung vor, während er das Bündel auswickelte. Im nächsten Augenblick floh er mit Eimer und brennendem Hintern die Straße hinunter, Tom war voller Eifer am Tünchen, und Tante Polly zog sich mit einem Pantoffel in der Hand und Triumph in den Augen vom Schlachtfeld zurück.
Doch Toms Energie hielt nicht lange vor. Er dachte an all den Spaß, den er sich für diesen Tag vorgenommen hatte, und sein Kummer vervielfachte sich. Bald schon würden die Jungen, die frei hatten, in der Aussicht auf herrliche Abenteuer vorbeigelaufen kommen, und sie würden sich über ihn lustig machen, weil er arbeiten mußte – allein der Gedanke daran brannte schon wie Feuer. Er zog seine Besitztümer aus der Tasche und begutachtete sie – Spielzeug, Murmeln und Krimskrams; genug, um vielleicht Arbeitskraft dafür einzutauschen, aber nicht genug, um auch nur eine halbe Stunde reiner Freiheit zu kaufen. Also stopfte er seinen bescheidenen Besitz wieder in die Tasche und ließ die Idee fallen, die Jungs kaufen zu können. In diesem tristen, hoffnungslosen Augenblick hatte er eine Eingebung! Nichts geringeres als eine große, phantastische Eingebung!
Er nahm seinen Pinsel und machte sich in aller Ruhe wieder an die Arbeit. Nicht lange, und Ben Rogers stampfte heran; genau der Junge, vor dessen Spott Tom sich am meisten fürchtete. Bens Gang glich eher einer Art Dreisprung – Beweis genug dafür, daß er frohen Herzens und voller hochgestimmter Erwartungen war. Er aß einen Apfel und ließ ab und zu ein langes, melodiöses »Tuut« hören, gefolgt von einem tiefen »Ding-dong-dong, dingdong-dong«, denn er verkörperte einen Dampfer. Als er näher kam, drosselte er die Geschwindigkeit, manövrierte in die Straßenmitte, beugte sich weit nach Steuerbord und luvte mühselig und mit schwerfälligem Pomp und Getöse an, denn er war schließlich die Big Missouri und tat so, als hätte er drei Meter Tiefgang. Er war Dampfer, Kapitän und Maschinenglocken in einem, und so mußte er sich vorstellen, auf seinem eigenen Oberdeck zu stehen, die Befehle zu geben und sie auszuführen: »Stopp, Sir! Ding-a-ling-ling.« Das Fahrzeug verlor zusehends an Geschwindigkeit und glitt langsam zum Gehweg. »Zurück! Ding-a-ling-ling!« Er ließ seine Arme lang und steif herabhängen. »Steuerbord achteraus! Ding-a-ling-ling! Tschuuh! Tschtschuuh-huuh-tschuu!«, und sein rechter Arm beschrieb majestätische Kreise, denn er stellte ein zwölf Meter hohes Schaufelrad dar. »Backbord achteraus! Ding-a-ling-ling! Tschuuh-tsch-tschuuh-tschuuh!« Die linke Hand trat kreisend in Aktion.
»Steuerbord stopp! Ding-a-ling-ling! Backbord stopp! Steuerbord langsame Fahrt voraus! Stopp! Außenrad langsame Fahrt! Ding-a-ling-ling! Tschuuh-huuh-huuh! Her mit der Bugleine! Aber ’n bißchen flott! Raus mit dem Spanntau … was machen Sie da? Das Tau einmal um den Poller da schlagen! Wahrschau an der Landungsbrücke … und ab! Alle Maschinen still, Sir! Ding-a-ling-ling! Scht! Sch-scht! Scht!« Er probierte die Dampfhähne.
Tom tünchte ungerührt weiter – kümmerte sich gar nicht um den Dampfer. Ben schaute einen Augenblick zu und sagte dann: »Hallo-ho! Steckst ganz schön in der Klemme, was?«
Keine Antwort. Tom begutachtete seinen letzten Pinselstrich mit dem Auge eines Künstlers, dann fuhr er noch einmal sanft mit dem Pinsel über die Stelle und begutachtete erneut das Ergebnis. Ben manövrierte auf seine Höhe. Tom lief beim Anblick des Apfels das Wasser im Munde zusammen, aber er kümmerte sich weiter um seine Arbeit. Ben sagte: »Hallo, alter Knabe, mußt arbeiten, was?«
»Ach, du bist’s, Ben! Ich hab dich gar nicht bemerkt.«
»He, ich geh schwimmen, jawohl. Willst du nicht mitkommen? Aber du arbeitest natürlich lieber, stimmt’s? Aber klar!« Tom sah den Jungen eine Weile an und sagte: »Was meinst du mit Arbeit?«
»Na, ist das denn keine Arbeit?«
Tom betrachtete sein Werk und antwortete wie nebenher: »Tja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß nur, für Tom Sawyer ist das genau das Richtige.«
»Ach, hör schon auf, du willst mir doch nicht einreden, daß dir das Spaß macht?«
Und wieder wurde der Pinsel hin und her bewegt.
»Spaß? Nun, ich wüßte nicht, warum mir das keinen Spaß machen sollte. Kriegt ein Junge vielleicht jeden Tag die Gelegenheit, einen Zaun zu tünchen?«
Das ließ die Sache in einem ganz anderen Licht erscheinen. Ben hörte auf, an seinem Apfel herumzuknabbern. Tom fuhr mit seinem Pinsel geziert hin und her – machte einen Schritt zurück, um das Ergebnis zu betrachten – fügte hier und da noch einen Strich hinzu – begutachtete erneut das Ergebnis – Ben beobachtete jede Bewegung, sein Interesse war geweckt, und er war fasziniert. Schließlich sagte er: »He, Tom, laß mich auch mal ein bißchen tünchen.«
Tom dachte darüber nach, als ob er einwilligen wolle, änderte aber seine Meinung: »Nein, nein, ich glaube, das geht nicht, Ben. Weißt du, Tante Polly ist fürchterlich pingelig mit diesem Zaun … du weißt schon, so direkt an der Straße. Also, wenn es die Rückseite wäre, dann hätte ich nichts dagegen, und sie auch nicht. Ja, ja, sie ist schon ziemlich pingelig mit diesem Zaun; das muß sehr sorgfältig gemacht werden. Ich glaub, es gibt unter tausend, vielleicht zweitausend Jungen nicht einen, der das richtig hinkriegt.«
»Meinst du wirklich? Ach, komm schon, laß mich doch mal probieren, nur ein bißchen. Ich würde dich auch probieren lassen, wenn ich du wäre, Tom.«
»Ben, ich würde ja gern, hoch und heilig; aber Tante Polly… Weißt du, Jim wollte schon mal tünchen, aber sie hat ihn nicht gelassen. Sid wollte tünchen, aber Sid hat sie auch nicht gelassen. Siehst du, in welcher Klemme ich stecke? Wenn du an dem Zaun herummachst, und es passiert irgendwas …«
»Ach, Quatsch! Ich paß schon auf: Laß mich doch mal probieren. Hör mal, ich geb dir auch meine Apfelkitsche.«
»Also gut. Ach nein, Ben, besser nicht, ich hab Angst …«
»Ich geb dir den ganzen Apfel!«
Tom gab den Pinsel mit Zögern in der Miene, aber mit Bereitwilligkeit im Herzen aus der Hand. Und während der ehemalige Raddampfer Big Missouri in der prallen Sonne schuftete und schwitzte, saß der ehemalige Künstler daneben auf einem Faß im Schatten, ließ die Beine baumeln, verspeiste seinen Apfel und heckte bereits das Hinmetzeln weiterer Unschuldiger aus. An Opfern gab es keinen Mangel; ständig kamen Jungen vorbei. Erst machten sie sich lustig, aber dann blieben sie, weil auch sie tünchen wollten. Als Ben müde geworden war, hatte Tom seine Ablösung schon für einen recht gut erhaltenen Drachen an Billy Fisher verkauft; als der genug hatte, kaufte sich Johnny Miller für eine tote Ratte und einen Bindfaden ein, an der man sie kreisen lassen konnte; und so weiter und so fort, Stunde um Stunde. Und als es später Nachmittag war, schwelgte Tom, der noch am Morgen ein von Armut geschlagener Junge war, förmlich in Reichtum. Außer den bereits erwähnten Gegenständen hatte er nun zwölf Murmeln, ein Stück von einer Maultrommel, eine blaue Flaschenglasscherbe zum Durchschauen, eine Spulenkanone, einen Schlüssel, der nichts aufsperrte, ein Stück Kreide, den Glasstopfen einer Karaffe, einen Zinnsoldaten, ein paar Kaulquappen, sechs Kracher, ein Kätzchen mit nur einem Auge, einen Messingtürknauf, ein Hundehalsband – ohne Hund –, einen Messergriff, vier Stück Orangenschale und einen verwitterten alten Fensterrahmen. Die ganze Zeit über hatte er eine nette, gute friedliche Zeit verbracht, jede Menge Gesellschaft gehabt, und der Zaun war dreimal gestrichen worden! Wenn ihm nicht die Tünche ausgegangen wäre, dann hätte er jeden Jungen in der Stadt ruiniert.
Tom sagte sich, daß das Dasein alles in allem doch nicht gar so sinnentleert sei. Er hatte, ohne es zu wissen, eines der grundlegenden Gesetze menschlichen Handelns entdeckt, das da lautet: Man muß nur dafür sorgen, daß etwas schwierig zu bekommen ist, schon will jeder es haben. Wenn er ein großer und weiser Philosoph gewesen wäre, wie der Verfasser dieses Buchs einer ist, dann hätte er nun begriffen, daß Arbeit aus dem besteht, wozu man gezwungen wird, und Spiel aus dem, wozu man nicht gezwungen wird. Dann hätte er auch verstanden, warum die Herstellung von künstlichen Blumen oder das Bedienen einer Tretmühle Arbeit ist, Kegeln oder die Besteigung des Mont Blanc aber reines Vergnügen. Es gibt reiche Herrschaften in England, die im Sommer vierspännige Überlandkutschen zwanzig oder dreißig Meilen weit chauffieren, und für dieses Privileg müssen sie ziemlich viel Geld bezahlen. Würde man ihnen für ihre Dienste Geld anbieten und sie so in Arbeit verwandeln, dann würden sie sie ablehnen.
Drittes Kapitel
Tom tauchte bei Tante Polly auf, die in einem hübschen rückwärtigen Zimmer, das Schlafzimmer, Eßzimmer und Bibliothek zugleich war, am offenen Fenster saß. Die milde Sommerluft, die friedliche Ruhe, der Duft der Blumen und das einschläfernde Gesumm der Bienen hatten ihre Wirkung gezeigt, und sie war über ihrem Strickzeug eingeschlafen – denn sie hatte außer der Katze keine andere Gesellschaft, und die lag schlafend auf ihrem Schoß. Ihre Brille hatte sie zur Sicherheit nach oben auf ihr graues Haupt geschoben. Sie hatte angenommen, daß Tom sich natürlich schon längst verdrückt hatte, und sie wunderte sich, daß er sich derart unerschrocken vor ihre Augen traute.
»Darf ich jetzt spielen gehen, Tante?«
»Was, schon fertig? Wieviel hast du geschafft?«
»Ich bin fertig, Tante.«
»Tom, lüg mich nicht an. Das ertrag ich nicht.«
»Tu ich nicht, Tante, es ist wirklich alles fertig.«
Tante Polly schenkte solchen Aussagen wenig Glauben. Sie ging hinaus, um selbst nachzusehen; und sie wäre schon bei der Feststellung, daß zwanzig Prozent von Toms Behauptung stimmten, zufrieden gewesen. Als sie sah, daß der ganze Zaun gestrichen war, und zwar nicht nur einfach gestrichen, sondern sorgfältig nachgestrichen, und das zweimal, sogar zusätzlich mit einem Streifen am Boden, verschlug es ihr vor Überraschung fast die Sprache. Sie sagte: »Also, das hätte ich ja nie gedacht! Das muß man dir lassen, du kannst arbeiten, wenn du nur willst, Tom.« Und dann milderte sie das Kompliment ein wenig ab und bemerkte: »Aber es kommt schon ziemlich selten vor, daß du willst, das muß ich schon sagen. Na, geh und spiel; aber paß auf, daß du irgendwann im Lauf der Woche wiederkommst, sonst setzt es was.«
Sie war vom Glanz seiner Leistung derart geblendet, daß sie ihn mit in die Speisekammer nahm und einen prächtigen Apfel heraussuchte, den sie ihm mit der Ermahnung gab, welch großen Wert und Geschmack doch ein Genuß annehme, wenn er ohne Sünde durch ehrliches Bemühen erworben sei. Und als sie mit einem erbaulichen Bibelzitat endete, stibitzte er einen Krapfen.
Dann verdrückte er sich und sah, wie Sid gerade die Außentreppe zu den Hinterzimmern im ersten Stock hochstieg. Es lagen gerade ein paar Erdklumpen griffbereit, und im nächsten Augenblick schwirrte die Luft nur so von ihnen. Sie umtosten Sid wie ein Hagelschauer, und bevor Tante Polly ihre überraschten Sinne wieder beisammen hatte und zur Rettung eilen konnte, hatten sechs oder sieben Klumpen bereits ihr Ziel erreicht, und Tom war über den Zaun auf und davon. Es gab zwar ein Gartentor, doch meistens hatte er nicht genügend Zeit, um es zu benutzen. Nun, da er mit Sid abgerechnet hatte, weil dieser auf den schwarzen Faden aufmerksam gemacht und ihn in Schwierigkeiten gebracht hatte, fand seine Seele wieder Ruhe.
Tom lief um die benachbarten Grundstücke herum und bog in eine schlammige Gasse ein, die hinter dem Kuhstall seiner Tante vorbeiführte. So schaffte er es, aus der Gefahrenzone zu kommen, ohne in Gefangenschaft zu geraten und bestraft zu werden, und ging weiter Richtung Marktplatz, wo zwei feindliche »Kompanien« von Jungen sich zum Kampf versammelt hatten, wie vorher ausgemacht worden war. Tom war der General einer dieser Armeen, Joe Harper, einer seiner Busenfreunde, General der anderen. Diese beiden großen Kommandeure ließen sich nicht dazu herab, selbst zu kämpfen – das überließ man besser dem Fußvolk –, sondern saßen gemeinsam auf einer Anhöhe und lenkten das Kampfgetümmel mit Befehlen, die sie durch Adjutanten übermitteln ließen. Nach langem, erbittertem Kampf errang Toms Armee einen großartigen Sieg. Dann wurden die Toten gezählt, Gefangene ausgetauscht, die Bedingungen des nächsten Scharmützels ausgehandelt und der Tag der Schlacht festgelegt. Danach traten die Armeen in Reih und Glied an und marschierten davon, und Tom ging allein nach Haus.
Als er an dem Haus vorbeikam, in dem Jeff Thatcher lebte, sah er dort ein neues Mädchen im Garten – ein hübsches, kleines blauäugiges Wesen mit blonden Haaren, die zu zwei langen Zöpfen geflochten waren, einem weißen Sommerkleid und bestickten Pantoletten. Der ruhmreiche Held fiel, ohne einen Schuß abzufeuern. Eine gewisse Amy Lawrence verschwand aus seinem Herzen und ließ nicht die leiseste Spur einer Erinnerung zurück. Tom hatte immer geglaubt, sie bis zur Raserei zu lieben; er hatte seine Leidenschaft für Bewunderung gehalten; und siehe da, es war doch nur eine arme, kleine flüchtige Schwäche gewesen. Er hatte Monate gebraucht, um sie zu erobern, und sie hatte ihm erst vor einer knappen Woche ihre Zuneigung gestanden. Für sieben kurze Tage lang war er der glücklichste und stolzeste Junge auf der Welt gewesen, und schon war sie, nach einem kurzen Augenblick, aus seinem Herzen verschwunden wie eine flüchtige Bekannte, deren Besuch vorüber ist.
Mit verstohlenem Blick himmelte er diesen neuen Engel an, bis er sicher war, daß sie ihn bemerkt hatte. Dann tat er wiederum so, als wisse er gar nichts von ihrer Gegenwart, und fing an, auf jede nur erdenkliche, jungenhafte Weise anzugeben, um ihre Bewunderung zu erlangen. Er führte diese grotesken Albernheiten noch eine Weile fort, doch dann warf er, mitten in einer gefährlichen Turnübung, einen Blick zur Seite und sah, daß das kleine Mädchen aufs Haus zuging. Tom trat an den Zaun, lehnte sich betrübt darauf und hoffte, sie würde sich noch ein wenig Zeit lassen. Sie blieb einen Augenblick an der Treppe stehen und ging dann auf die Haustür zu. Tom seufzte laut, als sie ihren Fuß auf die Schwelle setzte, doch schon strahlte er übers ganze Gesicht, denn sie warf ihm ein Stiefmütterchen zu, bevor sie verschwand. Der Junge stürzte sich dorthin und blieb ein oder zwei Schritte vor der Blume stehen, dann beschattete er seine Augen mit der Hand und blickte die Straße entlang, als habe er dort etwas Interessantes entdeckt. Schließlich hob er einen Strohhalm auf und versuchte ihn, den Kopf weit in den Nacken gelegt, auf der Nase zu balancieren, und bei diesen Bemühungen schlich er sich immer näher an das Stiefmütterchen heran. Schließlich ruhte sein nackter Fuß auf der Blüte, seine geschmeidigen Zehen umschlossen sie, und er hopste mit seinem Schatz davon und verschwand um die Ecke. Doch nur für einen Augenblick – nur so lange, bis er die Blume an die Jacke stecken konnte, nah bei seinem Herzen oder vielleicht nahe bei seinem Magen, denn er kannte sich in Anatomie nicht allzu gut aus und nahm es damit sowieso nicht so genau.
Dann kehrte er zurück und hing bis zum Einbruch der Dunkelheit am Zaun herum und gab an wie zuvor. Aber das Mädchen zeigte sich nicht wieder, und Tom tröstete sich ein wenig mit dem Gedanken, daß sie in der Zwischenzeit irgendwo an einem Fenster gestanden und seine Aufmerksamkeiten bemerkt hatte. Schließlich ging er zögernd nach Hause, den armen Kopf voller Träumereien.
Das ganze Abendessen über war Tom derart guter Laune, daß seine Tante sich fragte, »was wohl in das Kind gefahren« sein mochte. Er wurde heftig ausgeschimpft, weil er Sid mit Lehmklumpen beworfen hatte, aber es schien ihm nicht das geringste auszumachen. Er versuchte, direkt vor Tante Pollys Nase Zuckerstückchen zu stibitzen, und bekam dafür einen Schlag auf die Finger. Er sagte: »Wenn Sid sich welche nimmt, schlägst du ihn nie, Tante.«
»Nun, Sid quält ja auch niemanden so wie du. Wenn ich nicht aufpassen würde, hättest du deine Finger andauernd im Zucker.«
Dann ging sie in die Küche, und Sid, der sich seiner Straffreiheit erfreute, griff nach der Zuckerdose – mit einer Miene des Triumphs über Tom, die fast nicht auszuhalten war. Doch Sid griff nicht richtig zu, und die Zuckerdose fiel herunter und zerbrach. Tom geriet in Verzückung – in solche Verzückung, daß er sogar den Mund hielt und kein Wort verlor. Er sagte sich, daß er selbst dann kein Wort verlieren würde, wenn seine Tante wieder hereinkäme, sondern vollkommen still dasitzen würde, bis sie fragte, wer das gewesen sei. Dann würde er es sagen, und es würde nichts Schöneres auf der Welt geben als zuzuschauen, wie dieser Musterknabe sich »eine fing«. Tom floß das Herz schier über vor Jubel, daß er kaum an sich halten konnte, als die alte Dame zurückkam, über den Scherben stand und Zornesblitze über ihre Brille schleuderte. Er sagte bei sich: »Jetzt kommt’s!« Und im nächsten Augenblick lag er der Länge lang auf dem Fußboden! Die mächtige Hand erhob sich, um erneut zuzuschlagen, als Tom laut rief: »He, mal langsam, warum schlägst du mich? Sid war’s!«
Tante Polly hielt verwirrt inne, und Tom hoffte auf linderndes Mitleid. Doch als sie ihre Sprache wiederfand, sagte sie nur: »Hmm! Na, du wirst dir die Ohrfeige auch so verdient haben. Kaum war ich weg, hast du bestimmt schon wieder einen anderen üblen Streich ausgeheckt, da bin ich sicher.«
Doch da plagte sie ihr Gewissen, und sie wollte etwas Nettes und Liebes sagen, aber dann fand sie, daß man das als Eingeständnis verstehen könnte, einen Fehler gemacht zu haben, was sich aus Gründen der Disziplin verbat. Also sagte sie nichts und wand sich mit betrübtem Herzen wieder ihren Verrichtungen zu. Tom schmollte in einer Ecke und ergötzte sich an seinem Leid. Er wußte, daß seine Tante im Innersten auf den Knien vor ihm lag, und auf mürrische Weise befriedigte ihn dieses Wissen. Er würde darauf nicht reagieren, würde keinerlei Notiz davon nehmen. Er wußte, daß ab und zu ein flehender, tränenverschleierter Blick auf ihn fallen würde, aber er weigerte sich, es zu bemerken. Er stellte sich vor, wie er sterbenskrank dalag und seine Tante sich über ihn beugte, doch er würde sein Gesicht zur Wand drehen und, ohne das erlösende Wort zu sagen, sterben. Wie sie sich dann wohl fühlen würde? Und dann stellte er sich vor, wie sie ihn vom Fluß heimtrugen, tot, die Haare naß, die armen Hände für immer ruhig und das gebrochene Herz still. Wie sie sich dann auf ihn werfen würde, wie ihre Tränen wie Regen fallen würden und sie zu Gott beten würde, ihr ihren Jungen zurückzugeben, und daß sie ihn auch nie, nie wieder schlecht behandeln würde! Doch er würde kalt und weiß daliegen und sich nicht rühren – ein armer kleiner Leidender, dessen Sorgen nun für immer ein Ende hatten. Seine Gefühle gingen im Überschwang dieser Vorstellungen derart mit ihm durch, daß er immer wieder schlucken mußte – so schnürte es ihm den Hals zu. Seine Augen schwammen in Tränen, die überflossen, wenn er blinzelte, herunterrannen und von seiner Nasenspitze tropften. Seinen Kummer zu pflegen war ihm so kostbar, daß er es nicht ertragen konnte, von irgendwelchen profanen Belustigungen oder irgendeiner unangenehmen Freude belästigt zu werden. Der Kummer war zu heilig, um mit solchen Dingen in Kontakt zu kommen. Und als schließlich seine Cousine Mary hereingetanzt kam und ganz aufgeregt war vor Freude, nach einem ewig langen Aufenthalt von einer Woche auf dem Land wieder zu Hause zu sein, stand er auf und ging in Wolken und Düsternis gehüllt zu der einen Tür hinaus, als sie Musik und Sonnenschein durch die andere hereintrug. Er hielt sich fern von den Stellen, an denen die Jungen normalerweise herumtollten, und suchte nach einsamen Plätzen, die seiner Stimmung entsprachen. Ein Floß auf dem Mississippi wirkte einladend auf ihn, und er setzte sich am Ufer hin, betrachtete die trübselige Weite des Stroms und wünschte sich die ganze Zeit, auf der Stelle und unbemerkt zu ertrinken, ohne den ungemütlichen Weg zu gehen, den die Natur dafür vorgesehen hatte. Dann fiel ihm das Stiefmütterchen ein. Er zog es ganz verknittert und verwelkt hervor, was seine düstere Stimmung nur noch bestärkte. Er fragte sich, ob sie wohl Mitleid hätte, wenn sie wüßte? Würde sie weinen und sich wünschen, sie hätte das Recht, ihre Arme um ihn zu schlingen und ihn zu trösten? Oder würde sie sich kühl abwenden wie der Rest der öden Welt? Diese Vorstellung löste derart süße Qualen in ihm aus, daß er sie in Gedanken immer und immer wieder durchging und sie in neues und anderes Licht rückte, bis sie zu guter Letzt ziemlich fadenscheinig geworden waren. Schließlich erhob er sich seufzend und verschwand in der Dunkelheit.
Zwischen halb zehn und zehn Uhr kam er die verlassene Straße entlang, in der die angebetete Unbekannte lebte. Er blieb einen Augenblick stehen; kein Geräusch drang an seine gespitzten Ohren. Eine Kerze warf ihren schwachen Schein auf die Gardine eines Fensters im ersten Stock. Befand sich die Verehrte in jenem Zimmer? Er kletterte über den Zaun und schlich sich durch den Garten, bis er unter jenem Fenster stand; lange und voller Gefühle blickte er hinauf. Dann legte er sich rücklings auf die Erde, streckte sich aus, die Hände mit der armen verwelkten Blume auf der Brust gefaltet. Und so würde er sterben – draußen in der kalten Welt, ohne Obdach für sein Haupt, ohne eine freundliche Hand, die ihm den Todesschweiß von der Stirn wischte, kein liebendes Gesicht, das sich mitleidig über ihn beugte, wenn die Todesqualen einsetzten. Und so würde sie ihn finden, wenn sie am hellichten Morgen hinausschaute – ach, würde sie eine Träne auf seine leblose Gestalt fallen lassen? Würde sie einen leisen Seufzer ausstoßen, dieses blühende junge Leben im Keim erstickt, viel zu früh gepflückt zu sehen?
Das Fenster ging auf, die mißtönende Stimme eines Hausmädchens entweihte die heilige Stille, und ein Wasserschwall durchnäßte die hingestreckten Überreste des Märtyrers!
Der mit dem Tode ringende Held sprang prustend auf; dann hörte man das Zischen eines Wurfgeschosses in der Luft, dazu ein undeutlich gemurmelter Fluch, darauf das Geräusch von splitterndem Glas, und eine kleine, nicht genau zu erkennende Gestalt kletterte über den Zaun und verschwand eilig in der Dunkelheit.
Kurze Zeit später, als Tom, der sich ausgezogen hatte, um ins Bett zu gehen, beim Schein einer Talgkerze seine nassen Sachen begutachtete, wachte Sid auf. Doch falls er die Absicht gehabt haben sollte, »gewisse Andeutungen zu machen«, besann er sich eines Besseren und schwieg – denn in Toms Augen blitzte Gefahr. Tom ging zu Bett, ohne sich noch die zusätzliche Mühe eines Gebets zu machen, und Sid merkte sich diese Unterlassung.
Viertes Kapitel
Die Sonne erhob sich über einer still in sich ruhenden Welt und schien auf das friedliche Städtchen herab, als wollte sie es segnen. Nach dem Frühstück hielt Tante Polly den Familiengottesdienst ab; er begann mit einem Gebet, das von Grund auf aus einer soliden Folge von Bibelzitaten gemauert war, die von einer dünnen Mörtelschicht Originalität zusammengehalten wurden, und von der Höhe dieses Gebets aus hielt sie eine unerbittliche Predigt aus dem Gesetz Mose, als stünde sie auf dem Berg Sinai.
Dann wappnete sich Tom gewissermaßen und machte sich daran, »seine Verse zu lernen«. Sid hatte seine Lektion schon Tage zuvor gelernt. Tom setzte all seine Energie daran, um fünf Bibelverse auswendig zu behalten; er hatte sich ein Stück von der Bergpredigt herausgesucht, weil er keine Verse finden konnte, die kürzer waren. Nach einer halben Stunde hatte Tom eine vage, allgemeine Vorstellung von seiner Lektion, aber mehr auch nicht, denn seine Gedanken wanderten über das gesamte Feld menschlichen Wissens, und seine Hände waren mit anderen Dingen beschäftigt. Mary nahm seine Bibel, um ihn abzuhören, und er versuchte, sich einen Weg durch den Nebel zu bahnen. »Selig sind, die ähm … äh … äh …«
»… die da geistlich …«
»Ja … geistlich. Selig sind, die da geistlich … ähm… ähm … « »… arm sind …«
»… arm sind; selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das … das …«
»Himmelreich …«
»Himmelreich. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie … denn sie …«
»… s …«
»Denn sie … ähm …«
»s… o … l …«
»Denn sie s … s … ach, ich hab keine Ahnung!«
»… sollen!«
»Ach ja, sollen! Denn sie sollen … denn sie sollen … ähm … ähm … sollen Leid tragen … ähm … ähm … Selig sind, die da sollen … die da … ähm … die da Leid tragen sollen, denn sie sollen … ähm … was sollen die? Warum sagst du es mir nicht, Mary? Warum bist du so gemein zu mir?«
»Ach, Tom, du armer Dummkopf, ich will dich doch nicht aufziehen. Das würde ich nie tun. Du mußt es noch mal lernen. Sei nicht traurig, Tom, du wirst es schon schaffen … und wenn, dann geb ich dir was ganz Tolles. Also los, sei ein braver Junge.«
»Na gut! Was ist denn, Mary, sag doch, was es ist.«
»Mach dir keine Sorgen, Tom. Du weißt doch, wenn ich sage, es ist toll, dann ist es das auch.«
»Da kannst du drauf wetten, Mary. Na gut, ich versuch’s noch mal.«
Und das tat er – und unter dem doppelten Ansporn von Neugier und der Aussicht, einen Preis zu gewinnen, machte er sich mit solchem Eifer daran, daß er einen glänzenden Sieg errang.
Mary schenkte ihm ein funkelnagelneues sogenanntes »Barlow«-Messer, das gerade mal zwölfeinhalb Cent wert war, und die Freude, die ihn durchfuhr, erschütterte ihn bis ins Innerste. Man konnte zwar mit diesem Messer nichts schneiden, aber immerhin war es »so gut wie« ein Barlow-Messer, und allein darin lag schon ein unermeßlicher Wert – wie allerdings die Jungen im Mittelwesten jemals auf die Idee kamen, daß es sich bei einer so groben Fälschung überhaupt um das Original handeln könnte, ist ein völliges Rätsel und wird es wohl auch für immer bleiben. Tom schaffte es, damit an seinem Schrank herumzuritzen und wollte sich gerade die Schreibtischplatte in Angriff nehmen, als er aufgefordert wurde, sich für die Sonntagsschule feinzumachen.