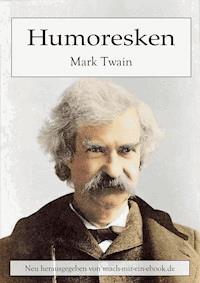1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
In "Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn" präsentiert Mark Twain ein Meisterwerk der amerikanischen Literatur, das die Lebensrealitäten des 19. Jahrhunderts in den südlichen Bundesstaaten der USA meisterhaft einfängt. In einem facettenreichen literarischen Stil, der sich durch einen lebhaften Dialog und ergreifende Beschreibungen auszeichnet, begleitet der Leser die beiden Protagonisten auf ihren spannenden und oft turbulenten Abenteuern entlang des Mississippi. Die Erzählung reflektiert nicht nur die Unschuld und den Spieltrieb der Kindheit, sondern verwebt auch tiefere gesellschaftliche Themen wie Rassismus und Moral, die in der Zeit der Entstehung prevalent waren. Twain gelingt es, durch seinen scharfsinnigen Humor und seine scharfen Beobachtungen, die Leser sowohl zum Lachen als auch zum Nachdenken zu bringen. Mark Twain, einer der bekanntesten amerikanischen Autoren, wurde 1835 geboren und wuchs in Missouri auf, wo er die Zutaten für seine späteren Werke sammelte. Seine eigene Kindheit und die Erlebnisse in einer sich wandelnden Gesellschaft flossen stark in die Charaktere und Geschichten ein. Twains Fähigkeit, lebendige Szenen aus dem Alltag der Menschen seiner Zeit darzustellen, zeugt von seinem tiefen Verständnis für die amerikanische Kultur und gesellschaftliche Dynamiken. Angereichert durch persönliche Erfahrungen und die Beobachtung seiner Umwelt, wurde er zu einer zentralen Figur in der Literatur des Realismus. Dieses Buch ist nicht nur eine Hommage an die unbeschwerte Kindheit, sondern auch eine kritische Betrachtung der menschlichen Natur und der gesellschaftlichen Normen. Leser, die sich für zeitlose Themen und brillante Charaktere interessieren, werden von Twains kunstvollem Erzählen gefesselt sein. Die illustrierte Ausgabe lädt zudem dazu ein, die bildliche Darstellung der Abenteuer noch intensiver zu erleben, wodurch das zeitlose Werk in neuem Licht erstrahlt. Ein unverzichtbares Leseerlebnis für Literaturfreunde und Geschichtsliebhaber.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn (Illustrierte Ausgabe)
Inhaltsverzeichnis
Die Abenteuer Tom Sawyers
Vorwort des Autors.
Die meisten der hier erzählten Abenteuer haben sich tatsächlich zugetragen. Das eine oder das andere habe ich selbst erlebt, die anderen meine Schulkameraden. Huck Finn ist nach dem Leben gezeichnet, nicht weniger Tom Sawyer, doch entspricht dieser nicht einer bestimmten Persönlichkeit, sondern wurde mit charakteristischen Zügen mehrerer meiner Altersgenossen ausgestattet und darf daher jenem gegenüber als einigermaßen kompliziertes psychologisches Problem gelten.
Ich muß hier bemerken, daß zur Zeit meiner Erzählung — vor dreißig bis vierzig Jahren — unter den Unmündigen und Unwissenden des Westens noch die seltsamsten, unwahrscheinlichsten Vorurteile und Aberglauben herrschten.
Obwohl dies Buch vor allem zur Unterhaltung der kleinen Welt geschrieben wurde, so darf ich doch wohl hoffen, daß es auch von Erwachsenen nicht ganz unbeachtet gelassen werde, habe ich doch darin versucht, ihnen auf angenehme Weise zu zeigen, was sie einst selbst waren, wie sie fühlten, dachten, sprachen, und welcher Art ihr Ehrgeiz und ihre Unternehmungen waren.
Erstes Kapitel.
Tom!“
Keine Antwort.
„Tom!“
Alles still.
„Soll mich doch wundern, wo der Bengel wieder steckt! Tom!“
Die alte Dame schob ihre Brille hinunter und schaute darüber hinweg; dann schob sie sie auf die Stirn und schaute darunter weg. Selten oder nie schaute sie nach einem so kleinen Ding, wie ein Knabe ist, durch die Gläser dieser ihrer Staatsbrille, die der Stolz ihres Herzens war und mehr stilvoll als brauchbar; sie würde durch ein paar Herdringe ebensoviel gesehen haben. Unruhig hielt sie einen Augenblick Umschau und sagte, nicht gerade erzürnt, aber doch immer laut genug, um im ganzen Zimmer gehört zu werden: „Ich werde strenges Gericht halten müssen, wenn ich dich erwische, ich werde —“
Hier brach sie ab, denn sie hatte sich inzwischen niedergebeugt und stocherte mit dem Besen unter dem Bett herum, und dann mußte sie wieder Atem holen, um ihrem Ärger Ausdruck zu verleihen. Sie hatte nichts als die Katze aufgestöbert.
„So ein Junge ist mir noch gar nicht vorgekommen!“
Sie ging zur offenen Tür, blieb stehen und spähte zwischen den Weinranken und dem blühenden Unkraut, welche zusammen den „Garten“ ausmachten, hindurch. Kein Tom. So erhob sie denn ihre Stimme und rief in alle Ecken hinein: „Tom, Tom!“ Hinter ihr wurde ein schwaches Geräusch hörbar und sie wandte sich noch eben rechtzeitig um, um einen kleinen Burschen zu erwischen und an der Flucht zu hindern. „Also, da steckst du? An die Speisekammer habe ich freilich nicht gedacht! Was hast du denn da wieder gemacht, he?“
„Nichts.“
„Nichts! Schau deine Hände an und deinen Mund. Was ist das?“
„Bei Gott, ich weiß es nicht, Tante!“
„Aber ich weiß es, ‘s ist Marmelade. Wie oft habe ich dir gesagt, wenn du über die Marmelade gingest, würde ich dich bläuen. Gib mir den Stock her!“
Der Stock zitterte in ihren Händen. Die Gefahr war dringend.
„Holla, Tante, sieh dich mal schnell um!“
Die alte Dame fuhr herum und brachte ihre Röcke in Sicherheit, während der Bursche, den Augenblick wahrnehmend, auf den hohen Bretterzaun kletterte und jenseits verschwand.
Tante Polly stand sprachlos, dann begann sie gutmütig zu lächeln. „Der Kuckuck hole den Jungen! Werde ich denn das niemals lernen? Hat er mir denn nicht schon Streiche genug gespielt, daß ich immer wieder auf den Leim krieche? Aber alte Torheit ist die größte Torheit, und ein alter Hund lernt keine neuen Kunststücke mehr. Aber, du lieber Gott, er macht jeden Tag neue, und wie kann jemand bei ihm wissen, was kommt! Es scheint, er weiß ganz genau, wie lange er mich quälen kann, bis ich dahinter komme, und ist gar zu gerissen, wenn es gilt, etwas ausfindig zu machen, um mich für einen Augenblick zu verblüffen oder mich wider Willen lachen zu machen, es ist immer dieselbe Geschichte, und ich bringe es nicht fertig, ihn zu prügeln. Ich tue meine Pflicht nicht an dem Knaben, wie ich sollte, Gott weiß es. ‚Spare die Rute, und du verdirbst dein Kind‘, heißt es. Ich begehe vielleicht unrecht und kann es vor mir und ihm nicht verantworten, fürcht‘ ich. Er steckt voller Narrenspossen und allerhand Unsinn — aber einerlei! Er ist meiner toten Schwester Kind, ein armes Kind, und ich habe nicht das Herz, ihn irgendwie am Gängelband zu führen. Wenn ich ihn sich selbst überlasse, drückt mich mein Gewissen, und so oft ich ihn schlagen muß, möchte mit das alte Herz brechen. Nun, mag‘s drum sein, der weibgeborene Mensch bleibt halt sein ganzes Leben durch in Zweifel und Irrtum, wie die heilige Schrift sagt, und ich denke, es ist so. Er wird wieder den ganzen Abend Blindekuh spielen, und ich sollte ihn von Rechts wegen, um ihn zu strafen, morgen arbeiten lassen. Es ist wohl hart für ihn, am Samstag stillzusitzen, wenn alle anderen Knaben Feiertag haben, aber er haßt Arbeit mehr als irgend sonst was, und ich will meine Pflicht an ihm tun, oder ich würde das Kind zu Grunde richten.“
Tom spielte Blindekuh und fühlte sich sehr wohl dabei. Zur rechten Zeit kehrte er ganz frech nach Hause zurück, um Jim, dem kleinen, farbigen Bengel, zu helfen, noch vor Tisch das Holz für den nächsten Tag zu sägen und zu spalten — und schließlich hatte er Jim die Abenteuer des Tages erzählt, während Jim drei Viertel der Arbeit getan hatte. Toms jüngerer Bruder (oder vielmehr Halbbruder) Sid war bereits fertig mit seinem Anteil an der Arbeit, dem Zusammenlesen des Holzes, denn er war ein phlegmatischer Junge und hatte keinerlei Abenteuer und kühne Unternehmungen.
Während Tom nun seine Suppe aß und nach Möglichkeit Zuckerstückchen stahl, stellte Tante Polly allerhand Fragen an ihn, arglistige und verfängliche Fragen, denn sie brannte darauf, ihn in eine Falle zu locken. Wie so viele gutherzige Geschöpfe, bildete sie sich auf ihr Talent in der höheren Diplomatie nicht wenig ein und betrachtete ihre sehr durchsichtigen Anschläge als wahre Wunder inquisitorischer Verschlagenheit.
„Tom,“ sagte sie, „es war wohl ziemlich heiß in der Schule?“
„M — ja“
„Sehr heiß, he?“
„M — ja.“
„Hattest du nicht Lust, zum Schwimmen zu gehen?“
Tom stutzte — ein ungemütlicher Verdacht stieg in ihm auf. Er schaute forschend in Tante Pollys Gesicht, aber es war nichts darin zu lesen. So sagte er: „Nein — das heißt — nicht so sehr.“
Die alte Dame streckte ihre Hand nach ihm aus, befühlte seinen Kragen und sagte: „Jetzt, scheint mir, kann dir jedenfalls nicht mehr zu warm sein, nicht?“ Auf diese Art, dachte sie, habe sie sich von der vollkommenen Trockenheit seines Kragens überzeugt, ohne ihre wahre Absicht von fern merken zu lassen. Aber Tom hatte trotzdem begriffen, woher der Wind wehte. So beeilte er sich wohlweislich, allen etwaigen Fragen zuvorzukommen.
„Einige von uns haben sich den Kopf unter die Pumpe gehalten — meiner ist noch feucht — fühl nur.“ Tante Polly ärgerte sich, eine so wichtige Indizie übersehen zu haben; so hatte sie von vornherein ihre Waffen aus der Hand gegeben. Dann kam ihr aber ein neuer Gedanke.
„Tom, du hast doch wohl nicht den Kragen, den ich dir an die Jacke genäht hatte, beim Unter-die-Pumpe-halten des Kopfes abgenommen? Mach doch mal die Jacke auf!“
Toms Mienen hellten sich auf. Er öffnete seine Jacke. Sein Kragen saß ganz fest.
„Wirklich. Na ‘s ist gut, du kannst gehen. Ich hätte darauf geschworen, daß du im Wasser gewesen seiest. Nun, dir geht es diesmal wie der gebrannten Katze, ich habe dich zu Unrecht in Verdacht gehabt — diesmal, Tom.“
Sie war halb verdrießlich, so aus dem Felde geschlagen zu sein, und doch freute sie sich, daß Tom doch wirklich mal gehorsam gewesen war. Plötzlich sagte Sidney: „Ich hab‘ aber doch gesehen, daß du seinen Kragen mit weißem Zwirn genäht hast — und jetzt ist er auf einmal schwarz!“
„Freilich hab‘ ich weißen genommen — Tom!“
Aber Tom hatte sich schon aus dem Staube gemacht. „Na, warte, Sidney, das sollst du mir büßen,“ damit war er aus der Tür.
An einem sicheren Plätzchen beschaute Tom dann zwei lange Nadeln, welche unter dem Kragen seines Rockes steckten, die eine mit schwarzem, die andere mit weißem Zwirn.
„Sie allein hätte es nie gemerkt,“ dachte er, „ohne diesen Sid. Einmal schwarzen, das andere Mal weißen — zum Teufel, ich wollte, sie entschiede sich für einen, damit ich wüßte, woran ich wäre. Und Sid — na, seine Prügel sind ihm sicher; wenn ich‘s nicht tue, soll man mir die Ohren abschneiden.“
Tom war kein Musterknabe, aber er kannte einen und haßte ihn von Herzen.
Ein Augenblick — und Tom hatte alle seine Kümmernisse vergessen. Nicht, daß sie auf einmal geringer geworden wären oder weniger auf dem Herzen des kleinen Mannes gelastet hätten, — aber Tom hatte eine neue, wundervolle Beschäftigung, und die richtete ihn auf und half ihm über alles hinweg — für den Augenblick; wie eben ein Mann alles Mißgeschick beim Gedanken an neue Taten verschmerzt. Diese neue Beschäftigung war eine ganz neue Art, zu pfeifen, die ihm irgend ein Negerbengel vor kurzem beigebracht hatte, und die jetzt ungestört geübt werden mußte. Die wichtige Erfindung beruhte auf einem vogelartigen, schmetternden Triller, mit gleichzeitigem, durch Zungenschlag hervorgebrachten Geschwindmarsch von Tönen. Der Leser weiß, wie man diese delikate Musik ausübt — oder er ist niemals jung gewesen. Tom hatte mit Fleiß und Aufmerksamkeit bald den Trick heraus und schlenderte, den Mund voll Harmonie und Stolz im Herzen, die Dorfstraße hinunter. Er fühlte sich wie ein Sterngucker, der ein neues Gestirn entdeckt hat. Nur daß keines Sternguckers Freude und Genugtuung so tief und ungetrübt hatte sein können wie die Toms.
Der Sommerabend war lang und noch hell. Plötzlich hörte Tom auf zu pfeifen. Ein Fremder stand vor ihm, ein Bursche, kaum größer als er selbst. Eine neue Bekanntschaft, einerlei, welchen Alters und Geschlechts, war in dem armseligen, kleinen St. Petersburg schon ein Ereignis. Dieser Bursche war gut gekleidet — zu gut für einen Werktag. Sonderbar. Seine Mütze war zierlich, seine enganliegende blaue Jacke neu und sauber, ebenso seine Hose. Er hatte Schuhe an, und es war erst Freitag! Er hatte sogar ein Halstuch um, ein wahres Monstrum von einem Tuch. Überhaupt hatte er etwas an sich, was den Naturmenschen in Tom herausforderte. Je mehr Tom das neue Weltwunder anstarrte, um so mehr rümpfte er die Nase über solche Geziertheit, und sein eigenes Äußere erschien ihm immer schäbiger. Beide schwiegen. Wollte einer ausweichen, so wollte auch der andere ausweichen, natürlich nach derselben Seite. So schauten sie lange einander herausfordernd in die Augen. Endlich sagte Tom: „Soll ich dich prügeln?“
„Das möchte ich doch erst einmal sehen!“
„Das wirst du allerdings sehen!“
„Du kannst es ja gar nicht!“
„Wohl kann ich‘s!“
„Pah!“
„Wohl kann ich‘s!“
„Nicht wahr!“
„Doch wahr!“
Eine ungemütliche Pause. Darauf wieder Tom: „Wie heißt du denn?“
„Das geht dich nichts an, Straßenjunge!“
„Ich will dir schon zeigen, daß mich‘s was angeht!“
„Na, warum tust du‘s denn nicht?“
„Wenn du noch viel sagst, tu ich‘s!“
„Viel — viel — viel, — so, nun tu‘s!“
„Ach, du hältst dich wohl für mehr als mich? Wenn ich nur wollte, könnte ich dich mit einer Hand unterkriegen!“
„Na, warum tust du‘s denn nicht? Du sagst nur immer, daß du‘s kannst!“
„Wenn du frech wirst, tu ich‘s!“
„Pah — das kann jeder sagen!“
„Du bist wohl was Rechts, du Windhund!“
„Was du für einen dummen Hut aufhast!“
„Wenn er dir nicht gefällt, kannst du ihn ja herunterschlagen! Schlag ihn doch runter, wenn du ein paar Ohrfeigen haben willst!“
„Lügner!“
„Selbst Lügner!“
„Prahlhans, du bist ja zu feig!“
„Ach, mach, daß du weiter kommst!“
„Du, wenn du noch lange Blödsinn schwatzt, schmeiß ich dir ‘nen Stein an den Kopf!“
„Na, so wag‘s doch!“
„Ich tu‘s auch!“
„Warum tust du‘s denn nicht? Du sagst es ja immer nur. Tu‘s doch mal! Du bist ja zu bange!“
„Ich bin nicht bange!“
„Natürlich bist du bange!“
„Nicht wahr!“
„Doch wahr!“
Wieder eine Pause. Beide starren sich an, gehen umeinander herum und beschnüffeln sich wie junge Hunde. Plötzlich liegen sie in schönster Kampfstellung Schulter an Schulter. Tom schrie: „Scher dich fort!“
„Fällt mir gar nicht ein!“
„Fällt mir auch nicht ein!“
So standen sie, jeder einen Fuß als Stütze zurückgestellt, aus aller Kraft aneinander herumschiebend und sich wütend anstarrend. Aber keiner konnte dem Gegner einen Vorteil abgewinnen. Von diesem stillen Kampf heiß und atemlos, hielten beide gleichzeitig inne, und Tom sagte: „Du bist doch ein Feigling und ein Aff obendrein! Ich werd‘s meinem großen Bruder sagen, der kann dich mit dem kleinen Finger verhauen, und ich werd‘s ihm sagen, daß er‘s tut!“
„Was schert mich dein Bruder! Ich hab‘ einen Bruder, der noch viel stärker ist als deiner. Der wirft deinen Bruder über den Zaun da!“
Beide Brüder waren natürlich durchaus imaginär.
„Das lügst du!“
„Das weißt du!“
Tom zog mit dem Fuß einen Strich durch den Sand und sagte: „Komm herüber und ich hau dich, daß du liegen bleibst!“
Sofort sprang der andere hinüber und sagte herausfordernd: „So, nun tu‘s!“
„Mach mich nicht wütend, rat ich dir!“
„Beim Deuker, für zwei Penny würd‘ ich‘s wirklich tun!“
Im nächsten Augenblick hatte der feine Junge ein Zweipennystück aus der Tasche geholt und hielt es Tom herausfordernd vor die Nase. Tom schlug es ihm aus der Hand. Im nächsten Augenblick rollten beide Jungen im Schmutz, ineinander verbissen wie zwei Katzen, und während ein paar Minuten rissen und zerrten sie sich an den Haaren und Kleidern, schlugen und zerkratzten sich die Nasen und bedeckten sich mit Staub und Ruhm. Plötzlich klärte sich die Situation, und aus dem Kampfgewühl tauchte Tom empor, auf dem andern reitend und ihn mit den Fäusten traktierend.
„Sag: Genug!“
Der Bengel setzte seine krampfhaften Bemühungen, sich zu befreien, fort, vor Wut schreiend.
„Sag: Genug!“ Und Tom prügelte lustig weiter.
Schließlich stieß der andere ein halb ersticktes „Genug“ hervor. Tom ließ ihn aufstehen und sagte: „So, nun weißt du‘s! Das nächste Mal sieh dich besser vor, mit wem du anbindest!“
Der Fremde trollte sich, sich den Staub von den Kleidern schlagend, schluchzend, sich die Nase reibend, von Zeit zu Zeit sich umsehend, um Tom zu drohen, daß er ihn das nächste Mal verhauen werde, worauf Tom höhnisch lachte und seelenvergnügt nach Hause schlenderte. Und sobald er den Rücken gewandt hatte, hob der andere einen Stein auf, zielte, traf Tom zwischen die Schultern und rannte davon mit der Geschwindigkeit einer Antilope. Tom verfolgte den Verräter bis zu dessen Wohnung und fand so heraus, wo er wohne. Als tapferer Held blieb er dann herausfordernd eine Zeitlang an einem Zaun stehen, um zu warten, ob der Feind es wagen werde, wieder herauszukommen; aber der Feind begnügte sich, ihm durch die Fenster Gesichter zu schneiden und hütete sich, den neutralen Boden zu verlassen. Schließlich erschien des Feindes Mutter und nannte Tom ein schlechtes, lasterhaftes, gemeines Kind und jagte ihn davon. So ging Tom also fort, aber er sagte, „er hoffe, den Feind doch noch einmal zu erwischen.“
Er kam ein bißchen spät nach Haus, und indem er behutsam in das Fenster kletterte, entdeckte er einen Hinterhalt in Gestalt seiner Tante; und als sie den Zustand seiner Kleider sah, war ihr Entschluß unumstößlich gefaßt, ihn am Samstag in strenge Haft zu nehmen und ordentlich schwitzen zu lassen.
Zweites Kapitel.
Samstag morgen war gekommen, und es war ein heller, frischer Sommermorgen und sprühend von Leben. Jedes Herz war voll Gesang, und wessen Herz jung war, der hatte ein Lied auf den Lippen. Freude glänzte auf allen Gesichtern, und die Lust, zu springen, zuckte in aller Füßen. Die Akazien blühten, und ihr süßer Duft erfüllte die Luft.
Cardiff Hill, in der Nähe des Hauses und dasselbe überragend, war von Grün bedeckt und war gerade entfernt genug, um wie das gelobte Land, träumerisch, ruhevoll und unberührt zu erscheinen.
Tom erschien auf der Bildfläche mit einem Eimer voll Farbe und einem großen Pinsel. Er überblickte die Umzäunung — und aller Glanz schwand aus der Natur, und tiefe Schwermut bemächtigte sich seines Geistes. Dreißig Yards lang und neun Fuß hoch war der unglückliche Zaun! Das Leben erschien ihm traurig. Er empfand sein kleines Dasein als Last. Seufzend tauchte er den Pinsel in den Topf und strich einmal über die oberste Planke, wiederholte die Operation, und nochmals, und verglich das kleine gestrichene Stückchen mit der unendlichen noch zu erledigenden Strecke — und hockte sich entmutigt auf einen Baumstumpf. Jim kam mit einem Zinneimer aus der Tür, „Buffalo Gals“ singend. Wasser von der Pumpe zu holen, war Tom bisher immer als eine der unwürdigsten Verrichtungen erschienen, jetzt schien es ihm anders. Er sagte sich, daß er dort Gesellschaft finden werde; Weiße, Mulatten und Neger, Knaben und Mädchen traf man immer dort, die, bis an sie die Reihe, zu pumpen kam, herumlungerten, irgend ein Spiel trieben, sich zankten, prügelten und Wetten anstellten. Und dann überlegte er, daß die Pumpe zwar nur einhundertundfünfzig Yards entfernt sei, Jim trotzdem aber nie unter einer Stunde brauchte, um einen Eimer Wasser zu holen, und dann auch noch gewöhnlich geholt werden mußte. Er sagte also: „Du, Jim, ich will Wasser holen, wenn du inzwischen anstreichen willst.“
Jim schüttelte den Kopf und antwortete: „Es geht nicht, Master Tom. Alte Dame sagen mir zu gehen und holen Wasser und nix aufhalten mit irgendwem. Sie sagen, sie wissen, daß Master Tom werden versuchen zu gewinnen mich zu streichen, und so sie sagen, Jim zu gehen nach sein eigenes Geschäft und nix zu streichen.“
„Ach was, Jim, laß sie nur reden! So macht sie‘s immer. Gib mir nur den Eimer — du sollst sehen, ich bin gleich wieder da! Sie braucht‘s ja nicht zu wissen.“
„Nein, Master Tom, ich nix tun! Alte Dame wollen ihm Kopf abreißen, wenn er tut so. Sicher, Master Tom!“
„Sie? Sie kann ja gar nicht schlagen — sie fährt einem mit dem Fingerhut über den Kopf, und wer macht sich daraus was? Ihre Worte sind gefährlich, hm, — ja, aber sagen, ist doch nicht tun, wenn sie nur nicht so viel dabei weinen wollte. — Du, Jim, ich geb dir auch ‘ne Murmel! Oder ‘ne Glaskugel!“
Jim begann zu schwanken.
„Eine weiße Glaskugel, Jim — und horch mal, was für ‘nen schönen Klang hat sie!“
„Ach, sein das schöne, wunderschöne Glaskugel! Aber Master Tom, ich haben so furchtbar Angst vor alte Dame!“
Aber Jim war auch nur ein Mensch — diese Verführungskünste waren zu stark für ihn. Er setzte seinen Eimer hin und griff nach der Kugel. Im nächsten Augenblick sauste er die Straße hinunter mit seinem Eimer und einem Schreckensschrei, — Tom arbeitete mit Vehemenz, und Tante Polly, einen Pantoffel in der Hand und Triumph im Auge, kehrte vom Felde zurück.
Aber Toms Energie hielt nicht lange an. Er begann, an all die Streiche zu denken, die er für heute geplant hatte, und sein Kummer wurde immer größer. Bald würden seine Spielgefährten, frei und sorglos, vorbeikommen, um auf alle möglichen Expeditionen auszugehen und die würden ihre Witze reißen über ihn, der dastand und arbeiten mußte — der bloße Gedanke daran brannte wie Feuer. Er kramte seine weltlichen Schätze aus und hielt Heerschau: allerhand selbsterfundenes Spielzeug, Murmel und Plunder — genug, um sich einen Arbeitstausch zu erkaufen, aber nicht genug, um dadurch auch nur für eine halbe Stunde die Freiheit zu bekommen. So steckte er seine armselige Habe wieder in die Tasche und gab den Gedanken auf, einen Bestechungsversuch bei den Jungen zu machen. Mitten in diese trüben und hoffnungslosen Betrachtungen kam plötzlich ein Einfall über ihn. Durchaus kein großer, glänzender Einfall. Er nahm seinen Pinsel wieder auf und setzte ruhig die Arbeit fort. Ben Rogers erschien in Sicht, der Junge aller Jungen, der sich über alle lustig machen durfte. Bens Gang war springend, tanzend, hüpfend — Beweis genug, daß sein Herz leicht und seine Gedanken und Pläne großartig waren. Er knupperte an einem Apfel und ließ ein langes, melodiöses ho! ho! hören, gefolgt von einem gegrunzten: ding, dong, ding! ding, dong, dong! — denn er war in diesem Augenblick ein Dampfboot. Als er näher kam, mäßigte er seine Geschwindigkeit, nahm die Mitte der Straße, bog nach Steuerbord über und legte elegant und mit vielem Geschrei und Umstand bei, denn er vertrat hier die Stelle des „Big Missouri“ und hatte neun Fuß Tiefgang. Er war Dampfboot, Kapitän, Bemannung zugleich und sah sich selbst auf der Kommandobrücke stehend, Befehle gebend und ihre Ausführung überwachend.
„Stopp!! Ling — a, ling, ling!!“ Die Hauptroute war zu Ende, und er wandte sich langsam einem Nebenarme des Flusses zu. „Stopp! Zurück!! Ling — a, ling, ling!“ Seine Arme sanken ermüdet herunter. „Steuerbord wenden! Ling — a, ling, ling! Tschschschuh! Tschuh! Tschuuuhhh!!!“ Sein Arm beschrieb jetzt große Kreise, denn er stellte ein Rad von 40 Fuß Durchmesser dar. „Backbord zurück! Ling — a, ling, ling! Tschschuh! Tschuh! Tschuuuhhh!!“ Wieder beschrieb der Arm — diesmal der linke — gewaltige Kreise. „Steuerbord stopp!! Ling — a, ling, ling! Backbord stopp! Halt! Langsam überholen! Ling — a, ling, ling! Tschschuh! Tschuh! Tschuuuhhh!! Heraus mit dem Tau dort! Lustig, hoho! Heraus damit! He — wird‘s bald?! Ein Tau dort um den Pfeiler — so, nun los, Jungens — los!! Maschine stopp!! Ling — a, ling, ling!!“
„Tschschuh! Schscht! Schscht!!“ (Läßt den Dampf ausströmen.)
Tom war ganz vertieft in seine Anstreicherei, er merkte nichts von der Ankunft des Dampfbootes! Ben blieb einen Moment stehen, dann sagte er: „Ho, ho, Strafarbeit, Tom, he?“
Keine Antwort. Tom überschaute seine Arbeit mit dem Auge eines Künstlers. Dann machte er mit dem Pinsel noch einen eleganten Strich und übte wieder Kritik. Ben rannte zu ihm hin, Tom wässerte der Mund nach dem Apfel, aber er stellte sich ganz vertieft in seine Arbeit. Ben sagte: „Hallo, alter Bursche, Strafarbeit, was?“
„Ach, bist du‘s, Ben. Ich hatte dich nicht bemerkt.“
„Weißt, ich geh‘ grad zum Schwimmen. Würdest du gern mitgehen können? Aber, natürlich, bleibst du lieber bei deiner Arbeit, nicht?“
Tom schaute den Burschen erstaunt an und sagte: „Was nennst du Arbeit?“
„Na, ist das denn keine Arbeit?“
Tom betrachtete seine Malerei und sagte nachlässig: „Na, vielleicht ist das Arbeit, oder es ist keine Arbeit, jedenfalls macht es Tom Sawyer Spaß.“
„Na, na, du willst doch nicht wirklich sagen, daß dir das da Spaß macht!?“
Der Pinsel strich und strich.
„Spaß? Warum soll‘s denn kein Spaß sein? Kannst du vielleicht jeden Tag einen Zaun anstreichen?“
Ben erschien die Sache plötzlich in anderem Lichte. Er hörte auf, an seinem Apfel zu knuppern. Tom fuhr mit seinem Pinsel bedächtig hin und her, hin und her, hielt an, um sich von der Wirkung zu überzeugen, half hier und da ein bißchen nach, prüfte wieder, während Ben immer aufmerksamer wurde, immer interessierter. Plötzlich sagte er: „Du, Tom, laß mich ein bißchen streichen!“
Tom überlegte, war nahe daran, einzuwilligen, aber er besann sich: „Ne, ne. Ich würde es herzlich gern tun, Ben. Aber — Tante Polly gibt so viel gerade auf diesen Zaun, gerade an der Straße — weißt du. Aber wenn es der schwarze Zaun wäre, wär‘s mir recht und ihr wär‘s auch recht. Ja, sie gibt schrecklich viel auf diesen Zaun, deshalb muß ich das da sehr sorgfältig machen! Ich glaube von tausend, was — zweitausend Jungen ist vielleicht nicht einer, der‘s ihr recht machen kann, wie sie‘s haben will.“
„Na — wirklich? — Du — gib her, nur mal versuchen, nur ein klein — bißchen versuchen. Ich würde dich lassen, wenn‘s meine Arbeit wäre, Tom.“
„Ben, ich würd‘s wahr — haf — tig gern tun; aber Tante Polly — weißt du, Jim wollt‘s auch schon tun, aber sie ließ ihn nicht. Sid wollte es tun, aber sie ließ es ihn auch nicht tun! Na, siehst du wohl, daß es nicht geht? Wenn du den Zaun anstrichest und es passierte was, Ben —“
„O, Unsinn! Ich will‘s so vorsichtig machen! Nur mal versuchen! Wenn ich dir den Rest von meinem Apfel geb‘?“
„Na, dann — ne, Ben, tu‘s nicht, ich hab‘ solche Angst —!“
„Ich geb‘ dir den ganzen Apfel!“
Tom gab mit betrübter Miene den Pinsel ab — innerlich frohlockend. Und während der Dampfer „Big Missouri“ in der Sonnenhitze arbeitete und schwitzte, saß der Künstler, ausruhend, auf einem Baumstumpf im Schatten des Zaunes, schlug die Beine übereinander, verzehrte seinen Apfel und grübelte, wie er noch mehr Unschuldige zu seinem Ersatz anlocken könne. Opfer genug waren vorhanden. Jeden Augenblick schlenderten Knaben vorbei. Sie kamen, um ihn zu verhöhnen und blieben, um zu streichen. Nach einiger Zeit war Ben müde geworden, Tom hatte als Nächsten Billy Fisher ins Auge gefaßt, der ihm eine tote Ratte und eine Schnur, um die Ratte daran durch die Luft fliegen zu lassen, anbot; und von Johnny Miller bekam er eine gut erhaltene Sackpfeife, und so immer weiter — stundenlang. Und als der Nachmittag halb vergangen war, war aus dem armen, verlassenen Tom vom Morgen ein buchstäblich in Reichtum schwimmender Tom geworden. Er besaß außer den angeführten Sachen zwölf Murmel, ein Stück eines Brummeisens, ein Stück blau gefärbtes Glas zum Durchschauen, eine Spielkanone, ein Messer, das gewiß nie jemand Schaden getan hatte oder jemals tun konnte, ein bißchen Kreide, einen Glasstöpsel, einen Zinnsoldaten, den Kopf eines Frosches, sechs Feuerschwärmer, ein Kaninchen mit einem Auge, einen messingnen Türgriff, ein Hundehalsband (aber keinen Hund), den Griff eines Messers, vier Orangeschalen und einen kaputten Fensterrahmen. Er hatte einen sorglosen, bequemen, lustigen Tag gehabt, eine Menge Gesellschafter — und der Zaun hatte eine dreifache Lage Farbe bekommen! Wäre nicht der Zaun jetzt fertig gewesen — Tom hätte noch alle Jungens des Dorfes bankerott gemacht.
Tom dachte bei sich, die Welt wäre schließlich doch wohl nicht so buckelig. Er war, ohne es selbst recht zu wissen, hinter ein wichtiges Gesetz menschlicher Tätigkeit gekommen, das nämlich, daß, um jemand, groß oder klein, nach etwas lüstern zu machen, es nur nötig ist, dieses Etwas schwer erreichbar zu machen. Wäre er ein großer und weiser Philosoph gewesen, gleich dem Verfasser dieses Buches, er würde jetzt begriffen haben, daß, was jemand tun muß, Arbeit, was man freiwillig tut, dagegen Vergnügen heißt. Er würde ferner verstanden haben, daß künstliche Blumen machen oder in der Tretmühle ziehen, „Arbeit“ ist, Kegelschieben aber oder den Mont Blanc besteigen, „Vergnügen“.
Es gibt reiche Engländer, die einen Viererzug zwanzig bis dreißig Meilen in einem Tage laufen lassen, weil dieser Spaß sie einen Haufen Geld kostet; würden sie aber dafür bezahlt werden, so würden sie es als „Arbeit“ ansehen und darauf verzichten.
Drittes Kapitel.
Tom präsentierte sich Tante Polly, welche in einem gemütlichen, zugleich als Schlaf-, Frühstücks- und Speisezimmer dienenden Raum am offenen Fenster saß und fleißig mit Handarbeit beschäftigt gewesen war. Die balsamische Sommerluft, die vollkommene Ruhe, Blumenduft und Summen der Bienen, alles hatte seine Wirkung geübt — sie war über ihrer Beschäftigung eingenickt. Sie hatte nur die Katze zur Gesellschaft gehabt, und die schlief in ihrem Korbe. Die Brille hatte sie (Tante Polly) zur Vorsicht auf ihren grauen Kopf weiter hinaufgeschoben. Sie mochte geglaubt haben, Tom sei längst wieder flüchtig geworden und wunderte sich nun, ihn ungeniert neben sich sitzen zu sehen.
„Darf ich jetzt spielen gehen, Tante?“ fragte Tom unschuldig.
„Was, schon wieder? Was hast du denn heut getan?“
„Alles fertig, Tante!“
„Tom, lüg‘ nicht! Ich glaub‘s nicht!“
„Ich lüge aber nicht, Tante. Es ist alles fertig.“
Tante Polly setzte kein besonderes Vertrauen in seine Beteuerungen. Sie ging hinaus, um selbst zu sehen, und sie wäre zufrieden gewesen, hätte sie zwanzig Prozent von Toms Worten wahr gefunden; als sie sah, daß wirklich der ganze Zaun gestrichen und nicht nur leicht gestrichen, sondern gründlich und mehrfach mit Farbe bedeckt, und noch ein Stück Boden obendrein eine Farbschicht abbekommen hatte, war ihr Erstaunen unaussprechlich. Sie sagte: „Na, das hätt‘ ich nicht für möglich gehalten! Ich sehe, Tom, du kannst arbeiten, wenn du willst.“ Und dann dämpfte sie das Kompliment, indem sie hinzufügte: „Aber es ist mächtig selten, daß du willst — leider. ‘s ist gut, geh‘ jetzt und spiel. Schau aber, daß du in einer Woche spätestens wieder hier bist, oder ich hau‘ dich — —“
Sie war so überrascht durch den Glanz seiner Heldentat, daß sie ihn in die Speisekammer zog und einen auserwählten Apfel hervorsuchte und ihn ihm gab — mit dem salbungsvollen Hinweis darauf, wie getane Arbeit jeden Genuß erhöhe und veredele — wenn sie fleißig, ehrlich und ohne Kniffe und Betrügerei getan werde. Und während sie mit einer passenden Bibelstelle schloß, hatte er ein Stück Kuchen stibitzt. Dann hüpfte er davon und sah Sid gerade die Außentreppe hinaufklettern, die auf einen Hinterraum im zweiten Boden führte. Erdklumpen waren genug vorhanden, und im nächsten Moment sausten eine ganze Menge durch die Luft. Sie fielen wie ein Hagelwetter um Sid herum nieder. Und bevor Tante Polly ihre überraschten Lebensgeister sammeln konnte und zu Hilfe eilen, hatten sechs oder sieben Geschosse ihr Ziel erreicht, und Tom war über den Zaun und davon. Es war zwar eine Tür in demselben, aber wie man sich denken kann, hatte Tom es viel zu eilig, um da durchzugehen. Er fühlte sich erleichtert, nun er sich mit Sid wegen dessen Verrates auseinandergesetzt und ihm eine tüchtige Lektion gegeben hatte.
Tom umging einen Häuserblock und gelangte in eine schlammige Allee, die zu Tante Pollys Kuhstall führte. Tom machte sich schleunigst aus dem Gebiet, wo Gefangenschaft und Strafe drohten und strebte dem öffentlichen Spielplatz des Dorfes zu, wo sich zwei feindliche Truppen von Knaben Rendezvous geben sollten — nach vorhergegangener Verabredung. Tom war der Anführer der einen, sein Busenfreund Joe Harper kommandierte die andere. Diese beiden großen Generale ließen sich nicht herab, selbst zu kämpfen — das schickt sich für den großen Haufen — sondern saßen zusammen auf einem Hügel und leiteten die Operationen durch Befehle an die Unterführer. Toms Armee gewann einen großen Sieg — nach einer langen, hartnäckigen Schlacht. Dann wurden die Toten beerdigt, die Gefangenen ausgetauscht, die Bestimmungen für das nächste Zusammentreffen getroffen und der Tag dafür festgesetzt, worauf sich die Armeen in Kolonnen formierten und zurückmarschierten — Tom marschierte allein nach Haus.
Als er an dem Hause des Jeff Thatcher vorbeikam, sah er im Garten ein unbekanntes Mädchen, ein liebliches, kleines, blauäugiges Geschöpf mit hellem, in zwei Zöpfen gebundenem Haar, weißem Sommerkleid und gestickten Höschen. Der ruhmreiche Held fiel, ohne einen Schuß getan zu haben. Eine gewisse Amy Lawrence war mit einem Schlage aus seinem Herzen verstoßen und ließ nicht einmal eine Erinnerung darin zurück. Er hatte sie bis zum Wahnsinn zu lieben geglaubt; seine Liebe war ihm als Anbetung erschienen; und nun zeigte es sich, daß es nur eine schwache, unbeständige Neigung gewesen sei. Er hatte durch Monate um sie geseufzt, sie hatte seine Liebe vor kaum einer Woche erst mit ihrer Gegenliebe belohnt; er war vor kurzen sieben Tagen noch der glücklichste und stolzeste Bursche der Welt gewesen, und jetzt, in einem Augenblick war sie gleich irgend einer beliebigen Fremden, der man flüchtig begegnet ist, aus seinem Herzen verschwunden.
Er betrachtete diesen neuen Engel mit glänzenden Augen, bis er merkte, daß sie ihn entdeckt habe. Dann stellte er sich, als wisse er gar nichts von ihrer Anwesenheit, und begann dann, nach rechter Jungensmanier, sich zu spreizen, um ihre Bewunderung zu erregen. Diese Torheiten trieb er eine Weile, schielte dann hinüber und sah, daß das kleine Mädchen sich dem Hause zugewandt hatte. Tom kletterte auf den Zaun und balancierte oben herum, machte ein trübseliges Gesicht und hoffte, sie werde sich dadurch zu längerem Verweilen bewegen lassen. Sie blieb auch einen Augenblick stehen, dann ging sie weiter der Tür zu. Tom stieß einen tiefen Seufzer aus, als sie die Türschwelle betrat, aber seine Mienen hellten sich auf, leuchteten vor Vergnügen, denn sie hatte in dem Moment, ehe sie verschwand, ein Stiefmütterchcn über den Zaun geworfen.
Tom rannte herzu und blieb dicht vor der Blume stehen, beschattete seine Augen und schaute die Straße hinunter, als hätte er dort etwas von größtem Interesse entdeckt. Dann nahm er einen Strohhalm auf und begann ihn auf der Nase zu balancieren, indem er den Kopf zurückwarf. So sich rechts und links drehend, kam er der Blume immer näher. Schließlich ruhte sein bloßer Fuß darauf, seine Zehen nahmen sie auf, und er hüpfte mit seinem Schatz davon und verschwand um die nächste Ecke. Aber nur für eine Minute — bis er die Blume unter seiner Jacke versteckt hatte, auf seinem Herzen oder auch auf dem Bauche, denn er war in der Anatomie nicht sehr bewandert und durchaus nicht kritisch. Dann kehrte er zurück, lungerte auf seinem Zaun herum und ließ seine Augen nach ihr herumspazieren, bis die Nacht anbrach; aber die Kleine ließ sich nicht wieder sehen. Tom tröstete sich mit dem Gedanken, daß sie hinter irgend einem Fenster gestanden und von seinen Aufmerksamkeiten Notiz genommen habe. Endlich ging er nach Hause, den Kopf voll angenehmer Vorstellungen.
Während des ganzen Abendessens war er so geistesabwesend, daß sich seine Tante wunderte, was in ihn gefahren sein könne. Er bekam wegen seiner Beschießung Sids Schelte und schien sich weiter gar nichts daraus zu machen.
Er versuchte, seiner Tante vor der Nase Zucker zu stehlen und bekam was auf die Finger. Er sagte: „Tante, du schlägst Sid nie, wenn er so was macht!“
„Na, Sid treibt‘s auch nicht so arg wie du. Du würdest den ganzen Tag im Zucker sein, wenn ich nicht aufpaßte.“
Gleich darauf ging sie in die Küche, und Sid, auf seine Unverletzlichkeit pochend, griff nach der Zuckerdose, mit einer Selbstüberhebung gegen Tom, die diesem unerträglich dünkte. Aber Sids Finger glitten aus, und die Zuckerdose fiel auf den Boden und zerbrach. Tom war außer sich vor Vergnügen, so außer sich, daß er sogar seine Zunge im Zaume hielt und verstummte. Er nahm sich vor, kein Wort zu sagen, auch nicht, wenn seine Tante wieder hereinkomme — solange, bis sie frage, wer dieses Verbrechen begangen habe. Dann wollte er es sagen, und niemand auf der Welt würde so glücklich sein wie er, wenn dieser Musterknabe auch einmal was auf die Pfoten bekam. Er war so voll Erwartung, daß er sich kaum zurückhalten konnte, als die alte Dame dann kam und vor den Scherben stand und Zornesblitze über den Rand ihrer Brille schleuderte. Er sagte zu sich: Jetzt kommt‘s! Und im nächsten Augenblick zappelte er auf dem Fußboden! Eine drohende Hand schwebte über ihm, um ihn nochmals zu treffen; Tom brüllte: „Halt, halt, warum prügelst du mich? Sid hat sie zerbrochen!“
Tante Polly hielt erschrocken inne, und Tom sah sofort, daß sich das Mitleid bei ihr zu regen begann. Aber sie sagte nur: „Auf! Ich denke, bei dir schadet kein Schlag. Du hast manches auf dem Kerbholz, wofür du keine Prügel bekommen hast.“
Dann aber empfand sie doch Reue und hätte gerne etwas Liebevolles, Versöhnendes gesagt. Aber sie dachte, das könne als Zugeständnis ihres Unrechts gelten, und dadurch würde die Disziplin leiden. So schwieg sie und ging betrübten Herzens ihren Geschäften nach. Tom verkroch sich in einen Winkel und wühlte in seinen Leiden. Er wußte, daß seine Tante innerlich vor ihm auf den Knien lag, und er fühlte wilde Genugtuung bei diesem Gedanken. Er würde sich nichts merken lassen und „nicht dergleichen tun.“ Er wußte, daß liebevolle Blicke auf ihm ruhten, aber er spielte den Gleichgültigen. Er stellte sich vor, wie er krank oder tot daliege und seine Tante händeringend über ihm, um ein verzeihendes Wort bettelnd; aber er würde sich abwenden und sterben, ohne das Wort zu sagen. Was würde sie dann wohl empfinden? Dann wieder sah er sich, vom Fluß nach Hause getragen, tot, mit triefenden Haaren, steifen Gliedern und für immer erstarrtem Herzen. O, wie würde sie sich über ihn werfen, wie würden ihre Tränen fließen und wie würde sie zu Gott flehen, ihn ihr wiederzugeben, und sie würde ihn nie, nie wieder mißhandeln! Aber er würde kalt und blaß daliegen und sich nicht regen, ein kleiner Märtyrer, dessen Leiden für immer zu Ende sind. So schraubte er seine Gefühle durch eingebildetes Elend künstlich in die Höhe, daß er fast daran erstickt wäre — er war so leicht gerührt! Seine Augen schwammen in einem trüben Nebel, welcher zu Tränen wurde, sobald er blinzelte, und herabrann und von der Spitze seiner Nase troff. Und solche Wollust bereitete ihm sein Kummer, daß er sich nicht um die Welt von irgend jemand hätte trösten oder aufheitern lassen; er war viel zu zart für eine solche Berührung mit der Außenwelt. Und als seine Cousine Mary nach einem eine ganze Woche langen Besuch auf dem Lande lustig und guter Dinge hereinhüpfte, sprang er auf und schlich in Einsamkeit und Kälte zu einer Tür hinaus, während sie Gesang und Sonnenschein zur anderen hereinbrachte.
Er vermied die Orte, an denen sich seine Freunde herumzutreiben pflegten und suchte vielmehr trostlos-verlassene Gegenden, die mit seiner Stimmung mehr im Einklang wären.
Ein Holzfloß auf dem Flusse lud ihn ein; er setzte sich ans äußerste Ende und versenkte sich in die traurige Eintönigkeit um ihn her und wünschte nichts anderes, als tot und ertrunken zu sein — aber ohne vorher einen häßlichen Todeskampf durchmachen zu müssen. Danach zog er seine Blume hervor. Sie war zerknittert und verwelkt und erhöhte noch das süße Gefühl der Selbstbemitleidung.
Ob sie Mitleid mit ihm haben würde, wenn sie wüßte? Würde sie weinen und sich danach sehnen, die Arme um ihn zu schlingen und ihn wieder zu erwärmen? Oder würde sie sich gleich der übrigen Welt kalt abwenden? Dieses Bild schien ihm so rührend, daß er es sich immer und immer wieder ausmalte und ausschmückte, bis er es greifbar vor sich sah. Schließlich stand er seufzend auf und schlich in die Finsternis hinaus.
Um halb zehn oder zehn Uhr gelangte er in die Straße, in welcher die angebetete Unbekannte wohnte. Er blieb einen Augenblick stehen; kein Ton traf sein lauschendes Ohr; aus einem Fenster des zweiten Stockes fiel ein schwacher Lichtschimmer. War dieser Raum durch ihre Anwesenheit geheiligt? Er erkletterte den Zaun und bahnte sich seinen eigenen Weg durch das Buschwerk, bis er unter dem Fenster stand. Lange und aufmerksam spähte er hinauf. Dann legte er sich auf die Erde nieder, die Hände über der Brust gefaltet und in den Händen seine arme, verwelkte Blume. Und so wollte er sterben — draußen, in der kalten Welt, kein Dach über sich, ohne eine freundliche Hand, die ihm den Todesschweiß von der Stirn wischen würde, ohne ein mitleidiges Gesicht, das sich, wenn der Todeskampf kam, über ihn beugen würde — und würde sie wohl eine Träne weinen über seinen armen toten Leib, würde es ihr weh tun, ein blühendes, junges Leben so grausam geknickt, so nutzlos vernichtet zu sehen?
Das Fenster ging auf; eines Dienstmädchens mißtönende Stimme entweihte die stille Ruhe und ein Strom Wasser überschüttete die Überreste des Märtyrers.
Halb erstickt sprang unser Held auf, prustend und sich schüttelnd. Ein Wurfgeschoß durchsauste die Luft, ein unterdrückter Fluch, das Klirren einer zerbrochenen Fensterscheibe — und eine kleine unbestimmte Gestalt kroch über den Zaun und verschwand in der Dunkelheit.
Nicht lange danach, als Tom bereits zum Schlafengehen entkleidet, seine durchnäßten Sachen beim Scheine eines Talglichtes besichtigte, erwachte Sid. Er wollte seine Glossen dazu machen, hielt es aber doch für besser, zu schweigen, denn aus Toms Augen schossen Blitze. Tom kroch ins Bett, ohne sich lange mit Beten aufzuhalten, und Sid merkte sich das gehörig, um gelegentlich Gebrauch davon zu machen.
Viertes Kapitel.
Die Sonne ging über einer ruhigen Welt auf und schien über das Dorf wie ein Segensspruch. Nach dem Frühstück hielt Tante Polly Hausandacht. Sie begann mit einem aus den kräftigsten Bibelstellen bestehenden, mit ein bißchen eigenen Gedanken verbrämten Gebet. Und von dieser Höhe aus gab sie ein grimmiges Kapitel des mosaischen Gesetzes zum besten — wie vom Sinai herab. Danach gürtete Tom, um diesen Ausdruck zu gebrauchen, seine Lenden und machte sich ans Werk, sich seine Bibelverse einzutrichtern. Sid hatte die natürlich schon am Tage vorher gelernt. Tom brachte es mit Aufbietung aller Energie auf fünf Verse — die er aus der Bergpredigt gewählt hatte, da er keine kürzeren finden konnte.
Nach einer halben Stunde hatte Tom eine unbestimmte, allgemeine Idee von seiner Lektion. Weiter kam er nicht, denn seine Gedanken spazierten durch das ganze Gebiet menschlichen Denkens, und seine Finger hatten allerhand zerstreuende Nebenbeschäftigungen. Schließlich nahm Mary sein Buch, um ihn zu überhören, und er machte krampfhafte Anstrengungen, um seinen Weg durch den Nebel zu finden.
„Selig sind die — ä — ä — ä —“
„Die da arm sind —“
„Ja — arm sind; selig sind, die da arm sind — ä — ä — ä —“
„Im Geiste —“
„Im Geiste; selig sind, die da arm sind im Geiste, denn sie — sie —“
„Ihrer —“
„Denn ihrer; selig sind, die da arm sind im Geiste, denn ihrer — ist das Himmelsreich!“
„Selig sind, die da Leid tragen, denn sie — sie — ä — ä —“
„So — —“
„Denn sie s — o —“
„S — o — l — l —?“
„Denn sie soll —. Ach was, ich weiß nichts weiter!“
„Sollen —“
„Ach so: sollen! Denn sie sollen — denn sie sollen — ä —ä — sollen Leid tragen —, denn sie sollen — ä — sollen — was? Warum sagst du mir‘s nicht. Mary! Sei doch nicht so eklig!“
„Ach, Tom, du armer, dickköpfiger Kerl, ich quäl‘ dich ja nicht. Das fällt mir gar nicht ein. Du mußt dich halt nochmal dahinter setzen. Nur nicht mutlos. Tom, du wirst es schon zwingen — und wenn du‘s kannst, Tom, geb ich dir ganz, ganz was Schönes! Na also, sei ein braver Junge!“
„Meinetwegen. — Du, Mary, was ist es denn?“ „Jetzt noch nicht, Tom. Wenn ich sage, ‘s ist was Schönes, dann ist‘s was Schönes!“
„Da hast du recht, Mary. Na also, ich werd‘s noch mal tun!“
Und er machte sich nochmal darüber. Und unter dem doppelten Ansporn der Neugier und der Erwartung des Gewinnes machte er sich mit solcher Vehemenz darüber, daß er einen schönen Erfolg hatte.
Mary gab ihm ein nagelneues Taschenmesser, zwölf und einen halben Pence mindestens im Wert; ein Schauer des Entzückens fuhr ihm durch die Glieder. Es ist wahr, zum Schneiden war das Messer nicht gerade zu brauchen, aber es war ein echtes „Barlow“ und von unaussprechlicher Pracht; und wenn unter den Burschen des „Wild-West“ die Behauptung aufgestellt worden ist, dieses Messer trage seine Bezeichnung als „Waffe“ durchaus zu Unrecht, so ist das eine kolossale Lüge; so ist‘s, mögen sie sagen, was sie wollen. Tom versuchte die Tischkante damit anzuschneiden, und war eben in voller Tätigkeit, als man ihn abrief, um zur Sonntagsschule Staat zu machen.
Mary gab ihm einen Zinneimer und Seife, und er ging zur Tür hinaus und setzte den Eimer auf eine kleine Bank; dann tauchte er die Seife ins Wasser und legte sie daneben; krempelte sich die Ärmel auf, ließ das Wasser auslaufen, ging in die Küche zurück und begann hinter der Tür sich das Gesicht mit dem Tuch eifrig abzutrocknen.
Aber Mary entriß ihm das Tuch und sagte: „Schämst du dich nicht, Tom? Du sollst nicht immer so schlecht sein. Ein bißchen Wasser schadet dir wahrhaftig nicht.“
Tom war einen Augenblick in Verwirrung. Der Eimer wurde wieder gefüllt, und diesmal blieb er eine Weile darüber gebeugt stehen, Mut sammelnd. Ein tiefer Seufzer — und los! Als er dann wieder in die Küche zurückkam, beide Augen geschlossen, und nach dem Tuch griff, tropften Schmutz und Wasser von seinem Gesicht herunter — ein ehrenvolles Zeichen seines Mutes. Aber als er hinter dem Tuche wieder auftauchte, sah er durchaus noch nicht einwandfrei aus; das reine Gebiet hörte an Mund und Ohren auf. Jenseits dieser Linie breitete sich eine undurchdringlich schwarze Fläche bis in den Nacken aus. Mary nahm ihn jetzt in die Mache und als sie mit ihm fertig war, sah er wie ein tadelloser Gentleman aus, fleckenlos und mit hübschen Sonntagslocken in gleichmäßiger Verteilung. (Er selbst haßte diese Locken von Herzen und versuchte, sie auf den Kopf niederzubürsten; denn er hielt Locken für weibisch, und sie erfüllten sein Leben mit Bitterkeit.) Dann kam Mary mit einem Anzuge, den er während zweier Jahre nur an Sonntagen getragen hatte und der allgemein nur als die „anderen Kleider“ bezeichnet wurde — woraus man auf den Stand seiner Garderobe schließen kann. Das Mädchen schubste ihn noch ein bißchen zurecht, nachdem er sich selbständig angezogen hatte. Sie verlieh ihm einen gewissen (ganz ungewohnten) Schein von Zierlichkeit, zog den Hemdkragen herunter, bürstete ihn ab und krönte ihn mit seinem farbigen Strohhut. So sah er außerordentlich sanftmütig und behaglich aus. Und er fühlte sich auch so. Sein Widerwillen gegen ganze und saubere Kleider war unverwüstlich. Er hoffte, Mary werde wenigstens die Stiefel vergessen, aber diese Hoffnung wurde zunichte. Sie bestrich sie, wie es sich gehört, mit Talg und brachte sie ihm. Jetzt verlor er die Geduld und sagte, er solle immer tun, was er nicht möchte. Aber Mary sagte überredend: „Na, komm, Tom, sei ein braver Bursche!“ So fuhr er brummend in seine Stiefel. Mary war bald fertig, und die drei Kinder gingen zur Sonntagsschule, ein Ort, der Tom gründlich verhaßt war. Aber Sid und Mary gingen sehr gern hin.
Die Zeit der Sonntagsschule war von neun bis halb zehn Uhr; dann kam der Gottesdienst. Zwei der Kinder blieben stets mit Vergnügen zur Predigt da, das dritte blieb auch — ja, aber aus anderen Gründen. Die hochlehnigen, schmucken Kirchenstühle konnten über dreihundert Personen fassen; das Gebäude selbst war klein, vollgestopft — mit einer Art fichtenem Kasten als Turm darauf.
An der Tür blieb Tom ein bißchen zurück und hielt einen sonntäglich gekleideten Kameraden an: „Sag, Bill, hast du ein gelbes Billett?“
„M — ja!“
„Was willst du dafür haben?“
„Was willst du geben?“
„Ein Stück Zuckerstange und einen Angelhaken.“
„Zeig her.“
Tom zeigte seine Tauschobjekte. Sie waren befriedigend, und das Geschäft wurde gemacht. Dann erhandelte Tom einige blaue und rote Zettel gegen ähnliche Kleinigkeiten. Er stellte die anderen Jungen, wie sie ihm in den Weg kamen, und verkaufte, indem er Zettel der verschiedenen Farben dagegen kaufte. Dann ging er in die Kirche, inmitten eines Schwarmes geputzter, lärmender Knaben und Mädchen, schlängelte sich auf seinen Platz und fing mit dem ersten besten Streit an. Der Lehrer, ein würdiger, bejahrter Mann, trat dazwischen. Dann wandte er sich einen Augenblick um, und Tom riß einen Knaben in der vorderen Bank an den Haaren und war vertieft in sein Buch, als der Knabe herumfuhr. Darauf stach er einen anderen mit einer Nadel, dieser schrie auf, und Tom erhielt abermals einen Verweis. Toms ganze Klasse war eine Musterklasse — nach seinem Muster — unruhig, vorlaut und lärmend. Als es ans Aufsagen der Lektion ging, wußte nicht ein einziger seine Verse gründlich, alles stümperte und war unsicher. Indessen — sie kamen durch, und jeder erhielt seine Bestätigung in Form eines blauen Zettels, jeder mit einem Bibelspruch darauf; jeder solcher Zettel galt für zwei aufgesagte Verse. Zehn blaue Zettel waren gleich einem roten und konnten gegen einen solchen umgetauscht werden; zehn rote machten einen gelben aus, und für diesen gab der Superintendent eine sehr einfach gebundene Bibel (heutzutage gewiß vierzig Cents wert).
Wie viele meiner Leser würden Fleiß und Aufmerksamkeit genug haben, um zweitausend Verse auswendig zu lernen, und handelte es sich um eine Doréesche Bibel? Und doch hatte Mary auf diese Weise zwei Bibeln erworben; es war das Werk zweier Jahre; ein Knabe deutscher Abkunft hatte es gar auf vier oder fünf gebracht. Einmal hatte er dreitausend Verse hergesagt, ohne zu stocken. Aber die geistige Anstrengung war zu groß gewesen, und er war von dem Tage an nicht viel besser als ein Idiot — ein böses Mißgeschick für die Schule, denn vor diesem Ereignis hatte der Superintendent bei besonderen Gelegenheiten den Knaben vortreten und „sich blähen“ lassen (wie Tom das nannte). Nur die gesetzteren Schüler gaben sich die Mühe, ihre Zettel aufzubewahren, und ihr langweiliges Werk solange fortzusetzen, bis sie Anspruch auf eine Bibel hatten. So war die Erlangung eines solchen Preises ein seltenes und bemerkenswertes Ereignis; der Sieger war an seinem Ehrentage eine so große, hervorragende Person, daß heiliger Ehrgeiz die Brust eines jeden Schülers erfüllte und oft mehrere Wochen anhielt. Es ist möglich, daß Toms Streben niemals auf einen solchen Preis gerichtet war, zweifellos aber sehnte sich sein ganzes Sein nach dem Ruhm und Aufsehen, die ein solches Ereignis mit sich brachten.
Der Geistliche stand jetzt vor der Versammlung, einen geschlossenen Psalter in der Hand und den vierten Finger zwischen die Blätter geschoben. Er befahl Ruhe. Wenn nämlich ein Sonntagsschullehrer seine gewohnte kleine Rede vom Stapel lassen will, ist ein Psalterbuch in seiner Hand so notwendig, wie die Notenblätter in der Hand eines Sängers, der im Konzert vom Podium aus ein Solo vortragen soll — wer weiß, warum? Denn niemals werden Psalterbuch oder Notenblätter beim Vortrag geöffnet.
Der Superintendent war ein schmächtiger Mann von fünfunddreißig Jahren, mit sandgelbem Ziegenbart und kurzgeschorenem sandgelbem Haar. Er trug einen steifen Stehkragen, dessen oberer Rand seine Ohren streifte und dessen scharfe Ecken bis zu den Mundwinkeln vorsprangen — eine Planke, die ihn zwang, den Kopf stets vorzustrecken und den ganzen Körper zu drehen, wenn er zur Seite blicken wollte. Sein Kinn war in eine riesige Krawatte gezwängt, die so breit und lang war, wie eine Banknote und spitze Enden hatte. Mr. Walter war äußerst ernsthaft von Aussehen und sehr gutmütig und ehrenhaft von Charakter. Und er hielt geistige Dinge und Angelegenheiten so sehr in Ehren und wußte sie so streng von allem Weltlichen zu trennen, daß seine Sonntagsschulstimme ihm selbst unbewußt einen gewissen Klang angenommen hatte, von dem sie an Wochentagen vollkommen frei war.
Er begann also: „Nun, Kinder, sitzt einmal so ruhig und gesittet, als es euch nur immer möglich ist, und paßt einmal ein paar Minuten tüchtig auf, denn darauf kommt es vor allem an! Das sollten alle braven Knaben und Mädchen stets tun! Ich sehe ein kleines Mädchen, das zum Fenster hinausschaut — ich fürchte, sie bildet sich ein, ich wäre irgendwo draußen, vielleicht in einem Baum und hielte den Vögeln meine Rede?! (Unterdrücktes Kichern.) Ich möchte euch sagen, daß es mich glücklich macht, so viele frische, helle Kindergesichter an diesem Ort versammelt zu sehen, um zu lernen, recht tun und gut sein.“
In diesem Stil ging‘s immer weiter. Es ist nicht nötig, den Rest der Rede hierherzusetzen. Sie war ganz nach bekanntem Muster — wir alle haben sie mal gehört.
Das letzte Drittel der Rede wurde durch die Wiederaufnahme des Kampfes zwischen gewissen bösen Buben gestört und durch Unruhe und Geschwätz hier und dort, deren Wellen sogar an den Grundlagen solcher Felsen der Folgsamkeit und Bravheit, wie Sid und Mary, nagten. Aber mit dem Schwächerwerden von Mr. Walters Stimme wurde auch das allgemeine Summen schwächer, und der Schluß der Rede wurde mit stiller Heiterkeit begrüßt.
Zum guten Teil war die Unaufmerksamkeit hervorgerufen worden durch ein ziemlich seltenes Vorkommnis: das Erscheinen von Besuchern: Richter Thatcher, begleitet von einem sehr schwachen, alten Mann, einem vornehmen, mittelalterlichen Gentleman mit eisengrauem Haar, und einer würdevollen Dame, zweifellos der Frau des letzteren. Die Dame führte ein Kind an der Hand. Tom war bis dahin unruhig und schuldbewußt gewesen — er konnte den Blick aus Amy Lawrences Augen nicht ertragen — es sprach zu viel Liebe aus diesem Blick! Aber als er diesen kleinen Ankömmling sah, war seine Beklommenheit auf einmal vorbei. Im nächsten Augenblick ließ er wieder seine Künste spielen — er knuffte andere Knaben, riß sie an den Haaren, schnitt Fratzen, mit einem Wort, tat alles, was nur irgend eines Mädchens Aufmerksamkeit erregen und ihren Beifall gewinnen kann. Aber seine Exaltation wurde rasch gedämpft, er erinnerte sich seiner Erlebnisse im Garten dieses Engels; aber diese Erinnerung wurde rasch durch das Glücksgefühl, von dem sein Herz plötzlich erfüllt war, fortgeschwemmt.
Den Besuchern wurden die höchsten Ehrenbezeugungen erwiesen, und nach Beendigung von Mr. Walters Anrede führte er sie in der Schule herum. Der mittelalterliche Mann schien ein bedeutender Mann zu sein. Er war der oberste Richter des Kreises — gewiß die erhabenste Persönlichkeit, die diese Kinder bis jetzt gesehen hatten; und sie grübelten darüber, aus welchem Stoff der wohl gemacht sein könne; und dann waren sie begierig auf seine Stimme und dann zitterten sie wieder davor, sie zu hören. Er war aus Konstantinopel — zwölf Meilen entfernt, — er war also durch die ganze Welt gekommen und hatte alles gesehen; diese Augen hatten das Staatshaus gesehen, von dem man sagte, es habe ein wirkliches Zinndach! Die scheue Ehrfurcht, welche diese Vorstellungen hervorriefen, war aus dem absoluten Schweigen und den starr auf ihn gerichteten Augen deutlich zu lesen.
Das also war der große Richter Thatcher, der Bruder ihres Bürgermeisters.
Von Jeff Thatcher hieß es sogleich, er sei mit dem großen Mann verwandt, und den beherbergte die Schule! Es würde Musik für Jeffs Ohren gewesen sein, hätte er gehört, was man von ihm flüsterte.
„Sieh nur, Jim, er ist wahrhaftig vorgegangen! Donnerwetter, er will ihm die Hand geben. Er hat ihm die Hand gegeben. Bei Jingo, möchtet wohl auch Jeff sein, he?“
Mr. Walter suchte sich jetzt in Geltung zu bringen durch möglichste Geschäftigkeit, erteilte Befehle, fällte Urteile, gab Winke hier und dort und überall, und zeigte, daß er am rechten Platz sei. Darauf „zeigte“ sich der Bücherverwalter, rannte mit Stößen von Büchern herum, klapperte mit den Bücherbrettern und vollführte einen Spektakel, daß es für jeden Vorgesetzten eine wahre Lust sein mußte. Die jungen Lehrerinnen „zeigten“ sich auch, taten schön mit Kindern, die sie eben geprügelt hatten, hoben warnend ihre niedlichen Finger gegen böse Buben und streichelten brave, kleine Mädchen. Die jungen Lehrer „zeigten“ sich mit kleinen Ermahnungen und anderen Beweisen ihrer Autorität und ihrer Sorgfalt. Und alle Lehrenden beiderlei Geschlechts machten sich mit Vorliebe am Klassenpult zu tun, und es schienen Geschäfte zu sein, die fortwährend wiederholt werden mußten (und wie sie dabei ärgerlich waren!). Die kleinen Mädchen „zeigten“ sich auf verschiedene Weise, und die Knaben „zeigten“ sich mit solchem Nachdruck, daß die Luft mit Papierkugeln und halb unterdrücktem Gezänk angefüllt war. Und bei alledem saß der große Mann da, hatte ein erhabenes Richterlächeln für die ganze Schule und wärmte sich im Glanze seiner eigenen Größe, denn er „zeigte“ sich erst recht. Aber eins fehlte, was Mr. Walters Glück vollgemacht hätte, das war die Gelegenheit, einen Bibelpreis auszuteilen und eins seiner Wunderkinder zu zeigen. Mehrere Schüler hatten eine Menge kleinerer Zettel, aber niemand hatte genug. Er hätte die Welt darum gegeben, seinen kleinen Deutschen für eine einzige Stunde wiederzuhaben.
Da — trat Tom Sawyer vor, neun gelbe Zettel, neun rote und zehn blaue, und verlangte eine Bibel! Das wirkte wie ein Blitz aus heiterm Himmel! So etwas hätte Walter nicht erwartet — in den nächsten zehn Jahren sicher nicht. Aber es war nichts auszusetzen — da lagen die nötigen Zettel beisammen und nahmen sich hübsch genug aus. Tom erhielt also seinen Platz beim Richter und den anderen Auserwählten, und die unerhörte Neuigkeit wurde nach allen Himmelsgegenden ausposaunt.
Es war zweifellos die staunenswerteste Tatsache des Jahrzehnts; und so tief war die Erregung, daß sie den neuen Helden auf die Höhe des Kreisrichters hob und die Schule zwei Weltwunder aus einmal zu bestaunen hatte. Die Jungen waren durch die Bank von Neid erfüllt. Aber die am tiefsten Beleidigten waren diejenigen, welche zu spät einsahen, daß sie selbst zu diesem unerhörten Glanz beigetragen hatten, indem sie Tom Billetts verkauften für die Schätze, welche er durch Übertragung der Anstreich-Gerechtsame erworben hatte. Sie verachteten sich selbst, da sie sich durch einen listigen Betrüger hatten anführen lassen.
Der Preis wurde Tom überreicht, mit so viel Salbung, als der Superintendent unter solchen Umständen auftreiben konnte. Aber es war doch nicht der rechte Schwung darin, denn sein Instinkt sagte ihm, hierbei müsse ein Geheimnis walten, das wohl nicht ganz gut das Licht der Sonne vertragen würde. Es war ganz einfach unglaublich, daß dieser Knabe zweitausend Bibelverse in seinem Kopfe aufgespeichert haben sollte — ein Dutzend schon hätte zweifellos seine Kräfte überstiegen. Amy Lawrence war ganz rot vor Stolz und versuchte, es Tom zu zeigen, aber er wollte nicht sehen. Sie wunderte sich; dann grämte sie sich ein bißchen; schließlich stieg ein leiser Verdacht in ihr auf und verflog und kam wieder. Sie paßte auf. Ein heimlicher Blick verriet ihr Welten, und dann brach ihr Herz, und sie wurde eifersüchtig und wütend, und die Tränen kamen, und sie haßte alle, alle, Tom natürlich am meisten.
Tom wurde vor den Richter geführt. Aber seine Zunge klebte am Gaumen, der Schweiß trat ihm auf die Stirn, sein Herz klopfte — teils infolge der Größe des Mannes, aber mehr noch, weil er ihr Vater war. Er hätte, wäre es dunkel gewesen, vor ihm niederfallen und ihn anbeten mögen. Der Richter legte die Hand auf Toms Kopf und nannte ihn einen tüchtigen, kleinen Mann und fragte ihn nach seinem Namen. Der Junge stammelte, hustete und stieß endlich mühsam heraus: „Tom!“
„O nein — nicht Tom, sondern —“
„Thomas.“
„Richtig. Ich dachte mir doch, daß noch etwas fehlte. Gut. Aber ich glaube, du hast noch einen Namen, und du wirst ihn mir nennen, nicht?“
„Nenne dem Herrn deinen anderen Namen, Thomas, und sage: Herr! Nicht vergessen, was sich schickt!“
„Thomas Sawyer — Herr!“
„So — so ist‘s recht! Ein guter Junge. Ein braver Junge. Ein braver, kleiner Junge. Zweitausend Verse sind viel — sehr, sehr viel! Und Sie brauchen die Mühe, die es Ihnen bereitet hat, es ihm beizubringen, sicher nicht zu bereuen; denn Kenntnisse sind gewiß mehr wert, als irgend etwas anderes in der Welt. Sie machen große Männer und große Menschen. — Du wirst eines Tages ein großer Mann sein und ein großer Mensch, Thomas, und dann wirst du zurückblicken und sagen: Das alles verdanke ich der herrlichen Sonntagsschule meines Heimatsdorfes; alles meinen lieben Lehrern, die mich angehalten haben, zu lernen; alles dem guten Superintendenten, der mich anfeuerte und über mir wachte und mir eine wundervolle Bibel schenkte, eine herrliche, prächtige Bibel, damit ich sie immer, immer bei mir haben möge; alles meiner Erziehung! Das wirst du sagen, Thomas! Und du würdest dir mit keinem Geld deinen Schatz von zweitausend Versen bezahlen lassen — nein, wahrhaftig nicht! — Und jetzt kannst du mir und dieser Dame eine große Freude machen und uns einige deiner Verse aufsagen — du wirst es gern tun, denn wir freuen uns ja so sehr über einen fleißigen Knaben. Ohne Zweifel kennst du die Namen aller zwölf Jünger. Willst du uns also die Namen der beiden zuerst erwählten Jünger nennen?“
Tom zupfte an einem Knopf und sah möglichst einfältig aus. Er wurde rot und senkte die Augen. Mr. Walters Herz sank mit. Er sagte sich, es sei gar nicht möglich, von diesem Jungen Antwort auf die einfachste Frage zu bekommen — und den gerade mußte der Richter fragen! Doch fühlte er sich veranlaßt, zu Hilfe zu kommen und sagte: „Antworte dem Herrn, Thomas, — fürchte dich nicht!“
Tom wurde immer röter.
„Nun, ich weiß, mir wirst du es sagen,“ mischte sich hier die Dame ein. „Die Namen der zwei ersten Jünger waren —“
„David und Goliath!“
Decken wir den Schleier der Nächstenliebe über das, was nun folgte!
Fünftes Kapitel.
Ungefähr um halb zehn Uhr begann die kleine Glocke der Kirche zu läuten, und sogleich begann das Volk zur Morgenpredigt herbeizuströmen. Die Sonntagsschulkinder zerstreuten sich durchs ganze Haus und nahmen Plätze bei ihren Eltern ein, um unter Aufsicht zu sein. Tante Polly kam, und Tom, Sid und Mary saßen bei ihr. Tom wurde zunächst der Kanzel plaziert, um so weit wie möglich vom offenen Fenster und dem Sommer draußen entfernt zu sein.