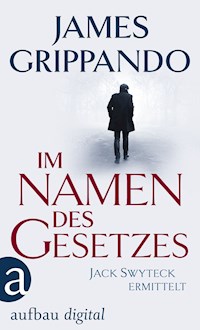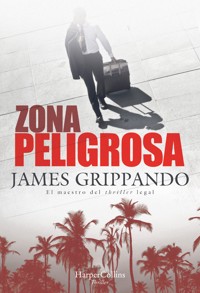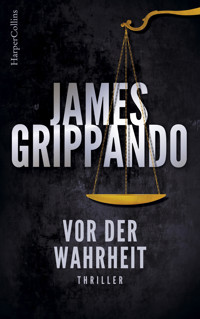9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: James Grippando Thriller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die junge Amy Parkens findet zweihunderttausend Dollar in einem Paket ohne Absender. Ryan Duffy entdeckt nach dem Tod seines Vaters, der seine Familie immer mehr schlecht als recht ernährt hatte, zwei Millionen Dollar in einem Aluminiumkoffer.
Als Amy und Ryan sich zum ersten Mal begegnen, ahnen sie noch nichts von dem dunklen Geheimnis ihrer Eltern. Um die Wahrheit zu erfahren, müssen die beiden alles riskieren: das Vertrauen ihrer Familien, ihre Freiheit und sogar ihr Leben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Ähnliche
Über das Buch
Die junge Amy Parkens findet zweihunderttausend Dollar in einem Paket ohne Absender. Ryan Duffy entdeckt nach dem Tod seines Vaters, der seine Familie immer mehr schlecht als recht ernährt hatte, zwei Millionen Dollar in einem Aluminiumkoffer.
Als Amy und Ryan sich zum ersten Mal begegnen, ahnen sie noch nichts von dem dunklen Geheimnis ihrer Eltern. Um die Wahrheit zu erfahren, müssen die beiden alles riskieren: das Vertrauen ihrer Familien, ihre Freiheit und sogar ihr Leben …
Über James Grippando
James Grippando ist Autor diverser New York Times-Bestseller. Er arbeitete zwölf Jahre als Strafverteidiger bevor sein erstes Buch »Im Namen des Gesetzes« 1994 veröffentlicht wurde und ist weiterhin als Berater für eine Kanzlei tätig. Er lebt mit seiner Familie im Süden Floridas.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
James Grippando
Die Abfindung
Aus dem Englischen von Charlotte Breuer
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Teil eins
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Teil zwei
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Teil drei
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Epilog
Danksagung
Impressum
Für Dich, Tiffany, immer.
»Behaupte nicht, jemanden wirklich zu kennen, ehe du nicht eine Erbschaft mit ihm geteilt hast.«
JOHANNKASPARLAVATER, Aphorismen
Prolog
Juli 1979
Er würde sterben. Es gab keine Rettung. Und Amy Parkens schaute mit der Faszination eines Kindes zu.
Es war eine perfekte Nacht. Keine Stadtlichter, noch nicht einmal ein Mond, der den wolkenlosen Himmel vor Amys Fenster erhellte. Milliarden von Sternen schimmerten in der endlos schwarzen Tiefe. Amys 6-Zoll-Newtonian-Spiegelteleskop war auf den Ringnebel gerichtet, einen sterbenden Stern in der Leier. Es war Amys Lieblingssternbild. Es erinnerte sie an die Ringe, die ihr Großvater mit seinem Zigarrenrauch blies – ein blasser, graugrüner Ring, der im Weltraum schwebte. Der Tod kam langsam, zog sich über viele Jahrtausende hin. Er war unwiderruflich.
Amy schob sich eine Haarsträhne aus der Stirn und spähte durch das Okular. Sie war ein hoch aufgeschossenes, mageres achtjähriges Mädchen mit einem strohblonden Pony, der ihr immer in den Augen hing. Sie hatte Erwachsene oft sagen hören, sie würde einmal die Twiggy der achtziger Jahre, aber das interessierte sie nicht. Sie hatte andere Interessen als die meisten ihrer Schulkameraden. Fernsehen und Computerspiele langweilten sie. Sie war es gewohnt, sich abends allein mit Büchern, Himmelskarten und ihrem Teleskop die Zeit zu vertreiben – mit Dingen, die ihre Freundinnen als Hausaufgaben betrachtet hätten. Ihren Vater hatte sie nie gekannt. Er war in Vietnam gefallen, noch bevor Amy laufen gelernt hatte. Sie lebte allein mit ihrer Mutter, einer vielbeschäftigten Professorin für Physik an der University of Colorado in Boulder. Das leidenschaftliche Interesse für die Sterne hatte sie von ihr geerbt. Lange bevor sie ihr erstes eigenes Teleskop bekam, hatte Amy in den Nachthimmel geschaut und viel mehr als nur das Glitzern der Sterne gesehen. Als sie sieben Jahre alt war, kannte sie jedes Sternbild mit Namen. Seitdem hatte sie sogar einige Konstellationen erfunden und ihnen Namen gegeben – weit entfernte Sternbilder, die jenseits der Reichweite selbst der stärksten Teleskope lagen, aber nicht jenseits von Amys Vorstellungsvermögen. Andere Kinder mochten nächtelang durch Teleskope in den Himmel starren, ohne Orion oder Sirius jemals zu entdecken, weil die Sterne in ihren Augen nicht richtig zusammenpaßten. Für Amy jedoch ergab das alles einen Sinn.
Amy schaltete ihre Taschenlampe ein, das einzige Licht, das sie in ihrem rosafarbenen Zimmer brauchte. Mit Buntstiften zeichnete sie den Ringnebel in ihr Heft, ihr selbstgestaltetes Malbuch. Sie war das einzige Kind in ihrer Klasse, das sich nicht im Dunkeln fürchtete – solange ihr Teleskop in der Nähe war.
»Licht aus, mein Schatz«, rief ihre Mutter aus dem Flur.
»Das Licht ist aus, Mom.«
»Du weißt schon, was ich meine.«
Die Tür öffnete sich, und ihre Mutter kam ins Zimmer. Sie knipste die kleine Lampe neben Amys Bett an. Amy kniff die Augen zusammen, bis sie sich an das Licht gewöhnt hatte. Das Lächeln ihrer Mutter war warm aber schwach. Ihre Augen sahen müde aus. In letzter Zeit wirkte sie häufig erschöpft. Und besorgt. Amy war die Veränderung in den vergangenen Tagen aufgefallen, sie hatte ihre Mutter sogar gefragt, ob irgend etwas nicht stimme. Aber ihre Mutter hatte nur gesagt, es sei »nichts«.
Amy hatte sich schon vor Stunden zum Schlafen fertig gemacht, lange vor ihrem Ausflug in den Nachthimmel. Sie hatte sich die Zähne geputzt, das Gesicht gewaschen und ihren gelben Sommerschlafanzug angezogen. Sie kletterte von ihrem Stuhl und umarmte ihre Mutter. »Kann ich nicht noch ein bißchen aufbleiben? Bitte!«
»Nein, mein Schatz. Es ist schon längst Zeit zum Schlafen.«
Amy machte ein enttäuschtes Gesicht, doch sie war zu müde, um zu streiten. Sie schlüpfte ins Bett und ließ sich von ihrer Mutter zudecken.
»Erzählst du mir denn eine Geschichte?«
»Ich bin wirklich müde heute abend. Ich erzähle dir morgen eine.«
Amy verzog das Gesicht, doch ihre Enttäuschung währte nicht lange. »Eine gute?«
»Versprochen. Die beste, die du je gehört hast.«
»Okay.«
Ihre Mutter gab ihr einen Kuß auf die Stirn und schaltete das Licht aus. »Träum was Schönes, mein Schatz.«
»Nacht, Mom.«
Amys Blick folgte ihrer Mutter durch das dunkle Zimmer. Die Tür öffnete sich. Ihre Mutter drehte sich noch einmal um, wie zu einem letzten stummen Gruß, dann schloß sie die Tür.
Amy drehte sich auf die Seite und schaute aus dem Fenster. Kein Teleskop mehr für heute, aber es war eine jener unglaublich klaren Nächte, in denen der Himmel auch für das bloße Auge ein Ehrfurcht gebietender Anblick ist. Sie schaute hinaus, bis die Sterne vor ihren Augen verschwammen. Sie wurde schläfrig. Zwanzig Minuten vergingen. Vielleicht mehr. Sie schloß die Augen, dann öffnete sie sie wieder. Ihr Kopf sank tiefer ins Kopfkissen. Der helle Lichtstreifen unter ihrer Zimmertür verschwand. Offenbar ging ihre Mutter gerade ins Bett. Amy fand es beruhigend, das zu wissen. Während der vergangenen Nächte hatte ihre Mutter überhaupt nicht geschlafen.
Amy schaute wieder aus dem Fenster. Hinter den Bäumen gingen die Lichter im Nachbarhaus aus. Sie schloß die Augen und stellte sich vor, wie in einem Haus nach dem anderen die Lichter verloschen und das Viertel, die Stadt, das ganze Land schlafen ging. Auf der ganzen Welt war es dunkel. Aber die Sterne leuchteten hell. Amy war fast eingeschlafen.
Ein lauter Knall zerriß die Nacht – wie ein Donner, aber es war kein Donner. Amy fuhr im Bett zusammen, als hätte sie jemand in den Bauch getreten.
Das Geräusch war aus dem Innern des Hauses gekommen.
Ihr Herz raste. Sie lauschte in die Dunkelheit, doch es war totenstill. Sie hatte zuviel Angst, um zu schreien. Sie wollte nach ihrer Mutter rufen, doch ihre Kehle war wie zugeschnürt. Es war ein gräßliches Geräusch gewesen, so schrecklich, daß sie jetzt für immer Angst vor der Dunkelheit haben würde. Aber sie hatte innerhalb von Sekunden gewußt, was es war. Sie kannte dieses Geräusch. Da war kein Irrtum möglich. Sie hatte es schon oft gehört, weit entfernt vom Haus, wenn ihre Mutter sie mit in den Wald genommen hatte und Amy ihr beim Üben zusehen durfte.
Es war der Knall von der Pistole ihrer Mutter.
Teil eins
Sommer 1999
1 Amy wünschte, sie könnte sich in die Vergangenheit zurückversetzen. Nicht weit zurück. Nicht daß sie davon träumte, mit Aristoteles Ouzo zu trinken oder Lincoln zuzurufen, er solle sich ducken. Knapp vierzehn Tage würden ihr schon reichen. Nur so weit, daß sie dem Computerhorror hätte ausweichen können, den sie gerade durchlebte.
Amy war Computerspezialistin bei Bailey, Gaslow & Heinz, der größten Anwaltskanzlei in den Rocky Mountains. Es war ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, daß vertrauliche Informationen sicher und ungehindert zwischen den Niederlassungen der Firma in Boulder, Denver, Salt Lake City, Washington, London und Moskau fließen konnten. Tag für Tag hatte sie die Macht, zweihundert Anwälte auf den Knien rutschen zu lassen. Und sie hatte das Vergnügen, sie toben zu hören. Gleichzeitig. Ihretwegen.
Als hätte ich den Virus produziert, dachte sie und malte sich dabei aus, was sie einem der Anwälte gern gesagt hätte, als er ihr Vorwürfe machte. Sie hatte ihn schon meilenweit hinter sich gelassen und mußte immer noch daran denken. Wenn man allein über den Highway fuhr, konnte man wunderbar herumphantasieren.
Sie hatte fast eine Woche gebraucht, um das gesamte System von dem Virus zu befreien. In dieser Zeit war sie zwischen sechs verschiedenen Büros hin und her gependelt, hatte achtzehn Stunden täglich gearbeitet. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden nach dem ersten Auftreten des Virus hatte sie jeden verfügbaren Mitarbeiter mobilisiert, und es war ihr gelungen, fünfundneunzig Prozent der gespeicherten Daten zu retten. Und danach hatte sie sich der dankbaren Aufgabe gestellt, einem halben Dutzend Anwälten, die Pech gehabt hatten, zu erklären, daß sämtliche Daten auf ihren Computern zum Teufel waren.
Es war eine wenig bekannte Tatsache, aber Amy hatte es mit eigenen Augen gesehen: Anwälte können weinen.
Ein plötzliches Klappern im Armaturenbrett riß Amy aus ihren Gedanken. Ihr alter Ford Pick-up gab die unterschiedlichsten Töne von sich. Jeder von ihnen hörte sich anders an, und Amy kannte sie alle. Wie eine Mutter, die wußte, ob das Schreien ihres Babys bedeutete, gib mir was zu essen, wechsel mir die Windel oder bitte, rette mich aus Omas Klauen. Dieses spezielle Geräusch war eher ein Rasseln – ein Symptom, das leicht zu diagnostizieren war, denn plötzlich strömte heiße Luft aus der Klimaanlage. Amy schaltete die Klimaanlage aus und wollte das Fenster herunterkurbeln. Es klemmte. Wunderbar. Draußen herrschten achtunddreißig Grad, ihr Wagen gebärdete sich wie ein Drachen, der heiße Luft spie, und das verdammte Fenster ließ sich nicht bewegen. In Colorado besagte eine alte Volksweisheit, daß man dort Urlaub machte, um den Winter zu genießen, aber dort hinzog wegen der schönen Sommer. Zweifellos konnte das nicht damit gemeint sein.
Ich schmelze, dachte sie. Wie Dorothy in »Der Zauberer von Oz«.
Sie hob die Rocky Mountain News vom Boden auf und fächelte sich Luft zu. Als sie die Zeitung vor acht Tagen gekauft hatte, hatte sie ihre Tochter für eine Woche zu ihrem Exmann gebracht, um sich mit ihrer ganzen Energie der Computerkrise widmen zu können. Sechs Tage von Taylor getrennt zu sein war ein neuer Rekord, den sie hoffentlich nie brechen würde. Obwohl sie todmüde war, konnte sie es kaum erwarten, ihre Tochter wiederzusehen.
Amy saß in einem Brutkasten, als sie endlich die Clover Leaf Apartments erreichte, eine langweilige Reihenhaussiedlung aus alten, zweistöckigen Ziegelbauten. Kein Vergleich zu den vornehmen Adressen, die den Preis für ein Haus in Boulder auf über eine Viertelmillion Dollar trieben. Die Clover Leaf Apartments waren staatlich subventionierte Wohnungen und allen außer armen Studenten und mittellosen Rentnern ein Dorn im Auge. Es gab kaum Grünanlagen. Dafür um so mehr Beton. Amy hatte schon Gewerbegebiete gesehen, die mehr architektonisches Flair besaßen. Der Bauherr war offenbar der Meinung, daß ohnehin nichts von Menschenhand Gemachtes so schön sein konnte wie die Berge am Horizont, und hatte sich erst gar keine Mühe gegeben. Trotzdem gab es eine endlose Warteliste, und es dauerte mindestens vier Jahre, bis man eine Wohnung in der Siedlung ergatterte.
Plötzlich wurde Amy mit dem Kopf gegen das Dach ihres Wagens geschleudert. Eine übersehene Straßenschwelle. Sie setzte ihren Wagen in die erste freie Parklücke und stieg aus. Nach ein oder zwei Minuten wich die Röte aus ihrem Gesicht. Sie sah wieder aus wie sie selbst. Amy war keine Frau, die es darauf anlegte, doch die Männer drehten sich nicht selten auf der Straße nach ihr um. Ihr Exmann hatte immer gesagt, das seien ihre langen Beine und ihr sinnlicher Mund. Aber es war viel mehr als das. Amy strahlte eine gewisse Energie aus, wann immer sie sich bewegte, wann immer sie lächelte, wann immer sie einen mit ihren graublauen Augen ansah. Ihre Großmutter behauptete immer, sie hätte die ungezügelte Energie ihrer Mutter geerbt – und Gran mußte es schließlich wissen.
Amys Mutter war vor zwanzig Jahren unter tragischen Umständen ums Leben gekommen. Amy war damals gerade acht. Ihr Vater war noch früher gestorben. Im Prinzip hatte Gran sie großgezogen. Sie kannte Amy; sie hatte sogar die Warnsignale ihres Exmannes wahrgenommen, bevor Amy selbst etwas gemerkt hatte. Vor vier Jahren war Amy eine junge Mutter gewesen, die versuchte, eine Ehe, einen Säugling und ein Astronomiestudium unter einen Hut zu bringen. Ihre Tochter und ihr Studium nahmen sie sosehr in Anspruch, daß wenig Zeit für Ted blieb – zu wenig Zeit, um ihm auf die Finger zu schauen. Er lernte eine andere Frau kennen. Nach der Scheidung zog sie zu Gran, die ihr half, Taylor zu versorgen. Gute Jobs waren schwer zu finden in Boulder, einem Mekka für talentierte, gut ausgebildete junge Akademiker, die sich von dem Lebensstil in Colorado angezogen fühlten. Am liebsten wäre Amy bei ihrem Astronomiestudium geblieben, aber das Geld war knapp, und ein Abschluß in Astronomie würde daran nichts ändern. Selbst ihr Computerjob hatte nichts daran geändert. Ihr Gehalt reichte gerade für ihren Dreipersonenhaushalt. Alles, was übrigblieb, wurde für das Jurastudium gespart, das sie im September beginnen wollte.
Eine juristische Laufbahn einzuschlagen war für Amy keine emotionale, sondern eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen. Sie war sich sicher, daß unter ihren zukünftigen Kommilitonen viele sein würden, denen es ähnlich erging wie ihr – Kunsthistoriker, Literaturwissenschaftler und viele mehr, die jede Hoffnung aufgegeben hatten, in dem Fachgebiet, an dem ihr Herz hing, Arbeit zu finden.
Amy wünschte, es wäre alles ganz anders.
»Mama, Mama!«
Amy fuhr herum, als sie die Stimme ihrer Tochter hörte. Taylor trug ihr rosafarbenes Lieblingskleid und rote Tennisschuhe. Die linke Hälfte ihres hellblonden Haars war zu einem Zöpfchen zusammengefaßt, die andere Hälfte wehte im Wind – sie hatte schon wieder eine Haarspange verloren. Sie rannte auf Amy zu und sprang ihr in die Arme.
»Ich hab dich so vermißt«, sagte Amy, während sie ihre Tochter fest an sich drückte.
Taylor lachte, dann verzog sie das Gesicht. »Iihh, du bist ja ganz naß!«
Amy wischte ihren Schweiß von Taylors Wange. »Mein Auto hat Fieber.«
»Gran sagt, du sollst den Schrotthaufen einfach verkaufen.«
»Niemals«, erwiderte Amy. Dieser Schrotthaufen hatte ihrer Mutter gehört. Er war so ziemlich das einzige, was ihr nach der Scheidung geblieben war. Das und ihre Tochter. Sie setzte Taylor ab. »Und, wie geht’s Dad?«
»Gut. Er hat versprochen, uns zu besuchen.«
»Uns?«
»Mhmm. Er hat gesagt, er will zu unserer Party kommen.«
»Welcher Party?«
»Zu unserer Party. Wenn du mit dem Studium fertig bist und ich mit der High-School.«
Amy blinzelte und bemühte sich, den Stich zu ignorieren. »Das hat er wirklich gesagt?«
»So ein Studium dauert ganz lange, nicht wahr?«
»So lange auch wieder nicht, mein Schatz. Bevor wir uns versehen, ist es schon vorbei.«
Gran näherte sich den beiden von hinten. »Ich habe noch nie eine Vierjährige so schnell laufen sehen«, keuchte sie.
Taylor kicherte. Gran begrüßte Amy mit einem Lächeln, dann zog sie eine Grimasse. »Mein Gott, du bist ja nur noch Haut und Knochen. Hast du dich mal wieder ausschließlich von Koffein ernährt?«
»Nein, ich schwöre, ich hab diesmal versucht, ein bißchen Kaffee dazu zu trinken.«
»Komm rein, ich mach dir was zu essen.«
Amy war zu müde, um ans Essen zu denken. »Ich schieb mir einfach was in die Mikrowelle.«
»Mikrowelle«, schnaubte Gran verächtlich. »Ich mag vielleicht alt sein, aber wenn ich koche, dauert es nun auch wieder nicht so lange, als müßte ich erst mit zwei Stöcken Feuer machen. Bis du aus der Dusche kommst, habe ich dir ein leckeres Mittagessen gekocht.«
Einschließlich einer Monatsration Fett und Kalorien, dachte Amy. Gran gehörte zur alten Schule, auch was das Essen anging. »Okay«, sagte Amy, während sie ihren Koffer aus dem Wagen nahm. »Laßt uns reingehen.«
Hand in Hand gingen sie zu dritt über den Parkplatz und ließen Taylor wie ein Äffchen zwischen sich schaukeln.
»Mama ist wieder zu Hause, Mama ist wieder zu Hause«, sang Taylor vergnügt vor sich hin.
Amy steckte den Schlüssel ins Schlüsselloch und öffnete die Tür. Ihr Zuhause war eine einfache Dreizimmerwohnung. Das Zimmer, in dem sie sich am meisten aufhielten, war eine Kombination aus Wohn-, Eß- und Spielzimmer. Gran sagte manchmal, die »Mädels« hätten das Zimmer in eine Lagerhalle verwandelt. Fahrräder und Inlineskates verstellten den schmalen Eingang; die kleinen gehörten Taylor, die großen Amy. In der Mitte standen ein altes Sofa und ein dazu passender Sessel, das typische Mobiliar einer Mietwohnung. In einer alten Schrankwand aus Kiefernholz standen Bücher, ein paar Zimmerpflanzen und ein Fernseher. Rechter Hand befand sich eine Küche von der Größe eines Wandschranks.
Amy stellte ihren Koffer an der Tür ab.
»Ich fange gleich in der Küche an«, sagte Gran.
»Ich helfe dir!« rief Taylor.
»Erst Hände waschen«, sagte Amy.
Taylor rannte ins Bad, gefolgt von Gran. »Deine Post liegt auf dem Tisch, Amy. Zusammen mit den Telefonnotizen.« Dann verschwand sie im Flur, Taylor dicht auf den Fersen.
Amy trat an den Tisch. Die Post von einer Woche war säuberlich in drei Stapel aufgeteilt: Persönliches, Rechnungen und Wurfsendungen. Den größten Stapel bildeten die Rechnungen und Mahnungen. Die persönliche Post war alles andere als persönlich – hauptsächlich per Computer erstellte Reklamepost, die so aufgemacht war, daß sie aussah wie ein Brief von einem alten Freund. In dem Stapel mit den normalen Werbeprospekten fiel ihr ein Päckchen auf. Es trug keinen Absender. Auch keine Briefmarke und keinen Poststempel. Es sah aus, als wäre es von einem privaten Kurierdienst abgeliefert worden. Für seine Größe kam es Amy ziemlich schwer vor.
Neugierig riß sie das braune Packpapier auf. Zum Vorschein kam eine Schachtel mit einem Bild von einem Römertopf. Amy schüttelte die Schachtel. Der Inhalt fühlte sich nicht an wie ein Römertopf. Eher wie etwas viel Kompakteres, so, als wäre der Karton mit Zement gefüllt. Amy bemerkte, daß die Laschen an dem Karton mit Klebestreifen neu zugeklebt worden waren. Wahrscheinlich war der Römertopf durch etwas anderes ersetzt worden. Sie durchtrennte den Klebestreifen mit ihrem Schlüssel und öffnete die Laschen. Eine weitere Verpackung kam zum Vorschein, eine Art wasserdichter Plastiksack mit Reißverschluß. Das Päckchen enthielt keinen Brief, keine Karte, nichts, was auf die Identität des Absenders hätte schließen lassen. Amy öffnete den Reißverschluß und erstarrte.
»O mein Gott.«
Das Konterfei von Benjamin Franklin starrte sie an, und das nicht nur einmal. Hundertdollarnoten. Stapelweise. Sie nahm ein Bündel aus dem Plastikbeutel, dann ein weiteres, legte sie alle nebeneinander auf den Tisch. Mit zitternden Händen zählte sie die Geldscheine eines Bündels. Fünfzig pro Bündel. Vierzig Bündel.
Sie ließ sich auf einen Stuhl sinken und starrte ungläubig auf das viele Geld. Jemand – irgend jemand, der anonym bleiben wollte – hatte ihr zweihunderttausend Dollar geschickt.
Und sie hatte keine Ahnung, warum.
2 Weiche Schlieren in Orange, Pink und Violett hingen am Horizont, das Nachglühen eines Sonnenuntergangs in Südcolorado. Von der überdachten Veranda des Hauses, in dem er seine Kindheit verbracht hatte, starrte der fünfunddreißigjährige Ryan Duffy nachdenklich in das Abendrot. Die Natur schien einen täglich daran erinnern zu wollen, daß das Ende schön sein konnte. Allmählich wich das Naturschauspiel der Dunkelheit, einem schwarzen, mond- und sternenlosen Himmel. Die Farbenpracht hatte ihn beinahe genarrt. Jetzt machte er sich Vorwürfe, weil er einen Augenblick lang gedacht hatte, daß es für seinen Vater jetzt besser wäre zu sterben.
Ryans Vater hatte zweiundsechzig Jahre nach einem simplen Grundsatz gelebt: »Zuletzt« war das schlimmste aller Schimpfwörter. Für Frank Duffy existierte das Wort »zweitrangig« nicht, für ihn gab es keine Prioritäten. Alles kam an erster Stelle. Gott, die Familie, der Beruf – er betrieb alles mit derselben ungebremsten Energie. Er war ein unermüdlicher Arbeiter, der nie einen Sonntagsgottesdienst verpaßte, nie seine Familie im Stich ließ, nie eine Arbeitsstelle verließ, ehe nicht jemand sagte: »Dieser Duffy ist der beste Elektriker in der verdammten Branche.« Nur im wichtigsten Kampf seines Lebens hatte er diesen Grundsatz verraten.
Er war der letzte, der zugab, daß der Krebs ihn töten würde.
Erst als der Schmerz unerträglich wurde, räumte er ein, daß er nicht allein damit fertig werden würde. Es machte Ryan wütend, daß er seine Medizin ablehnte. Aber Ryans Eigenschaft als Arzt schien seine unablässigen Überzeugungsversuche nur noch verdächtiger zu machen. Als wäre er nur einer von diesen Apparatemedizinern, denen Frank Duffy noch nie über den Weg getraut hatte. Es stellte sich jedoch heraus, daß eine Behandlung das Unausweichliche nur hinausgezögert hätte – zwei, höchstens drei Monate. Ryan wäre über jeden zusätzlichen Tag froh gewesen. Andererseits konnte er sich vorstellen, daß er im umgekehrten Fall womöglich dieselbe Sturheit an den Tag gelegt hätte wie sein Vater. Ryan freute sich, wenn die Leute sagten, er sei genau wie sein Vater. Die beiden sahen sich tatsächlich so ähnlich, daß sie immer wieder miteinander verglichen wurden. Sie waren beide gutaussehend und hatten warme, braune Augen. Frank war schon in jungen Jahren ergraut, und auch bei Ryan zeigten sich erste graue Strähnen. Bei einer Größe von einem Meter dreiundachtzig überragte er Frank um mehrere Zentimeter, doch er wäre der letzte gewesen, der auch nur erwähnt hätte, daß sein stolzer Vater im Alter geschrumpft war.
Die Sonne war mittlerweile ganz verschwunden, aufgesogen von dem flachen Horizont. In der Dunkelheit wirkten die Ebenen von Südostcolorado wie ein riesiger Ozean. Weit und friedlich, keine Stadtlichter in Sichtweite. Die ideale Gegend, um Kinder großzuziehen. Kaum Kriminalität. Das nächste Einkaufszentrum befand sich in Pueblo, einer Arbeiterstadt etwa hundert Meilen westlich. In Garden City, Kansas, noch weiter weg in östlicher Richtung, war das einzige annehmbare Restaurant der ganzen Gegend. Manche behaupteten, Piedmont läge am Ende der Welt. Für Ryan lag es genau da, wo es hingehörte.
Ryan hatte die Entscheidung seines Vaters, seine letzten Tage zu Hause zu verbringen, voll unterstützt. Frank Duffy war bei den zwölfhundert Einwohnern seines Heimatorts sehr beliebt, aber die zweistündige Fahrt ins Krankenhaus machte es seinen ältesten Freunden schwer, sich persönlich von ihm zu verabschieden. Ryan hatte seinen Vater im hinteren Teil des Hauses in seinem Lieblingszimmer untergebracht. Ein gemietetes Krankenhausbett mit verchromten Stangen und verstellbarer Matratze hatte die rustikale Holzbank mit den grünen Kissen ersetzt. Vor dem großen Fenster lag ein Gemüsegarten mit kniehohen Maispflanzen und buschigen Tomatensträuchern. Der Fußboden aus Eiche und die Deckenbalken aus Zedernholz trugen zur Blockhausatmosphäre bei. Es war das freundlichste Zimmer im ganzen Haus.
»Hast du welchen bekommen?« fragte Frank begierig, als Ryan das Zimmer betrat.
Grinsend nahm Ryan die Flasche aus der braunen Papiertüte: einen Viertelliter Jameson Irish Whiskey.
Frank strahlte. »Guter Junge.«
Ryan stellte ein Tablett mit zwei Gläsern auf das Bett und goß zwei Fingerbreit Whiskey in jedes Glas.
»Weißt du, was das Gute an irischem Whiskey ist, Ryan?« fragte Frank und hob lächelnd sein Glas. »Er kommt aus Irland. Auf deine Gesundheit, Junge«, sagte er mit übertriebenem Akzent.
Ryan bemerkte, daß die Hand seines Vaters zitterte, nicht etwa, weil er getrunken hatte, sondern vor Schwäche. Er war noch blasser als am Tag zuvor, und sein ausgemergelter Körper wirkte unter dem weißen Laken geisterhaft, beinahe leblos. Schweigend kippten sie den letzten Schluck. Zufrieden lächelnd setzte Frank das Glas ab.
»Ich weiß noch genau, wie du deinen ersten Whiskey getrunken hast«, sagte er mit wehmütigem Blick. »Du warst damals ein elfjähriger Knirps und hast meinen alten Herrn pausenlos angebettelt, dich von seinem Glas probieren zu lassen. Deine Großmutter sagte schließlich, na, gib ihm ruhig einen Schluck, weil sie glaubte, du würdest das Zeug sofort wieder ausspucken wie bittere Medizin, und dann wäre Ruhe. Du hast den Kopf in den Nacken gelegt, den Whiskey gekippt und das Glas auf den Tisch geknallt wie ein Cowboy in einem Western. Das Zeug hat dir so in der Kehle gebrannt, daß dir fast die Augen aus dem Kopf getreten wären. Aber du hast dir nur mit dem Ärmel über die Lippen gewischt, deine Großmutter angesehen und gesagt: ›Besser als Sex.‹«
Sie lachten gequält. Dann schaute Frank seinen Sohn forschend an. »Das ist seit ich weiß nicht wie langer Zeit das erstemal, daß ich dich lächeln sehe.«
»Mir ist einfach lange nicht mehr danach gewesen. Eigentlich hatte ich heute abend auch nicht unbedingt Lust, was zu trinken.«
»Was schlägst du denn vor? Sollen wir vielleicht ein paar Telefonate führen und den Krebs einfach abbestellen? Hör zu«, sagte Frank liebevoll, »so, wie ich die Sache sehe, können wir entweder im Angesicht des Todes lachen, oder wir sterben vor lauter Anstrengung, uns das Lachen zu verkneifen. Also, sei kein Spielverderber, und schenk deinem Vater noch einen Whiskey ein.«
»Du solltest lieber nichts mehr trinken, Dad. Schmerzmittel und Alkohol vertragen sich nicht besonders gut.«
»Gott, Ryan, du bist immer so verdammt vernünftig.«
»Was ist denn dagegen einzuwenden?«
»Nichts. Im Grunde bewundere ich dich dafür. Ich wünschte, ich hätte selbst ein bißchen mehr davon. Die Leute sagen immer, wir würden uns gleichen wie ein Ei dem andern, aber das ist doch nur oberflächlich gesehen so. Klar, war es rührend, wie du früher am Frühstückstisch gesessen hast und so getan hast, als würdest du den Sportteil der Tageszeitung mit mir zusammen studieren. Du wolltest es genauso machen wie dein Dad, obwohl du erst zwei Jahre alt warst und noch gar nicht lesen konntest. Aber all das war doch nur, um so zu tun als ob. Innen drin, da, wo es zählt – na ja, sagen wir mal, daß wir beide da viel unterschiedlicher sind, als man meinen könnte.«
Er machte eine Pause und stellte sein Glas auf dem Tablett ab. Er wurde ernst und kam plötzlich ins Philosophieren. »Glaubst du, daß ein guter Mensch zu einem schlechten Menschen werden kann?«
»Klar«, sagte Ryan mit einem Achselzucken.
»Ich meine, richtig schlecht, kriminell. Oder glaubst du, daß ganz abscheuliche Dinge, unsagbar abscheuliche nur von Menschen getan werden, die von Geburt an durch und durch schlecht sind?«
»Ich glaube nicht, daß man als schlechter Mensch geboren wird. Der Mensch hat einen freien Willen. Man trifft Entscheidungen.«
»Und warum sollte irgend jemand sich entscheiden, zu einem schlechten Menschen zu werden, wenn er nicht schon schlecht ist?«
»Weil er schwach ist, nehme ich an. Zu schwach, um sich für das Gute zu entscheiden, zu schwach, um dem Bösen zu widerstehen.«
»Glaubst du, daß ein schwacher Mensch stark werden kann?« Frank stützte sich an der Bettkante auf seinen Ellenbogen auf und schaute Ryan direkt in die Augen. »Oder glaubst du, wer sich einmal dem Bösen zuwendet, ist wie faules Obst für immer verloren?«
Ryan lächelte verlegen, er war sich nicht sicher, worauf sein Vater hinauswollte. »Warum fragst du mich das alles?«
Frank lehnte sich seufzend zurück. »Weil ein Sterbender Bilanz zieht. Und es besteht kein Zweifel, daß ich sterbe.«
»Komm schon, Dad. Du liebst deine Frau. Deine Kinder lieben dich. Du bist ein guter Mann.«
»Das Beste, was man über mich sagen kann, ist, daß ich ein guter Mann geworden bin.«
Die verhängnisvollen Worte hingen in der Luft. »Jeder tut mal was Schlechtes«, sagte Ryan vorsichtig. »Darum ist man noch kein schlechter Mensch.«
»Das ist der grundlegende Unterschied zwischen dir und mir, mein Sohn. Was ich getan habe, hättest du niemals getan.«
Ryan nippte nervös an seinem leeren Glas. Er wußte nicht, was er sagen sollte, fürchtete, daß sein Vater drauf und dran war, ihm irgend etwas zu beichten. Die Vorhänge bewegten sich in der lauen Brise.
»Auf dem Dachboden steht eine alte Kommode«, fuhr sein Vater fort. »Schieb sie beiseite. Unter den Dielenbrettern, auf denen die Kommode steht, habe ich etwas für dich hinterlegt. Etwas Geld. Eine Menge Geld.«
»Wieviel?«
»Zwei Millionen Dollar.«
Ryan erstarrte, dann mußte er lachen. »Das ist ein guter Witz, Dad. Zwei Millionen Dollar auf dem Dachboden. Und ich hab die ganze Zeit geglaubt, du hättest den Zaster unter deiner Matratze versteckt.« Er lächelte seinen Vater kopfschüttelnd an. Dann hielt er inne.
Sein Vater lächelte nicht.
Ryan schluckte nervös. »Komm schon. Du willst mich doch auf den Arm nehmen, oder?«
»Auf dem Dachboden liegen zwei Millionen Dollar, Ryan. Ich habe sie eigenhändig dort deponiert.«
»Wo zum Teufel hast du denn zwei Millionen Dollar her?«
»Das versuche ich dir ja gerade zu erklären. Du machst es mir nicht leicht.«
Ryan nahm die Flasche vom Tablett. »Okay, ich würde sagen, es reicht für heute. Von all dem Whiskey und den Schmerzmitteln hast du schon Halluzinationen.«
»Ich habe einen Mann erpreßt. Einen, der es verdient hat.«
»Dad, hör auf damit. Du hattest nie auch nur die Möglichkeit, jemanden zu erpressen.«
»Doch, die hatte ich, verdammt noch mal!« Er hatte so heftig gesprochen, daß er einen Hustenanfall bekam.
Ryan trat an sein Bett und richtete das Kissen in seinem Rücken. Franks Atem ging pfeifend, wenn er zwischen den Hustenattacken nach Luft rang. Sein Mund füllte sich mit blutigem Schleim. Ryan läutete nach der Krankenschwester, die sich im Nebenraum aufhielt. Sie kam sofort.
»Helfen Sie mir«, sagte Ryan. »Setzen Sie ihn aufrecht, damit er nicht erstickt.«
Sie folgte seinen Anweisungen. Ryan stellte die Sauerstoffflasche neben das Bett. Er öffnete das Ventil und schob Frank das Atemgerät in den Mund. Mit Sauerstoffversorgung kannte sich die ganze Familie aus. Frank hatte an einem Lungenemphysem gelitten, lange bevor der Krebs ausgebrochen war. Nach wenigen tiefen Atemzügen ließ das Pfeifen nach. Allmählich wurde der Atem wieder normal.
»Dr. Duffy, ich möchte Ihr Urteil als Arzt nicht in Frage stellen, aber ich glaube, Ihr Vater braucht jetzt Ruhe. Dieser ganze Abend war viel zu anstrengend für ihn.«
Er wußte, daß sie recht hatte, aber der Blick seines Vaters ließ ihn zögern. Ryan hatte den glasigen, fiebrigen Blick eines Mannes erwartet, der unter Beruhigungsmitteln stand und sich etwas von Erpressung zusammenphantasierte. Aber die dunklen alten Augen schauten ihn klar und durchdringend an. Sie sprachen auch ohne Worte eine deutliche Sprache. Ryan dachte unwillkürlich: Könnte er es ernst gemeint haben?
»Ich komme morgen früh wieder, Dad. Dann können wir weiterreden.«
Sein Vater schien den Aufschub zu begrüßen, als hätte er für heute genug gesagt. Ryan rang sich ein schwaches Lächeln ab. Er öffnete den Mund, um »Ich liebe dich« zu sagen; er tat es jedesmal beim Abschied aus Angst, es könnte ihr letzter sein. Doch diesmal drehte er sich wortlos um und verließ das Zimmer. Seine Gedanken rasten. Es war unvorstellbar – sein Vater ein Erpresser, der zwei Millionen Dollar ergaunert hatte. Aber Ryan hatte seinen Vater noch nie so ernst erlebt.
Wenn das ein Witz war, dann war er auf beängstigende Weise überzeugend. Und kein bißchen lustig.
Verdammt, Dad, dachte Ryan, als er das Haus verließ. Gib mir bloß keinen Grund, dich zu hassen.
3 Es war noch dunkel, als Amy aufwachte. Die Vorhänge waren zugezogen. Das schwache Licht, das von den Laternen auf dem Parkplatz kam, ließ die Stoffbahnen an den Rändern aufleuchten. Es war die einzige Lichtquelle im Zimmer. Allmählich gewöhnten sich Amys Augen an das Halbdunkel. Das Bett an der anderen Wand war leer und schon gemacht. Aus der Küche drangen die üblichen morgendlichen Geräusche. Gran war immer als erste auf den Beinen; mit jedem Jahr, das verging, stand sie früher auf. Amy warf einen Blick auf den Wecker, der auf ihrem Nachttisch stand: 5.16 Uhr.
Wahrscheinlich kocht sie schon das Mittagessen.
Amy lag reglos im Bett und starrte an die Decke. Es war richtig gewesen, Gran davon zu erzählen. Irgendwann hätte sie es ihr sowieso wie Würmer aus der Nase gezogen. Amys Gesicht war schon immer ein offenes Buch gewesen, eines, in dem Gran stets ohne Mühe lesen konnte. In Wahrheit hatte Amy das Bedürfnis gehabt, mit Gran zu reden. Sie brauchte ihre Hilfe. Gran war altmodisch, aber es gab wenige Dinge, die so verläßlich waren wie altmodischer gesunder Menschenverstand.
Amy schlüpfte in ihren Flanellmorgenrock und schlurfte in Richtung Küche. Der Duft von frischem, starkem Kaffee war zu verführerisch.
»Guten Morgen, Liebes«, sagte Gran. Sie war bereits angezogen. Richtig feingemacht, wenn man ihre sonstigen Gewohnheiten kannte. Seit beinahe einem halben Jahrhundert war Gran im Winter in Jeans und im Sommer in Bermudashorts herumgelaufen. Aber neuerdings trug sie Hosen mit Bügelfalte und Seidenblusen, selbst wenn sie nur kurz etwas im Supermarkt zu besorgen hatte. Amy hatte den Verdacht, daß da ein Mann im Spiel war, obwohl Gran diese Unterstellung weit von sich wies.
»Morgen«, sagte Amy und setzte sich an den Eßtisch. Gran brachte ihr eine Tasse Kaffee, ohne Milch, mit zwei Würfeln Zucker, so, wie Amy ihn mochte.
»Ich habe einen Entschluß gefaßt«, sagte sie, während sie Amy gegenüber Platz nahm. »Wir werden das Geld hier im Haus aufbewahren.«
»Du hattest doch gesagt, du wolltest noch mal darüber schlafen. Und dann wollten wir das Problem heute früh miteinander diskutieren.«
»Stimmt.«
»Also, das kann man wohl kaum eine Diskussion nennen. Du hast mir gerade deinen Entschluß unterbreitet.«
»Vertrau mir, Liebes. Deine Großmutter weiß am besten, wie man sich in solchen Situationen verhält.«
Der Kaffee schmeckte plötzlich bitter. Amy wählte ihre Worte mit Bedacht, aber ihre Stimme klang vorwurfsvoll. »Das hast du auch gesagt, als du mich dazu überredet hast, das Astronomiestudium abzubrechen und diesen Computerjob anzunehmen.«
»Und es war genau das richtige. Die Kanzlei ist so begeistert von dir, daß sie bereit sind, dir dein Jurastudium zu finanzieren.«
»Es ist nicht die Kanzlei, die von mir begeistert ist, sondern Marilyn Gaslow. Und sie hat die Kanzlei nur deswegen dazu überredet, dieses Teilstipendium auszuspucken, weil sie und Mom gute Freundinnen waren.«
»Werd nicht zynisch, Amy. Sei realistisch. Mit einem Abschluß in Astronomie hättest du doch höchstens einen Job als High-School-Lehrerin bekommen können. Und auch das nur mit viel Glück. Als Anwältin wirst du zehnmal soviel verdienen.«
»Klar. Und mit Stilettoabsätzen und Stringtanga könnte ich noch viel mehr Geld –«
»Hör auf«, sagte Gran und hielt sich die Ohren zu. »Ich kann es nicht leiden, wenn du so redest.«
»Das sollte ein Witz sein, okay? Ich wollte dir nur etwas klarmachen.«
»Mit diesem Blödsinn kann man niemandem etwas klarmachen.« Gran ging in die Küche und schenkte sich noch eine Tasse Kaffee ein.
Amy seufzte. Sie lenkte ein, wie immer. »Tut mir leid. Man kriegt schließlich nicht jeden Tag einen Haufen Geld in einem Paket ohne Absender. Ich würde einfach gerne darüber reden.«
Gran setzte sich wieder hin, dann schaute sie Amy über den Tisch hinweg in die Augen. »Was meinst du denn, was wir tun sollen?«
»Ich weiß nicht. Sollen wir die Polizei anrufen?«
»Wozu? Es ist doch kein Verbrechen verübt worden.«
»Du meinst, keins, von dem wir wissen.«
»Amy, du überraschst mich. Wie bist du nur so negativ geworden? Kaum passiert etwas Gutes, glaubst du sofort, es muß was mit einem Verbrechen zu tun haben.«
»Ich ziehe einfach alle Möglichkeiten in Betracht. Ich nehme an, wir haben keine reichen Verwandten, von denen du mir noch nichts erzählt hast?«
Gran lachte. »Schätzchen, an unserem Familienstammbaum sind nicht mal die Blätter grün.«
»Du hast auch keine Freunde, die solche Summen verschenken könnten, oder?«
»Die Frage kannst du dir selbst beantworten.«
»Also, wenn das ein Geschenk ist, dann kommt es von jemandem, den wir nicht kennen, der noch nicht mal mit uns verwandt ist.«
»Schon möglich. Solche Dinge passieren.«
»Wann?«
»Immer wieder.«
»Nenn mir ein Beispiel.«
»Mir fällt gerade keins ein, aber so was gibt es. Irgend jemand, den du irgendwann mal kennengelernt hast. Du bist ein liebenswerter Mensch, Amy. Vielleicht hat sich mal ein reicher alter Herr unsterblich in dich verliebt, ohne daß du je was davon mitbekommen hast.«
Amy schüttelte den Kopf. »Das ist einfach zu absurd. Wir sollten die Polizei anrufen.«
»Wozu? Dann werden wir das Geld nie wiedersehen.«
»Wenn niemand einen Anspruch darauf erhebt, wird man es uns wahrscheinlich irgendwann zurückgeben.«
»So funktioniert das nicht«, sagte Gran. »Vor ein paar Jahren hab ich in der Zeitung einen Bericht über einen Pfarrer gelesen, der einen Koffer mit über einer Million Dollar am Straßenrand gefunden hatte. Er hat den Koffer zur Polizei gebracht in der Annahme, er würde ihn zurückbekommen, falls der Besitzer sich nicht meldet. Natürlich hat niemand Anspruch auf das Geld erhoben. Aber weißt du was? Die Polizei hat erklärt, es handle sich um Drogengeld, und sie haben es aufgrund dieser neuen Drogengesetze einfach konfisziert. Bis auf den letzten Penny. Und genauso wird es uns ergehen.«
»Ich mache mir einfach Sorgen. Wenn es nur uns beide beträfe, wäre ich vielleicht mutiger. Aber für Taylor würde ich mir ein bißchen mehr Schutz wünschen.«
»Schutz wovor?«
»Na ja, vielleicht ist es ja tatsächlich Drogengeld. Vielleicht hat es mir jemand aus Versehen geschickt. Er hat meinen Namen mit einem aus deren Verteilerkreis verwechselt, oder so was.«
»Das ist doch absurd.«
»Ach ja? Aber daß ein reicher alter Knacker in mich verschossen ist, ist vollkommen logisch, was?«
»Hör zu«, sagte Gran, »ich weiß nicht, wer dir das Geld geschickt hat, und auch nicht, warum. Ich weiß nur, daß er sich keinen netteren Menschen hätte aussuchen können. Also laß uns das Geld behalten und ein paar Wochen abwarten. Wir werden nichts davon ausgeben, jedenfalls vorerst nicht. Vielleicht kriegst du in ein paar Tagen einen Brief, der alles erklärt.«
»Vielleicht klopft morgen die Mafia an unsere Tür.«
»Vielleicht. Deswegen werden wir das Geld hier in unserer Wohnung aufbewahren.«
»Das ist verrückt, Gran. Wir sollten es wenigstens in einem Bankschließfach deponieren.«
»Schlechter Vorschlag. Du hast schon lange keine Nachrichten mehr gesehen, was? Wenn man kein Geld bei sich hat, hat man die besten Aussichten, bei einem Überfall erschossen zu werden. Das macht Räuber ziemlich wütend.«
»Was hat das mit unserer Sache zu tun?«
»Nehmen wir an, es waren Verbrecher, die dir das Geld aus Versehen geschickt haben. Nehmen wir an, sie kommen, um es zurückzuholen. Wir sagen, wir haben es nicht. Sie glauben, wir lügen. Sie drehen durch. Und schon hat eine von uns eine Kugel im Kopf.«
»Und wenn das Geld hier in der Wohnung ist, was machen wir dann?«
»Dann geben wir es ihnen zurück. Sie ziehen zufrieden ab, und wir leben weiter wie bisher. Die Chancen, daß es so schlecht ausgeht, sind wahrscheinlich gleich null. Aber falls das Schlimmste passiert, will ich mir nicht von irgendeinem wütenden Gangster sagen lassen, daß ich gerade versuche, ihn auszutricksen. Dann ist es am besten, wenn wir das Geld herausrücken und die Sache hinter uns bringen.«
Amy trank ihren Kaffee aus. Sie wandte sich nervös ab. Dann schaute sie Gran wieder an. »Ich weiß nicht.«
»Wir können gar nichts falsch machen, Amy. Wenn es ein Geschenk ist, sind wir reich. Wenn irgendwelche Gangster kommen und es wiederhaben wollen, geben wir es ihnen. Wir brauchen nur ein paar Wochen lang stillzuhalten, das ist alles.« Gran lehnte sich vor und berührte die Hand ihrer Enkelin. »Und wenn alles so läuft, wie ich es vermute, dann kannst du dein Astronomiestudium wiederaufnehmen.«
»Du weißt genau, wo meine Schwachstellen sind.«
»Du bist also einverstanden?«
Amy lugte mit verschmitzten Augen über ihre Tasse hinweg. »Wo willst du unsere Beute denn verstauen?«
»Sie befindet sich bereits im perfekten Versteck. Im Tiefkühlschrank.«
»Im Tiefkühlschrank?«
Gran grinste. »Wo sonst sollte eine verrückte alte Frau eine Schachtel voll Bargeld aufbewahren?«
4 Ryan verbrachte die Nacht in seinem alten Zimmer. Er schlief schlecht und wachte immer wieder auf.
Als einziger Arzt im Ort hatte Ryan seit drei Jahren keinen Urlaub mehr gehabt. Für diese Ausnahmesituation jedoch hatte er sämtliche Termine abgesagt und seine Patienten bis auf die dringendsten Notfällen an die Praxen der benachbarten Orte verwiesen.
Seit sieben Wochen wohnte er jetzt im Haus seiner Eltern. Seine Frau und er lebten getrennt, die Scheidung nach achtjähriger Ehe war nur noch reine Formsache. Ein klassischer Fall unerfüllter Erwartungen. Liz hatte als Kellnerin gejobbt, um sein Studium mitzufinanzieren, und gehofft, daß sich der Einsatz später bezahlt machen würde. Ryans Studienfreunde wohnten inzwischen alle in vornehmen Häusern mit Aussicht auf die Berge, vor der Tür einen dicken BMW. Ryan hatte seine Zeit als Assistenzarzt in der Chirurgischen Abteilung des Krankenhauses in Denver erfolgreich absolviert und hätte eine ähnlich lukrative Karriere einschlagen können. Er war jedoch nie daran interessiert gewesen, von den Segnungen der »wirtschaftlichen Behandlung« zu profitieren. Als Arzt von Gesundheitsbehörden und Ausschüssen für Kosten-Nutzen-Analyse dafür belohnt zu werden, daß er seine Patienten nicht behandelte, war nicht seine Sache. Entgegen den Wünschen seiner Frau war er in seinen Heimatort zurückgekehrt und hatte sich als Allgemeinmediziner niedergelassen. Er war der einzige Arzt im Ort. Die meisten seiner Patienten gehörten zu den Opfern des derzeitigen Gesundheitssystems – Kinder von unterbezahlten Arbeitern oder selbständigen Farmern, die zuviel verdienten, um in den Genuß der staatlichen Gesundheitsversorgung zu kommen, und zuwenig, um sich eine Krankenversicherung leisten zu können. Irgendwann hatte Liz ein Schild in der Praxis aufgehängt, auf dem stand: »BEHAND-LUNG NUR GEGEN VORKASSE«, aber Ryan drückte jedesmal ein Auge zu, wenn jemand die Rechnung nicht gleich bezahlen konnte. Als die offenen Rechnungen sich auf eine sechsstellige Summe beliefen, hielt Liz es nicht mehr aus. Ryan betrieb ein Wohlfahrtsunternehmen. Sie reichte die Scheidung ein.
Jetzt war er wieder zu Hause. Sein Vater lag im Sterben. Seine Frau zog gerade nach Denver um. Kindheitserinnerungen starrten von den Zimmerwänden auf ihn herab. Das Ende vor Augen, hatte er weder Zeit noch Lust, das Zimmer neu einzurichten, die Vergangenheit auszulöschen. Poster von Quarterback Roger Staubach und von den Super Bowl Cowboys bedeckten die Wände, Hinterlassenschaften eines Jungen, der hier vor beinahe dreißig Jahren seinen Träumen nachgehangen hatte. Was mochte wohl aus dem Poster von Farrah Fawcett geworden sein, das sie mit wallendem Haar und in einem knappen, roten Bikini zeigte? Es war weg, aber nicht vergessen.
Zeit der Unschuld, dachte Ryan. Heute kamen ihm die Dinge nicht mehr so unschuldig vor.
Es war 6.00 Uhr, und Ryan hatte kaum ein Auge zugetan. Immer wieder fragte er sich, ob es wirklich die Kombination aus Alkohol und Schmerzmitteln gewesen sein konnte. Das Gerede von Erpressung und einem Haufen Bargeld klang eher nach Halluzinationen. Aber sein Vater war so verdammt ernst gewesen.
Ryan mußte auf den Dachboden gehen und nachsehen.
Er schlüpfte aus dem Bett und zog sich Jeans, Sportschuhe und ein Polohemd an. Die Dielen knarrten unter seinen Füßen. Er bemühte sich, leise zu sein. Seine Mutter war sicherlich schon auf und saß am Bett seines Vaters. Der frühe Morgen gehörte ihnen allein. In der Stunde seines Todes würde sie bei dem Mann zu sein, mit dem sie seit fünfundvierzig Jahren verheiratet war. Keiner wollte ihr das nehmen.
Die Tür öffnete sich quietschend. Ryan spähte in den Flur. Es war kein Laut zu hören. Der Dachboden war durch eine Luke am Ende des Flurs zu erreichen. Wie ein Einbrecher schlich Ryan am Badezimmer und am Gästezimmer vorbei und blieb unter der Kette stehen, die von der Decke baumelte. Er zog daran. Die Luke öffnete sich wie das Maul eines Krokodils. Die starken Federn knarrten, als Ryan die Leiter aufklappte. Er zuckte zusammen bei dem lauten Geräusch, fürchtete, als nächstes die Stimme seiner Mutter zu hören. Doch es blieb still. Langsam und geräuschlos zog er die Leiter bis zum Boden aus und ließ sie einrasten. Dann holte er tief Luft und kletterte hinauf.
Sofort brach ihm der Schweiß aus. Die Hitze des vergangenen Tages schlug ihm entgegen. Die modrige Luft kitzelte in seiner Nase. Das Licht der fahlen Dämmerung fiel durch das kleine Ostfenster, ließ lange Schatten entstehen, Spinnweben aufleuchten. Ryan zog an der Lampenschnur, aber die Birne war ausgebrannt. Er wartete, bis seine Augen sich an das schwache Licht gewöhnt hatten.
Langsam nahm die Vergangenheit vor ihm Gestalt an. Vor fünfundzwanzig Jahren hatte Ryan mit seinen Freunden hier oben gespielt. Sarah, seine ältere Schwester, hatte ihnen immer hinterherspioniert. Sie war es gewesen, die das wie einen Schatz gehütete Playboy-Heft entdeckt hatte. Ryan konnte nicht sagen, ob Sarah sich in der Rolle des braven Mädchens gefiel oder ob sie es einfach nur genoß, wenn er bestraft wurde. Was würde Fräulein Scheinheilig wohl jetzt denken?
Mit jedem Schritt über den Dachboden kamen neue Erinnerungen. Seine erste Stereoanlage mitsamt den Schallplatten. Sie waren in der Hitze hier oben sicher längst geschmolzen. Die Klarinette seiner Schwester aus High-School-Orchesterzeiten. Während er all diese Dinge betrachtete, mußte er daran denken, daß er schon bald seine Aufgabe als Nachlaßverwalter seines Vaters würde antreten müssen – die Inventur der Habseligkeiten eines Mannes, der sein Leben lang als Lohnarbeiter gearbeitet hatte. Eine Kiste mit rostigem Werkzeug. Eine Angel. Stapelweise abgelegte Kleidungsstücke. Möbel, die sein Vater immer hatte reparieren wollen. Und, wenn das kein Witz war, zwei Millionen Dollar schmutziges Geld.
Es mußte einfach ein Witz sein.
Ryan blieb vor der alten Kommode stehen, die sein Vater ihm am Abend zuvor beschrieben hatte. Er schluckte; die Kommode bewies zumindest, daß sein Vater nicht vollkommen verwirrt war. Aber das bedeutete noch lange nicht, daß sich darunter das Geld befand.
Er versuchte, die Kommode wegzuschieben. Sie rührte sich nicht vom Fleck. Er schob kräftiger. Sie bewegte sich zwei Zentimeter weit, dann noch einen. Mit aller Kraft gelang es ihm, die Kommode um einen guten halben Meter zu verrücken. Er betrachtete den Fußboden. Die Dielen, auf denen die Kommode gestanden hatte, waren nicht festgenagelt. Ryan kniete sich hin und hob die losen Dielen an, unter denen sich eine dicke Schicht Glaswolle befand. Als er sie beiseite schob, kam ein Koffer zum Vorschein. Nicht die typische Art Urlaubskoffer. Dieser Koffer war aus Metall, wahrscheinlich feuerfest, wie die Exemplare, die man in Spezialläden für Spione kaufen konnte. Ryan hob den Koffer aus der Vertiefung und legte ihn vor sich auf den Boden. Er war mit einem Zahlenschloß versehen, aber die Schnappriegel waren nicht eingerastet. Offenbar hatte sein Vater die Zahlenkombination nicht verstellt, um es seinem Sohn leichter zu machen. Ryan ließ die Schlösser aufspringen und öffnete den Koffer. Beim Anblick des Inhalts traten ihm fast die Augen aus dem Kopf.
»Ach du Scheiße!«
Da war das Geld, genau wie sein Vater es gesagt hatte. Ryan hatte noch nie im Leben zwei Millionen Dollar gesehen, aber die sauberen Bündel von Hundertdollarnoten konnten gut und gerne dieser Summe entsprechen.
Vorsichtig fuhr er mit den Fingern über die Geldscheine. Obwohl er nie nach Geld gegiert hatte, lief ihm beim Betrachten und Berühren von so viel Barem ein Schauer über den Rücken. Als er gestern Nacht in seinem Bett wach lag, hatte er versucht, über einen Traum in den Schlaf zu gleiten. Er hatte sich einfach vorgestellt, er hätte das Geld tatsächlich gefunden und müßte sich nun überlegen, was er damit anfangen sollte. Immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, wie unwahrscheinlich die ganze Sache war, hatte er beschlossen, alles für wohltätige Zwecke zu spenden. Mit den Früchten eines Verbrechens wollte er nichts zu tun haben. Auch dann nicht, wenn der Mann es nach der Aussage seines Vaters verdient hatte, erpreßt zu werden. Bei all den grünen Scheinen aber, die ihn nun anlachten, waren die Dinge nicht mehr ganz so eindeutig. Wenn er sich nicht in den Dienst einer armen Gemeinde gestellt hätte, hätte er in einer normalen, gutgehenden Arztpraxis leicht soviel Geld verdienen können. Vielleicht war das Gottes Entschädigung für seine guten Taten.
Krieg dich wieder ein, Duffy.
Er machte den Koffer zu, legte ihn zurück an seinen Platz und bedeckte ihn mit der Glaswolle und den Bodendielen. Dann schob er die schwere Kommode wieder an die Stelle, wo sie gestanden hatte. Eilig ging er auf die Luke zu. Mit dem Geld würde er sich später befassen. Nach der Beerdigung.
Nach einem letzten Gespräch mit seinem Vater.
Ryan kletterte die Leiter hinunter in den Flur. Sein Hemd war schmutzig und schweißnaß. Er schlüpfte ins Bad und klatschte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Sein Hemd warf er in den Wäschekorb, dann ging er in sein Zimmer, um sich ein frisches zu holen. Am Treppenabsatz blieb er stehen. Er meinte, seine Mutter im Wohnzimmer schluchzen zu hören. Er hastete die Treppe hinunter. Sie saß allein auf dem Sofa, in sich zusammengesunken, in Morgenmantel und Hausschuhen.
»Was ist los, Mom?«
Sie schaute auf, und er begriff.
Er setzte sich neben sie und nahm sie in die Arme. Sie war schon immer schmal gewesen, aber sie war ihm noch nie so zerbrechlich vorgekommen.
Sie zitterte am ganzen Körper. »Er war so … friedlich«, sagte sie stockend. »Sein Atem. Sein Blick. Auf einmal war es einfach zu Ende.«
»Es ist alles gut, Mom.«
»So, als wäre er bereit gewesen«, schniefte sie. »Als hätte er beschlossen, daß es Zeit war.«
Ryan spürte, wie Wut in ihm aufstieg. Als wollte er lieber sterben, um mit seinem Sohn nicht noch einmal unter vier Augen reden zu müssen.
Seine Mutter zitterte in seinen Armen, sie ließ ihren Tränen freien Lauf. Er hielt sie ganz fest und wiegte sie sanft. »Keine Sorge«, flüsterte er, mehr zu sich selbst. »Ich werde mich um alles kümmern.«
5 Amy hatte sich den Montagmorgen freigenommen. Sie betrat die Kanzlei erst gegen Mittag. Nachdem sie sechs Tage am Stück gearbeitet und dreitausend Meilen zurückgelegt hatte, um die verschiedenen Niederlassungen der Sozietät aufzusuchen, nachdem sie sich von in Panik geratenen Anwälten unablässig hatte beschimpfen lassen müssen, hatte sie sich ein paar Stunden mit ihrer Tochter verdient.
In Boulder befanden sich die Büroräume von Bailey, Gaslow & Heinz in den oberen drei Stockwerken eines Gebäudes auf der Walnut Street. Boulder war mit dreiunddreißig Anwälten die zweitgrößte Niederlassung der Sozietät, wenn auch weit kleiner als die in Denver, der hundertvierzig Anwälte angehörten. Die Kanzlei brüstete sich damit, daß sie dieselbe Erfolgsquote und die gleiche Anzahl abrechenbarer Stunden pro Anwalt erzielte wie ihre Kollegen in Denver. Das war der Mindeststandard des neuen Kanzleichefs, eines waschechten Workaholics, der aus Denver nach Boulder gekommen war, um den Laden auf Vordermann zu bringen.
»Morgen«, sagte Amy, als sie im Korridor an einem Kollegen vorbeihastete. Sie holte sich eine Tasse Kaffee aus der Kantine und eilte dann an ihren Arbeitsplatz. Als sie daran dachte, daß sich mittlerweile die Arbeit einer ganzen Woche auf ihrem Schreibtisch stapelte, hatte sie regelrecht Angst davor, die Tür zu ihrem Büro zu öffnen.
Ihr Büro war klein, aber Amy war außer den Anwälten die einzige in der Kanzlei, deren Zimmer ein Fenster besaß. Und obendrein ein Fenster mit Aussicht. Marilyn Gaslow hatte alle Register gezogen, damit sie dieses Zimmer bekam. Marilyn war Anwältin und eine einflußreiche Teilhaberin der Sozietät, sie arbeitete jedoch außerhalb von Denver. Ihr Großvater war der »Gaslow« in Bailey, Gaslow & Heinz. Er hatte vor über hundert Jahren die Sozietät mitbegründet. Marilyn und Amys Mutter waren seit der High-School miteinander befreundet – bis zu ihrem Tod waren sie beste Freundinnen gewesen. Marilyn war es gewesen, die Amy den Job als Computerexpertin besorgt hatte, und Marilyn hatte die Kanzlei dazu bewegt, die Hälfte der teuren Studiengebühren zu zahlen, falls Amy Jura studieren wollte. Die einzige Bedingung war, daß Amy nach Abschluß ihres Studiums als angestellte Anwältin in die Firma eintrat und ihre wertvolle Ausbildung der in Umweltrecht international renommierten Sozietät zur Verfügung stellte. Offiziell zumindest war das die einzige Bedingung. Seit Amy das Angebot akzeptiert hatte, wurde sie ausgebeutet wie eine Sklavin.
Sie setzte sich an ihren Schreibtisch und schaltete den Computer ein. Während der vergangenen Woche hatte sie ihre e-mails regelmäßig abgerufen, auch wenn sie sich nicht in ihrem Büro befand, aber es waren schon wieder neue Nachrichten da. Eine war von Marilyn, von heute morgen. Sie lautete: »Braves Mädchen. Verdammt gute Arbeit!«
Amy lächelte. Wenigstens einer der zweihundert Anwälte der Firma bedankte sich dafür, daß sie das Computersystem gerettet hatte. Aber da es von Marilyn kam, von der alten Freundin ihrer Mutter, bedeutete es irgendwie nicht ganz soviel. Sie klickte die nächste virtuelle Post auf ihrem Bildschirm an. Sie kam von Jason Phelps, dem Chef der Schadensersatzabteilung in Boulder. Ein Lob von ihm wäre etwas ganz anderes. Begierig öffnete sie die mail.
MELDEN SIE SICH BEI MIR! las Amy. Das war alles.
Sie schaute vom Bildschirm auf und fuhr zusammen. Er stand in der Tür und musterte sie mit finsterem Blick. »Mr. Phelps – guten Morgen, Sir. Ich meine, guten Tag.«
»Ja, es ist nach Mittag. Ich nehme an, Timmy hatte heute morgen ein wichtiges Tennisspiel, was?«
Amy drehte sich der Magen um. Es spielte keine Rolle, wie viele Nächte und Wochenenden sie durcharbeitete. Es spielte keine Rolle, wie oft sie im Auftrag der Kanzlei unterwegs war. Bei einer alleinerziehenden Mutter gab vorübergehende Abwesenheit vom Arbeitsplatz jedesmal Anlaß zu negativen Schlußfolgerungen.
»Sie heißt Taylor«, erwiderte sie kühl. »Und sie spielt nicht Tennis. Ihre Mutter hätte nämlich gar keine Zeit, sie zu den Spielen zu begleiten.«
»Ich brauche das gemeinschaftliche Verteidigungskonzept für den Wilson Superfonds-Prozeß bis spätestens drei Uhr. Keine Minute später.«
»Ich muß mich durch die Management Informationsdienste von sechs Niederlassungen arbeiten. Sie wollen es in zwei Stunden?«
»Ich wollte es gestern. Heute brauche ich es. Es ist mir scheißegal, wie Sie es schaffen, aber sehen Sie zu, daß Sie es schaffen.« Er hob eine seiner buschigen grauen Augenbrauen, dann drehte er sich um und ging.
Amy sank in ihren Schreibtischsessel. Es ging wieder genauso los wie vor einer Woche. Ich hätte die größte Lust, mit deinem Kopf Tennis zu spielen, du Blödmann.
Am liebsten hätte sie ihm das ins Gesicht gesagt. Aber dann würde er garantiert dafür sorgen, daß die Firma die finanzielle Unterstützung ihrer zukünftigen Ausbildung wieder streichen würde. Dann konnte sie sich ihr Jurastudium aus dem Kopf schlagen. Und diesen Horrorjob wäre sie auch los.
»Mein Leben macht mich fertig«, murmelte sie. Sie fragte sich, warum sie sich mit all dem abfand, aber sie kannte die Antwort. Ihr Exmann erinnerte sie regelmäßig alle zwei, drei Monate daran. Er rief an und erbot sich scheinheilig, die Hälfte von irgendwas für Taylor zu finanzieren, wenn Amy die andere Hälfte übernahm. Manchmal war er regelrecht schäbig. Einmal zum Beispiel hatte er Taylor erzählt, er würde sie mit Amy in die Ferien nach Hawaii schicken, wenn Mommy nur die Hälfte bezahlte. Daraufhin war Taylor eine Woche lang mit einer Kette aus Plastikblüten um den Hals und einer Sonnenbrille auf der Nase im Haus herumgesprungen, bis Amy ihr diese Flausen ausgetrieben hatte. Manchmal legte er es auch nur darauf an, Amy zu verhöhnen, zum Beispiel mit seinem stehenden Angebot, zehntausend Dollar als Grundstock für Taylors Ausbildung anzulegen, wenn Amy die andere Hälfte beisteuerte. Solche Dinge – Dinge, die Taylors Zukunft betrafen – ließen Amy wünschen, sie wäre in der Lage, es einfach drauf ankommen zu lassen.
Vielleicht war sie das ja jetzt.
Ein diebisches Lächeln erhellte ihr Gesicht. Sie nahm den Hörer ab und wählte die Nummer von Teds Büro. Seine Sekretärin meldete sich.
»Tut mir leid«, sagte sie. »Er ist in einer Besprechung. Kann ich ihm etwas ausrichten?«
Sie hatte die Nachricht schon auf der Zunge, und beinahe wäre es ihr herausgerutscht: Taylor geht nach Yale. Dann bezahl mal die Hälfte davon, du Großmaul. Aber es war noch zu früh. Das Geld gehörte ihr nicht. Noch nicht.
»Nein, danke.« Sie legte auf und kehrte in die Realität zurück.
Sie warf einen Blick auf die Uhr. Um Mr. Phelps’ Termin um drei Uhr einzuhalten, müßte sie sich selbst klonen. Sie holte tief Luft und setzte sich wieder an ihren Computer. Aber nicht, um an ihrem Auftrag für Phelps zu arbeiten. Auf ihrem Bildschirm erschien ein Programm zum Erstellen von Finanzierungsplänen.
Sie lächelte schwach, als der Computer ihr die Zinsen für zweihunderttausend Dollar ausrechnete.
Die Beerdigung fand am Dienstag in der katholischen Kirche St. Edmund’s statt. Weder Ryan noch seine Schwester waren regelmäßige Kirchgänger. Ihre Eltern dagegen hatten in den letzten vierzig Jahren fast keinen Gottesdienst verpaßt. Hier in dieser Kirche hatten Frank und Jeanette Duffy sich das Ehegelöbnis gegeben. Hier waren ihre beiden Kinder getauft worden und zur Erstkommunion gegangen, und Sarah hatte hier sogar geheiratet. In der letzten Reihe auf der Empore hatte einer der anderen Meßdiener Ryan eröffnet, wo die Babys wirklich herkamen. Hinter den schweren Eichentüren in der Seitenkapelle hatte Ryan regelmäßig bei dem alten irischen Priester mit der Trinkernase gebeichtet. »Segne mich, Vater, denn ich habe gesündigt …«
Ryan fragte sich, wann sein Vater zum letztenmal zur Beichte gegangen war. Und was er wohl gebeichtet haben mochte.
St. Edmund’s war ein altes Gotteshaus aus Stein, im Stil einer spanischen Missionskirche erbaut. Aber der Ort war keine echte spanische Missionsstation gewesen. Auf ihrer Suche nach den mythischen Sieben Goldenen Städten hatten die spanischen Eroberer sich nicht die Mühe gemacht, so weit nach Osten bis in die Ebenen von Colorado vorzudringen. In Orten wie San Luis Valley und Sangre de Cristo Mountains im Südwesten und im Süden von Colorado gab es viele Dinge, die an die legendäre Jagd nach dem puren Gold erinnerten. Aber die Spanier schienen ihre Suche überall dort aufgegeben zu haben, wo sie auf Flachland stießen. Irgendwie mußten die Konquistadoren des sechzehnten Jahrhunderts geahnt haben, daß in Piedmont Springs keine Reichtümer zu finden waren.
Hätten sie bloß auf dem Dachboden von Frank Duffy nachgeschaut.
Ryan fröstelte. In der Kirche war es kalt, selbst im Juli. Dunkle Bleiglasfenster hielten das Sonnenlicht ab. Der Duft nach Weihrauch hing über dem Sarg im Mittelgang und stieg in die steinernen Bögen auf. Der Trauergottesdienst war gut besucht. Frank Duffy hatte eine Menge Freunde. Von denen ahnte offenbar niemand, daß er ein Erpresser gewesen war, der irgend jemanden um zwei Millionen Dollar erleichtert hatte. Schwarzgekleidete Trauergäste füllten dreißig Kirchenbankreihen zu beiden Seiten des Mittelgangs. Pfarrer Marshall las die Messe mit ernstem Gesichtsausdruck und ganz in Violett gewandet. Ryan saß in der ersten Reihe neben seiner Mutter. Zu seiner Linken saßen seine Schwester und sein Schwager. Liz, seine Exfrau, war »verhindert«.
Die Orgelmusik hörte abrupt auf. Eine drückende Stille breitete sich in der Kirche aus, nur unterbrochen vom gelegentlichen Quäken eines ungeduldigen Kindes. Ryan faßte nach der Hand seiner Mutter, als sein Onkel die Kanzel betrat, um eine Ansprache zu halten. Onkel Kevin war kahlköpfig und übergewichtig; er war herzkrank, was ihn eigentlich dazu prädestiniert hätte, vor seinem jüngeren Bruder das Zeitliche zu segnen. Ihn schien Frank Duffys Tod besonders unverhofft getroffen zu haben.
Er rückte das Mikrophon zurecht und räusperte sich. »Ich habe Frank Duffy geliebt«, sagte er mit zittriger Stimme. »Wir alle haben ihn geliebt.«
Ryan hätte ihm gern zugehört, doch seine Gedanken schweiften ab. Seit Monaten hatten sie gewußt, daß dieser Tag kommen würde. Es hatte mit einem Husten angefangen, das Dad als Begleiterscheinung seines chronischen Lungenemphysems abgetan hatte. Dann war die krankhafte Veränderung am Kehlkopf entdeckt worden. Anfangs hatten sie befürchtet, Dad würde seine Stimme verlieren. Frank Duffy hatte ein reges Mundwerk besessen. Er war immer derjenige, der auf den Partys Witze erzählte und an der Bar am lautesten lachte. Es wäre eine grausame Ironie des Schicksals gewesen, wenn er seine Stimme verloren hätte – wie ein Maler, der erblindet, oder ein Musiker, der taub wird. Die krankhafte Veränderung des Kehlkopfs war jedoch nur die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs gewesen. Der Krebs hatte bereits Metastasen gebildet. Die Ärzte gaben ihm noch zwei oder drei Monate. Seine Stimme hatte er behalten – jedenfalls bis zum Ende, bis sein Schamgefühl ihn endgültig zum Schweigen gebracht hatte. Sein Tod hatte seine eigene Ironie.
Ryan konzentrierte sich wieder auf die Rede seines Onkels. »Mein Bruder hat sein Leben lang hart gearbeitet, er war der Typ, der nervös wurde, wenn der Einsatz beim Poker fünfzig Cent überstieg.« Onkel Kevins Lächeln erstarb, und er wurde wieder ernst. »Aber Frank war auf andere Weise reich, er hatte Humor und war mit einer liebevollen Familie gesegnet.«
Ryan spürte nur Leere. Die liebevollen Erinnerungen seines Onkels berührten ihn nicht. Angesichts der zwei Millionen Dollar auf dem Dachboden wirkten sie regelrecht verlogen.
Er hörte seine Tante in der zweiten Reihe schluchzen. Viele der Trauergäste waren zu Tränen gerührt. Ryan schaute seine Mutter an. Keine Tränen hinter dem schwarzen Schleier, stellte er verwundert fest. Ihr Gesicht war wie versteinert. Kein Anzeichen von Trauer oder Schmerz. Natürlich hatte sich die Krankheit lange hingezogen. Wahrscheinlich hatte sie alle ihre Tränen schon geweint.
Oder konnte es sein, überlegte Ryan,