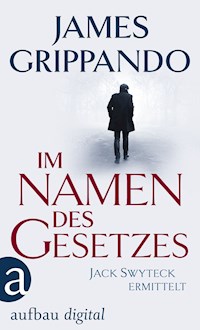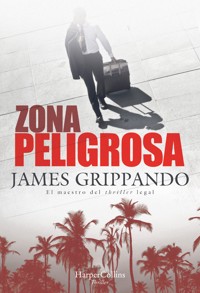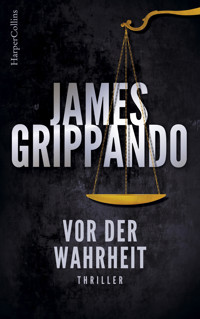9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: James Grippando Thriller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
FBI-Agentin Andie ermittelt in einem verzwickten Fall: gesucht wird ein Serienmörder, der seine Opfer erhängt. Die beiden ersten Opfer gleichen sich wie ein Haar dem anderen, haben aber ansonsten scheinbar nichts miteinander zu tun. Da meldet Erfolgsanwalt Gus Wheatly seine Frau Beth als vermisst.
Und das dritte Opfer des Killers wird entdeckt: weiblich, jung, gut aussehend. Sehr bald stellt sich heraus, dass es sich nicht um Gus' Frau handelt. Doch wo ist sie? Und wann wird der Killer wieder zuschlagen?
Andie und Gus machen sich auf die fieberhafte Suche ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 620
Ähnliche
Über das Buch
FBI-Agentin Andie ermittelt in einem verzwickten Fall: gesucht wird ein Serienmörder, der seine Opfer erhängt. Die beiden ersten Opfer gleichen sich wie ein Haar dem anderen, haben aber ansonsten scheinbar nichts miteinander zu tun … Da meldet Erfolgsanwalt Gus Wheatly seine Frau Beth als vermisst.
Und das dritte Opfer des Killers wird entdeckt: weiblich, jung, gut aussehend. Sehr bald stellt sich heraus, dass es sich nicht um Gus’ Frau handelt. Doch wo ist sie? Und wann wird der Killer wieder zuschlagen?
Andie und Gus machen sich auf die fieberhafte Suche …
Über James Grippando
James Grippando ist Autor diverser New York Times-Bestseller. Er arbeitete zwölf Jahre als Strafverteidiger bevor sein erstes Buch »Im Namen des Gesetzes« 1994 veröffentlicht wurde und ist weiterhin als Berater für eine Kanzlei tätig. Er lebt mit seiner Familie im Süden Floridas.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
James Grippando
Im Schutz der Dunkelheit
Roman
Aus dem Amerikanischen von Norbert Möllemann
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Teil 2
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Teil 3
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Teil 4
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Teil 5
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Herbst
Danksagung
Impressum
Prolog
Die Schlinge war außerordentlich sorgfältig vorbereitet. Ein zu großer Knoten, der an der falschen Stelle saß, konnte das Fleisch an Gesicht und Hals zerfetzen. Zu viel Schnur und eine zu große Fallhöhe konnten zu einer Enthauptung führen.
Ein Seil um den Hals ließ wenig Raum für einen Fehler.
Er band die Schlaufe zu einem Gleitknoten, anders als bei der klassischen Schlinge. Die klassische Variante würde eine rasche Exekution zur Folge haben, bei der das zu einem langen Knoten aufgewickelte Seil gegen den Hinterkopf schlägt und das Opfer sofort bewusstlos macht, ähnlich wie bei einem Hieb mit einem Totschläger. Das Genick würde brechen und Knochensplitter würden das Rückenmark zerquetschen. Das Resultat: völlige Lähmung und, theoretisch, ein schmerzloser Tod. Theoretisch. Seit Jahrhunderten hatten Augenzeugen immer wieder bestätigt, dass der Tod nie wirklich schmerzlos war. Sie berichteten von verzerrten Gesichtern, von wild zuckenden Körpern am Ende des Seils, von aufgerissenen Mündern, die vergeblich nach Luft schnappen. Manche behaupteten, dass es sich dabei lediglich um einen Reflex handle, wie bei einem Huhn, das buchstäblich kopflos über den Hof rast. Andere beharrten darauf, der Schmerz sei real, selbst bei einer »sauberen Exekution« durch den Strang.
An diesem Nachmittag war die alte Debatte unwichtig. Das hier sollte kein »sauberer« Vorgang werden. Er hatte etwas anderes vor.
Das gelbe Plastikseil war zweieinhalb Meter lang und knapp zwei Zentimeter dick. Er hatte es von einer Baustelle gestohlen, die eineinhalb Kilometer von ihm zu Hause entfernt lag. Es durchzuschneiden war ihm vorgekommen, als müsste er ein Stahlseil durchsägen. Mit einem Seil dieser Stärke konnte man fünf oder sechs Wasserski gleichzeitig ziehen oder Baumstümpfe aus dem Boden reißen, mit Wurzeln und allem Drum und Dran.
Ganz bestimmt konnte es das Gewicht eines fünfzehnjährigen Jungen aushalten.
Mit dem Seil in der Hand kletterte er auf die Trittleiter und wäre beinahe über seinen ausgefransten Hosenaufschlag gestolpert. Die ausgebeulten Jeans und der baumwollene Rollkragenpullover waren sein Markenzeichen. Er war bei weitem der Intelligenteste seiner Jahrgangsstufe an der Highschool, auch wenn seine Zeugnisse nur durchschnittlich waren, und er sah aus wie fast alle anderen Jungs an der Schule. Dünn und schlaksig. Mit Füßen so groß, dass er wie ein wandelndes L wirkte. Jede Menge Pickel im Gesicht ließen das Einsetzen der Pubertät erkennen. Ein paar kostbare Gesichtshaare deuteten einen Schnurrbart an.
Durch das beschlagene Garagenfenster warf er einen Blick nach draußen. Ein am Fensterrahmen befestigtes Thermometer zeigte zehn Grad Celsius an – ziemlich warm für das Ende des Winters, aber irgendwie schien es in der Garage kälter als draußen. Sein Blick wanderte zum Dachsparren und machte Halt an einer Stahlrolle, deren Halterung an der Holzdecke festgeschraubt war. Vorsichtig schob er das Seil nach oben und führte es über die Rolle. Zwei Enden von eins zwanzig Länge baumelten von oben herab und hingen wie Rattenschwänze über seiner einfachen Vorrichtung. Am einen Ende befand sich die Schlinge. Das andere Ende war ausgefranst und ungeknotet. Er zog daran. Die Rolle quietschte und die Schlinge bewegte sich langsam nach oben. Alles war betriebsbereit.
Er holte tief Luft und legte sich die Schlinge um den Hals.
Unvermittelt stürmten die Eindrücke seiner Umgebung auf seine Sinne ein; ganz plötzlich nahm er alles um sich herum wahr, als wohnten dem Seil magische Kräfte inne. Der Regen trommelte rhythmisch auf das alte Dach und gegen die Garagentür. Eine Neonlampe summte neben der Werkbank an der Wand. Motorenöl aus dem abgewrackten alten Buick seines Vaters hatte sich auf dem rissigen Betonboden verteilt. Auf der Trittleiter stand er gerade einmal einen halben Meter über dem Fußboden, aber es kam ihm viel höher vor. Er fühlte sich an die Bungee-Springer erinnert, die er bei einer dieser Nervenkitzel-Shows im Fernsehen gesehen hatte, deren Fußgelenke an einem langen elastischen Band befestigt waren und deren Augen vor Aufregung leuchteten, als sie sich von irgendeiner Brücke in einen Canyon stürzten.
Die sollten das hier erst mal ausprobieren, dachte er.
Er schlug den Rollkragen hoch und legte ihn eng an seinen Hals, bis hinauf zum Kinn. Das schützende Gewebe musste rundherum unter die Schlinge geschoben werden, so dass das Seil an keiner Stelle die empfindliche Haut des Halses berührte. Blaue Flecken ließen sich nicht vermeiden, aber er hatte gelernt, Brandblasen, die das Seil verursachen konnte, zu verhindern.
Er verschob den Gleitknoten so weit, dass sich die Schlinge fest um seinen Hals zog. Sofort fühlten sich seine Füße leichter, obwohl er immer noch fest auf der Trittleiter stand. Bei jedem Schlucken drückte das Seil gegen seinen Adamsapfel. Er befeuchtete seine Lippen und griff mit beiden Händen das lose Ende des Seils. Langsam begann er zu ziehen.
Die Rolle quietschte. Das Seil straffte sich. Die Schlinge umfasste seinen Hals und kippte seinen Kopf nach hinten. Seine Fersen hoben sich von der Trittfläche. Er stand auf seinen Zehenspitzen.
Er zog weiter.
Er hörte sich selbst aufstöhnen. Sein Blick verschwamm. Sein Stöhnen ging in Keuchen über. Er zog wieder, und noch einmal, Hand über Faust. Seine Zehen reckten sich instinktiv zum Fußboden hin, aber der war außer Reichweite. Jetzt hing er am Hals in der Luft.
Wir haben abgehoben!
Er fasste das Seil fester. Seine Beine strampelten. Seine Gliedmaßen befanden sich im Kriegszustand: Die Füße wollten zurück auf den Boden, die Hände wollten aber das Seil nicht loslassen.
Die Schlinge funktionierte perfekt. Durch die Arterien pumpte das Herz weiterhin Blut in den Hals und in den Kopf. Die Venen jedoch waren völlig abgeklemmt, so dass das Blut nicht zurückfließen konnte, was zu Druck auf das Gehirn führte. Vom Blutstau pochte ihm der Kopf wie bei den allerschlimmsten Kopfschmerzen. Die Augen traten aus den Höhlen. Das Gesicht lief rot an. Er konnte Blut schmecken, als es in der feuchten, weichen Schleimhaut der Lippen und der Mundhöhle zu kleinen Blutungen kam.
Und dann stellte es sich ein – das bizarre Gefühl, wenn Schließmuskel sich unkontrollierbar verkrampften und entspannten. Es war eine von drei ihm bekannten Möglichkeiten, zu einer Erektion zu kommen, sogar zum Orgasmus. Schlaf. Sex. Und Erhängen.
Seine Augen schlossen sich. Alles wurde schwarz. Der tödliche Griff ließ nach. Die Rolle quietschte, als das losgelassene Seil zurückjagte. Der schlaffe Körper plumpste auf den Boden und warf dabei die Trittleiter um.
Instinktiv erhob er sich auf die Knie und löste die Schlinge. Er hustete zweimal und schnappte nach Luft. Seine Brust schwoll an und seine hageren Schultern hoben und senkten sich unwillkürlich. Nach und nach wich die Dunkelheit verschwommener Wahrnehmung. Sein Blick wurde wieder klar.
»He! Was zum Teufel geht da draußen vor sich?«
Es war sein Vater, der aus dem Haus brüllte. Er brüllte immer. Das letzte Mal, dass sie ein normales Gespräch geführt hatten, musste irgendwann vor dem Tod seiner Mutter gewesen sein, bevor ihr halbwüchsiger Sohn ihre schlaffe Leiche entdeckt hatte, wie sie auf dem Dachboden ihres alten Hauses von der Decke baumelte.
»Nichts.« Seine Stimme klang schrill und das lag nicht am Stimmbruch.
»Wenn du irgendwas kaputtmachst, setzt es eine Tracht Prügel.«
Sein Alter verdarb ihm den Spaß, deshalb blendete er ihn aus seinem Bewusstsein aus, während er sich in eine gebückte Haltung erhob, die Hände auf die Knie gestützt, und nach Luft rang. Das Gefühl war besser als das Hochgefühl eines Langstreckenläufers, besser als jeder Endorphinrausch. Hätte er einen Kumpel dagehabt, hätte er ihn abgeklatscht. Aber seine Freunde würden das nie verstehen. Sollten sie ruhig glauben, die Druckstellen an seinem Hals wären Knutschflecken. Solche Erlebnisse würde er vorerst ganz allein auskosten.
Er hob das Seil auf und löste die Schlinge. Er hatte es schon mehrmals benutzt. Er würde es wieder benutzen. Übung macht den Meister, hatte seine Mutter immer gesagt. Er war eindeutig auf dem Wege, ein Meister zu werden. Irgendwann würde er derjenige sein, der anderen den Weg weisen würde. Weil er dort gewesen war. Viele Male.
Und er kannte den Weg zurück.
Teil 1 Vierzehn Jahre später
1
Der Regen war ein Vorzeichen für Glück und Freude.
Andrea Henning hat dieses Ammenmärchen heute schon mindestens dreißig Mal gehört. Hatte Mr Gallup jemals eine Umfrage durchgeführt, um herauszufinden, ob die Scheidungsrate bei Paaren, die an sonnigen Tagen heirateten, tatsächlich höher lag als bei jenen, die auf dem Weg zum Altar durch Pfützen stapfen mussten? Nicht dass das wirklich wichtig gewesen wäre. Dass es bei dieser Hochzeit regnen würde, war vorhersehbar gewesen. Schließlich neigte sich der Winter in Seattle dem Ende zu.
Andie – niemand nannte sie »Andrea« – ließ sich weder vom Wetter noch von all den anderen Dingen, über die sich eine Braut normalerweise den Kopf zerbricht, aus der Ruhe bringen. Vielleicht war das auf ihre Ausbildung zur FBI-Agentin zurückzuführen, vielleicht lag es aber auch an dem ihr eigenen gesunden Menschenverstand. Immer, wenn irgendetwas außer Kontrolle geriet, nahm Andie die Sache kurz entschlossen in die Hand, meist mit positivem Ausgang. Ihre Blitzdiät war eine Katastrophe gewesen, trotzdem saß ihr Kleid perfekt. Der Trauzeuge war zwar ein Idiot, aber wenigstens hatte er an die Papiere gedacht. Und die alte von Kerzen erleuchtete Kirche hatte nie besser ausgesehen. Mit Spitze und rosafarbenen Bändern geschmückte Gestecke aus weißen Rosen zierten die Kirchenbänke. Im Mittelgang war ein langer weißer Läufer von der Vorhalle bis zum Altar ausgelegt. Die Menge hatte sich links und rechts gleichmäßig verteilt und wurde von sanften Harfenklängen eingelullt, als die letzte der vier Brautjungfern den Mittelgang entlang auf den Altar zuschritt. Regen hin oder her, das war die Hochzeit, von der zu träumen ihre Mutter ihr beigebracht hatte.
Andie trat durch die offene Doppeltür in die Kirche. Ihre beste Freundin trug die seidene Schleppe hinter ihr her.
Vorn am Altar wartete der grauhaarige Pfarrer, zu seiner Rechten flankiert von Brautjungfern in roten Samtkleidern. Zu seiner Linken standen drei junge Brautführer und Andies gut aussehender Ehemann in spe. Rick war seine Nervosität schon von weitem anzusehen. Seine stahlblauen Augen glänzten. Sie waren fast schon glasig – wahrscheinlich von dem Trinkgelage, das ihm seine Freunde in der Nacht zuvor aufgenötigt hatten. Der geliehene Smoking schien um Brust und Schultern zu spannen, was vielleicht daran lag, dass er gerade tief Luft holte. In Jeans hätte er sich erheblich wohler gefühlt. Andie ging es ebenso.
Die Harfenmusik klang aus. Die Gäste verstummten. Alle Köpfe wandten sich zum Eingang der Kirche um.
Andie nahm den Arm ihres Vaters. Obwohl er einen halben Kopf kleiner war als sie, war er durch nichts zu erschüttern – normalerweise. Aber in diesem Moment spürte sie, wie seine Hände zitterten.
»Bist du bereit?«
Sie gab keine Antwort. Es war so weit.
Die Orgel dröhnte los. Andie zuckte zusammen. Sie hatte den Organisten ausdrücklich angewiesen, nicht den traditionellen Hochzeitsmarsch zu spielen. Ihre übereifrige Mutter hatte mal wieder zugeschlagen.
Am Arm ihres Vaters schritt Andie den Mittelgang entlang.
Ein Blitzlicht blendete sie. Dann noch eins. Es war, als würde sie in eine Stroboskoplampe starren. Wenn das so weiterging, würde sie in diesem Jahr nicht nur eine gemeinsame Steuererklärung ausfüllen, sondern auch bei der Frage: »Sind Sie blind?«, das Kästchen vor dem Ja ankreuzen müssen. Andie konzentrierte sich auf die brennenden Kerzen auf dem Altar.
Freunde und Verwandte strahlten, als sie an ihnen vorüberschritt. Sie gaben ihr das Gefühl, schön zu sein, auch wenn man ihr das schon ihr ganzes Leben lang gesagt hatte. Sie hatte natürlich keinerlei Ähnlichkeit mit ihren Adoptiveltern. Sie hatte die ausgeprägten Wangenknochen und das tiefschwarze Haar ihrer indianischen Mutter, die sie nie gekannt hatte. Die dunkelgrünen Augen stammten wahrscheinlich von einem angelsächsischen Vater. Das Ergebnis war bemerkenswert, eine exotische Mischung verschiedenster Erbanlagen.
Auf halbem Wege zum Altar verlangsamte Andie ihren Schritt. Ihr nervöser Vater ging viel zu schnell. Seine Hand schwitzte in ihrer. Sie drückte sie kurz. Schließlich blieben sie nebeneinander vor dem Pfarrer stehen. Die laute Orgelmusik verstummte.
Andie spürte ein Kribbeln in der Magengegend. Der Pfarrer bedeutete den Anwesenden, Platz zu nehmen. Nur leises Schlurfen war zu vernehmen, als zweihundert Gäste sich auf den Eichenbänken niederließen. Als Ruhe eingekehrt war, fragte der Pfarrer mit lauter Stimme: »Wer gibt die Braut frei?«
Die Frage hallte zwischen den gotischen Steinbögen wider.
Andies Vater musste schlucken. »Ihre Mutter und ich geben sie her.«
Andie erkannte die zittrige Stimme kaum wieder. Er hob ihren Schleier und küsste sie auf die Wange. »Ich liebe dich«, flüsterte sie.
Er brachte kein Wort heraus. Er drehte sich um und nahm neben seiner Frau in der vordersten Kirchenbank Platz.
Andie ging die beiden Marmorstufen hinauf. Der Bräutigam reichte ihr seine Hand. Doch sie drehte sich um und wandte sich den Gästen zu. Sie holte tief Luft und setzte selbstbewusst zu einer Rede an. »Ich weiß, dass das ungewöhnlich ist. Aber bevor wir beginnen, möchte ich mich bei einigen Menschen bedanken.«
Die Gäste wirkten verwirrt. Ihre Eltern sahen einander an. Niemand rührte sich.
»Als Erstes«, fuhr Andie fort, »möchte ich meinen Eltern danken. Mom, Dad, ich liebe euch beide sehr. Ich möchte mich bei Reverend Jenkins bedanken, der mich schon kennt, seit ich ein schlaksiger Teenager war, und der sich wahrscheinlich mehr als alle anderen auf diesen Tag gefreut hat. Ich möchte mich außerdem bei euch allen dafür bedanken, dass ihr heute hier erschienen seid. Eure Freundschaft und eure Unterstützung bedeuten mir sehr viel.« Ihre Stimme verlor sich. Sie wandte den Blick ab, holte tief Luft und fixierte die Uhr im hinteren Teil der Kirche. »Aber ganz besonders«, sagte sie mit zitternder Stimme, »danke ich Linda, meiner wunderbaren Schwester und Trauzeugin.« Sie wandte ihren Blick nach rechts.
»Dafür, dass sie vergangene Nacht mit dem Bräutigam geschlafen hat.«
Die Anwesenden schnappten nach Luft. Andie fuhr herum und knallte dem Bräutigam den Blumenstrauß vor die Brust. Außer sich vor Wut und Verlegenheit, raffte sie ihr langes weißes Hochzeitskleid und lief zum Seitenausgang.
»Du verdammter Scheißkerl«, schrie ihr Vater und stürzte sich auf den Bräutigam. Ricks Trauzeuge machte einen Satz nach vorn, um den Vater zurückzuhalten, stellte sich jedoch so ungeschickt an, dass er ihn niederschlug.
»Mein Rücken!«, stöhnte Andies Vater auf. Der Trauzeuge stand breitbeinig über ihm wie Mike Tyson, der Red Buttons k. o. geschlagen hatte.
»Er hat ihren Vater umgehauen!«, schrie jemand.
Die Kirche dröhnte wie bei einem mittleren Erdbeben, als ein Dutzend Männer von ihren Sitzen aufsprangen, die einen, um dem am Boden liegenden Brautvater beizustehen, die anderen, um auf den Angreifer loszugehen. Ricks Kumpels eilten ihm zu Hilfe. Aus dem Geschrei wurde schnell ein Handgemenge und innerhalb von Sekunden rollte ein schwarz-weißes Knäuel von sich prügelnden Männern im Smoking auf den Altar zu. Ein schriller Schrei übertönte den Aufruhr, als die verschreckte Trauzeugin zum Ausgang rannte.
»Haltet sie!«, rief eine der Brautjungfern.
Die Hochzeitsgäste liefen auseinander. Frauen kreischten. Fäuste flogen. Plötzlich stürzte einer der Brautführer rücklings gegen das Lesepult.
»Leute, ich bitte euch«, rief Reverend Jenkins. »Nicht im Hause des Herrn!«
Andie lief einfach weiter. Sie stürmte zum Ausgang hinaus in die Vorhalle. Hinter ihr hörte es sich an wie ein Aufruhr im Fußballstadion. Sie hoffte, dass niemand ihr folgte. Sie musste jetzt allein sein. Sie schlüpfte in ein leeres Büro und schloss schnell die Tür hinter sich ab.
Sie war außer Atem, ihre Schultern hoben und senkten sich. Sie war den Tränen nahe, aber sie kämpfte gegen das Gefühl an. Er war die Tränen nicht wert, er hatte es nicht verdient, geheiratet zu werden.
Eine Träne lief ihr über die Wange. Sie wischte sie auf der Stelle weg. Also gut, eine Träne. Aber mehr würde sie nicht zulassen. Als sie sich an die Wand lehnte, stieß sie aus Versehen mit dem Schulterblatt gegen den Lichtschalter. Nun lag das Zimmer in völliger Dunkelheit. Sie lächelte schwach, als ihr die letzten Worte ihres sterbenden Großvaters einfielen.
»Macht das Licht aus, das Fest ist vorüber«, wiederholte sie leise.
Das schwache Lächeln verschwand und sie war allein im Dunkeln.
2
Die Sonntage waren Gus Wheatleys liebste Arbeitstage. Von Montag bis Freitag klingelte ununterbrochen das Telefon, gab es Sitzungen in der Anwaltskanzlei und außerhalb. Auch an den Samstagen hatte man keine Ruhe. Ehrgeizige junge Anwälte kamen in sein Büro, nur um den Geschäftsführer damit zu beeindrucken, dass sie ihre Wochenenden nicht auf dem Tennisplatz verbrachten. Der Sonntag war der einzige Tag, an dem er ungestört die Stereoanlage aufdrehen und seinen Schreibtisch in Ordnung bringen konnte.
Für einen Workaholic war Gus in erstaunlich guter körperlicher Verfassung, was hauptsächlich daran lag, dass er die Ermahnungen seines Arztes, der ihn auf das häufige Vorkommen von Herzinfarkt in seiner Familie hingewiesen hatte, übertrieben beherzigte. Fast jeden Tag ging er vor Sonnenaufgang aus dem Haus, um zu joggen oder Rad zu fahren. Telefonkonferenzen erledigte er häufig auf dem Laufband in dem kleinen Fitness-Raum neben seinem Büro. Bei Geschäftsessen oder auf Cocktail-Partys trank er selten etwas, da er es vorzog, jederzeit klar denken zu können. Sein gutes Aussehen und seine zuversichtliche Ausstrahlung erregten in jeder Gesellschaft Aufmerksamkeit. Mit einundvierzig Jahren war er der jüngste Anwalt, der je die Position des Geschäftsführers bei Preston & Coolidge, Seattles führender Anwaltskanzlei, innegehabt hatte. Er hatte seine gesamte juristische Laufbahn dort absolviert; nach seinem Jura-Examen an der Universität von Stanford hatte er sogar eine Anstellung beim Obersten Bundesgericht abgelehnt. Für manch einen wäre ein Jahr am höchsten Gericht der USA ein Traumziel gewesen. Aber Stellungnahmen zu Berufungsverfahren zu erarbeiten, war ihm als zu trocken erschienen. Vom ersten Tag seines Jurastudiums an hatte er sich zum Ziel gesetzt, eine der führenden Anwaltsfirmen des Landes zu leiten. Bei Preston & Coolidge konnte er diesen Traum in die Tat umsetzen. Tag und Nacht. Sieben Tage die Woche.
Die Firma hatte formal einen fünfköpfigen Verwaltungsrat, aber niemand bestritt, dass es Gus war, der tatsächlich die Geschicke lenkte, der gütige Diktator, der das Schicksal von zweihundert Anwälten in der Hand hatte. Gus liebte es, die Dinge unter Kontrolle zu halten; allerdings war das Geschick eines gewieften Politikers vonnöten, Übereinstimmung zwischen Partnern herzustellen, deren Egos kaum unter einem Dach Platz hatten. Es setzte leidenschaftliches Engagement voraus, eine Anwaltsfirma zu leiten, nebenher Zeit für einen Small Talk mit neuen Mandanten zu finden und sich darüber hinaus auch noch ein wenig mit der Rechtsprechung zu befassen. Natürlich hatte er Unterstützung. Zwei der besten Sekretärinnen der Firma ordneten seinen Tagesablauf. Zudem hatte er zwei Laufburschen, loyale junge Männer, die für alles Mögliche zuständig waren, dafür, Mandanten vom Flughafen abzuholen oder auch ihrem Boss die Schuhe zu putzen. Für wichtigere Angelegenheiten stand ihm Martha Goldstein, eine Anwältin für internationales Recht, als unersetzliche Assistentin der Geschäftsführung zur Seite. »Assistentin der Geschäftsführung« war die reichlich untertriebene Bezeichnung für eine derart begehrte Position. Man ging allgemein davon aus, dass Gus Martha darauf vorbereitete, seine Nachfolgerin zu werden. Bis dahin würden noch Jahre vergehen. Schon jetzt besaß sie die geistigen Fähigkeiten und die Ausstrahlung, Mandanten zu beeindrucken, wenn Gus nicht da sein konnte, und sie organisierte mehr und mehr die innerbetrieblichen Verwaltungsabläufe, mit denen Gus sich nur äußerst ungern beschäftigte. Vielleicht grenzte es ja an Sexismus, aber es war nicht von der Hand zu weisen, dass ältere männliche Mitarbeiter weniger über ihre jährliche Prämie zeterten, wenn sie ihnen von einer attraktiven, sechsunddreißigjährigen Frau überreicht wurde.
Im Rhythmus der Musik, die aus der Stereoanlage dröhnte, klopfte Gus mit seinem Bleistift auf die Zahlenaufstellungen, die vor ihm lagen. Nur Sinatra konnte etwas Glamour in seine obligatorische Übersicht über die monatlichen anwaltlichen Honorarabrechnungen in Höhe von elf Millionen Dollar bringen. Die Lautsprecher auf seinem Bücherschrank begannen zu scheppern. Zu viel »New York, New York«. Er lehnte sich zurück und drehte die Lautstärke herunter.
»Wollen Sie auch was vom Chinesen?«
Die weibliche Stimme schreckte ihn aus seinen Gedanken auf. Es war Martha.
Er warf einen Blick auf seine Rolex, er hatte gar nicht gemerkt, dass es schon Zeit fürs Abendessen war.
»Ja, gerne«, erwiderte er lächelnd. »Setzen wir es Ihrem Mandanten auf die Rechnung oder meinem?«
Sie wusste, dass er nur scherzen wollte. Martha hatte eben erst eine führende internationale Bank als Mandanten verloren, nachdem sie die Rechnung eines Kollegen abgeschickt hatte, auf der auch die Position »Wäschereiservice« aufgeführt war. Dabei war es nicht einmal um Geldwäsche gegangen. Der Kollege hatte einfach nur seine Hemden in die Hotelreinigung geschickt und die Kosten seinem Mandanten aufgebrummt.
»Das finde ich jetzt gar nicht witzig, Gus.«
Das Telefon auf seinem Schreibtisch klingelte. Er drückte auf den Freisprech-Knopf. »Ja, bitte?«
»Mr Wheatley?«
»Am Apparat.«
»Hier ist Mrs Volpe vom Jugendzentrum.«
»Wer bitte?«
»Ich bin die Leiterin der Turngruppe der Sechs- bis Achtjährigen, an der Ihre Tochter sonntagnachmittags immer teilnimmt.«
»Ach ja, stimmt«, sagte er; er hatte keine Ahnung davon. »Morgan hat Spaß an dieser Turnerei.«
»Ich habe den Eindruck, dass sie noch ziemlich schüchtern ist. Aber das ist nicht der Grund meines Anrufs. Sie hat mir zwar gesagt, ich solle Sie nicht bei der Arbeit behelligen, aber sie wartet schon seit zwei Stunden darauf, abgeholt zu werden. Es ist jetzt fast sechs Uhr. Alle anderen sind schon gegangen. Wir würden gerne bald Feierabend machen.«
»Danke für den Anruf, aber Morgans Mutter holt die Kleine immer ab.«
»Ja, gewöhnlich macht sie das auch. Aber den ganzen Tag über hat niemand Ihre Frau gesehen. Wir können sie auch nicht telefonisch erreichen.«
Gus sah Martha an, die das Gespräch mithören konnte. Sie flüsterte: »Schicken Sie doch ein Taxi.«
Seine Augen strahlten, als wäre Martha ein Genie. »Mrs Volpe, wenn Sie noch einen Moment warten könnten. Ich schicke sofort ein Taxi vorbei.«
Einen Moment lang herrschte Schweigen am anderen Ende. »Es tut mir Leid, Sir. Aber die Einzigen, die Kinder unter zwölf vom Jugendzentrum abholen dürfen, sind die Eltern oder Betreuer, deren Foto und Unterschrift im Büro hinterlegt sind. Wir schicken Kinder nicht mit Fremden nach Hause.«
»Oh, natürlich.« Er fuhr sich mit einer Hand durchs Haar und überlegte. »Und Sie können meine Frau ganz sicher nicht erreichen?«
»Ich versuche es schon seit zwei Stunden.«
»In Ordnung«, sagte er verärgert. »Ich versuche, sie zu finden. Einer von uns beiden wird so bald wie möglich da sein.« Er legte auf, dann wählte er schnell die Handy-Nummer seiner Frau. Nach vier Klingelzeichen erhielt er von einer Computerstimme die Mitteilung, der Teilnehmer sei nicht erreichbar.
»Verdammt, Beth. Schalt dein blödes Telefon ein.« Er sah genervt zu Martha hinüber. »Wir müssen wohl ein andermal zusammen zu Abend essen. Sieht ganz so aus, als müsste ich heute den Chauffeur spielen.«
»Wo ist Beth?«
»Wenn ich das wüsste.«
»Kommt das öfter vor, dass sie einfach vergisst, das Kind abzuholen?«
Er ging zur Tür und nahm seinen Mantel vom Haken. »Dauernd hat sie irgendwelche spontanen Einfälle.«
»Klingt, als könnte sie mal ordentlich was auf den Hintern gebrauchen.«
Gus warf ihr einen scharfen Blick zu.
»War nur so dahergesagt«, sagte Martha. »Ich habe so was einen meiner englischen Mandanten neulich sagen hören.«
»Hoffentlich nicht über seine Frau.«
»Immer mit der Ruhe. Ich hab’s nicht wörtlich gemeint.«
»Na gut. Wir sehen uns morgen.«
Er eilte den Flur entlang. Mit Hilfe einer Codekarte passierte er das Eisentor, mit dem die aufwendig gestaltete Eingangshalle der Firma, die sich über drei Stockwerke erstreckte, an den Wochenenden gesichert war. Er drückte den Knopf, um den Aufzug zu bestellen. Es würde ein bis zwei Minuten dauern, bis er im neunundvierzigsten Stock ankam. Während er wartete, dachte er über Marthas Bemerkung nach. Diese Art Witz war ihm ziemlich peinlich in Anbetracht des Zustands seiner Ehe. In den fünfzehn Jahren mit Beth hatte es reichlich Gerüchte und Unterstellungen gegeben. Über so etwas sollte man keine Witze machen. Vielleicht war er aber auch nur empfindlicher in letzter Zeit und sich stärker der Tatsache bewusst, dass seine Gefühle für Beth nach wie vor ziemlich unklar waren.
Manchmal erschien es ihm wie ein Wunder, dass er immer noch mit ihr verheiratet war.
3
Gus und seine Tochter blieben noch auf und sahen sich das Video »Der König der Löwen« an. Die Zeit, zu der Morgan sonntagabends ins Bett ging, war längst überschritten, aber Gus hatte angenommen, er könne sie mit dem Sonderrecht, länger fernzusehen, von ihrer Sorge ablenken. Es klappte nicht.
»Wann kommt Mommy nach Hause?« Sie musste diese Frage jede Viertelstunde gestellt haben. Gus hatte längst alle Entschuldigungen vorgebracht, die ihm einfielen. Der Verkehr. Vergessen, auf die Uhr zu sehen. Jetzt, inzwischen fast zehn, fiel ihm absolut nichts mehr ein. Er brachte Morgan ins Bett, was sich zu einem Drama entwickelte. Er las ihr vor, blieb an ihrem Bett sitzen und kroch schließlich zu ihr unter die Decke. Er versuchte alles, um sie zu beruhigen. Aber sie spürte deutlich seine eigene Besorgnis.
Schließlich schlief sie ein.
Er ließ sich in den ledernen Lehnsessel sinken und zappte durch das Fernsehprogramm. Bei den Lokalnachrichten blieb er hängen. Die üblichen Meldungen über die Verbrechen am Wochenende boten ein wenig Ablenkung, bis der Sender zu einer Livereportage über einen verheerenden Verkehrsunfall auf der I-5 umschaltete. Im Bild erschien ein Gewirr von verkeiltem Metall, die Wracks von zwei PKWs und einem Lastwagen. Er beugte sich vor, entspannte sich aber wieder, als er hörte, dass sämtliche Unfallbeteiligten männlich waren.
Er schalt sich dafür, sich aufgeregt zu haben. Natürlich war Beth nicht dabei. Ihr Wagen stand noch in der Garage.
Aber genau das irritierte ihn.
Er wusste, dass sie Morgan um zwei Uhr in dem Jugendzentrum abgeliefert hatte. Das hatte ihm Morgan bestätigt. Gus war alles mehrmals mit seiner Tochter durchgegangen, aber sie konnte sich einfach nicht mehr erinnern, ob ihre Mommy gesagt hatte, sie würde um vier wieder dort sein, oder ob sie gesagt hatte, Daddy würde sie abholen. Er versuchte verzweifelt, sich daran zu erinnern, ob Beth irgendwohin wollte und ihn gebeten hatte, Morgan abzuholen. Vielleicht hatte er es ja schlichtweg vergessen. Das musste es sein. Während der vergangenen Monate hatte sich ihre Kommunikation auf ein Minimum reduziert. Vermutlich hatte sie vor drei Tagen irgendetwas dahingemurmelt, während er gerade zur Tür hinausging. Typisch Beth.
Gus erhob sich aus dem Sessel und ging in die Küche. Die Frühstücksecke in ihrer an einem Hang gelegenen Villa war in der Form eines sechseckigen, gläsernen Schmuckkästchens gebaut und die raumhohen Fenster ermöglichten eine nahezu perfekte Rundumsicht. Den nächtlichen Ausblick liebte er ganz besonders. Es war der einzige, der ihm wirklich vertraut war. Er ging immer vor Sonnenaufgang aus dem Haus und kehrte nicht vor der Dunkelheit zurück. Die Wheatleys wohnten in dem nördlich der Innenstadt gelegenen besseren Viertel von Magnolia, wo neu errichtete Traumhäuser und prachtvolle alte Villen sowohl den Blick auf die Stadt als auch auf das Wasser boten. Bürotürme aus Glas und Stein erleuchteten die Skyline im Südosten. Wie an vielen anderen Abenden waren auch heute die Spitzen der höchsten Gebäude von niedrig hängenden Wolken verdeckt. Gus’ eigenes Büro lag genau auf Höhe der Wolken, ein ständig erleuchteter Würfel am Himmel. Im Westen befand sich der Puget Sound, der riesige Wasserfinger, der sich von Norden nach Süden erstreckte und die Hafenstadt Seattle von den Kitsap- und Olympic-Halbinseln trennte. Mit ein bisschen Fantasie konnte man sich den Nordwesten des Staates Washington wie einen rechten Fausthandschuh vorstellen. Den Daumen bildeten die nach Westen hin gelegenen Halbinseln und die Olympic Mountains, die verhinderten, dass der Pazifische Ozean den Puget Sound und die Stadt Seattle im Osten verwüstete. Die Meerenge lag jetzt im Dunkeln, nur die Lichter einiger Schiffe waren zu sehen. Ein paar vereinzelte Lebenszeichen in Form von flimmernden Lichtern markierten Bainbridge Island. Gus konzentrierte den Blick auf das am weitesten entfernte schwache Licht, irgendwo da draußen in der Nacht.
Wo zum Teufel steckt Beth?, fragte er sich.
Der Montagmorgen war alles andere als Routine. Gus war die ganze Nacht aufgeblieben. Um sechs Uhr verspürte er den einprogrammierten Drang, die übliche Flut von Telefonaten mit seinen Mandanten von der Ostküste zu erledigen, die ihm drei Stunden voraushatten. Allerdings fühlte sich dieses Bedürfnis nicht zwingend an. Er war sogar eher überrascht, was für die Prioritäten eines Mannes, der voll in seinem Beruf aufging, einer Beleidigung gleichkam. Aber er war mit seinen Gefühlen und seinen Gedanken woanders. In einer halben Stunde würde Morgan aufwachen. Sie würde wissen wollen, wo ihre Mommy war.
Er wollte auch wissen, wo ihre Mommy war.
Gus goss sich eine Tasse Kaffee ein und setzte sich allein an den Küchentisch. Das Wall Street Journal, die New York Times und der Seattle Post-Intelligencer lagen zusammengerollt und ungelesen auf der Anrichte. Der Regen pladderte leicht gegen das Küchenfenster. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Dichter Frühnebel verwehrte ihm jede Aussicht aus dem Fenster, kein Mond, keine Sterne, keine Lichter der Innenstadt. Es war zwar noch früh, aber er benötigte Antworten, bevor seine Tochter aufwachte. Nach Morgans Geburt hatte Beth eine Liste von Telefonnummern erstellt, die am Kühlschrank hing, eine Liste von Leuten, die man in Notfällen anrufen konnte. Er wählte die oberste Nummer und machte sich auf Unannehmlichkeiten gefasst.
Nach dem vierten Klingeln ertönte ein gereiztes »Hallo«.
»Carla, ich bin’s, Gus. Tut mir Leid, dass ich dich wecke.«
Sie antwortete nicht. Einen Moment dachte Gus, sie würde wieder auflegen. Carla war seine jüngere Schwester, aber das war nebensächlich. Vor allem war sie die beste Freundin seiner Frau. In ihrer Kindheit hatten sie nie ein inniges Verhältnis zueinander gehabt. Als er Beth geheiratet hatte und damit buchstäblich zwischen sie und ihre beste Freundin geraten war, war es nur noch schlimmer geworden. Immer, wenn Beth sich über Gus beklagte, hatte sie Carla auf ihrer Seite. Manchmal kam es ihm vor, als wäre Carla sogar diejenige, die hinter Beths Anschuldigungen steckte. Aber irgendwie hatten sie es dennoch geschafft, ein gewisses Niveau des zivilen Umgangs miteinander zu erreichen. Allerdings nur ein ziemlich niedriges Niveau.
»Es ist zwanzig nach sechs«, stöhnte Carla. »Was willst du?«
»Ich bin ein bisschen in Sorge um Beth.«
Ihre Stimme wurde schärfer. »Was hast du mit ihr angestellt?«
Der vorwurfsvolle Ton ärgerte ihn. Der Himmel wusste, was Beth Carla mal wieder erzählt hatte. »Ich habe überhaupt nichts mit ihr angestellt. Kannst du mir bitte eine einfache Frage beantworten? Wann hast du das letzte Mal mit Beth gesprochen?«
»Wir sind gestern zusammen frühstücken gegangen. Warum?«
»Hat sie was davon gesagt, dass sie irgendwohin wollte – dass sie wegwollte?«
»Du meinst in Urlaub?«
»Irgendwas. In die Stadt, aus der Stadt weg. Es spielt keine Rolle.«
»Das Einzige, was sie gesagt hat, war, dass sie Morgan um zwei zum Jugendzentrum bringen wollte. Warum fragst du das alles?«
Er seufzte. »Beth hat Morgan hingebracht, aber nicht abgeholt. Ich musste Morgan selbst abholen. Beth ist die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. Ich habe keine Ahnung, wo sie steckt.«
»Bei mir ist sie jedenfalls nicht, falls du darauf hinauswillst.«
»Ich will auf gar nichts hinaus. Ich versuche einfach nur, meine Frau zu finden. Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnte?«
»Nein. Aber ich kann es mir vorstellen.«
»Tu dir keinen Zwang an.«
»Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Beth vielleicht endgültig ein Licht aufgegangen sein könnte und sie den Mut gefunden hat, dich zu verlassen?«
Sie klang so selbstgefällig, dass er sie am liebsten zum Teufel gewünscht hätte. Aber er wusste, dass Carlas Gedanke nicht so abwegig war. »Wenn das der Fall wäre, meinst du nicht, sie hätte andere Möglichkeiten gehabt, als ihre sechsjährige Tochter im Jugendzentrum hängen zu lassen? Macht eine einigermaßen intelligente Frau so was?«
»Wenn sie richtig durcheinander ist, kann das schon sein. Beth war sehr unglücklich. Du hast keine Ahnung, wie unglücklich sie war.«
»Aber das erklärt nicht alles. Ich habe in ihrem Schrank und in ihren Schubladen nachgesehen. Alle ihre Sachen sind noch da. Ihre Schuhe. Ihre Fotoalben und ihr ganzer persönlicher Kram. Anscheinend fehlt nichts. Es sieht ganz einfach nicht so aus, als hätte sie eine Flucht geplant. Selbst ihr Auto steht in der Garage.«
»Sie kann dich auch ohne Auto verlassen.«
»Ich habe seit vier Uhr heute Nacht herumtelefoniert. Ich habe jeden Taxibetrieb überprüft. Niemand hat Beth gestern von unserem Haus abgeholt. Ich habe bei jedem Hotel bis nach White Pass nachgefragt. Ich habe sogar die Autobahn-Polizei angerufen, um herauszufinden, ob es Unfälle gegeben hat.«
»Hast du es am Flughafen probiert?«
»Die Fluggesellschaften geben keine Informationen über Passagiere heraus.«
»Das wird’s sein. Wahrscheinlich sitzt sie fröhlich in irgendeinem Flieger, während wir hier telefonieren.«
»Das glaube ich nicht.«
»Warum nicht?«
»Rück schon raus mit der Sprache, Carla. Ich weiß, was hier los ist. Ich habe schon seit Monaten den Verdacht.«
»Welchen Verdacht?«
»Sie trifft sich mit jemandem, stimmt’s?«
»Mit einem anderen Mann? Keinesfalls. Diese Gattung hast du ihr für den Rest ihres Lebens vermiest.«
»Carla, sei offen mir gegenüber. Wenn sie die Nacht mit einem anderen Mann verbringt, geht das nur sie und mich etwas an. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann geht hier irgendetwas Beängstigendes vor sich, und ich muss die Polizei anrufen, damit sie die Suche nach ihr aufnehmen können. Also, sag’s mir, und du tätest gut daran, mir die Wahrheit zu sagen. In letzter Zeit war die Beziehung zwischen mir und Beth nicht gut. Aber wir reden hier über Morgans Mutter. Die Mutter deiner Nichte.«
»Ehrlich, ich hab keine Ahnung, was ich dir sagen könnte.«
»Hör auf, sie in Schutz zu nehmen.« Er war lauter geworden, als er beabsichtigt hatte. Er holte tief Luft, fuhr jedoch immer noch ziemlich barsch fort. »Ich meine es sehr ernst. Verlässt eine Frau ihren Mann ohne einen Koffer? Ohne Handtasche, ohne Brieftasche, ohne ihre Papiere? Ohne auch nur fünfzig Dollar von der Bank abzuheben? Bring mich nicht dazu, die Polizei einzuschalten, wenn du weißt, dass da lediglich ein Liebhaber im Spiel ist. Aber wenn wir uns einig sind, dass sie möglicherweise in Schwierigkeiten steckt, dann ist es höchste Zeit, die Polizei zu benachrichtigen. Also, was machen wir, Carla?«
Am anderen Ende der Leitung herrschte Schweigen, als versuchte sie, angestrengt die ganze Wut auf ihren Bruder zu verdrängen, die sich ein Leben lang aufgestaut hatte. Schließlich antwortete sie mit zitternder Stimme: »Ich glaube, du rufst lieber die Polizei.«
Die Antwort jagte ihm einen Schauer über den Rücken. Er bedankte sich nicht. Er verabschiedete sich nicht. Er legte einfach nur auf und wählte die Nummer der Polizei.
4
Die Meany Science, Math and Arts Academy hatte um halb vier nachmittags Unterrichtsschluss. Fünfhundert Schüler der Mittelschule drängelten sich durch die Türen wie ausgebrochene Häftlinge. Manche gingen auf den Spielplatz, bis sie abgeholt wurden. Andere steuerten direkt die lange Reihe gelber Busse an. Lärmende Gruppen von Kindern, die nahe genug wohnten, um zu Fuß nach Hause gehen zu können, wurden vom Schulgelände hinunter von freiwilligen Aufpassern begleitet. Benny Martinez und seine beiden Kumpels machten sich allein auf den Weg.
Benny war groß für einen Sechstklässler, selbstbewusst mit einem Anflug von Überheblichkeit, der geborene Anführer. Ob er sein Talent in den Dienst einer guten Sache oder einer Straßengang stellen würde, musste sich noch erweisen.
Er ging langsam den Gehweg entlang, von der Schule weg, und kam an den überfüllten Bussen vorbei. Er trug eine grelle blaugraue Sportjacke der Seattle Seahawks. Kaum hatte er das Schulgelände verlassen, befestigte er eine Kampfhundleine an seinen Jeans in Übergröße, nur um anzugeben. Auch wenn seine Eltern ihm keine Skinhead-Frisur erlaubten, die das Markenzeichen der Straßengangs war, hatte er sein Haar so kurz geschnitten, wie es mit einer Schere gerade möglich war.
»Komm schon, Benny«, sagte sein Kumpel. Seine Stimme zitterte vor Nervosität. Er hatte es offensichtlich eilig.
»Bleib ganz ruhig.« Benny umklammerte seinen Rucksack, der einen gestohlenen Football verbarg. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, nie zu rennen, wenn man etwas geklaut hatte. Ungefähr zwanzig Prozent seiner Mitschüler waren irgendwann einmal während des Schuljahres vorübergehend vom Unterricht ausgeschlossen worden. Benny war bisher noch nicht erwischt worden. Alles Trottel. Cool bleiben war die Devise.
Er lächelte die Aufpasserin an der Ecke an, als er und seine beiden Kumpels die Straße überquerten. Seine Freunde wirkten, als würden sie sich jeden Moment in die Hose machen. »Wehe, ihr rennt«, murmelte Benny vor sich hin, »ich bring euch um.«
Seine Freunde verlangsamten ihren Schritt. Die Schläge, die Benny ihnen in der Vergangenheit verpasst hatte, hatten sie gelehrt, genau das zu tun, was er sagte.
Benny schien über die Straße zu gleiten, nicht im Geringsten beunruhigt. Seine Freunde trotteten neben Benny her, der einen halben Schritt vorausging. Sie gingen mehrere Blocks weit zusammen, bis Benny das Zeichen zum Stehenbleiben gab. Sie hatten den Eingang zum Washington Park Arboretum erreicht, einem bewaldeten Gelände von einem drei viertel Quadratkilometer nördlich der Innenstadt. Eine leichte Brise aus der Union Bay bewegte die hoch aufragenden Tannen vor ihnen. Die Sonne war bloß ein verschwommener bernsteinfarbener Ball hinter einer hier und da aufreißenden Wolkendecke. Benny öffnete seinen Rucksack und holte den ledernen Football heraus. Erst jetzt erlaubte er sich ein Lächeln.
»Auf geht’s«, sagte er.
Seine Freunde sprinteten in den Park. Benny gab ihnen winkend zu verstehen, sie sollten weiterlaufen. Mit aller Kraft schleuderte er den Ball im hohen Bogen. Durch die Unterstützung des Windes schaffte er es fast bis zu seinen Freunden, die miteinander rangen und sich im Gras wälzten, um den springenden Ball an sich zu bringen. Benny spurtete los, um sie einzuholen. Sein Freund warf den Ball in Rugby-Manier zurück. Alle drei rannten den asphaltierten Fahrradweg entlang, wobei sie sich den Ball nach vorn und zurück zuwarfen. Über den gewundenen Weg, der sie hinauf über den Hügel führte, erreichten sie eine saftig grüne Wiese. Der eindrucksvolle Japanische Teegarten tauchte vor ihnen auf. Aber die Jungs interessierten sich mehr für den Ball als für die Umgebung. Von der Rennerei waren sie völlig außer Atem, aber keiner von den dreien wollte der Schlappschwanz sein, der das Spiel beendete. Benny schleuderte den Ball wieder hinauf. Sein Freund berührte ihn mit der Hand, verfehlte ihn jedoch. Der Ball rollte den Hügel hinunter in ein dicht bewaldetes Gelände.
»Idiot!«, schrie Benny.
»Ich? Du hast geworfen.«
Sie standen am Rande des Radweges. Der Hügel hatte hier ein steiles Gefälle von vierzig Grad. Die Kiefern waren fast zehn Meter hoch, die Douglasien sogar noch höher. Aber die Schlucht war so tief, dass einige der Baumwipfel sich auf Augenhöhe der Jungs befanden. Sie konnten Wasser rauschen hören, das irgendwo da unten gegen Felsen plätscherte, aber die immergrünen Gehölze standen zu dicht, als dass man den Bach hätte sehen können.
Benny starrte seinen Freund an. »Geh ihn holen.«
»Ich denk nicht dran.«
Benny schubste ihn über den Vorsprung. Er rollte fast zehn Meter den Abhang hinab, bis er sich schließlich an einem Baum festhalten konnte. Lose Steinchen rieselten an ihm vorbei weiter hinunter. Er blickte voller Angst nach oben, kurz davor loszuheulen. Benny verzog keine Miene. »Hol den Ball«, befahl er.
Der andere Junge mischte sich ein. »Lass doch. Der war sowieso geklaut.«
»Hast du etwa Angst?«, fragte Benny.
»Nein. Du?«
Benny zog die Augenbrauen zusammen. »Wenn du eher unten bist als ich, kannst du den Ball behalten.«
Sein Kumpel grinste über die Herausforderung. Schnell, aber vorsichtig, begannen sie, auf ihrem Hosenboden den Abhang hinunterzurutschen. Oben wuchs Gras, wodurch sie ihren Abstieg noch abbremsen konnten. Aber der Schlamm weiter unten ließ sie immer schneller werden. Zu schnell. Sie stolperten und verloren die Kontrolle. Tief hängende Äste peitschten ihnen ins Gesicht. Überall war Schlamm, er drang in ihre Schuhe und spritzte auf ihre T-Shirts. Je weiter hinunter sie rutschten, desto dunkler wurde es. Das Geräusch des Bachs wurde immer lauter, bis sie schließlich mit einem Aufprall auf dem Boden der Schlucht landeten.
Benny stöhnte. Sein Freund stöhnte noch lauter. Sie waren nur einen guten Meter voneinander entfernt, aber das Licht war so spärlich, dass sie einander kaum sehen konnten.
»Benny?«
Der schüttelte den Kopf und fand bald die Orientierung wieder. »Ja?«
»Was zum Teufel ist das?«
»Was?«
Sein Freund deutete auf etwas. »Das da. Da oben. Hinter dir.«
Benny drehte sich um. Seine Augen hatten sich langsam an das Dämmerlicht gewöhnt. Irgendetwas war in dem Baum, sechs Meter über ihnen. Er kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Schließlich erkannte er es. Es drehte sich hin und her. Seine Augen weiteten sich. Ein Irrtum war ausgeschlossen.
Da baumelte eine Leiche an einem Seil.
Die Jungs sahen einander an, schrien gleichzeitig auf und rannten in die andere Richtung den Bach entlang.
Für einen Special Agent des FBI war ein »typischer« Montag schwer zu beschreiben. Der Montag nach einer Hochzeit wie der von Andie war auf jeden Fall nicht typisch.
Andie war seit drei Jahren beim FBI, und zwar bei der Außendienststelle in Seattle. Man konnte nicht sagen, dass sie ihr ganzes Leben lang von diesem Posten geträumt hätte. Er war eher eine Art sichere Landung einer selbstbewussten Draufgängerin, die sich hätte durchaus auf der anderen Seite des Gesetzes wiederfinden können, wären nicht Mr und Mrs Henning gewesen, die sie im Alter von neun Jahren adoptiert und ihre Energie in die richtigen Bahnen gelenkt hatten. Sie war Teilnehmerin am olympischen Juniorwettbewerb in der Mogul-Ski-Disziplin gewesen, bis ihr Knie nicht mehr mitmachte, und mit sechzehn hatte sie eine Ausbildung zur Sporttaucherin gemacht. Sie ging nach Santa Barbara, um ihr Grundstudium am College der University of California zu absolvieren, in der Hoffnung, sie könnte sich eine Existenz in der Nähe der Küste aufbauen. Zur allgemeinen Überraschung entschied sie sich für ein ziemlich ernsthaftes Hauptfach, für Psychologie. Ihre Noten waren gut genug für eine Zulassung zum Jurastudium, das sie, was die nächste Überraschung war, tatsächlich aufnahm. Aber erst im letzten Studienjahr wurde ihr klar, welchen Weg sie einschlagen wollte. Bei einer Anwerbeveranstaltung für verschiedene Berufe schlug eine Frau sie in ihren Bann, die eben erst von Ermittlungen zu einem terroristischen Bombenattentat zurückgekehrt war. Das hatte den Ausschlag gegeben. Sie beschloss, beim FBI zu arbeiten.
Ihr Vater war begeistert von ihrer Entscheidung. Schließlich war er selbst Polizist und hatte sie schon früh im Umgang mit Waffen vertraut gemacht. Während ihrer Ausbildung in der Police Academy war sie die zwanzigste Frau seit Bestehen des FBI, der es gelang, in den »Possible Club« vorzustoßen, einem zu achtundneunzig Prozent von Männern dominierten Eliteclub von Agenten, die bei einem der härtesten Feuerwaffen-Kurse der Polizei die höchstmögliche Punktzahl erreicht hatten. Trotz dieser Auszeichnung hatte sie ihre ersten sechs Monate mit Routineüberprüfungen von zukünftigen Angestellten des FBI verbracht. Diese Arbeit wurde normalerweise von unbedeutenden Agenten erledigt, die keinen weiteren Aufstieg zu erwarten hatten, oder von jemandem wie Andie, die ganz einfach jünger aussah, als sie war, und nicht besonders ernst genommen wurde. Zum Glück entdeckte einer der Special Agents, die sie betreuten, ihr Talent: »Unübertroffener Unternehmungsgeist und gesunder Abenteuerdrang«, hatte er in ihre Beurteilung geschrieben, »die von ausgeprägter Intelligenz und außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten ausgeglichen werden.« Er sorgte dafür, dass sie dem Bankraubdezernat zugeteilt wurde, wo sie sich innerhalb der nächsten eineinhalb Jahre einen Namen machte. Mit siebenundzwanzig sah sie immer noch jung aus. Aber niemand hatte mehr ein Problem damit, sie ernst zu nehmen.
Zumindest nicht bis zu ihrer geplatzten Hochzeit.
Andie bemühte sich den ganzen Tag über, ein Lächeln aufzusetzen. Niemand verlor ein Wort über die Hochzeit, obwohl einige Sekretärinnen, die um den Wasserspender herumstanden, gekichert hatten, als sie vorbeigekommen war. Jeder wusste natürlich Bescheid. Einige von ihnen waren dabei gewesen. Einer hatte ein blaues Auge als Andenken vorzuweisen.
»Wir sehen uns morgen«, sagte Andie auf dem Weg zum Aufzug. Die Empfangsdame winkte ihr zu und öffnete per Knopfdruck die elektronisch gesicherte Tür.
Es war noch früh, ungefähr halb fünf. Dank ihrer abgeblasenen Hochzeitsreise war ihr Terminkalender völlig leer und sie musste sich schon ziemlich anstrengen, mit ihrem Tag irgendetwas Sinnvolles anzufangen. Ihr war nicht danach, direkt nach Hause zu gehen und schon wieder eine Nacht allein zu verbringen. Um diese Jahreszeit waren die Nächte scheußlich lang, selbst ohne Liebeskummer. Vom FBI-Gebäude aus ging sie einige Häuserblocks nach Süden zum historischen Pioneer Square, dem alten Geschäftsviertel in der Innenstadt, in dessen idyllischen Straßen mit Kopfsteinpflaster und Ziegelbauten aus dem neunzehnten Jahrhundert schicke Galerien, Boutiquen und Restaurants entstanden waren. Andie betrat das J&M-Café, eine beliebte Bar, in der der beeindruckendste Holztresen diesseits von San Francisco zu bewundern war. Hier gab es die besten Nachos, das ideale sündhafte Ende ihrer Kaninchenfutterdiät. Dieser hatte sie sich nur unterzogen, um auf ihrer Hochzeitsreise, die sie nun nicht machte, am Strand von Hawaii einen Bikini, den sie nun nicht mehr brauchte, tragen zu können.
Die Bar war wie üblich voller lärmender Leute, aber sie fühlte sich allein. Ein ständiger Strom von Stammgästen schob sich an ihrem Rücken entlang auf die Toiletten zu. Nachdem sie ihren Berg fettiger Tortilla-Chips zur Hälfte verdrückt hatte, spürte sie, dass jemand direkt hinter ihr stand. Sie warf einen Blick über die Schulter.
Ein gut aussehender Schwarzer starrte auf den leeren Barhocker neben ihr. »Entschuldigung«, sagte er, immer noch auf den Barhocker schauend, »ist diese Frau besetzt?«
Andie hob die Augenbrauen. »Das ist ja wohl der lahmste Annäherungsversuch, der mir je untergekommen ist.«
»Danke.« Er nahm sich den Hocker und hielt ihr die Hand hin. »Bond ist mein Name. B. J. Bond.«
Sie schüttelte ihm die Hand. »Was bedeutet B. J.?«
»Bond James.«
»Dann lautet also Ihr voller Name …?«
»Bond James Bond.«
Sie machten beide im gleichen Moment schlapp. Zusammen lachten sie laut los und beendeten ihre Scharade.
»Isaac«, sagte sie ausgelassen, »gut zu wissen, dass ich mich auf Ihren urigen Sinn für Humor verlassen kann. Das hebt doch gleich meine Stimmung.«
Er grinste breit, winkte dem Barkeeper und bestellte eine Tasse Kaffee. Isaac Underwood war Special Agent und der stellvertretende Leiter des FBI-Außendienstbüros in Seattle, genannt ASAC, die Nummer zwei in einem Büro mit hundertsechzehn Agenten. Vor seiner Beförderung war er Andies unmittelbarer Vorgesetzter gewesen.
Er machte es sich auf dem Barhocker bequem und langte nach einem dick mit Käse beladenen Nacho. »Ganz schön dekadentes Mittagessen«, sagte er mit vollem Mund.
»Wir haben uns schließlich nicht an die Spitze der Nahrungskette vorgearbeitet, um uns mit Tofu abfüllen zu lassen.«
»Amen.« Der Barmann brachte den Kaffee. Isaac nahm sich Zucker. »Also, meine Liebe. Alles in Ordnung?«
»Ja«, erwiderte sie und nickte schnell wie zur Bestätigung. »Doch, doch.«
Sein Gesichtsausdruck wurde ernst. »Wenn es irgendwas gibt, was Sie brauchen. Eine Auszeit. Vielleicht sogar eine Versetzung …«
Sie hob eine Hand, um ihn zum Schweigen zu bringen. »Mir geht’s gut. Wirklich.«
Er nippte an seinem Kaffee. »Falls Sie das tröstet, ich fand schon immer, dass der Typ ein ziemliches Arschloch ist.«
»Was Sie nicht sagen.«
»Haben Sie das etwa nicht gemerkt?«
»Er war nicht immer so. Während des ganzen Jurastudiums waren wir unzertrennlich. Wir haben sogar überlegt, eine gemeinsame Kanzlei zu gründen. Als ich die Idee fallen ließ, die Juristerei zu praktizieren, und mich stattdessen für das FBI entschied, hat er sich offenbar gesagt, dass mich der Job auffressen und ich ihn über kurz oder lang aufgeben würde. Auf keinen Fall konnte er sich vorstellen, dass ich drei Jahre durchhalten würde.«
»Viele Leute ändern ihre Meinung darüber, ob sie einen Polizisten heiraten sollten. Die meisten lösen die Verlobung wieder auf.«
Andie senkte den Blick. »Im Nachhinein denke ich, dass er das auch wollte. Vergangene Woche hatten wir einen Riesenkrach. Seit dem ersten Tag unserer Verlobung hatten wir geplant, eine Familie zu gründen. Und auf einmal sagt er mir, er will keine Kinder, solange mein Job die Möglichkeit einschließt, dass ich in Schießereien verwickelt werde.«
»Eigentlich hätten Sie Schluss machen sollen.«
»Ich weiß. Meine Mutter hat auf mich eingeredet, ich müsste da durch. Sie wollte mich davon überzeugen, dass wir das klären könnten und dass Rick nur geblufft hätte. Aber ich glaube, er hat es wirklich ernst gemeint. Wenn er bloß nicht so einen schäbigen Weg gewählt hätte, um uns beide davon abzuhalten, einen schrecklichen Irrtum zu begehen. Und jetzt wünschte ich mir wirklich, ich hätte nicht so einen Zirkus veranstaltet.«
»Das tut mir Leid, Andie.«
»Danke. Aber das braucht es nicht. Ich möchte nur einfach so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren.«
»Es freut mich, dass Sie es so sehen. Ich habe nämlich einen Auftrag für Sie.«
»Wie nett von Ihnen. Da haben Sie also extra einen Bankraub organisiert, nur um mich auf andere Gedanken zu bringen.«
»Nicht ganz.« Er lächelte, wurde dann aber wieder ernst. »Victoria Santos kommt morgen früh von Quantico rüber.«
Andie kannte Santos nicht näher, aber sie wusste auf jeden Fall über sie Bescheid. Santos hatte in Andies Kurs für Anwärter auf der Academy Kurse über Kriminalpsychologie abgehalten. Vor allem aber galt sie als Legende unter den Profilern bei der ISU, der FBI-Elite-Einheit für Verbrechensaufklärung.
»Warum kommt sie her?«
Isaac warf einen Blick auf die vielen Gäste, die um sie herum standen. »Lassen Sie uns draußen darüber reden, okay?«
Sie zahlten, kippten ihren Kaffee in Pappbecher und verließen die Bar. Der Stoßverkehr rauschte auf dem nassen Pflaster durch die belebte Hauptstraße. Feuchte Kälte drang in ihre Mäntel. Die Sonne war zwar eben erst untergegangen, aber die Temperatur war augenblicklich gesunken. Andie trank ihren heißen Kaffee. Isaac nahm das Gespräch wieder auf, während sie den breiten, von Bäumen gesäumten Gehweg entlangspazierten.
»Die örtliche Polizei hat um Unterstützung durch das FBI gebeten«, sagte er. »Es gibt einige Fälle von Totschlag, zwischen denen ein Zusammenhang bestehen könnte. Möglicherweise steckt ein Serienmörder dahinter.«
»Wie viele Opfer sind es bisher?«
»Zwei, die eindeutig zuzuordnen sind. Ein drittes wurde heute gefunden.«
»Was lässt darauf schließen, dass da ein Zusammenhang besteht?«
»Die ersten beiden Morde wurden an verschiedenen Orten in der Stadt verübt, im Abstand von ungefähr einer Woche. Aber sie waren so gut wie identisch.«
»Besteht die Übereinstimmung im Vorgehen des Mörders oder in den Charakteristika der Opfer?«
»Beides. Vom viktimologischen Standpunkt aus betrachtet sieht es aus, als wäre ein Opfer die Kopie des anderen. Beides weiße Männer. Beide einundfünfzig Jahre alt. Dieselbe Augen- und Haarfarbe. Beide geschieden. Sie fuhren sogar die gleiche Automarke. Ford Pick-ups.«
»Wie sind sie gestorben?«
»Im Grunde durch Strangulieren. Aber es gab eine Menge Anzeichen für mehrfache Todesursachen. Zahlreiche Stichwunden, Einwirkung von stumpfen Gegenständen, sogar Brandverletzungen.«
»Also haben wir es mit einem Serienmörder zu tun, der weiße Männer mittleren Alters hasst?«
»Nicht ausschließlich. Das dritte Opfer ist eine weiße Frau von Mitte dreißig. Ein paar Jungs haben ihre Leiche heute Nachmittag gefunden.«
»Warum geht die Polizei davon aus, dass ein Zusammenhang zu dem Mord an den beiden Männern besteht?«
»Zum einen wurde sie auch stranguliert. Zum anderen gab es auch bei ihr auffällig viele andere Verletzungen. Aber die Cops sind nicht sicher, dass es eine Verbindung gibt. Deshalb haben sie das FBI eingeschaltet. Ich habe den Eindruck, dass die Genies drüben in Quantico noch nicht einmal von einem Serienmörder ausgehen. Deshalb schicken sie wohl auch Santos von der ISU anstelle eines Profilers von der CASKU.«
Andie nickte, obwohl sie nicht besonders vertraut war mit der Arbeitsteilung des FBI zwischen der ISU, die die Erstellung von Täterprofilen ursprünglich entwickelt hatte, und der CASKU, der Einheit für Kindesentführung und Serienmörder, die erst vor einiger Zeit ins Leben gerufen worden war.
Sie blieben an der Ecke bei Andies Wagen stehen. »Und welche Aufgabe haben Sie für mich vorgesehen?«, fragte sie.
»Ich möchte, dass Sie die Koordination vor Ort übernehmen. Arbeiten Sie mit Santos zusammen. Sorgen Sie dafür, dass sie alles, was sie braucht, bekommt, solange sie hier bei uns ist.«
Andie zögerte, sie war überrascht. »Sie können sich vorstellen, dass ich nichts lieber täte, als an der Seite von Victoria Santos zu arbeiten. Aber es gibt mindestens fünfzehn andere Agenten in der Dienststelle, die sich um diese Aufgabe reißen würden.«
»Sie sind die Einzige mit einem Abschluss in Psychologie. Und das ist bei diesem Fall so gut wie eine Grundvoraussetzung für jeden Agenten, der darauf hofft, bei der ISU Fuß fassen zu können. Warum soll man den Auftrag an jemanden verschwenden, der ohnehin keine Chance hat, da reinzukommen?«
»Isaac, ich weiß das wirklich zu schätzen. Aber ich will ganz offen sein. Ich möchte nicht, dass diese Entscheidung nur auf Mitgefühl wegen der Ereignisse am Samstag beruht.«
»Das hier ist keine Wohltätigkeitsveranstaltung. Es ist einfach nur gutes Timing. Sie sind qualifiziert. Es ist das, was Sie immer machen wollten. Und Sie haben Zeit. Ehrlich gesagt, nachdem Sie jetzt ihre Hochzeitsreise abgesagt haben, sind Sie der einzige Agent in Seattle, dessen Terminkalender in den nächsten zwei Wochen völlig leer ist.«
»Sieht ja ganz so aus, als ob Rick mir einen Gefallen getan hätte.«
»Vielleicht hat er sogar uns beiden einen Gefallen getan.«
Für den Bruchteil einer Sekunde überlegte sie, ob seine Worte eher privat als dienstlich gemeint waren. Bevor sie weiter darüber nachdenken konnte, hatte er schon seinen Aktenkoffer geöffnet und übergab ihr einen Ordner.
»Hier sind Kopien des Materials, das wir an Santos geschickt haben. Polizeiprotokolle, Autopsieberichte, Fotos der Tatorte – alles, was sie über die ersten beiden Verbrechen haben wollte. Gehen Sie es heute Abend durch.«
Die Fußgängerampel sprang auf Grün um. Isaac stand schon mit einem Fuß auf der Straße. Andie klemmte den Ordner unter ihren Arm und blieb an der Ecke stehen.
»Ach ja«, sagte er, »seien Sie um Punkt acht morgen früh in meinem Büro. Und machen Sie sich darauf gefasst, dass das hier Knochenarbeit wird.«
Kalter Regen setzte ein. Andie öffnete ihren Regenschirm. »Soll ich Sie bis zu Ihrem Wagen mitnehmen?«
»Schon gut. Ich steh bloß einen halben Block weg.« Er wandte sich um.
»Isaac«, sagte sie. Er blieb stehen. »Danke.«
Der Regen wurde heftiger. Er salutierte scherzhaft und eilte über die Straße. Andie sah ihm nach. Auf halbem Wege kam er auf dem nassen Pflaster ins Rutschen, fing sich aber wieder und setzte seinen Weg fast ohne Unterbrechung fort. Triumphierend reckte er eine Faust in die Luft.
B. J. Bond, dachte sie lächelnd und ging zu ihrem Wagen.
5
Von der Polizei bekam Gus nicht die Hilfe, die er sich erhofft hatte. Eine fünfunddreißigjährige Frau, die in einer zerrütteten Ehe lebte und weniger als vierundzwanzig Stunden vermisst wurde, galt für sie nicht als Opfer eines Gewaltverbrechens, sondern eher als Kandidatin für eine außereheliche Affäre. Sie ließen ihn eine Vermisstenmeldung ausfüllen. Abgesehen davon war Gus ziemlich auf sich allein gestellt.
Er sagte all seine Termine für den Montag ab und verbrachte den Vormittag und die meiste Zeit des Nachmittags mit dem Versuch, Beths Wochenende zu rekonstruieren. Er rief die Kreditkartengesellschaften an, um herauszufinden, wo sie mit der Karte bezahlt hatte. Dann suchte er die in Frage kommenden Geschäfte und Restaurants auf. Ihm selbst war es peinlich, dass sein jüngstes Foto von Beth fast ein Jahr alt war; um ihre Beziehung stand es wirklich sehr schlecht. Dennoch erkannte eine der Verkäuferinnen im Kaufhaus Nordstrom’s sie wieder. Sie hatte Beth seit Wochen nicht mehr gesehen. Alle anderen konnten sie nicht einmal zuordnen.
Gegen fünfzehn Uhr erhielt er einen Notfallanruf von einem dieser ach so rücksichtsvollen Mandanten, die nicht einmal eine »Familienangelegenheit« als Verhinderungsgrund akzeptieren. Aus zwei Minuten wurden zehn, aus zehn wurden fünfunddreißig. Schließlich musste Gus leere Batterien in seinem Handy vortäuschen, um seine Ruhe zu haben. Er verbrachte den größten Teil des Nachmittags zu Hause damit, herumzutelefonieren. Beth hatte eine Adressenliste auf ihrem Rechner gespeichert, die er in alphabetischer Reihenfolge durchging. Er rief bei jedem eingetragenen Namen an, um zu fragen, ob jemand sie gesehen hatte. Nach einer Weile machte er das nur noch ganz mechanisch und verlor darüber irgendwann das Zeitgefühl. Er war gerade bei den Adressen, die mit P anfingen, als es an der Tür klingelte.
Gus öffnete. Carla stand draußen mit einem abgedeckten Topf.
»Ich bringe das Abendessen für Morgan.«
Bevor er sie hereinbitten konnte, war sie schon unterwegs in die Küche. »Kann ich auch was davon haben?«
Der Scherz konnte das Eis nicht brechen. »Es ist so«, sagte er, »dass Morgan bei einer Freundin zu Abend isst. Ich habe den ganzen Tag telefoniert. Ich wollte sie nicht dabeihaben.«
»Die Geschäfte müssen weiterlaufen, wie?«
»Es hatte nichts mit Geschäften zu tun. Ich habe versucht, Beth zu finden.«
»Oh«, erwiderte Carla verlegen. Ihre Streitlust ließ ein wenig nach. »Ich übrigens auch.«
»Hast du irgendwas rausgefunden?«
Sie stellte die Kasserolle auf die Anrichte und zog ihre Handschuhe aus. »Nein. Aber das hat nichts zu sagen. Es ist ja noch nicht so viel Zeit vergangen.«
Gus wandte den Blick ab, dann sah er sie wieder an. »Darf ich dich etwas Persönliches fragen?«
»Kommt drauf an.«
»Vergiss einfach einen Moment, dass du meine Schwester bist. Sieh dich einfach als Beth’ beste Freundin.«
»Okay.«
»In letzter Zeit habe ich euch beide nicht mehr so häufig zusammen gesehen. Manchmal können enge Freundinnen wie Schwestern sein. Manchmal sieht es aber auch nur so aus. Steht ihr euch sehr nahe?«
Sie verzog das Gesicht, als sei die Frage kompliziert. »Es gab eine Zeit, da haben wir uns sehr nahe gestanden.«
»Aber in letzter Zeit nicht?«
»Wir waren uns schon mal vertrauter. Es hat keinen Riesenkrach oder so gegeben. Aber es stimmt, was ich dir heute Morgen gesagt habe. Beth ist seit einigen Monaten wirklich unglücklich. Sie wurde ziemlich unnahbar.«
Gus nickte. »Genau das ist auch mein Eindruck. Ich bin ihr ganzes Adressbuch durchgegangen und habe alle ihre Freunde und Freundinnen angerufen. Keiner von ihnen hat sie in den vergangenen zwei Monaten gesehen oder auch nur mit ihr telefoniert.«
»Vielleicht hat sie sich zu sehr geschämt. Misshandelte Frauen geben sich oft selbst die Schuld.«
Er wandte sich verärgert ab. »Ich habe nie die Hand gegen Beth erhoben. Ich weiß nicht, warum sie so etwas erzählt hat. Höchstens, um mich zu verletzen.«
»Gus Wheatley soll ein Opfer sein? Das glaube ich nicht. Wie ich sie in letzter Zeit erlebt habe, hätte sie eher sich selbst etwas angetan, als dich zu verletzen.«
Sie starrten einander unvermittelt an, wie vom Blitz getroffen. Jeder hätte genau sagen können, was der andere dachte. »Du glaubst doch nicht …?«, sagte Gus.
»O Gott, ich hoffe nicht.«
Das Telefon klingelte. Gus nahm beim zweiten Läuten ab. »Hallo. Ja, das bin ich.« Er begann, auf und ab zu gehen, und hörte gespannt zu. Seine Augen spiegelten Besorgnis wider, die sich in Panik verwandelte.
»Ich kann in zwanzig Minuten da sein«, sagte er schließlich und legte auf.
Carla schien vor Anspannung zu platzen. »Was ist los?«, fragte sie eindringlich.
»Die Polizei hat im Washington Park Arboretum eine Leiche gefunden. Es soll sich um eine Frau von Mitte dreißig handeln.«
Sie hob vor Schreck eine Hand an den Mund. »Ist es –«
»Keine Ahnung. Ich soll hinkommen, um sie zu identifizieren.« Er musste schwer schlucken und sagte mit krächzender Stimme: »Sie meinen, es könnte Beth sein.«