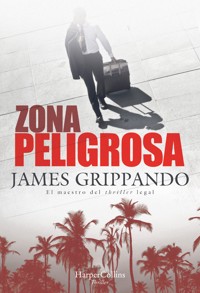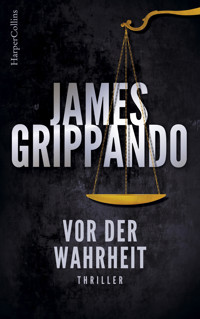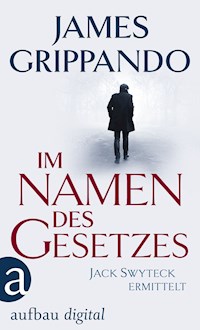
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Anwalt Jack Swyteck ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
In einem aufsehenerregenden Prozess gelingt es Jack Swyteck, den Freispruch eines Mandanten zu erwirken. Mit fatalen Folgen: Der Mann, der des Mordes angeklagt war, kündigt an weiterzutöten. Jack zweifelt am Sinn seines Berufes und kündigt fristlos. Kurz darauf wird sein ehemaliger Mandant ermordet und Jack selbst steht auf einmal unter Mordverdacht …
Der erste Fall für Jack Swyteck! Spannend, rasant und äußerst raffiniert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Ähnliche
Über das Buch
In einem aufsehenerregenden Prozess gelingt es Jack Swyteck, den Freispruch eines Mandanten zu erwirken. Mit fatalen Folgen: Der Mann, der des Mordes angeklagt war, kündigt an weiterzutöten. Jack zweifelt am Sinn seines Berufes und kündigt fristlos. Kurz darauf wird sein ehemaliger Mandant ermordet und Jack selbst steht auf einmal unter Mordverdacht …
Der erste Fall für Jack Swyteck! Spannend, rasant und äußerst raffiniert.
Über James Grippando
James Grippando ist Autor diverser New York Times-Bestseller. Er arbeitete zwölf Jahre als Strafverteidiger bevor sein erstes Buch »Im Namen des Gesetzes« 1994 veröffentlicht wurde und ist weiterhin als Berater für eine Kanzlei tätig. Er lebt mit seiner Familie im Süden Floridas.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
James Grippando
Im Namen des Gesetzes
Roman
Aus dem Englischen von Hans-Jürgen Heckler
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
1 Oktober 1992
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
2 Juli 1994
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
3 Dienstag, 2. August
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
4 Dienstag, 11. Oktober
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
5 Samstag, 29. Oktober
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
Epilog: Januar 1995
Danksagung
Impressum
Meinen Eltern
1 Oktober 1992
Prolog
Das Ritual hatte bei Einbruch der Dämmerung begonnen, und es würde die ganze Nacht dauern. Nach Mitternacht waren Wolken aufgezogen und hatten den Vollmond verdunkelt. Es war, als hätte der Himmel sein allwissendes Auge aus Kummer oder nur aus purer Gleichgültigkeit geschlossen. Noch sechs Stunden Dunkelheit und Warten, bis die rote Morgensonne über den Kiefern und Palmen im Nordosten Floridas aufgehen würde. Dann, genau um 7.00 Uhr morgens, würde Raul Fernandez hingerichtet werden.
Eine Menschenmenge versammelte sich vor dem Maschendrahtzaun, der das größte Hochsicherheitsgefängnis des Staates umgab. Stille und einige trübe Lichter drangen aus dem kastenförmigen dreistöckigen Gebäude jenseits des Gefängnishofes, einem menschlichen Arsenal nutzloser Teile und gebrochener Seelen. Bewaffnete Posten liefen in ihren Wachtürmen auf und ab, nur schemenhaft erkennbar im Spiel der Suchscheinwerfer. In dieser Nacht waren nicht so viele Zuschauer gekommen wie in jenen Tagen, als Hinrichtungen in Florida noch fette Schlagzeilen machten und kein kümmerliches Dasein neben dem Wetterbericht fristeten. Dennoch war das übliche Geschrei ausgebrochen, als der schwarze Leichenwagen erschien, der den Toten abtransportieren würde. Die lautesten Zuschauer johlten und grölten von den Ladeflächen ihrer Pickups, nuckelten an ihren langhalsigen Budweiser-Flaschen und schwenkten Spruchbänder mit der Aufschrift AUF GEHT’S SPARKY, dem Kosenamen, den Befürworter der Todesstrafe dem »Stuhl« gegeben hatten.
Die Eltern des Opfers starrten mit ruhiger Entschlossenheit durch den Maschendrahtzaun. Alles, was sie wollten, war Vergeltung, da es ohnehin weder gerecht war noch Sinn hatte, daß ihrer Tochter die Kehle aufgeschlitzt worden war. Auf der anderen Straßenseite wurden bei Kerzenlicht und Gitarrengeklimper von den einstigen Blumenkindern einer engagierten Generation die Namen von John Lennon und Joan Baez heraufbeschworen. Die Jahre und die Last aller Probleme dieser Welt hatten auf ihren besorgten Gesichtern Spuren hinterlassen. Neben einer Gruppe von Nonnen, die zum Gebet niedergekniet waren, riefen einige Bewohner von Little Havanna, Miamis kubanischem Viertel, in ihrer spanischen Muttersprache: »Raul es inocente!«
Hinter den Backsteinmauern und den vergitterten Fenstern des Gefängnisses hatte Raul Fernandez gerade seine letzte Mahlzeit beendet – eine Riesenportion honigglasierter Hähnchenflügel mit Kartoffelpüree – und stattete nun dem Gefängnisfrisör einen letzten Besuch ab. Eskortiert von bewaffneten Wärtern in gestärkten braun-beigen Uniformen, nahm er auf einem durchgesessenen, lederbezogenen Frisörstuhl Platz, der fast so unbequem war wie der kastenförmige Holzthron, auf dem er sterben sollte. Die Wärter schnallten ihn fest und bezogen ihre Posten – der eine an der Tür, der andere neben dem Gefangenen.
»Der Frisör kommt gleich«, sagte einer der Wärter. »Bleib schön ruhig sitzen.«
Fernandez saß bewegungslos da und wartete, als ob ihn jeden Augenblick der erste Stromstoß treffen könnte. Seine blutunterlaufenen Augen blinzelten unter dem grellen Schein des weißen Lichts, das die weißgetünchten Zementwände und der weiße Kachelboden reflektierten. Er gestattete sich einen Augenblick bitterer Ironie, als ihm bewußt wurde, daß sogar die Wärter weiß waren.
In der Tat war alles weiß, bis auf den Mann, der sterben sollte. Fernandez war einer von Tausenden kubanischer Flüchtlinge, die 1980 während der Mariel-Seebrücke in Miami gelandet waren. Ein Jahr später wurde er wegen Mordes verhaftet. Die Geschworenen benötigten für die Urteilsfindung weniger Zeit als das junge Opfer, um an seinem eigenen Blut zu ersticken. Der Richter verurteilte ihn zum Tode durch den elektrischen Stuhl, und nach einem zehn Jahre dauernden Gang durch alle Instanzen war nun seine Zeit gekommen.
»Morgen, Sportsfreund«, sagte der stämmige Wärter, der an der Tür Posten bezogen hatte.
Der Gefangene beobachtete ängstlich, wie ein dickwanstiger Frisör mit Blumenkohlohren und einem selbstfabrizierten Matrosenhaarschnitt in den Raum trat. Seine Bewegungen waren langsam und überlegt. Er schien es zu genießen, daß für Fernandez jeder Augenblick eine Ewigkeit bedeutete. Grinsend stand er vor seinem gefangenen Kunden, den unverwüstlichen elektrischen Rasierer in der einen Hand und eine große Plastiktasse mit dem schwärzesten Tee, den Fernandez je gesehen hatte, in der anderen.
»Auf die Minute«, sagte der Frisör durch seine tabakgelben Zähne. Er spuckte seinen braunen Schleim in die Tasse, stellte sie auf die Ablage und blickte Fernandez prüfend an. »Tatsächlich«, schnaufte er, »du siehst genauso aus wie im Fernsehen.«
Fernandez saß mit versteinertem Gesicht auf dem Stuhl und ignorierte die Bemerkung.
»Hab’ ’n Louis-Armstrong-Schnitt im Angebot heute«, sagte der Frisör, während er seinen Rasierer einschaltete.
Krauses schwarzes Haar fiel auf den Boden, als der Rasierapparat den dichten Haarschopf des Gefangenen in Stoppeln verwandelte, die von nervösem Schweiß glänzten. Im gegebenen Augenblick zogen die Wärter Fernandez die Hosenbeine hoch, und der Friseur rasierte ihm die Fesseln. Danach war der Gefangene so präpariert, daß man ihn an beiden Enden anschließen, seinen kahlen Kopf und die enthaarten Fesseln gleichsam als menschliche Steckdosen für den Spannungsstoß von mehreren tausend Volt benutzen konnte, die seine Haut versengen, sein Blut zum Sieden bringen und sein Leben auslöschen würden.
Der Frisör trat einen Schritt zurück, um seine Arbeit zu bewundern. »Also, wenn das kein heißer Schnitt ist«, sagte er. »Darauf gibt’s sogar ’ne lebenslange Garantie.«
Die Wärter kicherten, während Fernandez die Fäuste ballte.
Ein kurzes Klopfen an der Tür brach die Spannung. Die Schlüssel des stämmigen Wärters klirrten, als er die Tür öffnete. Raul hörte Gemurmel, konnte jedoch trotz aller Anstrengung nicht verstehen, was gesagt wurde. Schließlich drehte sich der Wärter mit verärgerter Miene zu ihm um.
»Fernandez, ein Anruf für dich. Dein Anwalt.«
Rauls Kopf schnellte nach oben.
»Na los«, befahl der Wärter, während er den Gefangenen am Arm packte.
Fernandez schoß aus dem Stuhl hoch.
»Immer schön langsam!« sagte der Wärter.
Fernandez kannte die Übung. Er streckte die Arme vor, und der Wärter legte ihm die Handschellen an. Dann ließ er sich auf die Knie fallen, damit der andere Wärter ihm von hinten die Beinschellen anlegen konnte. Er erhob sich langsam, aber ungeduldig, und ging so schnell wie seine Ketten und die bewaffneten Begleiter es erlaubten durch die Tür und in den Gang hinaus. Sofort war er in der kleinen, in einer Nische versteckten Telefonzelle, in der die Gefangenen die Anrufe ihrer Anwälte entgegennahmen. Sie hatte ein rautenförmiges Fenster in der Tür, das es den Wachen ermöglichte, die vertraulichen Gespräche, wenn schon nicht zu hören, so doch zumindest zu beobachten.
»Was haben Sie gesagt, Mann?«
Am anderen Ende der Leitung entstand eine Pause, die nichts Gutes verhieß.
»Es tut mir leid, Raul«, sagte sein Anwalt.
»Nein!« Er schlug mit der Faust auf die Ablage. »Das kann nicht wahr sein! Ich bin unschuldig! Ich bin unschuldig!« Er schnappte mehrmals wütend nach Luft, während seine Augen wie wild durch die kleine Kabine schossen, als könnte er dort die Lösung finden. Der Anwalt fuhr mit leiser, ruhiger Stimme fort. »Ich habe Ihnen versprochen, Raul, daß ich nicht um den heißen Brei reden werde. Wir haben wirklich alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft. Das Ergebnis könnte schlimmer nicht sein. Der Oberste Gerichtshof hat nicht nur Ihren Antrag auf Vollstreckungsaufschub abgelehnt, sondern außerdem eine Verfügung erlassen, die es jedem anderen Gericht im Land verbietet, Ihnen einen Aufschub zu gewähren.«
»Warum? Ich will wissen, warum, verdammt noch mal!«
»Das Gericht hat nicht gesagt, warum – und das braucht es auch nicht«, erwiderte sein Anwalt.
»Dann sagen Sie es mir! Irgend jemand muß mir doch sagen können, warum man mir das antut!«
In der Leitung war es still.
Raul legte ungläubig die Hand an den Kopf, aber das fremde Gefühl der Kahlheit verstärkte nur noch das, was er gerade gehört hat. »Das ist … irgendwie … hören Sie, wir müssen etwas unternehmen«, sagte er mit bebender Stimme. »Wir waren doch schon mal an dem Punkt, ich und Sie. Machen Sie’s wie letztes Mal. Legen Sie noch mal Berufung ein, stellen Sie ’n Antrag oder wie zum Teufel ihr Anwälte diese Sachen nennt. Alles, was ich brauche, is’ ’n bißchen Zeit. Aber beeilen Sie sich, Mann. Die haben schon meinen verdammten Schädel kahlgeschoren!«
Sein Anwalt seufzte so laut, daß es in der Leitung knackte.
»Kommen Sie«, sagte Fernandez verzweifelt. »Es muß doch irgend etwas geben, was Sie tun können.«
»Da wäre vielleicht noch eine Möglichkeit«, sagte sein Anwalt ohne Begeisterung.
»Na siehste, Junge!« Fernandez kam wieder in Schwung und ballte die Fäuste für eine weitere Runde.
»Wir haben eine Chance von eins zu einer Million«, sagte der Anwalt, um seinen Mandanten auf den Boden zurückzuholen. »Es gibt vielleicht einen neuen Punkt, an dem man ansetzen könnte. Ich werde den Gouverneur bitten, die Strafe umzuwandeln. Aber ich will Ihnen nichts vormachen. Sie müssen auf das Schlimmste gefaßt sein. Sie wissen ja, daß der Gouverneur es war, der Ihr Todesurteil unterschrieben hat. Es ist unwahrscheinlich, daß er das Urteil in eine lebenslängliche Freiheitsstrafe abmildert. Verstehen Sie, was ich meine?«
Fernandez schloß fest die Augen und schluckte seine Angst hinunter, aber er gab die Hoffnung nicht auf. »Ich verstehe, Mann, wirklich. Aber machen Sie’s. Machen Sie’s einfach. Und danke, Mann. Danke, und Gott segne Sie«, fügte er hinzu und hängte ein.
Er atmete tief durch und sah auf die Uhr an der Wand. Acht Minuten nach zwei. Nur noch vier Stunden zu leben.
1. Kapitel
Es war 5.00 Uhr morgens, und Gouverneur Harold Swyteck war endlich auf seiner Couch eingeschlafen. Schlaf ermöglichte ihm in den Nächten vor Hinrichtungen eine Art Flucht, was jeden erstaunt hätte, der wußte, wie der Gouverneur immer wieder die Notwendigkeit unterstrich, »diese Langzeitmieter« in Floridas überfüllten Todestrakten zur Räumung zu zwingen. Harold Swyteck, der als Polizist begonnen hatte und danach Mitglied der Gesetzgebenden Versammlung des Staates geworden war, hatte für den Gouverneursposten mit einem auf dem Ruf nach Recht und Ordnung basierenden Wahlprogramm kandidiert, das mehr Gefängnisse, längere Freiheitsstrafen und mehr Todesurteile als schnelle und sichere Mittel gegen die dramatisch ansteigende Kriminalität forderte. Nachdem er mit einer ausreichenden Mehrheit ins Amt gewählt worden war, hatte er sein Wahlversprechen sofort eingelöst und noch am Tage seiner Amtseinführung im Januar 1991 das erste Todesurteil unterzeichnet. In den folgenden einundzwanzig Monaten hatten mehr Todesurteile die Unterschrift des Gouverneurs erhalten als in den zwei vorangegangenen Amtsperioden zusammen.
Um zwanzig nach fünf unterbrach ein schrilles Läuten den Schlummer des Gouverneurs. Instinktiv streckte Harry die Hand aus, um den Wecker abzustellen, aber da war kein Wecker. Das Läuten hielt an.
»Das Telefon«, stöhnte seine im behaglichen Ehebett liegende Frau von der anderen Seite des Zimmers.
Der Gouverneur schüttelte sich wach, erkannte, daß er auf der Couch lag und ging dann auf das blinkende Licht am Sicherheitstelefon neben der leeren Hälfte des Himmelbetts zu.
Er stieß sich den Zeh am Bett, bevor er das Telefon erreichte. »Verdammt noch mal! Was ist los?«
»Herr Gouverneur«, kam die Antwort, »hier ist der Sicherheitsdienst.«
»Das weiß ich, Mel. Gibt’s was Dringendes?«
Der Wachbeamte rutschte unruhig auf seinem Posten hin und her, so wie es jeder tun würde, der seinen Chef kurz vor Sonnenaufgang geweckt hatte. »Sir, da ist jemand, der Sie sprechen möchte. Es geht um die Hinrichtung.«
Der Gouverneur biß die Zähne zusammen, um nicht den Ärger über einen angestoßenen Zeh und eine schlaflose Nacht an dem Mann auszulassen, der für seine Sicherheit sorgte. »Mel, bitte! Sie können mich nicht jedesmal aufwecken, wenn in letzter Minute eine von diesen Petitionen vor meiner Haustür landet. Für diese Dinge gibt es einen Dienstweg. Wozu habe ich meine Rechtsberater? Rufen Sie die an. Und jetzt, gute …«
»Sir«, unterbrach Mel behutsam, »ich … ich verstehe Ihre Reaktion, Sir. Aber bei dem liegen die Dinge, glaube ich, etwas anders. Er sagt, er habe Informationen, die Sie davon überzeugen werden, daß Fernandez unschuldig ist.«
»Und wer ist es diesmal?« fragte Harry, während er die Augen verdrehte. »Seine Mutter? Irgendein Freund der Familie?«
»Nein, Sir, er … also, er sagt, er sei Ihr Sohn.«
Der Gouverneur war plötzlich hellwach. »Schicken Sie ihn rein«, sagte er und legte den Hörer auf. Er sah auf die Uhr. Beinahe fünf Uhr dreißig. Nur noch neunzig Minuten. Verdammt günstiger Moment für deinen ersten Besuch in meinem Amtssitz, mein Sohn.
Jack Swyteck stand steif auf der überdachten Veranda und wußte nicht, wie er den mürrischen Ausdruck auf dem Gesicht seines Vaters deuten sollte.
»Da sieh einer an«, sagte der Gouverneur, der in seinem burgunderroten Bademantel mit Monogramm in der offenen Tür verharrte. Jack war der sechsundzwanzigjährige Sohn des Gouverneurs, sein einziger Sprößling. Jacks Mutter war wenige Stunden nach seiner Geburt gestorben. Obwohl er es versucht hatte, hatte Harold seinem Sohn ihren Tod nie ganz verzeihen können.
»Ich bin in einer offiziellen Angelegenheit hier«, sagte Jack hastig. »Es dauert nur zehn Minuten.«
Über die Schwelle hinweg warf der Gouverneur seinem Sohn einen kühlen Blick zu. Mit seinen dunklen, durchdringenden Augen schien Jack seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. In dieser Nacht trug er ausgewaschene Jeans, eine Fliegerjacke aus braunem Leder und passende Stiefel. Mit seiner rauhen, breitschultrigen Erscheinung hätte man ihn leicht für einen vielumschwärmten Countrysänger halten können, obwohl seine gewählte Sprache und sein Jurastudium in Yale in eine ganz andere Richtung wiesen. Sein Vater hatte in dem Alter ganz ähnlich ausgesehen, und er war mit dreiundfünfzig immer noch schlank und muskulös. Er hatte sein Studium 1965 an der University of Florida abgeschlossen – ein geschickter Säbelfechter, der zunächst Polizist, dann Politiker geworden war. Der Gouverneur war ein Mann, der jeden Angriff abwehren, sofort zurückschlagen und dann seinem Gegner dessen eigenen Kopf überreichen konnte, wenn man nicht auf der Hut war. Sein Sohn war stets auf der Hut.
»Komm herein«, sagte Harry.
Jack trat ins Foyer, schloß die Tür hinter sich und folgte seinem Vater in die Diele. Die Räume waren kleiner als Jack erwartet hatte – elegant, aber schlicht, mit hohen Kassettendecken und Parkettböden in Eiche und Mahagoni. Stilmöbel, persische Seidenteppiche und Kristallüster bildeten die wichtigsten Einrichtungsgegenstände. Die Gemälde waren Originale und spiegelten die Geschichte Floridas wider.
»Setz dich«, sagte der Gouverneur, als er in die Bibliothek trat.
Der dunkelbraun getäfelte Raum erinnerte Jack an das Haus, in dem er aufgewachsen war. Er setzte sich in einen Ledersessel vor dem offenen Kamin, streckte die Beine aus und stützte die Stiefel respektlos auf den Kopf eines großen Braunbären, den sein Vater vor Jahren in Alaska zur Strecke gebracht und in einen Teppich verwandelt hatte. Der Gouverneur wandte den Blick ab und unterdrückte den Wunsch, seinem Sohn zu sagen, er möge sich ordentlich hinsetzen. Er trat hinter die große Bar aus Eichenholz und füllte sein altmodisches Glas mit Eiswürfeln.
Jack traute seinen Augen nicht. Er dachte, sein Vater hätte mit dem Trinken von hochprozentigem Alkohol aufgehört – andererseits war dies auch das erstemal, daß er ihn als Gouverneur Swyteck sah. »Mußt du unbedingt trinken? Wie ich schon sagte, bin ich in einer offiziellen Angelegenheit hier.«
Der Gouverneur warf ihm einen strafenden Blick zu, griff nach einer Flasche Chivas Regal und füllte sein Glas bis zum Rand. »Und das« – er erhob sein Glas –, »ist ausschließlich meine Angelegenheit. Prost.« Er nahm einen kräftigen Schluck.
Jack sah schweigend zu und versuchte sich wieder auf sein eigentliches Anliegen zu konzentrieren.
»So«, sagte der Gouverneur, mit den Lippen schmatzend. »Ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann wir beide das letztemal miteinander geredet, geschweige denn uns gesehen haben. Wie lang ist das her?«
Jack zuckte die Schultern. »Zwei, zweieinhalb Jahre.«
»Seit deinem Juraexamen, oder?«
»Nein.« Jacks Ausdruck verriet ein wenn auch noch so schwaches Lächeln. »Seit ich dir sagte, daß ich einen Job beim Freedom Institute annehmen würde.«
»Ach, ja, das Freedom Institute.« Harry Swyteck verdrehte die Augen. »Der Ort, wo die Anwälte ihren Erfolg daran messen, wie viele Mörder, Frauenschänder und Räuber sie wieder auf freien Fuß bekommen. Der Ort, wo Liberale blutenden Herzens Schuldige verteidigen und dabei noch unerträglich scheinheilig sein können, weil sie von dem Pack, das sie verteidigen, kein Geld nehmen.« Er blickte verbittert. »Der einzige Ort, von dem du wußtest, daß es mich um den Verstand bringen würde, wenn du dort arbeitest.«
Jack klammerte sich fest an die Sessellehne. »Ich bin nicht hierhergekommen, um alte Wunden wieder aufzureißen.«
»Das glaube ich dir gerne. Es ist sowieso fast immer dieselbe alte Geschichte. Zugegeben, das letztemal ist der Graben zwischen uns noch etwas tiefer geworden. Aber im Grunde war es das gleiche wie die anderen Male, als du mich aus deinem Leben verbannt hast. Du wirst nie begreifen, daß ich immer nur das Beste für dich wollte.«
Jack wollte schon etwas zu der angemaßten Unfehlbarkeit seines Vaters sagen, wurde aber durch etwas auf dem Bücherregal abgelenkt. Es war ein altes Foto von ihnen beiden, zusammen beim Hochseefischen in einem ihrer seltenen glücklichen Augenblicke. Fall nur bei der erstbesten Gelegenheit über mich her, Vater, aber du hast da oben dieses Bild stehen, damit alle es sehen können, nicht wahr?
»Hör zu«, sagte Jack, »ich weiß, daß es Dinge gibt, über die wir reden müssen. Aber dies ist nicht der richtige Augenblick. Deshalb bin ich nicht hergekommen.«
»Ich weiß. Du bist gekommen, weil Raul Fernandez in« – der Gouverneur sah auf seine Uhr – »etwa achtzig Minuten auf dem elektrischen Stuhl sterben soll.«
»Ich bin gekommen, weil er unschuldig ist.«
»Die zwölf Geschworenen waren nicht der Meinung, Jack.«
»Sie haben nicht die ganze Geschichte gehört.«
»Sie haben genug gehört, um ihn nach nicht einmal zwanzigminütiger Beratung zu verurteilen. Ich habe Geschworene gekannt, die länger brauchten, um sich zu entscheiden, wer ihr Sprecher sein sollte.«
»Würdest du mir bitte nur mal zuhören«, sagte Jack aufbrausend. »Bitte, Vater« – er bemühte sich um einen ruhigeren Ton –, »hör mir zu.«
Der Gouverneur schenkte sich ein zweites Glas ein. »Also gut«, sagte er. »Ich höre.«
Jack beugte sich vor. »Vor ungefähr fünf Stunden rief mich ein Mann an und sagte, er müsse mich unbedingt sprechen … vertraulich, als Mandant. Er wollte seinen Namen nicht nennen, aber er sagte, es gehe um Leben und Tod, und so erklärte ich mich bereit, ihn zu treffen. Zehn Minuten später tauchte er in meinem Büro auf, mit einer Skimaske über dem Gesicht. Zuerst dachte ich, es sei ein Raubüberfall, doch dann stellte sich heraus, daß er nur über den Fall Fernandez reden wollte. Und das war dann auch alles, was wir taten … reden.« Er hielt inne und sah seinem Vater direkt in die Augen. »Und in weniger als fünf Minuten hatte er mich überzeugt, daß Raul Fernandez unschuldig ist.«
Der Gouverneur blickte skeptisch. »Und was hat dieser mysteriöse nächtliche Besucher dir erzählt?«
»Darüber kann ich nicht sprechen.«
»Warum nicht?«
»Das sagte ich dir ja: Er wollte vertraulich mit mir reden, als mein Mandant. Ich habe sein Gesicht nie gesehen, und ich bezweifle, daß ich ihn je wiedersehen werde, aber juristisch gesehen bin ich sein Anwalt – oder war es zumindest für die Dauer dieser Unterhaltung. Jedenfalls unterliegt alles, was er mir erzählt hat, der anwaltlichen Schweigepflicht. Ohne seine Einwilligung kann ich nichts davon preisgeben. Und er wird mir bestimmt nicht erlauben, auch nur ein Wort zu wiederholen.«
»Aber warum bist du dann hier?«
Jack warf ihm einen ernüchternden Blick zu. »Weil ein unschuldiger Mann auf dem elektrischen Stuhl sterben wird, wenn du Fernandez’ Hinrichtung nicht sofort stoppst.«
Der Gouverneur lief langsam durch den Raum, das Glas in der einen und eine offene Flasche Scotch in der anderen Hand. Er setzte sich in den Sessel Jack gegenüber. »Und ich frage dich noch einmal: Woher willst du wissen, daß Fernandez unschuldig ist?«
»Woher ich das wissen will?« Jacks Gesicht wurde rot vor Wut. »Warum verlangst du immer mehr, als ich geben kann? Daß ich hier mitten in der Nacht hereingestürzt komme, reicht dir wohl nicht. Daß ich dir alles erzähle, was ich juristisch und moralisch verantworten kann, ist dir einfach nicht genug.«
»Alles, was ich sagen will, ist, daß ich Beweise brauche. Ich kann nicht einfach einen Vollstreckungsaufschub veranlassen, der sich auf … ja eigentlich auf nichts gründet.«
»Mein Wort bedeutet dir also nichts«, interpretierte Jack.
»In dieser Situation, nein – und so muß es auch sein. In diesem Kontext bist du der Anwalt, und ich bin der Gouverneur.«
»Nein – in diesem Kontext bin ich ein Zeuge, und du bist ein Mörder. Weil du Fernandez hinrichten läßt. Und ich weiß, daß er unschuldig ist.«
»Woher weißt du das?«
»Weil ich den wirklichen Mörder heute nacht getroffen habe. Er hat ein Geständnis abgelegt. Und nicht nur das: Er hat mir etwas gezeigt, was beweist, daß er der Mörder ist.«
»Und was war das?« fragte der Gouverneur mit ernsthaftem Interesse.
»Das kann ich dir nicht erzählen«, sagte Jack. Er spürte, wie seine Frustration wuchs. »Ich habe ohnehin schon mehr gesagt, als mir meine Schweigepflicht erlaubt.«
Mit einem dünnen, paternalistischen Lächeln lehnte sich der Gouverneur in seinem Sessel zurück. »Glaubst du nicht, daß du ein bißchen naiv bist? Du mußt diese Gesuche in letzter Minute im Zusammenhang sehen. Fernandez ist ein verurteilter Mörder. Er und jeder, der ihn kennt, ist verzweifelt. Man kann nicht alles, was sie sagen, für bare Münze nehmen. Dieser sogenannte Mandant, der bei dir aufgetaucht ist, ist mit Sicherheit ein Cousin oder ein Kumpel von Raul Fernandez, und er wird alles tun, um die Hinrichtung zu verhindern.«
»Das weißt du nicht!«
Der Gouverneur seufzte schwer und schlug die Augen nieder. »Du hast recht.« Er hob die Hände und begann sich die Schläfen zu reiben. »Wir sind nie ganz sicher. Vielleicht ist das der Grund, weshalb ich damit angefangen habe«, sagte er, während er nach der Flasche Scotch griff und sie hochhob. »Aber die rauhe Wirklichkeit ist, daß ich für den Gouverneursposten kandidiert habe als ein Mann, der für Recht und Ordnung eintritt. Ich habe die Todesstrafe zu meinem zentralen Wahlkampfthema gemacht. Ich versprach, sie mit aller Härte anzuwenden, und damals stand ich voll hinter dem, was ich sagte. Jetzt, wo ich hier bin, ist es nicht mehr ganz so leicht, meinen Namen unter ein Todesurteil zu setzen. Du kennst sie ja – diese unheilvollen Dokumente mit dem schwarzen Rand und dem geprägten Staatssiegel. Aber hast du auch schon mal durchgelesen, was darin steht? Ich habe es, glaub mir.« Seine Stimme wurde brüchig. »Diese Art von Macht kann einem zu Kopf steigen, wenn man es zuläßt. Zum Teufel«, spottete er und nahm einen Schluck aus seinem Glas, »und Ärzte glauben, sie seien Gott.«
Jack schwieg, weil ihn dieser seltene Einblick in die Psyche seines Vaters überraschte und er nicht genau wußte, wie er reagieren sollte. »Das ist ein Grund mehr, mir zuzuhören«, sagte er schließlich. »Um sicherzugehen, daß du keinen Fehler machst.«
»Ich mache keinen Fehler, Jack. Begreifst du das denn nicht? Was du nicht sagst, ist genauso wichtig wie das, was du sagst. Du willst deine Schweigepflicht nicht verletzen, nicht einmal um mich dazu zu bewegen, meine Meinung in bezug auf die Hinrichtung zu ändern. Ich respektiere das, Jack. Aber du mußt auch meinen Standpunkt respektieren. Ich habe Regeln. Ich habe Verpflichtungen, genau wie du. Meine sind die, die ich gegenüber denen eingegangen bin, die mich gewählt haben – und die von mir erwarten, daß ich meine Wahlversprechen halte.«
»Das ist nicht dasselbe.«
»Das stimmt«, räumte der Gouverneur ein. »Es ist nicht dasselbe. Deshalb möchte ich auch nicht, daß du dir irgendwelche Vorwürfe machst, wenn du nachher von hier fortgehst. Du hast alles getan, was du konntest. Jetzt ist es an mir, eine Entscheidung zu treffen. Und ich treffe sie. Ich glaube nicht, daß Raul Fernandez unschuldig ist. Aber wenn du es glaubst, möchte ich nicht, daß du dich für seinen Tod verantwortlich fühlst.«
Jack sah seinem Vater in die Augen. Er wußte, daß dieser Mann die Hand nach ihm ausstreckte, daß er etwas von seinem Sohn erwartete, eine entsprechende Bestätigung etwa, daß Jack ihn auch nicht dafür verantwortlich machte, daß er seine Arbeit tat. Harold Swyteck bat um Absolution, um Vergebung – um Gnade.
Jack wandte den Blick ab. Er wollte – konnte – es nicht zulassen, daß seine Entschlossenheit durch einen Augenblick der Schwäche ins Wanken geriet. »Mach dir keine Sorgen, Vater. Ich werde mir keine Vorwürfe machen. Es ist so, wie du immer gesagt hast: Wir sind für unsere eigenen Taten selbst verantwortlich. Wenn ein unschuldiger Mann auf dem elektrischen Stuhl stirbt, bist du, als Gouverneur, der Verantwortliche. Du bist derjenige, der sich dann etwas vorzuwerfen hat.«
Jacks Worte hatten einen Nerv getroffen. Das Gesicht des Gouverneurs wurde rot vor Wut, während jedes versöhnliche Gefühl dahinschwand. »Niemand hat sich etwas vorzuwerfen«, erklärte er. »Niemand, außer Fernandez selbst. Du läßt dich doch von denen nur verarschen. Fernandez und sein Kumpel benutzen dich. Was glaubst du, warum dir der Typ seinen Namen nicht genannt hat oder dir sein Gesicht nicht zeigen wollte?«
»Weil er nicht erwischt werden will«, antwortete Jack, »aber er will ebensowenig, daß ein Unschuldiger stirbt.«
»Ein Mörder, und zwar einer von der bestialischsten Sorte, will nicht, daß ein Unschuldiger stirbt?« Harry Swyteck schüttelte verächtlich den Kopf. »Es klingt vielleicht zynisch, Jack« – jetzt sprach der blanke Zorn aus ihm –, »aber manchmal bin ich beinahe froh, daß deine Mutter starb, bevor sie sehen konnte, was für einen Dickschädel sie zur Welt gebracht hat.«
Jack erhob sich schnell von seinem Sessel. »Diese Scheiße brauche ich mir von dir nicht anzuhören.«
»Ich bin dein Vater!« tobte Harry. »Und du wirst dir anhören, was ich –«
»Nein! Ich werde mir gar nichts von dir anhören. Ich habe dich nie um etwas gebeten. Und ich will auch nichts von dir. Niemals.« Er stürmte zur Tür.
»Warte!« schrie der Gouverneur. Jack blieb wie angewurzelt stehen, drehte sich langsam um und starrte seinen Vater wütend an. »Hör mir zu, junger Mann. Fernandez wird heute morgen hingerichtet werden, weil ich nichts von diesem Unsinn über seine Unschuld glaube. Nicht mehr, als ich die Fünfvor-zwölf-Geschichte von dem letzten ›Unschuldigen‹, den wir hingerichtet haben, glaubte, der behauptete, es sei nur ein Unfall gewesen, daß er seine Freundin mit« – er hielt inne, atemlos vor Wut – »mit einundzwanzig Messerstichen umbrachte.«
»Du bist ein unglaublich verbohrter alter Mann geworden«, sagte Jack.
Der Gouverneur stand stoisch an der Bar. »Verschwinde, Jack. Verschwinde aus meinem Haus.«
Jack drehte sich um und marschierte mit seinen schweren Stiefeln durch die Diele, als ob er den harten Parkettboden strafen wollte. Er riß die Tür auf und blieb dann noch einmal stehen, als das Klirren von Eiswürfeln ihm signalisierte, daß sein Vater sich wieder ein Glas Scotch einschenkte. »Prost, Herr Gouverneur!« hallte seine Stimme durch das Foyer. »Tu uns allen einen Gefallen und sauf dich zu Tode.«
Er schlug die Tür zu und ging.
2. Kapitel
Nur noch wenige Minuten trennten Raul Fernandez vom Tod. Er hockte in sich zusammengesackt auf dem Rand der Schlafkoje in seiner Zelle, den kahlen Kopf gebeugt und die Hände zwischen den Knien gefaltet. Neben dem Gefangenen saß Pater José Ramirez, ein römisch-katholischer Priester. Er war ganz in Schwarz gekleidet, nur die weißen Haare und der weiße Stehkragen bildeten dazu einen Kontrast. Rosenkranzperlen ruhten auf dem einen, eine offene Bibel auf dem anderen Knie. Er sah Fernandez besorgt, ja fast verzweifelt an, als er erneut versuchte, die Seele des Mannes zu reinigen.
»Mord ist eine Todsünde, Raul«, sagte er. »Im Himmel gibt es keinen Platz für die, die sterben, ohne ihre Todsünden zu beichten. Im Johannesevangelium sagt Jesus zu seinen Jüngern: ›Welchen ihr die Sünden nachlasset, denen sind sie nachgelassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.‹ Laß mich deine Sünden hören, Raul, auf daß sie dir vergeben werden.«
Fernandez sah ihm direkt in die Augen. »Pater«, sagte er mit der ganzen Aufrichtigkeit, die ihm zu Gebote stand, »in diesem Augenblick habe ich nichts zu verlieren, wenn ich Ihnen die Wahrheit sage. Und ich sage Ihnen: Ich habe nichts zu beichten.«
Pater Ramirez zeigte keine Reaktion, obwohl ihm ein Schauder über den Rücken lief. Er zuckte erst zusammen, als er hörte, wie ein Schlüssel in der Stahltür klapperte.
»Es ist soweit«, verkündete der Wärter. Zwei Männer traten in die Zelle, um Fernandez abzuführen. Pater Ramirez erhob sich von seinem Stuhl, segnete den Gefangenen mit dem Zeichen des Kreuzes und trat dann zur Seite. Fernandez rührte sich nicht von seiner Schlafkoje.
»Gehn wir«, befahl der Wärter.
»Geben Sie ihm eine Minute«, sagte der Priester.
Der Wärter ging entschlossen auf den Gefangenen zu. »Wir haben keine Minute.«
Fernandez sprang plötzlich auf und stieß seine Schulter in den Bauch des ersten Wärters. Beide fielen zu Boden. »Ich bin unschuldig«, schrie er, wild gestikulierend. Der andere Wärter zückte seinen Schlagstock und drosch so lange auf den Rücken und die Schultern des Gefangenen ein, bis dieser halb gelähmt war.
»Du verrückter Hurensohn«, schrie der zu Boden gegangene Wärter, während er Fernandez auf den Bauch zwang. »Leg ihm die Schellen an«, rief er seinem Kollegen zu. Gemeinsam hielten sie ihm die Arme hinter dem Rücken fest und legten ihm dann Hand- und Beinschellen an.
»Ich bin unschuldig«, wimmerte Fernandez mit dem Gesicht auf dem Zementboden. »Ich bin unschuldig!«
»Ein Dreck bist du«, sagte der Wärter, der gerade mit dem Verurteilten gerauft hatte. Er zog einen Lederriemen aus der Tasche, knebelte den Gefangenen und band den Riemen in seinem Nacken fest zu.
Pater Ramirez sah entsetzt zu, als die Wärter Fernandez auf die Füße hoben. Da er immer noch ganz benommen von den Schlägen war, mußten sie ihn schütteln, damit er wieder zu sich kam. Das Gesetz verlangte, daß ein Verurteilter seinem bevorstehenden Tod bei vollem Bewußtsein entgegensah. Die Wärter packten ihn jeder an einem Arm und führten ihn aus der Zelle.
Der Priester war nachdenklich und verwirrt, als er dem Zug durch den hell erleuchteten Gang folgte. Er hatte schon viele Insassen von Todeszellen gesehen, aber noch keiner hatte so gekämpft wie dieser. Und mit Sicherheit hatte noch keiner so vehement seine Unschuld beteuert.
Am Ende des Ganges hielten sie an und warteten, bis sich die Stahltür der Hinrichtungskammer automatisch öffnete. Drinnen übergaben die Wärter den Gefangenen an zwei Aufseher, die auf Hinrichtungen spezialisiert waren. Sie bewegten sich schnell und routiniert, während auf der Wanduhr kostbare Sekunden verstrichen. Fernandez wurde in dem schweren Eichenstuhl festgeschnallt, und an seinem rasierten Kopf und seinen Fesseln wurden Elektroden befestigt. Der Knebel wurde aus seinem Mund entfernt und durch eine Stahlkandare ersetzt.
Alles war ruhig, bis auf das Summen der grellen Leuchtröhren an der Decke. Fernandez saß wie versteinert in seinem Stuhl. Die Wärter zogen ihm die schwarze Kapuze übers Gesicht und bezogen dann ihre Posten an den grau-grünen Wänden. Die Stahljalousien öffneten sich und gaben den Gefangenen den Blicken von drei Dutzend Zeugen auf der dunklen Seite der Glaswand preis. Einige Reporter regten sich. Ein stellvertretender Staatsanwalt blickte teilnahmslos. Der Onkel des Opfers – der einzige anwesende Verwandte des jungen Mädchens – atmete tief durch. Alle Augen außer denen des Gefangenen richteten sich auf die Uhr. Die seinen waren durch die Kapuze und ein strammes Lederband abgeschirmt, das verhindern sollte, daß die Stromstöße seine Augäpfel bersten ließen.
Pater Ramirez trat in den dunklen Bereich mit den Sitzplätzen und schloß sich den Augenzeugen an. Der Wärter an der Tür zog die Augenbrauen hoch. »Wollen Sie sich das wirklich ansehen, Pater?« fragte er leise.
»Sie wissen genau, daß ich noch nie zugesehen habe«, sagte der Priester.
»Es gibt für alles ein erstes Mal.«
»Ja«, sagte Ramirez. »In der Tat. Und ich kann nur hoffen, daß dies das letztemal ist, daß ihr jemanden hinrichtet, der, wenn mich mein Instinkt nicht täuscht, unschuldig ist.« Dann schloß er die Augen und versenkte sich ins Gebet.
Der Wärter wandte den Blick ab. Die Worte des Priesters waren treffend gewesen, aber er ließ sie an sich abprallen und tröstete sich wie jeder Normalbürger mit der Tatsache, daß nicht er es war, der jemanden tötete. Es war Gouverneur Swyteck, der das Todesurteil des Mannes unterzeichnet hatte. Es war jemand anderer, der den Schalter umlegen würde.
In diesem Augenblick erreichte der Sekundenzeiger den höchsten Punkt. Der Gefängnisdirektor gab das Zeichen, und die Lichter im ganzen Gefängnis wurden schwächer, als zweitausendfünfhundert Volt in den Körper des Gefangenen schossen. Fernandez wurde nach vorne geschleudert wie bei einem Frontalzusammenstoß, sein Rücken krümmte sich, seine Haut schmorte und zischte. Die Kiefer preßten die Stahlkandare so stark zusammen, daß die Zähne zerschmetterten. Seine Finger stemmten sich mit solcher Kraft gegen die Eichenholzlehnen, daß die Knochen zerbrachen.
Ein zweiter schneller Stromstoß traf ihn direkt ins Herz.
Ein dritter stellte sicher, daß die Sache erledigt war.
Es hatte etwas länger als eine Minute gedauert – die letzten und längsten siebenundsechzig Sekunden dieses fünfunddreißig Jahre alten Lebens. Ein Entlüfter wurde eingeschaltet, um den Gestank abzusaugen. Ein Arzt trat nach vorn, setzte ein Stethoskop an die Brust des Gefangenen und horchte.
»Er ist tot«, erklärte der Arzt.
Pater Ramirez seufzte vor Schmerz, als er die Augen öffnete, senkte dann den Kopf und bekreuzigte sich. »Möge Gott uns vergeben«, sagte er leise, »wenn Er den Unschuldigen aufnimmt.«
2 Juli 1994
3. Kapitel
Eddy Goss stand vor Gericht wegen eines Gewaltverbrechens, das so außergewöhnlich war, daß es sogar ihn selbst erstaunte. Er hatte das Mädchen zum erstenmal bemerkt, als es eines Abends in der Uniform ihres Exerzierkorps von der Schule nach Hause lief. Damals hatte er sie auf sechzehn geschätzt. Ihr Aussehen entsprach genau seinem Ideal – langes blondes Haar, das locker über die Schultern herabfiel, eine hübsche kurvenreiche Figur und, das Wichtigste von allem, kein Make-up. Er liebte dieses frische Aussehen. Es signalisierte ihm, daß er der erste sein würde.
Als er sie eingeholt hatte, mußte sie schon gewußt haben, daß irgend etwas nicht stimmte. Er war sich dessen sicher. Sie hatte begonnen, sich umzusehen und schneller zu laufen. Seiner Meinung nach mußte sie wirklich Angst gehabt haben – zuviel Angst, um zu reagieren –, denn er benötigte nur wenige Sekunden, um sie in seinen Ford Pinto zu zerren. Etwa fünf Meilen außerhalb der Stadt, in einem dichten Kiefernwäldchen weitab vom Highway, hielt er ihr ein Messer an die Kehle und drohte ihr, sie umzubringen, falls sie nicht alles täte, was er verlangte. Natürlich fügte sie sich. Was hätte sie auch sonst tun sollen? Sie zog ihren Rock hoch, streifte ihre Strumpfhose herunter – er wußte, daß alle Mitglieder des Exerzierkorps an der Senior High-School fleischfarbene Strumpfhosen tragen mußten – und saß vollkommen still da, während Eddy Goss mit den Fingern in ihre Vagina eindrang. Doch dann begann sie zu weinen – in heftigen, quälenden Schluchzern, die ihn wütend machten. Er haßte es, wenn sie weinten. Deshalb schlang er die Strumpfhose um ihren Hals – und zog. Immer wieder. Er zog so fest, bis er es schließlich schaffte: Er durchtrennte ihre Halswirbel und enthauptete sie. Bestie!
Eddy Goss stand vor Gericht wegen eines Verbrechens, das er für sein Meisterwerk hielt. Und sein Anwalt war Jack Swyteck.
»Bitte erheben Sie sich«, rief der Gerichtsdiener, als die Geschworenen von ihren Beratungen zurückkehrten. Ruhig kamen sie herein. Eine angehende Krankenschwester. Ein Busfahrer. Ein Hausmeister. Fünf Schwarze, zwei Juden. Vier Männer, acht Frauen. Sieben Arbeiter, zwei Angestellte und drei, die in keine Kategorie paßten. Es spielte keine Rolle mehr, wie Jack sie jeweils einstufte. Individuelle Meinungen waren nicht mehr wichtig; sie hatten eine kollektive Entscheidung getroffen. Sie verteilten sich auf zwei Reihen, blieben vor ihren Kunstlederstühlen stehen und richteten ihre Augen auf das »Kap der guten Hoffnung«, wie Jack jenen freien, bühnenartigen Bereich vor dem Richter und der Jury nannte, wo die Verteidiger der Angeklagten mit ihren Billigpokerargumenten auftrumpften und dann aufs Beste hofften.
Jack schluckte, während er sich bemühte, in ihren Gesichtern zu lesen. Die Erfahrung erlaubte es ihm, ruhig zu erscheinen, doch sein Adrenalin floß reichlich an diesem letzten Tag eines Prozesses, der über einen Monat lang die Schlagzeilen beherrscht hatte. Er hatte sich äußerlich in den letzten zwei Jahren kaum verändert, bis auf den gesunden Zynismus in seinem Blick und die leicht angegrauten Haare, die ihn aussehen ließen, als läge sein Juraexamen schon länger als vier Jahre zurück. Jack knöpfte das Jackett seines Nadelstreifenanzugs zu und warf dann seinem Mandanten, der steif neben ihm stand, einen kurzen Blick zu. Was für ein Prachtexemplar.
»Bitte, nehmen Sie Platz«, rief der silberhaarige Richter ins Publikum, das den Gerichtssaal bis auf den letzten Platz füllte.
Der Angeklagte Eddy Goss beobachtete aus dunklen, tiefliegenden Augen, wie die Geschworenen ihre Plätze einnahmen. Sein Blick glich dem eines Soldaten, der eine Landmine entschärft. Er hatte riesige Hände – die Hände eines Würgers, wie der Staatsanwalt nicht schnell genug bemerken konnte – und Fingernägel, die bis zur Hälfte des Nagelbetts abgekaut waren. Sein hervorstehendes Kinn und die große glänzende Stirn verliehen ihm ein bedrohliches Aussehen, das es einem leicht machte, sich vorzustellen, daß er das ihm zur Last gelegte Verbrechen begangen hatte. Heute wirkte er fast entspannt, dachte Jack, so als ob er das alles genießen würde.
Denselben Eindruck von Goss hatte Jack auch vor vier Monaten gehabt, als er sich ein Videoband ansah, auf dem sein Mandant während eines polizeilichen Verhörs mit dem gräßlichen Mord prahlte. Der Fall war eigentlich sonnenklar: Der Staatsanwalt hatte ein auf Video aufgezeichnetes Geständnis. Aber die Geschworenen bekamen es nie zu sehen. Jack hatte dafür gesorgt, daß es als Beweismittel nicht zugelassen wurde.
»Sind die Geschworenen zu einem Urteil gekommen?« fragte der Richter.
»Ja«, verkündete die Sprecherin.
Die Zuschauer rutschten nach vorn auf die Stuhlkanten. Deckenventilatoren surrten in der Stille. Das schriftliche Urteil wurde von der Jury an den Richter übergeben.
Es spielt keine Rolle, wie das Urteil lautet, versuchte sich Jack einzureden. Er hatte dem System gedient, der Justiz gedient. Als er so dastand und sah, wie der Richter das Papier an die Sprecherin zurückgab, dachte er an all die Predigten, die er während seines Studiums gehört hatte: daß jeder Bürger ein Recht auf die beste Verteidigung habe, daß die Rechte von Unschuldigen mit Füßen getreten würden, wenn es keine Anwälte gäbe, die diese Rechte bei der Verteidigung von Schuldigen einforderten. Damals hatte das alles so nobel geklungen, aber die Realität wirkte oft sehr ernüchternd. Und nun stand er hier und verteidigte jemanden, dem das, was er getan hatte, nicht einmal leid tat. Und die Geschworenen befanden ihn für …
»Nicht schuldig.«
»Nein!« schrie die Schwester des Opfers und löste damit eine Welle der Empörung im ganzen Gerichtssaal aus.
Jack schloß die Augen; es war ein schmerzlicher Sieg.
»Ruhe!« brüllte der Richter und schlug mit seinem Hammer auf den Tisch, um die in Hysterie ausgebrochene Menge zu beruhigen. Doch die Beschimpfungen, die wütenden Blicke und die Papierknäuel flogen weiter durch den Raum in Richtung von Jack Swyteck und dem Gesindel, das er verteidigte.
»Ruhe!«
»So kommst du uns nicht davon, Goss!« rief ein Freund der Familie des toten Mädchens. »Und du auch nicht, Swyteck.«
Jack sah zur Decke und versuchte alles an sich abprallen zu lassen.
»Ich hoffe, Sie können heute nacht ruhig schlafen«, fauchte ihn eine wütende Staatsanwältin beim Verlassen des Gerichtssaals an.
Jack suchte tief in seinem Inneren nach einer Antwort, aber er fand keine. Er wandte sich einfach ab und tat das, was ihm in dieser Situation als das gesellschaftlich einzig Vertretbare erschien. Er vermied es, Eddy Goss zu gratulieren und ihm die Hand zu schütteln. Statt dessen packte er seine Prozeßunterlagen zusammen und blickte nach rechts.
Goss sah ihn mit einem zufriedenen Grinsen an. »Könnte ich vielleicht Ihre Visitenkarte haben, Mr. Swyteck?« fragte Goss mit erhobenem Kopf, die Hände selbstgefällig in die Hüften gestemmt. »Nur damit ich weiß, wen ich anrufen muß – das nächstemal.«
Plötzlich hatte Jack das Gefühl, nicht nur Goss anzusehen, sondern auch all die anderen unbarmherzigen Verbrecher, die er im Lauf der Zeit verteidigt hatte. Er trat zu Goss und blickte ihm direkt ins Gesicht: »Hör zu, du Hurensohn«, flüsterte er, »es wäre besser für dich, wenn es kein nächstes Mal gäbe. Falls doch, werde ich dich nicht nur nicht verteidigen, sondern ich werde auch persönlich dafür sorgen, daß du das letzte Arschloch von Staatsanwalt bekommst. Und glaub nicht, daß der Sohn des Gouverneurs das nicht schafft. Verstanden?«
Goss hörte auf zu grinsen und kniff geringschätzig die Augen zusammen. »Niemand droht mir, Swyteck.«
»Das habe ich gerade getan.«
Goss schürzte verächtlich die Lippen. »Jetzt haben Sie es geschafft. Jetzt haben Sie meine Gefühle verletzt. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das verzeihen kann, Swyteck. Aber eins weiß ich«, sagte er, während er sich vorbeugte, »eines Tages – und dieser Tag ist nicht mehr fern – wird Jack Swyteck mich bitten, ihm zu verzeihen.« Goss richtete sich auf und blickte Jack mit seinen dunklen Augen bohrend an. »Mich bitten.«
Jack versuchte, dem Blick standzuhalten, aber diese Augen setzen ihm zu. »Sie wissen überhaupt nicht, was Verzeihen ist, Goss«, sagte er schließlich, bevor er sich abwandte und ging. Er lief durch den Mittelgang, die abgenutzte Aktenmappe in der Hand, und fühlte sich sehr allein, als er durch die aufgebrachte, angewiderte Menge auf den Ausgang, eine mit Schnitzereien verzierte Mahagonitür, zusteuerte.
»Da geht er, Ladies und Gentlemen«, rief Goss über die Köpfe der Menge hinweg und schwenkte seine Arme wie ein Zirkusdirektor. »Mein ehemaliger bester Freund, Jack Swyteck.«
Weder Jack noch die anderen schenkten ihm Beachtung. Alle Blicke waren auf den Anwalt gerichtet.
»Arschloch!« verhöhnte ihn ein Unbekannter.
»Ekel!« sagte ein anderer.
Jacks Augen fuhren herum und fingen eine Salve wütender Blicke ein. Plötzlich wußte er, was es bedeutete, jemanden zu vertreten bzw. zu repräsentieren. Er vertrat Eddy Goss, wie eine Flagge ein Land repräsentiert, wie das Böse den Satan repräsentiert. »Da ist er!« riefen Reporter, als Jack, Schulter an Schulter mit einer Traube von Zuschauern, aus dem lärmenden Gerichtssaal trat. In der Halle, vor den Aufzügen, wartete schon die nächste, eine mit Kameras und Mikrofonen bewaffnete Meute auf ihn.
»Mr. Swyteck!« brüllten die Reporter gegen den Lärm der Menge an. Im Nu war er von Mikrofonen umgeben, so daß er kaum noch vorankam. »Ihre Reaktion? … macht Ihr Mandant jetzt? … sagen Sie der Familie des Opfers?« Die Fragen überstürzten sich.
Jack war eingekeilt zwischen der Menge, die von hinten nachdrängte, und den Reportern, die ihn von vorne bestürmten. Mit einem knappen »Kein Kommentar« würde er hier nie herauskommen. Er blieb stehen, überlegte einen Augenblick und sagte dann: »Ich glaube, das einzige, was man über das heutige Urteil sagen kann, ist, daß es ein Sieg für unser Rechtssystem ist. Und dieses System erfordert vom Staatsanwalt den Beweis, daß der Angeklagte schuldig ist, schuldig ohne den geringsten …«
Plötzlich gingen Schreie durch die Halle, als mitten aus der Menge heraus ein Schwall roter Flüssigkeit emporschoß und sich auf Jack ergoß. Das Geschrei wurde noch schlimmer, als kurz darauf ein zweiter Schwall nicht nur Jack, sondern auch alle Umstehenden besudelte.
Einen Augenblick lang war er vollkommen perplex und stand wie gelähmt da. Dann wischte er sich wortlos die Flüssigkeit aus den Augen – war es Blut oder irgendeine Farbe? –, während die rote Substanz seine Hose hinunterrann und auf den Boden tropfte.
»Es klebt an dir, Swyteck«, brüllte der Urheber des symbolhaften Anschlags irgendwoher aus der Menge. »Ihr Blut klebt an dir!«
4. Kapitel
Auf der Fahrt nach Hause war Jack »oben ohne«, im weitesten Sinne des Wortes. Sein blutdurchtränktes Hemd und sein Jackett lagen im Kofferraum des Mustang-Cabrios, Baujahr 53, und das Verdeck war nach hinten gerollt, damit der Gestank verflog. Es war ein merkwürdiger Ausgang, doch die Presse hatte bereits einen Freispruch vorausgesagt, und die Aussicht auf ein Urteil, das »nicht schuldig« lautete, hatte irgend jemanden offenbar so erzürnt, daß er sich mit mehreren Beuteln einer dicken roten Flüssigkeit bewaffnet und es jenen fanatischen Tierschützern gleichgetan hatte, die auf den Straßen New Yorks Frauen in Pelzmänteln angriffen. Er fragte sich erneut, welche Art von Munition benutzt worden war. Tierblut? Menschenblut, infiziert mit AIDS? Ihn schreckte der Gedanke an das Foto und die Überschrift, die am nächsten Tag in der Boulevardpresse erscheinen würden: »Jack Swyteck – Der rote Anwalt.« Scheiße, wie schlimm soll es eigentlich noch werden?
Es war schon dunkel, als er zu Hause ankam. Er bemerkte sofort, daß der rote Pontiac nicht in der Auffahrt stand, was bedeutete, daß seine Freundin, Cindy Paige, nicht dasein würde, um sich die Ereignisse des Tages anzuhören. Seine Freundin. Er fragte sich, ob er sich da nicht selbst etwas vormachte. Zwischen ihnen war es in letzter Zeit nicht besonders gut gelaufen. Die Geschichte, die sie ihm aufgetischt hatte, nach der sie für ein paar Tage bei ihrer Freundin Gina bleiben wollte, »um ihr bei einigen Problemen zu helfen«, klang für ihn immer mehr wie ein Vorwand, um all dem Ballast zu entkommen, den er in den letzten Monaten mit sich herumgeschleppt hatte. Verdammt, wie konnte man ihr das auch verdenken. Wenn er nicht gerade bis über beide Ohren in Arbeit steckte, führte er diese Selbstgespräche, in denen er sich fragte, welche Richtung sein Leben nahm. Und meistens ließ er Cindy als Zuschauerin außen vor.
»Hallo, Junge«, sagte Jack, als ihn sein haariger bester Freund auf der Veranda bestürmte, seine bärenartigen Pfoten auf die Brust seines Herrchens pflanzte und ihn mit einem kalten Nasenkuß begrüßte. Sein Name war Donnerstag wegen des Tages, an dem Jack, Cindy und deren fünfjährige Nichte ihn aus dem Tierheim geholt und vor dem Einschläfern bewahrt hatten, und er war der dankbarste Gefangene, den er je vor dem Tod retten konnte. Er hatte eindeutig Labrador im Blut, war aber überwiegend ein Produkt des Schmelztiegels der Rassen. Seine ausdrucksvollen, schokoladenbraunen Augen machten ihn äußerst kommunikativ, und im Augenblick schrien sie: »Ich bin hungrig.«
»Sieht aus, als ob du dringend was zum Schmatzen bräuchtest«, sagte Jack und schob ihn sanft beiseite, als er ins Haus trat. Er ging in die Küche und füllte den Hundenapf mit Puppy Chow. Dann holte er die als pikante Vorspeise gedachten »Pizzaknochen« aus dem Kühlschrank. Cindy aß nie die Kruste und die Salami. Sie hob sie immer für Donnerstag auf.
Er stellte den Napf auf den Boden und beobachtete, wie der Hund sich darüber hermachte.
Zum Glück ließ sich das Blut – oder was immer es war – unter der Dusche leicht abwaschen. Als er sich abtrocknete, hörte Jack, wie Donnerstag seinen leeren Napf mit der Nase über den Küchenboden schob. Jack lächelte und zog seine Boxershorts an. Dann ging er ins Schlafzimmer und setzte sich auf den Rand des Doppelbetts. Seine Augen wanderten durch den Raum, bis sie schließlich auf einem gerahmten Foto von Cindy haften blieben, das auf dem Nachttisch stand. Es zeigte sie auf einem Felsen an einem Bergpfad in Utah, wo sie zusammen gewandert waren. Sie hatte ein breites glückliches Lächeln auf dem Gesicht, und der Sommerwind spielte in ihren honigblonden Haaren. Es war sein Lieblingsbild von ihr, weil es so viele der Merkmale einfing, die ihre Persönlichkeit ausmachten. Auf den ersten Blick wäre jeder von ihrem schönen Gesicht und ihrem herrlichen Körper beeindruckt gewesen. Aber für Jack waren es Cindys Augen und ihr Lächeln, die ihre ganze Geschichte erzählten.
Instinktiv griff er nach dem Telefon. Er runzelte die Stirn, als sich Gina Terisis Anrufbeantworter einschaltete: »Es tut mir leid, daß ich im Augenblick nicht ans Telefon gehen kann …«, kam die Nachricht vom Band.
»Cindy, ruf mich an«, sagte er. »Du fehlst mir«, fügte er hinzu und legte wieder auf. Er ließ sich aufs Bett fallen, schloß die Augen und begann sich zum erstenmal seit über vierundzwanzig Stunden zu entspannen. Doch er wurde wieder unruhig, als ihm bewußt wurde, daß Gina die Nachricht als erste bekommen und Cindy erzählen würde, wie sehr er sich nach ihr sehnte. Nun ja, tat er das etwa nicht?
Lustlos schaltete er den Fernseher ein und begann alle Programme durchzugehen, auf der Suche nach einem Sender, der nicht irgend etwas über den Freispruch von Eddy Goss brachte. Er mußte mit MTV vorliebnehmen. Zwei heruntergekommene Rockmusiker droschen auf ihre Gitarren ein, während ihnen ein Cindy-Crawford-Verschnitt die Gesichter leckte.
Er schaltete den Fernseher ab, ließ den Kopf aufs Kopfkissen sinken und lag still in der Dunkelheit. Aber er konnte nicht schlafen. Er blickte geradeaus über seine Zehenspitzen hinweg und starrte auf den Fernseher auf der Kommode. Es gab eigentlich nichts, was er sehen wollte. Doch als die häßlichen Ereignisse des Tages wieder an ihm vorüberzogen, gab es plötzlich etwas, was er sehen mußte.
Er rollte sich aus dem Bett, schnappte sich seine Aktentasche, öffnete sie und fand trotz der Dunkelheit sofort, was er suchte. Er schaltete den Fernseher und das Videogerät an, legte eine Kassette ein und setzte sich auf die Bettkante. Auf dem Bildschirm sah man Schneegestöber, ein paar Steuerzeichen und dann …
»Mein Name ist Eddy Goss«, sagte der Mann auf dem Bildschirm, der steif vor einer Videokamera der Polizei saß. Goss’ für gewöhnlich glattes, faseriges Haar bildete ein wirres, fettiges Durcheinander. Er sah aus und roch zweifellos auch, als ob er die ganze Woche unter einer Brücke geschlafen hätte: dreckige Jeans, Tennisschuhe mit offenen Schnürsenkeln und ein gelbliches Unterhemd mit eingerissenem V-Ausschnitt und Achselschweißkränzen. Er saß selbstgefällig auf dem Metallklappstuhl, die Arme fest verschränkt, und verströmte das Selbstbewußtsein eines Kleinganoven. An seinem Hals sah man vier lange frische Kratzwunden. Das Datum und die Uhrzeit, 11.04 Uhr, 12. März – viereinhalb Monate her – leuchteten in einer Ecke des Bildschirms auf.
»Ich wohne in der East Adams Street 409«, fuhr Goss fort, »Apartment 217.«
Die Kamera entfernte sich, und man sah, daß der mutmaßliche Täter am Ende eines langen Konferenztisches saß, mit einem älteren Mann zu seiner Rechten. Der Mann, grauhaarig und mit einer Hakennase, auf der eine schwarze Hornbrille saß, schien Ende Sechzig zu sein.
»Mr. Goss«, sagte der Mann, »ich bin Detective Lonzo Stafford. Der Mann hinter der Kamera ist mein Kollege Detective Jamahl Bradley. Sie wissen, mein Junge, daß Sie das Recht haben, die Aussage zu verweigern. Sie haben das Recht –«
Jack drückte auf der Fernbedienung den schnellen Vorlauf bis zu der Stelle, die er inzwischen schon mindestens hundertmal gesehen hatte. Jetzt sah man auf dem Bildschirm einen anderen Goss, lebhafter und prahlend wie ein stolzer Vater.
»… tötete ich die kleine Nutte«, sagte Goss mit unbekümmertem Achselzucken.
Jack drückte die STOP-Taste, ließ das Band zurücklaufen und hörte noch einmal zu, als ob er sich selbst geißeln wollte.
»… tötete ich die kleine Nutte.« Wie er hatten es Tausende von Menschen, wenn auch ohne den ordinären Ausdruck, gehört und würden es heute abend in den Fernsehnachrichten wahrscheinlich wieder hören. Das Band lief weiter, und Jack hörte mit geschlossenen Augen zu, wie Goss die Tat in gräßlichen Details beschrieb. Die Fahrt mit dem Auto in den Wald. Das Messer an der Kehle des jungen Mädchens. Die Tränen, die seine vulgären Versuche einer sanften Liebkosung beendet hatten. Und schließlich, wie er die Strumpfhose um den Hals des Mädchens schlang …
Jack seufzte und hielt die Augen geschlossen. Das Band lief weiter, aber es kam nur noch Schweigen. Selbst den Vernehmungsbeamten schien es die Sprache verschlagen zu haben. Wenn sie es hätten hören dürfen, wäre es den Geschworenen wahrscheinlich ähnlich ergangen. Aber er hatte das verhindert. Er hatte verhindert, daß das Videoband als Beweismittel zugelassen wurde, und zwar mit dem Argument, daß Goss’ verfassungsmäßige Rechte verletzt worden waren, daß das Geständnis nicht freiwillig zustande gekommen war. Nein, die Polizei hatte es nicht mit einem Gummiknüppel aus ihm herausgeprügelt. Sie hatte ihm nicht einmal gedroht. »Sie haben ihn hereingelegt«, war Jacks Argument gewesen, wobei er sich auf eine einzige bedenkliche Äußerung eines erfahrenen Detective stützte, der so verzweifelt versuchte, Goss festzunageln, daß er etwas zu weit ging. Dabei hatte der Detective noch gute Chancen gehabt, damit durchzukommen, denn er wußte aus Erfahrung, daß nur ein wirklich ultraliberaler Richter seine Taktik verurteilen würde.
»Wir wollen nicht wissen, ob Sie es getan haben«, hatte Detective Stafford Goss versichert. »Wir wollen nur, daß Sie uns zeigen, wo Kerrys Leiche ist, damit sie ein ordentliches christliches Begräbnis bekommt.« Das war die ganze Munition, die Jack benötigte. »Sie haben meinem Mandanten ein Geständnis entlockt, indem sie mit seinem Gewissen spielten!« hatte er dem Richter erklärt. »Sie appellierten an seine religiösen Gefühle. Eine christliche Grabrede ist eindeutig illegal, Euer Ehren.«
Niemand war überraschter als Jack, als der Richter sich seiner Argumentation anschloß. Das Geständnis wurde für unzulässig erklärt. Die Geschworenen bekamen das Videoband nie zu sehen. Sie sprachen einen Schuldigen frei. Das Versagen der Justiz war mehr denn offenkundig. Gute Arbeit, Swyteck.
Angewidert von sich selbst und von der Art, wie er sein Geld verdiente, drückte er die EJECT-Taste und schleuderte das Geständnis auf den Boden. Er holte eine andere Kassette aus dem Kasten neben dem Fernseher, schob Wer die Nachtigall stört in das Videogerät und sah zum fünfzehnten Mal, seit er am Freedom Institute angefangen hatte, wie Gregory Peck Unschuldige verteidigte.
Pecks Atticus Finch hatte gerade mit seinem Schlußplädoyer begonnen, als ein schrilles Läuten Jack aus dem Halbschlaf riß.
Er nahm den Hörer ab, in der Hoffnung, Cindys Stimme zu hören. Doch zunächst war alles, was er hörte, Schweigen. Schließlich kam eine rauhe Stimme aus der Leitung. »Swyteck?« fragte sie.
Jack rührte sich nicht. Die Stimme schien ihm vage vertraut, aber sie schien auch krächzend und verstellt. Und schließlich kam die kurze, ernüchternde Botschaft.
»Ein Mörder läuft heute nacht frei herum, Swyteck. Ein Mörder läuft frei herum.«
Jack preßte den Hörer ans Ohr. »Wer ist da?«
Wieder Schweigen.
»Wer ist da? Wer sind Sie?« Jack wartete, aber er hörte nur sein eigenes unregelmäßiges Atmen. Dann, endlich …
»Schlaf gut«, war die kühle Antwort. Das Telefon klickte, und dann kam der Wählton.
5. Kapitel
Gouverneur Harold Swyteck lief einen mit Holzspänen bestreuten Joggingpfad hinunter. Er stieß einen leisen Fluch aus, als er über die politischen Konsequenzen von Jacks Sieg am Tag zuvor nachdachte. Der Gouverneur und seine Berater hatten wochenlang darüber spekuliert, wie sich der Prozeß auf seine Chancen für eine Wiederwahl auswirken könnte. Sie glaubten, ein paar Reden, in denen er sich für eine konsequente Verbrechensbekämpfung stark machte, würden genügen, um sich von Jacks Position zu distanzieren. Was sie jedoch nie geglaubt hatten, war, daß er tatsächlich einen Freispruch erreichen würde. Hätten sie es in Betracht gezogen, hätten sie wenigstens sofort reagieren können, als die Medien in ihren stündlichen Berichten meldeten, daß der Sohn des Gouverneurs einen geständigen Mörder aufgrund eines Verfahrensfehlers freibekommen hatte.
»Zum Teufel mit allem!« schimpfte Harry mit keuchender Stimme. Und während er die Arme heftiger bewegte und seine Beine nach vorne schnellten, spürte er, wie sein Ärger wuchs. Es war der Ärger eines Vaters, getragen mehr von Enttäuschung als von echtem Groll.
Der Gouverneur mußte kämpfen, um sein Tempo zu halten. Seit der Hinrichtung von Fernandez hatte er zu joggen begonnen und dem Alkohol abgeschworen. In den etwa zwölfhundert Tagen seiner Amtszeit war er fast genauso viele Meilen gelaufen und hatte mindestens ebenso oft über jene beunruhigende Nacht nachgedacht und sich gewünscht, er hätte auf seinen Sohn gehört und die Hinrichtung für einige Tage verschoben, damit genug Zeit gewesen wäre, um Jacks Geschichte nachzugehen. Joggen bot ihm Gelegenheit, über Ereignisse und Gefühle nachzudenken, ohne jemand anderen ins Vertrauen ziehen zu müssen. Obwohl seine Berater immer wieder Sicherheitsbedenken geäußert hatten, verzichtete er auf Leibwächter, wenn er nicht gerade spätabends oder in großen Städten unterwegs war. »Wenn irgend so ein Verrückter mich erschießen will«, sagte er immer, »dann sucht er bestimmt nicht auf einem abgelegenen Pfad nach einem Typ in einem altmodischen Jogginganzug und mit Baseballmütze.« Bis zu diesem Tag hatte er recht behalten.
Harry verlangsamte sein Tempo, als er sich einer Gruppe wuchernder Eichen und Flamboyants näherte, die ihm signalisierten, daß er bald die Hälfte der Strecke zurückgelegt hatte. Er erinnerte sich an die Regeln: Die erste Streckenhälfte diente dazu, Ärger abzulassen; die zweite Hälfte war für positive Gedanken reserviert.
»Liebe Landsleute aus Florida«, sprach er leise vor sich hin, als er an einem Flamboyant mit orangefarbener Krone vorbeijoggte, der den Scheidepunkt zwischen der ersten und zweiten Streckenhälfte markierte. Er merkte, wie sich seine Stimmung änderte. Seine Sorgen fielen von ihm ab; die Rede, die er an diesem Morgen vor loyalen Anhängern halten sollte, rückte näher. Schon in wenigen Stunden würde er offiziell seinen Wahlkampf für eine zweite Amtsperiode eröffnen.